
[Wolfgang_J._Kox,_Claudia_D._Spies]_Check-up_Ans(BookFi.org)
.pdf
Schmerztherapie
550 C-1.3 · Psychologische Schmerztherapie
sich als Hauptproblem, dass die Adjektive bei den Patienten sehr unterschiedliche Assoziationen auslösen, weshalb dieses Verfahren mit einem systematischen Fehler behaftet ist und kaum noch verwendet wird.
Konventionelle Aktenführung
Bei Patienten, die im Rahmen des APS (Acute Pain Service) oder nur kurzfristig im Rahmen des CPS (Chronic Pain Service) gesehen werden, erfolgt die Dokumentation in Patientenakten unter Verwendung von speziellen Formularen.
C-1.3 Psychologische Schmerztherapie
Der in der Schmerztherapie arbeitende Anästhesist benötigt ein Wissen über Inhalte der psychologischen/ psychotherapeutischen Tätigkeit, um Schmerzpatienten auf eine psychologische Behandlung vorbereiten und deren Notwendigkeit verdeutlichen zu können. Der Indikationsstellung für eine psychologische Therapie geht die vom Psychologen durchgeführte psychosoziale Diagnostik voraus, anhand derer die individuellen Therapieziele bestimmt werden.
Die psychologischen Behandlungsverfahren lassen sich unterscheiden in psychologische Schmerztherapie
und in Psychotherapie. Zur psychologischen Schmerztherapie gehören im Wesentlichen Verfahren zur Schmerzbewältigung sowie solche verhaltenstherapeutischen Verfahren, die Verhaltensweisen verändern, welche die Schmerzen auslösen bzw. aufrechterhalten (z. B. lernen, sich abzugrenzen, Nein zu sagen).
Psychotherapie, bei der nicht die symptomorientierte psychologische Schmerztherapie im Vordergrund steht, ist indiziert, wenn chronische Schmerzen z. B. als Belastungsreaktionen im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung, als Somatisierung psychischen Leidens oder auf der Basis früherer Belastungen zu verstehen sind ( Tabelle C-1).
Beachte: Patienten mit Somatisierungstendenzen sind meist davon überzeugt, dass ihre Beschwerden ausschließlich organisch bedingt seien, auch wenn wiederholte Untersuchungen keine relevanten Organbefunde ergeben. Diese Patienten sind selten für ein herkömmliches psychotherapeutisches Verfahren zu gewinnen. In diesen Fällen ist es häufig sinnvoll, sie über den Aufbau von tragfähigen Beziehungen und das Erlernen von Schmerzbewältigungsstrategien in einem zweiten Schritt zur Aufnahme einer Psychotherapie zu bewegen.

C-2
Einzelne Schmerzsyndrome
Kopfschmerzen
M. Schenk, H. Urnauer
C-2.1 Migräne 552
C-2.2 |
Kopfschmerzen vom Spannungstyp 554 |
C-2.3 Atypischer Gesichtsschmerz 555
C-2.4 Clusterkopfschmerz 556
C-2.5 Medikamenteninduzierter Kopfschmerz 557
C-2.6 Trigeminusneuralgie 558

Schmerztherapie
552 C-2.1 · Migräne
Klassifikation
Die Klassifikation erfolgt nach den Richtlinien der International Headache Society (IHS) in 13 Gruppen.
Epidemiologie
Migräne und Kopfschmerzen vom Spannungstyp sind für 92% aller Kopfschmerzen verantwortlich
Die Lebenszeitprävalenz liegt bei 80%
Diagnostische Kriterien
Extrem wichtig ist der Ausschluss eines symptomatischen Kopfschmerzes. Die IHS-Kriterien müssen zur Erstellung einer Kopfschmerzdiagnose erfüllt sein. Hilfreich ist die Verwendung von Fragebögen, z. B. des Kieler Kopfschmerzfragebogens. Die Erstanamnese bei Kopfschmerzerkrankungen ist besonders zeitaufwendig und muss u. U. in mehreren Sitzungen durchgeführt werden.
Verlaufsbeobachtung
Sie erfolgt mit Kopfschmerztagebüchern, z. B. dem Kieler Kopfschmerzkalender. Er dient zur Verlaufsund Erfolgskontrolle der Kopfschmerzerkrankung.
Zusätzlich neurologische Symptome, die sich über 5–20 min entwickeln und < 1 h andauern
Sie sind eindeutig dem Hirnstamm oder dem zerebralen Kortex zuzuordnen
Typische Aura
Homonyme Sehstörungen
Dysphasie
Halbseitensymptomatik, z. B. Sensibilitätsstörungen oder Hemiplegie
Dauer < 1 h
Prolongierte Aura
Dauer >1 h und < 1 Woche
Familiäre hemiplegische Migräne
Ein Verwandter 1. Grades hat identische Attacken
Basilarismigräne
Aurasymptome mit Zuordnung zum Hirnstamm oder den Okzipitalislappen
Status migraenosus
Dauer unter Behandlung länger als 72 h
C-2.1 Migräne
Klassifikation
IHS 1.1–1.7.
Diagnostische Kriterien
Migräne ohne Aura
Kopfschmerzattacken, wenigstens 5, mit einer Dauer von 4–72 h (unbehandelt)
Lokalisation einseitig
Qualität pulsierend
Schmerzintensität mäßig bis stark
Übliche Tagesaktivität erschwert oder unmöglich
Verstärkung beim Treppensteigen oder üblicher körperlicher Arbeit
Begleiterscheinungen Übelkeit und/oder Erbrechen und/oder Photophobie und Phonophobie
Migräne mit Aura
Wie bei der Migräne ohne Aura
Epidemiologie
Vorkommen bei ca. 12% der Erwachsenen in Deutschland
Verhältnis Frauen zu Männer = 2 : 1
Mittlere Attackenfrequenz 3 Tage/Monat
Etwa 270 Krankheitstage pro 1000 Beschäftigte pro Jahr
Ätiologie
Unbekannt
Annahme einer neuronalen mitochondrialen Energiereserve-Problematik, die mit einer Reizüberempfindlichkeitsstörung gekoppelt ist
Einfluss genetischer Faktoren
Pathophysiologie
Interaktionen des trigeminalen Systems und anderer Systeme mit intraund extrakraniellen Gefäßen und deren unmittelbarer Umgebung
Kortikale Spreading-Depression durch Überangebot von exzitatorischen Neurotransmittern

C-2 · Kopfschmerzen
Vor und während der Aura Reduktion der zerebralen Perfusion mit nachfolgender Hyperämie
Auslösung teilweise durch Triggermechanismen
Differenzialdiagnosen
Symptomatischer (sekundärer) Kopfschmerz
Zerebrale Ischämien
Andere primäre Kopfschmerzformen
Medikamentöse Therapie
Leichte Migräneattacke
Übelkeit, Magen-Darm-Atonie
Metoclopramid (1. Wahl)
Dosierung: 20 mg Tropfen, Tablette oder Suppositorium
Domperidon (2. Wahl) Dosierung: 20 mg Tropfen
Analgesie
Acetylsalicylsäure (1. Wahl)
Dosierung: 1000 mg p.o. als Brausetablette
Ibuprofen (2. Wahl)
Dosierung: 400–800 mg p.o. oder Supp.
Paracetamol (2. Wahl)
Dosierung: 1000 mg p.o. oder Supp.
Schwere Migräneattacke
Leichte Übelkeit ohne Erbrechen
Naratriptan Dosierung: 2,5 mg p.o.
Rizatriptan Dosierung: 10 mg p.o.
Sumatriptan
Dosierung: 50–100 mg p.o.
Zolmitriptan
Dosierung: 2,5–5 mg p.o.
Starke Übelkeit mit Erbrechen
Rizatriptan Dosierung: 10 mg s.l.
Sumatriptan
Dosierung: 6 mg s.c., 10–20 mg nasal, 25 mg rektal
Zolmitriptan Dosierung: 2,5–5 mg s.l.
553 C-2.1
Medikamentöse Therapie
bei Notfallkonsultation (Status migraenosus)
MCP
Dosierung: 10 mg i.v.
Lysinacetylsalicylat
Dosierung: 1000 mg i.v. zusammen mit MCP über 3–5 min
Alternativ: Sumatriptan
Dosierung 6 mg s.c. oder 1–2 mg Dihydroergotamin s.c.
Dexamethason Dosierung: 24 mg
Furosemid Dosierung: 10 mg i.v.
Medikamentöse Prophylaxe
Bei Migräneattacken mit hoher Auftretenshäufigkeitsrate und Schwere und starker Reduktion von Lebensqualität und beruflicher Leistungsfähigkeit. Die Wirkungsmechanismen für diese Indikation sind nicht bekannt.
Propanolol (1. Wahl)
Dosierung: TD 200 mg p.o./Tag (Weber 1972)
Metoprolol (1. Wahl)
Dosierung: TD 200 mg p.o./Tag (Andersson 1983)
Flunarizin (2. Wahl)
Dosierung: 5–10 mg p.o./Tag (Drillisch 1980)
Interventionelle Schmerztherapie
Keine Indikation
Psychologische Therapieverfahren und Prophylaxe
Intervallprophylaxe
Stressund Reizverarbeitungstraining
–Entspannungsverfahren:
Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, Hypnose, autogenes Training
–Kognitiv-verhaltensorientierte Verfahren: Wirksamkeit ist gut belegt (Gerber 1986)
Anfallsbehandlung
Biofeedback: Vasokonstriktionstraining (Wirksamkeit insbesondere in Verbindung mit kognitivverhaltensorientierten Verfahren), Hauttemperaturtraining

Schmerztherapie
554 C-2.2 · Kopfschmerzen vom Spannungstyp
Gegenirritationsverfahren
Akupunktur
Physikalische Verfahren
Massagen
Wärmetherapie
Pfefferminzöl in äthanolischer Lösung
Physiotherapie
C-2.2 Kopfschmerzen vom Spannungstyp
Klassifikation
ISH-Code 2
Episodischer Kopfschmerz vom Spannungstyp – ISH-Code 2.1: An weniger als 15 Tagen im Monat, an weniger als 180 Tagen im Jahr, Dauer Minuten bis Tage
Chronischer Kopfschmerz vom Spannungstyp – ISH-Code 2.2: An wenigstens 15 Tagen im Monat an wenigstens 6 Monaten, an mehr als 180 Tagen im Jahr
Diagnostische Kriterien
Qualität drückend, dumpf, ziehend, nicht pulsierend
Lokalisation bilateral, Nacken–Hinterkopf oder Stirn-/Schläfenregion oder auch holenzephal
Intensität leicht bis mittel
Druckdolenz perikranialer Muskeln
Vegetative Begleiterscheinungen gering oder fehlend
Keine Steigerung bei körperlicher Aktivität
Epidemiologie
Häufigste Kopfschmerzform
Bevölkerung zu 40–90% betroffen, 3% der Bevölkerung hat chronischen Kopfschmerz vom Spannungstyp
Etwa 920 Krankheitstage pro 1000 Beschäftigte pro Jahr
Ätiologie
Muskulärer Stress, oromandibuläre Funktionsstörung
Angst/Depression (in ca. 70% vorhanden)
Kopfschmerz als Vorstellung, psychosozialer Stress
Medikamentenabusus (besonders Kombinationspräparate)
Pathophysiologie
Modell der Erkrankung der perikranialen Muskeln und Sehnen (mit klinischer Druckdolenz); initial muskuläre Hypoxien und folgende Mikroläsionen (ausgelöst durch unphysiologische muskuläre Beanspruchung)
In Folge von Dauerschmerz Beginn zentraler Chronifizierungsmechanismen mit Versagen zentraler Inhibitionsmechanismen
Differenzialdiagnosen
Symptomatischer (sekundärer) Kopfschmerz
Andere primäre Kopfschmerzformen
Medikamentöse Therapie
Episodischer Kopfschmerz vom Spannungstyp
Ibuprofen
Dosierung: 200–400 mg p.o.
Paracetamol
Dosierung: 500–1000 mg p.o.
Acetylsalicylsäure Dosierung: 500–1000 mg p.o.
Analgetikaeinnahme an nicht mehr als 10 Tagen pro Monat!
Chronischer Kopfschmerz vom Spannungstyp
Keine Analgetika!
Amitriptylin (1. Wahl)
Dosierung: 25–150 mg p.o./Tag (Lance 1964)
Doxepin (2. Wahl)
Dosierung: 25–150 mg p.o./Tag
Interventionelle Schmerztherapie
Blockaden der Nn. occipitales majores, minores, supraorbitales
Psychologische Therapieverfahren und Prophylaxe
Progressive Muskelrelaxation und EMG-Biofeedback (Metaanalyse nach Andrasik u. Blanchard 1987; Wirksamkeit belegt)
Kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren (Holyroyd u. Andrasik 1982)

C-2 · Kopfschmerzen
Gegenirritationsverfahren
Akupunktur
TENS
Physikalische Verfahren
Behandlung einer oromandibulären Dysfunktion
Massagen
Pfefferminzöl in äthanolischer Lösung
Physiotherapie
Wärmetherapie
Nichtmedikamentöse Therapiemaßnahmen stehen beim Kopfschmerz vom Spannungstyp im Vordergrund.
C-2.3 Atypischer Gesichtsschmerz
Klassifikation
IHS-Code 13, Ausschlussdiagnose
Diagnostische Kriterien
Dauerschmerz, zusätzliche Attacken möglich
Qualität meist brennend, manchmal ziehend
Lokalisation oft nur ungenau möglich, meist einseitig, keinem definierten Nerv zuzuordnen, nicht durch eine kausale Erkrankung zu begründen
Häufige Assoziation mit psychischen Störungen
Ätiologie
Nicht geklärt
Ausschlussdiagnose
Psychologische Faktoren werden als mitverursachend angenommen
Epidemiologie
Alter meist über 30 Jahre
Verhältnis Frauen zu Männer = 8 : 2
Pathophysiologie
Nicht geklärt
Möglicherweise eine Form des Kopfschmerzes vom Spannungstyp mit Lokalisation im Gesichtsbereich
555 C-2.3
Differenzialdiagnosen
Symptomatischer (sekundärer) Kopfschmerz
Andere primäre Kopfschmerzformen
Ausschlussdiagnose
Medikamentöse Therapie
Amitriptylin (1. Wahl)
Dosierung: 25–75 mg p.o./Tag (Sharav 1987)
Doxepin (2. Wahl)
Dosierung: 10–75 mg p.o./Tag (Thomalske 1991)
Carbamazepin
Dosierung: 200–1200 mg p.o./Tag
Tizanidin
Dosierung: 3-mal 2–8 mg p.o./Tag
Interventionelle Schmerztherapie
GLOA
Stellatumblockaden
Psychologische Therapieverfahren und Prophylaxe
EMG-Biofeedback
Autosuggestive Verfahren
Psychotherapie
Gegenirritationsverfahren
Akupunktur
(TENS)
Neurodestruktive Eingriffe
Kontraindiziert
Im Gesicht ist eine besonders hohe Innervationsdichte vorhanden, Gesichtsschmerzen haben eine starke emotionale Komponente, somit ein besonders hohes Chronifizierungsrisiko. Invasive Therapieverfahren können die Schmerzen verschlimmern. Psychische Auffälligkeiten liegen häufig vor (erhöhtes Ausmaß an Depression, Hypochondrie, abnorme Persönlichkeitsentwicklung). Psychotherapie ist indiziert. Patienten verneinen häufig psychische Aspekte. Ziel: Verhinderung unnötiger kieferchirurgischer Eingriffe.

Schmerztherapie
556 C-2.4 · Clusterkopfschmerz
C-2.4 Clusterkopfschmerz
Klassifikation
IHS-Code 3
IHS-Code 3.1.2 Episodischer Clusterkopfschmerz: Clusterperioden über 1 Woche bis höchstens
1 Jahr mit schmerzfreien Remissionsphasen von
6 Monaten bis 2 Jahren Dauer
IHS-Code 3.1.3 Chronischer Clusterkopfschmerz: Clusterperioden über 1 Jahr, ohne schmerzfreie Remissionsphase von mindestens 14 Tagen
Diagnostische Kriterien
Kopfschmerzattacken, wenigstens 5/Monat
Häufigkeit jeden 2. Tag bis 8 pro Tag
Dauer 15–180 min unbehandelt
Qualität bohrend, brennend, vernichtend
Intensität stark bis unerträglich
Lokalisation einseitig orbital, supraorbital und/oder temporal
Neurologische Begleitstörung im Sinne einer Sympathikusregulationsstörung (Lidödem, partielles Horner-Syndrom, Lakrimation, konjunktivale Injektion, Rhinorrhö), Bewegungsdrang, Trigger
Alkohol, Vasodilatatoren, z. B. Nitroglycerin (zum Testen) oder Ca2+-Antagonisten
Epidemiologie
Prävalenz 0,9%, 10/100 000/Jahr
Männer 15/100 000/Jahr, Frauen 4/100 000/Jahr, Verhältnis Frauen zu Männer = 1 : 9
Das mittlere Alter beim erstmaligen Auftreten ist das 30. Lebensjahr
Ätiologie
Unklar
Pathophysiologie
Möglicherweise Entzündung (aseptisch) im Bereich des Sinus cavernosus und der V. ophthalmica superior mit mechanischer und inflammatorischer Alteration angrenzender Strukturen wie z. B. des N. ophthalmicus, sympathischer Fasern etc.
Differenzialdiagnosen
Chronische paroxysmale Hemikranie
Symptomatischer (sekundärer) Kopfschmerz
Trigeminusneuralgie
SUNCT-Syndrom (»shortlasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection, tearing sweating and rhinorrhoea«)
Medikamentöse Therapie
Medikamentöse Therapie im Anfall
Sumatriptan
Dosierung: 6 mg s.c. mit Autoinjektor, Erfolgsrate 74% (Kudrow 1980)
Nichtmedikamentöse Therapie im Anfall
Sauerstoff
Inhalation von reinem (100%igem Sauerstoff), 6–8 l über 15 min (Kudrow 1980)
Medikamentöse Therapie zur Prophylaxe des episodischen Clusterkopfschmerzes
Verapamil (1. Wahl)
Dosierung: 2-mal 240–360 mg p.o./Tag (Bussone 1990; Gabai 1989) oder
Ergotamintartrat (1. Wahl)
Dosierung: 2-mal 2–4 mg p.o. oder als Supp./Tag
Prednisolon (2. Wahl)
Dosierung: 2-mal 50 mg p.o./Tag, dann ausschleichend, nur Kurzzeitprophylaxe oder
Lithium (2. Wahl)
Dosierung: 1- bis 2-mal 400 mg p.o./Tag (Bussone 1990) oder
Methysergid (2. Wahl)
Dosierung: 2-mal 1/4–1/2 Retardtablette à 3 mg p.o./Tag, maximal 3–4 Monate
Medikamentöse Prophylaxe des chronischen Clusterkopfschmerzes
Verapamil (1. Wahl)
Dosierung: 2-mal 240–360 mg p.o./Tag
Lithium (1. Wahl)
Dosierung: 1- bis 2-mal 400 mg/p.o./Tag
Prednisolon (2. Wahl) Dosierung: 2-mal 50 mg p.o./Tag, dann ausschleichend
Interventionelle Schmerztherapie
Blockaden des N. maxillaris und des Ganglion pterygopalatinum (Devogel 1981)
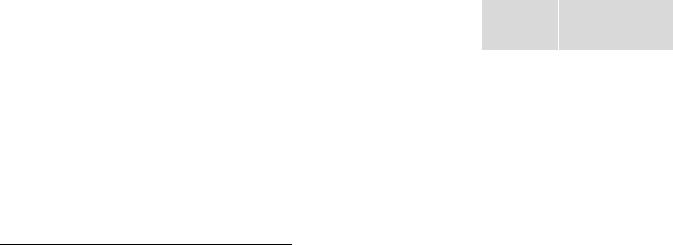
C-2 · Kopfschmerzen
Psychologische Therapieverfahren
Nicht primär indiziert
Medikamentöse Therapiemaßnahmen stehen im Vordergrund, psychische Einflüsse auf das Geschehen gelten als minimal.
C-2.5 Medikamenteninduzierter
Kopfschmerz
Klassifikation
IHS-Code 8.2–8.4.
Diagnostische Kriterien
Kopfschmerz an mindestens 15 Tagen im Monat
Meist als täglicher Dauerkopfschmerz
Qualität dumpf drückend, manchmal pulsierend
Begleiterscheinungen: Übelkeit, Erbrechen, Photound Phonophobie, Müdigkeit, Schlafstörungen
Tägliche Medikamenteneinnahme seit mehr als 3 Monaten und Abklingen des Kopfschmerzes innerhalb eines Monates nach Absetzen der Medikamente
Nach Analgetikakarenz tritt zunächst immer ein sehr starker Entzugskopfschmerz auf
Epidemiologie
Nicht eindeutig belegt; ca. 1% der deutschen Bevölkerung nimmt täglich Analgetika zu sich
8 der 20 meistverkauften Medikamente sind Analgetika
Verhältnis Frauen zu Männer = 4 : 1
Ätiologie
Analgetikainduzierter Kopfschmerz:
Monatliche Einnahme von mindestens 50 g ASS oder eines anderen Analgetikums in gleicher Menge (Paracetamol, Ibuprofen) oder mindestens 100 Tabletten eines Kombinationspräparates mit Barbituraten oder anderen Nichtopioidanalgetika oder mehreren Opioidanalgetika
Ergotamininduzierter Kopfschmerz:
Tägliche Einnahme von Ergotalkaloiden, 2 mg oral/ 1 mg rektal mit holenzephalem pulsierendem, aber ansonsten nicht migränetypischem Kopfschmerz.
Kombinationspräparate, speziell mit Koffein, haben ein besonders hohes algogenes Potenzial
557 C-2.5
Pathophysiologie
Durch sehr häufige Einnahme von Analgetika in sehr hoher Dosis in Kombination mit psychotrop wirkenden Substanzen (z. B. Koffein) kommt es zu einer Reduktion (Downregulation) der Rezeptorsensitivität
Zusätzlich Veränderungen der Schmerzwahrnehmung durch Fehlsteuerung der antinozizeptiven Systeme mit Hyperalgesie. Hierdurch induziert kontinuierliche Steigerung der Medikamentendosis
Differenzialdiagnosen
Symptomatischer (sekundärer) Kopfschmerz
Andere primäre Kopfschmerzformen
Entzugstherapie
Den Patienten muss vermittelt werden, dass ihre Kopfschmerzen durch Analgetika induziert wurden
Ein Schmerzmittelentzug muss stationär in einer spezialisierten Schmerzklinik über mindestens 14 Tage erfolgen. Der Versuch eines ambulanten Entzuges bleibt meist erfolglos
40% der Patienten werden innerhalb eines Jahres wieder rückfällig (Diener et al. 1989)
Nach erfolgreichem Entzug ist das primäre Kopfschmerzleiden entsprechend den oben genannten Richtlinien zu behandeln
Medikamentöse Therapie
Zur Dämpfung vegetativer Entzugssymptome können adjuvant Antidepressiva oder auch niedrigpotente Neuroleptika eingesetzt werden
Amitriptylin
Dosierung: 25–75 mg p.o./Tag
Interventionelle Schmerztherapie
Keine Indikation
Psychologische Therapieverfahren
Rückfallprophylaxe durch Edukation, Entspannungsübungen, Erarbeitung von Bewältigungsressourcen

Schmerztherapie
558 C-2.6 · Trigeminusneuralgie
C-2.6 Trigeminusneuralgie
Klassifikation
ISH-Code 12.2.
Diagnostische Kriterien
Paroxysmale Schmerzattacken, Dauer wenige Sekunden bis 2 min
Qualität stromstoßartig, stechend, brennend, oberflächlich
Lokalisation streng einseitig im Versorgungsbereich eines oder mehrerer Äste des N. trigeminus
In der Regel durch Trigger (nichtnoxischer sensorischer Input) ausgelöst
Kein neurologisches Defizit
Schmerzintensität sehr hoch
Epidemiologie
Erkrankung der 2. Lebenshälfte, meist 40.–60. Lebensjahr
Verhältnis Frauen zu Männer = 2 : 1
Ätiologie
Nervenkompression und -läsion (durch Angiome, Arterien, Venen, Cholesteatome etc.)
Differenzialdiagnosen
Symptomatischer (sekundärer) Kopfschmerz
Andere primäre Kopfschmerzformen
Pathophysiologie
Nicht eindeutig geklärt
Durch Kompression segmentale Demyelinisation im Bereich der Trigeminuswurzel und ephaptische Erregungsübertragung von myelinisierten taktilen Fasern auf Ad- oder C-Fasern. Hierdurch ebenfalls Wegfall der hemmenden Wirkung von Neuronen mit konsekutiver übermäßiger Erregung von »Wide-dynamic-range (WDR-)Neuronen«
Medikamentöse Therapie
Carbamazepin (1. Wahl)
Dosierung: 200 mg, maximal 1600 mg p.o./Tag; Erfolgsrate über 80% bei erstbehandelten Patienten; Länge der Therapiedauer korreliert mit
der erforderlichen Dosis
Baclofen (2. Wahl)
Dosierung: 3-mal 5–20 mg p.o./Tag; Erfolgsrate über 70% bei erstbehandelten Patienten
Phenytoin (2. Wahl)
Dosierung: 1- bis 3-mal 100–200 mg p.o./Tag; Erfolgsrate über 60% bei erstbehandelten Patienten
Carbamazepin und Baclofen und Phenytoin (3. Wahl)
Dosierung: s. oben
Interventionelle Schmerztherapie
V1, V2: GLOA
Blockade der peripheren Trigeminusäste mit LA, später u. U. Neurolysen:
–V1: N. supraorbitalis, N. supratrochlearis
–V2: N. maxillaris (inkl. Ganglion pterygopalatinum), N. infraorbitalis
–V3: N. mandibularis (inkl. Ganglion oticum), N. mentalis
Psychologische Therapieverfahren und Prophylaxe
Folgeerscheinungen sind starke Depressionen mit starken Rückzugstendenzen: Psychotherapie zur Depressionsbehandlung
Schmerzimmunisierungsverfahren greifen aufgrund der geringen Schmerzdauer von wenigen Minuten nicht
Stützende, beratende Gespräche
Invasive Therapie
Chirurgische Therapieverfahren, z. B. mikrovaskuläre Dekompression nach Janetta, Radiofrequenzgangliolyse
Wegen der Irreversibilität der Läsionen ist jede medikamentöse Therapie eine Langzeittherapie. Leider kommt es oft nach initial sehr erfolgreicher medikamentöser Behandlung zu einem Wirkungsverlust.

559 C-2.6
C-2 · Kopfschmerzen
Literatur
Andersson PG (1983) Cephalgia 3: 207–212
Andrasik F, Blanchard EB (1987) Biofeedback-studies in clinical efficacy, pp 1–79
Bussone G (1990) Headache 30: 411–417 Devogel JC (1981) Acta Anest Belg 32: 101–107
Diener HC et al. (1989) J Neurol Neurosurg Psychiat 236: 9–14 Drillisch C (1980) Med Welt 31: 1870–1872
Gabai IJ (1989) Headache 29: 167–168
Gerber WD (1986) Verhaltensmedizin der Migräne, Edition Medizin. VCH, Weinheim
Holyroyd KA, Andrasik F (1982) Cogn Ther Res 6: 325–333 Kudrow L (1980) Oxford University Press
Lance JW (1964) Lancet 2: 1236–1239 Sharav Y (1987) Pain 31: 199–201
Thomalske G (1991) Schmerz und Depression. Dtsch Ärzte-Verlag, S 61–67
Weber R (1972) Neurology 22: 366–369
