
[Wolfgang_J._Kox,_Claudia_D._Spies]_Check-up_Ans(BookFi.org)
.pdf
219 A-9.12
A-9 · Standards für HNO-Eingriffe
Raum für Notizen

Anästhesie
220 A-9.13 · Tracheotomie
A-9.13 Tracheotomie
Checkliste
ITN: oral |
PVK: 18 G |
W-MATTE |
evtl. LA
Operationsdauer: 15–30 min
Prämedikation: nach Standard; Hinweise auf Intubationsschwierigkeiten (Anatomie, Voroperationen, HNO-Spiegelbefunde, Sprach-/Schluckstörungen, Mundöffnungsmöglichkeiten, liegende PEG/PEJ); aktuelle respiratorische Funktion (Stridor, Zyanose, Hypoxie)
Eine Nottracheotomie muss so schnell wie möglich erfolgen, ggf. nur kurze orientierende Untersuchung
immer zuständigen OA rufen
Vorbereitung im OP
|
Material |
|
|
|
Medikamente |
|
||
|
|
|
|
|||||
|
Periphervenöser Zugang (18 G) |
|
|
|
NaCl 0,9% 10 ml |
|||
|
|
Endotrachealtubus (Magill) 7,5(–8,5) mm |
|
|
|
Atropin 0,5 mg/ml |
||
|
|
Innendurchmesser; andere Größen bereithalten |
|
|
|
Fentanyl 0,5 mg/10 ml |
||
|
Zubehör für schwierige Intubation bereithalten |
|
|
|
Propofol 200 mg/20 ml |
|||
|
|
Trachealkanülen unterschiedler Größen |
|
|
|
Propofolperfusor 1% |
||
|
|
bereithalten |
|
|
|
Cis-Atracurium 20 mg/20 ml |
||
|
Manujet, Flexülen 14 G und Konnektionsstücke |
|
|
|
Vollelektrolytlösung |
|||
|
|
für den Notfall |
|
|
|
|
|
|
|
Notfallwagen für schwierige Intubation |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

221 A-9.13
A-9 · Standards für HNO-Eingriffe
Monitoring
Standardmonitoring
Narkoseeinleitung
Eine Nottracheotomie erfolgt grundsätzlich in Lokalanästhesie durch den Operateur.
Sauerstoffzufuhr
Anschluss des Monitorings
Periphervenöser Zugang (bevorzugt linker Arm)
Infusionsbeginn
Einleitung bei elektiver Tracheotomie
Fentanyl 3–5 g/kgKG
Propofol 2–3 mg/kgKG (alternativ: Thiopental 3–5 mg/kgKG)
Cis-Atracurium 0,1 mg/kgKG (alternativ Mivacurium)
Intubation und Auskultation
Tubus muss nach Lagerung des Kopfes unter den Tüchern noch zugänglich sein
Augenschutz
Lagerung
Rückenlage
Oberkörper leicht erhöht
Kopf leicht überstreckt
Narkoseführung
Beatmung
N2O-O2-Gemisch
Bei schlechter Oxygenierung und Beatmungsproblemen FIO2 1,0; sonst FIO2: 0,5
Manuelle Beatmung: Oft treten Beatmungsprobleme durch Tubusdislokation durch Operateur oder intraoperative Cuffschädigung auf, sie werden so früher erkannt!
Narkose
Aufrechterhaltung der Narkose mit Propofol (6–10 mg/kgKG/h)
Vor Eröffnung der Trachea Umstellung auf FIO2 1,0 und manuelle Beatmung
Nach Tracheaeröffnung oft deutliche Leckage (Tubus tiefer schieben) oder Cuff beschädigt: Bei Sättigungsabfällen muss der Operateur vorübergehend bis zur Erholung der Sättigung das Leck zur Optimierung der Beatmungssituation mit der Hand abdichten
Bei Cuffverletzungen und großen Beatmungsproblemen evtl. Umintubation erwägen
Zum frühestmöglichen Zeitpunkt Entfernung des alten oralen Tubus und Ersatz durch einen Woodbridge-Tubus über das Operationsgebiet (Tubus und Blockungsspritze steril anreichen; Tubus wird dann unter dem Tuch mit dem Beatmungssystem konnektiert; Lagekontrolle; Operateur näht Tubus in der Regel vorübergehend bis zum Ende der Operation an)
Am Operationsende Ersatz des Tubus durch eine Trachealkanüle ausreichender Größe (Größe dokumentieren)
Wegen operationstechnisch bedingter Pneumothoraxgefahr: Auskultationsund Perkussionsbefund am Operationsende erheben; routinemäßige Thoraxröntgenkontrolle 6 h postoperativ (bei Problemen sofort)
Bei suffizienter Spontanatmung Verlegung in den Aufwachraum
Nottracheotomie
Initial extreme Gefährdung durch Hypoxie bis hin zum hypoxisch bedingten Herz-Kreislauf-Still- stand
Schnelle Sauerstoffzufuhr, in welcher Form auch immer: Operateur: Notkoniotomie und
Manujet, alternativ:
Flexüle G 14 + Konnektionsstück
+ Ambubeutel mit O2
Aufgrund der initial meist erheblichen Dyspnoe der Patienten am Operationsbeginn meist nur suboptimale Lagerungsbedingungen für den Operateur – Optimierung nach Sicherung der Atemwege intraoperativ notwendig
Sofortige Besserung des Allgemeinzustands häufig unmittelbar nach Eröffnung der Trachea
Postoperatives Management
Standardmonitoring im Aufwachraum
Gabe von Sauerstoff über Trachealkanülenadapter
Postoperative Umstellung bei der Atmung fällt Patienten oft schwer, erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich der respiratorischen Funktionen
Initial häufiges Absaugen erforderlich
Bei erheblichem postoperativem Hustenreiz Lokalanästhesie mit Lidocain-Spray, ggf. zusätzlich 7,5–15 mg Hydrocodon (Dicodid) s.c.
Auskultatorische Kontrollen (Anhalt für Pneumothorax)
Routinemäßige Thoraxröntgenkontrolle 6 h postoperativ, bei Pneumothoraxverdacht sofort (falls notwendig, Anlage einer Thoraxdrainage)
Literatur
Janssens M, Hartstein G (2001) Management of difficult intubation. Eur J Anaesthesiol 18 (1): 3–12

A-10
Anästhesie
in der Augenheilkunde
I. Dornberger, M. Kastrup
A-10.1 |
Allgemeine Vorbemerkungen |
224 |
|
A-10.2 |
Glaukom (grüner Star) 228 |
|
|
A-10.3 |
Kataraktoperation (grauer Star) |
230 |
|
A-10.4 |
Keratoplastik (Hornhauttransplantation) 232 |
|
|
A-10.5 |
Eingriffe bei Kindern in der Augenheilkunde |
234 |
|
A-10.6 |
Netzhautablösung (Amotio/Ablatio retinae) |
236 |
|
A-10.7 |
Versorgung von perforierenden |
|
|
|
Augenverletzungen 238 |
|
|
A-10.8 |
Pars-Plana-Vitrektomie (PPV) 240 |
|
|
A-10.9 |
Schieloperation (operative Strabismuskorrektur) 242 |
||

Anästhesie
224 A-10.1 · Allgemeine Vorbemerkungen
A-10.1 Allgemeine Vorbemerkungen
Besonderheiten der Patienten
Patienten in der Ophthalmologie gehören extremen Altersgruppen an. Neonaten mit einem Geburtsgewicht zwischen 500 und 1000 g leiden häufig an einer Retinopathia praematurorum, die behandlungsund überwachungsbedürftig ist. Nicht nur aufgrund des Alters, sondern auch wegen der Grunderkrankungen, z. B. Diabetes mellitus mit entprechenden Augenerkrankungen, besteht für die Patienten ein erhöhtes perioperatives Risiko. Es handelt sich häufig um Patienten der Klassen ASA III und IV. Dies muss bei der Prämedikation und bei der Auswahl des Betäubungsverfahrens eine besondere Berücksichtigung finden.
Die Eingriffe am Auge lassen sich grob in extraokuläre und intraokuläre Eingriffe einteilen. Bei den intraokulären Eingriffen steht die Kontrolle des Augeninnendrucks und die Akinesie im Vordergrund. Bei allen okulären Eingriffen steht die Vermeidung bzw. die Therapie des okulokardialen Reflexes im Vordergrund.
Besonderheiten
des Anästhesiearbeitsplatzes
Anästhesist und Operateur haben ein gemeinsames Arbeitsfeld (Kopf des Patienten); Kommunikation und die gegenseitige Rücksichtnahme zwischen den Fachgebieten ist besonders wichtig
Die Atemwege müssen besonders gut gesichert sein, da ein späteres Intervenieren eine Operationsunterbrechung zu Folge hätte
Der Patient muss sich in einer ausreichenden Narkosetiefe befinden, da Husten oder Pressen des Patienten (oder Sterilitätseinbußen)
den Operationserfolg in Frage stellen würden
Da häufig mit einem Operationsmikroskop operiert wird, darf es zu keiner Berührung des Operationstisches kommen: Bewegungen werden unter dem Mikroskop so verstärkt, dass der Operateur keine Sicht mehr hat
Stand-by und Sedierung bei Regionalanästhesie
Die Regionalanästhesie, welche in der Regel vom Ophthalmologen selbst durchgeführt wird, eignet sich für Operationen am vorderen Augenabschnitt mit einer Operationsdauer unter 2 h. Bei Kataraktoperationen ist in mehr als 30% aller Fälle ein Anästhesist beteiligt (Rosenfeld et al. 1999). Deswegen sollten die Eingriffe in »stand-by« genauso vorbereitet sein wie in Vollnarkose (qualifiziertes Anästhesiepersonal, präoperative Visite, Nüchternheit, Monitoring, O2-Sonde).
Während der Operation in LA kann der Patient eine Sedierung erhalten. Er muss allerdings noch in der Lage sein, Aufforderungen Folge zu leisten (»conscious sedation«). So ist außerdem ein frühzeitiges Erkennen von Komplikationen, z. B. durch die Lokalanästhesie möglich. Niedrigdosiertes Propofol 0,3–0,5 mg/kgKG als Bolus ist dem Midazolam vorzuziehen. Fentanylgaben vor Anlage der Retrobulbäranästhesie erwiesen sich als günstig. Eine Oxygenation und Verringerung der CO2- Rückatmung wird durch O2-Zufuhr über eine O2-Na- sensonde unter den Abdecktüchern gewährleistet.
Intraokulärer Druck (IOD)
Abhängig von den Faktoren: Kammerwasser, choriodales Blutvolumen und extraokulärer Muskeltonus (Funktion von Produktion und Abfluss des Kammerwassers) intraokularer Gefäßtonus (CO2-Partialdruck und dienzephale Steuerung)
Normalwert: 10–20 mmHg
Erhöhter IOD beeinflusst die Durchblutung des Auges und den Metabolismus von Cornea und Linse negativ; bei zu niedrigem IOD droht dem Auge die Bildung von Ödemen und eine abnehmende Sehleistung
Der IOD ist weitgehend von Blutdruckschwankungen unabhängig (Autoregulation); bei plötzlichen exzessiven Blutdrucksteigerungen kann es allerdings zu deutlichen IOD-Erhöhungen kommen
Die Gabe von Atropin i.m. oder i.v. stellt bei gleichzeitiger Gabe von lokal geträufelten Mydriatika keine Kontraindikation dar
Allgemein gilt es, zur Reduktion des IOD den Oberkörper der Patienten leicht erhöht zu lagern
Der IOD wird erhöht durch ( Tabelle)
–Intubation, Laryngoskopie
–Hypoventilation mit Hyperkapnie
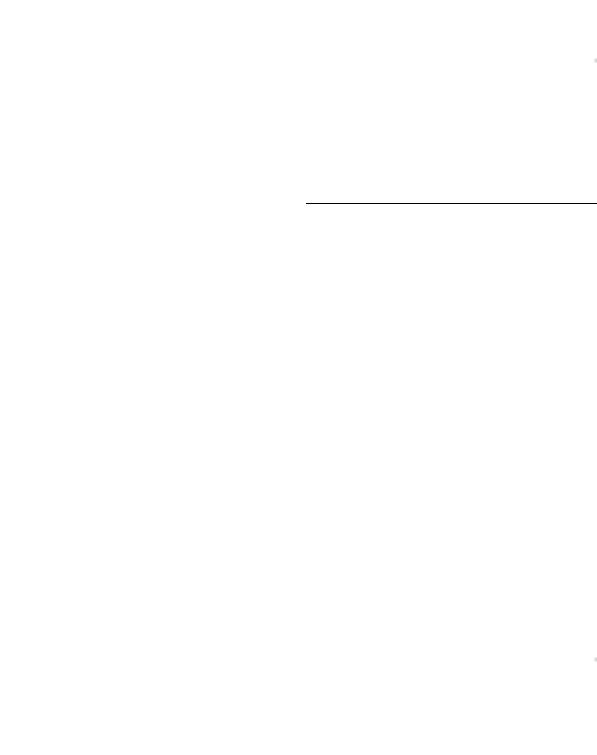
A-10 · Anästhesie in der Augenheilkunde |
|
|
|
225 |
|
A-10.1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Medikamente und deren Einfluss auf den IOD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Senkung des IOD |
|
Ohne |
|
Erhöhung des |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einfluss |
|
intraokulären Drucks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barbiturate, Hynomidate, |
|
Diazepam, |
|
Succinylcholin, |
|
|
|
|
Neuroleptanästhetika, volatile |
|
Atropin i.m. |
|
Lachgas |
|
|
|
|
Anästhetika, Midazolam, Propofol, |
|
Scopolamin i.m. |
|
|
|
|
|
|
nichtdepolarisierende Muskelrelaxanzien, Midazolam, |
|
|
|
|
|
|
|
|
Propofol, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mydriatika, Azetazolamid, Mannit 20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–Hoher ZVD, hoher PEEP
–Husten, Erbrechen, Valsalva-Manöver
–Plötzlicher Blutdruckanstieg
–Azidose, starke Erhöhung des paO2
Okulokardialer Reflex, ein trigeminovagaler ReflexAusgelöst durch Druck oder Zug am Auge oder
seinen Anhangorganen (Dornberger et al.
1991)
Begünstigt durch zu flache Narkose,
Hypoventilation mit Hyperkapnie
oder Hypoxie
Atropin (0,01 mg/kgKG) bereithalten; bis zum
Einsetzen der Atropinwirkung muss der Ope-
rateur den operativen Reiz unterbrechen
EKG-Überwachung bei allen Augenoperationen zwingend erforderlich!
Allgemeinanästhesie
Nur für < 50% der ophthalmologischen Eingriffe erforderlich.
Indikationen
Kinder
Ablehnung einer Regionalanästhesie durch den Patienten
Kontraindikationen gegen eine Lokalanästhesie
Unkooperative Patienten (Demenz, geistige Retardierung)
Unruhige Patienten, welche nicht in der Lage sind, still zu liegen (Husten, Dyspnoe)
Lange Operationen von > 1 h
Eingriffe am hinteren Augenabschnitt
Eingriffe am »letzten« Auge
Perforierende Augenverletzungen
Systemische Effekte ophthalmologischer Medikation
Augentropfen werden sehr schnell über die hyperämische Bindehaut resorbiert und können außer lokalen auch systemische Wirkungen erzielen.
Die Prämedikation mit Atropin und Diazepam senkt die postoperative PONV-Rate. Bei den meisten Eingriffen eignet sich eine TIVA mit Propofol und Remifentanil oder Fentanyl: geringe postoperative Beeinträchtigung von Vitalfunktionen und Vigilanz, geringere Inzidenz
Wirkung und Nebenwirkung von Augenmedikation |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Medikamente |
|
Wirkung |
|
Nebenwirkung |
||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Cholinesterasehemmer |
|
Lokale Glaukombehandlung, durch |
|
Verminderte Cholinesterasespiegel |
||
z. B. Physostigmin, Pilocarpin |
|
|
Vergrößerung des Querschnitts der |
|
|
|
|
|
Kammerabflusskanäle |
|
|
|
|
Azetazolamid, Diamox |
|
|
Kammerwasserproduktion gesenkt, |
|
ZNS-Depression, Diurese erhöht, Kali- |
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
durch Carboanhydrasehemmung |
|
umverlust, metabolische Azidose |
|
Atropin-Adrenalin-Phenylephrinlösung |
|
|
Mydriasis |
|
|
Tachykardie, Hypertonie, Arrhythmie |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|

Anästhesie
226 A-10.1 · Allgemeine Vorbemerkungen
von PONV, gute Steuerbarkeit und damit kurze Wechselzeiten und erhöhte Effizienz des Operationstraktes.
Bei der Einund Ausleitung der Allgemeinanästhesie ist ein Husten und Pressen unbedingt zu vermeiden
(Erhöhung des IOD): Intubation erst bei ausreichender Narkosetiefe und Relaxierung, Extubation in leichter Oberkörperhochlagerung (Verbesserung des venösen Abflusses). Die intraoperative Gabe von Clonidin kann ein »shivering« in der Aufwachphase verhindern (CAVE:
Bradykardie).
Bei Operationen in der Nähe der Makula oder Papille kann es bei Bewegungen des Patienten oder bei Bewegungen des Operationstisches zu schwersten Verletzungen am Auge kommen.
Die Pupillenreaktionen können wegen des Einsatzes von Mydriatika nicht für das Einschätzen der Narkosetiefe verwendet werden. Darüber hinaus ist bei einigen Eingriffen (z. B. Makularelokationen) eine kontinuierliche Relaxierung des Patienten indiziert. Hierbei muss an das Monitoring der Relaxation mit dem Relaxometer gedacht werden.
Neuere Arbeiten zeigen einen Vorteil bei der Anwendung der Larynxmaske. Sie führt signifikant seltener zu Husten und Pressen in der Aufwachphase. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass man während der Operation sehr schlecht an den Kopf des Patienten herankommt, um eventuelle Lageveränderungen vornehmen zu können (Denny u. Gadelrab 1993; Lamb et al.).
Postoperatives Management
In der Augenchirurgie ist das Operationstrauma eher gering. Vor allem bei Eingriffen im hinteren Augenabschnitt können allerdings postoperativ Schmerzen auftreten. Diese können in aller Regel mit Piritramid und Metamizol in üblicher Dosierung gut beherrscht werden. Sollten die Schmerzen weiter anhalten, sollte ein Augenarzt informiert werden, damit z. B. ein Anstieg des Augeninnendrucks (Glaukomanfall) ausgeschlossen werden kann.
Literatur
Henn-Beilharz A, Ullrich W, Georgi R, Kienzle F (1999) Anasthesie in der Zahn-, Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie, der Hals-, Nasenund Ohrenheilkunde und in der Augenchirurgie. Teil 2: Spezifische Aspekte in der Hals,- Nasenund Ohrenheilkunde und in der Augenchirurgie. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 34 (3): 147–170
Barrios A, Kotak D (1998) Anesthesia for the diabetic patient undergoing ophthalmological procedures. Int Ophthalmol Clin 38 (2): 195–211
Rex S Anästhesie in der Augenheilkunde. Anaesthesist 50 (10): 798–815
Denny NM, Gadelrab R (1993) Complications following general aneasthesia for cataract surgery: a comparison of the laryngeal mask airway with tracheal intubation. J R Soc Med 86 (9): 521–522 Lamb K, James MF, Janicki PK The laryngeal mask airway for intraocular surgery: effects on intraocular pressure and stress responses. Br J Anest 69 (2): 143–147
Rosenfeld et al. (1999) Effectiveness of monitored anesthesia care in cataract surgery. Ophthalmology 106 (7): 1256–1260
Kawohl C, Heilighaus A, Heiden M et al. (2002) Additive Retrobulbäranästhesie bei Operationen von Netzhautablösungen in Allgemeinanästhesie. Ophthalmologe 99: 538–544
Dornberger I, Quast D, Velhagen K-H et al. (1991) Untersuchungen des okulo-kardialen Reflexes bei Vitrektomien in Neuroleptanalgesie. Anaesthesiol Reanimat 17, 16 (2): 94–106

227 A-10.1
A-10 · Anästhesie in der Augenheilkunde
Raum für Notizen

Anästhesie
228 A-10.2 · Glaukom (grüner Star)
A-10.2 Glaukom (grüner Star)
Checkliste
|
|
LMA |
PVK: 18 G |
|
|
Operationsdauer: ca. 60 min bei unkomplizierter Operation
Prämedikation: nach Standard
Besonderheiten
Bei chronischem Glaukom Augentropfen perioperativ weitergegeben
Systemisch appliziertes Atropin ist nur bei dem Winkelblockglaukom kontraindiziert
(akuter Glaukomanfall)
Falls der Augeninnendruck medikamentös nicht einstellbar ist, erfolgt eine Laserbehandlung des Trabekelwerks oder eine Filteroperation:
Trabekulektomie, tiefe Sklerektomie, Goniotrepanation oder Retinektomie
Bei Patienten mit bekanntem engem Kammerwinkel perioperativ jede Steigerung des Augeninnendrucks vermeiden
LA oder Allgemeinanästhesie möglich: Bei der Retrooder Peribulbäranästhesie besteht allerdings die Gefahr der Erhöhung des Augeninnnendrucks. Einige Zentren führen deshalb eine subkonjuntivale Lokalanästhesie durch
Der Patient kann zur Sedierung Propofolboli erhalten
Ist eine Lokalanästhesie kontraindiziert oder sonst eine Allgemeinanästhesie erforderlich, kommt eine Larynxmaske zur Sicherung der Atemwege zum Einsatz
Vorbereitung im OP
|
Material |
|
|
|
Medikamente |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Periphervenöser Zugang (18 G) |
|
|
|
NaCl 0,9% 10 ml |
||
|
Larynxmaske Größe 3–5 |
|
|
|
Atropin 0,5 mg/ml |
||
|
|
|
|
|
|
Propofol 200 mg/20 ml |
|
|
|
|
|
|
|
Propofolperfusor 1% |
|
|
|
|
|
|
Remifentanil (5 mg/50 ml) oder Alfentanilbolus |
||
|
|
|
|
|
|
bei Larynxmaske |
|
|
|
|
|
|
|
Vollelektrolytlösung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

A-10 · Anästhesie in der Augenheilkunde
Monitoring
Standardmonitoring
Narkoseeinleitung
Anschluss des Monitorings
Periphervenöser Zugang
Infusionsbeginn
Einleitung
Remifentanil 0,2–0,4 g/kgKG/min zur Einleitung, Reduktion auf 0,1–0,2 g/kgKG/min oder Alfentanilbolus 0,5 mg
Propofol ca. 2 mg/kgKG
Einsetzen der Larynxmaske nach Erreichen einer ausreichenden Narkosetiefe
Gute Fixierung der Larynxmaske und nach Kopflagerung erneute Auskultation
Lagerung
Rückenlage, zur Extubation leichte Oberkörperhochlagerung
Narkoseführung
Gabe von Propofolboli oder 100–200 mg/h kontinuierlich nach klinischem Bedarf bei Regionalanästhesie
Behandlung von Bradykardien mit Atropin 0,25–0,5 mg, Aufforderung an den Operateur zum Unterbrechen des operativen Reizes
Behandlung von hypertensiven Entgleisungen
mit Uradipil (Ebrantil) in 5- bis 10-mg-Fraktionen bis zum Eintritt des gewünschten Effektes
229 A-10.2
Beatmung bei Larynxmaske
Luft-O2-Gemisch, PEEP: 3–5 cm H2O
FIO2: 0,3–0,5
petCO2: 35–45 mmHg
Narkose
TIVA mit Propofol 5–8 mg/kgKG/h und Remifentanil 0,1–0,3 g/kgKG/min oder Alfentanilbolus 0,5 mg
Auskühlung des Patienten vermeiden (CAVE: »shivering« postoperativ)
Vor Ausleitung: 2 g Metamizol als Kurzinfusion auf 100 ml NaCl
Schonende Entfernung der Larynxmaske ohne Husten und Pressen des Patienten und mit leichter Oberkörperhochlagerung
Vollelektrolytlösung
Extubation auf Operationstisch
Betreuung im Aufwachraum postoperativ
Postoperatives Management
Überwachung und Behandlung im Aufwachraum mit Standardmonitoring
Bei Schmerzen Gabe von 3–5 mg Piritramid (Dipidolor); nach 10–15 min Wiederholung möglich
Bei ungewöhnlich starken Schmerzen oder sehr hohem Analgetikaverbrauch Augenarzt konsultieren (CAVE: akuter Glaukomanfall)
Verlegung nach Anweisung
