
Lffler_Dialektologie
.pdf
88 Grammatische Beschreibung von Mundart
Präteritopräsentien
Präsensflexion
Präteritumflexion
Unregelmäßige Verben
6. Wortbildungslehre (nach H. Paul [194] Bd. 5)
Zusammensetzungen: nominal, verbal, flexionslos
Ableitungen:
-Substantive:
Diminutive, Movierte Feminina, Kollektiva, -ja, Mari, -10, Nomina agentis mit -n,
Mask. -ing, -ung, -ling, -rieh, -bold, -ian, Eigenschaften auf Mi, -ida, got. -odus, -nis,
-sal, -ung, -t, ohne Suffix, -ei, -turn, -Schaft, -heit, -keit, Sonstige
-Adjektive:
auf -in, -isch, -ig, -icht, -no, -ni, -ta, -tja, vereinzelte Bildungen, -haft, -sam, -lieh,
-bar, konkurrierende Bildungen, Komparativ, Superlativ, Ordinalia
-Verben:
aus Substantiven, aus Adjektiven, auf -ern, -eIn, -igen, -sen, -zen, -ehen, Mieren, aus Verben
-Indeklinabilia
Die Einteilungsprinzipien sind nicht einheitlich. Inhaltliche, formale, historische und synchrone Aspekte werden vermischt. Mit einem solchen Einteilungsmuster konnte trotz oder gerade wegen der Uneinheitlichkeit die gesamte Vielfalt der Formen annähernd vollständig beschrieben werden. Man brauchte zumindest aus systematischen Gründen nichts wegzulassen.
Das Einteilungsschema, das eben für die Hochsprache vorgestellt wurde, fand auch Verwendung für die Dialekte. Eine dialektale Formenklasse wird hiernach gemessen nach dem Grade ihrer Abweichung nicht von der deutschen Hochsprache, sondern von der historischen Ausgangsstufe, die für Dialekt und Hochsprache gleichermaßen als Bezugspunkt angesetzt wird. Vergleichbarkeit und Kontrastierungsmöglichkeit der Dialekte untereinander und gegenüber der Hochsprache sind damit, ähnlich wie bei den historischen Bezugsgrammatiken auf phonetisch-phonologischem Gebiet, besser gewährleistet, als wenn man das heterogene morphologische System der Hochsprache als Bezugspunkt zugrunde legen würde. Das historische Bezugssystem hat in der Formenlehre jedoch den Nachteil, dass es auf verschiedenen Zeitstufen, vom Mittelhochdeutschen bis zum Indogermanischen, beruht. Die Bezugssysteme liegen daher viel zu weit ab und lassen kein Prinzip erkennen. Praktikabler wäre eine taxonomisch-morpholo- gische Analyse etwa des Althochdeutschen, deren Ergebnisse als Bezugssysteme für alle dialektalen Formen-Analysen und selbst für das Neuhochdeutsche gelten könnten. Eine solche synchrone Analyse ohne das indogermanische Bezugssystem steht jedoch für das Althochdeutsche noch aus. Die bisherigen Versuche auf morphologischem Gebiet nach taxonomischer Methode haben bisher noch nicht die Vollständigkeit der Materialsammlung und Klassenbildung erreicht, wie sie in den traditionellen Grammatiken vorliegt.
Morphologie 89
Die Dialektologie wird also, wenn sie strukturell-taxonomische Morphologie betreiben will, nicht auf fertige Muster zurückgreifen können. Sie muss sich für die Anlage der Stoffsammlung und der Einteilung wohl oder übel noch an die
überkommenen Muster halten, wobei von dieser Basis gerade wegen der reichen
Vielfalt an Gliederungsgesichtspunkten leicht eine Umschreibung auf die Klassifizierungen der strukturellen Morphologie möglich ist. Wie schwierig gerade die vergleichende Formenlehre auf der Basis der herkömmlichen Klassifizierung ist, zeigt die materialreiche Arbeit von Schirmunski [7], die auf den vorhandenen historisch-vergleichenden Formenlehren der Dialekte beruht. Die strukturelle
Umnotierung würde hier als Ordnungsfaktor gerade für die Komparatistik große Vorteile bringen.
Die dialektalogische Forschung auf dem Gebiete der Formen hat sich meistens auf die Bereiche beschränkt, die leicht zu erfragen waren: einzelne Pronominalformen, z.B. he gegen er, dir gegen dich und di, verschiedene Diminutivbildungen auf -eehen, -ken, -Ie, -li, -la, -lein, den Präteritumschwund zugunsten der zusam- mengesetzten Formen, den sogenannten Einheitsplural in der Präsensflexion im
Oberdeutschen (vgl. Schirmunski [7] 521ff.). Schwieriger zu fassende Bereiche, z.B. vollständige Inventare von Formenklassen, der Partizipien oder Gerun-
diumformen oder vollständige Listen der Wortbildungsklassen eines Dialekts sind selten bearbeitet.
[238]Richard von Kienle, Historische Lautund Formenlehre des Deutschen. Tübingen
'1969
[239]Walter Henzen, Deutsche Wortbildung. 3. Auf!. Tübingen 1969
[240]Ludwig M. Eicbinger, Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen 2000
Vgl. Hermann Paul [194] Bd. 2: Flexionslehre; Bd. 5: Wortbildungslehre. Weitere Arbeiten zur dialektalen Morpho]ogie bei Sonderegger [39] Nrr. 625-679 und Wiesinger, Raffin [43] passim.
5.3.2Strukturelle Morphologie
In der strukturellen Linguistik werden die sprachlichen Einheiten und deren Klassifizierungen durch taxonomische Operationen gewonnen, d.h. durch äußere Tests wie Abspalten substituierbarer (ersetzbarer) oderpermutierbarer (verschiebbarer) Segmente. Die Morphologie befasst sich dabei mit jenen sprachlichen Einheiten, die eine eigene Bedeutung haben, also nicht nur wie die Phoneme bedeutungsunterscheidende Funktion haben. Man nennt diese kleinsten bedeutungstragenden Einheiten Morphe. In der herkömmlichen Terminologie gehören dazu: die Wortstämme, die Flexionsendungen, die Themavokale, die Präund Suffixe, der Umlaut als Pluraloder Konjunktivzeichen, der Ablaut als Tempuszeichen. Als Bedeutung versteht man nicht nur die lexikalische, sondern auch die grammatische Funktion wie Modus, Tempus, Plural, iterative oder faktitive Funktion. Morphem ist dann die Klasse derjenigen Morphe, die dieselbe Bedeu-
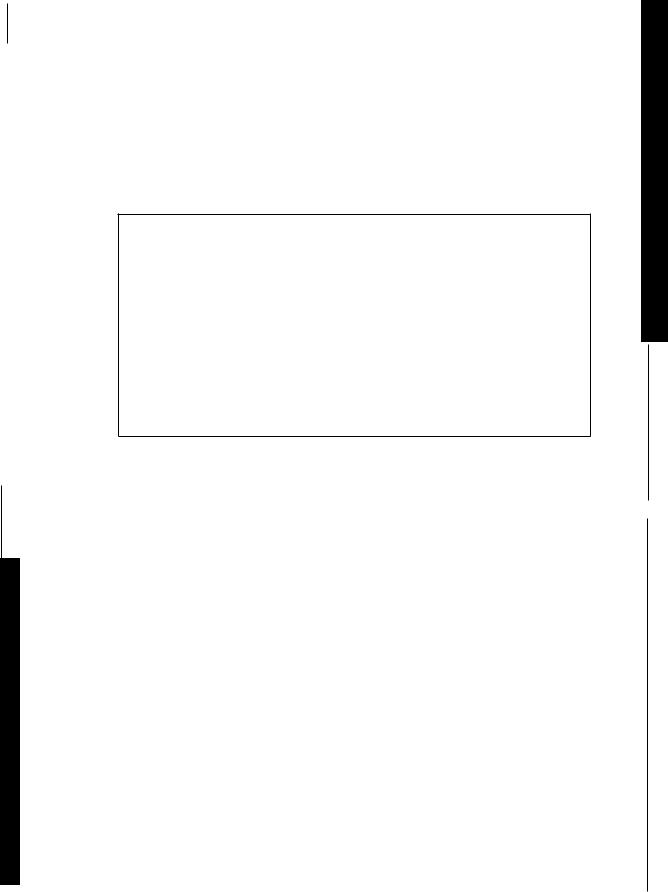
90Grammatische Beschreibung von Mundart
tung tragen, z.B. ist das Plural-Morphem im Deutschen die Klasse der Morphe I-s, -en, -e, -er, Null/. Allomorphe sind diejenigen Morphe, die zusammen die Elemente einer Morphem-Klasse bilden. Ein nicht vorhandenes Morph, also eine Leerstelle, wird aus systematischen Gründen als Null-Allomorph gewertet 1-0/. Eine terminologische Gegenüberstellung der strukturell-taxonomischen und der herkömmlichen historisch-vergleichenden Bezeichnungen soll die unterschiedlichen Klassifizierungsprinzipien darstellen:
|
MorphelMorpheme |
|
(Wörter/Formen) |
----~--------- |
|
frei |
gebunden |
~~
lexikalisch grammatisch |
lexikalisch grammatisch |
||
(Wortstamm) ~ (Wortstamm) ~ |
|||
derivativ |
flexiv |
derivativ |
flexiv |
(werden nicht zur |
|
(Worbildungs- |
(FlexionsendullM |
Formenlehre ge- |
|
suffixe/-präfixe |
gen, Thema- |
rechnet) |
|
|
vokale) |
Freie Morphe können allein stehen, gebundene nur in Verbindung mit anderen Morphen, z.B. die Flexionsendungen oder die Wortbildungssuffixe -heit, -ung u.a. Es gibt freie grammatische Morphe, wie z.B. die Personalpronomina als PersonAnzeiger bei Verbalformen oder die Artikel als Kasuszeichen bei Substantiven, falls die Endungen keinen Hinweis auf die Klasse geben. In der herkömmlichen Formenlehre werden solche Morphe nicht als Formen betrachtet.
Morphe können wie Phoneme auch phonologischen Distributionsbedingungen und -restriktionen unterliegen. Man spricht dann von morphonemischem oder morpho-phonologischem Wechsel. So steht in der Stadt-Münchener Mundart für den Artikel Mask. Akk. Sg. Idenl in der Stellung vor Ib, f, w, ml die morphonemische Variante Idem/, also: Idem buaml 'den Buben' Idem mol 'den Mann'. Die strukturelle Grammatik der Stadt-Münchener Mundart von H.L. Kufner [108] ist der erste bekannte Versuch, den Flexionsbereich einer Dialektgrammatik strukturell-taxonomisch darzustellen (vgl. jetzt auch Gladiator [109]). Die Einteilung der Flexionsklassen geschieht nicht mehr nach den indogermanischen Stammvokalen, sondern nach streng synchronen Merkmalen, z.B.
I. Deklinationsklasse (frei nach Kufner [1081 57!!.):
Kennzeichen: |
Singular-Morphem und Plural-Morphem identisch oder 10/: |
|
5g.: tog/-01 'Tag' Pl.: tog/-01 'Tage' |
Morphologie 91
2.Deklinationsklasse:
Kennzeichen: Plural-Morphem I-n, -mI (Nasalsuffix);
5g.: |
lumbb/-01 'Lump' |
PI.: lumbb/-ml 'Lumpen' |
5g.: |
egg 1-01 'Ecke' |
PI.: egg I-ni 'Ecken' |
Die neueren grammatischen Beschreibungen des Hochdeutschen haben die alten Einteilungsprinzipien schon länger aufgegeben (Duden [325]), ohne jedoch eine neue verbindliche Einteilung gefunden zu haben, die für dialektologische Arbei- ten unbesehen übernommen werden könnte.
Einführungen in die strukturell-taxonomische Morphologie, z.B. Lyons [56] und
[2411 Karl-Dieter Bünting, Morphologische Strukturen deutscher Wörter. Hamburg
'1975
Das klassische Handbuch der taxonomischen Morphologie mit Übungsaufgaben und Beispielen aus exotischen Sprachen ist
[2421 Eugen A. Nida, Morphology. The Descriptive Analysis of Words. Arm Arbor
121976
5.3.3Generative Morphologie
Die generative Morphologie hat im Deutschen außer einigen Versuchen, die bisherigen Klassifizierungen in generative Regeln umzuschreiben, keine grundlegend neuen Erkenntnisse oder gar eine neue umfassende Bestandsaufnahme gebracht. In der Dialektologie sind derartige Versuche noch nicht bekannt geworden. Das vorhandene Material der bisherigen Arbeiten eignet sich wegen der Zufälligkeit der Auswahl nicht besonders gut für eine generalisierende Umnotierung in allgemeine Anweisungsregeln. Selbst wenn dies gelänge, wäre für die Komparatistik, die auch in der morphologischen Dialektologie im Vordergrund steht, nicht viel gewonnen. Es gibt innerhalb des hochsprachlichen Bereichs Versuche, einen Teil des Wortschatzes, den man syntaktisch paraphrasieren kann, durch syntaktische Transformationsregeln entstehen zu lassen (s. Naumann [243]):
'man etwas essen kann' |
::::::} etwas ist 'ess-bar' |
ess-bar |
::::::} 'man etwas essen kann' |
Generelle Transformationsregel für das Adjektivsuffix I-bar/:
x-bar |
::::::} 'man etwas x-en kann' |
Da solche Ableitungsregeln sich jedoch nicht mechanisch anwenden lassen im Sinne des Modells einer Maschinengrammatik und da diese Regeln nur noch in den seltensten Fällen produktiv sind, d.h.zu Wortneubildungen führen, ist für die strukturelle Beschreibung der Wortbildung einer Sprache oder gar eines Dialektes wenig gewonnen.
In der dialektologischen Morphologie ginge es zunächst einmal um eine Bestandsaufnahme überhaupt, unabhängig von Beschreibungsmethode und An-
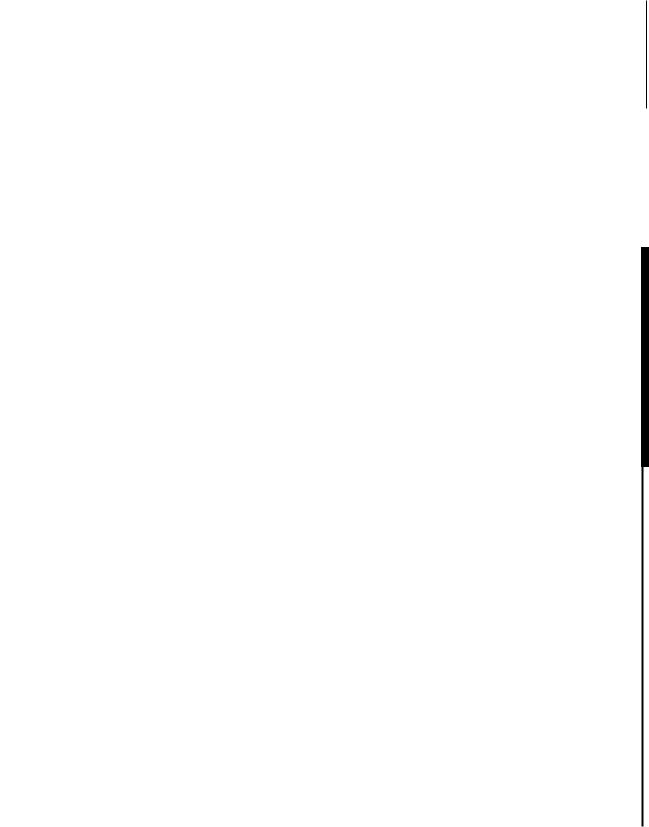
92Grammatische Beschreibung von Mundart
ordnungsprinzipien. Die Erhebung des sprachlichen Materials ist bei angestrebter Vollständigkeit mit einigem Aufwand verbunden, da man die Flexionsund Wortbildungsklassen nicht einfach heruntersagen lassen kann, abgesehen davon, dass bestimmte Formen wie 'ich lüge', 'ich stehle' schwer zu provozieren sind, da sie in der Praxis des Sprechers nicht vorkommen. Auch ist es schwer, die selten gebrauchten, aber im System vorhandenen Flexionsformen wie Indik. Präs. oder
Konj. Präteritum herauszulocken, da sie von den zusammengesetzten Formen
'ich tu graben, du tust graben' oder 'ich tat nähen, du tatst nähen' überlagert sind.
Nach der strukturellen Methode, die auch in der Morphologie diasystematische Vergleiche zulässt. lässt sich erst arbeiten, wenn alle Elemente und Klassen eines Systems voll belegt sind. Defekte Systeme, vor allem wenn tatsächlich vorhandene Formen fälschlicherweise als Null-Größen geführt werden, führen zu falschen Schlüssen. Auch die Kontrastierung zur Hochsprache leidet unter der mangelhaften Bearbeitung der Dialekte auf dem Gebiet der Formenlehre und Wortbildung.
[243]Bernd Naumann, Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen. Tübingen 1986 (2. Auflage von: Wortbildung in der deutschen Gegenwartssprache. Tübin-
gen 1971)
5.3.4Komparative Morphologie
In der Dialektgeographie spielen Sprachgrenzen, die auf unterschiedlichen Formen beruhen, keine große Rolle. Solche morphologischen Grenzlinien, wie z.B. der Einheitsplural in der Verbalflexion ('wir, ihr, sie geben' oder 'wir, ihr, sie gebend') oder Infinitiv mit und ohne Endung ('macha' gegen 'mach'), Präteritum gegen Perfekt ('ich grub' gegen 'ich hab gegraben') wurden zusätzlich zu bestimmten Lautgrenzen gewissermaßen als Begleitlinien ohne eigenen Einteilungswert hinzugenommen. Erst in jüngerer Zeit wurde wiederum für den niederdeutschen Sprachraum ein Versuch vorgelegt, die Morphologie als grenzund raumbildenden Faktor heranzuziehen (Panzer [247]). Dabei geht es nicht darum, ob man einzelne Lautlinien vielleicht durch morphologische Linien ersetzen oder verstärken könnte, sondern um eine Einteilung der sprachlichen Teilräume des Niederdeutschen nach morphologischen Systemunterschieden. Innerhalb der Verbalflexion werden z.B. verschiedene Typen von Pluralklassen oder die Zahl der jeweils vorhandenen Präteritumklassen, ferner Systemunterschiede in der Artikelund Adjektivflexion aufgedeckt und räumlich fixiert. Dadurch ergeben sich innerhalb des Niederdeutschen geographisch differenzierbare Flexionstypen, die als "holländisch", "niederländisch", "westflämisch" oder "deutsch" bezeichnet werden. Die morphologischen Systemunterscbiede erweisen sich als raumbildend, allerdings mit weit gröberem Raster als die herkömmlichen Einteilungen nach Einzel-Lautgrenzen. Der Versuch der morphologischen Gliederung beklagt aus-
'I'.,
Lexik und Semantik 93
drücklieh die mangelhafte Materialbasis der vorhandenen Einzelgrammatiken
(vgl. auch Shrier [245]. Neue Darstellungen der Formen-Geographie SBS [130], Bd. 6, 1998).
. Diachrone Morphologie ist im dialektalen Bereich über die Bearbeitung von Emzelproblemen noch nicht hinausgekommen. Die Schwierigkeiten der Erhebung stellen sich für eine historische Zeitstufe noch in viel größerem Maße. Dass hier dennoch wenigstens in Teilsystemen und -ausschnitten gearbeitet werden kann, zeigt der historische Sprachatlas des deutschen Südwestens [185] in einigen BeIspIelen (vgl. auch Löffler [184]).
Ein Gesamtüberblick der (bis 1962) vorhandenen Teilarbeiten der Formenlehre bei
Schirmunski [7] S. 409-578
[244]~udwig R.ösel, Die Gliederung der germanischen Sprachen nach dem Zeugnis
Ihrer FlexlOllsformen. Nürnberg 1962
[245]M. Shrier, Case systems in German dialects. In: Language 41, 1965, S. 420-438
[246]Heinrich Löffler, Die Ablösung von nieder durch unter in Ortsnamen am Oberrhein. In: Beiträge zur Namenforschung 5, 1970, S. 23-35 (Diachronisch-diatopi- scher Strukturwandel im Wortund Namenbereich nach historischen Quellen)
[247]Baldur Panzer, Morphologische Systeme niederdeutscher und niederländischer
Dialekte. In: Niederdeutsches Wort 12, 1972, S. 144-169
5.4Lexik und Semantik
5.4.0Vorbemerkung
Lexik befasst sich mit den Wörtern und Semantik mit deren Bedeutungen. Die kleinsten sprachlichen Bedeutungsträger sind die Morphe und Morpheme. Man unterscheidet zwischen leXikalischer oder Wortbedeutung und grammatischer Bedeutung. Unter Bedeutung im Allgemeinen versteht man die einer Ausdrucksseite, z.B. einem Wortkörper, zugeordnete Inhaltsseite als Wortoder Satzbedeutung oder als grammatische Funktion. Die klassische Zeichenlehre, die ihre Tradition vor allem in der mittelalterlichen Scholastik hat (Definition des Zeichens: aliquid stat pro aliquo), unterscheidet drei Seiten des Zeichens: I. das äußere Zeichen, also die materielle Seite, in der Sprache: der Wortkörper; 2. das mit dem signum Bezeichnete designatum, den Begriff; 3. die damit gemeinte Sache selbst, die Realität in der Außenwelt, das denotatum oder Referent. Semantik ist also Teil der allgemeinen Zeichenlehre (Semiotik) und reicht damit weit über die eigentliche Linguistik hinaus in den logisch-ontologischen Bereich der Philosophie. Innerhalb der Linguistik befasst sich Semantik im engeren Sinne mit der Bedeutung oder Inhaltsseite von Wörtern und Sätzen. Die Wortsemantik untersucht das semiotische Dreieck Signum (Wort), Designat (Begriff), Denotat (Sache). Die Satzsemantik deckt logische Beziehungen auf, die zwischen sprachlichen
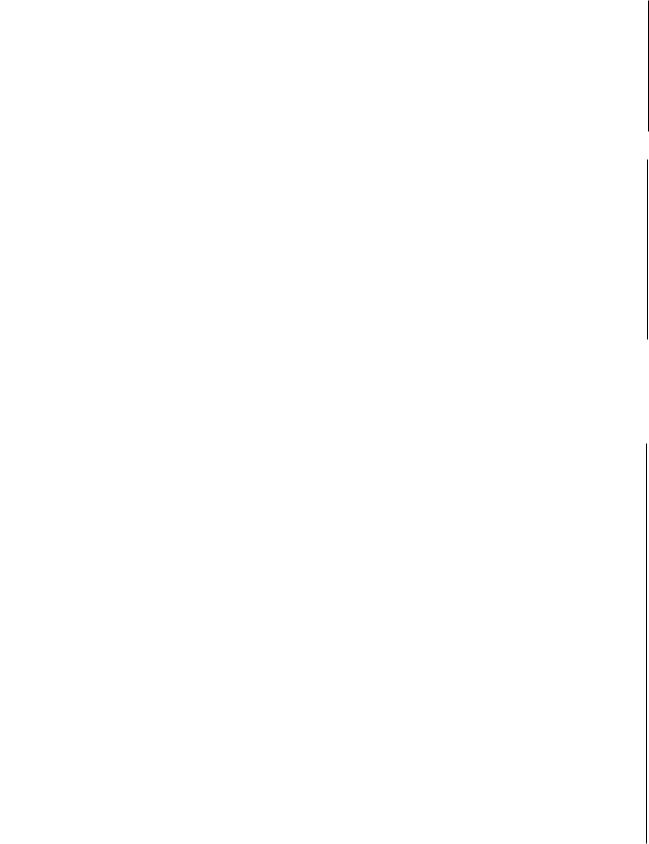
94 Grammatische Beschreibung von Mundart
Syntagmen (Sätzen) bestehen, die man als logische Prädikate (Tatsachen) oder ontologische Sachverhalte (Aussagen) formulieren kann. Die Semantik hat zu allen Zeiten im Mittelpunkt des linguistischen Interesses gestanden, da sie über die Sprache selbst hinausweist in die Begriffsund Sachwelt, die durch Sprache ausgedrückt und mitgeteilt werden kann. Es geht bei der Semantik gewissermaßen "um die Sache".
Hier sollen nun wieder einige Teilbereiche der Semantik angesprochen werden, soweit sie innerhalb der Dialektologie fruchtbar geworden sind. Für eine gesamte Einführung in die Probleme und Arbeitsweise der linguistischen Semantik sei auf die entsprechenden Einführungen und Handbücher verwiesen. Die Dialektologie befasst sich vor allem mit der Wortsemantik. Man unterscheidet hierbei innerhalb der Beziehung Ausdrucksseite - Inhaltsseite zwei Aspekte: Die semasiologische Fragestellung geht von einem gegebenen Wort aus und fragt nach der oder den Inhaltsseiten (Bedeutungen). Die onomasiologische Arbeitsweise geht von einer Sache oder einem Sachbereich aus und fragt nach den Wörtern, die diesen Sachbereich ausdrücken. Sie fragt, wie eine Sprache mit ihrem Wortschatz einen Begriffsund Sachzusammenhang ausdrückt und damit sprachlich gliedert.
[248]Franz Hundsnurseher, Neuere Methoden der Semantik. Eine Einführung anhand deutscher Beispiele. (Germanistische Arbeitshefte 2). Tübingen 21972
[249]lohn Lyons, Semantik. 2 Bde. München 1980
5.4.1Wortfeldtheorie
Einen besonderen Aspekt der Semantik stellt die Wortfeldforschung dar. Für ein bestimmtes Wort ist nicht absolut und isoliert ein bestimmtes Designat angebbar. Das Designat (Bedeutung) eines Wortes und damit dessen begrifflicher Geltungsbereich ist definiert durch die Nachbarwörter und Nachbarbedeutungen innerhalb desselben Begriffsund Sachbereichs. Jedes Wort steht in einem Geflecht anderer Wörter, die sich gegenseitig eingrenzen. Der Stellenwert des Einzelwortes wird durch die Gesamtstruktur des sprachlichen Feldes bestimmt. Als Demonstrationsbeispiele für eine Feldstruktur werden immer wieder die Bezeichnungen für die schulischen Leistungsbezeichnungen (Noten) oder die Farbwörter herangezogen. Die Noten 'sehr gut' bis 'mangelhaft' haben für sich keine absolute Bedeutung. Erst wenn festliegt, wie viele Leistungsbezeichnungen das Feld zwischen den Polen 'am besten' und 'am schlechtesten' besetzt haben (z.B. drei: sehr gut, noch gut, mangelbaft oder fünf: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft), kann man den Geltungsbereich und damit die Inhaltsseite der Noten-Bezeich- nungen angeben. Ähnliches gilt für die Farbadjektive, die das physikalisch kontinuierliche Farbspektrum verbal in Farbzonen aufteilen. Der Farbwert des Adjektivs "rosa" wird durch die Geltungsbereiche der Farbwerte 'rot' und 'weiß' bestimmt.
Lexik und Semantik 95
Die einzelnen Sprachen und deren Subsprachen unterscheiden sich darin, wie sie ihr Wortnetz über die Sachen, überhaupt über die Begriffsund Dingwelt stülpen. Diese spezielle Art, die Welt einzuteilen, und die daraus resultierende spezielle Bedeutung der Einzelwörter wurde in der Dialektologie seit der ersten derartigen Arbeit von J. Trier 1931 [250] öfters untersucht. Die Methode der Wortfelduntersuchung eignet sich gut zum Vergleich der Dialekte untereinander und mit der Hochsprache. Es treten sprachliche Unterschiede in Form von verschiedenartigen "Weltbildern" zutage, die weit über äußere Formalien etwa des Kasusgebrauchs hinausgehen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom sprachlichen Weltbild oder der inneren Form einer Sprache oder eines Dialekts. Die Wortfeldarbeiten beschränken sich gewöhnlich aus Materialgründen auf Teilbereiche und auf geographisch eng begrenzte Ausschnitte. Ein Unsicherheitsfaktor ist bei Wortfelduntersuchungen die Tatsache, dass Wortfelder oft idiolektal, also von Person zu Person verschieden, strukturiert sein können und dass durch die verbreitete Zweisprachigkeit (Bilingualismus) in Dialektgebieten, wenn der einzelne sowohl den Dialekt als auch eine Art Hochsprache spricht, die unterschiedlichen Feldstrukturen sehr verwischt sind.
Die Wortfeldtheorie ist einer der frühesten strukturellen Ansätze innerhalb der europäischen Linguistik. Wegen der wenig operationalisierten Arbeitsweise und den oft subjektiven Zuteilungen und Abgrenzungen stand die Wortfeldtheorie lange abseits der strukturellen Linguistik und wurde von vielen als "inhaltsbezogene" und damit nicht-strukturelle Grammatik abgetan. In der Dialektologie kam die Wortfeldforschung als strukturelle Semantik mit einem exakteren Beschreibungsinstrumentarium sehr früh zur Geltung.
Die ersten Wortfeldarbeiten waren:
[250]Jost Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes. Heidelberg 1931
[251]LeD Weisgerber, Von den Kräften der deutschen Sprache. Bd. 2: Vom Weltbild der deutschen Sprache. Düsseldorf 21953 ("'Die inhaltsbezogene Grammatik",
S.165-197)
Zusammenfassende Darstellungen:
[252]Rudolf Hoberg, Die Lehre vom Sprachlichen Feld. (Sprache der Gegenwart 11). Düsseldorf 1970
[253]Horst Geckeler, Strukturelle Semantik und Wortfeldtheorie. München 31982
Dialektologische Wortfelduntersuchungen:
I254] Alfons Mohr, Die intellektuelle Einschätzung des Menschen in der Mundart des
Amtes Drolshagen im Sauerland. Ein mundartliches sprachliches Feld. Mün- ster/West!. 1939
[255]Heinz Rosenkranz, Wortfeld im Mundartraum. Das Wortfeld "'schlafen" im
Thüringischen. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Jena 16, 1967,
S. 653-669
I256] Werner Marti, Wäärche - Schaffe. Ein Wortfeldkomplex in der Sprache des bemischen Seelandes. Bern 1968
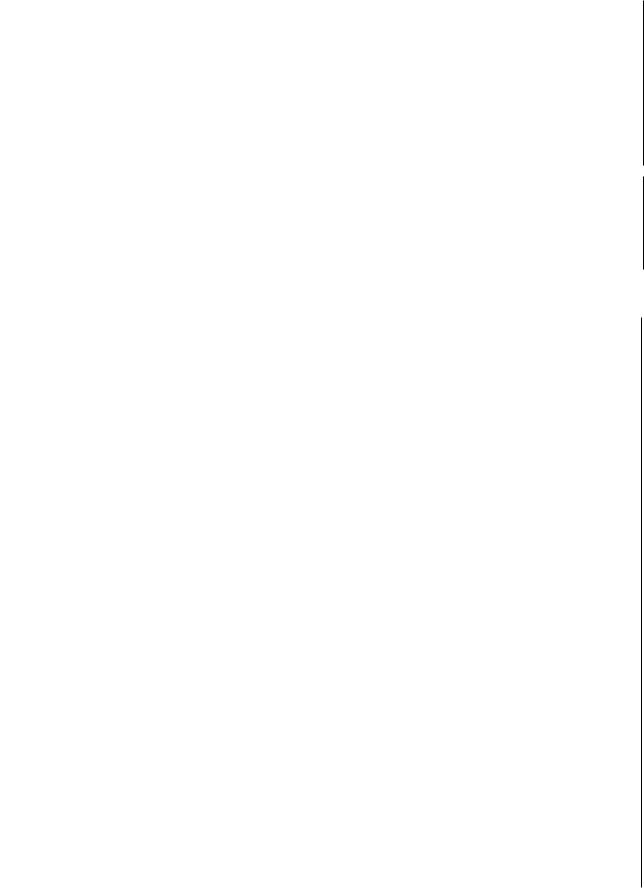
96Grammatische Beschreibung von Mundart
[257]Jan Peter Ponten, Obturamentum Lagenae (Flaschenverschluss). Untersuchung zum Begriffsfeld eines dialektalen Wortverbandes. Marburg 1969
[258]Gertrud Frei, Walserdeutsch in Saley. Wortinhaltliche Untersuchungen zur
Mundart und WeItsicht der altertümlichen Siedlung Saleyl Salecchio im Antigo- Tiotal. BeIn 1970
5.4.2Strukturelle Semantik
Auch wenn die Wortfeldtheorie schon als strukturell bezeichnet wird, so versteht man im engeren Sinn unter struktureller Semantik Formalisierung der Inhalts· seite durch Aufstellen von Systemen inhaltlicher Elemente, die man nach dem Muster von Phon und Phonem als Sem und Semem bezeichnet. Man gewinnt Seme und Sememe durch semantische Dekomposition der Inhaltsseite komplexer Wörter. Statt einer umgangssprachlichen Paraphrase der Wortbedeutung ('ein Gaukel ist ein ... '), wie üblicherweise in Wörterbüchern angegeben wird, soll ein System inhaltlicher Merkmale und deren Struktur die Inhaltsseite objektivieren. Die generative Semantik fasst die Wörter als Ergebnisse einer Komposition verschiedener Seme auf, die als eine Art atomarer, d.h. nicht mehr weiter teilbarer Inhaltselemente die Wortbedeutung konstituieren. Diese Komposition wird geschrieben in Form von Anweisungsregeln, mit denen man die komplexe Inhaltsstruktur erzeugen und damit auch beschreiben kann. Die theoretischen Ansätze sind dabei sehr unterschiedlich, angefangen vom Modellcharakter des sprachlichen Zeichens bis hin zu Einzelheiten der Operationalisierung. Allen Methoden gemeinsam ist jedoch, dass sie kein zwingend deduzierbares Inventar der kleinsten Inhaltselemente vorweisen können. Darüber, was semantische Merkmale und nicht mehr teilbare, kleinste Bedeutungsteilchen sind, ist keine verbindliche Aussage zu machen. Das Problem ist so alt wie die Aristotelische Kategorienlehre und die Frage nach der Gliederung und Inventarisierung der Dinge und der ganzen Welt (catalogus mundi).
In der Dialektologie hat die strukturell-semantische Analysemethode als Dekomposition in Sem-Strukturen noch keine Arbeiten hervorgebracht. Selbst im hochsprachlichen Bereich sind die Versuche nicht über ein Experimentierstadium an exemplarischen Beispielen hinausgekommen. Für die komparative Methode der Dialektologie wäre es durchaus denkbar, dass sich sprachliche Subsysteme, als die man sich die einzelnen Dialekte denken kann, in der semantischen tiefenstruktur unterscheiden. Hier muss allerdings sowohl die Theorie als auch die empirisch-deskriptive Arbeit an geeignetem Material die Brauchbarkeit erst noch beweisen (vgl. auch 5.4.3.1 'Strukturelle Wortgeographie').
[259]Helmut Henne, Herbert E. Wiegand, Geometrische Modelle und das Problem der
Bedeutung. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 36, 1969, S. 129-173
[260]Noam Chomsky, Studien zu Fragen der Semantik. Vom Autor korrigierte dt.
Erstausg. Frankfurt a. M. 1978
Lexik und Semantik 97
[261]Werner Abraham (Hrsg.), Generative Semantik. (Linguistische Forschungen 11). Wiesbaden 21979
Vgl. auch Lyons [248]
5.4.3Wortgeographie
I. Wortatlasforschung
Aus der überraschenden Erkenntnis, dass manche Wörter, die mit Hilfe der Wenker-Sätze für den DSA [ll2] für Lautprobleme erfragt werden sollten, gar nicht im ganzen deutschen Sprachgebiet belegt waren (s. Bsp. Pferd-Gaul- Ross im Kap. 2.4.4), hatte sich der Plan eines Wortatlasses ergeben. Hierfür wurde zu Ende der dreißiger Jahre ein eigener Fragebogen ntit 200 Wortfragen verschickt. In 20 Bänden liegt der deutsche Wortatlas inzwischen vor (Verzeichnis der behandelten Wörter bei Barth [264]). Die Wortkarte und dantit der gesamte Wortatlas ist onomasiologisch angelegt. Man fragt nach dem Tier 'Ameise' oder nach dem 'bestrichenen Brot' und erhebt die Wörter, welche in den einzelnen Gegenden hierfür gebraucht werden. So ergeben sich für ein und dieselbe Sache Wortlandschaften, die für fast jedes Wort eine andere Umgrenzung haben und sich auch rticht unbedingt ntit Lautlandschaften decken. Eine Erklärung für diese Nichtübereinstimmung muss die Karteninterpretation liefern. Dem Kartentyp nach ist der DWA [113] eine Mischung zwischen Originalkarte und Zeichenkarte (s. Kap. 4.2.4). Die einzelnen Wörter werden in größeren Geltungsräumen original eingetragen, phonetische Varianten werden mit Symbolen vermerkt. Im Anschluss an den Atlas wurde eine Reihe von Einzelproblemen in größeren Untersuchungen bearbeitet, die in der Regel den Rahmen einer einfachen Kartenbeschreibung und -deutung weit überschreiten. Sie sind in der Hauptsache in der 'Wortforschung in europäischen Bezügen' publiziert [35]. Wortkarten sind auch in den regionalen Sprachatlanten (SDS [115], ALA [122]) mit einem entsprechend kleineren Ortsnetz enthalten. Eine Schwierigkeit der Wortgeographie liegt darin, dass man schon im Voraus wissen muss, welche Wörter überhaupt Wortlandschaften ergeben, d.h. welche Sachbereiche auf der Ausdrucksseite diatopische Varianten aufweisen. Über die 200 im DWA [113] dargestellten Begriffe hinaus dürfte es noch eine Reihe weiterer Bereiche geben, die eine Wortgeographie ergeben. Hierfür sind jedoch kleinräuntige Wortuntersuchungen nötig. Vor allem durch die für alle großen Dialektlandschaften derzeit in Arbeit befindlichen Dialektwörterbücher dürfte eine neue Grundlage für eine umfassendere und feiner strukturierte Wortgeographie der deutschen Dialekte möglich werden, die man aus dem Wörterbuchmaterial direkt oder mit einer aus den landschaftlichen Ull.tersuchungen neu erstellten Wortliste erheben müsste.
Vgl. die Lit. zum Wortatlas unter 2.4.4.
[262] Elli SiegeL Deutsche Wortkarte 1890-1962. Eine Bibliographie. Giessen 1964
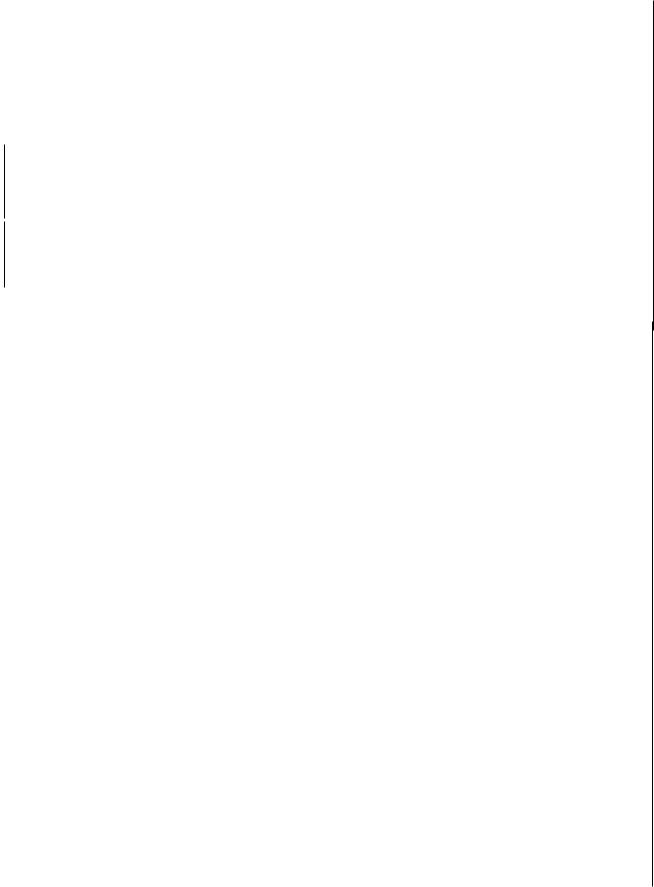
98Grammatische Beschreibung von Mundart
[263]Herbert E. Wiegand, Gisela Harras, Zur wissenschaftlichen Einordnung und linguistischen Beurteilung des DWA [113]. In: Germanistische Linguistik 2, 1971,
S. 1-204
[264]Erhard Barth, Deutscher Wortatlas 1939-1971. Eine Bibliographie. In: Germa- nistische Linguistik L 1972, S. 125-156 (mit einem Verzeichnis der im DWA behandelten Wörter und der Untersuchungen zum DWA)
[265]Wolfgang Kleiber (Hrsg.), Wortatlas der kontinentalgermanischen Winzertenninologie. Kartenund Kommentarband. Tübingen 1990-96
2. Strukturelle Wortgeographie
Neben der Wortgeographie in der genannten onomasiologischen Fragestellung des Wortatlasses hat sich auch in Ansätzen eine Wortfeldgeographie entwickelt, die Wortfelder in ihrer regionalen Verschiedenheit untersucht, z.B. die Wortfelder 'Heiratsverwandtschaft' (Debus [266]), 'Getreide' (Höing [267]) oder 'Schiffe' (Bickel [270]). Eine zusammenfassende Darstellung der Arbeiten auf dem Gebiet der strukturellen Wortgeographie bringt Goossens mit 20 Kartenbeispielen [135]. Neben die rein onomasiologische Wortkarte, die für eine gegebene Sache die landschaftlich unterschiedlichen Bezeichnungen (Heteronymen) kartiert, tritt nun die "Bedeutungskarte". Sie hat ein Leitwort zum Thema, z.B. 'Rain', und kartiert nun semasiologisch die landschaftlich unterschiedlichen Inhaltsseiten des Wortes, in dem genannten Beispiel als: Grenzstreifen, Grenzfurche, Streifen unbebauten Landes. Was sich an einem einzelnen Ort als Wortfeld zusammenstellen lässt, ergibt, aufgelöst in Einzelwörter und geographisch kartiert, ein diatopisches Bedeutungsfeld. Der enge Zusammenhang mit der Sachund Kulturgeographie ist dabei nicht zu übersehen. Wo man eine Sense benutzt, die zwei Griffe hat, können für beide Griffe eher unterschiedliche Wörter vorkommen als in Gegenden, wo eine Sense mit nur einem Griff gebraucht wird. Die Interpretation von Wortund Bedeutungskarten sieht sich einigen Problemen gegenüber. Vor allem in Grenzgebieten, wo zwei Bezeichnungen für eine Sache aufeinanderstoßen, kommt es zu seltsamen Randphänomenen wie Kontamination (Verschmelzung), Addition zweier Wörter oder gleichberechtigte Geltung zweier Wörter nebeneinander (echte Synonymie). Auch beim Phänomen der Homonymie, dass für zwei verschiedene Sachen an einem Ort oder in einer Gegend nur ein Wort zur Verfügung steht (auch als Polysemie bezeichnet), spielen gerade die Übergangszonen eine große Rolle. Hierbei muss die scheinbare Homonymie oder Synonymie getrennt werden von der echten. Die echte Homonymie oder Synonymie liegt dann vor, wenn an einem Ort bei ein und demselben Sprecher für zwei verschiedene Dinge dasselbe Wort oder umgekehrt für ein Ding zwei verschiedene Wörter gebraucht werden. Scheinbare Synonymie ergibt sich, wenn die verschiedenen Wörter für eine Sache nicht am selben Ort, sondern in verschiedenen Orten oder von verschiedenen Sprechern gebraucht werden. Die Herausarbeitung solcher Zusammenhänge zwischen Inhaltsund Ausdrucksseite, projiziert in den geographischen Raum, bringt für die semantische Struktur des Wortschatzes, auch des hochsprachlichen, wichtige Erkennmisse, die man z.B. an der statisch-mono-
,I··
4!
Lexik und Semantik 99
topen Struktur des schriftsprachlichen Einheitswortschatzes nicht gewinnen könnte. Hochsprachliche Homonymie, d.h. echte Zweideutigkeit eines Wortes (z.B. 'Mutter': 1. Elternteil, 2. Gewindering) ist auf diesem Hintergrund als das Ergebnis regionaler oder fachsprachlicher Systemmischung zu erklären.
Interessante Versuche wurden aus der Werkstatt des Lothringischen Sprachatlas vorgelegt (M. Philipp [268], G. Harras [269]), wo ebenfalls an kleinen Wortfeldern mit engem Ortsnetz eine Schritt-für-Schritt -Verschiebung im Gefüge Signijiant (Signum) - Signijie (Designat) sich hat nachweisen lassen. Auf engstem Raum mit hundertprozentigem Ortsnetz ergibt z.B. die Wortkarte 'Krawatte' drei Zonen, die aneinander anschließen: 1. Zone: iSlap/, 2. Zone: Islips/, 3. Zone: Ikrawäts/. Die semasiologische Bedeutungskarte IkrawätSI zeigt, dass dieses Wort in den Zonen 1 und 2 bedeutet: 'Schal' und in Zone 3: 'Krawatte'. Zwischen Zone l, 2 und 3 liegt eine 4. Zone, wo das Wort Ikrawätsl polysem ist, d.h. 'Schal' und 'Krawatte' bedeutet. Ein zweites Beispiel aus demselben Atlasmaterial betrifft den Teilbereich 'Oberbekleidung' aus dem übergeordneten Sachbereich 'Kleidung'. Diese Sachbereiche und deren Strukturierung werden aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in französischer Bezeichnung gegeben. Es wird für mehrere Ortsdialekte zu einem gegebenen Designatensystem das zugehörige Signem- (d.h. Wort-) System aufgestellt und auf Deckung oder auf ortsspezifische Differenzen in der Besetzung hin untersucht: "

100Grammatische Beschreibung von Mundart
Designatenstruktur (nach G. Harras [269] 1971. mit leichten Veränderungen):
vetements
weiblich |
männlich |
~~
jupe robe COTgemanteau
denteIle capuchon |
|
|
|
par |
habit acamplet pantalon veste gilet |
|
chemise |
dessus |
queu |
/-------- |
|
|
col |
pan de la |
|
|
|
I |
chemise |
|
|
|
|
|
cravate |
||
|
~ |
||
|
nceud de |
|
nceud de |
|
cravate |
|
papillon |
Signem- (Wort-) Struktur eines Ortsdialekts:
Kleidung
Montel |
SchwolbeOnzug |
IBux, Hos |
|
schwanz |
|
Schlips
~
Schlupp |
PupeHer |
|
|
|
|
Lexik und Semantik 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LUXEMBURG |
DEUTSCHLA N 0 |
|
||
|
|
|
|
~~~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
\ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karte 3: Wortkarte: 'Krawatte' im Lothringischen, nach M. Philipp [268], bearbeitet von H. Löffler.
LUXEMBURG |
|
|
DEUTSCHLAND |
r-.......--.....--r |
|
|
- |
|
|
||
'T |
|
" Scha l-"--/..,.~"" |
|
•\ |
|
||
|
|||
|
/ |
||
,
,
\
Karte 4: Bedeutungskarte: Ikrawatsl im Lothringischen, nach M. Philipp [268], be- arbeitet von H. Löffler.

102 Grammatische Beschreibung von Mundart
Solche Wortstrukturen können nun für mehrere Ortsdialekte aufgestellt werden. Aus der Verschiedenheit der Besetzung können dann örtliche Unterschiede in der Relation Designatenstruktur - Signemstruktur abgelesen werden. Die besonderen Probleme dieser Arbeitsweise liegen in der Strukturierung der Sachund Begriffswelt, die ja nicht objektiv vorgegeben ist, sondern ihrerseits wieder durch Wörter einer Sprache (hier des Französischen) strukturiert wird. Hinzu kommen Schwierigkeiten bei der adäquaten Erhebung der genauen semantischen Abgrenzung, wenn es sich um kompliziertere Sachund Begriffsbereiche handeh als in diesem Fall.
Bei diesen Kleinfeld-Veränderungen auf diatopischer Basis kommt es sehr darauf an, dass kein Ortspunkt übersprungen wird, weil dann eine vielleicht entscheidende Stelle als Zwischenglied einer ansonsten abrupten Lagerung fehlen würde. Aus den scharfen Übergängen, die eine Umkehrung des Verhältnisses Wort - Bedeutung im Raum anzeigen, wird bei lückenlosem Ortsnetz ein Bild der alhnählichen Übergänge mit einer von Ort zu Ort schrittweisen Veränderung. Solche strukturellen Auswertungsversuche von Sprachatlasmaterial zeigen, dass nur mit dichtestem Ortsnetz und nur bei vollständiger und mündlicher Befragung eine fehlerfreie Bearbeitung möglich ist. Die zweifelsfreie Zuordnung von Ausdrucksseite und Inhaltsseite muss für jedes Wort und jeden Ort gesichert sein. Indirekte Befragungen unterliegen der Gefahr vielfacher Missverständnisse, da sich Explorator und Informant nicht verständigen können, ob sie auch in jedem Fall immer dieselbe Sache meinen.
[266]Friedhelm Debus, Die deutschen Bezeichnungen für die Heiratsverwandtschaft. Giessen 1958
[267]Hans Höing, Deutsche Getreidebezeichungen in europäischen Bezügen semasiologisch und onomasiologisch untersucht. Giessen 1958
[2681 Marthe Philipp, Cartes Structurales en Moselle Germanophone. In: Melanges POUI
Jean Fourquet. Paris 1969, 5. 295-308
[269] Gisela Harras, Semantische Modelle diatopischer Teilsysteme. Marburg 1972 [270J Hans Bickel, Traditionelle Schiffahrt auf den Gewässern der deutschen Schweiz.
Wort und Sache nach den Materialien des Sprachatlasses der deutschen Schweiz. Aarau 1995
3. Historische Wortgeographie
Neben den lautlichen Phänomenen wurden von der sprachgeschichtlichen Forschung auf allen Zeitstufen auch einzelne Wörter als raumbildende Faktoren erkannt. Erinnert sei nur an die schon in ahd. Zeit in unterschiedlicher geographischer Verbreitung vorkommenden 'Synonyme" für 'leiden' als !iden, dougen, dulden (vgl. Bach [271], Karte 5 nach de Smet). Geographische Wortuntersuchungen in historischer Zeit sind für den Zeitraum vor dem 13. Jahrhundert weitgehend auf literarische Quellen angewiesen, die dazu noch in der Regel als spätere Kopien überliefert sind. Echte diachrone Wortgeographie ist daher erst von einem zeitpunkt an möglich, wo die deutschsprachigen Urkunden und
Lexik und Semantik 103
Urbare und die genau datierbaren und lokalisierbaren Handschriften literarischer Texte einen klaren synchronen Schnitt mit optimalem Ortsnetz und vergleichbarem Sprachmaterial zulassen. Seit die frühesten deutschen Urkunden immer zahlreicher gesammelt und publiziert werden, hat die historische Sprachgeographie ein weites Arbeitsfeld. Die Auswertungen von Th. Frings [351] und seinen Schülern, später von B. Boesch [183] für das Alemannische und R. Schützeichel [356] für das Mitteldeutsche, galten vorwiegend den Lauten. Wortprobleme ergaben sich textbedingt nur selten. W. Besch [273] hat für die Zeit des 15. Jahrhunderts durch die Auswertung einer geographisch auf dem gesamten deutschen Sprachgebiet verstreuten Handschriftengruppe eines literarischen Textes eine Reihe wortgeographischer Lagerungen in Einzelkarten dargestellt. Die 'Urbar-Linguistik" mit ihrem optimalen Ortsnetz und einer Feindatierung, die für den Untersuchungszeitraum nochmals synchrone Schnitte zulässt, hat ebenfalls schon wortgeographische Ergebnisse vorlegen können (z.B. Kleiber [272] u. Löffler [246]). Der strukturell-wortgeographischen Auswertung sind durch die Eigenart der Quellen enge Grenzen gesetzt. Der Wortschatz, der sich durchgängig für alle Ortspunkte, d.h. in jeder Quelle findet, und darüber hinaus noch geographisch raumbildend ist, ist quellenbedingt zufällig. Wortfeldforschung ist daher nur in beschränktem Maße möglich, bei Urbaren z.B. auf dem Gebiet der Zahlund Maßangaben, der Lagebezeichnungen und kleinen Teilbereichen des landwirtschaftlichen Arbeitsund Abgabewesens. Eine systematische Auswertung steht noch aus.
Gerade die historische Komponente der diatopischen Wortforschung könnte für die Semantik wichtige Erkenntnisse bringen. Zu der schon zusätzlichen Dimension des Raumes, die strukturelle Einsichten vermittelt, kommt noch die weitere Ditnension der Zeit und der Strukturveränderung im zeitlichen Ablauf, kombiniert mit diatopischen Lagerungen. Die Zusammenhänge zwischen Wort und Bedeutung, die synchron und punktuell nur mühsam analysiert werden können, liegen bildlich gesprochen in der diatopischen und diachronen Dialektologie ausgebreitet im Raum und im zeitlichen Ablauf, sozusagen in einem Längsund Querschnitt präpariert, vor. Da aber die Quellenaufbereitung hierbei das weitaus mühsamste Geschäft darstellt, sind derartige dia-systematische Wortuntersuchungen vom Aufwand her nur als großangelegte Forschungsunterneh- mungen zu leisten.
[271]Adolf Bach, Geschichte der deutschen Sprache. Heidelberg '1971 § 69, 5b
[2721 Wollgang Kleiber, Die Bezeichnungen für Rebneuanlage am Oberrhein im 14.
Jahrhundert. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 112, 1964,
5.225-242
[273]Werner Besch, Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jahrhundert. Studien zur Erforschung der spätmittelhochdeutschen Schreibdialekte und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. München 1967
[274]Angelo Garovi, Rechtssprachlandschaften der Schweiz und ihr e~~... ,
Bezug. Tübingen 1999 (Historische Wortgeographie von Rechtsbe~en) |
~6~ |
t:) |
~ |
~ BiTh:ff-G'tnek ~~ |
|
~ |
:;:; |
~. |
.($ |
......q |
r-.'Ö'c-:. |
t Far (je','\~'

104 Grammatische Beschreibung von Mundart
5.4.4Dialektwörterbücher
Die dialektale Semantik hat ihren Platz vor allem in der Wörterbucharbeit. Schon der Anfang der Dialektologie war bekanntlich die Sammlung von Idiotismen, d.h. regionaler Sonderwörter, die sich vom hochsprachlichen Wortschatz unterschieden. Dieses Anliegen des Aufdeckens und Inventarisierens semantischer Differenzen zwischen Hochsprache und Dialekt innerhalb des Wortschatzes ist bis heute das erste Ziel der zahlreichen Dialektwörterbücher geblieben.
Man könnte die AufgabensteIlung eines regionalen Wörterbuches, von denen Z.Z. an die 20 noch in Arbeit sind und teilweise schon, wie das schweizerische Idiotikon [303], auf eine über hundertjährige Tradition zurückblicken, so zusammenfassen: Als Wortartikel (Lemma) müssen in einem Dialektwörterbuch erscheinen:
1.Wörter, die als Wort (signum) und als Bedeutung (designatum) nur in der Mundart, also nicht in der Schriftsprache, vorkommen.
2.Wörter, die als Wort (signum) in Mundart und Hochsprache zwar gleichermaßen vorkommen, jedoch in unterschiedlicher Bedeutung und Verwendung.
3.Wörter, die nach Punkt I dialektspezifisch, aber nur noch historisch aus Quellen belegbar sind, also nicht mehr leben.
Schwierig ist für die Wörterbucharbeit die Frage der Materialerhebung. Niemand hat den gesamten Wortschatz eines Dialektes in aktivem Besitz, schon gar nicht eines größeren Sprachraumes. Zunächst bedarf es der Befragung nach onomasiologischer Methode, um überhaupt einen Grundstock an Bezeichnungen zu bekommen. Dann muss man die benötigte Zahl an Informationen itn direkten Verfahren oder per Korrespondenz aufbauen und durch die Auswertung schriftlieher Texte ergänzen. So wird üblicherweise die gesamte Mundartdichtung und wissenschaftliche Literatur aus dem Untersuchungsraum über mundartliche Probleme lexikalisch ausgewertet. Daneben müssen für Punkt 3 die historischen Belege aus lokalisierten Quellen des Bearbeitungsgebietes erhoben werden. Die Herkunft des Wortmaterials eines Dialektwörterbuches ist in der Regel heterogen, vor allem, wenn ein größeres Gebiet, oder gar, wie beim Badischen Wörterbuch [305], gleich zwei genetisch verschiedene Dialekte (Alemannisch und Fränkisch) berücksichtigt werden sollen. Die intendierte Sprecherschicht ist wie bei allen herkömmlichen Dialektarbeiten die bodenständige, lokal fixierbare bäuerliche Bevölkerung. Die Thematik umfasst hauptsächlich die Sachbereiche Mensch, Körper, Geist, Gemüt, Familie, Haushalt, bäuerliche Arbeitswelt, dörfliche Geselligkeit, Feste, Feiern, Bräuche, Geräte, Arbeitstechniken, Tiere, Pflanzen, also alle Bereiche, die zu den dialektspezifischen Themen gehören.
Ein Wörterbuchartikel enthält in der Regel nach dem Leitwort die wichtigsten Lautvarianten des Wortes mit genauer Ortsangabe, bei polysemen, d.h. mehrdeutigen Wörtern folgen dann die einzelnen Bedeutungen ntit Ortsangabe und Beispiele der Verwendung im sprachlichen Kontext. Zuletzt folgt die Etymologie,
Lexik und Semantik 105
die geschichtliche Entwicklung des Wortes. Hat ein Wort zwei weit abliegende Bedeutungen, so werden dafür zwei Wortartikel angesetzt. Man spricht dann von Homonymen. Die Unterscheidung zwischen polysemen und homonymen Wörtern ist jedoch nicht immer klar zu treffen. Den Aufbau eines Wortartikels soll folgender (leicht veränderter) Auszug aus dem 'Südhessischen Wörterbuch' [310], 1971, Sp. 1116, veranschaulichen:
Gaukel!. m. (1.) gäg.1, gägl verbr(eitet) St. Rhh. Dirn. (Ortsangaben):
-geglxa Be-Wahl.: 1. hochaufgeschossenes Geschöpf, dem es an Festigkeit und
Stärke fehlt, von männl. Personen ffi. (es folgen mehrere Ortsangaben: Of.wt.verb.
Di. Da. etc.); von weibl. Pers. m. (Ortsangaben ... ); von einem langbeinigen Hahn
(Di·Gbieb), von Bäumen (Da·Seeh ... ) von Gemüsepflanzen (01. SeI ... ). Synon.....
Schminz. 2. (scherzhaft) penis (Wo-Osth.), Synon..... Bippe!. 3. Diminutiv: kleine
Klickerkugel (Be-Wahl); Zusammensetzung: Wasser-gauket Synon. -+ Bickel,
Wetze!. 4. kindische Person e kinnische G. (Of-Egb.). Rückbildung zu gaukeln !. Kehr 149, Bad. 2, 304, D w B 4 1,1, 1548 (Literaturangaben),
Gaukel II. m. gaug.1, gaug!.
1. hochaufgeschossener Mensch. 2 a. Einfaltspinsel ... b. scheler G.: Schelte für einen a) schielenden ß) einen saumseligen, trägen Menschen, c. f. Mädchen, das häufig den Liebhaber wechselt. B Rückbildung zu gaukeln 11, vg!. Gaukel!.
Die dialektologische Wörterbucharbeit ist geographisch-vergleichende Wortforschung, Sie umfasst immer eine größere Sprachregion und unterscheidet in- nerha b dieser möglichst viele einzelne Belegorte. Vielen Wortartikeln können daher echte Wortkarten beigegeben werden. Die Dialektwörterbücher arbeiten auch kontrastiv, da sie immer die Differenz zur Hochsprache, zumindest bei der Auswahl der Ortsartikel überhaupt, itn Auge haben, Sie haben auch eine historisch diachrone Komponente, wenn historische Formen entweder als untergegangene Einzelwörter oder Vorstufen zu heutigen Formen angegeben werden, falls die Quellenlage dies überhaupt zulässt. itn Wörterbuch sind also die verschiedensten methodischen Ansätze des dialektologischen Arbeitens vereinigt. Der Benutzer eines Dialektwörterbuches muss sich darüber im Klaren sein, dass die Methodenvielfalt die Gefahr der Vermischung und Ungenauigkeit birgt, wenn z.B. historische Formen anstelle moderner Belege geboten werden, wenn geographisehe Heteronymie mit echter Synonymie verwechselt wird.
Aus.komparatistischer Sicht der Wortgeographie ist es bedauerlich, dass noch nicht alle modernen Dialektwörterbücher fertiggestellt sind. Erst wenn die wichtigsten Landschaften von Abis Z aufgearbeitet sind, lassen sich weiträumige semasiologische oder onomasiologische Feldstrukturen darstellen, die zwar vom Material her nicht einheitlich sind, aber von der möglichen Thematik her weit über die 200 zufälligen Wörter des DWA [113] hinausgehen könnten. Neben den großen regionalen Dialektwörterbüchern sind eine Reihe meist einbändiger Wörterbücher zu Kleinregionen oder Städten und Ortschaften entstanden - oder noch in Arbeit (vgL [298] bis [302]).

106Grammatische Beschreibung von Mundart
[275]Erhard Barth, Deutsche Mundartwörterbücher (Bibliographie) 1945-1965. In: Zeitschrift für Mundartforschung 33, 1966, S. 190-192 (unvollständig)
[276]Hans Friebertshäuser (Hrsg.), Lexikographie der Dialekte. Beiträge zu Geschichte, Theorie und Praxis. Tübingen 1986 (mit Verzeichnis der Wörterbücher)
[277]HermannNiebaum, Deutsche Dialektwörterbücher. In: Deutsche Sprache 7, 1979,
S. 345-373
Systematische Beschreibung der frühen Mundartwörterbücher vor 1890: Schülz [65] und
Zusammenstellung bei Mentz [37].
Abgeschlossene landschaftliche Dialektwörterbücher auf wissenschaftlicher Basis (chronologisch; nicht aufgenommen sind - meist populäre - Wörterbücher zu einzelnen Ort5-
mundarten) :
[278]Wörterbuch der ostfriesischen Sprache. Von J. ten Doornkaat Koolman, 3 Bde.
1879-1884, Neudruck Vaduz 1965
[2791 EIsässisches Wörterbuch. Von Ernst Martin, Hans Lienhart. 2 Bde. Strassburg
1899-1907
[280]Schwäbisches Wörterbuch. Von Hermann Fischer. 7 Bde. Tübingen 1904-1936
[281]Wörterbuch der deutsch -lothringischen Mundarten. Von Michael Follmann. Metz
1909, Neudruck Niederwalluff 1971
[282]Schleswig-holsteinisches Wörterbuch. Von Otto Mensing. 5 Bde. Neumünster
1927-1935
[283]Rheinisches Wörterbuch. Von Josef Müller, Kar! Meisen. 9 Bde. Bonn, Berlin
1928-1971
[284]Mecklenburgisches Wörterbuch. Von Richard Wossidlo, Hermann Teuchert.
8 Bde. Neumünster 1937-1998
[285]Siegerländer Wörterbuch. Von Jakob Heinzerling. Siegen 1938,21968
[286]Lüneburger Wörterbuch. Von Eduard Kück. 3 Bde. Neumünster 1942-1967
[287]Luxemburger Wörterbuch. Hrsg. von der Wörterbuchkommission. 5 Bde. Luxem- burg 1950-1977
[288]Wörterbuch der Tiroler Mundarten. Von Josef Schatz. 2 Bde. Innsbruck
1955-1956
[289]Wörterbuch der Teltower Volkssprache (Telschet Wöderbuek). Von Willy Lade- mann. Berlin 1956
[290]Hadeler Wörterbuch. Der plattdeutsche Wortschatz ges Landes Hadeln (Niederelbe). Von Heinrich Teut. 4 Bde. Neumünster 1959
[291]Vorarlbergisches Wörterbuch. Von Leo Jutz. 2 Bde. Wien 1960-1965
[292]Schlesisches Wörterbuch. Von Walther Mitzka. 3 Bde. Berlin 1962-1965
[293]Hochdeutsch-plattdeutsches Wörterbuch. Von Otto Buurmann. 12 Bde. Neumün- ster 1962-1975
[294]Pfälzisches Wörterbuch. Von Ernst Christmann. 6 Bde. Wiesbaden, Stuttgart
1965-1998
[295]Thüringisches Wörterbuch. Von Kar! Spangenberg. 6 Bde. Berlin 1966-1990
[296]Brandenburg-Berlinisches Wörterbuch. Von Annelies Bretschneider. 4 Bde. Berlin
1968-2001; kritisch dazu:
[297]Gerd Simon, Blutund Boden-Dialektologie. Eine NS-Linguistin zwischen Wissenschaft und Politik; Arnleliese Bretschneider und das "Brandenburg-Berlinische
Wörterbuch". Tübingen 1998
[298]Sirnmentaler Wortschatz. Wörterbuch der Mundart des Sirnmentals (Berner
Oberland). Von Armin Bratschi, Rudolf Trüb. Thun 1991
Lexik und Semantik 107
[299]Rheinberger Wörterbuch. Eine Dokumentation der Mundart am unteren Niederrhein. Von Theodor Horster. Köln 1996
[300]Wörterbuch der Wiener Mundart. Von Maria Hornung. Wien 1998,22002
[301]Senslerdeutsches Wörterbuch. Mundartwörterbuch des Sensebezirks im Kanton Freiburg. Von Christian Schmutz. Freiburg/Schweiz 2000
[302]Baselbieter Wörterbuch. Von Hans Peter Muster, Beatrice Bürkli. Basel 2001
Noch nicht abgeschlossene Wörterbücher (chronologisch nach Erstpublikation):
[303]Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Von
Friedrich Staub. 1f1. Frauenfeld 1881f1. Bd. 16: W, 1999
[304]Siebenbürgisch-sächsisches Wörterbuch. Von Adolf Schullerus. Bd. 1ff. Berlin
1925; Bd. 8:N-P, 2002
[305]Badisches Wörterbuch. Von Ernst Ochs. Bd. 1ff. Lahr 1925fl. Bd. 4: N, 1999
[306J Hessen-Nassauisches Volkswörterbuch. Von Luise Berthold. Bd. 1ff. Marburg
1927fl. Bd. 4: T, 1969
[307]Niedersächsisches Wörterbuch. Von Wolfgang Jungandreas. Bd. Iff. Neumünster
1953ff. Bd. 5: H, 1998
[308]Hamburgisches Wörterbuch. Von Hans Kuhn, Ulrich PretzeL Bd. 1ff. Neumünster
1956fl. Bd. 2: H, 1998
[309]Bayerisch-Österreichisches Wörterbuch. Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich. Von Eberhard Kranzmeyer. Bd. 1f1. Wien 1963fl. Bd. 5: T, 1998
[310]Südhessisches Wörterbuch. Von Friedrich Maurer, Rudolf Mulch. Bd. 1f1. Marburg 1965ff. Bd. 5: S, 1998
[311]Westfälisches Wörterbuch. Von William Foerste, Dietrich Hofmann. Bd. 1ff.
Neumünster 1969fl. Bd. 2, Lfg. 1, 1997
5,4,5 Wortsoziologie
Zusammenhänge zwischen Wortgeographie und sprachsoziologischen Fragen wurden in der deutschen Dia]ektforschung seit den dreißiger Jahren gesehen (s. Kap. 2.6). Die zeitbedingte Fragestellung ging auf die vertikale Sprachschichtung in Mundart, Halbmundart, Umgangssprache und Hochsprache zurück. Erst mit neueren Ansätzen der Soziolinguistik kommen der Sprecher selbst und seine Merkmale und die Abhängigkeit von Sprache, insbesondere des Wortschatzes von Umweltund Arbeitsbedingungen (Grömminger [315]) in den Blickpunkt des
Interesses.
Fragen der Wortmischung, der Überlagerung, Verdrängung, des Verhältnisses von aktivem, d.h. expansivem gegenüber dem passiven, d.h. regressiven Wortschatz werden in Zusammenhang gebracht mit sozialbedingtem sprachlichen Gefälle, das sich als dritte Dimension auch auf gewöhnlichen Wortkarten ablesen lässt als geographische Differenz zwischen Stadt und Land, zwischen Stadt-und Landmundart. Wenn auf einer Wortkarte eine bestimmte Variante in einer Stadt und im Stadtumland gilt, auf dem flachen Land jedoch eine andere, so kann die
Differenz zwischen beiden Varianten an einem einzelnen Ort als schichtenspezi-
fisch interpretiert werden. Die Stadt-Variante ist auf dem Land höherschichtig und
umgekehrt. Sprachliches Raumbild stellt damit ein sozio-determiniertes Gefälle
