
Lffler_Dialektologie
.pdf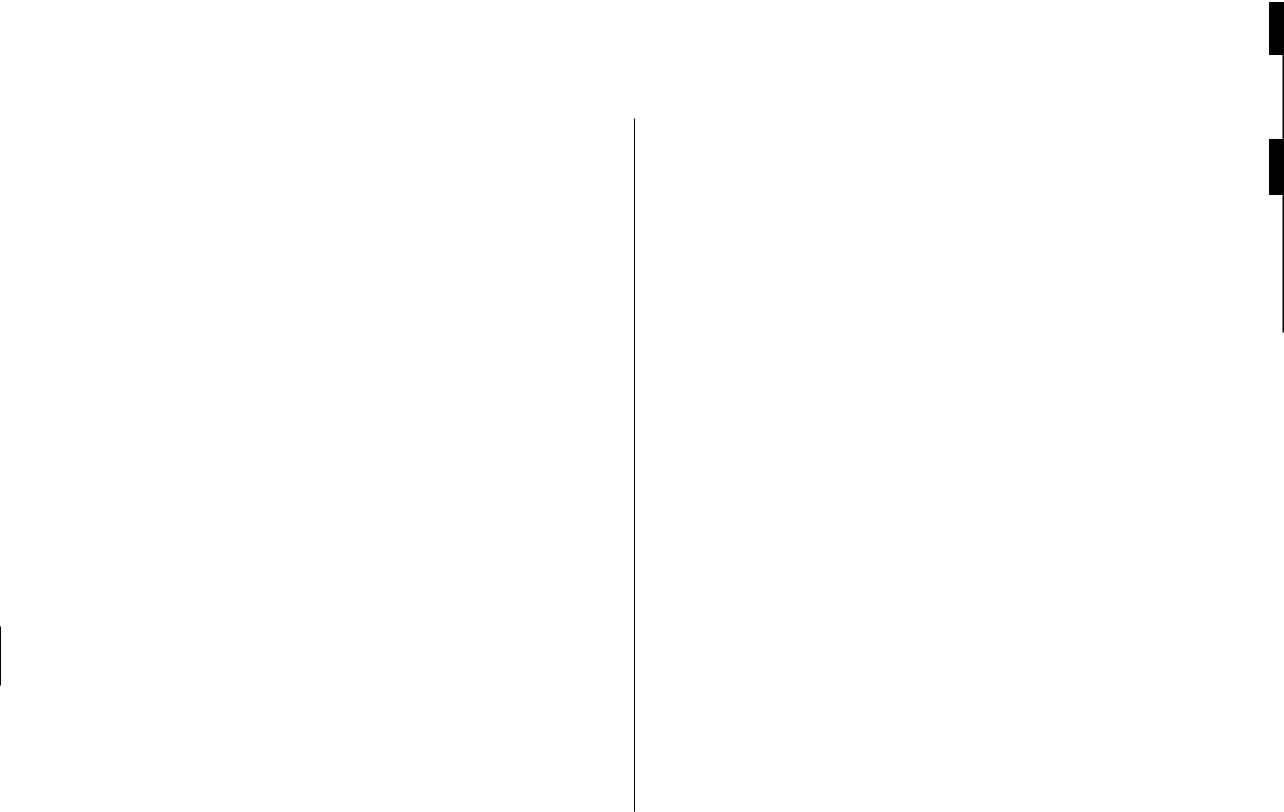
48Spracherhebung
werden konnte, musste entweder die Ortsnetzdichte sehr gering gehalten werden oder das Untersuchungsgebiet entsprechend klein. Bei weiträumigen Unternehmungen, die in direktem Aufnahmeverfahren arbeiteten, wie beim SDS [115] liegt die Ortsnetzdichte bei 25-66%, der ALA [122] hat 22% der Orte erfasst. Kleinräumige Untersuchungen können auf hundertprozentige Ortsnetzdichte kommen, wenn die Gesamtzahl der Orte nicht allzu groß ist (z.B. beim 'Voralbergischen Sprachatlas' [128]). Damit die direkte Befragung am Ort nicht ins Uferlose geht und ein Vorhaben nicht an der langen Dauer der Exploration scheitert, muss neben der Orts-Auswahl auch die Problemauswahl gut vorbereitet sein.
Beim direkten Aufnahmeverfahren ergeben sich einige Standardsituationen der Befragung:
Das gezielte Interview
Will man die sogenannte Grundmundart erheben ohne Rücksicht auf kontextuelle und situative Gegebenheiten, so ist das durch ein gezieltes Interview mit einer festen Frageliste zu erreichen. Der Explorator sitzt der Gewährsperson gegenüber und geht mit ihm die Fragen Punkt für Punkt durch. Der Frager muss dabei vermeiden, dass er seine Erwartungen zu deutlich formuliert, damit er nicht Gefälligkeitsforrnen bekommt, die dann eine Art Exploratoren-Dialekt ergeben. Der Explorator sollte auch in seiner eigenen Sprache nicht zu weit von der des Informanten abliegen, sonst bekommt er sogenannte EchoFormen, bei denen der Befragte unbewusst die Artikulation des Interviewers imitiert.
Die Sprechsituation des Interviews ist sehr künstlich, da sie im Leben des Befragten nicht vorkommt. Wenn diese Situation jedoch allen Erhebungen in gleicher Weise zugrunde liegt, sind die Informationen unter identischen Bedingungen zustande gekommen und damit in höchstem Maße vergleichbar.
Die Antworten werden vom Explorator sofort in einer phonetischen Schrift mitgeschrieben. Dabei werden Fragen und Antworten am besten in einer gleich-
bleibenden Nummerierung durchgezählt. Eine vergleichende Auswertung wird dadurch sehr erleichtert. Als Transkriptionsschrift hat sich die diakritische Lautschrift eingebürgert. Sie wurde auch in der Zeitschrift 'Teuthonista' [27] 1. 192 5 für die deutsche Dialektologie vorgeschlagen. Mit ihr arbeiten der SDS [115]. der ALA [122], der 'Vorarlbergische Sprachatlas' VALTS [128], der Südwestdeutsche Sprachatlas SWSA [126] und der Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben SBS [130]. Auch die in 2.4.4 genannten regionalen Atlanten schließen sich weitgehend dieser Schrift an. Die diakritische Lautschrift benutzt bis auf das Sonderzeichen a die Buchstaben des Alphabets und kennzeichnet Längen und Kürzen und Öff- nungsgrade mit zusätzlichen Häkchen (diakritischen Zeichen). Es heißt dann fi'nstar oder slQfa für "Fenster" und "schlafen". Das internationale phonetische Alphabet (IPA) oder auch API-System (Association Phonetique Internationale) genannt, das für alle Sprachen der Welt gelten soll und daher für jede phonetische
Aufnahmemethode 49
Artikulation ein eigenes Zeichen benutzt, hat sich in der deutschen Dialektologie nicht recht eingebürgert. Es ist für die im Grunde immer nur wenig variierenden Phoneminventare zu kompliziert. Man würde für "Fenster" und "schlafen" schreiben: venJtaR und Jb:va (vgl. auch die Textbeispiele in Kap. 4.2.1).
Für die Transkription hat sich als praktisch erwiesen, dass zur Kontrolle wenigstens in Ausschnitten Tonbandaufnahmen zur Verfügung stehen. Gerade bei größerem zeitlichen Abstand zwischen Aufnahme und Auswertung hilft die auditive Kontrolle nach Band, phonetische Zweifelsfälle leichter zu entscheiden.
[180]Peter Wiesinger, Das phonetische System der Zeitschrift "Teuthonista". In: Zeitschrift für Mundartforschung 31, 1964, S. 1-26. Das phonetische Transkriptionssystem der Association Phonetique Internationale (API) aus der Sicht der deutschen Dialektologie. Ebd. S. 42-49; Vorschläge zur Gestaltung eines für die deutsche Dialektologie allgemein verbindlichen phonetischen Transkriptions- system. Ebd. S. 57-61. Vgl. auch Hotzenköcherle [115]. König [130], Bd. 1
(Anhang: Fragebuch und Transkriptionsschlüssel)
Das freie Gespräch
Für die Aufnahme freier Rede in Abhängigkeit von Thematik, Partner, Situation oder psychischer Verfassung muss man die außersprachlichen Bedingungen künstlich herstellen oder so lange warten, bis sie sich von selbst einstellen. Letzteres ist nur mit größter Geduld möglich oder wenn man in einem Raum dauernd ein Tonbandgerät aufgestellt hat. wie dies von der Tübinger Arbeitsstelle wenigstens für 24 Stunden einmal ausprobiert worden ist. Der Explorator könnte auch für längere Zeit mit den Informanten zusammenleben und in echten Situationen seine Aufzeichnungen machen. Für Einzelorte dürfte das durchführbar sein, nicht aber für großräumige Untersuchungen. Der Normalfall ist also die gestellte Situation. Dabei lassen sich wiederum einige Grundkonstellationen unterscheiden:
I.Der Informant erzählt frei eine Geschichte oder ein Erlebnis vor dem Mikrophon. Der Interviewer ist still oder gibt lediglich Anstöße durch zustimmendes oder interessiertes Verhalten.
2.Der Informant unterhält sich mit einem oder mehreren Bekannten oder Familienmitgliedern in Form einer echten oder provozierten Konversation (conversation dirigee).
3.Der Informant unterhält sich mit dem Interviewer, den er entweder kennt oder der ihm bis dahin nicht bekannt war. Hierbei lassen sich durch Wechsel des Gesprächspartners bestimmte Sprechlagen provozieren.
Die technische Seite der Aufnahme stellt kein Problem dar. Die sogenannte Mikrophonangst besteht erfahrungsgemäß nur kurze Zeit. Durch geeignete Anordnung der Geräte außerhalb des Blickfeldes lassen sich solche Störfaktoren herunterspielen. Gute Erfahrungen wurden mit Stereo-Halsband- oder Ansteck-

50Spracherhebung
mikrophonen gemacht. Dadurch ist von Anfang an eine spontane Sprechhaltung gegeben, und bei der Auswertung sind die einzelnen Sprecher selbst bei gleichzeitigem Durcheinanderreden gut unterscheidbar. Beim Basler Stadtsprachenprojekt wurden von einigen Probanden an deren Arbeitsplatz mittels Funkmikrophonen Ganztagsaufnahmen gemacht. Auf diese Weise konnten sprachliche Tagesläufe in Echtzeit und störungsfrei erhoben werden [165].
Auch für die eigentliche Aufnahmetechnik lässt sich wiederum feststellen, dass sie abhängt von dem intendierten Forschungsziel. Eine standardisierte Aufnahmemethode für Dialektarbeiten gibt es nicht. Die Prozedur darf jedoch nicht dem Zufall überlassen werden. Die Einzelheiten der Aufnahmemethode sind hypo- thesenorientiert im Voraus genau durchzuplanen und durch ein Testprogramm zu modifizieren. Nur so können die Ergebnisse am Ende richtig eingeschätzt werden.
Der Zwang zur Transkription für jede Auswertung beschränkt die Anzahl und Dauer von Tonbandaufnahmen ganz erheblich. Selbst wenn die Speicherung und Aufbereitung des Sprachmaterials durch EDV maschinell bewältigt wird, bleibt der Aufwand groß, da die raschere Auswertung durch intensive manuelle Aufbereitung vor der Speicherung erkauft werden muss.
3.6Erhebung historischer Sprachzustände
Die Spracherhebung für historische Untersuchungen unterliegt besonderen Bedingungen. Es geht darum, welches Sprachcorpus genommen werden soll, wenn man Dialekte vergangener Epochen untersuchen will. Hierbei ist man ganz auf schriftliche Aufzeichnungen angewiesen, da phonetische Schriften erst eine Errungenschaft der Sprachwissenschaft sind. In der Zeit vor der überregionalen deutschen Einheitssprache gab es nur landschaftliche Dialekte, die uns in literarisehen Handschriften überliefert sind, über deren gesprochene Form jedoch keine direkten Zeugnisse vorliegen. Es ist auch nicht genau bekannt, in welchem Abbild-Verhältnis der geschriebene Buchstabe zum damaligen gesprochenen Laut stand. Lange Zeit hat die historische Grammatik den Buchstaben für den Laut genommen. Erst allmählich kam man darauf, dass es offensichtlich auch in ltistorischer Zeit eine erhebliche Diskrepanz zwischen gesprochenem Laut und traditioneller Schreibweise gab. Inzwischen hat sich über der Analyse der Zuordnung von Schriftzeichen und Laut eine eigene Wissenschaft entwickelt, die man Graphematik nennt (s. Kap. 5.1.6). Als vorzügliche Quelle für historische Sprachuntersuchungen entdeckte man die Urkunde, gewissermaßen als Ersatz für ein fehlendes Aufnahmeprotokoll. Urkunden kann man genau lokalisieren und datieren. Ihre Schreiber nennen sich meist am Schluss, Empfängerund Ausstellernamen sind Bestandteil des Urkundentextes. Von den äußeren Bedingungen her haben Urkunden also vergleichbare Merkmale. Ihre Sprache ist jedoch nicht einfach eine Transkription gesprochener Laute. Sie ist vielmehr eine von Formeln durchsetzte Juristenund Amtssprache. Die Formeln werden in ihrer stereotypen
Erhebung historischer Sprachzustände 51
Wiederkehr sofort erkannt. Die leichtesten Abweichungen springen daher sogleich ins Auge und lassen einen Niederschlag lokaler oder individueller Sprachgewohnheit vermuten. Die Thematik der Urkunden ist nicht literarisch-ästhetisch wie bei den überlieferten literarischen Handschriften. Sie stammt in der Regel aus dem praktischen Alltagsbereich. Mit Hilfe der Urkundensprache lassen sich daher in Ansätzen lokale Sprachgewohnheiten in ltistorischer Zeit erfassen. Ein Mangel besteht darin, dass trotz der großen Zahl an deutschsprachigen Urkunden seit der Mitte des 13. Jahrhunderts die Textmenge des Einzelstückes doch jeweils recht klein ist und die thematischen Bereiche sehr heterogen. Eine Vergleichbarkeit der einzelnen sprachlichen Elemente ist daher nur beschränkt möglich. Sie stößt beim Wortschatz sehr bald auf Grenzen.
Eine zweite Quellengattung für die Rekonstruktion historischer Sprechsprache sind die ebenfalls seit dem 13. Jahrhundert überlieferten deutschsprachigen
GüteIund Zinsverzeichnisse, die man auch Urbare nennt. Sie haben zwar einen monotoneren Inhalt als die Urkunden, ihre Lokalisierung ist aber ebenso gesichert wie bei diesen. Die Ortsnetzdichte ist noch größer, da viele kleine Herrschaften und Klöster zwar keine eigene Urkundenkanzlei hatten, sehr wohl aber ihre Güterverzeichnisse im eigenen Hause haben anfertigen lassen. Diese Register waren in der Regel zum internen Gebrauch bestimmt, zur wirtschaftlichen Verwaltung und für den Verkehr mit den Lehenleuten und anderen Abgabepflichtigen. Durch diesen lokalen und ökonomischen Charakter ist die Sprache der Urbare sehr mundartnah. Vor allem bei der Bezeichnung von Personen, Orten und bei der genauen Lageangabe von Grundstücken musste eine Art phonetische Schreibung verwendet werden, dantit die Identität von Person und Ort gesichert war. Viele Eigennamen dürften nach dem Gehör notiert sein.
Urbare des 15. Jahrhunderts wurden in einem langjährigen Forschungsprojekt unter Leitung von Friedrich Maurer in Freiburg i.Br. sprachhistorisch ausgewertet. Zunächst wurden zahlreiche Kanzleiund Schreiber-Grammatiken angefertigt. Aus diesen "Vorarbeiten" [182] ist dann ein historischer Schreibatlas entstanden. Über 800 urbariale Texte ließen sich auf 11 OOrtspunkte (Kanzleiorte) verteilen. Der 'Historische Südwestdeutsche Sprachatlas' [185] präsentiert mit seinen 220 Karten für einen historischen Zeitpunkt eine Materialfülle, die in ihrer Dichte durchaus einem modernen Sprachatlas vergleichbar ist. Mit Hilfe der Karten konnten schon bisher zahlreiche nicht lokalisierte Texte aus der fraglichen Zeit einer bestimmten Gegend oder sogar einem Ort oder einer Kanzlei zugeord- net werden.
Auch bei der Beschaffung historischer Sprachdaten sind also ähnlich wie bei der modernen Mundartforschung eine Reihe von extralinguistischen Bedingungen zu beachten. Durch die spezifischen Gegebenheiten historischer Quellen sind jedoch einige "Variablen" nicht veränderbar. Die Schriftform der Quellen liegt fest, ihre Zahl ebenso. Die Lage der Ortspunkte richtet sich nach der Quellenlokalisierung, die Zeitpunkte richten sich nach der Abfassungszeit, wobei für Kopien jeweils das Problem entsteht, ob für die Sprachform der Zeitpunkt des Originals

52Spracherhebung
oder der Abschrift zu gelten hat. Frei ist eigentlich nur die Art der Auswertung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Textmengen. Bei einer einzigen Quellengattung sind Untersuchungen zu soziologischen Problemen ausgeschlossen. Hier könnte der Vergleich verschiedener Text-Gattungen bei sonst identischer Fragestellung interessante Aspekte vermitteln. Doch ist für die meisten Quellengattungen außer den Urbaren die textkritische Situation, was Datierung, Lokalisierung und Originalität anbelangt. nicht sehr günstig.
[181]Rudolf Schützeichel, Mundart, Urkundensprache und Schriftsprache. Studien zur
Sprachgeschichte am Mittelrhein. Bonn 1960, 2 1974
[182J Friedrich Maurer (Hrsg.), Vorarbeiten und Studien zur Vertiefung der südwestdeutschen Sprachgeschichte. Freiburg 1965. Darin: Friedrich Maurer, Neue Forschungen zur südwestdeutschen Sprachgeschichte S. 1-46; Werner Besch, Zur Erschließung früheren Sprachstandes aus schriftlichen Quellen S. 104-130; Wolfgang Kleiber, Urbare als sprachgeschichtliche Quelle. Möglichkeiten und Methoden der Auswertung S. 151-243
[1831 BIuno Boesch, Die deutsche Urkundensprache. Probleme ihrer Erforschung im deutschen Südwesten. In: Rheinisches Vierteljahresbulletin 32,1968, S. 1-28
[184]Heinrich Löffler, Neue Möglichkeiten historischer Dialektgeographie durch sprachliche Auswertung von Güter~ und Zinsverzeichnissen. In: Rheinisches
Vierteljahresbulletin 36,1972. S. 281-291
[185J Wolfgang Kleiber, Konrad Kunze, Heinrich Löffler, Historischer Südwestdeutscher Sprachatlas des 14. und 15. Jahrhunderts. 2 Bde. Bern, München 1979
4.Beschreibung und Darstellung von Mundarten
4.0Problem der Beschreibung und Darstellung von Sprache überhaupt
Eine Beschäftigung mit Problemen der Analyse von dialektaler Sprache und deren Darstellung und Deutung kann notwendigerweise nur im Rahmen einer allgemeinen grammatischen Theorie vor sich gehen. Dialektgrammatik richtet sich nach dem Stand der grammatischen Beschreibung überhaupt, d.h. nach dem Stand der Linguistik, deren Methoden und Fragestellungen. Beschäftigung mit Dialekt ist Teil der Beschäftigung mit Sprache überhaupt als die Beschreibung eines Subsystems oder Subkodes, genannt Mundart oder Dialekt, mit allen seinen Besonderheiten. Ein Überblick über die Darstellungsmöglichkeiten der Mundartforschung ist somit ein überblick über Analyseund Darstellungsmöglichkeiten von Sprache mit den zusätzlichen Aspekten, die die Mundart von dem gewohnten Objekt einer Grammatik, eben der Gemeinsprache oder Einheitssprache, unterscheiden.
Die Darstellungsmöglichkeiten der dialektalen Analyse sollen hier in einer Systematik der Darstellung von Sprache überhaupt behandelt werden. Nicht jeder Punkt der Darstellungssystematik kann mit einer Forschungsrichtung oder einem Einzelwerk belegt werden. Die Geschichte der Mundartforschung und deren Analyseund Darstellungsprozeduren waren alles andere als systematisch.
4.1Systematik einer grammatischen Beschreibung von Mundart
Die eigentliche grammatische Analyseund Beschreibungsprozedur ist nach der Textbeschaffung und -aufbereitung der zweite wichtige Schritt in der dialektologisehen Arbeit. Die Vielfalt der möglichen Aspekte grammatischer Darstellung von Mundart und deren Korrelation mit anderen Faktoren lässt sich in einem Schema systematisieren, wobei einzelne Untersuchungen jeweils einen einzelnen oder mehrere Aspekte herausgreifen. Eine Gesamtdarstellung unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten wird eigentlich nie unternommen.

54Beschreibung und Darstellung von Mundarten
4.1.1 Übersicht
Grammatischer Bereich |
|
|
|
|
Beziehungsart |
Bezugsbereich |
|
Phonetik/Phonologie |
|
|
|
|
|
Ort: syntop |
|
|
|
|
|
|
punktuell, |
|
|
Prosodik |
Zeit: synchron |
||||||
|
|
|
|
mono-,syn- |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Morphologie |
|
|
|||||
|
|
|
|
linear |
Gruppe: (synsozial) |
||
Lexik/Semantik |
|
|
|
|
Ort: diatop |
||
|
|
|
|
poly" dia- |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Syntax |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeit: diachron |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtgrammatik |
|
|
|
|
|
Gruppe: (diasozial) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2Grammatische Bereiche
Die Aufgliederung der grammatischen Bereiche in Laute (Buchstaben), Formen (Deklination, Konjugation), Satz (Kasuslehre und Satzlehre) und Wortschatz (Wörterbuch) erfolgt nach alten Einteilungsprinzipien, die von der klassischen Lateingrammatik her bekannt sind. Seit der voraussetzungslosen Neubestimmung der grammatischen Kategorien durch den taxonomischen Strukturalismus, der durch formale Tests wie Permutations· oder Verschiebeprobe, Substitutionsoder Ersatzprobe die sprachlichen Einheiten segmentiert und neu klassifiziert, ist die Zuteilung der sprachlichen Elemente zu den verschiedenen grammatischen Bereichen etwas verändert worden, die Kategorien selbst sind größtenteils geblieben: Zur Phonologie gehört die sogenannte artikulatorische und akustische Phonetik als empirische Grundlage für die eigentliche phonologische, d.h. strukturell-systematische Einordnung der Laute. Prosodik befasst sich mit den sogenannten konstitutiven Faktoren wie Akzent, Tonhöhe, Melodie, Sprechgeschwindigkeit, Pausen u. dgl. Man spricht in der taxonomischen Terminologie auch von den suprasegmentalen oder supralinearen Einheiten der Sprache, die sich also nicht durch formale Tests segmentieren lassen. Die Vielfalt der Bezeichnungsweisen für prosodische Faktoren darf nicht als Zeichen für besonders intensive Beschäftigung der Forschung gewertet werden. Der prosodische Bereich ist in der Mundartforschung eher sogar vernachlässigt. Das dürfte mit der besonderen Schwierigkeit der Sprachaufbereitung zusammenhängen und den meist fehlenden Spezialkenntnissen der Bearbeiter auf musikalisch-rhythmischem Gebiet, die für eine derartige Analyse nötig wären, Unter Morphologie versteht man den Bereich jener sprachlichen Elemente, die eine eigene Bedeutung tragen als Einzelwörter, wie sie im Wörterbuch stehen oder als Wortteile wie Suffixe, Präfixe, welche grammatische Funktionen wie Kasus, Numerus, Tempus, Wortart anzeigen. Zur Morphologie gehören also die klassischen Bereiche der Flexion, Deklination, Konjugation und Wortbildungslehre. Der Bereich der Syntax teilt
Systematik einer grammatischen Beschreibung von Mundart 55
sich auf in einen paradigmatischen, in dem Elemente behandelt werden, die im Satz gegeneinander austauschbar sind, die also ein Paradigma bilden. Hierunter fällt der Bereich der Wortarten und der Satzfunktionen (Satzglieder). Man spricht auch gelegentlich von Wortsyntax, weil einzelne Wörter und Wortarten im Hinblick auf ihre Funktion und Leistung im Satz untersucht werden, Die Beziehungen der Wörter zueinander im Satz, ebenso die lineare oder hierarchische Verknüpfung von Satzgliedern oder ganzen Sätzen untereinander fällt in den syntagmatischen Bereich. Diesen könnte man mit der herkömmlichen Satzlehre vergleichen, Der Bereich der Lexik und Semantik war in der früheren Grammatikarbeit ganz auf das Wörterbuch verlegt. Dabei hielt man einen lexikalischen Grammatikteil eigentlich hauptsächlich bei Fremdsprachen für erforderlich. Gerade die Bearbeitung der Mundarten machte jedoch deren Fremdsprachencharakter sehr deutlich. Die früheste Form der Beschäftigung mit Dialekt war denn auch die Wörterbucharbeit als Sammlung von Idiotismen,
Die einzelnen Grammatikbereiche sind in der Dialektologie in unterschiedlicher Weise bearbeitet. Der Schwerpunkt liegt im lautlichen Bereich, insbesondere auf dem Gebiet der historisch-vergleichenden Phonetik. Die Wörterbucharbeit dürfte an zweiter Stelle des Interesses stehen. Die übrigen Bereiche werden immer nur am Rande behandelt oder aus verschiedenen Gründen ausgeklammert. Gesamtgrammatiken werden fast nie versucht (vgl. Kap, 2.4.3).
4.1.3Außersprachliche Bezugsbereiche
Das Besondere an jeder Mundartdarstellung ist, dass sie neben dem grammati- |
|
|
|
schenProblemausschnitt zugleich die außersprachlichen Faktoren Ort, Zeitpunkt |
|
|
|
und Sprecher mitberücksichtigt. Man könnte diese Bereiche der Sprachverwen- |
|
|
|
dung auch als pragmatische Faktoren bezeichnen. In der Beschreibung der über- |
|
|
|
regionalen Einheitssprache werden diese Faktoren gar nicht erwähnt, da sie |
|
|
|
dauernd konstant gehalten werden. Zur Definition von Dialekt gehört es jedoch |
|
|
|
geradezu, dass er in einer abhängigen Beziehung steht zu den Variablen Raum, |
|
|
|
Zeit und Sprechergruppe. Eine Dialektuntersuchung geht also von der Veränderlich- |
|
|
|
keit der Aspekte Ort, Zeit und Gruppe aus und beobachtet, wie hierdurch sprach- |
|
|
|
liehe Äußerungen |
als "abhängige Variable" beeinflusst werden. Gewöhnlich |
|
|
werden die Variablen Zeit und Gruppe konstant gehalten. Die Zeit ist die vom |
|
|
|
ältesten Sprecher am Ort erlebte frühere Zeit, wo noch alte und echte Mundart |
|
|
|
gesprochen wurde, die Gruppe sind die oft zitierten ältesten und bodenständigen |
|
|
|
Einwohner eines Ortes. Variiert wird also nur die Variable Raum, die Konstanten |
|
|
|
Zeit und Sprecher werden gar nicht erwähnt. Diese Arbeitsweise ist die dialekt- ~s\tät S |
|
||
geographische. Die Untersuchungen aus jüngster Zeit unterscheiden auch iW~ |
Q{.6.:. |
||
nerhalb der Gruppe noch verschiedene Schichten, selbst wenn diese kons~t |
|
~ |
|
gehalten werden. Auch innerhalb der Variablen Zeit gibt es verschiedene SchiSh-Bibliothek |
..-: |
||
ten, Werden diese |
veränderlich gehalten, spricht man von historischer o~r |
|
. f! |
|
~J'"',,ri\ .",$' |
||
'<lI" Ge'"

56Beschreibung und Darstellung von Mundarten
diachroner Dialektologie. Seit einiger Zeit werden auch schon Zeitstufen gegeneinander gehalten, die nur eine geringe Spanne auseinanderliegen, indem etwa die Wenkerbogen von 1880 mit heutigen Aufnahmen verglichen werden in einer Art Kurzzeit-Diachronie. Bei der hierbei erkennbaren raschen Veränderlichkeit der Sprache in der Zeit ist die exakte Angabe und Beachtung des Zeitpunktes immer von Bedeutung, selbst wenn er wiederum konstant gehalten wird, wie bei dialektgeographischen Arbeiten.
4.1.4Beziehungsart punktuell/komparativ
In der Korrelation zwischen sprachlichen Variablen und den außersprachlichen Faktoren Ort, Zeit und Gruppe unterscheidet man die punktuelle Beziehungsart, wenn jeweils nur ein Ortspunkt, ein Zeitpunkt und eine Sprechergruppe beachtet wird und die lineare oder komparative, wenn einer oder alle der außersprachlichen Faktoren variiert werden. Die punktuelle Arbeitsweise kann auch als syntopisch, synchron und synsozial bezeichnet werden, wobei letzterer Terminus noch nicht üblich ist. Für den Bereich der sozialen Gruppe hat sich als Überset - zung von Schicht die Bezeichnung syn- und diastratisch teilweise eingebürgert. Punktuell kann sehr weit gefasst sein. Auch ein großes Gebiet kann punktuell betrachtet werden, ebenso ein größerer Zeitraum, den man als synchronen Schnitt fasst. Auch eine heterogene Sprechergruppe mit unterschiedlichen Sozial· merkmalen kann unter Umständen als eine Gruppe gefasst werden. Man spricht immer dann von punktueller Arbeitsweise, wenn für eine außersprachliche Variable immer nur eine einzige sprachliche Einheit als abhängige Variable genommen wird, wenn man also keinen sprachlichen Vergleich anstellt. Die lineare oder komparative Arbeitsweise vergleicht verschiedene sprachliche Einheiten' deren Verschiedenheit durch die Varianz von Ort, Zeit oder Gruppe gesteuert wird. Man hat also für die einzelnen grammatischen Kategorien immer mehrere Daten, die in Korrelation zu den außersprachlichen Faktoren stehen. Sprachvergleich in Bezug auf mehrere Ortspunkte ist Sprachgeographie oder in der Terminologie der System-Linguistik diatopischer Systemvergleich. Sprachvergleich zwischen mehreren Zeitpunkten ist Sprachgeschichte, historische Grammatik oder diachronischer Systemvergleich. Sprachvergleich zwischen mehreren Sprechergruppen ist Soziolinguistik oder diasozialer (diastratischer) Systemver· gleich.
Zu prinzipiellen Fragen der linguistisch-grammatischen Terminologie vgl. die entsprechenden Kapitel der Einführungen in die Linguistik und Goossens, Strukturelle Sprachgeographie [135]. Ein früher Versuch der terminologischen Systematik:
[186]Gunnar Hammarström, Linguistische Einheiten im Rahmen der modemen SprachWissenschaft. Heidelberg 1966
5"~~"
Si
Dialektalogische Darstellungsmittel 57
4.2Dialektologische Darstellungsmittel
Die Dialektologie kennt verschiedene Mittel der Darstellung ihrer sprachlichen Analysen und deren Korrelation mit außersprachlichen Faktoren. Die am häufigsten gebrauchte Darstellungsforrn ist die Mundartmonographie als problem-, orts· oder zeitbezogene thematische Darstellung. Das zweite Instrument der Mundartanalyse ist das Wörterbuch, das dritte ist die Sprachkarte und der Sprachatlas. Eine besondere Darstellungsform ist die Dokumentation. Im Folgenden sollen kurz die spezifischen Merkmale und Leistungen der einzelnen Darstellungsmittel charakterisiert werden.
4.2.1Dokumentation als Kompetenzersatz
Die Mundartgrammatik ist nur selten die Beschreibung der Kompetenz des Verfassers selbst. In der Regel beruht das Beschreibungscorpus auf Fremdinformation. Die Mundartgrammatik beschreibt also die Kompetenz anderer, die in einem komplizierten Aufnahmeund Aufbereitungsverfahren erst beschreibbar gemacht werden muss. Hier stellt sich das Problem der Textdarstellung und der Dokumentation von Mundart als Kompetenzersatz. Grammatikbearbeiter und -benutzer brauchen einen Untersuchungstext als Ersatz oder Ergänzung der fehlenden Eigenkompetenz. So kann man die Versuche, Mundart in repräsentativen Ausschnitten zu dokumentieren (s. Kap. 2.3), als eine Art vorgrammatische Mundartdarstellung ansehen, als Reproduktion zum Zwecke der grammatischen Analyse.
Neben den Sprachwiedergaben auf Band oder Platte, die den lautlich-physika- lischen Aspekt originalgetreu und jederzeit wiederholbar reproduzieren, gibt es die Möglichkeit der schriftlichen, d.h. teilbearbeiteten Wiedergabe. Jede Verschriftlichung von gesprochener Sprache ist Teilbearbeitung, da die Zuteilung der gesprochenen Laute zu einem Schriftzeichen nur durch eine vorläufige lautliche Interpretation möglich ist. Die 'Lautbibliothek der deutschen Mundarten' als das bislang umfassendste dokumentarische Unternehmen [77] versucht dem Problem der ungewollten Bearbeitung durch Verschriftlichung dadurch zu entgehen, dass sie mehrere Arten der Transkription hintereinander bringt, die sich gegenseitig korrigieren. Man unterscheidet bei der Verschriftlichung von Mundart vier Stufen:
1.Die lautgetreue Transkription mit einem phonetischen Alphabet, wo jede artikulatorische Lautvariante mit einem entsprechenden Zeichen versehen wird.
2.Die sogenannte Phonologische Transkription, die zwar auch ein phonetisches Alphabet verwendet, aber nur so viele Zeichen gebraucht, wie eine Mundart Phoneme hat. Zwischentöne oder momentane Artikulationsvarianten werden nicht angegeben. Es wird so notiert, wie der Sprecher hat sagen wollen.
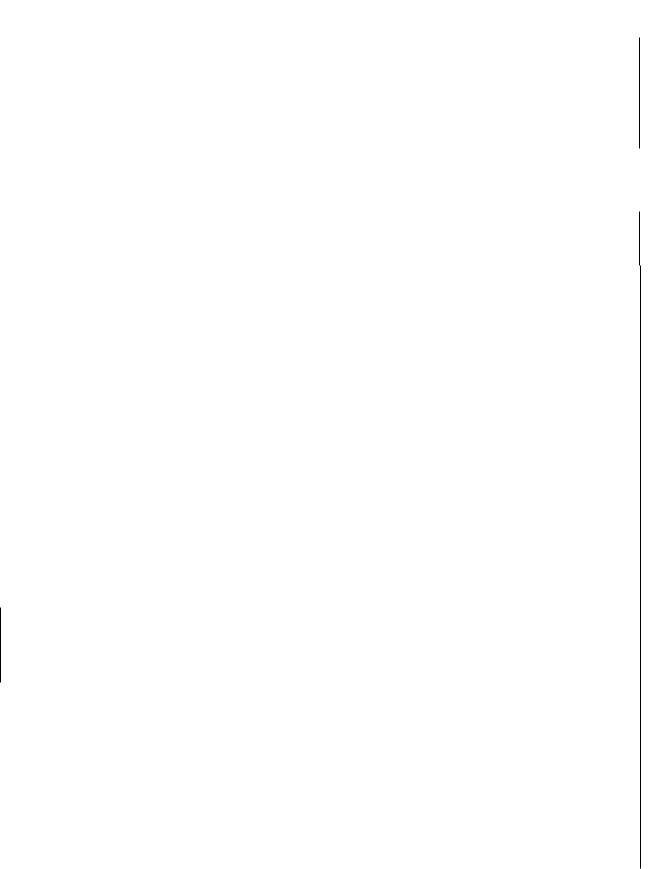
58Beschreibung und Darstellung von Mundarten
3.Die literarische Umschrift verwendet das Alphabet der Schriftsprache ohne jegliche Sonderzeichen. Hierbei gelten die Schreibregeln der gebräuchlichen Orthographie. Die tatsächliche mundartliche Lautung kann hinter dieser Schreibweise nur indirekt erschlossen werden.
4.Die Übersetzung (Übertragung) eines Mundarttextes In die Einheitssprache ist ebenfalls eine Art Mundartdokumentation. die vor allem als semantische Kontrolle für die phonetischen Transkriptionen gedacht ist.
Die Notation der prosodischen Faktoren kennt verschiedene Zeichen. Sie kann bei allen vier Transkriptionsweisen gewissermaßen darüber (supralinear) geschrieben werden. Versuche. auch nichtsprachliche Faktoren wie Gestik. Situation. psychische Reaktionen In einem pragma-Iinguistischen Kürzelsystem den Texten beizugeben. sind noch im Experimentierstadium. Bei herkömmlichen Transkriptionen werden diese Faktoren in einem Aufnahmeprotokoll. so gut es geht. festgehalten.
Zur Veranschaulichung der dokumentarischen Wiedergabe von gesprochener Sprache in Schriftform sollen die folgenden Beispiele dienen:
I. Walter Hedemann. Berlin. Lautbibliothek [77] 8. 1958. 8:
Phonetische Umschrift:
ja kjn~nu zQI ik ~X vat a'tseln vo jk hea bin --? jk bin? aos balin das kläR njva d~t
'höeda sön - - b)nn jO'büotije ·kRQts·b~Rja.
Literarische Umschrzft:
Ja, Kinder, nu soll ick wat azehln, wo ick her bin. Ick bin aus BeTlin, dis klaa, niwa, det hörda schoon. Bin'n jebürtija Kroizherja.
Hochsprachliche Übertragung:
Ja, Kinder, nun soll ich euch etwas erzählen, wo ich her bin. Ich bin aus Berlin, das ist klar, nicht wahr, das hört ihr schon. Bin ein gebürtiger Kreuzberger.
2. Herbert 1. Kufner. München. Lautbibliothek [77] 35. 1964. 14:
Phonetische Umschnft:
Ijä jl9.es1 js la2zö.2 !li: 3 j 2bjnl na\liali2 J indle~khQm;J2 JIlJn2tswä 1 Qis2sQtla 1.
Phonologische Umschrift (S. 15):
/lja 2 / Ides is a 2562 / 2e / 2bin na diale /lin2dlea ghuma2 /lnd2dswa :lis s:lddla 1.
Hochsprachliehe Übertragung (S. 14):
Ja, das ist (ein) so. ~ch bin natürlich in die Lehre gekommen und zwar als Sattler.
Erläuterungen zu den Texten: Zu den phonetischen Zeichen s. Hotzenköcherle [1l5] u. Zwirner [77] 31ff. Die untergesetzten Haken bedeuten offene Vokale. Das? bedeutet Stimmbandverschluss, der einen leichten Knacklaut bewirkt der im Deutschen vor jedem Vokal nach einer Pause gesprochen wird. Die vorgesetzten Zahlen in Text 2 geben den Melodieverlauf in 3 Tonhöhen wieder. Die Schrägstriche bedeuten Sprechsegmente, also Zäsuren, die der Sprecher macht.
Dialektologische Darstellungsmittel 59
Dokumentationen der gezeigten Form sind die Voraussetzungen für eine gramma-
tische Beschreibung Sie ersetzen nicht nur die Kompetenz des Bearbeiters. sondern geben durch die Segmentierungszeichen und andere Markierungen schon erste Interpretationshilfen. insbesondere für lexikalische. syntaktische und prosodische Fragen. In einer aufbereiteten Form ist ein Text trotz der nicht mehr wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe besser zur grammatischen Bearbeitung geeignet als ein nicht bearbeitetes objektives Tonband oder die subjektive Eigenkompetenz des Bearbeiters.
4.2.2Ortsund Gebietsmonographie
Die gebräuchlichste Form der dialektologischen Darstellung ist die sogenannte Ortsgrammatik. Die klassische Lautund Formenlehre. vermehrt um Wortiisten und Textproben. war die häufigste Kombination aus den grammatischen Bereichen. Die klassische Ortsoder Gebietsgrammatik ist nach der Beziehungsart punktuell. Sie beschreibt den Dialekt eines Ortes oder einer Landschaft zu einem Zeitpunkt, vertreten durch die Sprecher der Grundmundart. Die diatopische Bezugsart befasst sich meistens mit einem grammatischen Ausschnitt. hauptsächlich aus dem Bereich der Phonologie. Vom Begriff her ist die diatopische Grammatik keine Ortsgrammatik mehr. sondern befasst sich ntit größeren Räumen. Eine Ortsgrammatik kann sich sehr wohl aber komparativ in Bezug auf die Zeit und die sozialen Gruppen an einem Ort verhalten. Dieser Typ. der die Sprachgeschichte an einem Ort behandelt oder die Sprachschichten innerhalb einer örtlichen Sprachgemeinschaft, ist wegen der zusätzlich benötigten sprachlichen Informationen äußerst selten. Diasoziale Untersuchungen gehen in der Regel auf die Kontrastierung Dialekt - Umgangssprache oder Dialekt - Hochsprache. wobei die Sprecherseite gewöhnlich vernachlässigt und nur die Sprachschicht selbst thematisiert wird.
Einzelheiten des methodischen Vorgehens bei der grammatischen Darstellung und der Korrelierung ntit pragmatischen und anderen Faktoren finden sich in den Kap. 5 und 6.
Zur Lit. s. unter Kap. 2.4.3.
Immer wieder gibt es Versuche von meist populären Gesamtdarstellungen ("Dialektbü- cher" ). so z.B.
[187]Ludwig G. Zehetner, Das bairische Dialektbuch. München 1985
[188]Hans Friebertshäuser, Das hessische Dialektbuch. München 1987
[189]Joachim Schildt. Hartrnut Schmidt (Hrsg.). Berlinisch. Geschichtliche Einführung in die Sprache einer Stadt. Berlin/Ost 1986
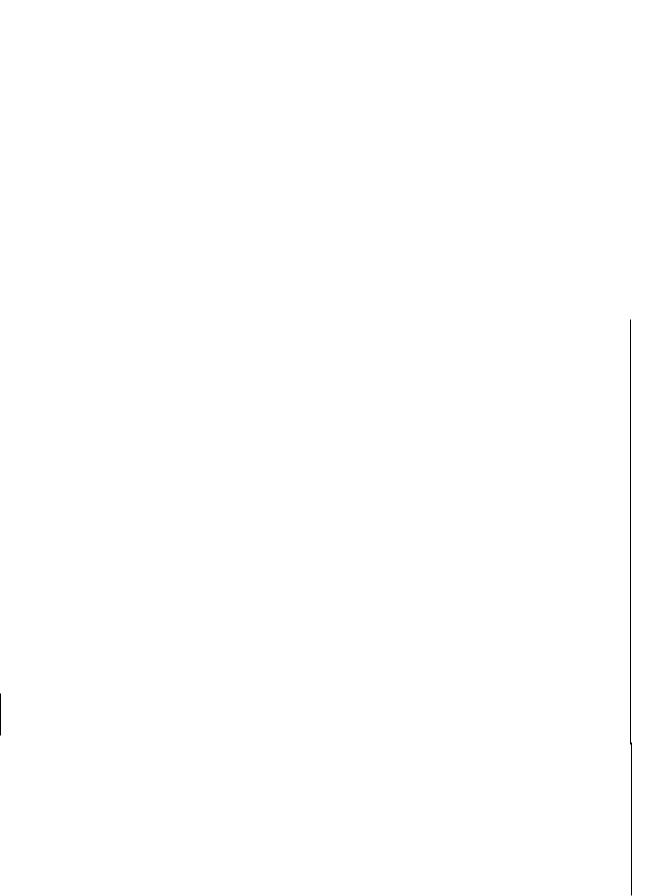
60 Beschreibung und Darstellung von Mundarten
4.2.3Dialektwörterbuch
Der Darstellungstyp Wörterbuch beschränkt sich nicht nur auf die granunatischen Aspekte Lexik und Semantik. Da die einzelnen Wörter innerhalb eines Wortartikels in der lautgetreuen Form wiedergegeben werden und oft innerhalb des syntaktischen Kontextes, kann ein Wörterbuch darüber ltinaus in beschränktem Maße auch Hinweise für phonetische Fragen und wortsyntaktische Probleme bieten. Das Hauptthema des Wörterbuches ist jedoch das Wort und seine (meist von der Schriftsprache) abweichende Bedeutung (vgl. die Beispiele unter 5.4.4). Die Dialektwörterbücher waren anfangs öfters syntopisch, d.h. sie stellten den Wortschatz eines einzelnen Ortes dar. Die heutigen modernen Mundartwörterbücher bearbeiten in der Regel ein größeres, ltistorisch und sprachgeographisch zusammengehöriges Gebiet. Die Belege stammen dabei ausVerschiedenen Orten des Bearbeitungsraumes. Daher ist die Arbeitsweise eines Dialektwörterbuches in der Regel diatopisch, d.h. wortgeographisch. In Bezug auf den Zeitpunkt ist das Vorgehen uneinheitlich. Viele Wörterbücher geben darüber keine Rechenschaft und sind nicht wählerisch in Bezug auf die Datierung der Belege. Die Wortbeispiele stammen oft aus ganz verschiedenen Jahrhunderten, ohne dass dabei die Zeitstufen methodisch getrennt behandelt würden. Das gesamte Belegmaterial wird oft synchron behandelt, als stamme es aus einern einzigen Zeitpunkt. Auch in Bezug auf die Herkunft der Wortbelege wird nicht scharf unterschieden zwischen mündlicher Information und zeitgenössischen Sprechern, Exzerpten aus Dialektliteratur und -dichtung, Belegen aus historischer Zeit. Gerade bei historischen Belegen zeigt sich, dass die Angabe der Quellengattung für die Qualität des Belegs von großer Bedeutung wäre. Die Dialektwörterbücher sind nach der Herkunft ihres Materials also sehr heterogen und in der Arbeitsweise methodisch oft nicht differenzierend. Hierin unterscheiden sich die verscltiedenen Wörterbuchunternehmen ganz erheblich, je nach dem Zeitpunkt ihrer ersten Konzipierung. Aber auch bei älterer und wenig expliziter Methode sind die Wortartikel auch für modernere Ansprüche noch brauchbar, wenn die Angaben in Bezug auf Zeit, Ort, Quelle und buchstabengetreue Wiedergabe exakt dargeboten werden. Zur Lit. s. unter Kap. 5.4.4.
4.2.4Dialektkarte und Dialektatlas
Jede Sprachkarte ist von der Definition her zweidimensional. Sie besteht aus einer Mehrzahl von Ortspunkten, die eine Fläche bilden oder deren Verbindungslinien sich zu Sprachlinien und -grenzen zusanunenfassen lassen. Die Lautund Wortkarten sind die Hauptvertreter der dialektologischen Sprachkarten. Andere grammatische Bereiche entziehen sich einer einfachen Kartierung, da sie nicht so leicht in Einzelsegmente aufteilbar und punktuell kartierbar sind. Eine Dialektkarte ist von Linie und Fläche her diatopisch angelegt. Wegen der Beschränkung auf
I
Dialektologische Darstellungsmittel 61
zwei Dimensionen ist kein weiterer Faktor gleichzeitig darstellbar, es sei denn, man schafft durch verscltiedene Farben oder Symbole eine zusätzliche Dimension auf Kosten der Anschaulichkeit. Auf der Dialektkarte sind also die Faktoren Zeit und Sprechergruppe konstant gehalten. Die Dialektkarte ist daher diatopisch in Bezug auf Raum, synchron in Bezug auf Zeit und synoder monosozial in Bezug auf die Sprechergruppe. Eine Kartensarnrnlung oder ein Sprachatlas kann jedoch in der Hintereinander-Reihung verscltiedener synchroner und monosozialer Kartenschnitte eine Tiefenwirkung oder einen Bewegungsablauf vermitteln, der auch diachrone und diasoziale Vergleiche zulässt. Die Sprachkarte war schon recht früh ein zusätzliches Demonstrationsrnittel granunatischer Darstellungen. Seit Dialektologie in der Hauptsache als Dialektgeographie betrieben wird, ist die Karte und die Kartensamrnlung als Sprachatlas das wichtigste Darstellungsmittel und Forschungsinstrument geworden. Wenn H. Fischer seinem geplanten 'Schwäbischen Wörterbuch' einen Sprachatlas gewissermaßen als Vorstudie voranschickte [110], so werden heute umgekehrt vor und neben den großen Atlasuntemehmen EinzeIund Begleitstudien angesetzt in Form von thematisch begrenzten Ortsoder Gebietsmonograpltien. Formal unterscheidet man verscltiedene Kartentypen:
I.Die Originalkarte enthält für jeden Ortspunkt die sprachliche Eintragung (Laut, Form, Wort) unverschlüsselt in phonetischer Schreibung. Nach dieser Methode arbeiten die französischen Sprachatlanten. Die volle Eintragung der Belege ist jedoch nur bei lockerem Ortsnetz möglich.
2.Die Symbolkarte oder Punktkarte enthält, wie der Name schon sagt, die Eintragungen nicht in direkter Form, sondern verschlüsselt in graphischen Zeichen und Symbolen, die in einer Legende für jede Karte einzeln definiert werden müssen. Als Symbole werden in der Regel geometrische Figuren auf der Basis von Fläche (Kreis, Dreieck, Rechteck) oder auf der Basis von Strichen verwendet, die man wiederum zu komplexen Gebilden kombinieren kann. Die Symbole haben eine klarere optische Wirkung und vermitteln schon eine gewisse Vorinterpretation, die durch die Wahl und Anordnung der Zeichen gegeben ist. Mit geometrischen Symbolen arbeiten der SDS [115], SWSA [126], SBS [130]. Dank Computergraphik kann die Geometrie der Symbole (Dreiecke, Vierecke, Kreise, gefüllt, leerusw.) leicht "symbolisiert", d.h. einern linguistischen Merkmal zugeschrieben werden. Mit Strichsymbolen, die eine größere Zahl an Kombinationsmöglichkeiten, allerdings auf Kosten der Lesbarkeit, zulassen, arbeiten der DSA [112] und der DWA [113]. Mit Kombinationen beider Symbolarten und zusätzlicher Schraffur arbeitet u.a. dank Computergraphik der KDSA [127].
3.Die Linienkarte ist eine Sonderform der Symbolkarte. Nicht jeder Ortspunkt bekommt ein Zeichen, sondern Punkte mit gleicher Eintragung werden durch eine Linie verbunden. Solche Linien heißen Isoglossen. Je nach Zahl der Linien, deren Kombination zu Linienbündeln, deren Anordnung von Orts-

62 Beschreibung und Darstellung von Mundarten
punkt zu Ortspunkt oder zwischen den Ortspunkten im freien Raum entlang der Gemarkungsgrenzen entstehen verschiedene optische Eindrücke. Karten, die jede einzelne Linie getrennt ausziehen, erwecken den Eindruck eines elektronischen Schaltbildes. Karten, die Linien addieren und gleichlaufende Linien graphisch addieren zu dickeren Strichen, erwecken den Eindruck eines Bienenwabensystems. Man spricht bei dieser Art von Kombinationskarte denn auch von Wabenkarte.
4.Die Flächenkarte ist eine Kombination zwischen Originalund Zeichen(Symbol- )karte. Ortspunkte mit gleichen Angaben werden in Zonen zusammengefasst und als Fläche durch eine Grenzlinie markiert oder durch Schraffur gekennzeichnet. Die für die Fläche geltende Sprachform wird dann direkt in Originalform eingetragen. Abweichungen können innerhalb eines Hauptgeltungsbereiches dann mit Sonderzeichen als Ausnahmen markiert werden. Diesem Typ entsprechen viele Karten des DSA und DWA.
Die Wahl des Kartentyps richtet sich nach der Größe und Form des Untersuchungsraumes, nach der Ortsnetzdichte, der Zahl und Art der darzustellenden Themen und nach der Art des sprachlichen Materials. Die Wahl des Kartentyps ist gleichzeitig schon eine Wahl zwischen dokumentarischer Genauigkeit ohne vorweggenommene Interpretation bei der Originalkarte und der größeren optischen Wirkung bei gleichzeitiger Vorausinterpretation durch die Wahl und Anordnung der Zeichen bei der Symbolkarte. Eine Aufgliederung der Kartentypen nach inhaltlichen Kriterien (Laut-, Wort-, Formenkarte) findet sich im Anschluss an die Besprechung der einzelnen grammatischen Bereiche in Kap. 5.
4.2.5Dialektometrische Darstellungen
Der Computereinsatz bei der Kartierung großer Datenmengen - auch computative Dialektologie genannt - dient zunächst nur der Beschleunigung der bisher manueil erfolgten Operationen wie Zuordnung der Antwort-Belege zu den entsprechenden Fragen, Zuordnung der Belege zu einem linguistischen Thema (Phonem, Lautkombination, Morphem, Lexem usw.) und schließlich Zuordnung des Befundes zu einem Ortspunkt auf der Karte und Auswahl und Zeichnung eines entsprechenden Symbols. Auch die Zusammenfassung mehrere Kartenthemen zu einer Gesamtdarstellung ("Kombinationskarte") ist dank Computer keine wochenlange Handarbeit mehr, sondern eine Frage von Augenblicken. Die auf diese Weise erzielten Ergebnisse unterscheiden sich prinzipiell nicht von den in traditioneller Handarbeit gewonnenen, außer dass sie mit großer Zeitersparnis entstanden sind.
Zu qualitativ anderen Ergebnissen führt ein fortgeschrittenerer Einsatz von Computerprogrammen in der sogenannten Dialektometrie. Auch hier ist das Ergebnis eine"computativ" hergestellte Kombinationskarte. Vor der maschinellen
Dialektologische Darstellungsmittel 63
Zeichnung der Karte werden aber die eingegebenen Daten gegeneinander "verrechnet". In der Regel sind dies Korrelationsberechnungen verschiedener gleicher oder ähnlicher Befunde. Es sind nicht mehr einzelne Laute oder Wortformen, sondern ganze Bündel von Lauten oder Wörtern und deren abgestufte Frequenzen. Die Dialektometrie verarbeitet also vor der Kartierung Sprachdaten zunächst einmal statistisch nach Vorkommenshäufigkeiten, bündelt ähnliche Befunde und lokalisiert diese auf der Karte. Es entstehen so abgestufte Areale als Hell-Dunkel- Kontraste oder verschiedene Schraffuren. Jedenfalls entstehen optische Grenz- verläufe zwischen verschiedenen Arealen, was man traditionell Sprachgrenze oder Isoglosse nennt. Dank Computer lassen sich solche statistisch errechneten Häufigkeiten oder Kombinationen auch kartieren. Das Ergebnis sind Kombinationskarten höheren Grades, welche stufenlose Übergänge und Tendenzen sichtbar machen, wie dies vorher nicht möglich gewesen ist.
Dialektometrie wird als dialektologische Darstellungstechnik hauptsächlich in der romanistischen Dialektologie gepflegt (s. Goebl [190], [191]). Es gibt aber auch schon einige deutsche dialektometrische Karten und Atlanten (Schiltz [193]).
Neuerdings werdenjedoch immer mehr auch dialektometrische Darstellungen mit deutschsprachigem Material versucht (Lausberg, Möller [192], Schiltz [193], KDSA [127]).
In der Dialektometrie müssen keine neuen Daten erhoben werden. Man kann die Belege der traditionellen Sprachatlas-Fragebücher, ja selbst die einzelnen Karten, oder auch Wörterbuchmaterialien als Grundlage nehmen. "Extra atlantes linguisticos nulla salus dialectometrica", heißt es bei Goebl [190, 39].
Dialektometrie hat kein eigenes Datenmaterial, sie strukturiert und verdichtet Daten, die in den gängigen Sprachatlanten schon vorhanden sind. Sie ist ein "heuristisches Typodiagnosticum" (Goebl [190], 68). Anhand verschiedener Kartentypen wie Ähnlichkeitskarte, Kennwortsynopsen, Wabenkarte, Strahlenkarte, Baumgraph u.a. können traditionell erhobene Daten verdichtet und in eine dritte Dimension gebracht werden. Auch ist es möglich, aus rein synchronen Sprachdaten mit Hilfe der Baumgraphentechnik eine Diachronie zu simulieren.
Die Ergebnisse sind optisch eindrücklich, vor allem, wenn sie gar dreidimensional gezeichnet sind. Die Prozedur selbst erfordert jedoch intimere computative Kenntnisse und Programm-Fähigkeiten, so dass Dialektometrie wohl immer die Sache einiger weniger Spezialisten bleiben wird (vgl. auch Kap. 6.1 Isoglossen).
Zum Stand der Dialektometrie
[190]Hans Goebl. Probleme und Methoden der Dialektometrie. In: Verhandlungen des
Internationalen Dialektologenkongresses. Bamberg, 29.7.-4.8.1990. Hrsg. von Wolfgang Viereck. Bd. 1: Plenarvorträge, Computative Datenverarbeitung, Dialektgliederung und Dialektklassifikation. Stuttgart 1993
[191]Hans GoebI. Dialektometrie und Dialektgeographie. In: [15] Klaus Mattheier,
Peter Wiesinger (Hrsg.), Dialektologie des Deutschen. Forschungsstand und Entwicklungstendenzen. Tübingen 1994, S. 171-191; vgl. auch Niebaum, Macha [18], Computative Verfahren S. 39-47 und Dialektometrische Dialekteinteilung,
S. 84-90

64Beschreibung und Darstellung von Mundarten
Dialektometrische Kartenwerke: KDSA [127]; ferner
[192]Helmut Lausberg, Robert Möller, Rheinische Wortgeographie. Karten des Rheinischen Wörterbuchs und ihre computative Auswertung. In: Rheinische Viertel- jahreshefte 60,1996, S. 263-293 u. 61,1997, S. 271-286
[193]Guillaume SchUtz, Der dialektometrische Atlas von Südwest-Baden. Konzepte
eines dialektometrischen Informationssystems. 4 Ede. Marburg 1996 (nach
Materialien des Südwestdeutschen Sprachatlas SWSA II26]
5. Grammatische Beschreibung von Mundart
5.0 Vorbemerkung
Viele Darstellungen der Probleme der Mundartforschung befassen sich ausschließlich mit der In-Beziehung-Setzung von Sprache mit außersprachlichen Faktoren. Dabei wird die grammatische Aufbereitung der sprachlichen Seite meistens als gegeben und problemlos hingestellt. Bei dem heute überall geforderten Theorieund Methodenbewusstsein muss eine Einführung in die Dialektologie auch eine Bestandsaufnahme der grammatischen Beschreibungsmöglichkeiten dialektaler Sprache bringen. Wenn auch das Interesse der Dialektologen immer über die rein sprachliche Äußerung und deren grammatischer Analyse hinausgeht auf Vergleich mit anderen Gegebenheiten und auf ursächliche Deutung, so müssen diese Äußerungen zunächst als sprachliche Elemente mit linguistischen Kriterien beschrieben und kategorisiert werden. Die folgenden Abschnitte sollen daher die einzelnen Teilbereiche der grammatischen Beschreibung der Mundart in den wichtigsten Vorgehensweisen der Reihe nach durchgehen. Es soll dantit auch ein Beitrag geleistet sein für die Operationalisierung der sprachlichen Variablen überhaupt. die bei den bisher vorliegenden Arbeiten auf soziolinguistischem Gebiet außerhalb der Dialektproblematik gegenüber dem soziologischen und statistischen Teil erheblich abfällt.
5,1 Phonetik I Phonologie
5,1,1 Abstammungsund Bezugsgrammatik
Die ersten wissenschaftlichen Darstellungen der Dialekte galten den "Buchstaben" und Lauten. Dabei war nicht klar, nach welchem Einteilungsprinzip man vorge-
hen wollte. Man vermischte zeitgenössische, historische, hochsprachliche und dialektale Laute untereinander zu einem großen Kapitel "a" oder "e". ~~i\.~~4, war jedoch Dialektologie die Erforschung früherer Sprachstufen durcli$ie zeitge- o~ nössischen Dialekte hindurch. Aus der Erfahrung, dass innerhalb dti? d\3Wl,hjin! "" Sprachgebietes zwar weithin dieselben Wörter gelten, dass diese ij$er lB. la~ri1C ,::$
<P |
... |
~. |
.~ |
<~ |
r'f>t.::i |
1'1ti1· Ge&

66 Grammatische Beschreibung von Mundart
einen oder andern Laut sich unterscheiden, war die Kennzeichnung der Dialekte am ehesten durch die Zusammenstellung der speziellen, typisch bairischen, fränkischen oder alemannischen Laute in vergleichbaren Wörtern zu erreichen.
Die weitere Entwicklung der Dialektgrammatiken suchte nach einem gemeinsamen Ordnungsprinzip, nach dem die Laute eines Dialekts in ihrer Einmaligkeit und Verschiedenheit dargestellt werden konnten. Dieses Ordnungsprinzip fand man in der überlieferten Sprachstufe des Mitteloder Althochdeutschen. Die einzelnen Laute eines Dialekts wurden in Beziehung gesetzt zu den historischen
Lauten und als identisch oder abweichend beschrieben. Die Abweichung wurde dabei meistens als Ergebnis einer lautlichen Entwicklung von der Vorstufe zu dem betreffenden Dialekt interpretiert. Man könnte mit einem Terntinus der strukturellen Dialektgeographie diese Art von Lautgrammatiken mit historischem Bezugssystem als Abstammungs- oder Bezugsgrammatiken bezeichnen.
In der Abstammungsgrammatik wird einem bestimmten Laut des Dialekts sein mitteloder althochdeutscher Vorgänger beigeschrieben. Hierfür muss jedes Wort Laut für Laut auf seine ältere Sprachstufe zurückgeführt werden, d.h. etymologisiert werden. Ein Dialektwort wie z.B. ostschwäbisch strauss ("Straße") wird auf die historische Vorstufe des Mhd. straze oder des Vorahd. strata zurückgeführt. Die lautlichen Differenzen Ist - stl, la - aul, I-a, -e - 01 geben dann für jeden Dialektlaut dessen Abstammung an.
Auch die Bezugsgrammatik setzt die Dialektlaute in Beziehung zu den mhd. oder vorahd. Entsprechungen. Nur geht man jetzt von dem historischen Laut als dem eigentlichen Einteilungsprinzip aus. Das historische Lautsystem ist die Basis, auf die hin alle dialektalen Lautsysteme projiziert werden. Der Ausgangspunkt ist in jedem Fall der historische Laut. Da aber in ein und demselben Dialekt ein mhd. Laut verschiedene Nachfolger haben kann, da sich die Laute je nach Umgebung und selbst auch unter lautlich gleichen Bedingungen in einzelnen Wörtern verschieden entwickelt haben, ist man davon abgekommen, die Beziehung Mhd. - Dialekt etwa in der Relation mhd. straze - schwäbisch strauss als eine einfache "wird-zu-Bezie- hung" (a > au) aufzufassen, zumal man den tatsächlichen Lautwert des mhd. a nicht kennt und über die wirklichen phonetischen Vorgänge daher nichts Genaues angeben kann. Das mhd. Lautsystem, wie es als Einteilungsprinzip auch heute in den Lautgrammatiken verwendet wird, war wohl nie ein tatsächlich gesprochenes Lautinventar. Es ist aus den literarischen Texten mhd. Dichtung, die von den Herausgebern des 19. Jahrhunderts idealisiert worden sind, in Richtung auf eine mhd. Einheits-Literatursprache abstrahiert worden. Gerade in dieser unwirklichen Idealisierung eignet sich das mhd. Lautsystem als Bezugsgröße für alle Dialekte vorzüglich, selbst wenn der einzelne Dialekt nicht der direkte Nachkomme der mhd. Laute sein sollte. Man sagt jetzt: mhd. il wird im Schwäbischen repräsentiert durch au im Wort strauss, bzw. schwäb. au im Wort strauss ist ein Reflex von mhd. il. Wie der lautliche Vorgang il zu au abgelaufen ist. wird dabei nicht gesagt.
Seit der lautphysiologischen Richtung, die auf experimental-phonetischer Basis die Dialektlaute analysierte, war die Kennzeichnung und Klassifizierung der
Phonetik I Phonologie 67
einzelnen Laute sehr viel exakter geworden. Die Einteilung der historischen Bezugssysteme wird seitdem nach ihren artikulatorischen Merkmalen und nicht nach der Reihenfolge im Alphabet vorgenommen. Für die Konsonanten verwen _ det man den vorahd. Stand als Bezugsgröße, da die Dialekte sich in mhd. Zeit gerade im Konsonantismus durch die unterschiedliche Teilhabe an der zweiten Lautverschiebung schon sehr weit auseinanderentwickelt hatten und die gemein- same virtuelle Basis daher in vorahd. Zeit zurückverlegt werden muss.
Das historische Bezugssystem, das den meisten Dialektgranunatiken zugrunde liegt, lässt sich so schematisieren:
Mhd. Vokale:
i, 1 |
Ü,U |
|
li,li |
ie |
UD, üe |
e, e |
ö/o |
|
0,6 |
ei |
ou,öu |
|
|
|
|
|
|
ä, ae |
|
a, ä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorahd. Konsonanten
Labiale: |
p |
b |
f |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dentale: |
t |
d |
P |
s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gutturale: k |
|
g |
|
|
h |
|
|
|
|
Liquide: |
|
|
|
|
1 |
r |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Nasale: |
|
|
|
|
|
m |
n |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Halbvokale: |
|
|
|
|
|
w |
j |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voraussetzung für die Verwendung des mhd. und vorahd. Bezugssystems ist die Kenntnis der Etymologie der Dialektwörter, d.h. die richtige Zuordnung von Dialektlaut und historischem Bezugslaut. Die historisch-etymologischen Wörterbücher, die es für die Hochsprache und für einzelne Dialekte gibt, helfen der richtigen Zuordnung. Unbedingte Voraussetzung zur Benutzung der etymologischen Hilfsmittel ist noch die Kenntnis der Lautges'etze, d.h. der gesetzmäßigen historischen Entwicklungen, die im Laufe der Geschichte der deutschen Dialekte und der deutschen Einheitssprache stattgefunden haben. Eine dialektale Lautgrammatik wäre auch denkbar mit den Lauten der neuhochdeutschen Schriftsprache als Bezugssystem. Die Laute des Neuhochdeutschen dienten als Einteilungsprinzip, die Laute der einzelnen Dialekte würden gegenüber den hochdeutschen Lauten kontrastiert. Dieses Verfahren hat sich als wenig brauchbar erwiesen, da die Beziehungslinie Hochdeutsch - Dialekt in den seltensten Fällen eine Entwicklungsrichtung darstellt. Das Hochdeutsche ist nicht die unmittelbare VoroderNachstufe eines der lebenden Dialekte. Die Hochsprache ist die gesprochene Form einer ursprünglich schriftlichen Kunstsprache, die ihre Elemente im Sinne einer nationalen Ausgleichsbewegung in unterschiedlichem Maße aus den einzelnen Dialekten nach dem Stand des 15.-18. Jahrhunderts erhalten hat. Als abstraktes Einteilungsprinzip wäre der Lautstand der deutschen Einheitssprache zwar denkbar. Die einzelnen Dialekte ließen sich auf diesem Hintergrund aber kaum miteinander vergleichen. Das historische Bezugssystem hat den großen Vorteil, dass es artikulatorisch doch in vielfacher Weise die unntittelbare Vorstufe für viele Dialekte darstellt im Sinne einer Stammbaumtheorie, wie sie J. Grimm
