
Lffler_Dialektologie
.pdf
68 Grammatische Beschreibung von Mundart
entwickelt hat, nach der sich aus einem Sprachstamm (Urdialekt) im Laufe der Zeit mehrere Äste (historische Dialekte) mit verschiedenen Zweigen (gesprochene Dialekte bzw. Mundarten) herausentwickelt haben. Selbst wenn diese monogenetische Theorie von der Entstehung der deutschen Sprache im Einzelnen nicht stimmt, gewährleistet das historische Bezugssystem in seiner Ordnungsfunktion eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Dialekte und vermittelt noch einen Einblick in mutmaßliche lautliche Entwicklungen und Bewegungen.
Das eigentliche Anliegen der Bezugsgrammatiken war anfangs die Verifizierung der junggrammatischen These, dass bestimmte lautliche Entwicklungen in der Zeit immer gleich ablaufen. Man leitete aus dem Vergleich Mhd. - Dialekt allgemeine Prinzipien der Lautentwicklung als Lautgesetze ab, z.B. mhd. i > schwäbisch ei oder Nasal vor Spirans schwindet im Oberdeutschen mit Ersatzdehnung des Vokals: aus mhd. gans wird obd. giis. Über den eigentlichen Ablauf der lautlichen Entwicklung, deren Anfangsund Endpunkte die Bezugsgrammatik markierte, also wie aus einem ehemaligen ei in stein ein dialektales Og im Wort stoa wurde, konnte die Bezugsgrammatik keine Auskunft geben. Die artikulatorischen Merkmale des Ausgangslautes ei waren nicht bekannt und Zwischenstufen der Entwicklung von ei zu oa nicht belegt. Die gelegentliche Kenntnis solcher historischer Zwischenstufen aus historischen Quellen und die Erfahrung, dass
Lautunterschiede von Ort zu Ort sich immer nur in kleinsten artikulatorischen
Schritten vollziehen, führte dazu, dass man die lautgesetzlichen Entwicklungen als eine Folge von ganz allmählich sich verschiebender Artikulatorik erkannte, die keine Sprünge duldete. Die artikulatorischen Zwischenstufen zwischen der Anfangsund Endstellung einer Lautentwicklung ließen sich daher theoretisch postulieren. Eine vollständige Lautentwicklung jedes Dialektes war aber nicht das Ziel der Bezugsgrammatiken. Es sollten nur die auffälligsten Lautmerkmale der Dialekte, wodurch sie sich voneinander abhoben, als jeweils verschiedene Entwicklungsstufen in Bezug auf ein gemeinsames Ausgangssystem beschrieben werden. Ziel war nicht die vollständige Lautgrammatik, sondern die Abgrenzungen lautlicher Art als Außenund Innengliederung der deutschen Dialekte.
Eine klassische Bezugsgrammatik des Deutschen ist
[1941 Hermann Paul, Deutsche Grammatik. 5 Bde. Halle 1916-1920 '1956; davon die
Kurzfassung:
[195]Hermann Paul, Heinz Stolte, Kurze deutsche Grammatik. Tübingen 31962
Zur Etymologie: Grimm, Dt. Wörterbuch [45], Kluge [51] und die -regionalen Wörterbü- cher s. Kap. 5.4.5 Einführung in die historische Grammatik:
[196]W. Günther Rohr, Einführung in die historische Grammatik des Deutschen.
Hamburg 1999
Beispiele für dialektologische Bezugsgrammatiken finden sich in fast allen Dialektarbeiten der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, vor allem in den zahlreichen Dissertationen mit dem Titel 'Laute und Flexion von ... '. Vgl. auch die Bände der
··r"'··',
•
I
I
Phonetik / Phonologie 69
Reihe BSG [32]. Für einen größeren Dialektraum als Zusammenfassung der vorliegenden EinzelBezugsgrammatiken:
[197]Leo Jutz, Die alemannischen Mundarten. Abriss der Lautverhältnisse. Halle 1971; für den gesamtdeutschen Sprachraum zusammenfassend Schirrnunski [7].
5.1.2Phonologische Analyse
Durch die Phonologie als die strukturalistische Richtung der Lautbeschreibungswissenschaft wurde eine vollständige Bestimmung des Lautcharakters und eine systematische Inventarisierung aller Laute eines Dialekts methodisch exakt möglich. Die Phonologische Methode kann eine systematische Beschreibung einer Einzelmundart und den Vergleich mehrerer Mundarten untereinander leisten, ohne die Bezugnahme auf ein historisches System. Die Möglichkeit einer Bezugsgrammatik im herkönnnlichen Sinn braucht dennoch nicht aufgegeben zu werden, da sich auch das historische Bezugssystem als phonologisches Dia-System darstellen lässt.
Seit N.S. Trubetzkoys im Jahre 1939 erschienenen 'Grundzügen der Phonologie' [133] haben vor allem die Forschungen des Prager Linguistenzirkels und auch die Linguisten aus dem angelsächsischen Bereich die Phonologische Methode weitergetrieben. In Deutschland, wo durch Sievers [92] und seine phonetische Schule gerade die experimentalphonetischen Voraussetzungen für eine Phonologische Systematisierung gelegt worden waren, fand die Phonologie erst sehr spät und zögernd Eingang in die dialektologischen Forschungen und in die Linguistik überhaupt. Erst nach 1950 wurden die ersten Dialektarbeiten auf phonologischer Grundlage vorgelegt. Zu lange war die sprachwissenschaftliche Methode und damit auch die Ausbildung ausschließlich lauthistorisch ausgerichtet gewesen.
Die Phonologie ist eine synchrone Beschreibungsmethode. Sie versucht, die Vielfalt an Lauten, die innerhalb derselben Sprache tatsächlich realisiert werden und die man in ihrem physikalisch-akustischen Charakter genau vermessen kann, durch sinnvolle Klassifizierung auf den notwendigen Bestand derjeniger Laute zu reduzieren, auf die es bei der sprachlichen Kommunikation ankommt, die man meint, wenn man spricht. Selbst wenn ein [al durch Schnupfen oder Heiserkeit oder durch Stimmbruch eine ganz individuelle Note bekommt, hat es doch für jeden Hörer bestimmte Merkmale, die es eindeutig als [a] kennzeichnen. Aus den 100 bis 200 möglichen phonetischen Realisationen einer Sprache kann durch eine Reduktion auf die von allen Sprechern gemeinten Grundlaute die Zahl der eigentlich entscheidenden Laute auf 40 bis 50 eingeschränkt werden. Terminologisch unterscheidet man das Phon als die tatsächliche Realisierung eines Lautes und das Phonem als die Klasse aller Laute (Phone), die in derselben Weise bedeutungsdistinktiv sind. Phoneme sind also die Laute oder Lautklassen, die bewirken können, dass ein Wort eine bestimmte Bedeutung hat oder bei Austausch dieses Phonems die Bedeutung verliert. So ist der Laut [i] in /Kiste/ ein Phonem, da ein Austausch (Substitution) des [i] etwa durch [ü] das Wort !Küste! ergibt, also eine

70 Grammatische Beschreibung von Mundart
andere Wortbedeutung bewirkt. lil und lül sind im Deutschen vokalische Phoneme. Die tatsächliche phonetische Realisierung eines Phonems, also der gesprochene Laut, wird üblich erweise in eckige Klammem gesetzt, z.B. ein spitzes [i] oder ein mehr nach [e] hin geöffnetes Ul in IKistel. Man nennt diese Realisierungen eines Phonems Allophone. Im Deutschen ist der Allophoncharakter des Zungenund Zäpfchen-R besonders auffällig. Beide [R, r] bilden zusammen das Phonem Irl, obwohl sie lautlich-artikulatorisch sehr weit auseinanderliegen. Aber kein Wort im Deutschen ändert seine Bedeutung durch den Austausch des Zäpfchen -R durch Zungen-r und umgekehrt. Kommen Allophone eines Phonems immer nur an bestimmten Stellen vor, das eine etwa nur im Wortanlaut das andere nur im
Inlaut, so spricht man von komplementär distribuierten Allophonen. Bei nicht geregelter Distribution spricht man von freien Allophonen oder Varianten.
Das Ziel einer phonologischen Analyse ist die Aufstellung eines Inventars aller vokalischen und konsonantischen Phoneme einer Sprache und deren systematische Ordnung als Lautstruktur. Daneben gehört zur phonologischen Analyse die Beschreibung der Distribution jedes einzelnen Phonems und seiner Allophone, d.h. deren Vorkommen in bestimmten lautlichen Umgebungen und die Häufigkeit ihres Vorkommens überhaupt (Frequenz). Für das Auffinden der Phoneme einer Sprache oder eines Dialekts bildet man Wortpaare wie das Beispiel IKiste/: IKüstel, die sich nur durch einen Laut unterscheiden, der jedem Wort seine eigene Bedeutung vermittelt. Man nennt solche Paare, deren unterschiedliche Bedeutung nur von einern Phonem abhängt, Minimalpaare. Die bedeutungsdistinktiven Phoneme stehen dabei in Opposition. Bei einern Minimalpaar Igebenl : Igaben/, Inehmenl : Inahmenl stehen die Phoneme lei: lai und liY : läl in Opposition. Für eine phonologische Analyse muss ein genügend großes Wortrnaterial oder die eigene Sprachkompetenz zur Verfügung stehen, da jeder Laut mit jedem kontrastiert werden und eine Entscheidung über gleichbleibende oder veränderte Wortbedeutung getroffen werden muss. Als Darstellungsform einer Minimalpaaranalyse hat sich folgendes Schema bewährt, indern die phonologischen Oppositionen und die zugehörigen Minimalpaare auf einen Blick ersichtlich sind.
e |
~ |
~ |
u |
0 |
Q |
a |
bid |
bid |
miSn |
wind |
friS |
bid |
wiSn |
bed |
b~d |
ffi'ldn |
wund |
fros |
bQd |
wasn |
e |
bed |
lefe |
wend |
slesa |
bed |
mes |
|
b~d |
I~fn |
wund |
slosa |
bQd |
mas |
|
~ |
r~hn |
b~da |
r~dn |
b~da |
I~dn |
|
|
r~hn |
buda |
forln |
bQda |
ladn |
|
|
~ |
sd~bn |
I~dn |
s~g |
s~fa |
|
|
|
sdubn |
lodn |
SQg |
safa |
|
|
|
u |
slus |
nus |
hund |
|
|
|
|
5105 |
nQs |
hand |
|
|
|
|
0 |
blas |
owa |
|
|
|
|
|
blQs |
awa |
|
|
|
|
|
Q |
Qwa |
|
|
|
|
|
|
a |
Phonetik / Phonologie 71
Das Beispiel stammt aus Gladiator [109, 20] und bringt den Vokalismus einer mittelbairischen Mundart. (Die API-Schrift wurde dabei in die von Teuthonista umgeändert, s. Kap. 4.2.1).
Als Ergänzung vor allem für ortsfremde Benutzer sollten den mundartlichen Minimalpaaren die schriftsprachlichen Übersetzungen beigegeben werden, damit die Bedeutungsdifferenz zwischen den Minimalpaaren ersichtlich ist, z.B. owa : awa 'hinab" : "aber". Aus der Minimalpaaranalyse ergibt sich das Inventar der Phoneme, die nach ihren artikulatorischen Merkmalen in ein System gebracht werden. Zur eindeutigen Bestimmung und Abgrenzung der Phoneme untereinander genügen jeweils zwei artikulatorische Merkmale, die Zungenstellung und die Zungenhöhe, von denen mindestens eines sich vorn Nachbarphonem unterscheiden muss. Man spricht darin vorn distinktiven Merkmal eines Phonems. Das Vokalsystem aus der obigen Minimalpaaranalyse sieht dann so aus:
|
|
Artikulationsstelle: |
|
Zungenstellung |
vorne |
Mitte |
hinten |
hoch |
lit |
|
lul |
mittel |
lei |
|
lai |
halbtief |
I~I |
|
IQI |
tief |
I~I |
|
lai |
|
|
|
|
Das Vokalphonemsystem des Hochdeutschen sieht dagegen so aus:
|
|
|
|
|
Artikulati0 nssteIle: |
|
|
Zungenstellung |
|
|
vorne |
Mitte |
hinten |
|
kurze Vokale: |
hoch |
lil |
lül |
|
lul |
|
|
mittel |
I~I |
11)1 |
|
IQI |
|
|
tief |
|
|
lai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lange Vokale: |
hoch |
111 |
lul |
|
lul |
|
|
mittel |
lei |
/0/ |
|
löl |
|
|
tief |
lai |
|
lai |
|
|
|
|
|
|
|
|
Je nach Anordnung der Phoneme spricht man von zwei-, dreioder vierstufigen Systemen, von Viereck- (das obere) oder Dreiecksystemen (das untere). Die Diphthonge ai, oi, ou, die im Hochdeutschen vorkommen, werden außerhalb dieser Merkmalskoordinaten gestellt. Für manche ist strittig, ob die Diphthonge überhaupt als Phoneme oder nicht vielmehr als Kombination zweier Phoneme zu werten sind.

72 Grammatische Beschreibung von Mundart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Phonetik / Phonologie 73 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Eine andere Darstellungsfarm eines Lautinventars ist die Merkmalsmatrix. Die |
|
|
|
ten. Bei einer gewissen Sicherheit in der Merkmalsbeschreibung lassen sich dann |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkmale werden auf einer Zeile abgetragen und für jeden Laut mit + oder - |
|
|
|
abweichende Bezeichnungssysteme leicht in das einmal erlernte umsetzen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
markiert, z.B. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach der Phonemanalyse, die zum Phoneminventar und -system führt, folgt |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
die sogenannte Distributionsanalyse. Hierzu wird ein noch umfangreicheres Sprach- |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mitte |
hinten |
|
gerundet ete. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
hoch |
mittel |
tief |
vorne |
|
|
|
|
material benötigt als zur Minimalpaarbildung. Man unterscheidet zunächst die |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wortstellungen: Anlaut, Inlaut, Auslaut. Manche Phoneme, wie z.B. das hoch- |
|||||||||||
|
e |
|
|
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
deutsche [<;] stehen nie |
im Anlaut, |
andere |
hingegen |
ausschließlich, |
wie das |
|||||||||||
|
a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
hochdeutsche [j]; |
[j] und [<;] sind jedoch keine komplementär distribuierte Allo- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
u |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
phone eines Archiphonems, sondern zwei verschiedene Phoneme, denn man sagt, |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dass Allophone mit ihren artikulatorischen Merkmalen nahe beisammen liegen |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
müssen. Ist das nicht der Fall, spricht man von Phonemen, selbst wenn sie wie Ijl |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
und 1<;/ komplementär distribuiert sind. Die weitere Distributionsanalyse beachtet |
||||||||||
|
Bei den Konsonanten kommt man mit denselben Prozeduren zum Phonemi~ven |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
die Kombinationsmöglichkeiten von Vokalund Konsonantenphonemen in den |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
tar, das sich wiederum nach artikulatorischen Merkmalen in ein System bnnge.n |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
verschiedenen Stellungen im Wort, z.B. Konsonant vor Vokal anlautend, abge- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
lässt. Auf der Waagrechten werden wieder die Artikulationsstellen vermerkt, dIe |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
kürzt: KVoder KKV-, KKKVusw. Nicht alle Phoneme können alle Verbindun- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
bei den Konsonanten allerdings differenzierter sind, auf der Senkrechten werden |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
gen eingehen. In den Verbindungsmöglichkeiten der Phoneme unterscheiden sich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
die Artikulationsarten angegeben. Als Beispiel soll das Konsonantensystem der |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Sprachen und Dialekte oft ganz erheblich, obwohl sie prinzipiell identische oder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deutschen Hochlautung dienen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fast identische Phonemsysteme haben. |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zur Darstellung der Distributionsverhältnisse hat sich ebenfalls die Matrixform |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
labial |
labio- |
dental |
|
|
|
|
|
palatal |
velar |
uvular |
glottal |
|
|
|
|
|
als praktisch und übersichtlich erwiesen: Distribution der Konsonanten: KKKV- |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bilab. |
dental |
alveol. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(drei Konsonanten var Vokal) nach M. Philipp [199] 201) in der deutschen |
|||||||||||||||||
|
|
|
Plosive (Verschlusslaute) |
|
b |
|
|
d |
|
|
|
|
|
|
|
|
g |
|
|
|
|
|
|
|
|
I; |
|
Hochlautung: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
stimmhaft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
k |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
stimmlos |
|
|
|
|
|
|
p |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ps |
ks |
ft |
st |
|
nt |
kt |
tst |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Frikative (Reibelaute) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
v |
z |
|
|
j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
k |
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
stimmhaft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
stimmlos |
|
|
|
|
|
|
|
|
f |
s |
|
|
S, |
|
x |
|
|
|
|
|
h |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Affrikaten |
|
|
|
|
|
|
|
|
pf |
ts |
|
|
ts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
n |
|
|
|
U |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
+ |
|
||||||||||
|
|
|
Nasale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Liquide |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Laterale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Distributionsanalyse ist die aufwendigste und zeitraubendste Prozedur der |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Vibranten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R |
|
|
|
|
|
|
|
|
phonologischen Beschreibung. Hier werden die Möglichkeiten der maschinellen |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
DeI Anfänger wird zunächst Schwierigkeiten haben, die Laute mit Hilfeder |
|
|
|
|
Bearbeitung eine erhebliche Erleichterung bringen, zumal für derartige mecha- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
nische Ordnungsarbeiten kein aufwendiges Programm erforderlich ist, sondern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
menschlichen Stimmwerkzeuge zu beschreiben und zu klassifizieren. Daruber |
|
|
|
|
nur die einmalige Arbeit des Eingebens der Sprachdaten. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
hinaus wird es ihm dadurch noch schwer gemacht, dass in fast jeder Darstellung |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
der artikulatorischen Phonetik eine andere Terminologie verwendet wlfd und |
|
|
|
|
Zur artikulatorischen Phonetik und Phonologie: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
jedermann glaubt, immer weitere Merkmalsbezeichnunge~ hinzufügen oder |
|
|
|
[198] |
Eugen Dieth, Vademekum der Phonetik. f-bgnetische Grundlagen für das wissen- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
umdefinieren zu dürfen. Statt stimmloser Verschlusslaute fmdet man z.B. dIe |
|
|
|
|
|
schaftliche und praktische Studium der Sprachen. Bern 21962 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
[199] |
Marthe Philipp, Phonologie de l'Allemand. Paris 1970 (mit vielen Beispielen zu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Bezeichnungen Plosive oder Okklusive oder Tenues. Hierdurch wird der Zugang zur |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
allen Oppositionen und Distributionen der deutschen Phoneme) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Phonetik und Phonologie für viele unnötig erschwert. Es empfiehlt sich daher, die |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
[200] |
Thomas Hengartner, Jürg Niederhauser, Phonetik, Phonologie und phonetische |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Terminologie einer einzelnen Darstellung sich anzueignen und diese beizubehal- |
|
|
|
|
|
Transkription. Aarau, Frankfurt a. M. 1993 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
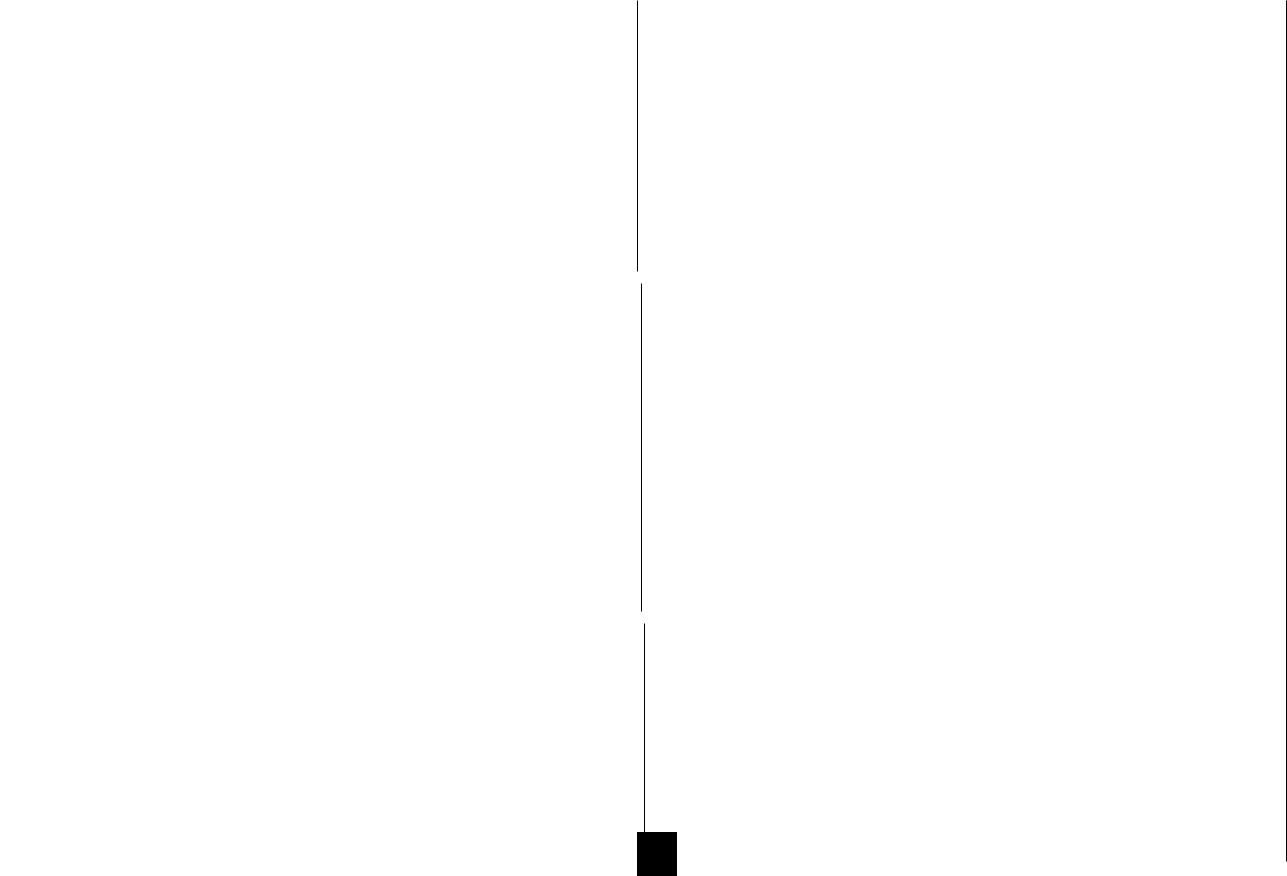
74Grammatische Beschreibung von Mundart
[201]Klaus J. Kohler, Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin 21995 (mit Einführung in die Phonologie)
[202]Gottfried Meinhold, Phonematik. In: Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache.
Hrsg. von Wolfgang Fleischer, Gerhard Helbig, Gotthard Lerchner. Frankfurt a. M.
2001, S. 310-350
Kürzere Abrisse zur Phonetik/Phonologie finden sich in fast allen Einführungen in die
Linguistik.
Zum Thema Phonologie und Dialekte:
[2031 Jean Fourquet, Phonologie und Dialektologie. In: Zeitschrift für Mundartfor- schung 26,1958, S. 161-173
[204]Nikolaj S. Trubetzkoy, Anleitung zur phonologischen Beschreibung (Lautbibliothek der deutschen Mundarten [77] 2), Göttingen '1958
Beispiele für phonologische Arbeiten über deutsche Dialekte:
[205]Byron J. Koekkoek, Zur Phonologie der Wiener Mundart. Giessen 1955
[206]Georg Reike, Zur Phonologie der Stadtkölner Mundart. Marburg 1964
[207]Horst Singer. Die Mundarten der Höri. Untersuchungen zur Lautgeographie und Phonologie. Freiburg 1965
[208]Hans Jochim Schädlich, Phonologie des Ostvogtlänmschen. Berlin 1966
[209]Gilbert Lü~bray, Das phonologische System der Oftersheimer Mundart. Marburg
1969
Vgl. auch Iwar Werlen [136]
[210]Peter Auer, Phonologie der Alltagssprache. Eine Untersuchung zur Standard/Dia- lekt-Variation am Beispiel der Konstanzer Stadtsprache. Berlin 1990
5.1.3Akustische Phonetik / Phonologie
Die artikulatorische Phonetik gibt für die einzelnen Laute an, an welcher Stelle oder auf welche Weise sie mit den Sprechwerkzeugen hervorgebracht werden. Die akustische Phonetik, die für eine elektronische Analysemöglichkeit komplexer physikalischer Schalleindrücke entwickelt wurde, beschreibt nicht die Art der Hervorbringung, sondern den physikalisch-akustischen Status der Schallereignisse. Sie gibt die als Kurven und Frequenzbündel abbildbaren physikalischen Eigenschaften der Laute an (visible speech). Jeder menschliche Laut besteht aus einer kontinuierlichen Abfolge sogenannter Formanten. Darunter versteht man bestimmte Frequenzhündel. die auf dem Messgerät (Sonagraph) für bestimmte Laute charakteristisch sind undjeweils in einer immer gleichbleibenden Lagerung zueinander erscheinen. Diese physikalisch messbaren Eigenschaften sind zwar sehr viel genauer als die artikulatorischen Merkmale, sie haben aber den Nachteil, dass sie nur instrumentell bestimmbar und nachprüfbar sind. Die typischen Frequenzbilder, die sich auf dem Bildschirm für jeden menschlichen Laut ergeben, wurden von Jakobsan und Halle [211] als akustische Merkmale definiert. Die englische Terminologie wurde dann von Meyer-Eppler 1959 [212] ins Deutsche übersetzt. So bekommen bestimmte Spektrogramme Namen wie "gespannt",
"dunkel", "kompakt", "scharf". Damit sollen aber keineswegs Gehörseindrücke
Phonetik / Phonologie 75
beschrieben werden, die man umgangssprachlich mit diesen Bezeichnungen in Verbindung bringt. "Dunkel" meint vielmehr artikulatorisch "hinten am Gaumen", also velar, "gespannt" meint "von längerer Dauer". Die Merkmalbestimmung von Lauten lässt sich also akustisch nur mit Hilfe einer technischen Apparatur bestimmen. Nach dem Gehör ist eine akustische Merkmalbestimmung nicht möglich. Wenn dies dennoch gelegentlich geschieht, dann handelt es sich einfach um die "Übersetzung" der artikulatorischen Merkmale in die akustische Terminologie, wohei so gut wie nichts gewonnen ist, im Gegenteil, die akustischen Termini sind vom Leser nicht nachzuvollziehen, bevor er sie nicht wieder in die artikulatorische Terminologie rückübersetzt hat.
In der Phonologie hahen sich die akustischen Merkmalsbezeichnungen nicht recht durchsetzen können, wohl aus der genannten mangelnden artikulatorischen und auditiven Nachvollziehbarkeit. Hinter der spektrographischen Terminologie steckt natürlich die Hoffnung, dass man Laute elektronisch quantifizieren und auf umgekehrtem Wege über ein Regelsystem wieder "nachbauen", d.h. synthetisieren kann. Will man aber nicht Sprache synthetisieren, sondern nur Dialekte beschreiben, so genügt die artikulatorische Phonetik durchaus. Der Durchschnittsdialektologe wird durch die akustische Terminologie, besonders wenn sie nicht auf apparativen Messungen beruht, sondern eine bloße Übersetzung der artikulatorischen Merkmale darstellt, eher verwirrt als gefördert. Selbst die generative Phonologie ist, wenn man nicht tatsächlich Sprach-Synthesizer hauen will, nicht auf die akustischen Merkmale angewiesen. Die mehr oder weniger gekonnten Versuche, in der Dialektologie mit der akustischen Terminologie zu arbeiten, sind bis jetzt den Beweis schuldig geblieben, in der Dialektbeschreibung wirklich neue Aspekte eingebracht zu haben.
[211]Roman Jakobson, Morris Halle, Phonologie und Phonetik. In: Dies., Grundlagen der Sprache (Fundamentals 01 Language). BerlinlOst 1960
[212]Werner Meyer-Eppler, Georg Heike, Grundlagen und Anwendungen der Informa- tionstheorie. Heidelberg 21969; Zur akustischen Phonetik: u.a. Kohler [201J,
S. 1-79
Arbeiten auf der Basis der akustische Terminologie:
[213]Werner H. Veith, Dialektkartographie auf der Grundlage der kontrastiv-trans- formationellen Methode. In: Germanistische Linguistik 4, 1970, S. 389-497; Heike
[206]; Wurzel [216]
[214]Joachim GöscheI, Strukturelle und instrumentalphonetische Untersuchungen zur gesprochenen Sprache. Berlin 1973
5.1.4Generative Phonologie
Die generative Phonologie ist eine Teilkomponente der generativen Grammatik. Sie hat die Funktion, den lexikalischen Elementen (Wörtern), deren syntaktische Struktur durch Formationsund Transformationsregeln festliegt, eine phonologi-

76Grammatische Beschreibung von Mundart
sche, d.h. konkret phonetische Realisation zuzuweisen. Das generative Prinzip fasst alle sprachlichen Einheiten auf als das Ergebnis von Regeln, die gewissermaßen als Arbeitsund Konstruktionsanweisungen sprachliche Gebilde erzeugen. Dahinter steht die Idee, dass die unendliche Vielfalt sprachlicher Äußerungen auf ein endliches Corpus kleinster Elemente reduziert werden kann, die mit einer beschränkten Zahl von Anweisungsregeln zu sprachlichen Einheiten komponiert oder generiert werden. Die generative Phonologie regelt also die phonetischen Erscheinungsweisen von grammatisch tieferliegenden Prozessen der Erzeugung von syntaktischen, morphologischen und lexikalischen Strukturen. Die kleinsten Einheiten der generativen Phonologie sind nicht die Sprachsegmente, die man als Laute, Phone oder Phoneme bezeichnet, sondern deren akustische Merkmal- komponenten, aus denen sie sich zusammensetzen lassen. Der konkrete Laut ist schreibbar als ein Bündel von Merkmalen. Der Kontrast zwischen zwei Lauten
oder eine lautliche Veränderung lässt sich dann schreiben als zwei Merkmalbündel die sich in einem oder mehreren Merkmalen unterscheiden, z.B. lei (+ vokal + kompakt -dunkel-diffus), lil (+ vokalkompakt -dunkel + diffus). Der Unterschied zwischen lei und lil liegt dann in der Merkmaldifferenz (-diffus):
(+ diffus), (+ kompakt): (-kompakt).
Die generativen Regeln gehen davon aus, dass man jeden beliebigen Laut aus einem Inventar von nicht mehr als 16 Merkmalen zusammenbauen kann, wofür man die Form der Anweisungsregel benutzt: --> + vokal - kons + gespannt etc. Dahinter steht wieder die Modellvorstellung des Sprachcomputers, dem man nicht das Phoneminventar einer Sprache, sondern die 16 Merkmale als elektronische Bildbeschreibungen eingibt, die dann mit Hilfe der Erzeugungsregeln zu
einem konkreten Laut zusammengesetzt werden.
Die nach dieser Art für jeden möglichen Laut einer Sprache aufzustellenden Merkmalsmatrizen sind also vom Ansatz her für maschinelle Verarbeitung gedacht. Für nichtrnaschineIlen Gebrauch, also für die herkömmliche Beschreibung eines Dialekts, sind sie unpraktisch, weil unlesbar und nicht auf ihre Richtigkeit überprüfbar. So ökonomisch es wäre, wenn man bestimmte Lautveränderungen als Vorgänge im Merkmalsbereich diagnostizieren könnte, so unpraktisch ist die generative Phonologie in ihrem Anspruch auf explizite Beschreibung und Vollständigkeit. Dadurch wird ein Beschreibungsballast hereingetragen, der für einen nichtrnaschineIlen, d.h. menschiichen Leser nicht zu bewältigen ist und der in der krampfbaften Nachahmung des binären Computersystems recht unnütz wirkt, da extralinguistisch und heuristisch absolut nichts gewonnen wird. Da überdies die Mehrzahl der vorhandenen empirischen Dialektarbeiten artikulatorisch-phonolo- gisch angelegt sind, wäre für eine generative Umschreibung eine Neuaufnahme der meisten Sprachdaten erforderlich. Da aber innerhalb der neuesten Linguistik die Empirie nicht sehr gepflegt wird und sich niemand mehr der aufwendigen Mühe des Explorierens und des sprachlichen Modellsitzens unterziehen will, muss man auf traditionelle Dialektbeschreibungen zurückgreifen. Hier erweist sich für phonologische Umarbeitungen die artikulatorische Merkmalsbeschreibung als
Phonetik I Phonologie 77
brauchbarer. Die Bemerkungen zur generativen Phonologie betreffen nicht die Berechtigung des prinzipiellen Ansatzes, sondern nur die Frage der Adäquatheit als Beschreibungsinstrument für Dialekte. Hier wird das generative Prinzip nur insoweit breiteren Raum gewinnen, als es für diatopische, d.h. kartierbare Sprachprobleme entscheidend Neues bietet. Es wäre denkbar, dass sich komplizierte Bündel von scheinbar heterogenen Sprachlinien als Merkmalgrenzen einleuchtender darstellen lassen, was für die Deutung des Warum und Woher dann von Belang sein könnte (vgl. Kap. 6.2).
Die strukturalistischen Ansätze, insbesondere die Theorie der generativen
Grammatik, müssen innerhalb der Dialektologie auf ihre Tauglichkeit hin geprüft werden für die spezifisch dialektologischen Probleme, nämlich die rationelle Sprachdatengewinnung, deren Aufbereitung und komparative Analyse in der Dialektgeographie, Dialektgeschichte und Sozio-Dialektologie. Ein ohnehin nicht stark frequentiertes Fach kann sich eine esoterische Methode und Terminologie, die nicht mehr einbringt als die konventionelle, nicht leisten, da hierdurch den potenziell Interessierten jeglicher Zugang verwehrt wird. Die linguistischen Beschreibungsinstrumente müssen daher auch vom Aspekt der Lehrbarkeit und Benutzerfreundlichkeit her beurteilt werden. Die systemlinguistischen Prozeduren müssen zusehends an ihrer Leistung im pragmatischen Bereich, wozu auch die Dialektologie gehört, gemessen werden, sosehr sich die reinen Systemlinguisten gegen solche Bewertungsmaßstäbe auch wehren mögen. Den Beweis der pragmalinguistischen Leistungsfähigkeit ist jedoch die gesamte generative Theorie in allen Teilbereichen bis heute schuldig geblieben.
[215]Manfred Bierwisch, Skizze der generativen Phonologie. (Studia Grammatica 6).
Berlin 1967. Referiert Morris Halle, Phonology in Generative Grammar. In: Word
18, 1962, S. 54--72
Die umfangreichste Arbeit zur generativen Phonologie des Deutschen:
[216]WolfgangU. Wurzel, Studien zur deutschen Lautstruktur. (Studia Grammatica 8).
Berlin 1970
Vgl. auch Werlen [136]. Eine Kritik der Generativen Phonologie: Kohler [201]. S. 131-134
5.1.5Lautgeographie oder diatopische Phonologie
Die klassische Dialektgeographie befasst sich vornehmiich mit dem Phänomen der Lautgrenzen in der Landschaft. Dabei wird nicht einfach das Vorkommen eines bestimmten Lautes als Charakteristikum einer Ortsmundart oder einer Gegend registriert, sondern die verschiedenen Realisierungen oder Reflexe eines histori - sehen Bezugslautes. Die Lautgrenze, die das Schwäbische vom übrigen Aleman-
nischen trennt (111: lei! in wib : weib), ist genaugenommen eine Trennungslinie zwischen Orten, wo für mhd. i noch [I] gesprochen wird und solchen Orte~~iil 8'11<6
für mhd. i [eil gesprochen wird. Nach solchen Lautgrenzen, bezogen,:;;,<itf das ~
historische Lautsystem, sind die deutschen DialektIandschaften eingeteiltBDie 'he"
p....,; lbllOu L1o.
"(?,..
~i' fl7t:1
<Ir'ar Ge.~

78Grammatische Beschreibung von Mundart
klassischen Lautkarten als Darstellungsmittel der Dialektgeographie werden demnach auch als Abstammungsund Bezugskarten bezeichnet. Die dialektologisehen Großlandschaften Niederdeutsch und Hochdeutsch werden eingeteilt nach den verschiedenen Repräsentanten der vorahd. Verschiusslaute p, 1. k. Im Niederdeutschen gilt p, 1. k, im Hochdeutschen pf. f. z, sund ch. Innerhalb des Hochdeutschen wird nochmals das Mitteldeutsche vom Oberdeutschen wiederum nach den Repräsentanten von vorahd. p, t, k unterteilt. Wo diese Verschlusslaute durchweg in allen Stellungen und Wörtern verschoben sind, d.h. die hochdeutsche Lautverschiebung zeigen, spricht man vom oberdeutschen Dialekt. Das Mitteldeutsche hat dagegen in manchen Stellungen und Wörtern die unverschobene Artikulation noch erhalten, z.B. in pund und dorp (s. Kap. 6.2). Alle weiteren Unterund Feingliederungen werden nach Lautgrenzen vorgenommen. Der dialektgeographische Standort eines Ortes lässt sich somit durch eine Reihe von Lautgrenzen angeben, innerhalb derer der betreffende Ort liegt. Die Phonologie sucht statt der Einzellautgrenzen Systemgrenzen, d.h. sie zieht nur da Gren- zen, wo zwischen zwei Orten im Lautsystem echte Veränderungen nachweisbar sind. Systemunterschiede können sein: Unterschiedliche Zahl an Phonemen, unterschiedliche Zahl von Allophonen, Zusammenfall zweier Phoneme, Aufspaltung eines Phonems in zwei usw. Solche Systemgrenzen decken sich nicht unbedingt mit den herkömmlichen Lautgrenzen. Darstellungsmittel für phonologische Systemunterschiede sind die sogenannten Dia-Systeme. Im strengen Sinne sind auch die Einzellautgrenzen Systemgrenzen, denn der lautliche Unterschied zwischen einem Ort und seinem Nachbarort, z.B. [l] gegen [ei] ist ja auch bezogen auf den mhd. Laut i, d.h. im Grund wird ein mhd. Teilsystem des Vokalismus diasystematisch verglichen mit einem Teilsystem des Ortes A und des Ortes B. Der eigentliche diasystematische Vergleich setzt jedoch größere Teilsysteme gegeneinander. Der diatopische Vergleich setzt mindestens zwei Systeme oder Teilsysteme voraus, die sich durch den Aspekt Ort unterscheiden. Das mhd. Bezugssystem ist dabei grundsätzlich nicht nötig. Es hat sich jedoch als gemeinsame Basis, sozusagen als Null-Stufe, eingeführt, auf die hin alle übrigen Differenzen diasystematisch bezogen werden können. Ein solches Diasystem wird seit Weinreich
[134]in folgender Form notiert:
Mhd. Bezugssystem: |
- |
e |
- |
~ |
- |
ä |
- |
a |
- |
ü |
- |
ö |
- |
0 |
- |
u |
Dialekt l |
- |
e |
- |
~ |
- |
a |
- |
0 |
- |
i |
- |
e |
- |
0 |
- |
u |
Dialekt2 |
- |
e |
|
|
~ |
|
- |
a |
- |
i |
- |
e |
- |
0 |
- |
u |
oder kürzer: |
|
|
. |
~ |
- |
ä |
a |
- |
ü |
- |
ö |
|
|
. u |
||
|
• |
e |
~ |
- a - 0 |
" |
|
" |
e • |
0 |
|||||||
|
|
|
|
|
~ |
- |
a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Phonetik / Phonologie 79
Die beiden Dialekte haben ein identisches Phoneminventar, jedoch in unterschiedlicher Distribution im Wortschatz. Die unterschiedliche Distribution lässt sich als diasystematische Lautunterschiede zum mhd. Bezugssystem darstellen.
Die unterschiedliche Verteilung des identischen Lautinventars im Wortschatz kann zwischen zwei Dialekten schwerwiegende Verständnisschwierigkeiten hervorrufen, wenn z.B. in Dialekt, der 'Hase' /Hos/ heißt, in Dialekt, tHost aber 'die Hose' bedeutet.
Wie kompliziert solche kommunikativen Barrieren bei gleichem Phoneminventar sind, hat P. Trost [218] zu systematisieren versucht. Er unterscheidet die vier häufigsten Möglichkeiten distributioneller Unterschiede zwischen zwei Dialekten (hier vereinfacht wiedergegeben):
l.P~
2.~~
3.P~;
4'~=~
Alle Wörter in A mit dem Phonem p haben in B das Pho- nem q und umgekehrt
Alle Wörter von A mit dem Phonem p haben in B das Phonem q, alle Wörter von A mit dem Phonem r haben in
Bebenfalls q
Die Wörter in A mit dem Phonem p teilen sich in B in solche mit Phonem q und solche mit Phonem r
Die Wörter in A mit Phonem p teilen sich in B auf in solche mit Phonem q und solche mit Phonem r. Alle Wörter von A mit Phonem s haben in B ebenfalls das Phonem r
Ein Systemvergleich muss also die Distributionsunterschiede mitberücksichtigen, entweder durch Vergleich langer Distributionslisten oder über ein lautliches Diasystem auf eine historische Bezugsgröße hin. Je komplizierter die Verteilungsunterschiede sind, desto größer ist der Grenzcharakter eines Diasystems, gemessen an der kommunikativen Durchlässigkeit. So lassen sich mit Hilfe der strukturell-systematischen Kriterien die Lautgrenzen objektiver darstellen und in ihrem Grenzcharakter, d.h. ihrer Bedeutung für die zwischensprachliche Verstehbarkeit oder Nichtverstehbarkeit, gewichten.
Einen neuen Einteilungsversuch der niederdeutschen Dialekte auf diasystematischer Basis nach dem Material aller vorhandenen Dialektarbeiten haben 1971 B. Panzer und W. Thümmel [220] vorgelegt. Sie beschränken sich auf den Vergleich der Vokalsysteme. Alle 250 bearbeiteten Einzelmundarten (Ortspunkte) wurden auf ihr Vokalsystem hin phonologisch analysiert in Bezug auf Anzahl der Elemente (Langvokale, Diphthonge, Kurzvokale) in einer sogenannten LDK-Formel, ferner nach der Zahl der hinteren Vokale (a, 0, u, ä, Ö, ii, au) und vorderen Vokale (e, i, e, 1. ai), und zwar auf dem Hintergrund des westgermanischen Vokalsystems

80 Grammatische Beschreibung von Mundart
als Bezugsgröße. Jedes mundartliche Diasystem bekam eine Kennziffer, welche die Abweichung oder Identität zum Bezugssystem anzeigt, hinsichtlich der Anzahl der LDK-Vokale, der H- und V-Reihe (hintere und vordere Vokalreihe). Unterschieden wurden: Identität von System und Bezugssystem: a = a, Zusammenfall von Phonemen: a = 0, 0 = a. Diese westgermanisch-niederdeutschen Entsprechungsverhältnisse wurden in eine Formel gefasst:
V=
W·N
P
wobei V die Zahl der erhaltenen Vokale eines Dialekts ist, W die Zahl der ursprünglich im Westgerm. vorhandenen Vokale, N die Zahl der dem Westgerm. entsprechenden dialektalen Vokale und P die Zahl der Entsprechungspositionen, auf die sich diese im Niederdeutschen noch vorhandenen Vokale (N) verteilen. Für einen einzelnen Ort (Aalsam) sieht die Kennzeichnung dann so aus ([220] 105, Ziffern und Abkürzungen sind hier erläutert und aufgelöst):
Aalsam: Identifikationsformel: |
|
1 |
,- |
. |
1 . |
|
|
|
o =""2 au |
a = e = I = |
""2 aI |
||
LDK-Kriterium |
Vokale |
8,67 |
(Zahl |
der |
Vokale, |
bezogen auf Zahl der |
Längen |
L |
6,33 |
westgerm. Vokale) |
|
||
|
|
|
|
|||
Diphthonge |
D |
5.00 |
|
|
|
|
Kürzen |
K |
4,00 |
|
|
|
|
Hintere Vokale |
H |
6,33 |
|
|
|
|
Vordere Vokale |
V |
3,33 |
|
|
|
|
Orte mit gleichen Zahlenwerten lassen sich zusammenfassen. Die einzelnen Kriterien können dabei noch getrennt auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersucht werden. Es ergibt sich eine Durchstrukturierung des niederdeutschen Sprachgebietes nach Kriterien der Vokalsystemdifferenzen, bezogen auf das Westgermanische. Die Kriterien sind dabei quantifiziert, d.h. in vergleichbaren Zahlen ausgedrückt. Die Methode erscheint auf den ersten Blick als objektiv und unumstößlich. Ein zweiter Blick zeigt jedoch, dass die beste Operationalisierung nichts nützt, wenn die Ausgangsdaten heterogen sind und das Ortsnetz sich nach den zufällig vorhandenen Monographien aus ganz verschiedenen Erhebungsund Abfassungszeiten richten muss. Erst die Gegenprobe mit anderen Auswertungsanordnungen und Bezugszahlen und bei veränderten linguistischen Variablen müsste erweisen, ob die Messzahlen objektive Größen sind oder einfach nur Parameter, die sich je nach Anlage der Verhältnisformel ergeben und bei deren Veränderung entsprechend andere Werte bekämen, die dann vielleicht ganz andere Orte zu Zahlengemeinschaften zusammenschließen würden. Bei dem ohnehin hohen Abstraktionsgrad der diasystematischen Arbeitsweise wäre zu
Phonetik / Phonologie 81
bedenken, ob die Quantifizierung in Zahlenwerte nicht schon ein Schritt zu weit geht. Moulton [217] hat ebenfalls mit Kriterien der Systemoder Teilsystemdifferenz nach Materialien des SDS Sprachräume als Systemräume abgegrenzt (vgl. Kap. 6.2.6.). Er hat dabei versucht, statt Zahlen entsprechende Symbole zu setzen, die einen unmittelbaren Abbildcharakter haben sollten, indem Dreiecke eben Dreieck-Systeme darstellen usw. Hierdurch scheint der Bezug zum Sprachsystem direkter und durchschaubarer und auch überprülbarer zu sein als bei den Messzahlen. Die dialektometrische Methode (s. Kap. 4.2.5) hat solche Berechnungen inzwischen perfektioniert.
[217]William G. Moulton, Phonologie und Dialekteinteilung. In: Sprachleben der
Schweiz. Festschrift für Rudol! Hotzenköcherle. Bern 1963, S. 75-86
[218]Pavel Trost Primäre und sekundäre Dialektmerkmale. In: Zeitschrift für Mundart- forschung Beih. NF 4. Wiesbaden 1968, S. 823-826
[219]Peter Wiesinger, Phonetisch-phonologische Untersuchungen zurVokalentwicklung in den deutschen Dialekten. 2 Bde. Berlin 1970 (stellt die Lautgrenzen als Reihenschrittgrenzen dar)
1220] Baldur Panzer, Wolf ThümmeL Die Einteilung der niederdeutschen Mundarten auf Grund der strukturellen Entwicklung des Vokalismus. München 1971
5.1.6Lautgeschichte oder diachrone Phonologie
Der diachrone Aspekt des Lautvergleichs verläuft entsprechend dem diatopischen, nur wird statt der Größe Raum die Variable Zeitpunkt verändert. Wie schon erwähnt, will die diachrone Dialektologie die historischen Vorstufen heutiger Zustände (Lautgrenzen, Grenzbündel, örtliche und landschaftliche Lautsysteme) erschließen, um Alter, Verlauf und Bewegungsrichtung eines Sprachzustandes zu bestimmen. Es geht dabei nicht um die schon oft genannte Bezugsgröße, sondern um die tatsächliche entwicklungsgeschichtliche Vorstufe eines sprachlichen Befundes. Der untergelegte synchrone Schnitt aus einer historischen Zeitstufe ist quellenabhängig (s. Kap. 3.6). Diachrone Phonologie lässt sich nicht unmittelbar am Sprachmaterial der geschriebenen Texte betreiben. Die Buchstaben repräsentieren nicht unmittelbar und eindeutig einen bestimmten Laut. Eine von Konvention und Tradition geprägte Orthographie verhindert die direkte und unmittelbare Abbildfunktion zwischen Buchstaben und Laut. In vielen Wörtern werden Buchstaben für bestimmte Laute gesetzt, die sie in andern Wörtern nicht repräsentieren. Ein Buchstabe kann mehrere Phoneme bezeichnen, ein Phonem kann durch mehrere Buchstaben ausgedrückt sein. Das Aufdecken der Abbildverhältnisse zwischen Schriftzeichen und Laut und damit die Vorarbeit für eine komparativdiachrone Arbeitsweise ist Sache der Graphematik. Die Terminologie der Graphematik lehnt sich an die der Phonologie an. Dem Phon entspricht das Graph, dem Phonem das Graphem. Graph und Graphem sind definiert durch das Phon und Phonem, für die sie stehen. Sind Phon und Phonem nicht bekannt, was in der
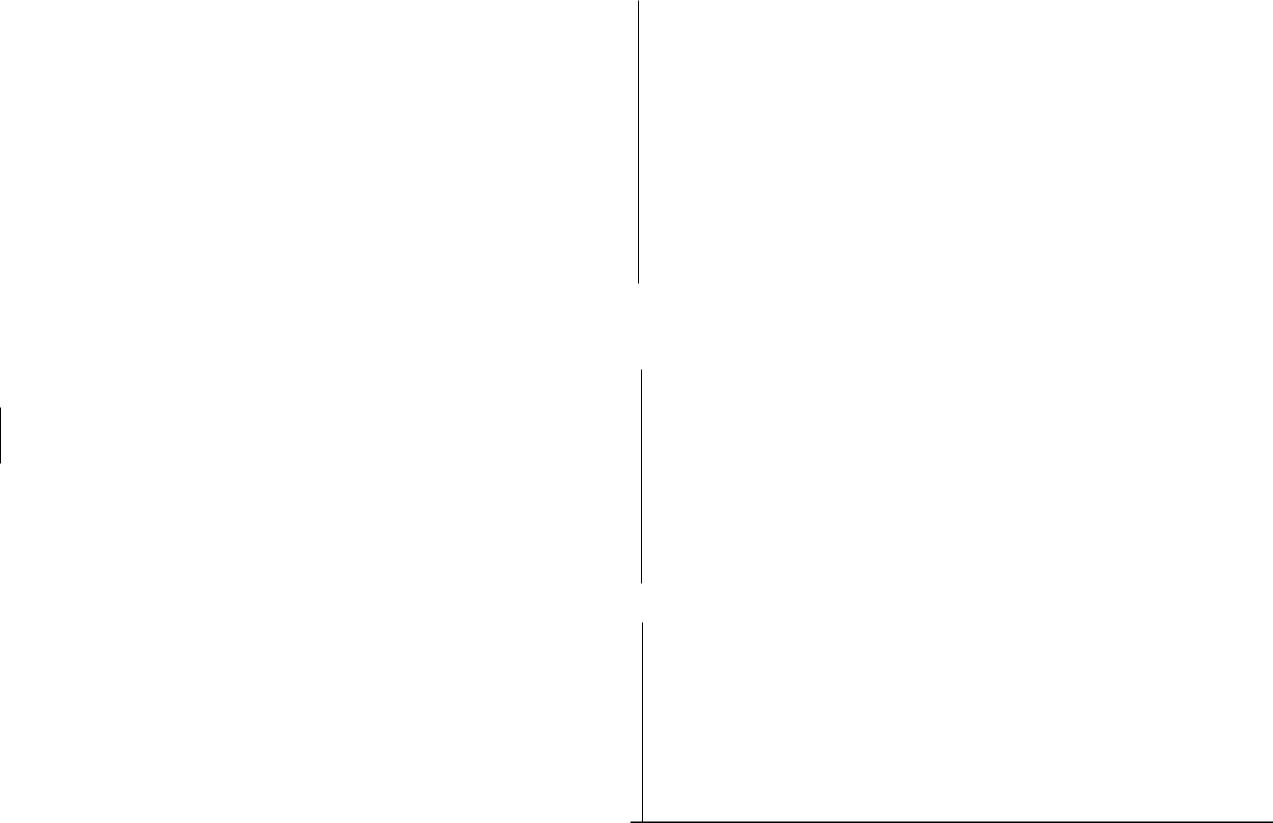
82 Grammatische Beschreibung von Mundart
historischen Phonologie zunächst anzunehmen ist, dann kann man auch nicht bestimmen, welche Buchstaben (Typ, Typeme) als Allographen ein bestimmtes historisches Graphem konstituieren. Die Grapheme werden also durch das bestimmt, was durch sie eigentlich erst aufgedeckt werden soll, nämlich die historischen Phoneme. Die Graphematik dreht sich damit im Kreis. Ein methodisch sauberer Ausweg ist bis jetzt noch nicht gefunden. Es gibt jedoch Möglichkeiten, wenigstens einzelnen Graphen (Buchstaben) auf indirektem Wege ihren Lautwert mit einiger Sicherheit zuzuweisen, eine Prozedur, die für jede einzelne Schrift oder Schreiberhand natürlich von neuem angewendet werden muss. Wenn z.B. das Graph lail im Wort Itairl geschrieben wird für das Wort 'Tor', und wenn lail auch in Wörtern vorkommt wie Istainl, Ihaiml, so bezeichnet lail den Lautwert eines Diphthongen oa. Die Verdumpfung von mundartlich ai > oe führte zu einer Homophonie des Zwielautes in stoeund toer. Von da an war die "falsche" Schreibung lail in Itairl phonologisch-grammatisch möglich. Das Lautsystem muss also das Phonem loal enthalten, obwohl dafür kein eigenes Schriftzeichen vorkommt.
Die Lauterschließung bei historischen Texten kann auf dreierlei Weise vor sich gehen:
1.Es werden die Eigennamen als annähernd phonetische Schreibungen ausgewertet, vor allem solche, deren Wortsinn offensichtlich schon in historischer Zeit nicht mehr durchsichtig war.
2.Es werden lautliche Direktanzeigen als unmittelbare Wiedergabe gesprochener Laute gewertet, wenn z.B. für mhd. straze im Text stras geschrieben wird oder für mhd. kirche das Wort kilche.
3.Es werden sogenannte hyperkorrekte Schreibungen als Vermeidungsversuche von Direktanzeige interpretiert. Ein Schreiber will vertuschen, dass man im Fränkischen libe spricht statt korrekt liebe habe oder bruder statt korrekt bruoder.
Daher schreibt er in falscher Korrektheit alle [l] und [ü] als ie und uo, selbst dann, wenn der einfache Laut [i] oder [ü] die richtige Schreibung wäre. Er schreibt also wiese statt wise, spietal statt spital, bruon statt brun.
Wegen der methodischen Schwierigkeit, von einem konventionellen Schreibsystem aus auf ein historisches Phonemsystem zu schließen, sind die Arbeiten auf diesem Gebiet nicht sehr zahlreich.
[221]Gunnar Hammarström, Grapheme, son et phoneme dans la description des vieux textes. In: Studia Neophilologica 31,1959, S. 5-18
[222]Wolfgang Fleischer, Strukturelle Untersuchungen zur Geschichte des Neuhoch~ deutschen. BeTlin/Ost 1966
[223]Horst Singer, Der Graphembegriff bei der Analyse altdeutscher Handschriften. In:
Linguistische Berichte 13, 1971. S. 83-85
Vgl. Histor. Südwestdeutscher Sprachatlas [185] 1979, darin: Heinrich Löffler, Zum
graphematischen Standort, S. 34-45
I
I
I
'i
1r
Phonetik I Phonologie 83
[224] Rudolf Steffens, Zur Graphematik domanialer Rechtsquellen aus Mainz (1315-1564). Ein Beitrag zur Geschichte des Frühneuhochdeutschen anhand von Urbaren. Stuttgart 1988
[225]Heinrich Löffler, Hyperkorrekturen als Quelle der Sprachgeschichte. In: Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Hrsg. von Wemer Besch, Anne Betten, Oskar Reichmann, Stefan
Sonderegger. 2. Auf!. 3. Teilbd. Berlin 2002
5.1.7Soziophonetik oder diastratische Phonologie
Die Abhängigkeit der sprachlichen Laute von sozialen Merkmalen des Sprechers oder einer Sprechergruppe ist eine der ältesten Erkenntnisse der Dialektologie. Bekannt waren vor allem altersbedingte Unterschiede im Lautstand. Die Sprache der Generationen an einem Ort zeigte verschiedene lautliche Stufungen zwischen der Grundmundart der ältesten Bewohner und der überörtlichen Geschäftsmundart der Berufstätigen. Neben den altersbedingten Unterschieden waren auch die geographischen Differenzen zwischen Stadt und Land aufgefallen, die man auch als Differenzen der Sozialstruktur interpretieren kann. Dabei ist sozial höherwertig nichtinuner die hochsprachenahe Variante. Auch hochsprache-ferne Laute können ein hohes Sozialprestige haben, wenn sie in der Stadt gelten oder in einer Landschaft mit sozialem Mehrwert. So ist alemannisch [nai] für 'nein' dem hochsprachlichen [nain] lautlich sehr nahe, dennoch wird es gelegentlich durch das Hoch- sprache-fernere schwäbische [noi] oder das niederdeutsche [ne] ausgetauscht, weil damit ein höheres Sprachprestige verbunden ist. Die ausdrückliche Untersuchung der Zusammenhänge von Laut und sozialen Faktoren ist Teil der Soziophonetik (Ammon [173], Lausberg [227], Hofer [228]). Bei "diastratisehen" Arbeiten im Lautbereich mit der veränderlichen Variablen Sozialmerkmal, sei es als Status, Rolle oder Gruppenzugehörigkeit, hat sich die Kenntnis der örtlichen Grundmundart als feste Bezugsgröße für alle soziodeterminierten Abweichungen als sehr brauchbar erwiesen. Eine Zuweisung prosodischer Faktoren zu sozialen Gruppierungen wurde experimentalphonetisch untersucht. Durch technische Hilfsmittel sollten prosodische Faktoren isoliert hörbar gemacht werden, und zwar so, dass die übrigen sprachlichen Elemente nicht mehr identifiziert, d.h. als sprachliche Äußerungen verstanden werden konnten. Die isoliert hörbar gemachten Intonationen wurden dann einigen Testpersonen zur Bewertung und Zuordnung zu sozialen Gruppen vorgelegt. Auf diese Weise konnten Intonationen als Indikatoren der sozialen Schichtenzugehörigkeit aufgedeckt werden (s. auch Kap. 5.2).
[226]Marianne Schneider u.a., Soziophonetik. In: Literaturwissenschaft und Linguistik
2,1972, S. 1551.
[227]Helmut Lausberg, Situative und individuelle Sprachvariation im Rheinland: variablenbezogene Untersuchung anhand von Tonbandaufnahmen aus Erftstadt-
Erp. Köln 1993
[228]Lorenz Hofer. Sprachwandel im städtischen Dialektrepertoire. Eine variationslinguistische Untersuchung am Beispiel des Baseldeutschen. Tübingen, Basel 1997
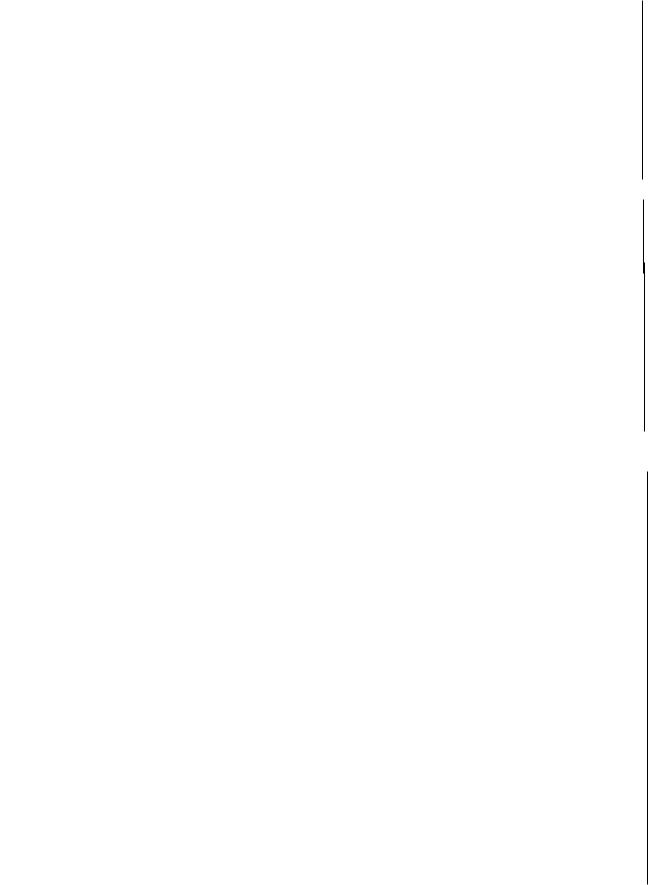
84 Grammatische Beschreibung von Mundart
5.2Prosodik
In den Bereich der prosodik fallen jene phonetischen Erscheinungen, die man nicht mit einem Einzellaut identifizieren kann. Gemeint sind: 1. Akzent (Silben-, Wort-, Satzakzent), d.h. die Intensität des Stimmdruckes; 2. Die Intonation, d.h. die Tonhöhe und ihr kontinuierlicher Verlauf. Man spricht hier auch von Wortund Satzmelodie; 3. Die Pausen oder Segment-Anzeiger, d.h. prosodische Merkmale wie Stimmanhalten (Glottisverschluss) zur Kennzeichnung von Wort-, Satzteiloder Satzgrenzen. Segmentgrenzen werden gelegentlich mit dem lateinisch-englischen Fremdwort Junktur (juncture) bezeichnet. Solche prosodische Elemente sind kontinuierlich über ein oder mehrere sprachliche Segmente wie Phonem, Morphem oder Satz verteilt. Man spricht daher auch von suprasegmentalen Einheiten oder Merkmalen. Von der Art ihrer Notation bei phonetischer Umschrift her ist auch die Bezeichnung supralineare Merkmale gebräuchlich. Die ältere experimentelle Phonetik sprach von konstitutiven Faktoren. In der strukturellen Linguistik wird terminologisch parallel zu Phon und Phonem unterschieden zwischen Prosod und Prosodem. Als Transkriptionszeichen sind gebräuchlich:
'.
1,2,3,4:
Iil:
I:
:1
1:
vor die entsprechende Silbe gesetzt als Betonungszeichen (Akzent): 'aRbgt ('Arbeit'), fud'eRbt ('verdorben'),
als Kennzahlen für die relative Tonhöhe, wobei in der Regel 3 Tonhöhenstufen ausreichen:
'über 2lege, 2ü bler'lege (Frage),
Tonhöhenverlauf als Satzgrenzzeichen (Junkturen),
ohne Änderung der Tonhöhe, wenn die Rede weitergehen soll, aufsteigender Ton bei Fragen,
absteigender Ton bei einer normalen Aussage.
Statt der Zahlen und der Satzgrenzzeichen werden auch übergeschriebene Tonkur-
yen verwendet: ~~ ufhere, her, ufo
In dieser vergröberten Notation, drei Tonhöhen, drei Satzjunkturen und zwei Druckstärken, kann das geschulte Ohr sehr gut Unterschiede wahrnehmen. In ihrer ganzen akustisch-physikalischen Struktur können Akzent (Intensität), Intonation (Frequenzkurvenverlauf) und Morphem-oder Satzpausen nur mit entsprechenden technischen Apparaturen (Spektrographen) analysiert werden. Voraussetzung hierfür sind hochwertige Bandaufnahmen. Die handschriftlichen Notizen bei manueller Transkription im direkten Aufnahmeverfahren ohne Tonträger sind in ihrer Subjektivität und Zufälligkeit ungenau, nicht überprüfbar und auch nicht zu korrigieren. Sie taugen daher wenig für prosodische Analysen. Als praktikabel hat sich die Autophonie erwiesen, bei der der Bearbeiter selbst seine eigene Intonation auf Band spricht. analysiert und die technisch aufbereiteten Ergebnisse bei sich selbst und einer Testgruppe auditiv, d.h. nach dem Gehör
Prosodik 85
kontrollieren lässt. Die Aufnahmen mit fremden Personen lassen eine nachträgliche Korrektur und Überprüfung meistens nicht zu. Auch lässt sich die intendierte, also vom Sprecher absichtlich angezielte Prosodie, vom Experten selbst besser erreichen als von einer dritten Testperson. Dieses einigermaßen fehlerfreie Verfahren gilt jedoch nur für die Eigensprach-Analyse des Bearbeiters. Die Bearbeitung fremder Prosodie setzt eine technische und auditive Ausbildung voraus, die in der Regel nur von wenigen Spezialisten (Phonetikern) erreicht wird, die aber wiederum nicht unbedingt Dialektologen sein müssen.
In der Dialektologie und in der deutschen Hochsprache war die Beschäftigung mit prosodischen Dingen nie sehr intensiv. Neben der mangelnden Ausbildung und den technischen Voraussetzungen dürfte ein weiterer Grund für die Vernachlässigung auch im ungeklärten linguistischen Status der prosodischen Einheiten liegen. Nach der phonologischen Definition müssen sie zu den Phonemen gerechnet werden, denn sie haben bedeutungsdistinktive Funktion. Nur die Silbenpause unterscheidet z.B. die beiden Wörter 'Lehrerkenntnisse' und 'Lehrerkenntnisse' . Ebenso wirkt das Satzgrenzzeichen auf die gesamte Satzbedeutung: 'du hast es getan' L(Behauptung) bzw. 'du hast es getan' T(Frage). Solche Einheiten können aber nicht mit einem bestimmten Phonem als deren Träger identifiziert werden. Sie können nicht einmal im Sprechkontinuum genau lokalisiert werden. Ähnlich wie die Semantik betrifft die Prosodie alle grammatischen Kategorien. Während über die hochdeutsche Prosodie keine reiche Literatur vorliegt, hat die Dialektologie seit der lautphysiologischen Zeit vor allem Akzent und Intonation immer wieder zu beschreiben versucht. So war z.B. die
"rheinische Schärfung" seit Th. Frings (I9l5) immer wieder Gegenstand der Untersuchung bis hin zur jüngsten Arbeit darüber von R. Jongen [235], der allein zu diesem Thema beinahe 100 Titel zusammengetragen hat. Die generative Linguistik sucht die suprasegmentalen Merkmale schon in der Tiefenstruktur eines Satzes einzubauen, da sie auf die prinzipielle Zuordnung der Satzelernente einen wesentlichen Einfluss haben, indem sie die Satzbedeutung mitbestimmen. Eine überzeugende Lösung ist jedoch bisher nicht gefunden, zumal auch hier wie auf allen Gebieten auf die Vorarbeiten der traditionellen Linguistik wegen der vom Ansatz her nicht so stringenten Terminologie und Methodik wiederum großzügig verzichtet wird. Dabei wären die empirischen Arbeiten aus der Dialektologie auf prosodischem Gebiet leicht in eine neue Notation umzuschreiben. Gerade jüngere Untersuchungen haben gezeigt, dass in der Regel die apparativen Analysen keine entscheidend anderen distinktiven Merkmale zutage fördern, als das menschliche Ohr auditiv schon wahrgenommen hat. Neuere Experimente mit Intonator und Vocoder, einer Art Filtermaschinen, die bestimmte suprasegmentale Elemente unter Belassung der übrigen herausfiltern, haben sogar gezeigt, dass das Gehör auch die Intensität (Akzent) als Tonhöhenunterschied, nicht als Intensitätsunterschied wahrnimmt und dass zumindest in der Hochlautung nur zwei Tonhöhen (mit und ohne hörbaren Übergängen) als distinktiv registriert werden, sobald sie die Differenz von wenigstens 5 Hz (oder beliebig mehr) erreichen.

86 Grammatische Beschreibung von Mundart |
|
|
|
Morphologie 87 |
|
|
|
|
|
|
|
Gerade bei einer derartigen Reduktionsmöglichkeit der gesamten prosodischen |
|
Prosodische Untersuchungen innerhalb der Dialektologie: |
|||
|
|||||
Merkmale auf zwei distinktive Frequenzunterschiede beliebiger Höhe wäre eine |
|
[233] |
Reinhold Gräter, Untersuchungen über den Silbenakzent schwäbisch-aleman- |
||
Umnotierung der herkömmlichen empirischen Arbeiten sehr leicht möglich. |
|
|
|
nischer Mundarten. Diss. Leipzig 1917 |
|
Wie also der genaue Status der Prosodie und ihre Interdependenz zu den |
|
[234] |
Heinrich Dittmaier, Die rheinische Schärfung. In: Teuthonista 10,1934, S. 155- |
||
grammatischen Ebenen noch nicht genügend geklärt ist, so sind die Analyse- |
|
|
|
171 (vergleicht die Intonation von Frankfurt a. M. mit Köln) |
|
|
[235] |
Rene Jongen, Rheinische Akzentuierung und sonstige prosodische Escheinungen. |
|||
prozeduren bisher - von den eben genannten Versuchen abgesehen (Jongen |
|
||||
|
|
|
Eine Beschreibung der suprasegmentalen Zeichenformdiakrise in der Moresneter |
||
[235], Isacenko, Schädlich [230]) - noch nicht so weit operationalisiert, d.h. in |
|
|
|
||
|
|
|
Mundart. Bonn 1972 (mit Forschungsüberblick und aktueller Methodik) |
||
einer von jedermann nachvollziehbaren Versuchsanordnung angelegt, dass damit |
|
|
|
||
|
[236] |
Eugen Gabriel, Die Mundarten an der alten churrätisch-konstanzischen Bistums- |
|||
komparativ, also sprachgeographisch oder soziolinguistisch, gearbeitet werden |
|
|
|
grenze im Vorarlberger Rheintal. Marburg 1963 (Transkription der Into- |
|
könnte. Komparativ-diachronisch dürfte auf direktem Weg nichts zu erkunden |
|
|
|
nation/Tonkurven S. 47-69) |
|
sein, da aus früheren Zeitstufen keine Tonaufzeichnungen vorliegen. Allerdings |
|
|
|
|
|
hat die Forschung schon früh mit Recht die Akzentzeichen in den Handschriften |
|
|
|
|
|
von Notker (St. Gallen ca. 1000 n. Chr.) beachtet und als suprasegmentale Merk- |
|
5.3 |
Morphologie |
||
malsbezeichnungen interpretiert. Gerade im Bereich der gesprochenen Sprache, |
|
|
|
|
|
in dem selbst dem ungeschulten Laien schon die feinsten Unterschiede des Ton- |
|
Der grammatische Bereich der Morphologie ist nach der Phonetik und Phonologie |
|||
falls als Ortsoder Landschaftsmerkmale auffallen, die in der Regel auch nach |
|
||||
|
der am häufigsten bearbeitete Teil der Dialektgrammatik, wenn auch in der Regel |
||||
Erlernung der Hochsprache nie vollständig abgelegt werden, hinkt die Forschung |
|
||||
|
immer nur Ausschnitte behandelt werden. |
||||
noch sehr hinterher. Jeder erkennt in öffentlicher Rede einen Hamburger, einen |
|
||||
|
|
|
|
||
Kölner, |
Stuttgarter oder Münchener am Tonfall. Es gibt aber nur ganz wenige |
|
|
|
|
vergleichende Untersuchungen, in denen diese Tonfälle mit linguistischen Mitteln |
|
5.3.1 Historisch-vergleichende Formenlehre |
|||
komparativ beschrieben sind. Dabei ist gerade auch in der Soziolinguistik dieser |
|
||||
|
|
|
|
||
Bereich |
als Sozial-Anzeiger von großer Bedeutung, etwa in der Zuordnung |
|
Die traditionellen, auf vergleichend-historischer Basis arbeitenden Grammatiken |
||
bestimmter Intonationen zu bestimmten $prechergruppen, Stadtteilen, sozialen |
|
||||
|
teilen den heute mit Morphologie bezeichneten Grammatikbereich ein in Fle- |
||||
Schichten. Die neue Forschungsrichtung der Soziophonetik (s. Kap. 5.1.7) nimmt |
|
||||
|
xionslehre und Wortbildungslehre. Die klassische Formenlehre hat als Eintei- |
||||
sich dieser Fragestellung an. Schon vor einigen Jahren hat H.L. Kufner in seiner |
|
||||
|
lungsprinzip die Wortarten, als erste Untergliederung die verschiedenen Genera, |
||||
'Münchner Grammatik' [108] herausgefunden, dass das "GranteIn" der Münch- |
|
||||
|
dann die einzelnen Flexionsklassen, eingeteilt nach dem historischen Stamm- |
||||
ner Straßenbahnschaffner kein sozialoder berufsspezifisches Merkmal ist, das |
|
||||
|
auslaut aus vor-ahd. Zeit, bei den starken Verben nach den für die Tempusformen |
||||
sozialpsychologisch ausdeutbar wäre, dass es sich vielmehr um eine typische |
|
||||
|
verwendeten Ablautstufen, bei schwachen Verben nach der Art der Ableitungs- |
||||
Tonhöhenkurve bei neutralen Aussagesätzen der Münchener Stadtmundart |
|
||||
|
silbe und des Fugenvokals im Präteritum. Eine Einteilung der klassischen Formen- |
||||
handelt. Eine solche Feststellung hat weittragende Bedeutung für eine gegenseiti- |
|
||||
|
und Wortbildungslehren erfolgt nach folgendem Schema (nach R. v. Kienle |
||||
ge, auf Spracheindrücken beruhende Einschätzung der sozialen und regionalen |
|
||||
|
[238]): |
|
|||
|
|
||||
gesellschaftlichen Gruppen. |
|
1. |
Substantivflexion: |
||
|
|
|
|||
Grundsätzliches zur Intonation: |
|
|
Mask. Neutr. Fern.: a-Stämme, ö-Stämme, i-Stämme, u-Stämme, Wurzelnomina, |
||
|
|
Verwandtschaftsnamen auf -r, n-Stämme oder schwache Deklination |
|||
[229] Georg Heike, Suprasegmentale Analyse. Marburg 1969 (mit mundartlichen |
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
Beispielen) |
|
2. |
Pronominalflexion: |
|
[2301 |
Aleksandr V. Isacenko, Hans Joachim Schädlich, Untersuchungen über die deut~ |
f; |
|
Personal-, Demonstrativ-, Interrogativ-, Relativ-, Indefinit-, Adjektivpronomina |
|
|
sehe Satzintonation. (Studia Grammatica 7). Berlin/Ost 1966, S. 5-68 |
|
3. |
Adjektivflexion: |
|
[231] |
WeIner König, Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik |
|
|||
|
|
Mask. Neutr. Fern.: starke - schwache Flexion, Adjektiv-Adverbien |
|||
|
Deutschland. 2 Ede. München 1989 (mit Analysen dialektaler Substrate der |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
hochdeutschen Aussprache) |
|
4. |
Zahlwörter (Numeralia) |
|
[232] |
Peter Auer (Hrsg.), Silbenschnitte und Tonakzente. Tübingen 2002 |
|
5. |
Verbalflexion: |
|
|
|
|
|||
Stammformen der starken Verben, Klasse 1-7
Schwache Verben, Klasse 1-3
