
Lffler_Dialektologie
.pdf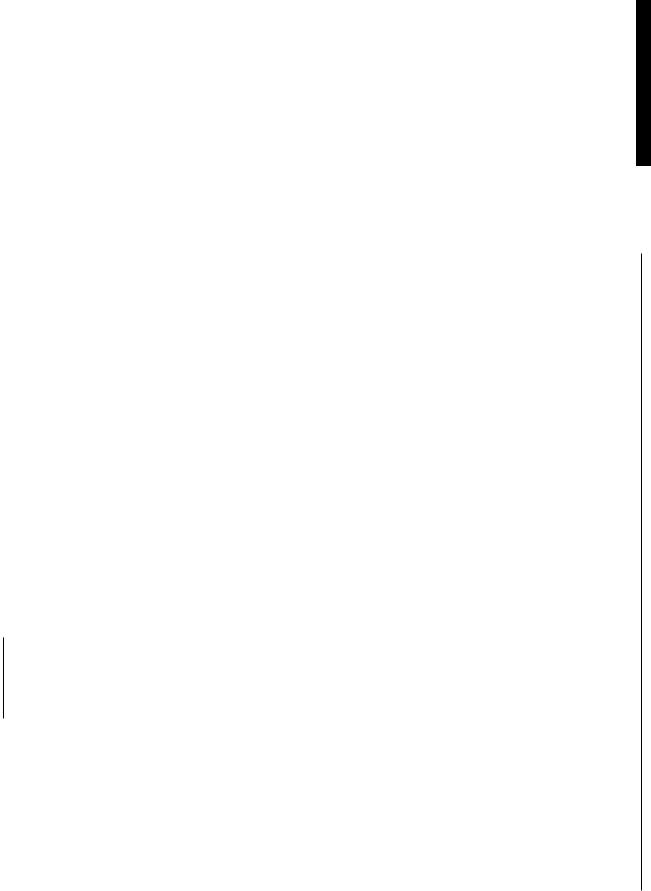
28 Geschichte und Stand der Dialektforschung
gebogen bestand aus 200 Einzelwörtern. Das ganze Unternehmen sollte eigentlich nur eine dialektgeographische Vorstudie sein zu dem kurze Zeit später (1904-20) erschienenen 'Schwäbischen Wörterbuch' [280] (Nachtragband 1936), welches H. Fischer ebenfalls als Einmann-Arbeit herausbrachte.
Mit zu den Vätern der deutschen Dialektgeographie gehörte auch Karl Haag,der in mehreren Arbeiten aus dem oberen Neckarraum [111]. [347], [348] nach persönlichen Erkundungen an über 200 Orten mit hunderprozentigem Ortsnetz bedeutende Anstöße für die Materialerhebung, die Kartentechnik und die Karteninterpretation gegeben hat, die jedoch von der Forschung kaum zur Kenntnis genommen wurden und erst heute wieder neu entdeckt werden. Statt der brieflichen oder indirekten Methode Wenkers und Fischers hat Haag seine Erhebungen persönlich an Ort und Stelle gemacht wie später auch K. Bohnenberger [103] und andere, die vertnutete Sprachgrenzen buchstäblich abgewandert sind. Auf diese Weise wurde schon damals das Problem der Isoglosse erkannt, das heute wieder diskutiert wird, dass nämlich eine Sprachlinie irmner eine Doppellinie oder ein Band darstellt, nämlich auf der einen Seite als Verbindungslinie aller Ortspunkte, in denen ein bestirmnter Laut, z.B. [1]. gilt und als eine zweite Linie, die alle Ortspunkte verbindet, in denen dieser selbe Laut z.B. als [ei] gesprochen wird. An die großen Atlasunternehmen DSA [112] und DWA [113] haben sich eine Reihe von Einzeluntersuchungen angeschlossen, die nach der dialektgeographischen Methode mit zusätzlichem Material oder ohne solches geographische Einzelabschnitte oder Teilräume mit feinerem Ortsnetz und differenzierterer Problemstellung bearbeitet haben. In der Reihe 'Deutsche Dialektgeographie' [31] (DDG), die F. Wrede als Nachfolger G. Wenkers 1908 eröffnet hat, sind bis 1972 78 Bände erschienen. Neben rein dialektgeographischen Problemen der Lautlehre kamen später auch Ortsgrammatiken hinzu oder andere grammatische Teil-
probleme wie Syntax (DDG 13, 54) und Semantik (DDG 75).
Auch der Wortatlas erhielt zahlreiche begleitende Einzeluntersuchungen. Sie sind in der Hauptsache in der Reihe 'Wortforschung in europäischen Bezügen [35] seit 1950 publiziert.
Anstelle der Publikation weiterer DSA-Karten über die 129 erschienenen ltinaus wurden nach dem Kriege eine Reihe regionaler Sprachatlanten in Arbeit genommen, von denen inzwischen einige schon in mehreren Bänden vorliegen.
Für weitere Gebiete sind die Vorarbeiten im Gange.
Auch außerhalb des ehemaligen deutschen Reichsgebietes haben als eigenständige Unternehmungen große Atlasarbeiten eingesetzt. Das wohl bedeutendste Werk, das neben der DSA-Tradition vor allem der dialektgeographischen Methode der romanischen Sprachatlanten verpflichtet ist, ist der 'Sprachatlas der Deutschen Schweiz' (SDS) [115], der seit 1963 unter Leitung von R. Hotzenköcherle mit 4 von 6 geplanten Bänden vorgelegt wurde. Er beruht auf einer seit 1938 im direkten Aufnahmeverfahren betriebenen Explorationsarbeit an durchschnittlich 35% aller Ortschaften der Schweiz. Das eigens hierfür ausgearbeitete Fragebuch mit 2400 Fragen ist inzwischen auch für andere Atlasunternehmen vorbildlich
Das linguistische Interesse 29
geworden. Auch in der Kartentechnik dürfte der SDS den modernsten Stand bieten, der auch für neueste strukturelle Interpretationsversuche eine brauchbare Grundlage darstellt. Ein anderes Unternehmen ist der'Atlas linguistique d'Alsace' (ALA) von E. Beyer [122]. dessen erster Band 1969 erschienen ist. Die Exploration geschah durch den Bearbeiter selbst in Anlehnung an das Fragebuch des SDS. Die Anlage des Atlas und die Kartierungstechnik hält sich an die französischen Sprachatlanten (sogenannte "Originalkarten" s. Kap. 4.2.4 und sachliche, nicht granunatische Gliederung der Kartenfolge ).
Seit einiger Zeit wird auf internationaler Ebene ein Europäischer Sprachatlas, der sogenannte Internationale Comparative Atlas' (ICA), neuerdings 'Atlas Linguistique de l'Europe' (ALE), geplant, nachdem in fast allen europäischen Ländern durch nationalsprachliche Atlasunternehmen eine genügend breite Materialbasis vorhanden ist. Der ICA (ALE) soll sprachliche Probleme von über- national-sprachlichem Charakter kartieren, z.B. Rundungsund Entrundungserscheinungen oder Palatalisierungen, die über die nationalsprachlichen Grenzen hinaus verschiedene, genetisch nicht verwandte Sprachen erfasst haben. Das Ortsnetz und die ganze Anlage muss durch die ganz neue Problemstellung von Grund auf neu durchdacht und erprobt werden.
Seit die großen Atlaswerke stellvertretend für Dialektologie überhaupt stehen, wird diese fast ausschließlich als Dialektgeographie verstanden. In den dreißiger Jahren gab es sogar ausdrückliche Bestrebungen, die Dialektologie nicht in bloße linguistische oder soziologische Fragestellungen abgleiten zu lassen (Bach [1] § 271). Heute geht die Tendenz eher wieder in Richtung einer stärkeren Betonung des rein sprachlichen Aspekts und der heuristischen Funktion für die allgemeine Linguistik (vg!. die "neue Dialektologie" bei Barbour, Stevenson [17]). Dass die dialektgeographische Fragestellung keine primär sprachliche ist, sondern auf die großen raumbildenden Kräfte und die Ursachen kultureller Vorgänge und Gegebenheiten abzielt, zeigte sich schon darin, dass nie alle sprachlichen Faktoren geographisch ausgelegt wurden. Außer den lautlichen und den lexikalischen blieben die morphologischen, syntaktischen und prosodischen Bereiche weitgehend ausgeklammert. Die neuere Dialektgeographie mit wieder mehr linguistischem Schwerpunkt wird diese vernachlässigten Gebiete mehr als bisher mit in die Betrachtung einbeziehen müssen.
Zur Dialektgeographie insgesamt vg!. Hard [l3] und Besch [14], [19]
[110]Hermann Fischer, Geographie der schwäbischen Mundart mit einem Atlas von 28
Karten. Tübingen 1895
[111]Karl Haag, Die Mundarten des oberen Neckar~ und Donaulandes. Reutlingen
1898
[1l2] Deutscher Sprachatlas (DSA), bearb. von Ferdinand Wrede, Bernhard Martin. Walther Mitzka. Ug. 1-23, Marburg 1927-1956; dazu: Walther Mitzka, Handbuch zum Deutschen Sprachatlas. Marburg 1952
[113]Deutscher Wortatlas (DWA). Hrsg. von Walther Mitzka und Ludwig E. Schmitt. Bd. 1-20. Marburg 1951-1972

30 Geschichte und Stand der Dialektforschung
[1141 |
Thüringischer Dialektatlas, bearb. von Hermann Hucke. 4 Bde. Berlin 1961-1965 |
|
[1151 |
Sprachatlas der deutschen Schweiz (SDS). Hrsg. von Rudolf Hotzenköcherle u.a. |
|
|
Bd. 1-8. Bem 1961-1997; dazu: Rudolf Hotzenköcherle, Einführung in den |
|
|
Sprachatlas der deutschen Schweiz. A: Zur Methodologie der Kleinraumatlanten; |
|
|
B: Fragebuch, Transkriptionsschlüssel, Aufnahmeprotokolle. BeIn 1962 |
|
[1161 |
Luxemburgischer Sprachatlas, bearb. von Robert Bruch. Marburg 1963 |
|
[1171 |
Siebenbürgisch-deutscher Sprachatlas, bearb. von Kurt Rein. Marburg 1964 |
|
[1181 |
Schlesischer Sprachatlas, bearb. von Günter Bellmann, Wolfgang Putschke, |
|
|
WeIner Veith. Marburg 1965-1967 |
|
[1191 |
Tirolischer Sprachatlas, bearb. von Egon Kühebacher. 3 Bde. Innsbruck 1965- |
|
|
1971 |
|
[1201 |
Antonius Angelus Weijnen, A. Hagen, Der "Internationale Comparative Atlas" |
|
|
(ICA). In: Zeitschrift für Mundartforschung 34,1967, S. 187-190 |
|
[1211 |
Atlas der Celler Mundart im Blickfelde der niedersächsischen Dialekte und deren |
|
|
Grenzgebiete, bearb. von Richard Mehlem. Marburg 1967 |
|
[1221 |
Atlas Linguistique et Ethnographique de l'Alsace (ALA), bearb. von Ernest Beyer, |
|
|
Raymond Matzen, Marthe Philipp. 2 Bde. Paris 1969-1984 |
|
[1231 |
Atlas Linguistique et Ethnographique de 1a Lorraine Germanophone (ALLG), |
|
|
bearb. von Marthe Philipp, Arlette Bothorel, Guy Levieuge. Paris 1977 |
|
[1241 |
DTV-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. Mit Mundartkarten, bearb. |
|
|
von Werner König. München 1978, 13 2001 |
|
[1251 |
Sprachatlas des nördlichen Rheinlands und des südöstlichen Niederlands : Fränki- |
|
|
scher Sprachatlas (FSA), bearb. von Jan Goossens. Marburg 1981 |
|
[1261 |
Südwestdeutscher Sprachatlas (SWSA). Hrsg. von Hugo Steger, Eugen Gabriel, |
|
|
Volker Schupp 1Ig. Iff. Marburg I 989fl. Dazu: Forschungsbericht zum SWSA von |
|
|
Eugen Gabriel und Karheinz Jakob. Marburg 1983 |
|
[1271 |
Kleiner Deutscher Sprachatlas (KDSA), bearb. von WernerH. Veith und Wolfgang |
|
|
Putschke. 2 Bde.. 4 Tle. Tübingen 1984-1999 |
|
[1281 |
Vorarlberger Sprachatlas mit Einschluss des Fürstentums Liechtenstein, Westtirols |
|
|
und des Allgäus (VALTS), bearb. von Eugen Gabriel und Hubert Klausmann, |
|
|
Bd. Ifl. Bregenz 1985fl. |
|
[1291 |
Mittelrheinischer Sprachatlas, bearb. von Günter Bellmann. Bd.1-5, Tübingen |
|
|
1994-2002 |
|
[130] |
Bayerischer Sprachatlas (BSA). Hrsg. von Robert |
Hinderling, Wemer |
|
König, Ludwig M. Eichinger u.a. Heidelberg 1996ff.; |
darin: Sprachatlas von |
|
Bayerisch-Schwaben (SBS). Hrsg. von Wemer König, |
Bd. 1-9fl., Heidelberg |
|
1996-200 Ifl. |
|
2.4,5 Das sprachliche Weltbild der Mundarten
Die ersten strukturalistischen Ansätze kamen in die Dialektologie durch die sogenannte inhaltsbezogene Grammatik, die Theorie der "inneren Form" einer Sprache. Im Besonderen war es die sogenannte Wortfeldtheorie, formuliert von Trier [2501 und Weisgerber [251], die im Bereich des Wortschatzes ein neuartiges Ordnungsund Deutungsprinzip einführte. Die Bedeutung eines Wortes ist nicht absolut und isoliert angebbar. Erst der Stellenwert des Wortes innerhalb seiner inhaltlichen Nachbarschaftsbeziehungen zu anderen Wörtern aus demselben
Das linguistische Interesse 31
Sachbereich gibt die eigentliche Wortbedeutung an. Jedes Wort steht also in einem Geflecht von Sachbezeichnungen, die sich gegenseitig in einem Wortfeld abgrenzen. Ein solches Wortfeld ist gewissermaßen über einen bestimmten Sachzusammenhang gestülpt, wodurch dieser Sachbereich überhaupt erst sprachlich gegliedert wird. Jede Sprache hat so ihre eigene Weise, die Sachwelt mit Hilfe des Wortschatzes zu gliedern. Man spricht daher vom sprachlichen Weltbild oder der inneren Form. In der Dialektologie ist die Wortfeldtheorie über wenige Ansätze nicht hinausgekommen (s. Marti [131]), obwohl gerade hier innerhalb einer nationalen Einheitssprache die einzige Möglichkeit gegeben wäre, verschiedene "Weltbilder", d.h. semantische Strukturen von Sub-Sprachen, aufzudecken. Vielleicht ist die mangelnde dialektologische Arbeit auf diesem Gebiet darin begründet, dass die Wortfeldtheorie erst heute sich anschickt, ihre Arbeitsweise zu operationalisieren. Die herkömmliche Arbeitsweise war oft auf subjektives Gutdünken gegründet und abhängig vom individuellen Sprachgefühl des Bearbeiters. Die jeweiligen Gliederungen von Sachund Wortbereich, etwa des Bereiches "stehlen", "weinen", "gehen" oder "sterben" oder der "intellektuellen Einschätzung des Menschen" überzeugen nicht und sind nicht von jedermann zwingend nachvollziehbar. Erst die strukturelle Semantik mit ihrer Merkmalsbeschreibung beginnt ein überprüfbares Instrumentarium zur Operationalisierung der Wortfeldtheorie bereitzustellen (vgl. darüber Kap. 5.4.1 mit Lit.).
[131]Werner Marti, Wäärche - schaffe. Ein Wortfeldkomplex in der Sprache des bernischen Seelandes. Bern 1968
Bach [11 Kap. VI: Die Mundart als geistige Gestaltung S. 264fl.; Hard [131 Kap. 6: Die
"innere Form" der Mundarten S. 48ff.
2.4.6Strukturelle Dialektologie
Die strukturalistische Epoche lässt man üblicherweise in der Dialektologie nicht mit der Wortfeldtheorie beginnen, sondern mit den 'Grundzügen der Phonologie' von N. Trubetzkoy von 1939 [133], denen ein Anhang über Phonologische Dialektbeschreibung beigegeben war. Die phonologische Methode der Lautstrukturbeschreibung kam jedoch in den dialektologischen Ortsund Gebietsmonographien erst ganz allmählich und in Deutschland erst seit den fünfziger Jahren in Gebrauch. Seit dem programmatischen Aufsatz von U. Weinreich, 'Is a structural dialectology possible?' von 1954 [134] hatte sozusagen der Strukturalismus auch nominell in der Dialektologie Eingang gefunden. Außer der Phonologie werden inzwischen auch die anderen grammatischen Bereiche strukturell bearbeitet. J. Goossens [135] hat mit seiner 'Strukturellen Sprachgeographie' 1969 eine erste Bestandsaufnahme der bisherigen Versuche aus dem Bereich der Phonologie und der Semantik vorgelegt, soweit sie diatopisch, d.h. sprachgeographisch angelegt sind (Einzelheiten darüber Kap. 5.1 u. 5.4).
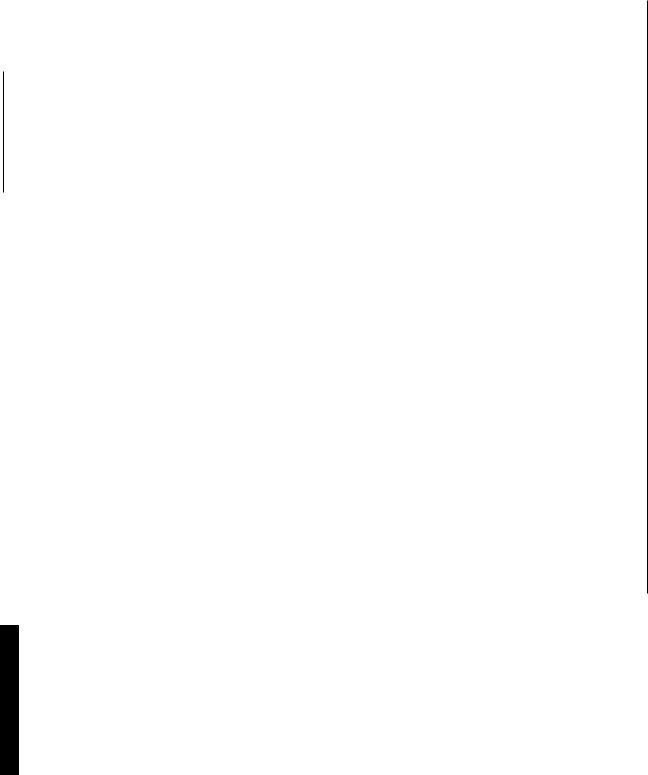
32 Geschichte und Stand der Dialektforschung
Das rein linguistische Interesse innerhalb der Dialektforschung war immer gekoppelt mit den jeweiligen Fragestellungen der Linguistik überhaupt. Die Dialektologie war insofern immer der Anwendungsbereich der zeitgenössischen linguistischen Theorie. Das eigentlich dialektspezifische Feld innerhalb der linguistischen Fragestellung ist die Dialektgeographie. Nur dort gewinnt man sprachliche Erkenntnisse über Sprachstruktur und Sprachbewegung, die man an der überregionalen Einheitssprache nicht bekommen könnte. Viele strukturelle Zusammenhänge, die sich an der Einheitssprache nur sehr schwer oder gar nicht aufdecken lassen, liegen in der geographischen Lagerung geradezu offen zutage.
Phonologische Dialektforschung neben und vor Trubetzkoy:
[132]Anton Pfalz, Zur Phonologie der baierisch-österreichischen Mundarten. Wien
1936
[133]Nikolaj S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie. Prag 1939, Göttingen 71989
[134]Uriel Weinreich, Is a structural dialectology possible? In: Ward 10, 1954, S. 388-
400
[135]lan Goossens, Strukturelle Sprachgeographie. Eine Einführung in Methodik und
Ergebnisse. Heidelberg 1969
Ein Beispiel einer strukturalistischen Ortsmonographie:
[136]Iwar Werlen, Lautstrukturen des Dialekts von Brig im schweizerischen Kanton
Wallis. Ein Versuch zur Integration strukturaler und generativer Beschreibungs~ verfahren in der Dialektologie. Wiesbaden 1977
2.5Das kulturgeographische Interesse
Die Grenzlinien, die sich auf den Lautkarten der Dialektatlanten abzeichneten, die trotz aller scheinbaren Regellosigkeit doch immer wieder durch bestimmte Bündelungen sprachliche Räume gegenüber anderen abgrenzten, bedurften einer plausiblen Erklärung. Diese wurde zunächst nicht innersprachlich versucht. Man suchte die Erklärung dafür, dass man an einem Ort oder in einer Gegend so, in der andern anders spricht, in außersprachlichen Gegebenheiten wie Topographie, Verkehr, wirtschaftliche Verhältnisse, Territorialgrenzen und anderen Faktoren. Sprache selbst war nur eine unter vielen anderen raumbildenden Kräften, selbst wieder bedingt durch alle möglichen außersprachlichen Verhältnisse.
Die Gleichung Sprachraum ~ Kulturraum galt für eine ganze forschungsgeschichtliche Epoche der Dialektologie. Es war der Versuch, die nach linguistischen Gesichtspunkten aufbereiteten sprachlichen Linien in der Landschaft in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Mit dem richtungweisenden Werk von Müller, Aubin und Frings 'Kulturströmungen in den Rheinlanden' von 1926 [137] war der entscheidende Anstoß zur extralinguistischen Interpretation im Bereich der Lautund Wortgeographie gegeben. Dass die Verbreitung gewisser Wörter sich mit Territorialoder Bistumsgrenzen deckte, dass gewisse Lautgrenzen sich an alte Kulturlandschaften anlehnten und dass gewisse Neuerungen,
Das soziologische Interesse 33
die sich auf der Sprachkarte wie Keile in einer homogenen Linienlandschaft ausnehmen, sich entlang alter oder neuer Verkehrsachsen ausdehnten, war die neue Erkenntnis. Daran schlössen sich weitere Fragestellungen an nach den Ursachen für sprachliche Bewegung überhaupt, nach der Art der sprachlichen Ausbreitung im Raum, ob in konzentrischer Wellenform, als Ausstrahlung über weite Gebiete hinweg oder als gerichtete Strömung, wo und warum solche Sprachbewegungen ausgelöst wurden oder zum Stillstand gekommen sind. Das kulturgeographische Interesse setzt das linguistische natürlich voraus. 0 hne die sprachliche Analyse auf geographischer Basis lässt sich nichts in einen außersprachlichen Begründungszusammenhang stellen. Man könnte daher auch die kulturgeographische Richtung als die eigentlich interpretierende Komponente der Dialektologie bezeichnen (vgl. die Kap. 6.2 u. 6.3).
[137]Hermann Aubin, Theodor Frings, Joset Müller, Kulturströmungen und Kultur~
provinzen in den Rheinlanden. Bonn 1926, Nachdruck 1966 (weitere Lit. unter
6.2.4)
2.6Das soziolinguistische Interesse
Soziolinguistik befasst sich mit der Abhängigkeit von Sprache von der veränderlichen Größe "Sprecher" oder "Mensch", insoweit er innerhalb einer gesellschaftlichen Verflechtung steht, einer oder mehreren Gruppen angehört, je nach sozialer Konstellation verschieden agiert und seine Sprechhandlung diesem Agieren anpasst. Die Dialektologie des normativen, des antiquarischen und des streng linguistischen Interesses ist nie soziolinguistisch ausgerichtet gewesen. Die Sprecherseite, der Mensch also in seiner sozialen Variabilität, und deren Einfluss auf das Sprachverhalten wurde nicht thematisiert. Man wusste natürlich Bescheid über den Dialektsprecher und seine soziale Merkmalsbeschreibung. Er war identisch mit dem "Volk". Dialekt war Volkssprache, d.h. die Sprache der Ungebildeten. Die Sprecherseite blieb als konstanter Hintergrund für die Betrachtung des Dialekts außerhalb der Diskussion.
In der bekannten mittelhochdeutschen Erzählung 'Meier Helmbrecht' des Werner Gaertenaere (um 1250) wird der Weitgereiste gegenüber den einheimischen Bauern dadurch gekennzeichnet, dass er verschiedene Sprachen und Dialekte spricht. So gibt sich der heimkehrende Helmbrecht als Mann von Welt, indem er neben lateinischen und böhmischen Brocken seine Angehörigen auf brabantisch anredet:
villiebe soete kindekin
ir sul! gOI willekomen sin (Vs. 716f.)
und kurz darauf auf niederdeutsch imponieren will:
ey waz snacket ir geburekin und jenez gunerte wH?

34 Geschichte und Stand der Dialektforschung
min parit, minen klären llf sol dehein gebilrie man
zeware nimmer gegripen an (Vs. 764ff.).
Bei Konrad von Megenberg (um 1350) galt mancher Landschaftsdialekt (z.B. das Ostfränkische) als Zeichen der Unbildung (nach Socin [63] 254). Fabian Frangk (1531) schließt Mundart als Sprache des gelehrten Menschen aus. Für Caspar Scoppius sind Dialektsprecher homines dissolutos, ignavos, animo omissiores, d.h. unzuverlässige, faule und geistig zurückgebliebene Leute (nach Socin [63] 326), wobei er zwischen den einzelnen Dialekten sehr wohl Prestigeunterschiede sah, etwa in folgender Reihenfolge der Bewertung von oben nach unten: Rheinisch, Schwäbisch, Schweizerisch, Sächsisch, Bairisch.
1m Zeitalter der Normsuche befasste man sich nicht mit der Unnorm und deren Sprecher. Dialekt war das zu Vermeidende, wovon man gerade wegkommen wollte. Dialekt war Zeichen von Unbildung, Anlass zu Spott. Sprachspott hätte in jener Zeit geradezu in die Definition von Dialekt aufgenommen werden können in dem Sinne, dass Dialekt die Sprache ist, über die andere lachen. Man suchte die "geläuterte Büchersprache unter feineren Menschen"· (Herder), die Sprache der oberen Klassen (Wieland) als tägliche Umgangssprache der guten und feinen Gesellschaft (Jean Paul). Neben der Zuordnung von Dialekt zu Pöbel und Unbildung (SchotteI) wurde man auch sehr früh auf einen Zusammenhang Dialekt - Konfession aufmerksam. Georg Litze!, genannt Megalissus, schrieb im Jahre 1731 in seiner Streitschrift 'Der Undeutsche Catholik oder historischer Bericht von der allzu großen Nachlässigkeit der Römisch-Catholischen, in Sonderheit unter der Clerisei der Jesuiten, in Verbesserung der deutschen Sprache und Poesie': "Die Catholiken sind darinnen unglücklich, dass sie meistentheils in solchen Landschaften gezeugt werden, worinnen eine raue Sprache in Gebrauch ist" (nach Socin [63] 365). Daneben wurde dem Dialekt vor allem im norddeutschen, d.h. niederdeutschen Gebiet sehr früh eine vis comica zugeschrieben (Wienbarg u.a.), die ihm bis heute geblieben ist. Die frühe Einschränkung des niederdeutschen Dialekts auf die Bauern prädestinierte ihn zur Sprache der Bauernkomödie und des Volkstheaters.
Auf Schulebene war man im 19. Jahrhundert auf die Diskrepanz zwischen häuslicher Sprache (Dialekt) und Schulsprache (Schriftdeutsch) gestoßen, wobei man zwischen beiden Polen verschiedene Zwischenstufen bemerkte, die man allesamt verwerflich fand. So bezeichnete Joh. Caspar Mörigkofer 1838 in seiner Schrift 'Mundart und Schriftsprache die Mundartvariante der Gebildeten in der Schweiz als "Großratsdeutsch" und die eher herablassende Variante der Schriftsprache auf Schulebene als "Schulkinder-Lehrhochdeutsch" (nach Socin [63] 508).
Die Sprachwissenschaft beschäftigte sich mit Dialekt als der lautgesetzlichen Weiterentwicklung der alten Sprachstufen. Für die Sprecher interessierte sie sich nur insoweit, als sie jeweils die Sprache der ältesten Leute am Ort untersuchte, um möglichst nahe an den Ursprung der Sprache zu kommen. Man sprach von echter oder reiner Mundart und meinte jene Form, die möglichst weit von der
Das soziologische Interesse 35
neuen Kultursprache entfernt und möglichst nahe an der historischen Sprachstufe des Mittelhochdeutschen war. Dass diese Grundsprache nicht die tatsächliche Ortssprache repräsentierte, war bekannt. Bereits 1880 forderte Ph. Wegener in einer programmatischen Arbeit die besondere Berücksichtigung von sprachlichen Zwischenstufen [138]: den Dialekt der Gebildeten, der Halbgebildeten und der bäuerlichen Mundart und deren Wechselbeziehungen (nach Schirmunski [7] 69). Die erste Kritik an Wenkers Sprachatlasmaterial richtete sich gegen die soziologische Uneinheitlichkeit der Informanten. Viele Ungereimtheiten auf den Karten ließen sich dadurch erklären, dass aus einem Ort z.B. die besagte Grundmundart gemeldet wurde, aus einem andern Orte jedoch irgendeine Zwischenstufe zwischen Dialekt und Hochsprache.
SeitP. Kretschmers 'Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache' VOn 1918 [149] war das Augenmerk auf wenigstens eine Variante zwischen Dialekt und Hochsprache gerichtet: die landschaftlich geprägte Sprechsprache der Gebildeten. Auch vom Gegenpol Dialekt her gesehen, ließ sich eine Zwischenform der gesprochenen Sprache abheben: die sogenannte Halbmundart, wozu das eben
genannte Großratsdeutsch, das Honoratiorenschwäbisch oder das sogenannte
Neuhessisch zu rechnen wäre.
Bei diesen Varianten zwischen echter Mundart und gebildeter Hochsprache blieb die eigentliche Sprecherseite unbeachtet. Die Spannung zwischen den Polen Dialekt und Hochsprache wurde weniger als der Gegensatz zwischen sozialen Gruppen betrachtet, als vielmehr geographisch in die Landschaft projiziert als Gegensatz Stadt - Land.
Nach dem Krieg kam das Sprachverhalten der Ostvertriebenen als Phänomen der sprachlichen Mobilität in den Blickpunkt des Interesses, wobei der Aspekt der Bewahrung des untergehenden Kulturund Brauchtums das eigentliche soziolinguistisehe Problem überwog. Erst in jüngerer Zeit kamen die vielfältigen Differenzierungen sprachlicher Möglichkeiten zwischen Dialekt und Hochsprache in Abhängigkeit von sozialen Strukturen in den Mittelpunkt des Interesses. Man thematisierte die Sprache der Industriearbeiter im Stadtumland-Bereich, die Sprache der Städter und einzelner Stadtbezirke, Berufsund Standessprachen, Mehrsprachigkeit und Mobilität im Sinne von sprachlichem Rollenverhalten von Einzelsprechern. Hierbei spielte die Durchlässigkeit zwischen der Ober-Sprache und dem Dialekt eine große Rolle. Die These Naumanns (1926 [139]) vom "gesunkenen Kulturgut", d.h. von der AbwärtsbewegungvOl'ider Hochsprache in
Richtung Dialekt als der einzigen Bewegungsrichtung, war dabei lange Zeit richtungweisend gewesen.
Alle diese soziolinguistischen Beobachtungen waren sozusagen als Neben-
r:.ergebnisse bei dem Bemühen angefallen, die Dialekte als raumbildende Faktoren
I |
lautlich und lexikalisch zu beschreiben. Empirische Arbeiten, die ausschließlich |
|
die Sprachschichten-Differenzierung und deren Korrelation mit sozialen Gegeben- |
|
heiten zum Thema haben, sind erst in den letzten Jahren unternommen worden, |
|
seitdem die Soziolinguistik außerhalb der Dialektproblematik dabei ist, ihre |

36Geschichte und Stand der Dialektforschung
Theorie auszubauen und operationalisierbare Versuchsanordnungen zu entwer-
fen.
Ein großangelegter Versuch des Bonner Instituts für geschichtliche Landeskunde wollte die Sprachwirklichkeit eines Ortes (Erp/Erfstadt b. Köln) in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Strukturen, von situativen Bedingungen, der dialektalen Basis am Ort und den daraus sich ergebenden Sprachniveaus empirisch untersuchen. Auch die subjektive Seite, die individualpsychologischen Faktoren als Konstituenten einer Redekonstellation und die subjektiven Einschätzungen der Sprachlichkeit durch die Sprecher selbst sollten thematisiert werden. Von 50% der Zielgruppe (220 Sprecher) wurden die Sprachdaten in einer standardisierten Aufnahmesituation, in der drei Möglichkeiten sprachlicher Wirklichkeit situativ simuliert werden, in Interview-Technik erhoben (s. Kap. 3). Die Auswertung sollte zunächst ausschließlich die sprachlichen Variablen und deren Veränderlichkeit feststellen und kategorisieren, und erst in einem zweiten Schritt wurde die Veränderlichkeit der Sprache mit den Sozialdaten im weitesten Sinne korreliert. Die Feststellung der tatsächlichen Abhängigkeiten im Sinne eines
Ursache-Wirkungs-Verhältnisses war dann Sache der Interpretation.
Ein zweites Unternehmen am Institut für empirische Kulturwissenschaft in Tübingen zielte direkt auf die Dialektproblematik. In einem Großversuch wurden die Dialektniveaus von Schulkindern erhoben und die negative Beziehung zwischen Dialektniveau und schulischem Leistungsniveau empirisch nachgewiesen. Die theoretische Grundlegung und Modelluntersuchungen hat U. Ammon [173], [175] 1972/73 vorgelegt. Seine Hypothesen gehen von einer verkürzten Definition von Dialekt auf der sprachlichen Seite und der Gesellschaftsstruktur auf der sozialen Seite aus. Dialekt ist lediglich die Sprachvariante mit geringster kommunikativer Reichweite und die Gesellschaftsstruktur auf die beiden Merkmalbereiche "manuell arbeitend" und "nicht manuell arbeitend" reduziert, was für die empirische Seite des Unternehmens keine Konsequenzen hat, sehr wohl aber für die interpretatorische, die am Ende doch zu praktischen Schlussfolgerun-
gen führen soll.
Die Abhängigkeit von Dialekt und Schulleistung bzw. die Aufdeckung von Überlagerungen (Interferenzen) zwischen dialektaler Muttersprache und hochsprachlicher Schulsprache als Fehlerquelle bei schulischen Sprachleistungen wurde mehrfach exemplarisch behandelt (Jäger [172], Hasselberg [177], Löffler
[174].
Während die genannten Arbeiten eher auf den Ist-Zustand abzielen, wollte ein drittes Projekt (s. Besch, Löffler [177]) gleich praktische Schlussfolgerungen ziehen. In einem landschaftlich begrenzten Raum des Schwarzwaldes hat die Analyse von 2000 Schülerarbeiten ergeben, dass bis zu 20% der Fehler, selbst noch auf der gymnasialen Unterstufe, als Umsetz-Pannen bei der Übertragung Dialekt _ Hochsprache interpretiert werden können. Als eine Art erste Hilfe oder praktische Nutzanwendung für diese dialektale Barriere auf Schulebene sollen kontrastive Hefte Dialekt - Hochsprache die Umsetzungsprozedur auf allen
Das soziologische Interesse 37
grammatischen Ebenen beschreiben und die wahrscheinlichen Fehlerquellen vorhersagen. Der interessierte Lehrer hatte damit ein Hilfsmittel zur Hand, die zahlreichen zunächst völlig unverständlichen Fehlleistungen zu erkennen, die auf Dialekt zurückzuführen sind, und als Umsetzungs-Pannen sprachlich entsprechend zu gewichten. Gegebenenfalls sollten dann Übungsprogramme gezielt auf die Hauptschwierigkeiten angesetzt werden. Hierzu sollten die Hefte vorbereitete Arbeitsblätter bereitstellen. Für die wichtigsten Dialektlandschaften wurde je ein Basisheft erstellt.
Die genannten drei dialektologischen Projekte im Bereich des soziolinguistischen Interesses zeigten sehr deutlich, wie wichtig die theoretische Fundierung sowohl der sprachlichen Seite im Sinne der Bereitstellung eines grammatischen Instrumentariums ist, als auch der soziologischen Seite im Sinne einer Versuchsanordnung zur Erhebung von sozialer Wirklichkeit
Wenn an irgendeiner Stelle der Kette zwischen Hypothesenbildung, Versuchsanordnung, Durchführung, Analyse der Daten und Korrelation zwischen Sprachund Sozialdaten und deren Ausdeutung ein schwaches Glied auftritt, läuft ein ganzes Unternehmen Gefahr, zu falschen Ergebnissen und Schlussfolgerungen zu kommen. Bei der Aufwendigkeit an personellem und materiellem Einsatz solcher Großversuche waren Fehlergebnisse wegen der vermutlichen Nichtwiederholbarkeit besonders misslich.
Die folgenden Kapitel sollen für den eigentlich sprachlichen Teil, die Aspekte Erhebung, grammatische Analyse und Ausdeutung, einige reflektierte Hinweise geben.
Zur soziologischen Dialektforschung vor 1950 s. A. Bach [1] § 18711.
[138]Philipp Wegener, Über deutsche Dialektforschung. In: Zeitschrift für deutsche
Philologie 9, 1880, S. 450--479
[139]Hans Naumann, Über das sprachliche Verhältnis von Oberund Unterschicht. In:
Jahrbuch für Philologie 1, 1926. S. 55fl.
[140]Friedrich Maurer, Geographische und soziologische Betrachtung in der neueren
Sprachgeschichte und Volkskunde. In: Friedrich Maurer, Volkssprache 1934,
'1964, S. 35-57
[141]Heinz Rosenkranz, Karl Spangenberg, Sprachsoziologische Studien in Thüringen.
Leipzig 1963
[142]Karl Spangenberg, Sprachsoziologie und Dialektforschung. In: Wissenschaftliche
Zeitschrift der Universität Jena 16, 1967, S. 567-675
[143]Walther Mitzka (Hrsg.), Wortgeographie und Gesellschaft. Festgabe für Ludwig
Erich Schmitt zum 60. Geb., Marburg 1968
[144]Else Hünert-Hofmann, Soziologie und Mundartforschung. In: Wortgeographie
[143].S. 1-9
[145]William Labov, Das Studium der Sprache im sozialen Kontext. In: Aspekte der
Soziolinguistik. Hrsg. von Wolfgang Klein und Dieter Wunderlich. Frankfurt a. M.
1971, S. 111-194
[146]Klaus J. Mattheier, Pragmatik und Soziologie der Dialekte. Einführung in die Kommunikative Dialektologie des Deutschen. Heidelberg 1980
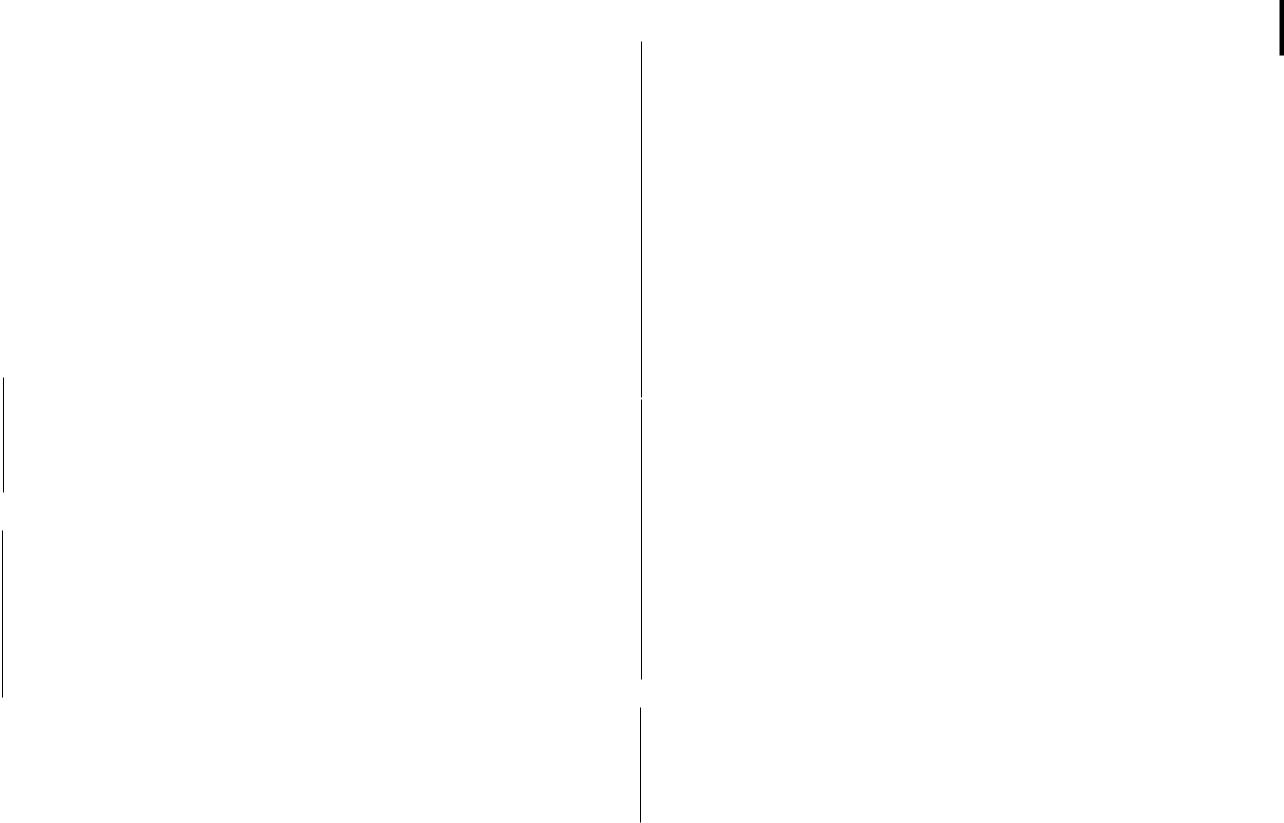
38Geschichte und Stand der Dialektforschung
[147]Heinrich Löffler, Sind Soziolekte neue Dialekte? Zum Aufgabenfeld einer nachsoziolinguistischen Dialektologie. In: Kontroversen, alte und neue. Akten des
VII. Internationalen Germanisten-Kongresses. Göttingen 1985. Bd. 4. Tübingen 1986, S. 232-239
[148]Heinrich Löffler, Germanistische Soziolinguistik. Berlin 2 1994
Zum Thema Umgangssprache (s. auch Bach [I] §189, Henzen [48], Eichel [58]):
[149]PaulKretschmer, Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen 1918, '1969
[150]Heinz Küpper. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. 6 Ede. Hamburg 1955-1970, Nachdruck Stuttgart 1988, CD-ROM, Berlin 2000
[151]Rugo Maser, Umgangssprache. Überlegungen zu ihren Formen und ihrer Stellung im Sprachganzen. In: Zeitschrift für Mundartforschung 27,1960, S. 215-232
[152]Jürgen Eichhoff, Wortatlas der deutschen Umgangssprache. 4 Bde. Bern, Mün~ ehen 1977-2000
[153]Hans Friebertshäuser, Heinrich J. Dingeldein, Wortgeographie der städtischen Alltagssprache in Hessen. Tübingen 1988
Zum Thema Stadtdialekte, Stadt~Umland-Verhältnis:
[154]Heinrich Baumgartner, Stadtmundart, Stadt~ und Landmundart. Bern 1940
[155]Wilhelm Bruckner, Sprachliche Spannung zwischen Stadt und Land. Ein Beitrag zur Geschichte der Basler Mundart. In: Zeitschrift für Mundartforschung 18, 1942, S. 30-48
[156]Hugo Moser, Vollschwäbisch, Stadtschwäbisch und Niederalemannisch. In: Alemannisches Jahrbuch 1954, S. 421-437
[157]Friedhelm Debus, Zwischen Mundart und Umgangssprache. In: Zeitschrift für Mundartforschung 29, 1962, S. 1-43
[158]Gunter Bergmann, Das Vorerzgebirgische. Mundart und Umgangssprache im Industriegebiet zwischen Karl-Marx~Stadt~Zwickau - Halle. Halle 1965
[159]Werner H. Veith, Die Stadtumland~Forschung als Gebiet der Sprachsoziologie. In: Muttersprache 77, S. 257-262
[160]Bruno F. Steinbruckner, Stadtsprache und Mundart. Eine sprachsoziologische Studie. In: Muttersprache 77,1967, S. 302-311
[161]Roger Shuy, Walter Wolfram, William K. Riley, Field Techniques in an Urban Language Study. Center for Applied Linguistics Massachusetts, NW, 1968
Neuere Stadtsprachen-Projekte:
[162]Norbert Dittmar, Brigitte Schlieben~Lange, Stadtsprache. Forschungsrichtungen und Perspektiven einer vernachlässigten soziolinguistischen Disziplin. In: KarlHeinz Bausch (Hrsg.), Mehrsprachigkeit in der Stadtregion. Düsseldorf 1982, S. 9-86
[163]Norbert Dittmar, Peter Schlobinski (Hrsg.), Wandlungen einer Stadtsprache. Berlinisch in Vergangenheit und Gegenwart. Berlin 1988
[164]Werner Kallmeyer (Hrsg.), Kommunikation in der Stadt. Teil 1: Exemplarische Analysen des Sprachverhaltens in Mannheim; Teil 2: Ethnographien von Mannheimer Stadtteilen; Teil 3: Kommunikative Stilistik einer sozialen Welt "kleiner Leute" in der Mannheimer Innenstadt; Teil 4: Kommunikative Stilistik von zwei Sozialwelten in Mannheim-Vogelstang. Berlin 1994-1995
[165]Lorenz Hofer, unter Mitarbeit von Annelies Häcki Buhofer, Heinrich Löffler, Beatrice Bürkli und Petra Leuenberger, Zur Dynamik urbanen Sprechens: Spracheinstellung und Dialektvariation. Tübingen, Basel 2001
Das soziologische Interesse 39
[166]Heinrich Löffler, Stadtsprachen~projekte im Vergleich: Basel und Mannheim. In: Ulrike Haß~Zumkehr, Werner Kallmeyer, Gisela Zifonun (Hrsg.), Ansichten der
deutschen Sprache. Festschrift für Gerhard Stickel zum 65. Geburtstag. Tübingen 2002, S. 477-500
Zum Thema Status der Dialekte (s. auch Bausinger [57]):
[167]Hans Joachim Gernentz, Niederdeutsch - gestern und heute. Beiträge zur Sprach-
situation in den nördlichen Bezirken der DDR in Geschichte und Gegenwart. Rostock 1964, '1980
[168]Rudolf Schwarzenbach, Die Stellung der Mundart in der deutschsprachigen Schweiz. Frauenfeld 1969
[169]Werner Besch (Hrsg.), Sprachverhalten in ländlichen Gemeinden. Ansätze zur Theorie und Methode. Forschungsbericht Erp~Projekt. 2 Bde. Berlin 1981-1983
[170]Wolfgang Ladin, Der elsässische Dialekt - museumsreif? Strasbourg 1982
[171]Dieter Stellmacher, Wer spricht Platt? Zur Lage des Niederdeutschen heute. Eine kurzgefasste Bestandsaufnahme. Leer 1987
Zum Thema Dialekt und Schule (s. auch Niebaum, Macha [18] Kap. 12 mit Li!.):
[172]Siegfried Jäger, Sprachnorm und Schülersprache. Allgemeine und regional
bedingte Abweichungen von der kodifizierten hochsprachlichen Norm in der geschriebenen Sprache bei Grund~ und Hauptschülern. Düsseldorf 1971,
S. 166-233
[173]Ulrich Ammon, Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule. Tübingen 1972
[174]Heinrich Löffler, Mundart als Sprachbarriere. In: Wirkendes Wort 22, 1972, S.23-39
[175]Ulrich Ammon, Dialekt und Einheitssprache in ihrer sozialen Verflechtung. Eine empirische Untersuchung. Weinheim, Basel 1973
[176]Dialekt als Sprachbarriere? Ergebnisbericht einer Tagung zur alemannischen Dialektforschung. Mit ausführlicher Bibliographie zum Thema Dialekt als Sprach ~ barriere. Tübingen 1973
[In] Wemer Besch, Heinrich Löffler, Hans H. Reich (Hrsg.), Dialekt/Hochsprache _ kontrastiv. Sprachhefte für den Deutschunterricht. Düsseldorf 1976-1981: I: Hessisch (Joachim Hasselberg, Klaus Peter Wegera), 2: Bairisch (Ludwig G. Zehenter), 3: Alemannisch (Werner Besch, Heinrich Löffler), 4: Schwäbisch
(UlrichAmmon, UlrichLoewer), 5: Westfälisch (HermannNiebaum), 6: Rheinisch (Eva Klein, Klaus J. Mattheier, Heinz Mickarz), 7: Pfälzisch (Beate Henn~Mem~
mesheimer), 8: Niedersächsisch (Dieter Stellmacher)
[178]Peter Sieber, Horst Sitta, Mundart und Standardsprache als Problem der Schule. Aarau, Frankfurt a.M. 1986

3.Spracherhebung
3.1Objektsprache und Corpus-Problem
In den früheren dialektologischen Arbeiten suchte man vergeblich nach einem Kapitel, in dem der Verfasser sich über Art und Herkunft seines Untersuchungsmaterials, seine Aufnahmemethode oder andere Besonderheiten seiner "Quelle" auslässt. In der Regel wurde wohl stillschweigend vorausgesetzt, dass der Arbeit die 40 Wenkersätze oder eine ähnliche Frageliste und die örtliche Kompetenz des Verfassers zugrunde liegen.
Rühmliche Ausnahmen bilden die Handbücher und Einleitungen zu den Sprachatlanten und einige Einführungen: Goossens [11]. Zwirner [77], Mitzka [112], Hotzenköcherle
[1151, König [124] Niebaum, Macha [18].
[179]Erika Weden, Studien zur Datenerhebung in der Dialektologie. (Zeitschrift für
Dialektologie und Linguistik Beih. 64). Wiesbaden 1984
Bei der Materialintensität und den erheblichen Schwierigkeiten bei der Erhebung, Aufbereitung und Auswertung großer Mengen von Sprachdaten muss schon der Erhebungsprozedur ein besonderes Augenmerk gewidmet sein. Wenn ein Bearbeiter auf längst vorhandene Sprachaufnahmen zurückgreift, um daran moderne Fragestellungen anzuschließen, sollte er die Bedingtheit der Materialgrundlage genau kennen. Wenn er sich selbst von neuem aufmacht, der neuen Problemstellung eine neue Materialbasis zu verschaffen, sollte er die Möglichkeiten und Grenzen sprachlicher Datengewinnung und -aufbereitung erst recht kennen und beurteilen können.
Selbst wenn man das abstrakte Sprachsystem eines Dialekts beschreiben will, also die langue, ist der Zugang immer nur über die konkrete sprachliche Äußerung, die parole, zu gewinnen. Die generative Grammatiktheorie unterscheidet in ähnlicher Weise zwischen Kompetenz als dem Sprachvermögen aller durchschnittlich gebildeten Teilhaber einer Sprachgemeinschaft und der Performanz, die jeweils hic et nunc "aufgeführte" Sprache meint mit allen Unzulänglichkeiten und Defekten. Eine Normgrammatik der deutschen Standardsprache will demnach eine Kompetenzgrammatik sein. Der Bearbeiter braucht als Teilhaber an der
Sprecher-Auswahl 41
Sprachgemeinschaft nur seine eigene Kompetenz zu beschreiben. In der Praxis wird er jedoch zur Unterstützung seines eigenen Sprachvermögens noch auf weitere Informationen zurückgreifen, auf ein sogenanntes Corpus. Hierunter versteht man einen Ausschnitt sprachlicher Äußerungen, den man repräsentativ zum Zwecke der Beschreibung der überindividuellen Sprachkompetenz als Untersuchungsmaterial zugrunde legt. Bei den normativen Grammatiken, die auch den Sprachlehren als Vorbild dienen, besteht das Corpus gewöhnlich aus den Texten anerkannter Schriftsteller der Zeit und aus Zeitungen.
Bei der Beschreibung von Mundart, die von der Definition her immer als Gegenpol zur Einheitssprache verstanden wird, stellt sich das Corpus-Problem je nach dem intendierten Untersuchungsziel verschieden. Da vor allem in jüngster Zeit die Erhebung der sprachlichen Schichten in Abhängigkeit von außersprachlichen Faktoren wie Situation, Sozialstatus, Rolle, Mobilität in den Vordergrund gerückt ist, sind Vorbereitung, Anordnung und Durchführung einer sprachlichen Erhebung für die daran anschließenden Aufbereitungsund Beschreibungsprozeduren und die angezielten Ergebnisse von entscheidender Bedeutung.
Das dialektale Corpus, d.h. die sprachlichen Daten, die der Dialektologe seiner Untersuchung zugrunde legen kann, sind äußerlich determiniert durch 1. den Raum, d.h. den Aufnahmeort der Spracherhebung, 2. den oder die Sprecher, 3. den Zeitpunkt der Aufnahme, 4. die Situation und 5. die Thematik der sprachlichen Äußerung. Die von derlei außersprachlichen "Variablen" abhängigen sprachlichen Äußerungen gilt es zu erheben. Selbst wenn eine anschließende Auswertung die Sprache nie in Abhängigkeit zu allen denkbaren Faktoren sieht und in Wirklichkeit viele Deterntinanten einfach konstant gehalten werden, müssen diese dennoch bekannt und als konstituierende Faktoren eines bestimm- ten Textes notiert sein.
3.2Sprecher-Auswahl
Wenn der Ort für eine Spracherhebung feststeht, muss ein Sprecher als Informant gefunden werden. Will man nach herkömmlicher Art die Grundmundart erheben, so muss man die ältesten Bewohner aufsuchen, die zeitlebens nie für längere Zeit aus dem Ort herausgekommen sind, deren Eltern möglichst auch schon am Ort ansässig waren. Man erhält dann die durch keine äußeren Einflüsse verfälschte ortsspezifische Sprache, die allerdings nicht für alle Einwohner repräsentativ zu sein braucht. Oft wird diese Grundmundart nur noch von wenigen alten Leuten und Kindern gesprochen. Sie ist aber ortstypisch und eignet sich für geographische Vergleiche besser als die überörtliche Umgangssprache der Berufstätigen ntittleren Alters. Große Schwierigkeiten bereitet bei den ältesten Sprechern die teilweise schon labile geistige und physische Konstitution. Was nicht schon durch artikulatorische Defekte verfälscht wird, fällt oft dem schlechten Gedächtnis oder der beschränkten Konzentrationsfähigkeit zum Opfer. So haben Explorationen
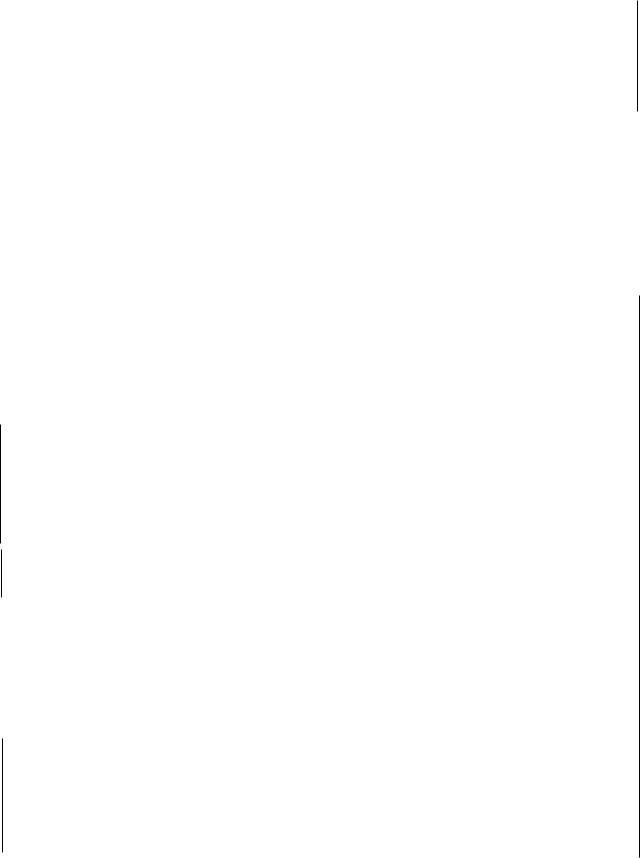
42 Spracherhebung
mit dem Ziel der Grundmundart auch schon gute Erfahrungen gemacht mit Sprechern mittleren und jüngeren Alters: deren mangelnde Sesshaftigkeit durch Auffassungsgabe, Gedächtnis und sprachliche Fertigkeit kompensiert wird. Durch die Erinnerung an früher bei den Großeltern gehörte Ausdrucksweisen treten oft ältere Formen zutage als bei den ältesten Ortseinwohnern. Die Erhebung der gesamten Sprachlichkeit eines Ortes, wie sie mit unterschiedlicher Zielsetzung von der Tübinger Arbeitsstelle (s. Kap. 2.3) und dem Bonner Institut für geschichtliche Landeskunde (s. Kap. 2.6) durchgeführt wurden, setzen im Grunde die Befragung aller Vertreter der Zielgruppe voraus. Technische Probleme bestehen beim derzeitigen Stand der Tonaufnahmegeräte weniger als solche der Aufbereitung und Auswertung angesichts der zu erwartenden Materialfülle. Hier wäre die Ermittlung der statistischen Untergrenze für eine repräsentative Auswahl an Sprechern wichtig. In der Demoskopie gilt bei einer sehr großen Zielgruppe schon ein Prozent der Population als repräsentativ. Der tatsächliche Prozentsatz, der für die Erhebung der Sprachlichkeit eines Ortes repräsentativ ist, lässt sich erst bei der
Auswertung ermitteln und kann somit erst bei einem zweiten Versuch an anderer
Stelle statistisch eingesetzt werden. Auch wird die Zahl je nach Arbeitshypothese wohl anders anzusetzen sein. Die Bonner Arbeitsgruppe ging aus Sicherheitsgründen von einer 50-prozentigen "Stichprobe" aus, damit wenigstens im ersten Versuch genügend Redundanzen (überzählige Daten) vorhanden sind, die dann eventuelle Fehler hinterher ausgleichen können. Vor der sprachlichen Erhebung ist in jedem Falle aber die Klärung der Sozialstruktur und die Erhebung aller Faktoren, die einen mutmaßlichen Einfluss auf das Sprachverhalten haben könnten, unbedingt erforderlich. Hierbei sind die Grundkenntnisse in der Methodik der empirischen Sozialforschung, insbesondere der Demoskopien, von großem Nutzen. Für die Aufnahmen des Deutschen Spracharchivs wurde die repräsentative Zahl im Voraus festgelegt. Es wurden pro Ort sechs Personen aufgenommen aus drei Altersschichten: aus dem vorberuflichen Alter bis 20 Jahre, aus dem Berufsleben bis ca. 40 Jahre und aus dem nachberuflichen Alter über 60 Jahre.
Drei Personen wurden aus dem Kreis der Heimatvertriebenen hinzugezogen.
Angaben zu Person, Beruf, Geschlecht u.a. werden miterhoben, spielen aber eine untergeordnete Rolle. Die entsprechenden Aufnahmen in der DDR hatten eine ganz ähnliche Versuchsanordnung.
Die sprachliche Auswertung solcher Aufnahmen, die überdies pro Person auf 10 Minuten freien Gespräches beschränkt sind, ist natürlich nur im Rahmen der durch die Aufnahme gesetzten Bedingungen möglich. Eine Phonologische Analyse wird schon auf Schwierigkeiten stoßen, während prosodische Elemente und die isolierten Elemente wie primäre und sekundäre Dialektmerkmale (s. Kap. 6.1) mit größeren Erfolgsaussichten analysiert werden können. Die Aufnahmen für regionale und überregionale Sprachatlanten zielen ohne Ausnahme auf die Grundmundart und damit auf die ortstypische Sprache der ältesten Sprecher. Die Zahl der Informanten ist dabei nicht festgelegt, vorausgesetzt, die Sprecher erfüllen alle die erwarteten Bedingungen. Da aber auf einer Atlaskarte pro Ortspunkt
Text-Auswahl 43
und Sprachproblem immer nur eine repräsentative Eintragung erfolgen kann, sollte die Zahl der Informanten und damit die Streuungsbreite an Varianten, die dann anmerkungsweise mitgeliefert werden müssen, nicht allzu groß sein. Eine verbindliche Personenbeschreibung des idealen Informanten für Sprachaufnahmen zum Zwecke dialektologischer Untersuchungen gibt es also nicht. Die Auswahl der Sprecher hängt jeweils ab von der Fragestellung einerseits und den örtlichen Gegebenheiten andererseits. Eine genaue Festlegung der Bedingungen und Auswahlprinzipien für das einzelne Vorhaben und die genaue Protokollierung des tatsächlichen Vorgehens sind wegen der prinzipiell zu fordernden Überprüfbarkeit und Wiederholbarkeit eines solchen Sprachexperiments unabdingbar.
3.3Text·Auswahl
Bei den ersten Sammlungen von Mundartproben im 19. Jahrhundert (s. Kap. 2.3) wurde nicht unterschieden zwischen Mundartgedicht, kunstvoller Erzählung, Anekdote, Kinderreim oder "diplomatischer" Nachschrift von mündlicher Rede. Dialekt ist jedoch von seiner Definition her gesprochene Sprache. Geschriebene Dialektdichtung als intellektuelle Kunstform ist eine Sonderform der Literatursprache und nicht Dialekt im eigentlichen Sinne. Das einzig adäquate Mittel der Fixierung von Dialekt als einer ausschließlich gesprochenen Variante der Sprache ist die lautgetreue Aufzeichnung mit einem Tonträger oder in einer Lautschrift. Die Sprachaufnahme soll wirklichkeitsgetreu sein, d.h. eine echte Sprechsituation simulieren. Die Gefahr einer unechten Sprechsituation, die zu einem Kunst-
Dialekt führt, ist bei der lebensfremden Konstellation des sprachlichen Interviews sehr groß. Wirklichkeitsnahes Sprachverhalten lässt sich steuern durch die Vorgabe echter Sprechbedingungen wie: Partner, Situation, Ort, psychische Verfassung und Thematik. Da injedem Fall ein Rest von unwirklichem Spielcharakter bleibt, empfiehlt es sich, den artifiziellen Charakter auf die außersprachlichen Faktoren zu verlegen, diese also künstlich vorzugeben und zu "stellen", innerhalb derer die Sprache dann "echt" wirkt. Ebenso kann man durch Vorgabe eines Themas die Echtheit der Sprechakte beeinflussen. Worüber soll nun der Dialektsprecher sprechen?
Seit der Differenzierung zwischen Schriftsprache und Dialekt haben sich auch die Sprachgegenstände und die Verwendungsbereiche zwischen beiden Sprachpolen aufgeteilt. Zur Schriftsprache, die auf Konvention der Bildungsschicht beruht, haben sich mehr die intellektuellen Gegenstände geschlagen: die Bildungsinhalte im weitesten Sinne, die Themen der hohen Kultur, der Wissenschaft, der Literatur und alle Bereiche des abstrakten Denkens. Themenkreise des Dialekts als der Universalsprache der Nicht-Bildungsbürger und der häuslichen Konversationssprache, gelegentlich auch der intellektuellen Schichten, sind die gegenständliche Welt der Familie, des Hauses und der Arbeit, der emotionale
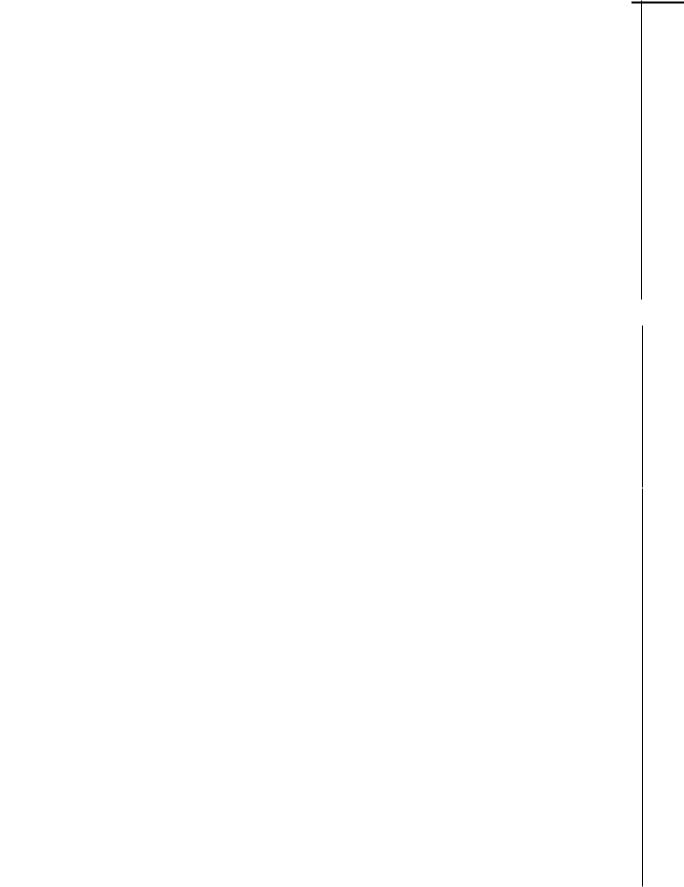
44 Spracherhebung
Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, die private und gesellige Intimsphäre. Thematik und Einsatzmöglichkeit von Dialekt hängt allerdings sehr vom Stellenwert des Dialekts im sozialen und kommunikativen Kontext der jeweiligen Sprachgemeinschaft ab. Hier zeigen sich erhebliche landschaftliche Unterschiede. In der Schweiz können bekanntlich auch intellektuelle Themen in Dialekt besprochen werden. Neue Wörter werden dabei einfach dem dialektalen Lautsystem angeglichen. Ob man in einem solchen Fall noch von Dialekt sprechen kann, wenn Thematik, Wortschatz, Satzbau und Ablauf des Gedankenganges genau mit der Schriftsprache übereinstimmen und nur eine mechanische Umsetzung in den Lautstand des Dialektes erfolgt, ist dabei zu fragen.
Um echten Dialekt im Sinne von Wirklichkeitsnähe zu bekommen, muss eine Erhebung also nicht nur echte Situationen, d.h.lebensnahe Rede-Anlässe, schaffen, sie muss auch echte Themen stellen. Für die Aufnahme der ältesten Sprachschicht, der Grundmundart, wird ein Gespräch über alte Dinge, früher gebrauchte Geräte, alte Bräuche, ehemalige Arbeitstechrtiken, vergangene Ereignisse wirklichkeitsnäher sein als über die jüngste Flurbereirtigung oder die geplante Ortskanalisation. Für eine vollständige Ortsgrammatik, die alle Aspekte der Grammatik von der Phonetik über die Flexion bis zur Syntax und Semantik enthalten soll, muss die Thematik möglichst breit angelegt sein, damit gerade im morphologischen und lexikalischen Bereich für eine vollständige Beschreibung genügend Text vorliegt. Für sprachvergleichende Arbeiten mit historischen Sprachstufen, mit verschiedenen geographischen Varianten oder mit sozial bedingten Sprachschichten sollte das Sprachmaterial möglichst einheitlich sein. Die Thematik und die Art der Befragung ist dann von untergeordneter Bedeutung, vorausgesetzt. die übrigen Bedingungen sind einheitlich und konstant gehalten. Der Grad der Einheitlichkeit richtet sich wieder nach der Problemstellung. Für eine Lautgeographie oder Soziophonetik müssen vergleichbare Laute vorhanden sein, die man am ehesten durch Erfragen identischer Wörter und Sätze erhält, in denen die Laute in möglichst verschiedenen Stellungen vorkommen. Wortgeographie setzt eine einheitliche Wortliste voraus und, was nicht übersehen werden darf, auch die Einheitlichkeit der Sachen. Bei einer vergleichenden Prosodik kommt es weniger auf identische Wörter und Sätze, sondern auf die Identität jener Bedingungen an, die vor allem auf Akzent, Satzmelodie und Tonkurvenverlauf einen Einfluss haben. Es müssen also die Gesprächssituation, die Thematik, die Intention der Rede und die psychische Verfassung vergleichbar gehalten werden.
Hieraus ergibt sich, dass Spracherhebungen ohne spezielle Problemstellungen, gewissermaßen als allgemeine Textgrundlage für alle möglichen Untersuchungen, ein recht fragwürdiges Unterfangen sind. Die Richtung der späteren Auswertung wird durch die Thematik und die gesamte Anordnung der Erhebung schon weitgehend festgelegt. Spätere Analysen sind nur im Rahmen der beobachteten Faktoren der Sprachaufnahme möglich.
Fragebuch 45
3.4Fragebuch
Unmittelbar im Zusammenhang mit der Textauswahl stellt sich das Problem des Fragebuches oder Questionnaires. Die von der komparativen Methode geforderte Vergleichbarkeit der sprachlichen Einheiten lässt sich am besten durch einen festen Fragenkatalog erreichen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1. Es werden vorgefertigte Sätze vorgelegt oder vorgesprochen, die der Informant in seine Mundart übersetzen soll. In diesen Sätzen sind die lautlichen, flexivischen und syntaktischen Probleme "verpackt", die als sprachliche Elemente hinterher beschrieben werden sollen. Diesem Typus entsprechen die Wenker-Sätze (s. Kap. 2.4.4 und Mitzka [1l2] 13-19). Bei der Vorformulierung der Sätze kann die Künstlichkeit der Fragesituation gemildert werden, indem der Satzinhalt bestimmte Kontexte, Zusammenhänge, Themenkreise anspricht, die dem Informanten die intendierte Sprechlage suggerieren. Dass dabei Sätze, die bereits 100 Jahre alt sind, nicht gerade geeignet sind, eine aktuelle Sprechiage zu provozieren, leuchtet ein. Für einen Satz wie "Die Leute sind heute alle draußen auf dem Felde und mähen" (Wenker-Satz Nr. 38, Mitzka [112] 14) fehlen im Jahre 2003 die "ergologischen", d.h. arbeitstechnischen Voraussetzungen. Es ist kaum eine Situation denkbar, in der ein bäuerlicher Sprecher eine solche Äußerung tut, da zum Mähen heute höchstens zwei, in der Regel nur eine Person gehört. Vor- gefertigte Sätze müssen also, wenn sie realistischen Kontext suggerieren sollen, thematisch eine Sprechlage intendieren, die der Sprecher tatsächlich als momentane Rolle auch wahrnehmen kann.
2. Statt vorgefertigter Sätze kann man auch Listen von Wörtern vorlegen und nachsprechen lassen. Dabei wird kein Kontext suggeriert. Die Situation ist die denkbar künstlichste, die man sich denken kann. Es kommen dabei auch die exaktesten lautlichen Formen heraus, da der Sprecher in keiner Phase von seiner Aufgabe abgelenkt wird, lautreinen Dialekt zu simulieren. Ähnliches gilt für die Aufforderung, die Zahlenreihe, die Wochenoder Monatsnamen aufzusagen. Eine derartige Liste hatte H. Fischer seinem 'Schwäbischen Atlas' ([1l0] S. IV) zugrunde gelegt. Sie enthielt 200 Wörter und begann so: 1. Fisch Sg. Fische PI. 2. Kopf Sg. Köpfe PI. 3. Kamm, Kämme, 4. Hand, Hände, 5. Wind, Winde, 6. Hund, Hunde, 7. Gans, Gänse, 8. Mensch, 9. denken, 10. Ente.
Auch neuere soziolinguistische Untersuchungen (Labov [145]) zeigen, dass beim
Sprechenlassen von Wortlisten die intendierte Sprechlage, die man dem Infor- |
|
||
manten gegenüber postuliert hat, am saubersten herauskommt. Auch bei der |
|
||
umgekehrten Aufgabe, eine Liste in möglichst reiner Hochlautung vorzulesen, |
|
||
kommen so die besten Ergebnisse zustande. Allerdings entsprechen sie in beiden |
|
||
Fällen nicht der Sprachwirklichkeit, da ein Sprecher normalerweise nie mit volleI0~.! |
|||
Konzentration auf seine Aussprache fixiert ist. |
|
~'O~ |
'" ;;.- |
.~~(CJ |
'<;;0(:, |
||
|
::J |
|
;p |
|
~ |
Bibliothek "'" |
|
|
|
:::: |
|
|
~. |
|
'!q |
|
,,~ |
|
"'~ |
QtJ'ti Ge-&'
r
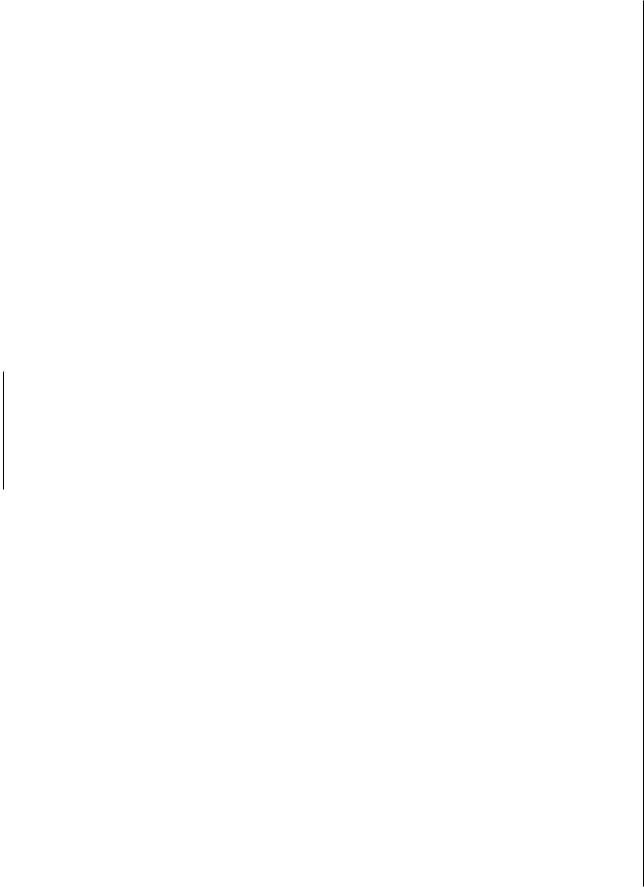
46 Spracherhebung
Statt einer Liste mit vorgegebenen Wörtern kann man auch eine Reihe von
Sachen vorlegen, zu denen der Sprecher dann die zutreffenden Wörter angibt. In dieser Form ist im Allgemeinen ein sogenanntes Fragebuch aufgebaut. Man fragt nach einer Sache, einem bestimmten Korb, einem Gerät, einer Tätigkeit oder einem Begriff, indem man das Gemeinte mit Gesten darstellt, in Worten umschreibt oder als Bild vorlegt, und lässt sich dazu das ortsübliche Wort sagen. Man nennt diese Art des Vorgehens, das von der Sache auf das Wort kommt, die onomasiologische Methode. Ein Fragebuch wird am besten auch in sich nach Sachgruppen gegliedert, damit die Aufmerksamkeit des Informanten nicht überstrapaziert wird durch dauernden Wechsel des Sachzusammenhangs. Wie der Explorator es zuwege bringt, ohne das zu erwartende Wort zu nennen, die Sache so zu beschreiben, dass die Gewährsperson unbeeinflusst das richtige Wort sagt, bleibt der Kunst des Einzelnen überlassen. Um diese aufwendige Prozedur abzukürzen, gibt es die Möglichkeit, einen Satz vorzusprechen, in dem das betreffende Wort ausgespart ist, aber kontextbedingt stehen muss. Der Informant muss dann nur die Lücke füllen, z.B. "ich hänge die Wäsche auf zum (trocknen)". Auf diese Weise wurde das Material zum 'Elsässischen Sprachatlas' (ALA) [122] abgefragt. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Fragebuch des SDS ([115] B 60), das auch für andere Erhebungen zum Vorbild geworden ist, soll einen Eindruck aus den insgesamt 2400 Fragen vermitteln:
Sachgruppe 32: Frauenarbeiten
Fragenkomplex 164: 1. das Nähkörbchen
Ja. das Durcheinander im Nähkörbchen
2."G (I) ufe"+ PI. (Sicherheitsnadel)
3.(Näh-) "Nadel"
4."Schere"+ PI.
5."Faden"+ PI.
6."Nädling" (der Faden, den man auf einmal auf die Nadel nimmt)
7."Garn"
7a. "Wolle"
8.(garn) "winden"
9.der Garnknäuel
Ein Fragebuch muss sich wiederum ganz nach dem angestrebten Untersuchungsziel richten. Die gültige Fassung entsteht erst während der Frageaktion selbst, d.h. nach einigen Probeaufnahmen. Es empfiehlt sich auch, bei der sachlichen Anordnung der Fragen jeweils das linguistische Problem zu notieren, dessentwegen die Frage überhaupt gestellt wird, damit der Explorator jederzeit weiß, welche sprachliche Frage er mit dieser Sachfrage abdecken kann. So sollte beim Verb "melken" vermerkt sein, ob dieses Wort gebraucht wird für die lautliche Kombination I + k oder für den e-Laut oder ,für eine Wortfeldfrage aus dem Bereich der Haustierhaltung'.
Von dem angestrebten Untersuchungsziel (Ortsgrammatik, Laut-und Formenatlas, Wortoder Sachgeographie) hängt Art und Umfang des Fragebuches ab.
Aufnahmemethode 47
Von der Größe eines Fragebuches hängt wiederum die Dauer einer Aufnahmeaktion ab. Wenn man über 2000 Sachfragen zu stellen hat, braucht man bei einer guten Gewährsperson fast eine Woche. Bei 500 Aufnahmeorten wird ein Explorator ein Forscherleben allein für die sprachliche Erhebung verwenden müssen.
Man wird demnach bei größeren Aktionen im Team arbeiten müssen oder bei begrenztem Untersuchungsziel ein auf diese Spezial-Hypothese zugeschnittenes Fragebuch benützen. So arbeitet der 'Lothringische Sprachatlas' [123] mit einem Fragebuch, das in weniger als einem Tag abgefragt werden kann. Die Auswertungsmöglichkeit ist damit vom Ansatz her zwar reduziert auf Phonologische Fragen und solche der strukturellen Wortgeographie, die Untersuchung lässt sich aber in überschaubarer Zeit durchund zu Ende führen.
3.5Aufnahmemethode
Nachdem Ort, Sprecher und Fragebuch festliegen, stellt sich die Frage nach der eigentlichen Aufnahmemethode. Hier unterscheidet man I. die indirekte Methode und 2. die direkte Methode.
I. Die indirekte Methode arbeitet mit Frageoder Testbogen, die an beliebig viele Orte verschickt werden können. Die Informanten sind dabei unbekannt. Die Fragebogen werden entweder an die Bürgermeisterämter, an die Schulen oder Pfarrämter verschickt, da deren Anschrift mit dem Ortsnamen identisch ist. Die Antworten bekommt man schriftlich in der gewöhnlichen Orthographie nach individueller Kunst des Schreibers. Das Material ist daher nur für solche Probleme auswertbar, bei denen es nicht auf exakte Lautschrift ankommt. Es wird schon schwierig sein, gesprochene Länge und Kürze aus den schriftlichen Antworten herauszulesen, denn ein gesprochenes Schäf kann wiedergegeben sein als Schaf, Schaaf, Schah! oder Schaff. Mit der indirekten Methode lassen sich am sichersten Wortprobleme auf onomasiologischer Basis erkunden. Schon die exakte Erhebung der tatsächlichen Bedeutung eines Wortes ist indirekt kaum zu leisten, da der Informant auf der Liste keine Möglichkeit hat, die gemeinte Sache genau zu beschreiben. Der große Vorteil der indirekten Methode ist die Möglichkeit, in kürzester Zeit für ein fast lückenloses Ortsnetz Informationen zu bekommen. Durch die maximale Ortsnetzdichte können sogar Mängel, die durch dilettanti- sche Schreibweise verursacht werden, bis zu einem gewissen Grade wieder ausgeglichen werden. Die großen deutschen Atlaswerke und einige Regionalatlanten verwenden die indirekte Methode.
2. Die direkte Methode wurde schon vor der Jahrhundertwende von K. Haag [111] und K. Bohnenberger [100] angewandt. Der Befrager ging dabei persönlich von Ort zu Ort und nahm die Sprache seiner Informanten direkt an Ort und Stelle zu Papier. Da auf diese Weise immer nur eine begrenzte Zahl von Orten besucht
