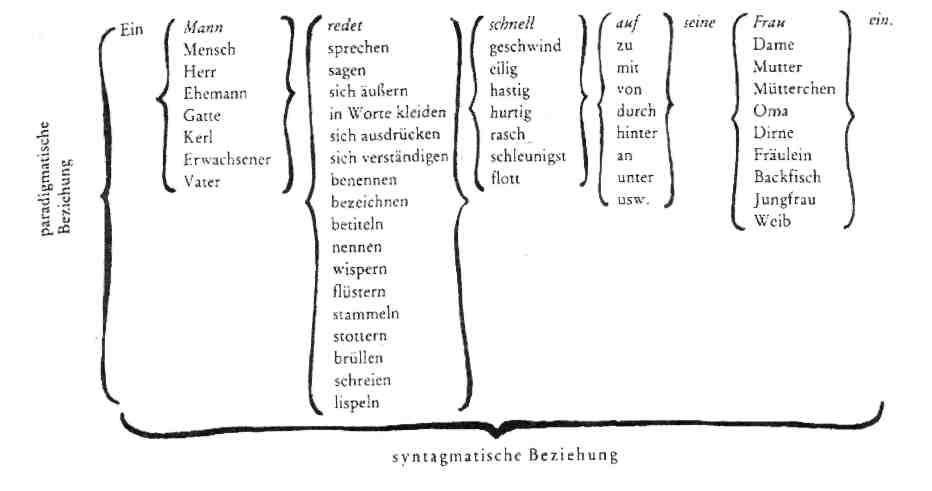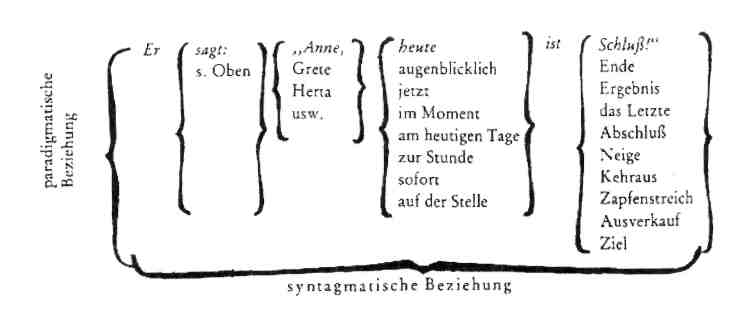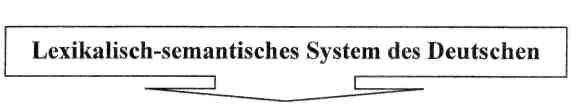

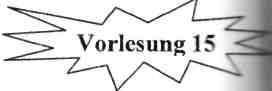
Thema 5. Das lexikalisch-semantische System der Sprache
Gliederung
Paradigmatische und syntagmatische Beziehungen
Synonyme
Theoretische Probleme der Synonymie
Synonymische Reihen und Klassifikation der Synonyme
5.3. Antonyme
Theoretische Probleme der Antonymie
Klassifikation der Antonyme
5.1. Paradigmatische und syntagmatische Beziehungen
Der Wortschatz ist keine chaotische Ansammlung von Wörtern. Die Wörter stehen zueinander in mannigfaltigen Beziehungen, bilden verschiedene, verhältnismässig geschlossene Gruppen. Aus der Grammatik ist bekannt, dass die Wörter nach den morphologisch-syntaktischen Charakteristiken in größeren Gruppen, in den so genannten lexikalisch-grammatischen Klassen bzw. Wortarten, erfasst werden. Diese Wortklassen werden in der Grammatik untersucht.
Seit Ferdinand de Saussure ist es üblich, die systemhaften Beziehungen in der Lexik als paradigmatische und syntagmatische Relationen zu klassifizieren. Paradigmatik und Syntagmatik bedingen einander. Jede lexikalische Einheit im Wortbestand hat Eigenschaften, auf denen ihre Fügung in der Rede beruht.
Paradigmatische Beziehungen bestehen zwischen den lexikalischen Einheiten, die auf Grund gemeinsamer Eigenschaften die gleiche Position in der Redekette einnehmen können. Die Ausgliederung paradigmatischer Gruppen ist sehr kompliziert und kann verschieden vorgenommen werden, je nachdem, auf welcher Ebene „gemeinsame Eigenschaften" angenommen werden. So bilden z.B. die Verwandtschaftsbezeichnungen (Vater, Mutter, Sohn, Tochter usw.) eine paradigmatische Gruppe, denn alle diese Substantive bezeichnen Personen nach der Verwandschaft, d.h. sie bilden ein „lexikalisches Paradigma".
Auf der paradigmatischen Ebene können verschiedene Gruppen von Wörtern ausgesondert werden. Nach dem rein semantischen Prinzip können die Wörter in folgende paradigmatische Gruppen eingeteilt werden:
lexikalisch-thematische Gruppen: Reise; Theater; Beim Arzt
assoziative Reihen, z.B.: Geburtstag: Geschenke, Wein, Gäste, essen, lustig...
kommunikative Absichten (Intentionen) oder Redeaufgaben: z.B. Widersprechen: Ganz im Gegenteil. Da bin ich anderer Meinung; Keinesfalls!
Wortverbindungen: Briefe schreiben / lesen / beantworten / aufbewahren
Hyperonym-Hyponym-Beziehungen: Verkehrsmittel: Erde (Zug, Auto, Fahrrad) ... Luft (Flugzeug, Hubschrauber)...
Antonyme, Synonyme u.a. (Eingehender sieh unten - 5.4.2.)
Nach dem semantisch-wortbildenden Prinzip lassen sich Wortnischen und Wortstände einerseits, Fächerungen und Wortfamilien, andererseits, aussondern.
214
 Unter
syntagmatischen
Beziehungen
werden Beziehungen zwischen den Wörtern verstanden, die miteinander
zur Redekette gefügt werden können. Die Aufnahme einer
lexikalischen Einheit in den Text ist die Realisierung ihrer
syntagmatischen Beziehungen im System. Es sind folglich Beziehungen
zwischen den Wörtern, die im Kontext gemeinsam vorkommen oder
vorkommen können. Es handelt sich also um Wortverbindungen
verschiedenster Art, in denen die Wortverbindbarkeit realisiert wird.
Somit sind die syntagmatischen Beziehungen als Beziehungen der
Verknüpfbarkeit in der Äußerung zu betrachten. Die Fähigkeit
eines Wortes, mit anderen Wörtern Verbindungen einzugehen, hängt
von der Valenz
ab.
Bei der Erforschung der syntagmatischen Beziehungen der
Spracheinheiten gewinnt die Valenz-und Distributionsanalyse (über
die Distribution sieh oben, §1,
S.
8) immer
mehr an Bedeutung. Die Valenztheorie beschäftigt sich mit der
Eigenschaft
von Wörtern (vor allem von Verben, aber auch von Substantiven und
Adjektiven), andere
Wörter an sich zu binden. Luden
Tesniere (1893-1954)
gilt
als Begründer der Valenzgrammatik.
Unter
syntagmatischen
Beziehungen
werden Beziehungen zwischen den Wörtern verstanden, die miteinander
zur Redekette gefügt werden können. Die Aufnahme einer
lexikalischen Einheit in den Text ist die Realisierung ihrer
syntagmatischen Beziehungen im System. Es sind folglich Beziehungen
zwischen den Wörtern, die im Kontext gemeinsam vorkommen oder
vorkommen können. Es handelt sich also um Wortverbindungen
verschiedenster Art, in denen die Wortverbindbarkeit realisiert wird.
Somit sind die syntagmatischen Beziehungen als Beziehungen der
Verknüpfbarkeit in der Äußerung zu betrachten. Die Fähigkeit
eines Wortes, mit anderen Wörtern Verbindungen einzugehen, hängt
von der Valenz
ab.
Bei der Erforschung der syntagmatischen Beziehungen der
Spracheinheiten gewinnt die Valenz-und Distributionsanalyse (über
die Distribution sieh oben, §1,
S.
8) immer
mehr an Bedeutung. Die Valenztheorie beschäftigt sich mit der
Eigenschaft
von Wörtern (vor allem von Verben, aber auch von Substantiven und
Adjektiven), andere
Wörter an sich zu binden. Luden
Tesniere (1893-1954)
gilt
als Begründer der Valenzgrammatik.
Am Beispiel des Theaters erläutert er seine Theorie:
Für ein Theaterstück benötigt man zunächst eine Handlung. Sie entspricht im Satz (in der Regel) dem Vollverb. Für das Bühnenstück werden außerdem Mitspieler benötigt, da ohne sie die Handlung nicht (oder nur eingeschränkt) stattfinden könnte. In der Valenzgrammatik werden sie „Ergänzungen" (d.h.Aktanten, Mitspieler) genannt. So fordert jedes Verb eine ganz bestimmte Anzahl von Ergönzungen {quantitative Valenz) in einer festgelegten grammatischen und semantischen Form {qualitative Valenz). Das ist die Wertigkeit (=Valenz) eines Verbs. Zu einem Theaterstück gehört schließlich noch das Bühnenbild, die Bestandteile der Kulisse. Valenzgrammatisch werden diese Teile als Angaben" bezeichnet, die beliebig hinzufügbar oder weglassbar sind und das zeitliche, räumliche, kausale usw.Umfeld für die Handlung darstellen. Ergänzungen (Aktanten) und Angaben bilden die Satzglieder eines Satzes.
Der Valenzträger wird auch „Regens" genannt, die abhängigen Elemente heißen „Dependentien". Die Valenz lässt sich dabei gut mit der Wertigkeit eines Atoms verglichen, welches nur eine festgelegte Anzahl an Bindungspartnern haben kann. Verben eröffnen Leerstellen um sich, die durch Wörter bestimmter Wortklassen ausgefüllt werden können. Die Wahl des Verbs ist für die grammatische Konstruktion des deutschen Satzes (nach der Duden-Grammatik) entscheidend. Beispiele:
Husten: wer,was? hustet? (1-wertiges Verb). Das Kind hustet.
Wohnen: wer, was? wohnt wo? (2-wertiges Verb). Mein Bruder wohnt in Kyjiw.
Schenken: wer,was? schenkt wem?, wen, was? (3-wertiges Verb). Die Eltern schenken dem Kind ein Fahrrad.
Schreiben: wer,was? schreibt wem bzw.an wen?wen, was? worüber? (4-wertiges Verb). Nina schreibt ihrer Freundin eine Mail über ihren Urlaub
Vergleichen wir aber/ Peter kauft Gesundheit. Dieser Satz ist grammatisch korrekt, jedoch ist er semantisch eigentlich nicht möglich. Ein Abstraktum (z:B. Gesundheit, Wahrheit, Ehrlichkeit, Liebe) als Produkt, das gekauft wird (was?), ist bei diesem Verb nicht vorgesehen. Die semantische Verträglichkeit von Wörtern im Kontext wird „Kompatibilität" (сумісність) genannt, welche für die Syntagmatik die entscheidende Rolle spielt. Eben sie bestimmt die semantische Valenz. Das Substantiv Felsen kann nicht mit Verben verbunden werden, in deren Bedeutung das Sem belebt enthalten ist. Manche Wörter können auf Grund ihrer semantischen Struktur mit vielen Wörtern verbunden werden, andere aber sind sehr beschränkt verbindbar:
-nach Hause laufen
- langsam laufen - blonde Haare laufen - in einer Stunde 5 km laufen blond - eine blonde Frau
- den ganzen Weg laufen - ein kühles Blondes
Auf der syntagmatischen Ebene lassen sich die so genannten syntaktischen Felder ausgliedern. Als Beispiel dazu führen wir das semantisch-syntaktische Feld des Verbs „erzählen".
215
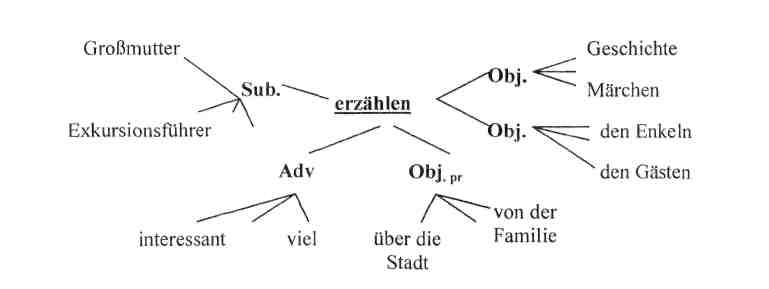
216