
- •Alphabetisch
- •Historisch
- •1915 Das Unbewußte
- •I. Die Rechtfertigung des Unbewussten
- •II. Die Vieldeutigkeit des Unbewussten und der topische Gesichtspunkt
- •III. Unbewusste Gefühle
- •IV. Topik und Dynamik der Verdrängung
- •V. Die besonderen Eigenschaften des Systems Ubw
- •VI. Der Verkehr der beiden Systeme
- •VII. Die Agnoszierung des Unbewussten
- •Anhang a. Freud und Ewald Hering
- •Anhang b. Der psycho-physische Parallelismus
- •Anhang c. Wort und Ding
- •I. Das Lustprinzip und seine Einschränkung durch das Realitätsprinzip
- •II. Traumatische Neurose und Kinderspiel als Wiederholung
- •III. Wiederholungszwang und Übertragungsneurosen
- •IV. Spekulation über ein « Jenseits des Lustprinzips ». Reizschutz und Trauma
- •V. Revision der Trieblehre. Ichtriebe und Sexualtriebe
- •VI. Biologische Argumente für die Annahme der Todestriebe
- •[VI. Biologische Argumente für die Annahme der Todestriebe: Erneute Revision der Trieblehre. Lebens- und Todestriebe]
- •VII. Schlussfolgerungen
- •1) Totem und Tabu (1912-13).
- •2) Totem und Tabu.
- •I. Bewusstsein und Unbewusstes
- •2) Das Unbewußte. (1915).
- •III. Das Ich und das Über-Ich (Ichideal)
- •IV. Die beiden Triebarten
- •V. Die Abhängigkeiten des Ichs
- •3) Totem und Tabu (1912-13).
- •Vorworte
- •Vorbemerkung [zur ersten Auflage]
- •Vorwort zur zweiten Auflage
- •Vorwort zur dritten Auflage
- •Vorwort zur vierten Auflage
- •Vorwort zur fünften Auflage
- •Vorwort zur sechsten Auflage
- •I. Die wissenschaftliche Literatur der Traumprobleme
- •II. Die Methode der Traumdeutung. Die Analyse eines Traummusters
- •III. Der Traum ist eine Wunscherfüllung
- •IV. Die Traumentstellung
- •V. Das Traummaterial und die Traumquellen
- •VI. Die Traumarbeit
- •I. Die sekundäre Bearbeitung
- •VII. Zur Psychologie der Traumvorgänge
- •Vergessen von Eigennamen.
- •II. Vergessen von fremdsprachigen Worten.
- •III. Über die Deckerinnerungen.
- •IV. Das Versprechen.
- •V. Verlesen und Verschreiben.
- •VI. Vergessen von Eindrücken und Vorsätzen.
- •VII. Das Vergreifen.
- •VIII. Symptom und Zufallshandlungen.
- •IX. Irrtümer.
- •X. Determinismus. Zufalls und Aberglauben. Gesichtspunkte.
- •I. Einleitung
- •III. Die Tendenzen des Witzes
- •IV. Der Lustmechanismus und die Psychogenese des Witzes
- •V. Die Motive des Witzes. Der Witz als sozialer Vorgang
- •VI. Die Beziehung des Witzes zum Traum und zum Unbewußten
- •VII. Der Witz und die Arten des Komischen
- •II. Krankengeschichte und Analyse
- •III. Epikrise
- •XI Nachträge
- •1) Widerstand und Gegenbesetzung
- •2) Angst aus Umwandlung von Libido
- •3) Verdrängung und Abwehr
- •Vorwort
- •I. Die Inzestscheu
- •II. Das Tabu und die Ambivalenz der Gefühlsregungen
- •III. Animismus, Magie und Allmacht der Gedanken
- •IV. Die infantile Wiederkehr des Totemismus
- •5 Psychoanalyse Werke
- •I. Der Krankheitszustand
- •II. Der erste Traum
- •III. Der zweite Traum
- •IV. Nachwort
- •I. Einleitung
- •II. Krankengeschichte und Analyse
- •III. Epikrise
- •1. Aus der Krankengeschichte
- •II. Zur Theorie
- •I. Krankengeschichte
- •II. Deutungsversuche
- •III. Über den paranoischen Mechanismus
- •I Einführung
- •II. Übersicht des Milieus und der Krankengeschichte
- •III. Die Verführung und ihre nächsten Folgen
- •IV. Der Traum und die Urszene
- •V. Einige Diskussionen
- •VI. Die Zwangsneurose
- •VII. Analerotik und Kastrationskomplex
- •VIII. Nachträge aus der Urzeit – Lösung
- •IX. Zusammenfassungen und Probleme
- •I. Moses, ein Ägypter
- •II. Wenn Moses ein Ägypter war ...
- •III. Moses, sein Volk und die monotheistische Religion
- •Vorbemerkung I
- •Vorbemerkung II
- •3) Totem und Tabu (1912-13).
- •Vorwort
- •1. Vorlesung. Einleitung
- •2. Vorlesung. Die Fehlleistungen
- •3. Vorlesung. Die Fehlleistungen (Fortsetzung)
- •4. Vorlesung. Die Fehlleistungen (Schluß)
- •5. Vorlesung. [Der Traum] Schwierigkeiten und erste Annäherungen
- •6. Vorlesung. [Der Traum] Voraussetzungen und Technik der Deutung
- •7. Vorlesung. Manifester Trauminhalt und latente Traumgedanken
- •8. Vorlesung. Kinderträume
- •9. Vorlesung. Die Traumzensur
- •10. Vorlesung. Die Symbolik im Traum
- •11. Vorlesung. Die Traumarbeit
- •12. Vorlesung. Analysen von Traumbeispielen
- •13. Vorlesung. Archaische Züge und Infantilismus des Traumes
- •14. Vorlesung. Die Wunscherfüllung
- •15. Vorlesung. Unsicherheiten und Kritiken
- •16. Vorlesung. Psychoanalyse und Psychiatrie
- •17. Vorlesung. Der Sinn der Symptome
- •18. Vorlesung. Die Fixierung an das Trauma, das Unbewußte
- •19. Vorlesung. Widerstand und Verdrängung
- •20. Vorlesung. Das menschliche Sexualleben
- •21. Vorlesung. Libidoentwicklung und Sexualorganisationen
- •22. Vorlesung. Gesichtspunkte der Entwicklung und Regression. Ätiologie
- •23. Vorlesung. Die Wege der Symptombildung
- •24. Vorlesung. Die gemeine Nervosität
- •25. Vorlesung. Die Angst
- •26. Vorlesung. Die Libidotheorie und der Narzißmus
- •27 Vorlesung. Die Übertragung
- •28. Vorlesung. Die analytische Therapie
- •29. Vorlesung. Revision der Traumlehre
- •30. Vorlesung. Traum und Okkultismus
- •31. Vorlesung. Die Zerlegung der psychischen Persönlichkeit
- •32. Vorlesung. Angst und Triebleben
- •33. Vorlesung. Die Weiblichkeit
- •34. Vorlesung. Aufklärungen, Anwendungen, Orientierungen
- •35. Vorlesung. Über eine Weltanschauung
- •I. Kapitel
- •II. Kapitel
- •III. Kapitel
- •IV. Kapitel
- •V. Kapitel
- •VI. Kapitel
- •III. Theoretisches.
- •I. Sind alle hysterischen Phänomene ideogen?
- •II. Die intracerebrale tonische Erregung. – Die Affecte.
- •III. Die hysterische Conversion.
- •IV. Hypnoide Zustände.
- •V. Unbewusste und bewusstseinsunfähige Vorstellungen. Spaltung der Psyche.
- •VI. Originäre Disposition; Entwicklung der Hysterie.
IV. Die infantile Wiederkehr des Totemismus
Von der Psychoanalyse, welche zuerst die regelmäßige Überdeterminierung psychischer Akte und Bildungen aufgedeckt hat, braucht man nicht zu besorgen, daß sie versucht sein werde, etwas so Kompliziertes wie die Religion aus einem einzigen Ursprung abzuleiten. Wenn sie in notgedrungener, eigentlich pflichtgemäßer Einseitigkeit eine einzige der Quellen dieser Institution zur Anerkennung bringen will, so beansprucht sie zunächst für dieselbe die Ausschließlichkeit so wenig wie den ersten Rang unter den zusammenwirkenden Momenten. Erst eine Synthese aus verschiedenen Gebieten der Forschung kann entscheiden, welche relative Bedeutung dem hier zu erörternden Mechanismus in der Genese der Religion zuzuteilen ist; eine solche Arbeit überschreitet aber sowohl die Mittel als auch die Absicht des Psychoanalytikers.
1
In der ersten Abhandlung dieser Reihe haben wir den Begriff des Totemismus kennengelernt. Wir haben gehört, daß der Totemismus ein System ist, welches bei gewissen primitiven Völkern in Australien, Amerika, Afrika die Stelle einer Religion vertritt und die Grundlage der sozialen Organisation abgibt. Wir wissen, daß der Schotte McLennan 1869 das allgemeinste Interesse für die bis dahin nur als Kuriosa gewürdigten Phänomene des Totemismus in Anspruch nahm, indem er die Vermutung aussprach, eine große Anzahl von Sitten und Gebräuchen in verschiedenen alten wie modernen Gesellschaften seien als Überreste einer totemistischen Epoche zu verstehen. Die Wissenschaft hat seither diese Bedeutung des Totemismus im vollen Umfange anerkannt. Als eine der letzten Äußerungen über diese Frage will ich eine Stelle aus den Elementen der Völkerpsychologie von W. Wundt (1912, p. 139) zitieren: »Nehmen wir alles dies zusammen, so ergibt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der Schluß, daß die totemistische Kultur überall einmal eine Vorstufe der späteren Entwicklungen und eine Übergangsstufe zwischen dem Zustand des primitiven Menschen und dem Helden- und Götterzeitalter gebildet hat.«
Die Absichten der vorliegenden Abhandlungen nötigen uns zu einem tieferen Eingehen auf die Charaktere des Totemismus. Aus Gründen, welche später ersichtlich werden sollen, bevorzuge ich hier eine Darstellung von S. Reinach, der im Jahre 1900 nachstehenden Code du totemisme in zwölf Artikeln, gleichsam einen Katechismus der totemistischen Religion, entworfen hat [Fußnote]Revue scientifique, Oktober 1900, abgedruckt in des Autors vierbändigem Werke Cultes, mythes et religions (1905–12, Bd. I, 17 ff.).:
1. Gewisse Tiere dürfen weder getötet noch gegessen werden, aber die Menschen ziehen Individuen dieser Tiergattungen auf und schenken ihnen Pflege.
2. Ein zufällig verstorbenes Tier wird betrauert und unter den gleichen Ehrenbezeigungen bestattet wie ein Mitglied des Stammes.
3. Das Speiseverbot bezieht sich gelegentlich nur auf einen bestimmten Körperteil des Tieres.
4. Wenn man ein für gewöhnlich verschontes Tier unter dem Drange der Notwendigkeit töten muß, so entschuldigt man sich bei ihm und sucht die Verletzung des Tabu, den Mord, durch mannigfache Kunstgriffe und Ausflüchte abzuschwächen.
5. Wenn das Tier rituell geopfert wird, wird es feierlich beweint.
6. Bei gewissen feierlichen Gelegenheiten, religiösen Zeremonien, legt man die Haut bestimmter Tiere an. Wo der Totemismus noch besteht, sind dies die Totemtiere.
7. Stämme und Einzelpersonen legen sich Tiernamen bei, eben die der Totemtiere.
8. Viele Stämme gebrauchen Tierbilder als Wappen und verzieren mit ihnen ihre Waffen; Männer malen sich Tierbilder auf den Leib oder lassen sich solche durch Tätowierung einritzen.
9. Wenn der Totem zu den gefürchteten und gefährlichen Tieren gehört, so wird angenommen, daß er die Mitglieder des nach ihm genannten Stammes verschont.
10. Das Totemtier beschützt und warnt die Angehörigen des Stammes.
11. Das Totemtier kündigt seinen Getreuen die Zukunft an und dient ihnen als Führer.
12. Die Mitglieder eines Totemstammes glauben oft daran, daß sie mit dem Totemtier durch das Band gemeinsamer Abstammung verknüpft sind.
Man kann diesen Katechismus der Totemreligion erst würdigen, wenn man in Betracht zieht, daß Reinach hier auch alle Anzeichen und Resterscheinungen eingetragen hat, aus denen man den einstigen Bestand des totemistischen Systems erschließen kann. Eine besondere Stellung dieses Autors zum Problem zeigt sich darin, daß er dafür die wesentlichen Züge des Totemismus einigermaßen vernachlässigt. Wir werden uns überzeugen, daß er von den zwei Hauptsätzen des totemistischen Katechismus den einen in den Hintergrund gedrängt, den anderen völlig übergangen hat.
Um von den Charakteren des Totemismus ein richtiges Bild zu gewinnen, wenden wir uns an einen Autor, welcher dem Thema ein vierbändiges Werk gewidmet hat, das die vollständigste Sammlung der hieher gehörigen Beobachtungen mit der eingehendsten Diskussion der durch sie angeregten Probleme verbindet. Wir werden J. G. Frazer, dem Verfasser von Totemism and Exogamy (1910), für Genuß und Belehrung verpflichtet bleiben, auch wenn die psychoanalytische Untersuchung zu Ergebnissen führen sollte, welche weit von den seinigen abweichen [Fußnote]Vielleicht tun wir aber vorher gut daran, dem Leser die Schwierigkeiten vorzuführen, mit denen Feststellungen auf diesem Gebiete zu kämpfen haben: Zunächst: die Personen, welche die Beobachtungen sammeln, sind nicht dieselben, welche sie verarbeiten und diskutieren, die ersteren Reisende und Missionäre, die letzteren Gelehrte, welche die Objekte ihrer Forschung vielleicht niemals gesehen haben. – Die Verständigung mit den Wilden ist nicht leicht. Nicht alle der Beobachter waren mit den Sprachen derselben vertraut, sondern mußten sich der Hilfe von Dolmetschern bedienen oder in der Hilfssprache des pidgin-english mit den Ausgefragten verkehren. Die Wilden sind nicht mitteilsam über die intimsten Angelegenheiten ihrer Kultur und eröffnen sich nur solchen Fremden, die viele Jahre in ihrer Mitte zugebracht haben. Sie geben aus den verschiedenartigsten Motiven (vgl. Frazer, 1910, Bd. 1, 150 f.) oft falsche oder mißverständliche Auskünfte. – Man darf nicht daran vergessen, daß die primitiven Völker keine jungen Völker sind, sondern eigentlich ebenso alt wie die zivilisiertesten, und daß man kein Recht zur Erwartung hat, sie würden ihre ursprünglichen Ideen und Institutionen ohne jede Entwicklung und Entstellung für unsere Kenntnisnahme aufbewahrt haben. Es ist vielmehr sicher, daß sich bei den Primitiven tiefgreifende Wandlungen nach allen Richtungen vollzogen haben, so daß man niemals ohne Bedenken entscheiden kann, was an ihren gegenwärtigen Zuständen und Meinungen nach Art eines Petrefakts die ursprüngliche Vergangenheit erhalten hat und was einer Entstellung und Veränderung derselben entspricht. Daher die überreichlichen Streitigkeiten unter den Autoren, was an den Eigentümlichkeiten einer primitiven Kultur als primär und was als spätere sekundäre Gestaltung aufzufassen sei. Die Feststellung des ursprünglichen Zustandes bleibt also jedesmal eine Sache der Konstruktion. – Es ist endlich nicht leicht, sich in die Denkungsart der Primitiven einzufühlen. Wir mißverstehen sie ebenso leicht wie die Kinder und sind immer geneigt, ihr Tun und Fühlen nach unseren eigenen psychischen Konstellationen zu deuten.
»Ein Totem«, schrieb Frazer in seinem ersten Aufsatz [Fußnote]Totemism, Edinburgh 1887, abgedruckt im ersten Band des großen Werkes Totemism and Exogamy (1910)., »ist ein materielles Objekt, welchem der Wilde einen abergläubischen Respekt bezeugt, weil er glaubt, daß zwischen seiner eigenen Person und jedem Ding dieser Gattung eine ganz besondere Beziehung besteht ... Die Verbindung zwischen einem Menschen und seinem Totem ist eine wechselseitige, der Totem beschützt den Menschen, und der Mensch beweist seine Achtung vor dem Totem auf verschiedene Arten, so z. B. daß er ihn nicht tötet, wenn es ein Tier, und nicht abpflückt, wenn es eine Pflanze ist. Der Totem unterscheidet sich vom Fetisch darin, daß er nie ein Einzelding ist wie dieser, sondern immer eine Gattung, in der Regel eine Tier- oder Pflanzenart, seltener eine Klasse von unbelebten Dingen und noch seltener von künstlich hergestellten Gegenständen ...«
»Man kann mindestens drei Arten von Totem unterscheiden:
1. den Stammestotem, an dem ein ganzer Stamm teilhat und der sich erblich von einer Generation auf die nächste überträgt;
2. den Geschlechtstotem, der allen männlichen oder allen weiblichen Mitgliedern eines Stammes mit Ausschluß des anderen Geschlechtes angehört, und
3. den individuellen Totem, der einer einzelnen Person eignet und nicht auf deren Nachkommenschaft übergeht ...« Die beiden letzten Arten von Totem kommen an Bedeutung gegen den Stammestotem nicht in Betracht. Es sind, wenn nicht alles täuscht, späte und für das Wesen des Totem wenig bedeutsame Bildungen.
»Der Stammestotem (Clantotem) ist Gegenstand der Verehrung einer Gruppe von Männern und Frauen, die sich nach dem Totem nennen, sich für blutsverwandte Abkömmlinge eines gemeinsamen Ahnen halten und durch gemeinsame Pflichten gegeneinander wie durch den Glauben an ihren Totem miteinander fest verbunden sind.«
»Der Totemismus ist sowohl ein religiöses wie ein soziales System. Nach seiner religiösen Seite besteht er in den Beziehungen gegenseitiger Achtung und Schonung zwischen einem Menschen und seinem Totem, nach seiner sozialen Seite in den Verpflichtungen der Clanmitglieder gegeneinander und gegen andere Stämme. In der späteren Geschichte des Totemismus zeigen dessen beide Seiten eine Neigung auseinanderzugehen; das soziale System überlebt häufig das religiöse, und umgekehrt verbleiben Reste von Totemismus in der Religion solcher Länder, in denen das auf den Totemismus gegründete soziale System verschwunden ist. Wie diese beiden Seiten des Totemismus ursprünglich miteinander zusammenhängen, können wir bei unserer Unkenntnis über dessen Ursprünge nicht mit Sicherheit sagen. Doch ergibt sich im ganzen eine starke Wahrscheinlichkeit dafür, daß die beiden Seiten des Totemismus zu Anfang unzertrennlich voneinander waren. Mit anderen Worten, je weiter wir zurückgehen, desto deutlicher zeigt es sich, daß der Stammesangehörige sich zur selben Art zählt wie seinen Totem und sein Verhalten gegen den Totem von dem gegen einen Stammesgenossen nicht unterscheidet.«
In der speziellen Beschreibung des Totemismus als eines religiösen Systems stellt Frazer voran, daß die Mitglieder eines Stammes sich nach ihrem Totem nennen und in der Regel auch glauben, daß sie von ihm abstammen. Die Folge dieses Glaubens ist es, daß sie das Totemtier nicht jagen, nicht töten und nicht essen und sich jeden anderen Gebrauch des Totem versagen, wenn er etwas anderes als ein Tier ist. Die Verbote, den Totem nicht zu töten und nicht zu essen, sind nicht die einzigen Tabu, die ihn betreffen; manchmal ist es auch verboten, ihn zu berühren, ja, ihn anzuschauen; in einer Anzahl von Fällen darf der Totem nicht bei seinem richtigen Namen genannt werden. Die Übertretung dieser den Totem schützenden Tabugebote straft sich automatisch durch schwere Erkrankungen oder Tod [Fußnote]Vgl. die Abhandlung über das Tabu..
Exemplare des Totemtieres werden gelegentlich von dem Clan aufgezogen und in der Gefangenschaft gehegt [Fußnote]Wie heute noch die Wölfe im Käfig an der Kapitolsstiege in Rom, die Bären im Zwinger von Bern.. Ein tot aufgefundenes Totemtier wird betrauert und bestattet wie ein Clangenosse. Mußte man ein Totemtier töten, so geschah es unter einem vorgeschriebenen Rituale von Entschuldigungen und Sühnezeremonien.
Von seinem Totem erwartete der Stamm Schutz und Schonung. Wenn er ein gefährliches Tier war (Raubtier, Giftschlange), so setzte man voraus, daß er seinen Genossen nichts zuleide tun würde, und wo sich diese Voraussetzung nicht bestätigte, wurde der Beschädigte aus dem Stamme ausgestoßen. Eide, meint Frazer, waren ursprünglich Ordalien; viele Abstammungs- und Echtheitsproben wurden so dem Totem zur Entscheidung überlassen. Der Totem hilft in Krankheiten, gibt dem Stamme Vorzeichen und Warnungen. Die Erscheinung des Totemtieres in der Nähe eines Hauses wurde häufig als Ankündigung eines Todesfalles angesehen. Der Totem war gekommen, seinen Verwandten zu holen [Fußnote]Also wie die weiße Frau mancher Adelsgeschlechter.. Unter verschiedenen bedeutsamen Verhältnissen sucht der Clangenosse seine Verwandtschaft mit dem Totem zu betonen, indem er sich ihm äußerlich ähnlich macht, sich in die Haut des Totemtieres hüllt, sich das Bild desselben einritzt u. dgl. Bei den feierlichen Gelegenheiten der Geburt, der Männerweihe, des Begräbnisses wird diese Identifizierung mit dem Totem in Taten und Worten durchgeführt. Tänze, bei denen alle Genossen des Stammes sich in ihren Totem verkleiden und wie er gebärden, dienen mannigfaltigen magischen und religiösen Absichten. Endlich gibt es Zeremonien, bei denen das Totemtier in feierlicher Weise getötet wird [Fußnote]Frazer (1910, Bd. 1, p. 45). – S. unten die Erörterung über das Opfer..
Die soziale Seite des Totemismus prägt sich vor allem in einem streng gehaltenen Gebot und in einer großartigen Einschränkung aus. Die Mitglieder eines Totemclans sind Brüder und Schwestern, verpflichtet, einander zu helfen und zu beschützen; im Falle der Tötung eines Clangenossen durch einen Fremden haftet der ganze Stamm des Täters für die Bluttat, und der Clan des Gemordeten fühlt sich solidarisch in der Forderung nach Sühne für das vergossene Blut. Die Totembande sind stärker als die Familienbande in unserem Sinne; sie fallen mit diesen nicht zusammen, da die Übertragung des Totem in der Regel durch mütterliche Vererbung geschieht und ursprünglich die väterliche Vererbung vielleicht überhaupt nicht in Geltung war.
Die entsprechende Tabubeschränkung aber besteht in dem Verbot, daß Mitglieder desselben Totemclans einander nicht heiraten und überhaupt nicht in Sexualverkehr miteinander treten dürfen. Dies ist die berühmte und rätselhafte, mit dem Totemismus verknüpfte Exogamie. Wir haben ihr die ganze erste Abhandlung dieser Reihe gewidmet und brauchen darum hier nur anzuführen, daß sie der verschärften Inzestscheu der Primitiven entspringt, daß sie als Sicherung gegen Inzest bei Gruppenehe vollkommen verständlich würde und daß sie zunächst die Inzestverhütung für die jüngere Generation besorgt und erst in weiterer Ausbildung auch der älteren Generation zum Hindernis wird [Fußnote]S. die erste Abhandlung..
An diese Darstellung des Totemismus bei Frazer, eine der frühesten in der Literatur des Gegenstandes, will ich nun einige Auszüge aus einer der letzten Zusammenfassungen anschließen. In den 1912 erschienenen Elementen der Völkerpsychologie sagt W. Wundt [Fußnote]p. 116: »Das Totemtier gilt als Ahnentier der betreffenden Gruppe. ›Totem‹ ist also einerseits Gruppen-, anderseits Abstammungsname, und in letzterer Beziehung hat dieser Name zugleich eine mythologische Bedeutung. Alle diese Verwendungen des Begriffes spielen aber ineinander, und die einzelnen dieser Bedeutungen können zurücktreten, so daß in manchen Fällen die Totems fast zu einer bloßen Nomenklatur der Stammesabteilungen geworden sind, während in anderen die Vorstellung der Abstammung oder aber auch die kultische Bedeutung des Totems im Vordergrund steht ...« Der Begriff des Totem wird für die Stammesgliederung und Stammesorganisation maßgebend. »Mit diesen Normen und mit ihrer Befestigung im Glauben und Fühlen der Stammesgenossen hängt es zusammen, daß man das Totemtier ursprünglich jedenfalls nicht bloß als einen Namen für eine Gruppe von Stammesgliedern betrachtete, sondern daß das Tier meist als Stammvater der betreffenden Abteilung gilt ... Damit hängt dann zusammen, daß diese Tierahnen einen Kult genießen ... Dieser Tierkult äußert sich ursprünglich, abgesehen von bestimmten Zeremonien und zeremoniellen Festen, vor allem in dem Verhalten gegenüber dem Totemtier: nicht nur ein einzelnes Tier, sondern jeder Repräsentant der gleichen Spezies ist in gewissem Grade ein geheiligtes Tier, es ist den Totemgenossen verboten oder nur unter gewissen Umständen erlaubt, das Fleisch des Totemtieres zu genießen. Dem entspricht die in solchem Zusammenhange bedeutsame Gegenerscheinung, daß unter gewissen Bedingungen eine Art von zeremoniellem Genuß des Totemfleisches stattfindet ...«
»... Die wichtigste soziale Seite dieser totemistischen Stammesgliederung besteht aber darin, daß mit ihr bestimmte Normen der Sitte für den Verkehr der Gruppen untereinander verbunden sind. Unter diesen Normen stehen in erster Linie die für den Eheverkehr. So hängt diese Stammesgliederung mit einer wichtigen Erscheinung zusammen, die zum erstenmal im totemistischen Zeitalter auftritt: mit der Exogamie.«
Wenn wir durch all das hindurch, was späterer Fortbildung oder Abschwächung entsprechen mag, zu einer Charakteristik des ursprünglichen Totemismus gelangen wollen, so ergeben sich uns folgende wesentliche Züge: Die Totem waren ursprünglich nur Tiere, sie galten als die Ahnen der einzelnen Stämme. Der Totem vererbte sich nur in weiblicher Linie; es war verboten, den Totem zu töten (oder zu essen, was für primitive Verhältnisse zusammenfällt); es war den Totemgenossen verboten, Sexualverkehr miteinander zu pflegen[Fußnote]Übereinstimmend mit diesem Text lautet das Fazit des Totemismus, welches Frazer in seiner zweiten Arbeit über den Gegenstand (›The Origin of Totemisms Fortnightly Review 1899) zieht: » Thus, Totemism has commonly been treated as a primitive system both of religion and of Society. As a System of religion it embraces the mystic union of the savage with his totem; as a System of Society it comprises the relations in which men and women of the same totem stand to each other and to the members of other totemic groups. And corresponding to these two sides of the System are two rough and ready tests or canons of Totemism: first, the rule that a man may not kill or eat his totem animal or plant; and second the rule that he may not marry or cohabit with a woman of the same totem.« Frazer fügt dann hinzu, was uns mitten in die Diskussionen über den Totemismus hineinführt: » Whether the two sides – the religious and the social – have always co-existed or are essentially independent, is a question which has been variously answered.«.
Es darf uns nun auffallen, daß in dem Code du totemisme, den Reinach aufgestellt hat, das eine der Haupttabu, das der Exogamie, überhaupt nicht vorkommt, während die Voraussetzung des zweiten, die Abstammung vom Totemtier, nur eine beiläufige Erwähnung findet. Ich habe aber die Darstellung Reinachs, eines um den Gegenstand sehr verdienten Autors, ausgewählt, um auf die Meinungsverschiedenheiten unter den Autoren vorzubereiten, welche uns nun beschäftigen sollen.
2
Je unabweisbarer die Einsicht auftrat, daß der Totemismus eine regelmäßige Phase aller Kulturen gebildet habe, desto dringender wurde das Bedürfnis, zu einem Verständnis desselben zu gelangen, die Rätsel seines Wesens aufzuhellen. Rätselhaft ist wohl alles am Totemismus; die entscheidenden Fragen sind die nach der Herkunft der Totemabstammung, nach der Motivierung der Exogamie (respektive des durch sie vertretenen Inzesttabu) und nach der Beziehung zwischen den beiden, der Totemorganisation und dem Inzestverbot. Das Verständnis sollte in einem ein historisches und ein psychologisches sein, Auskunft geben, unter welchen Bedingungen sich diese eigentümliche Institution entwickelt und welchen seelischen Bedürfnissen der Menschen sie Ausdruck gegeben hatte.
Meine Leser werden nun gewiß erstaunt sein zu hören, von wie verschiedenen Gesichtspunkten her die Beantwortung dieser Fragen versucht wurde und wie weit die Meinungen der sachkundigen Forscher hierüber auseinandergehen. Es steht so ziemlich alles in Frage, was man allgemein über Totemismus und Exogamie behaupten möchte; auch das vorangeschickte, aus einer von Frazer 1887 veröffentlichten Schrift geschöpfte Bild kann der Kritik nicht entgehen, eine willkürliche Vorliebe des Referenten auszudrücken, und würde heute von Frazer selbst, der seine Ansichten über den Gegenstand wiederholt geändert hat, beanständet werden [Fußnote]Anläßlich einer solchen Sinnesänderung schrieb er den schönen Satz nieder: » That my conclusions on these difftcult questions are final, I am not so foolish as to pretend. I have changed my views repeatedly, and I am resolved to change them again with every change of the evidence, for like a chameleon, the candid enquirer should shift his colours with the shifting colours of the ground he treads.« Vorrede zum I. Band von Totemism and Exogamy (1910)..
Es ist eine naheliegende Annahme, daß man das Wesen des Totemismus und der Exogamie am ehesten erfassen könnte, wenn man den Ursprüngen der beiden Institutionen näherkäme. Dann ist aber für die Beurteilung der Sachlage die Bemerkung von Andrew Lang nicht zu vergessen, daß auch die primitiven Völker uns diese ursprünglichen Formen der Institutionen und die Bedingungen für deren Entstehung nicht mehr aufbewahrt haben, so daß wir einzig und allein auf Hypothesen angewiesen bleiben, um die mangelnde Beobachtung zu ersetzen [Fußnote]» By the nature of the case, as the origin of totemism lies far beyond our powers of historical examination or of experiment, we must have recourse as regards this matter to conjecture«, A. Lang (1905, p. 27). – » Nowhere do we see absolutely primitive man, and a totemic system in the making.« (Ibid., p. 29.). Unter den vorgebrachten Erklärungsversuchen erscheinen einige dem Urteil des Psychologen von vornherein als inadäquat. Sie sind allzu rationell und nehmen auf den Gefühlscharakter der zu erklärenden Dinge keine Rücksicht. Andere ruhen auf Voraussetzungen, denen die Beobachtung die Bestätigung versagt; noch andere berufen sich auf ein Material, welches besser einer anderen Deutung unterworfen werden sollte. Die Widerlegung der verschiedenen Ansichten hat in der Regel wenig Schwierigkeiten; die Autoren sind wie gewöhnlich in der Kritik, die sie aneinander üben, stärker als in ihren eigenen Produktionen. Ein Non liquet ist für die meisten der behandelten Punkte das Endergebnis. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn in der neuesten, hier meist übergangenen Literatur des Gegenstandes das unverkennbare Bestreben auftritt, eine allgemeine Lösung der totemistischen Probleme als undurchführbar abzuweisen. So z. B. Goldenweiser, 1910. (Referat in Britannica Year Book 1913.) Ich habe mir gestattet, bei der Mitteilung dieser einander widerstreitenden Hypothesen von deren Zeitfolge abzusehen.
a) Die Herkunft des Totemismus
Die Frage nach der Entstehung des Totemismus läßt sich auch so formulieren: Wie kamen primitive Menschen dazu, sich (ihre Stämme) nach Tieren, Pflanzen, leblosen Gegenständen zu benennen? [Fußnote]Wahrscheinlich ursprünglich nur nach Tieren.
Der Schotte McLennan, der Totemismus und Exogamie für die Wissenschaft entdeckte (1869–70 und 1865), enthielt sich, eine Ansicht über die Entstehung des Totemismus zu veröffentlichen. Nach einer Mitteilung von A. Lang (1905, 34) war er eine Zeitlang geneigt, den Totemismus auf die Sitte des Tätowierens zurückzuführen. Die verlautbarten Theorien zur Ableitung des Totemismus möchte ich in drei Gruppen bringen, als α) nominalistische, β) soziologische, γ) psychologische.
α) Die nominalistischen Theorien
Die Mitteilungen über diese Theorien werden deren Zusammenfassung unter dem von mir gebrachten Titel rechtfertigen.
Schon Garcilaso de la Vega, ein Abkömmling der peruanischen Inka, der im 17. Jahrhundert die Geschichte seines Volkes schrieb, soll, was ihm von totemistischen Phänomenen bekannt war, auf das Bedürfnis der Stämme, sich durch Namen voneinander zu unterscheiden, zurückgeführt haben [Fußnote]Nach Lang, 1905, p. 34.. Derselbe Gedanke taucht Jahrhunderte später in der Ethnology von A. H. Keane auf: Die Totem seien aus » heraldic badges« (Wappenabzeichen) hervorgegangen, durch die Individuen, Familien und Stämme sich voneinander unterscheiden wollten. [Fußnote]Ibid.
Max Müller äußerte dieselbe Ansicht über die Bedeutung der Totem in seinen Contributions to the Science of Mythology. [Fußnote]Nach A. Lang. Ein Totem sei: 1. ein Clanabzeichen, 2. ein Clanname, 3. der Name des Ahnherrn des Clan, 4. der Name des vom Clan verehrten Gegenstandes. Später J. Pikler (1899): »Die Menschen bedurften eines bleibenden, schriftlich fixierbaren Namens für Gemeinschaften und Individuen ... So entspringt also der Totemismus nicht aus dem religiösen, sondern aus dem nüchternen Alltagsbedürfnis der Menschheit. Der Kern des Totemismus, die Benennung, ist eine Folge der primitiven Schrifttechnik. Der Charakter der Totem ist auch der von leicht darstellbaren Schriftzeichen. Wenn die Wilden aber erst den Namen eines Tieres trugen, so leiteten sie daraus die Idee einer Verwandtschaft mit diesem Tiere ab.« [Fußnote]Pikler und Somló. Die Autoren kennzeichnen ihren Erklärungsversuch mit Recht als »Beitrag zur materialistischen Geschichtstheorie«.
Herbert Spencer [Fußnote]1870, I. Bd., §§ 169 bis 176 legte gleichfalls der Namengebung die entscheidende Bedeutung für die Entstehung des Totemismus bei. Einzelne Individuen, führte er aus, hätten durch ihre Eigenschaften herausgefordert, sie nach Tieren zu benennen, und seien so zu Ehrennamen oder Spitznamen gekommen, welche sich auf ihre Nachkommen fortsetzten. Infolge der Unbestimmtheit und Unverständlichkeit der primitiven Sprachen seien diese Namen von den späteren Generationen so aufgefaßt worden, als seien sie ein Zeugnis für ihre Abstammung von diesen Tieren selbst. Der Totemismus hätte sich so als mißverständliche Ahnenverehrung ergeben.
Ganz ähnlich, obwohl ohne Hervorhebung des Mißverständnisses hat Lord Avebury (bekannter unter seinem früheren Namen Sir John Lubbock) die Entstehung des Totemismus beurteilt: Wenn wir die Tierverehrung erklären wollen, dürfen wir nicht daran vergessen, wie häufig die menschlichen Namen von den Tieren entlehnt werden. Die Kinder und das Gefolge eines Mannes, der Bär oder Löwe genannt wurde, machten daraus natürlich einen Stammesnamen. Daraus ergab sich, daß das Tier selbst zu einer gewissen Achtung und endlich Verehrung gelangte.
Einen, wie es scheint, unwiderleglichen Einwand gegen solche Zurückführung der Totemnamen auf die Namen von Individuen hat Fison vorgebracht [Fußnote]Kamilaroi and Kurmai, p. 165, 1880 (nach A. Lang, Secret etc.). Er zeigt an den Verhältnissen von Australien, daß der Totem stets das Merkzeichen einer Gruppe von Menschen, nie eines einzelnen ist. Wäre es aber anders und der Totem ursprünglich der Name eines einzelnen Menschen, so könnte er bei dem System der mütterlichen Vererbung nie auf dessen Kinder übergehen.
Die bisher mitgeteilten Theorien sind übrigens in offenkundiger Weise unzureichend. Sie erklären etwa die Tatsache der Tiernamen für die Stämme der Primitiven, aber niemals die Bedeutung, welche diese Namengebung für sie gewonnen hat, das totemistische System. Die beachtenswerteste Theorie dieser Gruppe ist die von A. Lang in seinen Büchern Social Origins 1903 und The Secret of the Totem 1905 entwickelte. Sie macht immer noch die Namengebung zum Kern des Problems, aber sie verarbeitet zwei interessante psychologische Momente und beansprucht so, das Rätsel des Totemismus der endgültigen Lösung zugeführt zu haben.
A. Lang meint, es sei zunächst gleichgültig, auf welche Weise die Clans zu ihren Tiernamen gekommen seien. Man wolle nur annehmen, sie erwachten eines Tages zum Bewußtsein, daß sie solche tragen, und wußten sich keine Rechenschaft zu geben, woher. Der Ursprung dieser Namen sei vergessen. Dann würden sie versuchen, sich durch Spekulation Auskunft darüber zu schaffen, und bei ihren Überzeugungen von der Bedeutung der Namen müßten sie notwendigerweise zu all den Ideen kommen, die im totemistischen System enthalten sind. Namen sind für die Primitiven – wie für die heutigen Wilden und selbst für unsere Kinder [Fußnote]Vgl. oben die Abhandlung über das Tabu,, S. 71. – nicht etwa etwas Gleichgültiges und Konventionelles, wie sie uns erscheinen, sondern etwas Bedeutungsvolles und Wesentliches. Der Name eines Menschen ist ein Hauptbestandteil seiner Person, vielleicht ein Stück seiner Seele. Die Gleichnamigkeit mit dem Tiere mußte die Primitiven dazu führen, ein geheimnisvolles und bedeutsames Band zwischen ihren Personen und dieser Tiergattung anzunehmen. Welches Band konnte da anders in Betracht kommen als das der Blutsverwandtschaft? War diese aber infolge der Namensgleichheit einmal angenommen, so ergaben sich aus ihr als direkte Folgen des Bluttabu alle Totemvorschriften mit Einschluß der Exogamie.
» No more than these three things – a group animal name of unknown origin; belief in a transcendental connection between all bearers, human and bestial, of the same name; and belief in the blood superstitions – was needed to give rise to all the totemic creeds and practices, including exogamy.« (Lang, 1905, p. 125)
Langs Erklärung ist sozusagen zweizeitig. Sie leitet das totemistische System mit psychologischer Notwendigkeit aus der Tatsache der Totemnamen ab unter der Voraussetzung, daß die Herkunft dieser Namengebung vergessen worden sei. Das andere Stück der Theorie sucht nun den Ursprung dieser Namen aufzuklären; wir werden sehen, daß es von ganz anderem Gepräge ist.
Dies andere Stück der Langschen Theorie entfernt sich nicht wesentlich von den übrigen, die ich »nominalistisch« genannt habe. Das praktische Bedürfnis nach Unterscheidung nötigte die einzelnen Stämme, Namen anzunehmen, und darum ließen sie sich die Namen gefallen, die jedem Stamm von den anderen gegeben wurden. Dies » naming from without« ist die Eigentümlichkeit der Langschen Konstruktion. Daß die Namen, die so zustande kamen, von Tieren entlehnt waren, ist nicht weiter auffällig und braucht von den Primitiven nicht als Schimpf oder Spott empfunden worden zu sein. Übrigens hat Lang die keineswegs vereinzelten Fälle aus späteren Epochen der Geschichte herangezogen, in denen von außen gegebene, ursprünglich als Spott gemeinte Namen von den so Bezeichneten akzeptiert und bereitwillig getragen wurden ( Geusen, Whigs und Tories). Die Annahme, daß die Entstehung dieser Namen im Laufe der Zeit vergessen wurde, verknüpft dies zweite Stück der Langschen Theorie mit dem vorhin dargestellten ersten.
β) Die soziologischen Theorien
S. Reinach, der den Überbleibseln des totemistischen Systems in Kult und Sitte späterer Perioden erfolgreich nachgespürt, aber von Anfang an das Moment der Abstammung vom Totemtier geringgeschätzt hat, äußert einmal ohne Bedenken, der Totemismus scheine ihm nichts anderes zu sein als » une hypertrophie de l'instinct social« [Fußnote]Reinach (1905–12, Bd. 1, p. 41)..
Dieselbe Auffassung scheint das neue Werk von E. Durkheim: Les formes élémentaires de la vie religieuse: Le système totémique en Australie (1912), zu durchziehen. Der Totem ist der sichtbare Repräsentant der sozialen Religion dieser Völker. Er verkörpert die Gemeinschaft, welche der eigentliche Gegenstand der Verehrung ist.
Andere Autoren haben nach näherer Begründung für diese Beteiligung der sozialen Triebe an der Bildung der totemistischen Institutionen gesucht. So hat A. C. Haddon angenommen, daß jeder primitive Stamm ursprünglich von einer besonderen Tier- oder Pflanzenart lebte, vielleicht auch mit diesem Nahrungsmittel Handel trieb und ihn anderen Stämmen im Austausch zuführte. So konnte es nicht fehlen, daß der Stamm den anderen unter dem Namen des Tieres, welches für ihn eine so wichtige Rolle spielte, bekannt wurde. Gleichzeitig mußte sich bei diesem Stamm eine besondere Vertrautheit mit dem betreffenden Tier und eine Art von Interesse für dasselbe entwickeln, welches aber auf kein anderes psychisches Motiv als auf das elementarste und dringendste der menschlichen Bedürfnisse, den Hunger, gegründet war [Fußnote]Haddon (1902), bei Frazer (1910, Bd. 4, p. 50)..
Die Einwendungen gegen diese rationalste aller Totemtheorien besagen, daß ein solcher Zustand der Ernährung bei den Primitiven nirgends gefunden werde und wahrscheinlich niemals bestanden habe. Die Wilden seien omnivor, und zwar um so mehr, je niedriger sie stehen. Ferner sei es nicht zu verstehen, wie aus solcher ausschließlicher Diät sich ein fast religiöses Verhältnis zu dem Totem entwickelt haben konnte, das in der absoluten Enthaltung von der Vorzugsnahrung gipfelte.
Die erste der drei Theorien, welche Frazer über die Entstehung des Totemismus ausgesprochen, war eine psychologische; sie wird an anderer Stelle berichtet werden.
Die zweite hier zu besprechende Theorie Frazers entstand unter dem Eindruck der bedeutungsvollen Publikation zweier Forscher über die Eingeborenen von Zentralaustralien.
Spencer und Gillen beschrieben bei einer Gruppe von Stämmen, der sogenannten Aruntanation, eine Reihe von eigentümlichen Einrichtungen, Gebräuchen und Ansichten, und Frazer schloß sich ihrem Urteile an, daß diese Besonderheiten als Züge eines primären Zustandes zu betrachten seien und über den ersten und eigentlichen Sinn des Totemismus Aufschluß geben können.
Diese Eigentümlichkeiten sind bei dem Aruntastamm selbst (einem Teil der Aruntanation) folgende:
1. Sie haben die Gliederung in Totemclans, aber der Totem wird nicht erblich übertragen, sondern (auf später mitzuteilende Weise) individuell bestimmt.
2. Die Totemclans sind nicht exogam, die Heiratsbeschränkungen werden durch eine hochentwickelte Gliederung in Heiratsklassen hergestellt, welche mit den Totem nichts zu tun haben.
3. Die Funktion der Totemclans besteht in der Ausführung einer Zeremonie, welche auf exquisit magische Weise die Vermehrung des eßbaren Totemobjekts bezweckt (diese Zeremonie heißt Intichiuma).
4. Die Arunta haben eine eigenartige Konzeptions- und Wiedergeburtstheorie. Sie nehmen an, daß an bestimmten Stellen ihres Landes die Geister der Verstorbenen desselben Totem auf ihre Wiedergeburt warten und in den Leib der Frauen eindringen, die jene Stellen passieren. Wird ein Kind geboren, so gibt die Mutter an, auf welcher Geisterstätte sie ihr Kind empfangen zu haben glaubt. Danach wird der Totem des Kindes bestimmt. Es wird ferner angenommen, daß die Geister (der Verstorbenen wie der Wiedergeborenen) an eigentümliche Steinamulette gebunden sind (namens Churinga), welche an jenen Stätten gefunden werden.
Zwei Momente scheinen Frazer zum Glauben bewogen zu haben, daß man in den Einrichtungen der Arunta die älteste Form des Totemismus aufgefunden habe. Erstens die Existenz gewisser Mythen, welche behaupteten, daß die Ahnen der Arunta sich regelmäßig von ihrem Totem genährt und keine anderen Frauen als die aus ihrem eigenen Totem geheiratet hätten. Zweitens die anscheinende Zurücksetzung des Geschlechtsaktes in ihrer Konzeptionstheorie. Menschen, die noch nicht erkannt hatten, daß die Empfängnis die Folge des Geschlechtsverkehrs sei, dürfte man wohl als die zurückgebliebensten und primitivsten unter den heute lebenden ansehen.
Indem Frazer sich für die Beurteilung des Totemismus an die Intichiumazeremonie hielt, erschien ihm das totemistische System auf einmal in gänzlich verändertem Lichte als eine durchwegs praktische Organisation zur Bestreitung der natürlichsten Bedürfnisse des Menschen (vgl. oben, Haddon) [Fußnote]» There is nothing vague or mystical about it, nothing of that metaphysical haze which some writers love to conjure up over the humble beginnings of human speculation, but which is utterly foreign to the simple, sensuous and concrete modes of thought of the savage.« (Frazer, 1910, I, p. 117.), Das System war einfach ein großartiges Stück von » co-operative magic«. Die Primitiven bildeten sozusagen einen magischen Produktions- und Konsumverein. Jeder Totemclan hatte die Aufgabe übernommen, für die Reichlichkeit eines gewissen Nahrungsmittels zu sorgen. Wenn es sich um nicht eßbare Totem handelte, wie um schädliche Tiere, um Regen, Wind u. dgl., so war die Pflicht des Totemclan, dieses Stück Natur zu beherrschen und dessen Schädlichkeit abzuwehren. Die Leistungen eines jeden Clan kamen allen anderen zugute. Da der Clan von seinem Totem nichts oder nur sehr wenig essen durfte, so beschaffte er dieses wertvolle Gut für die anderen und wurde dafür von ihnen mit dem versorgt, was sie selbst als ihre soziale Totempflicht zu besorgen hatten. Im Lichte dieser durch die Intichiumazeremonie vermittelten Auffassung wollte es Frazer scheinen, als wäre man durch das Verbot, von seinem Totem zu essen, verblendet worden, die wichtigere Seite des Verhältnisses zu vernachlässigen, nämlich das Gebot, möglichst viel von dem eßbaren Totem für den Bedarf der anderen herbeizuschaffen.
Frazer nahm die Tradition der Arunta an, daß jeder Totemclan sich ursprünglich ohne Einschränkung von seinem Totem genährt habe. Dann bereitete es Schwierigkeiten, die folgende Entwicklung zu verstehen, die sich damit begnügte, den Totem für andere zu sichern, während man selbst auf seinen Genuß fast verzichtete. Er nahm dann an, diese Einschränkung sei keineswegs aus einer Art von religiösem Respekt hervorgegangen, sondern vielleicht aus der Beobachtung, daß kein Tier seinesgleichen zu verzehren pflege, so daß dieser Abbruch der Identifizierung mit dem Totem der Macht, die man über denselben zu erlangen wünschte, Schaden brächte. Oder aus einem Bestreben, sich das Wesen geneigt zu machen, indem man es selbst verschonte. Frazer verhehlte sich aber die Schwierigkeiten dieser Erklärung nicht (1910, I. Bd., p. 121 ff.), und ebensowenig getraute er sich anzugeben, auf welchem Wege die von den Mythen der Arunta behauptete Gewohnheit, innerhalb des Totem zu heiraten, sich zur Exogamie gewandelt habe.
Die auf das Intichiuma gegründete Theorie Frazers steht und fällt mit der Anerkennung der primitiven Natur der Aruntainstitutionen. Es scheint aber unmöglich, diese letztere gegen die von Durkheim [Fußnote]L'année sociologique, Bd. I, V, VIII und an anderen Stellen. S. besonders die Abhandlung ›Sur le totémisme‹, Bd. V (1902). und Lang (1903 und 1905) vorgebrachten Einwendungen zu halten. Die Arunta scheinen vielmehr die entwickeltsten der australischen Stämme zu sein, eher ein Auflösungsstadium als den Beginn des Totemismus zu repräsentieren. Die Mythen, welche auf Frazer so großen Eindruck gemacht haben, weil sie im Gegensatz zu den heute herrschenden Institutionen die Freiheit betonen, vom Totem zu essen und innerhalb des Totem zu heiraten, würden sich uns leicht als Wunschphantasien erklären, welche in die Vergangenheit projiziert sind, ähnlich wie der Mythus vom goldenen Zeitalter.
γ) Die psychologischen Theorien
Die erste psychologische Theorie Frazers, noch vor seiner Bekanntschaft mit den Beobachtungen von Spencer und Gillen geschaffen, ruhte auf dem Glauben an die »äußerliche Seele« [Fußnote]The Golden Bough (1890), II, p. 332.. Der Totem sollte einen sicheren Zufluchtsort für die Seele darstellen, an dem sie deponiert wird, um den Gefahren, die sie bedrohen, entzogen zu bleiben. Wenn der Primitive seine Seele in seinem Totem untergebracht hatte, so war er selbst unverletzlich, und natürlich hütete er sich, den Träger seiner Seele selbst zu beschädigen. Da er aber nicht wußte, welches Individuum der Tierart sein Seelenträger war, lag es ihm nahe, die ganze Art zu verschonen. Frazer hat diese Ableitung des Totemismus aus dem Seelenglauben später selbst aufgegeben.
Als er mit den Beobachtungen von Spencer und Gillen bekannt wurde, stellte er die andere, soziologische Theorie des Totemismus auf, welche eben vorhin mitgeteilt wurde, aber er fand dann selbst, daß das Motiv, aus dem er den Totemismus abgeleitet, allzu »rationell« sei und daß er dabei eine soziale Organisation vorausgesetzt habe, die allzu kompliziert sei, als daß man sie primitiv heißen dürfe [Fußnote]» It is unlikely that a community of savages should deliberately parcel out the realm of nature into provinces, assign euch province to a particular band of magicians, and bid all the bands to work their magic and weave their spells for the common good.« (Frazer, 1910, Bd. 4, 57.). Die magischen Kooperativgesellschaften erschienen ihm jetzt eher als späte Früchte denn als Keime des Totemismus. Er suchte ein einfacheres Moment, einen primitiven Aberglauben, hinter diesen Bildungen, um aus ihm die Entstehung des Totemismus abzuleiten. Dieses ursprüngliche Moment fand er dann in der merkwürdigen Konzeptionstheorie der Arunta.
Die Arunta heben, wie bereits erwähnt, den Zusammenhang der Konzeption mit dem Geschlechtsakt auf. Wenn ein Weib sich Mutter fühlt, so ist in diesem Augenblick einer der auf Wiedergeburt lauernden Geister von der nächstliegenden Geisterstätte in ihren Leib eingedrungen und wird von ihr als Kind geboren. Dies Kind hat denselben Totem wie alle an der gewissen Stelle lauernden Geister. Diese Konzeptionstheorie kann den Totemismus nicht erklären, denn sie setzt den Totem voraus. Aber wenn man einen Schritt weiter zurückgehen und annehmen will, daß das Weib ursprünglich geglaubt, das Tier, die Pflanze, der Stein, das Objekt, welches ihre Phantasie in dem Moment beschäftigte, da sie sich zuerst Mutter fühlte, sei wirklich in sie eingedrungen und werde dann von ihr in menschlicher Form geboren, dann wäre die Identität eines Menschen mit seinem Totem durch den Glauben der Mutter wirklich begründet, und alle weiteren Totemgebote (mit Ausschluß der Exogamie) ließen sich leicht daraus ableiten. Der Mensch würde sich weigern, von diesem Tier, dieser Pflanze zu essen, weil er damit gleichsam sich selbst essen würde. Er würde sich aber veranlaßt finden, gelegentlich in zeremoniöser Weise etwas von seinem Totem zu genießen, weil er dadurch seine Identifizierung mit dem Totem, welche das Wesentliche am Totemismus ist, verstärken könnte. Beobachtungen von W. H. R. Rivers an den Eingeborenen der Banksinseln schienen die direkte Identifizierung der Menschen mit ihrem Totem auf Grund einer solchen Konzeptionstheorie zu erweisen [Fußnote]Frazer (1910, II, p. 89 und IV, p. 59)..
Die letzte Quelle des Totemismus wäre also die Unwissenheit der Wilden über den Prozeß, wie Menschen und Tiere ihr Geschlecht fortpflanzen. Des besonderen die Unkenntnis der Rolle, welche das Männchen bei der Befruchtung spielt. Diese Unkenntnis muß erleichtert werden durch das lange Intervall, welches sich zwischen den befruchtenden Akt und die Geburt des Kindes (oder das Verspüren der ersten Kindsbewegungen) einschiebt. Der Totemismus ist daher eine Schöpfung nicht des männlichen, sondern des weiblichen Geistes. Die Gelüste ( sick fancies) des schwangeren Weibes sind die Wurzel desselben. » Anything indeed that struck a woman at that mysterious moment of her life when she first knows herself to be a mother might easily be identified by her with the child in her womb. Such maternal fancies, so natural and seemingly so universal, appear to be the root of totemism.« [Fußnote]l. c. IV, p. 63.
Der Haupteinwand gegen diese dritte Frazersche Theorie ist derselbe, der bereits gegen die zweite, soziologische vorgebracht wurde. Die Arunta scheinen sich von den Anfängen des Totemismus weit weg entfernt zu haben. Ihre Verleugnung der Vaterschaft scheint nicht auf primitiver Unwissenheit zu beruhen; sie haben selbst in manchen Stücken väterliche Vererbung. Sie scheinen die Vaterschaft einer Art von Spekulation geopfert zu haben, welche die Ahnengeister zu Ehren bringen will [Fußnote]» That belief is a philosophy far from primitive.« (A. Lang, 1905, p. 192.). Wenn sie den Mythus der unbefleckten Empfängnis durch den Geist zur allgemeinen Konzeptionstheorie erheben, darf man ihnen darum Unwissenheit über die Bedingungen der Fortpflanzung ebensowenig zumuten wie den alten Völkern um die Zeit der Entstehung der christlichen Mythen.
Eine andere psychologische Theorie der Herkunft des Totemismus hat der Holländer G. A. Wilken aufgestellt. Sie stellt eine Verknüpfung des Totemismus mit der Seelenwanderung her. »Dasjenige Tier, in welches die Seelen der Toten nach allgemeinem Glauben übergingen, wurde zum Blutsverwandten, Ahnherrn und als solcher verehrt.« Aber der Glauben an die Tierwanderung der Seelen mag eher aus dem Totemismus abgeleitet sein als umgekehrt [Fußnote]Bei Frazer,1910, IV, p. 45 u. ff.)..
Eine andere Theorie des Totemismus wird von ausgezeichneten amerikanischen Ethnologen, Fr. Boas, Hill-Tout u. a., vertreten. Sie geht von den Beobachtungen an totemistischen Indianerstämmen aus und behauptet, der Totem sei ursprünglich der Schutzgeist eines Ahnen, den dieser durch einen Traum erworben und auf seine Nachkommenschaft vererbt habe. Wir haben schon früher gehört, welche Schwierigkeiten die Ableitung des Totemismus aus der Vererbung von einem Einzelnen her bietet; überdies sollen die australischen Beobachtungen die Zurückführung des Totem auf den Schutzgeist keineswegs unterstützen. [Fußnote]Frazer, l. c., p. 48 .
Für die letzte der psychologischen Theorien, die von Wundt ausgesprochene, sind die beiden Tatsachen entscheidend geworden, daß erstens das ursprüngliche Totemobjekt und das dauernd verbreitetste das Tier ist und daß zweitens unter den Totemtieren wieder die ursprünglichsten mit Seelentieren zusammenfallen. [Fußnote]Wundt, 1912, p. 190. Seelentiere, wie Vögel, Schlange, Eidechse, Maus, eignen sich durch ihre schnelle Beweglichkeit, ihren Flug in der Luft, durch andere Überraschung und Grauen erregende Eigenschaften dazu, als die Träger der den Körper verlassenden Seele erkannt zu werden. Das Totemtier ist ein Abkömmling der Tierverwandlungen der Hauchseele. So mündet hier für Wundt der Totemismus unmittelbar in den Seelenglauben oder Animismus ein.
b) und c) Die Herkunft der Exogamie und ihre Beziehung zum Totemismus
Ich habe die Theorien des Totemismus mit einiger Ausführlichkeit vorgebracht und muß dennoch befürchten, daß ich deren Eindruck durch die immerhin notwendige Verkürzung geschadet habe. In betreff der weiteren Fragen nehme ich mir im Interesse der Leser die Freiheit einer noch weitergehenden Zusammendrängung. Die Diskussionen über Exogamie der Totemvölker werden durch die Natur des dabei verwerteten Materials besonders kompliziert und unübersehbar; man könnte sagen: verworren. Die Ziele dieser Abhandlung gestatten es auch, daß ich mich hier auf Hervorhebung einiger Richtlinien beschränke und für eine gründlichere Verfolgung des Gegenstandes auf die mehrmals zitierten eingehenden Fachschriften verweise.
Die Stellung eines Autors zu den Problemen der Exogamie ist natürlich nicht unabhängig von seiner Parteinahme für diese oder jene Totemtheorie. Einige von diesen Erklärungen des Totemismus lassen jede Anknüpfung an die Exogamie vermissen, so daß die beiden Institutionen glatt auseinanderfallen. So stehen hier zwei Anschauungen einander gegenüber, die eine, welche den ursprünglichen Anschein festhalten will, die Exogamie sei ein wesentliches Stück des totemistischen Systems, und eine andere, welche einen solchen Zusammenhang bestreitet und an ein zufälliges Zusammentreffen der beiden Züge ältester Kulturen glaubt. Frazer hat in seinen späteren Arbeiten diesen letzteren Standpunkt mit Entschiedenheit vertreten.
» I must request the reader to bear constantly in mind that the two institutions of totemism and exogamy are fundamentally distinct inorigin and nature, though they have accidentally crossed and blended in many tribes.« (T. and Ex., I., Vorrede XII.)
Er warnt direkt vor der gegenteiligen Ansicht als einer Quelle unendlicher Schwierigkeiten und Mißverständnisse. Im Gegensatz hiezu haben andere Autoren den Weg gefunden, die Exogamie als notwendige Folge der totemistischen Grundanschauungen zu begreifen. Durkheim hat in seinen Arbeiten (1898 – 1904) ausgeführt, wie das an den Totem geknüpfte Tabu das Verbot mit sich bringen mußte, ein Weib des nämlichen Totem zum geschlechtlichen Verkehr zu gebrauchen. Der Totem ist von demselben Blut wie der Mensch, und darum verbietet der Blutbann (mit Rücksicht auf Defloration und Menstruation) den sexuellen Verkehr mit dem Weibe, das demselben Totem angehört [Fußnote]S. die Kritik der Erörterungen Durkheims bei Frazer, T. and Ex., IV, p. 101.. A. Lang, der sich hierin Durkheim anschließt, meint sogar, es bedürfte nicht des Bluttabu, um das Verbot der Frauen des gleichen Stammes zu bewirken. (Lang, 1905, p. 125.) Das allgemeine Totemtabu, welches z. B. verbietet, im Schatten des Totembaumes zu sitzen, würde hiefür hingereicht haben. A. Lang verficht übrigens auch eine andere Ableitung der Exogamie (s. unten) und läßt es zweifelhaft, wie sich diese beiden Erklärungen zueinander verhalten.
In betreff der zeitlichen Verhältnisse huldigt die Mehrzahl der Autoren der Ansicht, der Totemismus sei die ältere Institution, die Exogamie später hinzugekommen. [Fußnote]Zum Beispiel Frazer, l. c., IV, p. 75: » The totemic clan is a totally different social organism from the exogamous clan, and we have good grounds for thinking that it is far older.«.
Unter den Theorien, welche die Exogamie unabhängig vom Totemismus erklären wollen, seien nur einige hervorgehoben, welche die verschiedenen Einstellungen der Autoren zum Inzestproblem erläutern. McLennan (1865) hatte die Exogamie in geistreicher Weise aus den Überresten von Sitten erraten, welche auf den ehemaligen Frauenraub hindeuteten. Er nahm nun an, daß es in Urzeiten allgemein gebräuchlich gewesen sei, sich das Weib aus einem fremden Stamm zu holen, und die Heirat mit einem Weib aus dem eigenen Stamm sei allmählich unerlaubt geworden, weil sie ungewöhnlich war [Fußnote]» Improper because it was unusual.«. Das Motiv für diese Gewohnheit der Exogamie suchte er in einem Frauenmangel jener primitiven Stämme, der sich aus dem Gebrauch, die meisten weiblichen Kinder bei der Geburt zu töten, ergeben hatte. Wir haben es hier nicht mit der Nachprüfung zu tun, ob die tatsächlichen Verhältnisse die Annahmen McLennans bestätigen. Weit mehr interessiert uns das Argument, daß es unter den Voraussetzungen des Autors doch unerklärlich bliebe, warum sich die männlichen Mitglieder des Stammes auch die wenigen Frauen aus ihrem Blut unzugänglich machen sollten, und die Art, wie hier das Inzestproblem gänzlich beiseite gelassen wird. [Fußnote]Frazer, l. c., IV, p. 71–92.
Im Gegensatz hiezu und offenbar mit mehr Recht haben andere Forscher die Exogamie als eine Institution zur Verhütung des Inzests erfaßt [Fußnote]Vgl. die erste Abhandlung..
Überblickt man die allmählich wachsende Komplikation der australischen Heiratsbeschränkungen, so kann man nicht anders als der Ansicht von Morgan, Frazer, Howitt, Baldwin Spencer [Fußnote]Morgan, 1877. – Frazer, T. and Ex. IV, p 105 ff.). beistimmen, daß diese Einrichtungen das Gepräge zielbewußter Absicht (» deliberate design« nach Frazer) an sich tragen und daß sie das erreichen sollten, was sie tatsächlich geleistet haben. » In no other way does it seem possible to explain in all its details a system at once so complex and so regular.« (Frazer, ibid., p. 106.)
Es ist interessant hervorzuheben, daß die ersten der durch die Einführung von Heiratsklassen erzeugten Beschränkungen die Sexualfreiheit der jüngeren Generation, also den Inzest von Geschwistern und von Söhnen mit ihrer Mutter trafen, während der Inzest zwischen Vater und Tochter erst durch weitergehende Maßregeln aufgehoben wurde. Die Zurückführung der exogamischen Sexualbeschränkungen auf gesetzgeberische Absicht leistet aber nichts für das Verständnis des Motivs, welches diese Institutionen geschaffen hat. Woher stammt in letzter Auflösung die Inzestscheu, welche als die Wurzel der Exogamie erkannt werden muß? Es ist offenbar nicht genügend, sich zur Erklärung der Inzestscheu auf eine instinktive Abneigung gegen sexuellen Verkehr unter Blutsverwandten, d. h. also auf die Tatsache der Inzestscheu zu berufen, wenn die soziale Erfahrung nachweist, daß der Inzest diesem Instinkt zum Trotz kein seltenes Vorkommnis selbst in unserer heutigen Gesellschaft ist, und wenn die historische Erfahrung Fälle kennen lehrt, in denen die inzestuöse Ehe bevorzugten Personen zur Vorschrift gemacht wurde.
Westermarck [Fußnote]Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe, II. Die Ehe. 1909. Dort auch die Verteidigung des Autors gegen ihm bekannt gewordene Einwendungen. machte zur Erklärung der Inzestscheu geltend, »daß zwischen Personen, die von Kindheit an beisammen leben, eine angeborene Abneigung gegen den Geschlechtsverkehr herrscht und daß dieses Gefühl, da diese Personen in der Regel blutsverwandt sind, in Sitte und Gesetz einen natürlichen Ausdruck findet durch den Abscheu vor dem Geschlechtsumgang unter nahen Verwandten«. Havelock Ellis bestritt zwar den triebhaften Charakter dieser Abneigung in seinen Studies in the Psychology of Sex, trat aber sonst im wesentlichen derselben Erklärung bei, indem er äußerte: »Das normale Unterbleiben des Zutagetretens des Paarungstriebes dort, wo es sich um Brüder und Schwestern oder um von Kindheit auf beisammenlebende Mädchen und Knaben handelt, ist eine rein negative Erscheinung, welche daher kommt, daß unter jenen Umständen die den Paarungstrieb erweckenden Vorbedingungen durchaus fehlen müssen ... Zwischen Personen, die von Kindheit zusammen aufgewachsen sind, hat die Gewöhnung alle sinnlichen Reize des Sehens, des Hörens und der Berührung abgestumpft, in die Bahn einer ruhigen Zuneigung gelenkt und ihrer Macht beraubt, die zur Erzeugung geschlechtlicher Tumeszenz erforderliche nötige erethistische Erregung hervorzurufen.«
Es erscheint mir sehr merkwürdig, daß Westermarck diese angeborene Abneigung gegen den Geschlechtsverkehr mit Personen, mit denen man die Kindheit geteilt hat, gleichzeitig als psychische Repräsentanz der biologischen Tatsache ansieht, daß Inzucht eine Schädigung der Gattung bedeutet. Ein derartiger biologischer Instinkt würde in seiner psychologischen Äußerung so weit irregehen, daß er anstatt der für die Fortpflanzung schädlichen Blutsverwandten die in dieser Hinsicht ganz harmlosen Haus- und Herdgenossen träfe. Ich kann es mir aber auch nicht versagen, die ganz ausgezeichnete Kritik mitzuteilen, welche Frazer der Behauptung von Westermarck entgegenstellt. Frazer findet es unbegreiflich, daß das sexuelle Empfinden sich heute so gar nicht gegen den Verkehr mit Herdgenossen sträubt, während die Inzestscheu, die nur ein Abkömmling von diesem Sträuben sein soll, gegenwärtig so übermächtig angewachsen ist. Tiefer dringen aber andere Bemerkungen Frazers, die ich unverkürzt hieher setze, weil sie im Wesen mit den in meinem Aufsatz über das Tabu entwickelten Argumenten zusammentreffen.
»Es ist nicht leicht einzusehen, warum ein tief wurzelnder menschlicher Instinkt die Verstärkung durch ein Gesetz benötigen sollte. Es gibt kein Gesetz, welches den Menschen befiehlt zu essen und zu trinken, oder ihnen verbietet, ihre Hände ins Feuer zu stecken. Die Menschen essen und trinken und halten ihre Hände vom Feuer weg, instinktgemäß, aus Angst vor natürlichen und nicht vor gesetzlichen Strafen, die sie sich durch Beleidigung dieser Triebe zuziehen würden. Das Gesetz verbietet den Menschen nur, was sie unter dem Drängen ihrer Triebe ausführen könnten. Was die Natur selbst verbietet und bestraft, das braucht nicht erst das Gesetz zu verbieten und zu strafen. Wir dürfen daher auch ruhig annehmen, daß Verbrechen, die durch ein Gesetz verboten werden, Verbrechen sind, die viele Menschen aus natürlichen Neigungen gern begehen würden. Wenn es keine solche Neigung gäbe, kämen keine solche Verbrechen vor, und wenn solche Verbrechen nicht begangen würden, wozu brauchte man sie zu verbieten? Anstatt also aus dem gesetzlichen Verbot des Inzests zu schließen, daß eine natürliche Abneigung gegen den Inzest besteht, sollten wir eher den Schluß ziehen, daß ein natürlicher Instinkt zum Inzest treibt und daß, wenn das Gesetz diesen Trieb wie andere natürliche Triebe unterdrückt, dies seinen Grund in der Einsicht zivilisierter Menschen hat, daß die Befriedigung dieser natürlichen Triebe der Gesellschaft Schaden bringt.« [Fußnote]l. c., p. 97
Ich kann dieser kostbaren Argumentation Frazers noch hinzufügen, daß die Erfahrungen der Psychoanalyse die Annahme einer angeborenen Abneigung gegen den Inzestverkehr vollends unmöglich machen. Sie haben im Gegenteile gelehrt, daß die ersten sexuellen Regungen des jugendlichen Menschen regelmäßig inzestuöser Natur sind und daß solche verdrängte Regungen als Triebkräfte der späteren Neurosen eine kaum zu überschätzende Rolle spielen.
Die Auffassung der Inzestscheu als eines angeborenen Instinkts muß also fallengelassen werden. Nicht besser steht es um eine andere Ableitung des Inzestverbots, welche sich zahlreicher Anhänger erfreut, um die Annahme, daß die primitiven Völker frühzeitig bemerkt haben, mit welchen Gefahren die Inzucht ihr Geschlecht bedrohe, und daß sie darum in bewußter Absicht das Inzestverbot erlassen hätten. Die Einwendungen gegen diesen Erklärungsversuch drängen einander [Fußnote]Vgl. Durkheim (1896/97).. Nicht nur, daß das Inzestverbot älter sein muß als alle Haustierwirtschaft, an welcher der Mensch Erfahrungen über die Wirkung der Inzucht auf die Eigenschaften der Rasse machen konnte, sondern die schädlichen Folgen der Inzucht sind auch heute noch nicht über jeden Zweifel sichergestellt und beim Menschen nur schwer nachweisbar. Ferner macht alles, was wir über die heutigen Wilden wissen, es sehr unwahrscheinlich, daß die Gedanken ihrer entferntesten Ahnen bereits mit der Verhütung von Schäden für ihre spätere Nachkommenschaft beschäftigt waren. Es klingt fast lächerlich, wenn man diesen ohne jeden Vorbedacht lebenden Menschenkindern hygienische und eugenische Motive zumuten will, wie sie noch kaum in unserer heutigen Kultur Berücksichtigung gefunden haben [Fußnote]Ch. Darwin meint von den Wilden: » they are not likely to reflect on distant evils to their progeny.«.
Endlich wird man auch geltend machen müssen, daß das aus praktisch hygienischen Motiven gegebene Verbot der Inzucht als eines die Rasse schwächenden Moments ganz unangemessen erscheint, um den tiefen Abscheu zu erklären, welcher sich in unserer Gesellschaft gegen den Inzest erhebt. Wie ich an anderer Stelle dargetan habe [Fußnote]Vgl. die erste Abhandlung., erscheint diese Inzestscheu bei den heute lebenden primitiven Völkern eher noch reger und stärker als bei den zivilisierten.
Während man erwarten konnte, auch für die Ableitung der Inzestscheu die Wahl zu haben zwischen soziologischen, biologischen und psychologischen Erklärungsmöglichkeiten, wobei noch die psychologischen Motive vielleicht als Repräsentanz von biologischen Mächten zu würdigen wären, sieht man sich am Ende der Untersuchung genötigt, dem resignierten Ausspruch Frazers beizutreten: Wir kennen die Herkunft der Inzestscheu nicht und wissen selbst nicht, worauf wir raten sollen. Keine der bisher vorgebrachten Lösungen des Rätsels erscheint uns befriedigend [Fußnote]» Thus the ultimate origin of exogamy and with it the law of incest – since exogamy was devised to prevent incest – remains a problem nearly as dark as ever.« T. and Ex. I, p. 165.).
Ich muß noch eines Versuches erwähnen, die Entstehung der Inzestscheu zu erklären, welcher von ganz anderer Art ist als die bisher betrachteten. Man könnte ihn als eine historische Ableitung bezeichnen. Dieser Versuch knüpft an eine Hypothese von Ch. Darwin über den sozialen Urzustand des Menschen an. Darwin schloß aus den Lebensgewohnheiten der höheren Affen, daß auch der Mensch ursprünglich in kleineren Horden gelebt habe, innerhalb welcher die Eifersucht des ältesten und stärksten Männchens die sexuelle Promiskuität verhinderte. »Wir können in der Tat, nach dem, was wir von der Eifersucht aller Säugetiere wissen, von denen viele mit speziellen Waffen zum Kämpfen mit ihren Nebenbuhlern bewaffnet sind, schließen, daß allgemeine Vermischung der Geschlechter im Naturzustand äußerst unwahrscheinlich ist ... Wenn wir daher im Strome der Zeit weit genug zurückblicken ... und nach den sozialen Gewohnheiten des Menschen, wie er jetzt existiert, schließen, ... ist die wahrscheinlichste Ansicht die, daß der Mensch ursprünglich in kleinen Gesellschaften lebte, jeder Mann mit einer Frau oder, hatte er die Macht, mit mehreren, welche er eifersüchtig gegen alle anderen Männer verteidigte. Oder er mag kein soziales Tier gewesen sein und doch mit mehreren Frauen für sich allein gelebt haben wie der Gorilla; denn alle Eingeborenen ›stimmen darin überein, daß nur ein erwachsenes Männchen in einer Gruppe zu sehen ist. Wächst das junge Männchen heran, so findet ein Kampf um die Herrschaft statt, und der Stärkste setzt sich dann, indem er die anderen getötet oder vertrieben hat, als Oberhaupt der Gesellschaft fest‹ (Dr. Savage in Boston Journal of Nat. Hist. Bd. 5, 1845 bis 1847). Die jüngeren Männchen, welche hiedurch ausgestoßen sind und nun herumwandern, werden auch, wenn sie zuletzt beim Finden einer Gattin erfolgreich sind, die zu enge Inzucht innerhalb der Glieder einer und derselben Familie verhüten.« [Fußnote]Abstammung des Menschen, übersetzt von V. Carus, II. Bd., Kapitel 20, p. 341.
Atkinson [Fußnote]Primal Law (1903) (mit A. Lang, 1903). scheint zuerst erkannt zu haben, daß diese Verhältnisse der Darwinschen Urhorde die Exogamie der jungen Männer praktisch durchsetzen mußten. Jeder dieser Vertriebenen konnte eine ähnliche Horde gründen, in welcher dasselbe Verbot des Geschlechtsverkehrs dank der Eifersucht des Oberhauptes galt, und im Laufe der Zeit würde sich aus diesen Zuständen die jetzt als Gesetz bewußte Regel ergeben haben: Kein Sexualverkehr mit den Herdgenossen. Nach Einsetzung des Totemismus hätte sich die Regel in die andere Form gewandelt: Kein Sexualverkehr innerhalb des Totem.
A. Lang (1905, p. 114 und p. 143) hat sich dieser Erklärung der Exogamie angeschlossen. Er vertritt aber in demselben Buche die andere (Durkheimsche) Theorie, welche die Exogamie als Konsequenz aus den Totemgesetzen hervorgehen läßt. Es ist nicht ganz einfach, die beiden Auffassungen miteinander zu vereinigen; im ersten Falle hätte die Exogamie vor dem Totemismus bestanden, im zweiten wäre sie eine Folge desselben [Fußnote]» If it be granted that exogamy existed in practice, on the lines of Mr. Darwin's theory, before the totem beliefs lent to the practice a sacred sanction, our task is relatively easy. The first practical rule would be that of the jealous Sire, ›No males to touch the females in my camp‹, with expulsion of adolescent sons. In efflux of time that rule, become habitual, would be, ›No marriage within the local group‹. Next let the local groups receive names, such as Emus, Crows, Opossums, Snipes, and the rule becomes, ›No marriage within the local group of animal name; no Snipe to marry a Snipe‹. But, if the primal groups were not exogamous, they would become so, as soon as totemic myths and tabus were developed out of the animal, vegetable, and other names of small local groups.« (1905, p. 143.) (Die Hervorhebung in der Mitte dieser Stelle ist mein Werk.) – In seiner letzten Äußerung über den Gegenstand (1911) teilt A. Lang übrigens mit, daß er die Ableitung der Exogamie aus dem » general totemic« Tabu aufgegeben habe..
3
Einen einzigen Lichtstrahl wirft die psychoanalytische Erfahrung in dieses Dunkel.
Das Verhältnis des Kindes zum Tiere hat viel Ähnlichkeit mit dem des Primitiven zum Tiere. Das Kind zeigt noch keine Spur von jenem Hochmut, welcher dann den erwachsenen Kulturmenschen bewegt, seine eigene Natur durch eine scharfe Grenzlinie von allem anderen Animalischen abzusetzen. Es gesteht dem Tiere ohne Bedenken die volle Ebenbürtigkeit zu; im ungehemmten Bekennen zu seinen Bedürfnissen fühlt es sich wohl dem Tiere verwandter als dem ihm wahrscheinlich rätselhaften Erwachsenen.
In diesem ausgezeichneten Einverständnis zwischen Kind und Tier tritt nicht selten eine merkwürdige Störung auf. Das Kind beginnt plötzlich eine bestimmte Tierart zu fürchten und sich vor der Berührung oder dem Anblick aller einzelnen dieser Art zu schützen. Es stellt sich das klinische Bild einer Tierphobie her, eine der häufigsten unter den psychoneurotischen Erkrankungen dieses Alters und vielleicht die früheste Form solcher Erkrankung. Die Phobie betrifft in der Regel Tiere, für welche das Kind bis dahin ein besonders lebhaftes Interesse gezeigt hatte, sie hat mit dem Einzeltier nichts zu tun. Die Auswahl unter den Tieren, welche Objekte der Phobie werden können, ist unter städtischen Bedingungen nicht groß. Es sind Pferde, Hunde, Katzen, seltener Vögel, auffällig häufig kleinste Tiere wie Käfer und Schmetterlinge. Manchmal werden Tiere, die dem Kind nur aus Bilderbuch und Märchenerzählung bekannt worden sind, Objekte der unsinnigen und unmäßigen Angst, welche sich bei diesen Phobien zeigt; selten gelingt es einmal, die Wege zu erfahren, auf denen sich eine ungewöhnliche Wahl des Angsttieres vollzogen hat. So verdanke ich K. Abraham die Mitteilung eines Falles, in welchem ein Kind seine Angst vor Wespen selbst durch die Angabe aufklärte, die Farbe und Streifung des Wespenleibes hätte es an den Tiger denken lassen, vor dem es sich nach allem Gehörten fürchten durfte.
Die Tierphobien der Kinder sind noch nicht Gegenstand aufmerksamer analytischer Untersuchung geworden, obwohl sie es im hohen Grade verdienen. Die Schwierigkeiten der Analyse mit Kindern in so zartem Alter sind wohl das Motiv der Unterlassung gewesen. Man kann daher nicht behaupten, daß man den allgemeinen Sinn dieser Erkrankungen kennt, und ich meine selbst, daß er sich nicht als einheitlich herausstellen dürfte. Aber einige Fälle von solchen auf größere Tiere gerichteten Phobien haben sich der Analyse zugänglich erwiesen und so dem Untersucher ihr Geheimnis verraten. Es war in jedem Falle das nämliche: die Angst galt im Grunde dem Vater, wenn die untersuchten Kinder Knaben waren, und war nur auf das Tier verschoben worden.
Jeder in der Psychoanalyse Erfahrene hat gewiß solche Fälle gesehen und von ihnen den nämlichen Eindruck empfangen. Doch kann ich mich nur auf wenige ausführliche Publikationen darüber berufen. Es ist dies ein Zufall der Literatur, aus welchem nicht geschlossen werden sollte, daß wir unsere Behauptung überhaupt nur auf vereinzelte Beobachtungen stützen können. Ich erwähne z. B. einen Autor, welcher sich verständnisvoll mit den Neurosen des Kindesalters beschäftigt hat, M. Wulff (Odessa). Er erzählt im Zusammenhange der Krankengeschichte eines neunjährigen Knaben, daß dieser mit vier Jahren an einer Hundephobie gelitten hat. »Als er auf der Straße einen Hund vorbeilaufen sah, weinte er und schrie: ›Lieber Hund, fasse mich nicht, ich will artig sein.‹ Unter ›artig sein‹ meinte er: ›nicht mehr Geige spielen‹ (onanieren).« (Wulff, 1912, p. 15.)
Derselbe Autor resümiert später: »Seine Hundephobie ist eigentlich die auf die Hunde verschobene Angst vor dem Vater, denn seine sonderbare Äußerung: ›Hund, ich will artig sein‹ – d. h. nicht masturbieren – bezieht sich doch eigentlich auf den Vater, der die Masturbation verboten hat.« In einer Anmerkung setzt er dann hinzu, was sich eben so völlig mit meiner Erfahrung deckt und gleichzeitig die Reichlichkeit solcher Erfahrungen bezeugt: »Solche Phobien (Pferdephobien, Hundephobien, Katzen, Hühner und andere Haustiere) sind, glaube ich, im Kindesalter mindestens ebenso verbreitet wie der pavor nocturnus und lassen sich in der Analyse fast immer als eine Verschiebung der Angst von einem der Eltern auf die Tiere entpuppen. Ob die so verbreitete Mäuse- und Rattenphobie denselben Mechanismus hat, möchte ich nicht behaupten.«
Im ersten Band des Jahrbuches für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen teilte ich die ›Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben‹ mit, welche mir der Vater des kleinen Patienten zur Verfügung gestellt hatte. Es war eine Angst vor Pferden, in deren Konsequenz der Knabe sich weigerte, auf die Straße zu gehen. Er äußerte die Befürchtung, das Pferd werde ins Zimmer kommen, werde ihn beißen. Es erwies sich, daß dies die Strafe für seinen Wunsch sein sollte, daß das Pferd umfallen (sterben) möge. Nachdem man dem Knaben durch Zusicherungen die Angst vor dem Vater benommen hatte, ergab es sich, daß er gegen Wünsche ankämpfte, die das Wegsein (Abreisen, Sterben) des Vaters zum Inhalt hatten. Er empfand den Vater, wie er überdeutlich zu erkennen gab, als Konkurrenten in der Gunst der Mutter, auf welche seine keimenden Sexualwünsche in dunkeln Ahnungen gerichtet waren. Er befand sich also in jener typischen Einstellung des männlichen Kindes zu den Eltern, welche wir als den »Ödipuskomplex« bezeichnen und in der wir den Kernkomplex der Neurosen überhaupt erkennen. Was wir neu aus der Analyse des »kleinen Hans« erfahren, ist die für den Totemismus wertvolle Tatsache, daß das Kind unter solchen Bedingungen einen Anteil seiner Gefühle von dem Vater weg auf ein Tier verschiebt.
Die Analyse weist die inhaltlich bedeutsamen wie die zufälligen Assoziationswege nach, auf welchen eine solche Verschiebung vor sich geht. Sie läßt auch die Motive derselben erraten. Der aus der Nebenbuhlerschaft bei der Mutter hervorgehende Haß kann sich im Seelenleben des Knaben nicht ungehemmt ausbreiten, er hat mit der seit jeher bestehenden Zärtlichkeit und Bewunderung für dieselbe Person zu kämpfen, das Kind befindet sich in doppelsinniger – ambivalenter – Gefühlseinstellung gegen den Vater und schafft sich Erleichterung in diesem Ambivalenzkonflikt, wenn es seine feindseligen und ängstlichen Gefühle auf ein Vatersurrogat verschiebt. Die Verschiebung kann den Konflikt allerdings nicht in der Weise erledigen, daß sie eine glatte Scheidung der zärtlichen von den feindseligen Gefühlen herstellt. Der Konflikt setzt sich vielmehr auf das Verschiebungsobjekt fort, die Ambivalenz greift auf dieses letztere über. Es ist unverkennbar, daß der kleine Hans den Pferden nicht nur Angst, sondern auch Respekt und Interesse entgegenbringt. Sowie sich seine Angst ermäßigt hat, identifiziert er sich selbst mit dem gefürchteten Tier, springt als Pferd herum und beißt nun seinerseits den Vater [Fußnote](1909, s. 169).. In einem anderen Auflösungsstadium der Phobie macht es ihm nichts, die Eltern mit anderen großen Tieren zu identifizieren [Fußnote]Die Giraffenphantasie..
Man darf den Eindruck aussprechen, daß in diesen Tierphobien der Kinder gewisse Züge des Totemismus in negativer Ausprägung wiederkehren. Wir verdanken aber S. Ferenczi die vereinzelt schöne Beobachtung eines Falles, den man nur als positiven Totemismus bei einem Kinde bezeichnen kann (1913). Bei dem kleinen Árpád, von dem Ferenczi berichtet, erwachen die totemistischen Interessen allerdings nicht direkt im Zusammenhang des Ödipuskomplexes, sondern auf Grund der narzißtischen Voraussetzung desselben, der Kastrationsangst. Wer aber die Geschichte des kleinen Hans aufmerksam durchsieht, wird auch in dieser die reichlichsten Zeugnisse dafür finden, daß der Vater als der Besitzer des großen Genitales bewundert und als der Bedroher des eigenen Genitales gefürchtet wird. Im Ödipus- wie im Kastrationskomplex spielt der Vater die nämliche Rolle, die des gefürchteten Gegners der infantilen Sexualinteressen. Die Kastration und ihr Ersatz durch die Blendung ist die von ihm drohende Strafe [Fußnote]Über den Ersatz der Kastration durch die auch im Ödipus-Mythus enthaltene Blendung vgl. die Mitteilungen von Reitler (1913), Ferenczi (1913), Rank (1913) und Eder (1913)..
Als der kleine Árpád zweieinhalb Jahre alt war, versuchte er einmal in einem Sommeraufenthalte ins Geflügelhaus zu urinieren, wobei ihn ein Huhn ins Glied biß oder nach seinem Glied schnappte. Als er ein Jahr später an denselben Ort zurückkehrte, wurde er selbst zum Huhn, er interessierte sich nur mehr für das Geflügelhaus und alles, was darin vorging, und gab seine menschliche Sprache gegen Gackern und Krähen auf. Zur Zeit der Beobachtung (fünf Jahre) sprach er wieder, aber beschäftigte sich auch in der Rede ausschließlich nur mit Hühnern und anderem Geflügel. Er spielte mit keinem anderen Spielzeug, sang nur Lieder, in denen etwas vom Federvieh vorkam. Sein Benehmen gegen sein Totemtier war exquisit ambivalent, übermäßiges Hassen und Lieben. Am liebsten spielte er Hühnerschlachten. »Das Schlachten des Federviehs ist ihm überhaupt ein Fest. Er ist imstande, stundenlang um die Tierleichen erregt herumzutanzen.« Aber dann küßte und streichelte er das geschlachtete Tier, reinigte und liebkoste die von ihm selbst mißhandelten Ebenbilder von Hühnern.
Der kleine Árpád sorgte selbst dafür, daß der Sinn seines sonderbaren Treibens nicht verborgen bleiben konnte. Er übersetzte gelegentlich seine Wünsche aus der totemistischen Ausdrucksweise zurück in die des Alltagslebens. »Mein Vater ist der Hahn«, sagte er einmal. »Jetzt bin ich klein, jetzt bin ich ein Küchlein. Wenn ich größer werde, bin ich ein Huhn. Wenn ich noch größer werde, bin ich ein Hahn.« Ein andermal wünscht er sich plötzlich eine »eingemachte Mutter« zu essen (nach der Analogie des eingemachten Huhns). Er war sehr freigebig mit deutlichen Kastrationsandrohungen gegen andere, wie er sie wegen onanistischer Beschäftigung mit seinem Gliede selbst erfahren hatte.
Über die Quelle seines Interesses für das Treiben im Hühnerhof blieb nach Ferenczi kein Zweifel: »Der rege Sexualverkehr zwischen Hahn und Henne, das Eierlegen und das Herauskriechen der jungen Brut« befriedigten seine sexuelle Wißbegierde, die eigentlich dem menschlichen Familienleben galt. Nach dem Vorbild des Hühnerlebens hatte er seine Objektwünsche geformt, wenn er einmal der Nachbarin sagte: »Ich werde Sie heiraten und Ihre Schwester und meine drei Cousinen und die Köchin, nein, statt der Köchin lieber die Mutter.«
Wir werden an späterer Stelle die Würdigung dieser Beobachtung vervollständigen können; heben wir jetzt nur als wertvolle Übereinstimmungen mit dem Totemismus zwei Züge hervor: die volle Identifizierung mit dem Totemtier [Fußnote]In welcher nach Frazer (1910, IV, p. 5) das Wesentliche des Totemismus gegeben ist: » Totemism is an Identification of a man with his totem.« und die ambivalente Gefühlseinstellung gegen dasselbe. Wir halten uns nach diesen Beobachtungen für berechtigt, in die Formel des Totemismus – für den Mann – den Vater an Stelle des Totemtieres einzusetzen. Wir merken dann, daß wir damit keinen neuen oder besonders kühnen Schritt getan haben. Die Primitiven sagen es ja selbst und bezeichnen, soweit noch heute das totemistische System in Kraft besteht, den Totem als ihren Ahnherrn und Urvater. Wir haben nur eine Aussage dieser Völker wörtlich genommen, mit welcher die Ethnologen wenig anzufangen wußten und die sie darum gern in den Hintergrund gerückt haben. Die Psychoanalyse mahnt uns, im Gegenteile gerade diesen Punkt hervorzusuchen und an ihn den Erklärungsversuch des Totemismus zu knüpfen [Fußnote]O. Rank verdanke ich die Mitteilung eines Falles von Hundephobie bei einem intelligenten jungen Manne, dessen Erklärung, wie er zu seinem Leiden gekommen sei, merklich an die oben (S. 138) erwähnte Totemtheorie der Arunta anklingt. Er meinte, von seinem Vater erfahren zu haben, daß seine Mutter während der Schwangerschaft mit ihm einmal vor einem Hunde erschrocken sei..
Das erste Ergebnis unserer Ersetzung ist sehr merkwürdig. Wenn das Totemtier der Vater ist, dann fallen die beiden Hauptgebote des Totemismus, die beiden Tabuvorschriften, die seinen Kern ausmachen, den Totem nicht zu töten und kein Weib, das dem Totem angehört, sexuell zu gebrauchen, inhaltlich zusammen mit den beiden Verbrechen des Ödipus, der seinen Vater tötete und seine Mutter zum Weibe nahm, und mit den beiden Urwünschen des Kindes, deren ungenügende Verdrängung oder deren Wiedererweckung den Kern vielleicht aller Psychoneurosen bildet. Sollte diese Gleichung mehr als ein irreleitendes Spiel des Zufalls sein, so müßte sie uns gestatten, ein Licht auf die Entstehung des Totemismus in unvordenklichen Zeiten zu werfen. Mit anderen Worten, es müßte uns gelingen, wahrscheinlich zu machen, daß das totemistische System sich aus den Bedingungen des Ödipuskomplexes ergeben hat wie die Tierphobie des »kleinen Hans« und die Geflügelperversion des »kleinen Árpád«. Um dieser Möglichkeit nachzugehen, werden wir im folgenden eine Eigentümlichkeit des totemistischen Systems oder, wie wir sagen können, der Totemreligion studieren, welche bisher kaum Erwähnung finden konnte.
4
Der im Jahre 1894 verstorbene W. Robertson Smith, Physiker, Philologe, Bibelkritiker und Altertumsforscher, ein ebenso vielseitiger wie scharfsichtiger und freidenkender Mann, sprach in seinem 1889 veröffentlichten Werke über die Religion der Semiten [Fußnote]W. Robertson Smith, The Religion of the Semites. 1907. die Annahme aus, daß eine eigentümliche Zeremonie, die sogenannte Totemmahlzeit, von allem Anfang an einen integrierenden Bestandteil des totemistischen Systems gebildet habe. Zur Stütze dieser Vermutung stand ihm damals nur eine einzige, aus dem 5. Jahrhundert n. Chr. überlieferte Beschreibung eines solchen Aktes zu Gebote, aber er verstand es, die Annahme durch die Analyse des Opferwesens bei den alten Semiten zu einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu erheben. Da das Opfer eine göttliche Person voraussetzt, handelt es sich dabei um den Rückschluß von einer höheren Phase des religiösen Ritus auf die niedrigste des Totemismus.
Ich will nun versuchen, aus dem ausgezeichneten Buch von Robertson Smith die für unser Interesse entscheidenden Sätze über Ursprung und Bedeutung des Opferritus herauszuheben unter Weglassung aller oft so reizvollen Details und mit konsequenter Hintansetzung aller späteren Entwicklungen. Es ist ganz ausgeschlossen, in einem solchen Auszug dem Leser etwas von der Luzidität oder von der Beweiskraft der Darstellung im Original zu übermitteln.
Robertson Smith führt aus, daß das Opfer am Altar das wesentliche Stück im Ritus der alten Religion gewesen ist. Es spielt in allen Religionen die nämliche Rolle, so daß man seine Entstehung auf sehr allgemeine und überall gleichartig wirkende Ursachen zurückführen muß.
Das Opfer – die heilige Handlung κατ' εξοχήν ( sacrificium, ιερουργία) – bedeutete aber ursprünglich etwas anderes, als was spätere Zeiten darunter verstanden: die Darbringung an die Gottheit, um sie zu versöhnen oder sich geneigt zu machen. (Von dem Nebensinn der Selbstentäußerung ging dann die profane Verwendung des Wortes aus.) Das Opfer war nachweisbar zuerst nichts anderes als » an act of social fellowship between the deity and his worshippers«, ein Akt der Geselligkeit, eine Kommunion der Gläubigen mit ihrem Gotte.
Als Opfer wurden dargebracht eßbare und trinkbare Dinge; dasselbe, wovon der Mensch sich nährte, Fleisch, Zerealien, Früchte, Wein und Öl, das opferte er auch seinem Gotte. Nur in bezug auf das Opferfleisch bestanden Einschränkungen und Abweichungen. Von den Tieropfern speist der Gott gemeinsam mit seinen Anbetern, die vegetabilischen Opfer sind ihm allein überlassen. Es ist kein Zweifel, daß die Tieropfer die älteren sind und einmal die einzigen waren. Die vegetabilischen Opfer sind aus der Darbringung der Erstlinge aller Früchte hervorgegangen und entsprechen einem Tribut an den Herrn des Bodens und des Landes. Das Tieropfer ist aber älter als der Ackerbau.
Es ist aus sprachlichen Überresten gewiß, daß der dem Gott bestimmte Anteil des Opfers zuerst als seine wirkliche Nahrung angesehen wurde. Mit der fortschreitenden Dematerialisierung des göttlichen Wesens wurde diese Vorstellung anstößig; man wich ihr aus, indem man allein den flüssigen Anteil der Mahlzeit der Gottheit zuwies. Später gestattete der Gebrauch des Feuers, welcher das Opferfleisch auf dem Altar in Rauch aufgehen ließ, eine Zurichtung der menschlichen Nahrungsmittel, durch welche sie dem göttlichen Wesen angemessener wurden. Die Substanz des Trinkopfers war ursprünglich das Blut der Opfertiere; Wein wurde später der Ersatz des Blutes. Der Wein galt den Alten als das »Blut der Rebe«, wie ihn unsere Dichter jetzt noch heißen.
Die älteste Form des Opfers, älter als der Gebrauch des Feuers und die Kenntnis des Ackerbaues, war also das Tieropfer, dessen Fleisch und Blut der Gott und seine Anbeter gemeinsam genossen. Es war wesentlich, daß jeder der Teilnehmer seinen Anteil an der Mahlzeit erhalte.
Ein solches Opfer war eine öffentliche Zeremonie, das Fest eines ganzen Clan. Die Religion war überhaupt eine allgemeine Angelegenheit, die religiöse Pflicht ein Stück der sozialen Verpflichtung. Opfer und Festlichkeit fallen bei allen Völkern zusammen, jedes Opfer bringt ein Fest mit sich, und kein Fest kann ohne Opfer gefeiert werden. Das Opferfest war eine Gelegenheit der freudigen Erhebung über die eigenen Interessen, der Betonung der Zusammengehörigkeit untereinander und mit der Gottheit.
Die ethische Macht der öffentlichen Opfermahlzeit ruhte auf uralten Vorstellungen über die Bedeutung des gemeinsamen Essens und Trinkens. Mit einem anderen zu essen und zu trinken war gleichzeitig ein Symbol und eine Bekräftigung von sozialer Gemeinschaft und von Übernahme gegenseitiger Verpflichtungen; die Opfermahlzeit brachte zum direkten Ausdruck, daß der Gott und seine Anbeter Commensalen sind, aber damit waren alle ihre anderen Beziehungen gegeben. Gebräuche, die noch heute unter den Arabern der Wüste in Kraft sind, beweisen, daß das Bindende an der gemeinsamen Mahlzeit nicht ein religiöses Moment ist, sondern der Akt des Essens selbst. Wer den kleinsten Bissen mit einem solchen Beduinen geteilt oder einen Schluck von seiner Milch getrunken hat, der braucht ihn nicht mehr als Feind zu fürchten, sondern darf seines Schutzes und seiner Hilfe sicher sein. Allerdings nicht für ewige Zeiten; strenggenommen nur für so lange, als der gemeinsam genossene Stoff der Annahme nach in seinem Körper verbleibt. So realistisch wird das Band der Vereinigung aufgefaßt; es bedarf der Wiederholung, um es zu verstärken und dauerhaft zu machen.
Warum wird aber dem gemeinsamen Essen und Trinken diese bindende Kraft zugeschrieben? In den primitivsten Gesellschaften gibt es nur ein Band, welches unbedingt und ausnahmslos einigt, das der Stammesgemeinschaft ( kinship). Die Mitglieder dieser Gemeinschaft treten solidarisch füreinander ein, ein Kin ist eine Gruppe von Personen, deren Leben solcherart zu einer physischen Einheit verbunden sind, daß man sie wie Stücke eines gemeinsamen Lebens betrachten kann. Es heißt dann beim Mord eines Einzelnen aus dem Kin nicht: das Blut dieses oder jenes ist vergossen worden, sondern unser Blut ist vergossen worden. Die hebräische Phrase, mit welcher die Stammesverwandtschaft anerkannt wird, lautet: Du bist mein Bein und mein Fleisch. Kinship bedeutet also einen Anteil haben an einer gemeinsamen Substanz. Es ist dann natürlich, daß sie nicht nur auf die Tatsache gegründet wird, daß man ein Teil von der Substanz seiner Mutter ist, von der man geboren und mit deren Milch man genährt wurde, sondern daß auch die Nahrung, die man späterhin genießt und durch die man seinen Körper erneuert, Kinship erwerben und bestärken kann. Teilte man die Mahlzeit mit seinem Gotte, so drückte es die Überzeugung aus, daß man von einem Stoff mit ihm sei, und wen man als Fremden erkannte, mit dem teilte man keine Mahlzeit.
Die Opfermahlzeit war also ursprünglich ein Festmahl von Stammverwandten, dem Gesetze folgend, daß nur Stammverwandte miteinander essen. In unserer Gesellschaft einigt die Mahlzeit die Mitglieder der Familie, aber mit der Familie hat die Opfermahlzeit nichts zu tun. Kinship ist älter als Familienleben; die ältesten uns bekannten Familien umfassen regelmäßig Personen, die verschiedenen Verwandtschaftsverbänden angehören. Die Männer heiraten Frauen aus fremden Clans, die Kinder erben den Clan der Mutter; es besteht keine Stammesverwandtschaft zwischen dem Manne und den übrigen Familienmitgliedern. In einer solchen Familie gibt es keine gemeinsame Mahlzeit. Die Wilden essen noch heute abseits und allein, und die religiösen Speiseverbote des Totemismus machen ihnen oft die Eßgemeinschaft mit ihren Frauen und Kindern unmöglich.
Wenden wir uns nun zum Opfertier. Es gab, wie wir gehört, keine Stammeszusammenkunft ohne Tieropfer, aber – was nun bedeutsam ist – auch kein Schlachten eines Tieres außer für solche feierliche Gelegenheit. Man nährte sich ohne Bedenken von Früchten, Wild und von der Milch der Haustiere, aber religiöse Skrupel machten es dem Einzelnen unmöglich, ein Haustier für seinen eigenen Gebrauch zu töten. Es leidet nicht den leisesten Zweifel, sagt Robertson Smith, daß jedes Opfer ursprünglich Clanopfer war und daß das Töten eines Schlachtopfers ursprünglich zu jenen Handlungen gehörte, die dem Einzelnen verboten sind und nur dann gerechtfertigt werden, wenn der ganze Stamm die Verantwortlichkeit mit übernimmt. Es gibt bei den Primitiven nur eine Klasse von Handlungen, für welche diese Charakteristik zutrifft, nämlich Handlungen, welche an die Heiligkeit des dem Stamme gemeinsamen Blutes rühren. Ein Leben, welches kein Einzelner wegnehmen darf und das nur durch die Zustimmung, unter der Teilnahme aller Clangenossen geopfert werden kann, steht auf derselben Stufe wie das Leben der Stammesgenossen selbst. Die Regel, daß jeder Gast der Opfermahlzeit vom Fleisch des Opfertieres genießen müsse, hat denselben Sinn wie die Vorschrift, daß die Exekution an einem schuldigen Stammesgenossen von dem ganzen Stamm zu vollziehen sei. Mit anderen Worten: Das Opfertier wurde behandelt wie ein Stammverwandter, die opfernde Gemeinde, ihr Gott und das Opfertier waren eines Blutes, Mitglieder eines Clan.
Robertson Smith identifiziert auf Grund einer reichen Evidenz das Opfertier mit dem alten Totemtier. Es gab im späteren Altertum zwei Arten von Opfern, solche von Haustieren, die auch für gewöhnlich gegessen wurden, und ungewöhnliche Opfer von Tieren, die als unrein verboten waren. Die nähere Erforschung zeigt dann, daß diese unreinen Tiere heilige Tiere waren, daß sie den Göttern als Opfer dargebracht wurden, denen sie heilig waren, daß diese Tiere ursprünglich identisch waren mit den Göttern selbst und daß die Gläubigen in irgendeiner Weise beim Opfer ihre Blutsverwandtschaft mit dem Tiere und dem Gotte betonten. Für noch frühere Zeiten entfällt aber dieser Unterschied zwischen gewöhnlichen und »mystischen« Opfern. Alle Tiere sind ursprünglich heilig, ihr Fleisch ist verboten und darf nur bei feierlichen Gelegenheiten unter Teilnahme des ganzen Stammes genossen werden. Das Schlachten des Tieres kommt dem Vergießen von Stammesblut gleich und muß unter den nämlichen Vorsichten und Sicherungen gegen Vorwurf geschehen.
Die Zähmung von Haustieren und das Emporkommen der Viehzucht scheint überall dem reinen und strengen Totemismus der Urzeit ein Ende bereitet zu haben [Fußnote]» The inference is that the domestication to which totemism invariably leads (when there are any animals capable of domestication) is fatal to totemism.« (Jevons, 1902, p. 120.). Aber was in der nun »pastoralen« Religion den Haustieren an Heiligkeit verblieb, ist deutlich genug, um den ursprünglichen Totemcharakter derselben erkennen zu lassen. Noch in späten klassischen Zeiten schrieb der Ritus an verschiedenen Orten dem Opferer vor, nach vollzogenem Opfer die Flucht zu ergreifen, wie um sich einer Ahndung zu entziehen. In Griechenland muß die Idee, daß die Tötung eines Ochsen eigentlich ein Verbrechen sei, einst allgemein geherrscht haben. An dem athenischen Fest der Euphonien wurde nach dem Opfer ein förmlicher Prozeß eingeleitet, bei dem alle Beteiligten zum Verhör kamen. Endlich einigte man sich, die Schuld an der Mordtat auf das Messer abzuwälzen, welches dann ins Meer geworfen wurde.
Trotz der Scheu, welche das Leben des heiligen Tieres als eines Stammesgenossen schützt, wird es zur Notwendigkeit, ein solches Tier von Zeit zu Zeit in feierlicher Gemeinschaft zu töten und Fleisch und Blut desselben unter die Clangenossen zu verteilen. Das Motiv, welches diese Tat gebietet, gibt den tiefsten Sinn des Opferwesens preis. Wir haben gehört, daß in späteren Zeiten jedes gemeinsame Essen, die Teilnahme an der nämlichen Substanz, welche in ihre Körper eindringt, ein heiliges Band zwischen den Commensalen herstellt; in ältesten Zeiten scheint diese Bedeutung nur der Teilnahme an der Substanz eines heiligen Opfers zuzukommen. Das heilige Mysterium des Opfertodes rechtfertigt sich, indem nur auf diesem Wege das heilige Band hergestellt werden kann, welches die Teilnehmer untereinander und mit ihrem Gotte einigt[Fußnote]l. c., p. 113..
Dieses Band ist nichts anderes als das Leben des Opfertieres, welches in seinem Fleisch und in seinem Blute wohnt und durch die Opfermahlzeit allen Teilnehmern mitgeteilt wird. Eine solche Vorstellung liegt allen Blutbündnissen zugrunde, durch die sich noch in späten Zeiten Menschen gegeneinander verpflichten. Die durchaus realistische Auffassung der Blutsgemeinschaft als Identität der Substanz läßt die Notwendigkeit verstehen, sie von Zeit zu Zeit durch den physischen Prozeß der Opfermahlzeit zu erneuern.
Brechen wir hier die Mitteilung der Gedankengänge von Robertson Smith ab, um ihren Kern in gedrängtester Kürze zu resümieren: Als die Idee des Privateigentums aufkam, wurde das Opfer als eine Gabe an die Gottheit, als eine Übertragung aus dem Eigentum des Menschen in das des Gottes aufgefaßt. Allein diese Deutung ließ alle Eigentümlichkeiten des Opferrituals unaufgeklärt. In ältesten Zeiten war das Opfertier selbst heilig, sein Leben unverletzlich gewesen; es konnte nur unter der Teilnahme und Mitschuld des ganzen Stammes und in Gegenwart des Gottes genommen werden, um die heilige Substanz zu liefern, durch deren Genuß die Clangenossen sich ihrer stofflichen Identität untereinander und mit der Gottheit versicherten. Das Opfer war ein Sakrament, das Opfertier selbst ein Stammesgenosse. Es war in Wirklichkeit das alte Totemtier, der primitive Gott selbst, durch dessen Tötung und Verzehrung die Clangenossen ihre Gottähnlichkeit auffrischten und versicherten.
Aus dieser Analyse des Opferwesens zog Robertson Smith den Schluß, daß die periodische Tötung und Aufzehrung des Totem in Zeiten vor der Verehrung anthropomorpher Gottheiten ein bedeutsames Stück der Totemreligion gewesen sei. Das Zeremoniell einer solchen Totemmahlzeit, meinte er, sei uns in der Beschreibung eines Opfers aus späteren Zeiten erhalten. Der hl. Nilus berichtet von einer Opfersitte der Beduinen in der sinaitischen Wüste um das Ende des vierten Jahrhunderts nach Christi Geburt. Das Opfer, ein Kamel, wurde gebunden auf einen rohen Altar von Steinen gelegt; der Anführer des Stammes ließ die Teilnehmer dreimal unter Gesängen um den Altar herumgehen, brachte dem Tiere die erste Wunde bei und trank gierig das hervorquellende Blut; dann stürzte sich die ganze Gemeinde auf das Opfer, hieb mit den Schwertern Stücke des zuckenden Fleisches los und verzehrte sie roh in solcher Hast, daß in der kurzen Zwischenzeit zwischen dem Aufgang des Morgensterns, dem dieses Opfer galt, und dem Erblassen des Gestirns vor den Sonnenstrahlen alles vom Opfertier, Leib, Knochen, Haut, Fleisch und Eingeweide, vertilgt war. Dieser barbarische, von höchster Altertümlichkeit zeugende Ritus war allen Beweismitteln nach kein vereinzelter Gebrauch, sondern die allgemeine, ursprüngliche Form des Totemopfers, die in späterer Zeit die verschiedensten Abschwächungen erfuhr.
Viele Autoren haben sich geweigert, der Konzeption der Totemmahlzeit Gewicht beizulegen, weil sie durch die direkte Beobachtung auf der Stufe des Totemismus nicht erhärtet werden konnte. Robertson Smith hat noch selbst auf die Beispiele hingewiesen, in denen die sakramentale Bedeutung der Opfer gesichert scheint, z. B. bei den Menschenopfern der Azteken, und auf andere, welche an die Bedingungen der Totemmahlzeit erinnern, die Bärenopfer des Bärenstammes der Ouataouaks in Amerika und die Bärenfeste der Ainos in Japan. Frazer hat diese und ähnliche Fälle in den beiden letzterschienenen Abteilungen seines großen Werkes ausführlich mitgeteilt [Fußnote](1912). Ein Indianerstamm in Kalifornien, der einen großen Raubvogel (Bussard) verehrt, tötet diesen in feierlicher Zeremonie einmal im Jahre, worauf er betrauert und seine Haut mit den Federn aufbewahrt wird. Die Zuniindianer in Neumexiko verfahren ebenso mit ihrer heiligen Schildkröte.
In den Intichiumazeremonien der zentralaustralischen Stämme ist ein Zug beobachtet worden, welcher zu den Voraussetzungen von Robertson Smith vortrefflich stimmt. Jeder Stamm, der für die Vermehrung seines Totem, dessen Genuß ihm doch selbst verwehrt ist, Magie treibt, ist gehalten, bei der Zeremonie etwas von seinem Totem selbst zu genießen, ehe derselbe den anderen Stämmen zugänglich wird. Das schönste Beispiel für den sakramentalen Genuß des sonst verbotenen Totem soll sich nach Frazer bei den Bini in Westafrika in Verbindung mit dem Begräbniszeremoniell dieser Stämme finden. (Ibid., II, p. 590.)
Wir aber wollen Robertson Smith in der Annahme folgen, daß die sakramentale Tötung und gemeinsame Aufzehrung des sonst verbotenen Totemtieres ein bedeutungsvoller Zug der Totemreligion gewesen sei [Fußnote]Die von verschiedenen Autoren (Marillier, Hubert und Mauss u. a.) gegen diese Theorie des Opfers vorgebrachten Einwendungen sind mir nicht unbekannt geblieben, haben aber den Eindruck der Lehren von Robertson Smith im wesentlichen nicht beeinträchtigt..
5
Stellen wir uns nun die Szene einer solchen Totemmahlzeit vor und statten sie noch mit einigen wahrscheinlichen Zügen aus, die bisher nicht gewürdigt werden konnten. Der Clan, der sein Totemtier bei feierlichem Anlasse auf grausame Art tötet und es roh verzehrt, Blut, Fleisch und Knochen; dabei sind die Stammesgenossen in die Ähnlichkeit des Totem verkleidet, imitieren es in Lauten und Bewegungen, als ob sie seine und ihre Identität betonen wollten. Es ist das Bewußtsein dabei, daß man eine jedem Einzelnen verbotene Handlung ausführt, die nur durch die Teilnahme aller gerechtfertigt werden kann; es darf sich auch keiner von der Tötung und der Mahlzeit ausschließen. Nach der Tat wird das hingemordete Tier beweint und beklagt. Die Totenklage ist eine zwangsmäßige, durch die Furcht vor einer drohenden Vergeltung erzwungene, ihre Hauptabsicht geht dahin, wie Robertson Smith bei einer analogen Gelegenheit bemerkt, die Verantwortlichkeit für die Tötung von sich abzuwälzen. [Fußnote]1894, p. 412.
Aber nach dieser Trauer folgt die lauteste Festfreude, die Entfesselung aller Triebe und Gestattung aller Befriedigungen. Die Einsicht in das Wesen des Festes fällt uns hier ohne jede Mühe zu.
Ein Fest ist ein gestatteter, vielmehr ein gebotener Exzeß, ein feierlicher Durchbruch eines Verbotes. Nicht weil die Menschen infolge irgendeiner Vorschrift froh gestimmt sind, begehen sie die Ausschreitungen, sondern der Exzeß liegt im Wesen des Festes; die festliche Stimmung wird durch die Freigebung des sonst Verbotenen erzeugt.
Was soll aber die Einleitung zu dieser Festesfreude, die Trauer über den Tod des Totemtieres? Wenn man sich über die Tötung des Totem, die sonst versagt ist, freut, warum trauert man auch über sie?
Wir haben gehört, daß sich die Clangenossen durch den Genuß des Totem heiligen, in ihrer Identifizierung mit ihm und untereinander bestärken. Daß sie das heilige Leben, dessen Träger die Substanz des Totem ist, in sich aufgenommen haben, könnte ja die festliche Stimmung und alles, was aus ihr folgt, erklären.
Die Psychoanalyse hat uns verraten, daß das Totemtier wirklich der Ersatz des Vaters ist, und dazu stimmte wohl der Widerspruch, daß es sonst verboten ist, es zu töten, und daß seine Tötung zur Festlichkeit wird, daß man das Tier tötet und es doch betrauert. Die ambivalente Gefühlseinstellung, welche den Vaterkomplex heute noch bei unseren Kindern auszeichnet und sich oft ins Leben der Erwachsenen fortsetzt, würde sich auch auf den Vaterersatz des Totemtieres erstrecken.
Allein, wenn man die von der Psychoanalyse gegebene Übersetzung des Totem mit der Tatsache der Totemmahlzeit und der Darwinschen Hypothese über den Urzustand der menschlichen Gesellschaft zusammenhält, ergibt sich die Möglichkeit eines tieferen Verständnisses, der Ausblick auf eine Hypothese, die phantastisch erscheinen mag, aber den Vorteil bietet, eine unvermutete Einheit zwischen bisher gesonderten Reihen von Phänomenen herzustellen.
Die Darwinsche Urhorde hat natürlich keinen Raum für die Anfänge des Totemismus. Ein gewalttätiger, eifersüchtiger Vater, der alle Weibchen für sich behält und die heranwachsenden Söhne vertreibt, nichts weiter. Dieser Urzustand der Gesellschaft ist nirgends Gegenstand der Beobachtung geworden. Was wir als primitivste Organisation finden, was noch heute bei gewissen Stämmen in Kraft besteht, das sind Männerverbände, die aus gleichberechtigten Mitgliedern bestehen und den Einschränkungen des totemistischen Systems unterliegen, dabei mütterliche Erblichkeit. Kann das eine aus dem anderen hervorgegangen sein, und auf welchem Wege war es möglich?
Die Berufung auf die Feier der Totemmahlzeit gestattet uns eine Antwort zu geben: Eines Tages [Fußnote]Zu dieser Darstellung, die sonst mißverständlich würde, bitte ich die Schlußsätze der nachfolgenden Anmerkung als Korrektiv hinzuzunehmen. taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint wagten sie und brachten zustande, was dem Einzelnen unmöglich geblieben wäre. (Vielleicht hatte ein Kulturfortschritt, die Handhabung einer neuen Waffe, ihnen das Gefühl der Überlegenheit gegeben.) Daß sie den Getöteten auch verzehrten, ist für den kannibalen Wilden selbstverständlich. Der gewalttätige Urvater war gewiß das beneidete und gefürchtete Vorbild eines jeden aus der Brüderschar gewesen. Nun setzten sie im Akte des Verzehrens die Identifizierung mit ihm durch, eigneten sich ein jeder ein Stück seiner Stärke an. Die Totemmahlzeit, vielleicht das erste Fest der Menschheit, wäre die Wiederholung und die Gedenkfeier dieser denkwürdigen, verbrecherischen Tat, mit welcher so vieles seinen Anfang nahm, die sozialen Organisationen, die sittlichen Einschränkungen und die Religion [Fußnote]Die ungeheuerlich erscheinende Annahme der Überwältigung und Tötung des tyrannischen Vaters durch die Vereinigung der ausgetriebenen Sohne hat sich auch Atkinson als direkte Folgerung aus den Verhältnissen der Darwinschen Urhorde ergeben. » A youthful band of brothers living together in forced celibacy, or at most in polyandrous relation with some single female captive. A horde as yet weak in their impubescence they are, but they would, when strength was gained with time, inevitably wrench by combined attacks, renewed again and again, both wife and life from the paternal tyrant« (1903, p. 220). Atkinson, der übrigens sein Leben in Neu-Caledonien verbrachte und ungewöhnliche Gelegenheit zum Studium der Eingeborenen hatte, beruft sich auch darauf, daß die von Darwin supponierten Zustände der Urhorde bei wilden Rinder- und Pferdeherden leicht zu beobachten sind und regelmäßig zur Tötung des Vatertieres führen. Er nimmt dann weiter an, daß nach der Beseitigung des Vaters ein Zerfall der Horde durch den erbitterten Kampf der siegreichen Söhne untereinander eintritt. Auf diese Weise käme eine neue Organisation der Gesellschaft niemals zustande: » an ever recurring violent succession to the solitary paternal tyrant by sons, whose parricidal hands were so soon again clenched in fratricidal strife« (p. 228). Atkinson, dem die Winke der Psychoanalyse nicht zu Gebote standen und dem die Studien von Robertson Smith nicht bekannt waren, findet einen minder gewaltsamen Übergang von der Urhorde zur nächsten sozialen Stufe, auf welcher zahlreiche Männer in friedlicher Gemeinschaft zusammenleben. Er läßt es die Mutterliebe durchsetzen, daß anfangs nur die jüngsten, später auch andere Söhne in der Horde verbleiben, wofür diese Geduldeten das sexuelle Vorrecht des Vaters in Form der von ihnen geübten Entsagung gegen Mutter und Schwestern anerkennen. So viel über die höchst bemerkenswerte Theorie von Atkinson, ihre Übereinstimmung mit der hier vorgetragenen im wesentlichen Punkte und ihre Abweichung davon, welche den Verzicht auf den Zusammenhang mit so vielem anderen mit sich bringt. Die Unbestimmtheit, die zeitliche Verkürzung und inhaltliche Zusammendrängung der Angaben in meinen obenstehenden Ausführungen darf ich als eine durch die Natur des Gegenstandes geforderte Enthaltung hinstellen. Es wäre ebenso unsinnig, In dieser Materie Exaktheit anzustreben, wie es unbillig wäre, Sicherheiten zu fordern..
Um, von der Voraussetzung absehend, diese Folgen glaubwürdig zu finden, braucht man nur anzunehmen, daß die sich zusammenrottende Brüderschar von denselben einander widersprechenden Gefühlen gegen den Vater beherrscht war, die wir als Inhalt der Ambivalenz des Vaterkomplexes bei jedem unserer Kinder und unserer Neurotiker nachweisen können. Sie haßten den Vater, der ihrem Machtbedürfnis und ihren sexuellen Ansprüchen so mächtig im Wege stand, aber sie liebten und bewunderten ihn auch. Nachdem sie ihn beseitigt, ihren Haß befriedigt und ihren Wunsch nach Identifizierung mit ihm durchgesetzt hatten, mußten sich die dabei überwältigten zärtlichen Regungen zur Geltung bringen [Fußnote]Dieser neuen Gefühlseinstellung mußte auch zugute kommen, daß die Tat keinem der Täter die volle Befriedigung bringen konnte. Sie war in gewisser Hinsicht vergeblich geschehen. Keiner der Söhne konnte ja seinen ursprünglichen Wunsch durchsetzen, die Stelle des Vaters einzunehmen. Der Mißerfolg ist aber, wie wir wissen, der moralischen Reaktion weit günstiger als die Befriedigung.. Es geschah in der Form der Reue, es entstand ein Schuldbewußtsein, welches hier mit der gemeinsam empfundenen Reue zusammenfällt. Der Tote wurde nun stärker, als der Lebende gewesen war; all dies, wie wir es noch heute an Menschenschicksalen sehen. Was er früher durch seine Existenz verhindert hatte, das verboten sie sich jetzt selbst in der psychischen Situation des uns aus den Psychoanalysen so wohl bekannten » nachträglichen Gehorsams«. Sie widerriefen ihre Tat, indem sie die Tötung des Vaterersatzes, des Totem, für unerlaubt erklärten, und verzichteten auf deren Früchte, indem sie sich die freigewordenen Frauen versagten. So schufen sie aus dem Schuldbewußtsein des Sohnes die beiden fundamentalen Tabu des Totemismus, die eben darum mit den beiden verdrängten Wünschen des Ödipuskomplexes übereinstimmen mußten. Wer dawiderhandelte, machte sich der beiden einzigen Verbrechen schuldig, welche die primitive Gesellschaft bekümmerten [Fußnote]» Murder and incest, or offences of a like kind against the sacred law of blood, are in primitive society the only crimes of which the community as such takes cognizance...« (Smith, 1894, p. 419)..
Die beiden Tabu des Totemismus, mit denen die Sittlichkeit der Menschen beginnt, sind psychologisch nicht gleichwertig. Nur das eine, die Schonung des Totemtieres, ruht ganz auf Gefühlsmotiven; der Vater war ja beseitigt, in der Realität war nichts mehr gutzumachen. Das andere aber, das Inzestverbot, hatte auch eine starke praktische Begründung. Das sexuelle Bedürfnis einigt die Männer nicht, sondern entzweit sie. Hatten sich die Brüder verbündet, um den Vater zu überwältigen, so war jeder des anderen Nebenbuhler bei den Frauen. Jeder hätte sie wie der Vater alle für sich haben wollen, und in dem Kampfe aller gegen alle wäre die neue Organisation zugrunde gegangen. Es war kein Überstarker mehr da, der die Rolle des Vaters mit Erfolg hätte aufnehmen können. Somit blieb den Brüdern, wenn sie miteinander leben wollten, nichts übrig, als – vielleicht nach Überwindung schwerer Zwischenfälle – das Inzestverbot aufzurichten, mit welchem sie alle zugleich auf die von ihnen begehrten Frauen verzichteten, um derentwegen sie doch in erster Linie den Vater beseitigt hatten. Sie retteten so die Organisation, welche sie stark gemacht hatte und die auf homosexuellen Gefühlen und Betätigungen ruhen konnte, welche sich in der Zeit der Vertreibung bei ihnen eingestellt haben mochten. Vielleicht war es auch diese Situation, welche den Keim zu den von Bachofen erkannten Institutionen des Mutterrechts legte, bis dieses von der patriarchalischen Familienordnung abgelöst wurde.
An das andere Tabu, welches das Leben des Totemtieres beschützt, knüpft hingegen der Anspruch des Totemismus an, als erster Versuch einer Religion gewertet zu werden. Bot sich dem Empfinden der Söhne das Tier als natürlicher und nächstliegender Ersatz des Vaters, so fand sich in der ihnen zwanghaft gebotenen Behandlung desselben doch noch mehr Ausdruck als das Bedürfnis, ihre Reue zur Darstellung zu bringen. Es konnte mit dem Vatersurrogat der Versuch gemacht werden, das brennende Schuldgefühl zu beschwichtigen, eine Art von Aussöhnung mit dem Vater zu bewerkstelligen. Das totemistische System war gleichsam ein Vertrag mit dem Vater, in dem der letztere all das zusagte, was die kindliche Phantasie vom Vater erwarten durfte, Schutz, Fürsorge und Schonung, wogegen man sich verpflichtete, sein Leben zu ehren, das heißt die Tat an ihm nicht zu wiederholen, durch die der wirkliche Vater zugrunde gegangen war. Es lag auch ein Rechtfertigungsversuch im Totemismus. »Hätte der Vater uns behandelt wie der Totem, wir wären nie in die Versuchung gekommen, ihn zu töten.« So verhalf der Totemismus dazu, die Verhältnisse zu beschönigen und das Ereignis vergessen zu machen, dem er seine Entstehung verdankte.
Es wurden hiebei Züge geschaffen, die fortan für den Charakter der Religion bestimmend blieben. Die Totemreligion war aus dem Schuldbewußtsein der Söhne hervorgegangen als Versuch, dies Gefühl zu beschwichtigen und den beleidigten Vater durch den nachträglichen Gehorsam zu versöhnen. Alle späteren Religionen erweisen sich als Lösungsversuche desselben Problems, variabel je nach dem kulturellen Zustand, in dem sie unternommen werden, und nach den Wegen, die sie einschlagen, aber es sind alle gleichzielende Reaktionen auf dieselbe große Begebenheit, mit der die Kultur begonnen hat und die seitdem die Menschheit nicht zur Ruhe kommen läßt.
Auch ein anderer Charakter, den die Religion treu bewahrt hat, ist damals schon im Totemismus hervorgetreten. Die Ambivalenzspannung war wohl zu groß, um durch irgendeine Veranstaltung ausgeglichen zu werden, oder die psychologischen Bedingungen sind der Erledigung dieser Gefühlsgegensätze überhaupt nicht günstig. Man merkt jedenfalls, daß die dem Vaterkomplex anhaftende Ambivalenz sich auch in den Totemismus und in die Religionen überhaupt fortsetzt. Die Religion des Totem umfaßt nicht nur die Äußerungen der Reue und die Versuche der Versöhnung, sondern dient auch der Erinnerung an den Triumph über den Vater. Die Befriedigung darüber läßt das Erinnerungsfest der Totemmahlzeit einsetzen, bei dem die Einschränkungen des nachträglichen Gehorsams wegfallen, macht es zur Pflicht, das Verbrechen des Vatermordes in der Opferung des Totemtieres immer wieder von neuem zu wiederholen, sooft der festgehaltene Erwerb jener Tat, die Aneignung der Eigenschaften des Vaters, infolge der verändernden Einflüsse des Lebens zu entschwinden droht. Wir werden nicht überrascht sein zu finden, daß auch der Anteil des Sohnestrotzes, oft in den merkwürdigsten Verkleidungen und Umwendungen, in späteren Religionsbildungen wieder auftaucht.
Verfolgen wir in Religion und sittlicher Vorschrift, die im Totemismus noch wenig scharf gesondert sind, bisher die Folgen der in Reue verwandelten zärtlichen Strömung gegen den Vater, so wollen wir doch nicht übersehen, daß im wesentlichen die Tendenzen, welche zum Vatermord gedrängt haben, den Sieg behalten. Die sozialen Brudergefühle, auf denen die große Umwälzung ruht, bewahren von nun an über lange Zeiten den tiefstgehenden Einfluß auf die Entwicklung der Gesellschaft. Sie schaffen sich Ausdruck in der Heiligung des gemeinsamen Blutes, in der Betonung der Solidarität aller Leben desselben Clans. Indem die Brüder sich einander so das Leben zusichern, sprechen sie aus, daß niemand von ihnen vom anderen behandelt werden dürfe wie der Vater von ihnen allen gemeinsam. Sie schließen eine Wiederholung des Vaterschicksals aus. Zum religiös begründeten Verbot, den Totem zu töten, kommt nun das sozial begründete Verbot des Brudermordes hinzu. Es wird dann noch lange währen, bis das Gebot die Einschränkung auf den Stammesgenossen abstreifen und den einfachen Wortlaut annehmen wird: Du sollst nicht morden. Zunächst ist an Stelle der Vaterhorde der Brüderclan getreten, welcher sich durch das Blutband versichert hat. Die Gesellschaft ruht jetzt auf der Mitschuld an dem gemeinsam verübten Verbrechen, die Religion auf dem Schuldbewußtsein und der Reue darüber, die Sittlichkeit teils auf den Notwendigkeiten dieser Gesellschaft, zum anderen Teil auf den vom Schuldbewußtsein geforderten Bußen.
Im Gegensatz zu den neueren und in Anlehnung an die älteren Auffassungen des totemistischen Systems heißt uns also die Psychoanalyse einen innigen Zusammenhang und gleichzeitigen Ursprung von Totemismus und Exogamie vertreten.
6
Ich stehe unter der Einwirkung einer großen Anzahl von starken Motiven, die mich vom Versuche zurückhalten werden, die weitere Entwicklung der Religionen von ihrem Beginn im Totemismus an bis zu ihrem heutigen Stande zu schildern. Ich will nur zwei Fäden hindurch verfolgen, wo ich sie im Gewebe besonders deutlich auftauchen sehe: das Motiv des Totemopfers und das Verhältnis des Sohnes zum Vater [Fußnote]Vgl. die zum Teil von abweichenden Gesichtspunkten beherrschte Arbeit von C. G. Jung (1912)..
Robertson Smith hat uns belehrt, daß die alte Totemmahlzeit in der ursprünglichen Form des Opfers wiederkehrt. Der Sinn der Handlung ist derselbe: die Heiligung durch die Teilnahme an der gemeinsamen Mahlzeit; auch das Schuldbewußtsein ist dabei geblieben, welches nur durch die Solidarität aller Teilnehmer beschwichtigt werden kann. Neu hinzugekommen ist die Stammesgottheit, in deren gedachter Gegenwart das Opfer stattfindet, die an dem Mahle teilnimmt wie ein Stammesgenosse und mit der man sich durch den Genuß am Opfer identifiziert. Wie kommt der Gott in die ihm ursprünglich fremde Situation? Die Antwort könnte lauten, es sei unterdes – unbekannt woher – die Gottesidee aufgetaucht, habe sich das ganze religiöse Leben unterworfen, und wie alles andere, was bestehenbleiben wollte, hätte auch die Totemmahlzeit den Anschluß an das neue System gewinnen müssen. Allein die psychoanalytische Erforschung des einzelnen Menschen lehrt mit einer ganz besonderen Nachdrücklichkeit, daß für jeden der Gott nach dem Vater gebildet ist, daß sein persönliches Verhältnis zu Gott von seinem Verhältnis zum leiblichen Vater abhängt, mit ihm schwankt und sich verwandelt und daß Gott im Grunde nichts anderes ist als ein erhöhter Vater. Die Psychoanalyse rät auch hier wie im Falle des Totemismus, den Gläubigen Glauben zu schenken, die Gott Vater nennen, wie sie den Totem Ahnherrn genannt haben. Wenn die Psychoanalyse irgendwelche Beachtung verdient, so muß, unbeschadet aller anderen Ursprünge und Bedeutungen Gottes, auf welche die Psychoanalyse kein Licht werfen kann, der Vateranteil an der Gottesidee ein sehr gewichtiger sein. Dann wäre aber in der Situation des primitiven Opfers der Vater zweimal vertreten, einmal als Gott und dann als das Totemopfertier, und bei allem Bescheiden mit der geringen Mannigfaltigkeit der psychoanalytischen Lösungen müssen wir fragen, ob das möglich ist und welchen Sinn es haben kann.
Wir wissen, daß mehrfache Beziehungen zwischen dem Gott und dem heiligen Tier (Totem, Opfertier) bestehen: 1. Jedem Gott ist gewöhnlich ein Tier heilig, nicht selten selbst mehrere; 2. in gewissen, besonders heiligen Opfern, den »mystischen«, wurde dem Gotte gerade das ihm geheiligte Tier zum Opfer dargebracht (Smith, 1894); 3. der Gott wurde häufig in der Gestalt eines Tieres verehrt oder, anders gesehen, Tiere genossen göttliche Verehrung lange nach dem Zeitalter des Totemismus; 4. in den Mythen verwandelt sich der Gott häufig in ein Tier, oft in das ihm geheiligte. So läge die Annahme nahe, daß der Gott selbst das Totemtier wäre, sich auf einer späteren Stufe des religiösen Fühlens aus dem Totemtier entwickelt hätte. Aller weiteren Diskussion überhebt uns aber die Erwägung, daß der Totem selbst nichts anderes ist als ein Vaterersatz. So mag er die erste Form des Vaterersatzes sein, der Gott aber eine spätere, in welcher der Vater seine menschliche Gestalt wiedergewonnen. Eine solche Neuschöpfung aus der Wurzel aller Religionsbildung, der Vatersehnsucht, konnte möglich werden, wenn sich im Laufe der Zeiten am Verhältnis zum Vater – und vielleicht auch zum Tiere – Wesentliches geändert hatte.
Solche Veränderungen lassen sich leicht erraten, auch wenn man von dem Beginn einer psychischen Entfremdung von dem Tiere und von der Zersetzung des Totemismus durch die Domestikation absehen will. (S. oben S. 167) In der durch die Beseitigung des Vaters hergestellten Situation lag ein Moment, welches im Laufe der Zeit eine außerordentliche Steigerung der Vatersehnsucht erzeugen mußte. Die Brüder, welche sich zur Tötung des Vaters zusammengetan hatten, waren ja jeder für sich vom Wunsche beseelt gewesen, dem Vater gleich zu werden, und hatten diesem Wunsche durch Einverleibung von Teilen seines Ersatzes in der Totemmahlzeit Ausdruck gegeben. Dieser Wunsch mußte infolge des Druckes, welchen die Bande des Brüderclan auf jeden Teilnehmer übten, unerfüllt bleiben. Es konnte und durfte niemand mehr die Machtvollkommenheit des Vaters erreichen, nach der sie doch alle gestrebt hatten. Somit konnte im Laufe langer Zeiten die Erbitterung gegen den Vater, die zur Tat gedrängt hatte, nachlassen, die Sehnsucht nach ihm wachsen, und es konnte ein Ideal entstehen, welches die Machtfülle und Unbeschränktheit des einst bekämpften Urvaters und die Bereitwilligkeit, sich ihm zu unterwerfen, zum Inhalt hatte. Die ursprüngliche demokratische Gleichstellung aller einzelnen Stammesgenossen war infolge einschneidender kultureller Veränderungen nicht mehr festzuhalten; somit zeigte sich eine Geneigtheit, in Anlehnung an die Verehrung einzelner Menschen, die sich vor anderen hervorgetan hatten, das alte Vaterideal in der Schöpfung von Göttern wiederzubeleben. Daß ein Mensch zum Gott wird und daß ein Gott stirbt, was uns heute als empörende Zumutung erscheint, war ja noch für das Vorstellungsvermögen des klassischen Altertums keineswegs anstößig [Fußnote]» To us moderns, for whom the breach which divides the human and the divine has deepened into an impassible gulf, such mimicry may appear impious, but it was otherwise with the ancients. To their thinking gods and men were akin, for many families traced their descent from a divinity, and the deification of a man probably seemed as little extraordinary to them as the canonization of a saint seems to a modern Catholic.« (Frazer, 1911, II, p. 177.). Die Erhöhung des einst gemordeten Vaters zum Gott, von dem nun der Stamm seine Herkunft ableitete, war aber ein weit ernsthafterer Sühneversuch als seinerzeit der Vertrag mit dem Totem.
Wo sich in dieser Entwicklung die Stelle für die großen Muttergottheiten findet, die vielleicht allgemein den Vatergöttern vorhergegangen sind, weiß ich nicht anzugeben. Sicher scheint aber, daß die Wandlung im Verhältnis zum Vater sich nicht auf das religiöse Gebiet beschränkte, sondern folgerichtig auf die andere durch die Beseitigung des Vaters beeinflußte Seite des menschlichen Lebens, auf die soziale Organisation, übergriff. Mit der Einsetzung der Vatergottheiten wandelte sich die vaterlose Gesellschaft allmählich in die patriarchalisch geordnete um. Die Familie war eine Wiederherstellung der einstigen Urhorde und gab den Vätern auch ein großes Stück ihrer früheren Rechte wieder. Es gab jetzt wieder Väter, aber die sozialen Errungenschaften des Brüderclan waren nicht aufgegeben worden, und der faktische Abstand der neuen Familienväter vom unumschränkten Urvater der Horde war groß genug, um die Fortdauer des religiösen Bedürfnisses, die Erhaltung der ungestillten Vatersehnsucht, zu versichern.
In der Opferszene vor dem Stammesgott ist also der Vater wirklich zweimal enthalten, als Gott und als Totemopfertier. Aber bei dem Versuch, diese Situation zu verstehen, werden wir uns vor Deutungen in acht nehmen, welche sie in flächenhafter Auffassung wie eine Allegorie übersetzen wollen und dabei der historischen Schichtung vergessen. Die zweifache Anwesenheit des Vaters entspricht den zwei einander zeitlich ablösenden Bedeutungen der Szene. Die ambivalente Einstellung gegen den Vater hat hier plastischen Ausdruck gefunden und ebenso der Sieg der zärtlichen Gefühlsregungen des Sohnes über seine feindseligen. Die Szene der Überwältigung des Vaters, seiner größten Erniedrigung, ist hier zum Material für eine Darstellung seines höchsten Triumphes geworden. Die Bedeutung, die das Opfer ganz allgemein gewonnen hat, liegt eben darin, daß es dem Vater die Genugtuung für die an ihm verübte Schmach in derselben Handlung bietet, welche die Erinnerung an diese Untat fortsetzt.
In weiterer Folge verliert das Tier seine Heiligkeit und das Opfer die Beziehung zur Totemfeier; es wird zu einer einfachen Darbringung an die Gottheit, zu einer Selbstentäußerung zugunsten des Gottes. Gott selbst ist jetzt so hoch über den Menschen erhaben, daß man mit ihm nur durch die Vermittlung des Priesters verkehren kann. Gleichzeitig kennt die soziale Ordnung göttergleiche Könige, welche das patriarchalische System auf den Staat übertragen. Wir müssen sagen, die Rache des gestürzten und wiedereingesetzten Vaters ist eine harte geworden, die Herrschaft der Autorität steht auf ihrer Höhe. Die unterworfenen Söhne haben das neue Verhältnis dazu benützt, um ihr Schuldbewußtsein noch weiter zu entlasten. Das Opfer, wie es jetzt ist, fällt ganz aus ihrer Verantwortlichkeit heraus. Gott selbst hat es verlangt und angeordnet. Zu dieser Phase gehören Mythen, in welchen der Gott selbst das Tier tötet, das ihm heilig ist, das er eigentlich selbst ist. Dies ist die äußerste Verleugnung der großen Untat, mit welcher die Gesellschaft und das Schuldbewußtsein begann. Eine zweite Bedeutung dieser letzteren Opferdarstellung ist nicht zu verkennen. Sie drückt die Befriedigung darüber aus, daß man den früheren Vaterersatz zugunsten der höheren Gottesvorstellung verlassen hat. Die flach allegorische Übersetzung der Szene fällt hier ungefähr mit ihrer psychoanalytischen Deutung zusammen. Jene lautet: es werde dargestellt, daß der Gott den tierischen Anteil seines Wesens überwindet [Fußnote]Die Überwindung einer Göttergeneration durch eine andere in den Mythologien bedeutet bekanntlich den historischen Vorgang der Ersetzung eines religiösen Systems durch ein neues, sei es infolge von Eroberung durch ein Fremdvolk oder auf dem Wege psychologischer Entwicklung. Im letzteren Falle nähert sich der Mythus den »funktionalen Phänomenen« im Sinne von H. Silberer. Daß der das Tier tötende Gott ein Libidosymbol ist, wie C. G. Jung (1912) behauptet, setzt einen anderen Begriff der Libido als den bisher verwendeten voraus und erscheint mir überhaupt fragwürdig..
Es wäre indes irrig, wenn man glauben wollte, in diesen Zeiten der erneuerten Vaterautorität seien die feindseligen Regungen, welche dem Vaterkomplex zugehören, völlig verstummt. Aus den ersten Phasen der Herrschaft der beiden neuen Vaterersatzbildungen, der Götter und der Könige, kennen wir vielmehr die energischesten Äußerungen jener Ambivalenz, welche für die Religion charakteristisch bleibt.
Frazer hat in seinem großen Werk The Golden Bough die Vermutung ausgesprochen, daß die ersten Könige der lateinischen Stämme Fremde waren, welche die Rolle einer Gottheit spielten und in dieser Rolle an einem bestimmten Festtage feierlich hingerichtet wurden. Die jährliche Opferung (Variante: Selbstopferung) eines Gottes scheint ein wesentlicher Zug der semitischen Religionen gewesen zu sein. Das Zeremoniell der Menschenopfer an den verschiedensten Stellen der bewohnten Erde läßt wenig Zweifel darüber, daß diese Menschen als Repräsentanten der Gottheit ihr Ende fanden, und in der Ersetzung des lebenden Menschen durch eine leblose Nachahmung (Puppe) läßt sich dieser Opfergebrauch noch in späte Zeiten verfolgen. Das theanthropische Gottesopfer, welches ich hier leider nicht mit der gleichen Vertiefung wie das Tieropfer behandeln kann, wirft ein helles Licht nach rückwärts auf den Sinn der älteren Opferformen. Es bekennt mit kaum zu überbietender Aufrichtigkeit, daß das Objekt der Opferhandlung immer das nämliche war, dasselbe, was nun als Gott verehrt wird, der Vater also. Die Frage nach dem Verhältnis von Tier- und Menschenopfer findet jetzt eine einfache Lösung. Das ursprüngliche Tieropfer war bereits ein Ersatz für ein Menschenopfer, für die feierliche Tötung des Vaters, und als der Vaterersatz seine menschliche Gestalt wiedererhielt, konnte sich das Tieropfer auch wieder in das Menschenopfer verwandeln.
So hatte sich die Erinnerung an jene erste große Opfertat als unzerstörbar erwiesen, trotz aller Bemühungen, sie zu vergessen, und gerade als man sich von ihren Motiven am weitesten entfernen wollte, mußte in der Form des Gottesopfers ihre unentstellte Wiederholung zutage treten. Welche Entwicklungen des religiösen Denkens als Rationalisierungen diese Wiederkehr ermöglicht haben, brauche ich an dieser Stelle nicht auszuführen. Robertson Smith, dem ja unsere Zurückführung des Opfers auf jenes große Ereignis der menschlichen Urgeschichte fernliegt, gibt an, daß die Zeremonien jener Feste, mit denen die alten Semiten den Tod einer Gottheit feierten, als » commemoration of a mythical tragedy« ausgelegt wurden und daß die Klage dabei nicht den Charakter einer spontanen Teilnahme hatte, sondern etwas Zwangsmäßiges, von der Furcht vor dem göttlichen Zorn Gebotenes an sich trug [Fußnote](Religion of the Semites, p. 412): » The mourning is not a spontaneous expression of sympathy with the divine tragedy, but obligatory and enforced by fear of supernatural anger. And a chief object of the mourners is to disclaim responsibility for the god' s death – a point which has already come before us in connection with theanthropic sacrifices, such as the ›ox-murder at Athens‹.«. Wir glauben zu erkennen, daß diese Auslegung im Rechte war und daß die Gefühle der Feiernden in der zugrunde liegenden Situation ihre gute Aufklärung fanden.
Nehmen wir es nun als Tatsache hin, daß auch in der weiteren Entwicklung der Religionen die beiden treibenden Faktoren, das Schuldbewußtsein des Sohnes und der Sohnestrotz, niemals erlöschen. Jeder Lösungsversuch des religiösen Problems, jede Art der Versöhnung der beiden widerstreitenden seelischen Mächte wird allmählich hinfällig, wahrscheinlich unter dem kombinierten Einfluß von historischen Ereignissen, kulturellen Änderungen und inneren psychischen Wandlungen.
Mit immer größerer Deutlichkeit tritt das Bestreben des Sohnes hervor, sich an die Stelle des Vatergottes zu setzen. Mit der Einführung des Ackerbaues hebt sich die Bedeutung des Sohnes in der patriarchalischen Familie. Er getraut sich neuer Äußerungen seiner inzestuösen Libido, die in der Bearbeitung der Mutter Erde eine symbolische Befriedigung findet. Es entstehen die Göttergestalten des Attis, Adonis, Tammuz u. a., Vegetationsgeister und zugleich jugendliche Gottheiten, welche die Liebesgunst mütterlicher Gottheiten genießen, den Mutterinzest dem Vater zum Trotze durchsetzen. Allein das Schuldbewußtsein, welches durch diese Schöpfungen nicht beschwichtigt ist, drückt sich in den Mythen aus, die diesen jugendlichen Geliebten der Muttergöttinnen ein kurzes Leben und eine Bestrafung durch Entmannung oder durch den Zorn des Vatergottes in Tierform bescheiden. Adonis wird durch den Eber getötet, das heilige Tier der Aphrodite; Attis, der Geliebte der Kybele, stirbt an Entmannung [Fußnote]Die Kastrationsangst spielt eine außerordentlich große Rolle in der Störung des Verhältnisses zum Vater bei unseren jugendlichen Neurotikern. Aus der schönen Beobachtung von Ferenczi haben wir ersehen, wie der Knabe seinen Totem in dem Tier erkennt, welches nach seinem kleinen Gliede schnappt. Wenn unsere Kinder von der rituellen Beschneidung erfahren, stellen sie dieselbe der Kastration gleich. Die völkerpsychologische Parallele zu diesem Verhalten der Kinder ist meines Wissens noch nicht ausgeführt worden. Die in der Urzeit und bei primitiven Völkern so häufige Beschneidung gehört dem Zeitpunkt der Männerweihe an, wo sie ihre Bedeutung finden muß, und ist erst sekundär in frühere Lebenszeiten zurückgeschoben worden. Es ist überaus interessant, daß die Beschneidung bei den Primitiven mit Haarabschneiden und Zahnausschlagen kombiniert oder durch sie ersetzt ist und daß unsere Kinder, die von diesem Sachverhalt nichts wissen können, in ihren Angstreaktionen diese beiden Operationen wirklich wie Äquivalente der Kastration behandeln.. Die Beweinung und die Freude über die Auferstehung dieser Götter ist in das Rituale einer anderen Sohnesgottheit übergegangen, welche zu dauerndem Erfolge bestimmt war.
Als das Christentum seinen Einzug in die antike Welt begann, traf es auf die Konkurrenz der Mithrasreligion, und es war für eine Weile zweifelhaft, welcher Gottheit der Sieg zufallen würde.
Die lichtumflossene Gestalt des persischen Götterjünglings ist doch unserem Verständnis dunkel geblieben. Vielleicht darf man aus den Darstellungen der Stiertötungen durch Mithras schließen, daß er jenen Sohn vorstellte, der die Opferung des Vaters allein vollzog und somit die Brüder von der sie drückenden Mitschuld an der Tat erlöste. Es gab einen anderen Weg zur Beschwichtigung dieses Schuldbewußtseins, und diesen beschritt erst Christus. Er ging hin und opferte sein eigenes Leben, und dadurch erlöste er die Brüderschar von der Erbsünde.
Die Lehre von der Erbsünde ist orphischer Herkunft; sie wurde in den Mysterien erhalten und drang von da aus in die Philosophenschulen des griechischen Altertums ein. [Fußnote]Reinach, Cultes Mythes et Religions, (1905–12), II, p. 75 .) Die Menschen waren die Nachkommen von Titanen, welche den jungen Dionysos-Zagreus getötet und zerstückelt hatten; die Last dieses Verbrechens drückte auf sie. In einem Fragment von Anaximander wird gesagt, daß die Einheit der Welt durch ein urzeitliches Verbrechen zerstört worden sei und daß alles, was daraus hervorgegangen, die Strafe dafür weiter tragen muß [Fußnote]» Une sorte de péché proethnique« (Reinach, 1905–12, II, p. 76).. Erinnert die Tat der Titanen durch die Züge der Zusammenrottung, der Tötung und Zerreißung deutlich genug an das von St. Nilus beschriebene Totemopfer – wie übrigens viele andere Mythen des Altertums, z. B. der Tod des Orpheus selbst –, so stört uns hier doch die Abweichung, daß die Mordtat an einem jugendlichen Gotte vollzogen wird.
Im christlichen Mythus ist die Erbsünde des Menschen unzweifelhaft eine Versündigung gegen Gottvater. Wenn nun Christus die Menschen von dem Drucke der Erbsünde erlöst, indem er sein eigenes Leben opfert, so zwingt er uns zu dem Schlusse, daß diese Sünde eine Mordtat war. Nach dem im menschlichen Fühlen tiefgewurzelten Gesetz der Talion kann ein Mord nur durch die Opferung eines anderen Lebens gesühnt werden; die Selbstaufopferung weist auf eine Blutschuld zurück [Fußnote]Die Selbstmordimpulse unserer Neurotiker erweisen sich regelmäßig als Selbstbestrafungen für Todeswünsche, die gegen andere gerichtet sind.. Und wenn dies Opfer des eigenen Lebens die Versöhnung mit Gottvater herbeiführt, so kann das zu sühnende Verbrechen kein anderes als der Mord am Vater gewesen sein.
So bekennt sich denn in der christlichen Lehre die Menschheit am unverhülltesten zu der schuldvollen Tat der Urzeit, weil sie nun im Opfertod des einen Sohnes die ausgiebigste Sühne für sie gefunden hat. Die Versöhnung mit dem Vater ist um so gründlicher, weil gleichzeitig mit diesem Opfer der volle Verzicht auf das Weib erfolgt, um dessentwillen man sich gegen den Vater empört hatte. Aber nun fordert auch das psychologische Verhängnis der Ambivalenz seine Rechte. Mit der gleichen Tat, welche dem Vater die größtmögliche Sühne bietet, erreicht auch der Sohn das Ziel seiner Wünsche gegen den Vater. Er wird selbst zum Gott neben, eigentlich an Stelle des Vaters. Die Sohnesreligion löst die Vaterreligion ab. Zum Zeichen dieser Ersetzung wird die alte Totemmahlzeit als Kommunion wiederbelebt, in welcher nun die Brüderschar vom Fleisch und Blut des Sohnes, nicht mehr des Vaters, genießt, sich durch diesen Genuß heiligt und mit ihm identifiziert. Unser Blick verfolgt durch die Länge der Zeiten die Identität der Totemmahlzeit mit dem Tieropfer, dem theanthropischen Menschenopfer und mit der christlichen Eucharistie und erkennt in all diesen Feierlichkeiten die Nachwirkung jenes Verbrechens, welches die Menschen so sehr bedrückte und auf das sie doch so stolz sein mußten. Die christliche Kommunion ist aber im Grunde eine neuerliche Beseitigung des Vaters, eine Wiederholung der zu sühnenden Tat. Wir merken, wie berechtigt der Satz von Frazer ist, daß » the Christian communion has absorbed within itself a sacrament which is doubtless far older than Christianity« [Fußnote]Frazer (1912, II, p. 51). – Niemand, der mit der Literatur des Gegenstandes vertraut ist, wird annehmen, daß die Zurückführung der christlichen Kommunion auf die Totemmahlzeit eine Idee des Schreibers dieses Aufsatzes sei..
7
Ein Vorgang wie die Beseitigung des Urvaters durch die Brüderschar mußte unvertilgbare Spuren in der Geschichte der Menschheit hinterlassen und sich in desto zahlreicheren Ersatzbildungen zum Ausdruck bringen, je weniger er selbst erinnert werden sollte [Fußnote]Ariel im Sturm: ...................Full fathom five thy father lies: ...................Of his bones are coral made; ...................Those are pearls that were his eyes: ...................Nothing of him that doth fade, ...................But doth suffer a sea-change ...................Into something rich and strange. In der schönen Übersetzung von Schlegel: ...................Fünf Faden tief liegt Vater dein. ...................Sein Gebein wird zu Korallen, ...................Perlen sind die Augen sein. ...................Nichts an ihm, das soll verfallen, ...................Das nicht wandelt Meeres-Hut ...................In ein reich und seltnes Gut..
Ich gehe der Versuchung aus dem Wege, diese Spuren in der Mythologie, wo sie nicht schwer zu finden sind, nachzuweisen, und wende mich einem anderen Gebiete zu, indem ich einem Fingerzeig von S. Reinach in einer inhaltsreichen Abhandlung über den Tod des Orpheus folge [Fußnote]›La Mort d'Orphée‹ in dem hier oft zitierten Buche: Cultes, mythes et religions (1905–12), II, p. 100 ff.)..
In der Geschichte der griechischen Kunst gibt es eine Situation, welche auffällige Ähnlichkeiten und nicht minder tiefgehende Verschiedenheiten mit der von Robertson Smith erkannten Szene der Totemmahlzeit zeigt. Es ist die Situation der ältesten griechischen Tragödie. Eine Schar von Personen, alle gleich benannt und gleich gekleidet, umsteht einen einzigen, von dessen Reden und Handeln sie alle abhängig sind: es ist der Chor und der ursprünglich einzige Heldendarsteller. Spätere Entwicklungen brachten einen zweiten und dritten Schauspieler, um Gegenspieler und Abspaltungen des Helden darzustellen, aber der Charakter des Helden wie sein Verhältnis zum Chor blieben unverändert. Der Held der Tragödie mußte leiden; dies ist noch heute der wesentliche Inhalt einer Tragödie. Er hatte die sogenannte »tragische Schuld« auf sich geladen, die nicht immer leicht zu begründen ist; sie ist oft keine Schuld im Sinne des bürgerlichen Lebens. Zumeist bestand sie in der Auflehnung gegen eine göttliche oder menschliche Autorität, und der Chor begleitete den Helden mit seinen sympathischen Gefühlen, suchte ihn zurückzuhalten, zu warnen, zu mäßigen und beklagte ihn, nachdem er für sein kühnes Unternehmen die als verdient hingestellte Bestrafung gefunden hatte.
Warum muß aber der Held der Tragödie leiden, und was bedeutet seine »tragische« Schuld? Wir wollen die Diskussion durch rasche Beantwortung abschneiden. Er muß leiden, weil er der Urvater, der Held jener großen urzeitlichen Tragödie ist, die hier eine tendenziöse Wiederholung findet, und die tragische Schuld ist jene, die er auf sich nehmen muß, um den Chor von seiner Schuld zu entlasten. Die Szene auf der Bühne ist durch zweckmäßige Entstellung, man könnte sagen: im Dienste raffinierter Heuchelei, aus der historischen Szene hervorgegangen. In jener alten Wirklichkeit waren es gerade die Chorgenossen, die das Leiden des Helden verursachten; hier aber erschöpfen sie sich in Teilnahme und Bedauern, und der Held ist selbst an seinem Leiden schuld. Das auf ihn gewälzte Verbrechen, die Überhebung und Auflehnung gegen eine große Autorität, ist genau dasselbe, was in Wirklichkeit die Genossen des Chors, die Brüderschar, bedrückt. So wird der tragische Held – noch wider seinen Willen – zum Erlöser des Chors gemacht.
Waren speziell in der griechischen Tragödie die Leiden des göttlichen Bockes Dionysos und die Klage des mit ihm sich identifizierenden Gefolges von Böcken der Inhalt der Aufführung, so wird es leicht verständlich, daß das bereits erloschene Drama sich im Mittelalter an der Passion Christi neu entzündete.
So möchte ich denn zum Schlusse dieser mit äußerster Verkürzung geführten Untersuchung das Ergebnis aussprechen, daß im Ödipuskomplex die Anfänge von Religion, Sittlichkeit, Gesellschaft und Kunst zusammentreffen, in voller Übereinstimmung mit der Feststellung der Psychoanalyse, daß dieser Komplex den Kern aller Neurosen bildet, soweit sie bis jetzt unserem Verständnis nachgegeben haben. Es erscheint mir als eine große Überraschung, daß auch diese Probleme des Völkerseelenlebens eine Auflösung von einem einzigen konkreten Punkte her, wie es das Verhältnis zum Vater ist, gestatten sollten. Vielleicht ist selbst ein anderes psychologisches Problem in diesen Zusammenhang einzubeziehen. Wir haben so oft Gelegenheit gehabt, die Gefühlsambivalenz im eigentlichen Sinne, also das Zusammentreffen von Liebe und Haß gegen dasselbe Objekt, an der Wurzel wichtiger Kulturbildungen aufzuzeigen. Wir wissen nichts über die Herkunft dieser Ambivalenz. Man kann die Annahme machen, daß sie ein fundamentales Phänomen unseres Gefühlslebens sei. Aber auch die andere Möglichkeit scheint mir wohl beachtenswert, daß sie, dem Gefühlsleben ursprünglich fremd, von der Menschheit an dem Vaterkomplex [Fußnote]Respektive Elternkomplex. erworben wurde, wo die psychoanalytische Erforschung des Einzelmenschen heute noch ihre stärkste Ausprägung nachweist [Fußnote]Der Mißverständnisse gewöhnt, halte ich es nicht für überflüssig, ausdrücklich hervorzuheben, daß die hier gegebenen Zurückführungen an die komplexe Natur der abzuleitenden Phänomene keineswegs vergessen haben und daß sie nur den Anspruch erheben, zu den bereits bekannten oder noch unerkannten Ursprüngen der Religion, Sittlichkeit und der Gesellschaft ein neues Moment hinzuzufügen, welches sich aus der Berücksichtigung der psychoanalytischen Anforderungen ergibt. Die Synthese zu einem Ganzen der Erklärung muß ich anderen überlassen. Es geht aber diesmal aus der Natur dieses neuen Beitrages hervor, daß er in einer solchen Synthese keine andere als die zentrale Rolle spielen könnte, wenngleich die Überwindung von großen affektiven Widerständen erfordert werden dürfte, ehe man ihm eine solche Bedeutung zugesteht..
Bevor ich nun abschließe, muß ich der Bemerkung Raum geben, daß der hohe Grad von Konvergenz zu einem umfassenden Zusammenhange, den wir in diesen Ausführungen erreicht haben, uns nicht gegen die Unsicherheiten unserer Voraussetzungen und die Schwierigkeiten unserer Resultate verblenden kann. Von den letzteren will ich nur noch zwei behandeln, die sich manchem Leser aufgedrängt haben dürften.
Es kann zunächst niemandem entgangen sein, daß wir überall die Annahme einer Massenpsyche zugrunde legen, in welcher sich die seelischen Vorgänge vollziehen wie im Seelenleben eines Einzelnen. Wir lassen vor allem das Schuldbewußtsein wegen einer Tat über viele Jahrtausende fortleben und in Generationen wirksam bleiben, welche von dieser Tat nichts wissen konnten. Wir lassen einen Gefühlsprozeß, wie er bei Generationen von Söhnen entstehen konnte, die von ihrem Vater mißhandelt wurden, sich auf neue Generationen fortsetzen, welche einer solchen Behandlung gerade durch die Beseitigung des Vaters entzogen worden waren. Dies scheinen allerdings schwerwiegende Bedenken, und jede andere Erklärung scheint den Vorzug zu verdienen, welche solche Voraussetzungen vermeiden kann.
Allein eine weitere Erwägung zeigt, daß wir die Verantwortlichkeit für solche Kühnheit nicht allein zu tragen haben. Ohne die Annahme einer Massenpsyche, einer Kontinuität im Gefühlsleben der Menschen, welche gestattet, sich über die Unterbrechungen der seelischen Akte durch das Vergehen der Individuen hinwegzusetzen, kann die Völkerpsychologie überhaupt nicht bestehen. Setzen sich die psychischen Prozesse der einen Generation nicht auf die nächste fort, müßte jede ihre Einstellung zum Leben neu erwerben, so gäbe es auf diesem Gebiet keinen Fortschritt und so gut wie keine Entwicklung. Es erheben sich nun zwei neue Fragen, wieviel man der psychischen Kontinuität innerhalb der Generationsreihen zutrauen kann und welcher Mittel und Wege sich die eine Generation bedient, um ihre psychischen Zustände auf die nächste zu übertragen. Ich werde nicht behaupten, daß diese Probleme weit genug geklärt sind oder daß die direkte Mitteilung und Tradition, an die man zunächst denkt, für das Erfordernis hinreichen. Im allgemeinen kümmert sich die Völkerpsychologie wenig darum, auf welche Weise die verlangte Kontinuität im Seelenleben der einander ablösenden Generationen hergestellt wird. Ein Teil der Aufgabe scheint durch die Vererbung psychischer Dispositionen besorgt zu werden, welche aber doch gewisser Anstöße im individuellen Leben bedürfen, um zur Wirksamkeit zu erwachen. Es mag dies der Sinn des Dichterwortes sein:
Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.
Das Problem erschiene noch schwieriger, wenn wir zugestehen könnten, daß es seelische Regungen gibt, welche so spurlos unterdrückt werden können, daß sie keine Resterscheinungen zurücklassen. Allein solche gibt es nicht. Die stärkste Unterdrückung muß Raum lassen für entstellte Ersatzregungen und aus ihnen folgende Reaktionen. Dann dürfen wir aber annehmen, daß keine Generation imstande ist, bedeutsamere seelische Vorgänge vor der nächsten zu verbergen. Die Psychoanalyse hat uns nämlich gelehrt, daß jeder Mensch in seiner unbewußten Geistestätigkeit einen Apparat besitzt, der ihm gestattet, die Reaktionen anderer Menschen zu deuten, das heißt die Entstellungen wieder rückgängig zu machen, welche der andere an dem Ausdruck seiner Gefühlsregungen vorgenommen hat. Auf diesem Wege des unbewußten Verständnisses all der Sitten, Zeremonien und Satzungen, welche das ursprüngliche Verhältnis zum Urvater zurückgelassen hatte, mag auch den späteren Generationen die Übernahme jener Gefühlserbschaft gelungen sein.
Ein anderes Bedenken dürfte gerade von seiten der analytischen Denkweise erhoben werden.
Wir haben die ersten Moralvorschriften und sittlichen Beschränkungen der primitiven Gesellschaft als Reaktion auf eine Tat aufgefaßt, welche ihren Urhebern den Begriff des Verbrechens gab. Sie bereuten diese Tat und beschlossen, daß sie nicht mehr wiederholt werden solle und daß ihre Ausführung keinen Gewinn gebracht haben dürfe. Dies schöpferische Schuldbewußtsein ist nun unter uns nicht erloschen. Wir finden es bei den Neurotikern in asozialer Weise wirkend, um neue Moralvorschriften, fortgesetzte Einschränkungen zu produzieren, als Sühne für die begangenen und als Vorsicht gegen neu zu begehende Untaten [Fußnote]Vgl. den zweiten Aufsatz dieser Reihe über das Tabu.. Wenn wir aber bei diesen Neurotikern nach den Taten forschen, welche solche Reaktionen wachgerufen haben, so werden wir enttäuscht. Wir finden nicht Taten, sondern nur Impulse, Gefühlsregungen, welche nach dem Bösen verlangen, aber von der Ausführung abgehalten worden sind. Dem Schuldbewußtsein der Neurotiker liegen nur psychische Realitäten zugrunde, nicht faktische. Die Neurose ist dadurch charakterisiert, daß sie die psychische Realität über die faktische setzt, auf Gedanken ebenso ernsthaft reagiert wie die Normalen nur auf Wirklichkeiten.
Kann es sich bei den Primitiven nicht ähnlich verhalten haben? Wir sind berechtigt, ihnen eine außerordentliche Überschätzung ihrer psychischen Akte als Teilerscheinung ihrer narzißtischen Organisation zuzuschreiben [Fußnote]S. den Aufsatz über ›Animismus, Magie und Allmacht der Gedanken‹.. Demnach könnten die bloßen Impulse von Feindseligkeit gegen den Vater, die Existenz der Wunschphantasie, ihn zu töten und zu verzehren, hingereicht haben, um jene moralische Reaktion zu erzeugen, die Totemismus und Tabu geschaffen hat. Man würde so der Notwendigkeit entgehen, den Beginn unseres kulturellen Besitzes, auf den wir mit Recht so stolz sind, auf ein gräßliches, alle unsere Gefühle beleidigendes Verbrechen zurückzuführen. Die kausale, von jenem Anfang bis in unsere Gegenwart reichende Verknüpfung litte dabei keinen Schaden, denn die psychische Realität wäre bedeutsam genug, um alle diese Folgen zu tragen. Man wird dagegen einwenden, daß ja eine Veränderung der Gesellschaft von der Form der Vaterhorde zu der des Brüderclan wirklich vorgefallen ist. Dies ist ein starkes Argument, aber doch nicht entscheidend. Die Veränderung könnte auf minder gewaltsame Weise erreicht worden sein und doch die Bedingung für das Hervortreten der moralischen Reaktion enthalten haben. Solange der Druck des Urvaters sich fühlbar machte, waren die feindseligen Gefühle gegen ihn berechtigt, und die Reue über sie mußte einen anderen Zeitpunkt abwarten. Ebensowenig ist der zweite Einwand stichhaltig, daß alles, was sich aus der ambivalenten Relation zum Vater ableitet, Tabu und Opfervorschrift, den Charakter des höchsten Ernstes und der vollsten Realität an sich trägt. Auch das Zeremoniell und die Hemmungen der Zwangsneurotiker zeigen diesen Charakter und gehen doch nur auf psychische Realität, auf Vorsatz und nicht auf Ausführungen zurück. Wir müssen uns hüten, aus unserer nüchternen Welt, die voll ist von materiellen Werten, die Geringschätzung des bloß Gedachten und Gewünschten in die nur innerlich reiche Welt des Primitiven und des Neurotikers einzutragen.
Wir stehen hier vor einer Entscheidung, die uns wirklich nicht leicht gemacht ist. Beginnen wir aber mit dem Bekenntnis, daß der Unterschied, der anderen fundamental erscheinen kann, für unser Urteil nicht das Wesentliche des Gegenstandes trifft. Wenn für den Primitiven Wünsche und Impulse den vollen Wert von Tatsachen haben, so ist es an uns, solcher Auffassung verständnisvoll zu folgen, anstatt sie nach unserem Maßstab zu korrigieren. Dann aber wollen wir das Vorbild der Neurose, das uns in diesen Zweifel gebracht hat, selbst schärfer ins Auge fassen. Es ist nicht richtig, daß die Zwangsneurotiker, welche heute unter dem Drucke einer Übermoral stehen, sich nur gegen die psychische Realität von Versuchungen verteidigen und wegen bloß verspürter Impulse bestrafen. Es ist auch ein Stück historischer Realität dabei; in ihrer Kindheit hatten diese Menschen nichts anderes als die bösen Impulse, und insoweit sie in der Ohnmacht des Kindes es konnten, haben sie diese Impulse auch in Handlungen umgesetzt. Jeder von diesen Überguten hatte in der Kindheit seine böse Zeit, eine perverse Phase als Vorläufer und Voraussetzung der späteren übermoralischen. Die Analogie der Primitiven mit den Neurotikern wird also viel gründlicher hergestellt, wenn wir annehmen, daß auch bei den ersteren die psychische Realität, an deren Gestaltung kein Zweifel ist, anfänglich mit der faktischen Realität zusammenfiel, daß die Primitiven das wirklich getan haben, was sie nach allen Zeugnissen zu tun beabsichtigten.
Allzuweit dürfen wir unser Urteil über die Primitiven auch nicht durch die Analogie mit den Neurotikern beeinflussen lassen. Es sind auch die Unterschiede in Rechnung zu ziehen. Gewiß sind bei beiden, Wilden wie Neurotikern, die scharfen Scheidungen zwischen Denken und Tun, wie wir sie ziehen, nicht vorhanden. Allein der Neurotiker ist vor allem im Handeln gehemmt, bei ihm ist der Gedanke der volle Ersatz für die Tat. Der Primitive ist ungehemmt, der Gedanke setzt sich ohneweiters in Tat um, die Tat ist ihm sozusagen eher ein Ersatz des Gedankens, und darum meine ich, ohne selbst für die letzte Sicherheit der Entscheidung einzutreten, man darf in dem Falle, den wir diskutieren, wohl annehmen: »Im Anfang war die Tat.«
IV. Die infantile Wiederkehr des Totemismus
Von der Psychoanalyse, welche zuerst die regelmäßige Überdeterminierung psychischer Akte und Bildungen aufgedeckt hat, braucht man nicht zu besorgen, daß sie versucht sein werde, etwas so Kompliziertes wie die Religion aus einem einzigen Ursprung abzuleiten. Wenn sie in notgedrungener, eigentlich pflichtgemäßer Einseitigkeit eine einzige der Quellen dieser Institution zur Anerkennung bringen will, so beansprucht sie zunächst für dieselbe die Ausschließlichkeit so wenig wie den ersten Rang unter den zusammenwirkenden Momenten. Erst eine Synthese aus verschiedenen Gebieten der Forschung kann entscheiden, welche relative Bedeutung dem hier zu erörternden Mechanismus in der Genese der Religion zuzuteilen ist; eine solche Arbeit überschreitet aber sowohl die Mittel als auch die Absicht des Psychoanalytikers.
1
In der ersten Abhandlung dieser Reihe haben wir den Begriff des Totemismus kennengelernt. Wir haben gehört, daß der Totemismus ein System ist, welches bei gewissen primitiven Völkern in Australien, Amerika, Afrika die Stelle einer Religion vertritt und die Grundlage der sozialen Organisation abgibt. Wir wissen, daß der Schotte McLennan 1869 das allgemeinste Interesse für die bis dahin nur als Kuriosa gewürdigten Phänomene des Totemismus in Anspruch nahm, indem er die Vermutung aussprach, eine große Anzahl von Sitten und Gebräuchen in verschiedenen alten wie modernen Gesellschaften seien als Überreste einer totemistischen Epoche zu verstehen. Die Wissenschaft hat seither diese Bedeutung des Totemismus im vollen Umfange anerkannt. Als eine der letzten Äußerungen über diese Frage will ich eine Stelle aus den Elementen der Völkerpsychologie von W. Wundt (1912, p. 139) zitieren: »Nehmen wir alles dies zusammen, so ergibt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der Schluß, daß die totemistische Kultur überall einmal eine Vorstufe der späteren Entwicklungen und eine Übergangsstufe zwischen dem Zustand des primitiven Menschen und dem Helden- und Götterzeitalter gebildet hat.«
Die Absichten der vorliegenden Abhandlungen nötigen uns zu einem tieferen Eingehen auf die Charaktere des Totemismus. Aus Gründen, welche später ersichtlich werden sollen, bevorzuge ich hier eine Darstellung von S. Reinach, der im Jahre 1900 nachstehenden Code du totemisme in zwölf Artikeln, gleichsam einen Katechismus der totemistischen Religion, entworfen hat [Fußnote]Revue scientifique, Oktober 1900, abgedruckt in des Autors vierbändigem Werke Cultes, mythes et religions (1905–12, Bd. I, 17 ff.).:
1. Gewisse Tiere dürfen weder getötet noch gegessen werden, aber die Menschen ziehen Individuen dieser Tiergattungen auf und schenken ihnen Pflege.
2. Ein zufällig verstorbenes Tier wird betrauert und unter den gleichen Ehrenbezeigungen bestattet wie ein Mitglied des Stammes.
3. Das Speiseverbot bezieht sich gelegentlich nur auf einen bestimmten Körperteil des Tieres.
4. Wenn man ein für gewöhnlich verschontes Tier unter dem Drange der Notwendigkeit töten muß, so entschuldigt man sich bei ihm und sucht die Verletzung des Tabu, den Mord, durch mannigfache Kunstgriffe und Ausflüchte abzuschwächen.
5. Wenn das Tier rituell geopfert wird, wird es feierlich beweint.
6. Bei gewissen feierlichen Gelegenheiten, religiösen Zeremonien, legt man die Haut bestimmter Tiere an. Wo der Totemismus noch besteht, sind dies die Totemtiere.
7. Stämme und Einzelpersonen legen sich Tiernamen bei, eben die der Totemtiere.
8. Viele Stämme gebrauchen Tierbilder als Wappen und verzieren mit ihnen ihre Waffen; Männer malen sich Tierbilder auf den Leib oder lassen sich solche durch Tätowierung einritzen.
9. Wenn der Totem zu den gefürchteten und gefährlichen Tieren gehört, so wird angenommen, daß er die Mitglieder des nach ihm genannten Stammes verschont.
10. Das Totemtier beschützt und warnt die Angehörigen des Stammes.
11. Das Totemtier kündigt seinen Getreuen die Zukunft an und dient ihnen als Führer.
12. Die Mitglieder eines Totemstammes glauben oft daran, daß sie mit dem Totemtier durch das Band gemeinsamer Abstammung verknüpft sind.
Man kann diesen Katechismus der Totemreligion erst würdigen, wenn man in Betracht zieht, daß Reinach hier auch alle Anzeichen und Resterscheinungen eingetragen hat, aus denen man den einstigen Bestand des totemistischen Systems erschließen kann. Eine besondere Stellung dieses Autors zum Problem zeigt sich darin, daß er dafür die wesentlichen Züge des Totemismus einigermaßen vernachlässigt. Wir werden uns überzeugen, daß er von den zwei Hauptsätzen des totemistischen Katechismus den einen in den Hintergrund gedrängt, den anderen völlig übergangen hat.
Um von den Charakteren des Totemismus ein richtiges Bild zu gewinnen, wenden wir uns an einen Autor, welcher dem Thema ein vierbändiges Werk gewidmet hat, das die vollständigste Sammlung der hieher gehörigen Beobachtungen mit der eingehendsten Diskussion der durch sie angeregten Probleme verbindet. Wir werden J. G. Frazer, dem Verfasser von Totemism and Exogamy (1910), für Genuß und Belehrung verpflichtet bleiben, auch wenn die psychoanalytische Untersuchung zu Ergebnissen führen sollte, welche weit von den seinigen abweichen [Fußnote]Vielleicht tun wir aber vorher gut daran, dem Leser die Schwierigkeiten vorzuführen, mit denen Feststellungen auf diesem Gebiete zu kämpfen haben: Zunächst: die Personen, welche die Beobachtungen sammeln, sind nicht dieselben, welche sie verarbeiten und diskutieren, die ersteren Reisende und Missionäre, die letzteren Gelehrte, welche die Objekte ihrer Forschung vielleicht niemals gesehen haben. – Die Verständigung mit den Wilden ist nicht leicht. Nicht alle der Beobachter waren mit den Sprachen derselben vertraut, sondern mußten sich der Hilfe von Dolmetschern bedienen oder in der Hilfssprache des pidgin-english mit den Ausgefragten verkehren. Die Wilden sind nicht mitteilsam über die intimsten Angelegenheiten ihrer Kultur und eröffnen sich nur solchen Fremden, die viele Jahre in ihrer Mitte zugebracht haben. Sie geben aus den verschiedenartigsten Motiven (vgl. Frazer, 1910, Bd. 1, 150 f.) oft falsche oder mißverständliche Auskünfte. – Man darf nicht daran vergessen, daß die primitiven Völker keine jungen Völker sind, sondern eigentlich ebenso alt wie die zivilisiertesten, und daß man kein Recht zur Erwartung hat, sie würden ihre ursprünglichen Ideen und Institutionen ohne jede Entwicklung und Entstellung für unsere Kenntnisnahme aufbewahrt haben. Es ist vielmehr sicher, daß sich bei den Primitiven tiefgreifende Wandlungen nach allen Richtungen vollzogen haben, so daß man niemals ohne Bedenken entscheiden kann, was an ihren gegenwärtigen Zuständen und Meinungen nach Art eines Petrefakts die ursprüngliche Vergangenheit erhalten hat und was einer Entstellung und Veränderung derselben entspricht. Daher die überreichlichen Streitigkeiten unter den Autoren, was an den Eigentümlichkeiten einer primitiven Kultur als primär und was als spätere sekundäre Gestaltung aufzufassen sei. Die Feststellung des ursprünglichen Zustandes bleibt also jedesmal eine Sache der Konstruktion. – Es ist endlich nicht leicht, sich in die Denkungsart der Primitiven einzufühlen. Wir mißverstehen sie ebenso leicht wie die Kinder und sind immer geneigt, ihr Tun und Fühlen nach unseren eigenen psychischen Konstellationen zu deuten.
»Ein Totem«, schrieb Frazer in seinem ersten Aufsatz [Fußnote]Totemism, Edinburgh 1887, abgedruckt im ersten Band des großen Werkes Totemism and Exogamy (1910)., »ist ein materielles Objekt, welchem der Wilde einen abergläubischen Respekt bezeugt, weil er glaubt, daß zwischen seiner eigenen Person und jedem Ding dieser Gattung eine ganz besondere Beziehung besteht ... Die Verbindung zwischen einem Menschen und seinem Totem ist eine wechselseitige, der Totem beschützt den Menschen, und der Mensch beweist seine Achtung vor dem Totem auf verschiedene Arten, so z. B. daß er ihn nicht tötet, wenn es ein Tier, und nicht abpflückt, wenn es eine Pflanze ist. Der Totem unterscheidet sich vom Fetisch darin, daß er nie ein Einzelding ist wie dieser, sondern immer eine Gattung, in der Regel eine Tier- oder Pflanzenart, seltener eine Klasse von unbelebten Dingen und noch seltener von künstlich hergestellten Gegenständen ...«
»Man kann mindestens drei Arten von Totem unterscheiden:
1. den Stammestotem, an dem ein ganzer Stamm teilhat und der sich erblich von einer Generation auf die nächste überträgt;
2. den Geschlechtstotem, der allen männlichen oder allen weiblichen Mitgliedern eines Stammes mit Ausschluß des anderen Geschlechtes angehört, und
3. den individuellen Totem, der einer einzelnen Person eignet und nicht auf deren Nachkommenschaft übergeht ...« Die beiden letzten Arten von Totem kommen an Bedeutung gegen den Stammestotem nicht in Betracht. Es sind, wenn nicht alles täuscht, späte und für das Wesen des Totem wenig bedeutsame Bildungen.
»Der Stammestotem (Clantotem) ist Gegenstand der Verehrung einer Gruppe von Männern und Frauen, die sich nach dem Totem nennen, sich für blutsverwandte Abkömmlinge eines gemeinsamen Ahnen halten und durch gemeinsame Pflichten gegeneinander wie durch den Glauben an ihren Totem miteinander fest verbunden sind.«
»Der Totemismus ist sowohl ein religiöses wie ein soziales System. Nach seiner religiösen Seite besteht er in den Beziehungen gegenseitiger Achtung und Schonung zwischen einem Menschen und seinem Totem, nach seiner sozialen Seite in den Verpflichtungen der Clanmitglieder gegeneinander und gegen andere Stämme. In der späteren Geschichte des Totemismus zeigen dessen beide Seiten eine Neigung auseinanderzugehen; das soziale System überlebt häufig das religiöse, und umgekehrt verbleiben Reste von Totemismus in der Religion solcher Länder, in denen das auf den Totemismus gegründete soziale System verschwunden ist. Wie diese beiden Seiten des Totemismus ursprünglich miteinander zusammenhängen, können wir bei unserer Unkenntnis über dessen Ursprünge nicht mit Sicherheit sagen. Doch ergibt sich im ganzen eine starke Wahrscheinlichkeit dafür, daß die beiden Seiten des Totemismus zu Anfang unzertrennlich voneinander waren. Mit anderen Worten, je weiter wir zurückgehen, desto deutlicher zeigt es sich, daß der Stammesangehörige sich zur selben Art zählt wie seinen Totem und sein Verhalten gegen den Totem von dem gegen einen Stammesgenossen nicht unterscheidet.«
In der speziellen Beschreibung des Totemismus als eines religiösen Systems stellt Frazer voran, daß die Mitglieder eines Stammes sich nach ihrem Totem nennen und in der Regel auch glauben, daß sie von ihm abstammen. Die Folge dieses Glaubens ist es, daß sie das Totemtier nicht jagen, nicht töten und nicht essen und sich jeden anderen Gebrauch des Totem versagen, wenn er etwas anderes als ein Tier ist. Die Verbote, den Totem nicht zu töten und nicht zu essen, sind nicht die einzigen Tabu, die ihn betreffen; manchmal ist es auch verboten, ihn zu berühren, ja, ihn anzuschauen; in einer Anzahl von Fällen darf der Totem nicht bei seinem richtigen Namen genannt werden. Die Übertretung dieser den Totem schützenden Tabugebote straft sich automatisch durch schwere Erkrankungen oder Tod [Fußnote]Vgl. die Abhandlung über das Tabu..
Exemplare des Totemtieres werden gelegentlich von dem Clan aufgezogen und in der Gefangenschaft gehegt [Fußnote]Wie heute noch die Wölfe im Käfig an der Kapitolsstiege in Rom, die Bären im Zwinger von Bern.. Ein tot aufgefundenes Totemtier wird betrauert und bestattet wie ein Clangenosse. Mußte man ein Totemtier töten, so geschah es unter einem vorgeschriebenen Rituale von Entschuldigungen und Sühnezeremonien.
Von seinem Totem erwartete der Stamm Schutz und Schonung. Wenn er ein gefährliches Tier war (Raubtier, Giftschlange), so setzte man voraus, daß er seinen Genossen nichts zuleide tun würde, und wo sich diese Voraussetzung nicht bestätigte, wurde der Beschädigte aus dem Stamme ausgestoßen. Eide, meint Frazer, waren ursprünglich Ordalien; viele Abstammungs- und Echtheitsproben wurden so dem Totem zur Entscheidung überlassen. Der Totem hilft in Krankheiten, gibt dem Stamme Vorzeichen und Warnungen. Die Erscheinung des Totemtieres in der Nähe eines Hauses wurde häufig als Ankündigung eines Todesfalles angesehen. Der Totem war gekommen, seinen Verwandten zu holen [Fußnote]Also wie die weiße Frau mancher Adelsgeschlechter.. Unter verschiedenen bedeutsamen Verhältnissen sucht der Clangenosse seine Verwandtschaft mit dem Totem zu betonen, indem er sich ihm äußerlich ähnlich macht, sich in die Haut des Totemtieres hüllt, sich das Bild desselben einritzt u. dgl. Bei den feierlichen Gelegenheiten der Geburt, der Männerweihe, des Begräbnisses wird diese Identifizierung mit dem Totem in Taten und Worten durchgeführt. Tänze, bei denen alle Genossen des Stammes sich in ihren Totem verkleiden und wie er gebärden, dienen mannigfaltigen magischen und religiösen Absichten. Endlich gibt es Zeremonien, bei denen das Totemtier in feierlicher Weise getötet wird [Fußnote]Frazer (1910, Bd. 1, p. 45). – S. unten die Erörterung über das Opfer..
Die soziale Seite des Totemismus prägt sich vor allem in einem streng gehaltenen Gebot und in einer großartigen Einschränkung aus. Die Mitglieder eines Totemclans sind Brüder und Schwestern, verpflichtet, einander zu helfen und zu beschützen; im Falle der Tötung eines Clangenossen durch einen Fremden haftet der ganze Stamm des Täters für die Bluttat, und der Clan des Gemordeten fühlt sich solidarisch in der Forderung nach Sühne für das vergossene Blut. Die Totembande sind stärker als die Familienbande in unserem Sinne; sie fallen mit diesen nicht zusammen, da die Übertragung des Totem in der Regel durch mütterliche Vererbung geschieht und ursprünglich die väterliche Vererbung vielleicht überhaupt nicht in Geltung war.
Die entsprechende Tabubeschränkung aber besteht in dem Verbot, daß Mitglieder desselben Totemclans einander nicht heiraten und überhaupt nicht in Sexualverkehr miteinander treten dürfen. Dies ist die berühmte und rätselhafte, mit dem Totemismus verknüpfte Exogamie. Wir haben ihr die ganze erste Abhandlung dieser Reihe gewidmet und brauchen darum hier nur anzuführen, daß sie der verschärften Inzestscheu der Primitiven entspringt, daß sie als Sicherung gegen Inzest bei Gruppenehe vollkommen verständlich würde und daß sie zunächst die Inzestverhütung für die jüngere Generation besorgt und erst in weiterer Ausbildung auch der älteren Generation zum Hindernis wird [Fußnote]S. die erste Abhandlung..
An diese Darstellung des Totemismus bei Frazer, eine der frühesten in der Literatur des Gegenstandes, will ich nun einige Auszüge aus einer der letzten Zusammenfassungen anschließen. In den 1912 erschienenen Elementen der Völkerpsychologie sagt W. Wundt [Fußnote]p. 116: »Das Totemtier gilt als Ahnentier der betreffenden Gruppe. ›Totem‹ ist also einerseits Gruppen-, anderseits Abstammungsname, und in letzterer Beziehung hat dieser Name zugleich eine mythologische Bedeutung. Alle diese Verwendungen des Begriffes spielen aber ineinander, und die einzelnen dieser Bedeutungen können zurücktreten, so daß in manchen Fällen die Totems fast zu einer bloßen Nomenklatur der Stammesabteilungen geworden sind, während in anderen die Vorstellung der Abstammung oder aber auch die kultische Bedeutung des Totems im Vordergrund steht ...« Der Begriff des Totem wird für die Stammesgliederung und Stammesorganisation maßgebend. »Mit diesen Normen und mit ihrer Befestigung im Glauben und Fühlen der Stammesgenossen hängt es zusammen, daß man das Totemtier ursprünglich jedenfalls nicht bloß als einen Namen für eine Gruppe von Stammesgliedern betrachtete, sondern daß das Tier meist als Stammvater der betreffenden Abteilung gilt ... Damit hängt dann zusammen, daß diese Tierahnen einen Kult genießen ... Dieser Tierkult äußert sich ursprünglich, abgesehen von bestimmten Zeremonien und zeremoniellen Festen, vor allem in dem Verhalten gegenüber dem Totemtier: nicht nur ein einzelnes Tier, sondern jeder Repräsentant der gleichen Spezies ist in gewissem Grade ein geheiligtes Tier, es ist den Totemgenossen verboten oder nur unter gewissen Umständen erlaubt, das Fleisch des Totemtieres zu genießen. Dem entspricht die in solchem Zusammenhange bedeutsame Gegenerscheinung, daß unter gewissen Bedingungen eine Art von zeremoniellem Genuß des Totemfleisches stattfindet ...«
»... Die wichtigste soziale Seite dieser totemistischen Stammesgliederung besteht aber darin, daß mit ihr bestimmte Normen der Sitte für den Verkehr der Gruppen untereinander verbunden sind. Unter diesen Normen stehen in erster Linie die für den Eheverkehr. So hängt diese Stammesgliederung mit einer wichtigen Erscheinung zusammen, die zum erstenmal im totemistischen Zeitalter auftritt: mit der Exogamie.«
Wenn wir durch all das hindurch, was späterer Fortbildung oder Abschwächung entsprechen mag, zu einer Charakteristik des ursprünglichen Totemismus gelangen wollen, so ergeben sich uns folgende wesentliche Züge: Die Totem waren ursprünglich nur Tiere, sie galten als die Ahnen der einzelnen Stämme. Der Totem vererbte sich nur in weiblicher Linie; es war verboten, den Totem zu töten (oder zu essen, was für primitive Verhältnisse zusammenfällt); es war den Totemgenossen verboten, Sexualverkehr miteinander zu pflegen[Fußnote]Übereinstimmend mit diesem Text lautet das Fazit des Totemismus, welches Frazer in seiner zweiten Arbeit über den Gegenstand (›The Origin of Totemisms Fortnightly Review 1899) zieht: » Thus, Totemism has commonly been treated as a primitive system both of religion and of Society. As a System of religion it embraces the mystic union of the savage with his totem; as a System of Society it comprises the relations in which men and women of the same totem stand to each other and to the members of other totemic groups. And corresponding to these two sides of the System are two rough and ready tests or canons of Totemism: first, the rule that a man may not kill or eat his totem animal or plant; and second the rule that he may not marry or cohabit with a woman of the same totem.« Frazer fügt dann hinzu, was uns mitten in die Diskussionen über den Totemismus hineinführt: » Whether the two sides – the religious and the social – have always co-existed or are essentially independent, is a question which has been variously answered.«.
Es darf uns nun auffallen, daß in dem Code du totemisme, den Reinach aufgestellt hat, das eine der Haupttabu, das der Exogamie, überhaupt nicht vorkommt, während die Voraussetzung des zweiten, die Abstammung vom Totemtier, nur eine beiläufige Erwähnung findet. Ich habe aber die Darstellung Reinachs, eines um den Gegenstand sehr verdienten Autors, ausgewählt, um auf die Meinungsverschiedenheiten unter den Autoren vorzubereiten, welche uns nun beschäftigen sollen.
2
Je unabweisbarer die Einsicht auftrat, daß der Totemismus eine regelmäßige Phase aller Kulturen gebildet habe, desto dringender wurde das Bedürfnis, zu einem Verständnis desselben zu gelangen, die Rätsel seines Wesens aufzuhellen. Rätselhaft ist wohl alles am Totemismus; die entscheidenden Fragen sind die nach der Herkunft der Totemabstammung, nach der Motivierung der Exogamie (respektive des durch sie vertretenen Inzesttabu) und nach der Beziehung zwischen den beiden, der Totemorganisation und dem Inzestverbot. Das Verständnis sollte in einem ein historisches und ein psychologisches sein, Auskunft geben, unter welchen Bedingungen sich diese eigentümliche Institution entwickelt und welchen seelischen Bedürfnissen der Menschen sie Ausdruck gegeben hatte.
Meine Leser werden nun gewiß erstaunt sein zu hören, von wie verschiedenen Gesichtspunkten her die Beantwortung dieser Fragen versucht wurde und wie weit die Meinungen der sachkundigen Forscher hierüber auseinandergehen. Es steht so ziemlich alles in Frage, was man allgemein über Totemismus und Exogamie behaupten möchte; auch das vorangeschickte, aus einer von Frazer 1887 veröffentlichten Schrift geschöpfte Bild kann der Kritik nicht entgehen, eine willkürliche Vorliebe des Referenten auszudrücken, und würde heute von Frazer selbst, der seine Ansichten über den Gegenstand wiederholt geändert hat, beanständet werden [Fußnote]Anläßlich einer solchen Sinnesänderung schrieb er den schönen Satz nieder: » That my conclusions on these difftcult questions are final, I am not so foolish as to pretend. I have changed my views repeatedly, and I am resolved to change them again with every change of the evidence, for like a chameleon, the candid enquirer should shift his colours with the shifting colours of the ground he treads.« Vorrede zum I. Band von Totemism and Exogamy (1910)..
Es ist eine naheliegende Annahme, daß man das Wesen des Totemismus und der Exogamie am ehesten erfassen könnte, wenn man den Ursprüngen der beiden Institutionen näherkäme. Dann ist aber für die Beurteilung der Sachlage die Bemerkung von Andrew Lang nicht zu vergessen, daß auch die primitiven Völker uns diese ursprünglichen Formen der Institutionen und die Bedingungen für deren Entstehung nicht mehr aufbewahrt haben, so daß wir einzig und allein auf Hypothesen angewiesen bleiben, um die mangelnde Beobachtung zu ersetzen [Fußnote]» By the nature of the case, as the origin of totemism lies far beyond our powers of historical examination or of experiment, we must have recourse as regards this matter to conjecture«, A. Lang (1905, p. 27). – » Nowhere do we see absolutely primitive man, and a totemic system in the making.« (Ibid., p. 29.). Unter den vorgebrachten Erklärungsversuchen erscheinen einige dem Urteil des Psychologen von vornherein als inadäquat. Sie sind allzu rationell und nehmen auf den Gefühlscharakter der zu erklärenden Dinge keine Rücksicht. Andere ruhen auf Voraussetzungen, denen die Beobachtung die Bestätigung versagt; noch andere berufen sich auf ein Material, welches besser einer anderen Deutung unterworfen werden sollte. Die Widerlegung der verschiedenen Ansichten hat in der Regel wenig Schwierigkeiten; die Autoren sind wie gewöhnlich in der Kritik, die sie aneinander üben, stärker als in ihren eigenen Produktionen. Ein Non liquet ist für die meisten der behandelten Punkte das Endergebnis. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn in der neuesten, hier meist übergangenen Literatur des Gegenstandes das unverkennbare Bestreben auftritt, eine allgemeine Lösung der totemistischen Probleme als undurchführbar abzuweisen. So z. B. Goldenweiser, 1910. (Referat in Britannica Year Book 1913.) Ich habe mir gestattet, bei der Mitteilung dieser einander widerstreitenden Hypothesen von deren Zeitfolge abzusehen.
a) Die Herkunft des Totemismus
Die Frage nach der Entstehung des Totemismus läßt sich auch so formulieren: Wie kamen primitive Menschen dazu, sich (ihre Stämme) nach Tieren, Pflanzen, leblosen Gegenständen zu benennen? [Fußnote]Wahrscheinlich ursprünglich nur nach Tieren.
Der Schotte McLennan, der Totemismus und Exogamie für die Wissenschaft entdeckte (1869–70 und 1865), enthielt sich, eine Ansicht über die Entstehung des Totemismus zu veröffentlichen. Nach einer Mitteilung von A. Lang (1905, 34) war er eine Zeitlang geneigt, den Totemismus auf die Sitte des Tätowierens zurückzuführen. Die verlautbarten Theorien zur Ableitung des Totemismus möchte ich in drei Gruppen bringen, als α) nominalistische, β) soziologische, γ) psychologische.
α) Die nominalistischen Theorien
Die Mitteilungen über diese Theorien werden deren Zusammenfassung unter dem von mir gebrachten Titel rechtfertigen.
Schon Garcilaso de la Vega, ein Abkömmling der peruanischen Inka, der im 17. Jahrhundert die Geschichte seines Volkes schrieb, soll, was ihm von totemistischen Phänomenen bekannt war, auf das Bedürfnis der Stämme, sich durch Namen voneinander zu unterscheiden, zurückgeführt haben [Fußnote]Nach Lang, 1905, p. 34.. Derselbe Gedanke taucht Jahrhunderte später in der Ethnology von A. H. Keane auf: Die Totem seien aus » heraldic badges« (Wappenabzeichen) hervorgegangen, durch die Individuen, Familien und Stämme sich voneinander unterscheiden wollten. [Fußnote]Ibid.
Max Müller äußerte dieselbe Ansicht über die Bedeutung der Totem in seinen Contributions to the Science of Mythology. [Fußnote]Nach A. Lang. Ein Totem sei: 1. ein Clanabzeichen, 2. ein Clanname, 3. der Name des Ahnherrn des Clan, 4. der Name des vom Clan verehrten Gegenstandes. Später J. Pikler (1899): »Die Menschen bedurften eines bleibenden, schriftlich fixierbaren Namens für Gemeinschaften und Individuen ... So entspringt also der Totemismus nicht aus dem religiösen, sondern aus dem nüchternen Alltagsbedürfnis der Menschheit. Der Kern des Totemismus, die Benennung, ist eine Folge der primitiven Schrifttechnik. Der Charakter der Totem ist auch der von leicht darstellbaren Schriftzeichen. Wenn die Wilden aber erst den Namen eines Tieres trugen, so leiteten sie daraus die Idee einer Verwandtschaft mit diesem Tiere ab.« [Fußnote]Pikler und Somló. Die Autoren kennzeichnen ihren Erklärungsversuch mit Recht als »Beitrag zur materialistischen Geschichtstheorie«.
Herbert Spencer [Fußnote]1870, I. Bd., §§ 169 bis 176 legte gleichfalls der Namengebung die entscheidende Bedeutung für die Entstehung des Totemismus bei. Einzelne Individuen, führte er aus, hätten durch ihre Eigenschaften herausgefordert, sie nach Tieren zu benennen, und seien so zu Ehrennamen oder Spitznamen gekommen, welche sich auf ihre Nachkommen fortsetzten. Infolge der Unbestimmtheit und Unverständlichkeit der primitiven Sprachen seien diese Namen von den späteren Generationen so aufgefaßt worden, als seien sie ein Zeugnis für ihre Abstammung von diesen Tieren selbst. Der Totemismus hätte sich so als mißverständliche Ahnenverehrung ergeben.
Ganz ähnlich, obwohl ohne Hervorhebung des Mißverständnisses hat Lord Avebury (bekannter unter seinem früheren Namen Sir John Lubbock) die Entstehung des Totemismus beurteilt: Wenn wir die Tierverehrung erklären wollen, dürfen wir nicht daran vergessen, wie häufig die menschlichen Namen von den Tieren entlehnt werden. Die Kinder und das Gefolge eines Mannes, der Bär oder Löwe genannt wurde, machten daraus natürlich einen Stammesnamen. Daraus ergab sich, daß das Tier selbst zu einer gewissen Achtung und endlich Verehrung gelangte.
Einen, wie es scheint, unwiderleglichen Einwand gegen solche Zurückführung der Totemnamen auf die Namen von Individuen hat Fison vorgebracht [Fußnote]Kamilaroi and Kurmai, p. 165, 1880 (nach A. Lang, Secret etc.). Er zeigt an den Verhältnissen von Australien, daß der Totem stets das Merkzeichen einer Gruppe von Menschen, nie eines einzelnen ist. Wäre es aber anders und der Totem ursprünglich der Name eines einzelnen Menschen, so könnte er bei dem System der mütterlichen Vererbung nie auf dessen Kinder übergehen.
Die bisher mitgeteilten Theorien sind übrigens in offenkundiger Weise unzureichend. Sie erklären etwa die Tatsache der Tiernamen für die Stämme der Primitiven, aber niemals die Bedeutung, welche diese Namengebung für sie gewonnen hat, das totemistische System. Die beachtenswerteste Theorie dieser Gruppe ist die von A. Lang in seinen Büchern Social Origins 1903 und The Secret of the Totem 1905 entwickelte. Sie macht immer noch die Namengebung zum Kern des Problems, aber sie verarbeitet zwei interessante psychologische Momente und beansprucht so, das Rätsel des Totemismus der endgültigen Lösung zugeführt zu haben.
A. Lang meint, es sei zunächst gleichgültig, auf welche Weise die Clans zu ihren Tiernamen gekommen seien. Man wolle nur annehmen, sie erwachten eines Tages zum Bewußtsein, daß sie solche tragen, und wußten sich keine Rechenschaft zu geben, woher. Der Ursprung dieser Namen sei vergessen. Dann würden sie versuchen, sich durch Spekulation Auskunft darüber zu schaffen, und bei ihren Überzeugungen von der Bedeutung der Namen müßten sie notwendigerweise zu all den Ideen kommen, die im totemistischen System enthalten sind. Namen sind für die Primitiven – wie für die heutigen Wilden und selbst für unsere Kinder [Fußnote]Vgl. oben die Abhandlung über das Tabu,, S. 71. – nicht etwa etwas Gleichgültiges und Konventionelles, wie sie uns erscheinen, sondern etwas Bedeutungsvolles und Wesentliches. Der Name eines Menschen ist ein Hauptbestandteil seiner Person, vielleicht ein Stück seiner Seele. Die Gleichnamigkeit mit dem Tiere mußte die Primitiven dazu führen, ein geheimnisvolles und bedeutsames Band zwischen ihren Personen und dieser Tiergattung anzunehmen. Welches Band konnte da anders in Betracht kommen als das der Blutsverwandtschaft? War diese aber infolge der Namensgleichheit einmal angenommen, so ergaben sich aus ihr als direkte Folgen des Bluttabu alle Totemvorschriften mit Einschluß der Exogamie.
» No more than these three things – a group animal name of unknown origin; belief in a transcendental connection between all bearers, human and bestial, of the same name; and belief in the blood superstitions – was needed to give rise to all the totemic creeds and practices, including exogamy.« (Lang, 1905, p. 125)
Langs Erklärung ist sozusagen zweizeitig. Sie leitet das totemistische System mit psychologischer Notwendigkeit aus der Tatsache der Totemnamen ab unter der Voraussetzung, daß die Herkunft dieser Namengebung vergessen worden sei. Das andere Stück der Theorie sucht nun den Ursprung dieser Namen aufzuklären; wir werden sehen, daß es von ganz anderem Gepräge ist.
Dies andere Stück der Langschen Theorie entfernt sich nicht wesentlich von den übrigen, die ich »nominalistisch« genannt habe. Das praktische Bedürfnis nach Unterscheidung nötigte die einzelnen Stämme, Namen anzunehmen, und darum ließen sie sich die Namen gefallen, die jedem Stamm von den anderen gegeben wurden. Dies » naming from without« ist die Eigentümlichkeit der Langschen Konstruktion. Daß die Namen, die so zustande kamen, von Tieren entlehnt waren, ist nicht weiter auffällig und braucht von den Primitiven nicht als Schimpf oder Spott empfunden worden zu sein. Übrigens hat Lang die keineswegs vereinzelten Fälle aus späteren Epochen der Geschichte herangezogen, in denen von außen gegebene, ursprünglich als Spott gemeinte Namen von den so Bezeichneten akzeptiert und bereitwillig getragen wurden ( Geusen, Whigs und Tories). Die Annahme, daß die Entstehung dieser Namen im Laufe der Zeit vergessen wurde, verknüpft dies zweite Stück der Langschen Theorie mit dem vorhin dargestellten ersten.
β) Die soziologischen Theorien
S. Reinach, der den Überbleibseln des totemistischen Systems in Kult und Sitte späterer Perioden erfolgreich nachgespürt, aber von Anfang an das Moment der Abstammung vom Totemtier geringgeschätzt hat, äußert einmal ohne Bedenken, der Totemismus scheine ihm nichts anderes zu sein als » une hypertrophie de l'instinct social« [Fußnote]Reinach (1905–12, Bd. 1, p. 41)..
Dieselbe Auffassung scheint das neue Werk von E. Durkheim: Les formes élémentaires de la vie religieuse: Le système totémique en Australie (1912), zu durchziehen. Der Totem ist der sichtbare Repräsentant der sozialen Religion dieser Völker. Er verkörpert die Gemeinschaft, welche der eigentliche Gegenstand der Verehrung ist.
Andere Autoren haben nach näherer Begründung für diese Beteiligung der sozialen Triebe an der Bildung der totemistischen Institutionen gesucht. So hat A. C. Haddon angenommen, daß jeder primitive Stamm ursprünglich von einer besonderen Tier- oder Pflanzenart lebte, vielleicht auch mit diesem Nahrungsmittel Handel trieb und ihn anderen Stämmen im Austausch zuführte. So konnte es nicht fehlen, daß der Stamm den anderen unter dem Namen des Tieres, welches für ihn eine so wichtige Rolle spielte, bekannt wurde. Gleichzeitig mußte sich bei diesem Stamm eine besondere Vertrautheit mit dem betreffenden Tier und eine Art von Interesse für dasselbe entwickeln, welches aber auf kein anderes psychisches Motiv als auf das elementarste und dringendste der menschlichen Bedürfnisse, den Hunger, gegründet war [Fußnote]Haddon (1902), bei Frazer (1910, Bd. 4, p. 50)..
Die Einwendungen gegen diese rationalste aller Totemtheorien besagen, daß ein solcher Zustand der Ernährung bei den Primitiven nirgends gefunden werde und wahrscheinlich niemals bestanden habe. Die Wilden seien omnivor, und zwar um so mehr, je niedriger sie stehen. Ferner sei es nicht zu verstehen, wie aus solcher ausschließlicher Diät sich ein fast religiöses Verhältnis zu dem Totem entwickelt haben konnte, das in der absoluten Enthaltung von der Vorzugsnahrung gipfelte.
Die erste der drei Theorien, welche Frazer über die Entstehung des Totemismus ausgesprochen, war eine psychologische; sie wird an anderer Stelle berichtet werden.
Die zweite hier zu besprechende Theorie Frazers entstand unter dem Eindruck der bedeutungsvollen Publikation zweier Forscher über die Eingeborenen von Zentralaustralien.
Spencer und Gillen beschrieben bei einer Gruppe von Stämmen, der sogenannten Aruntanation, eine Reihe von eigentümlichen Einrichtungen, Gebräuchen und Ansichten, und Frazer schloß sich ihrem Urteile an, daß diese Besonderheiten als Züge eines primären Zustandes zu betrachten seien und über den ersten und eigentlichen Sinn des Totemismus Aufschluß geben können.
Diese Eigentümlichkeiten sind bei dem Aruntastamm selbst (einem Teil der Aruntanation) folgende:
1. Sie haben die Gliederung in Totemclans, aber der Totem wird nicht erblich übertragen, sondern (auf später mitzuteilende Weise) individuell bestimmt.
2. Die Totemclans sind nicht exogam, die Heiratsbeschränkungen werden durch eine hochentwickelte Gliederung in Heiratsklassen hergestellt, welche mit den Totem nichts zu tun haben.
3. Die Funktion der Totemclans besteht in der Ausführung einer Zeremonie, welche auf exquisit magische Weise die Vermehrung des eßbaren Totemobjekts bezweckt (diese Zeremonie heißt Intichiuma).
4. Die Arunta haben eine eigenartige Konzeptions- und Wiedergeburtstheorie. Sie nehmen an, daß an bestimmten Stellen ihres Landes die Geister der Verstorbenen desselben Totem auf ihre Wiedergeburt warten und in den Leib der Frauen eindringen, die jene Stellen passieren. Wird ein Kind geboren, so gibt die Mutter an, auf welcher Geisterstätte sie ihr Kind empfangen zu haben glaubt. Danach wird der Totem des Kindes bestimmt. Es wird ferner angenommen, daß die Geister (der Verstorbenen wie der Wiedergeborenen) an eigentümliche Steinamulette gebunden sind (namens Churinga), welche an jenen Stätten gefunden werden.
Zwei Momente scheinen Frazer zum Glauben bewogen zu haben, daß man in den Einrichtungen der Arunta die älteste Form des Totemismus aufgefunden habe. Erstens die Existenz gewisser Mythen, welche behaupteten, daß die Ahnen der Arunta sich regelmäßig von ihrem Totem genährt und keine anderen Frauen als die aus ihrem eigenen Totem geheiratet hätten. Zweitens die anscheinende Zurücksetzung des Geschlechtsaktes in ihrer Konzeptionstheorie. Menschen, die noch nicht erkannt hatten, daß die Empfängnis die Folge des Geschlechtsverkehrs sei, dürfte man wohl als die zurückgebliebensten und primitivsten unter den heute lebenden ansehen.
Indem Frazer sich für die Beurteilung des Totemismus an die Intichiumazeremonie hielt, erschien ihm das totemistische System auf einmal in gänzlich verändertem Lichte als eine durchwegs praktische Organisation zur Bestreitung der natürlichsten Bedürfnisse des Menschen (vgl. oben, Haddon) [Fußnote]» There is nothing vague or mystical about it, nothing of that metaphysical haze which some writers love to conjure up over the humble beginnings of human speculation, but which is utterly foreign to the simple, sensuous and concrete modes of thought of the savage.« (Frazer, 1910, I, p. 117.), Das System war einfach ein großartiges Stück von » co-operative magic«. Die Primitiven bildeten sozusagen einen magischen Produktions- und Konsumverein. Jeder Totemclan hatte die Aufgabe übernommen, für die Reichlichkeit eines gewissen Nahrungsmittels zu sorgen. Wenn es sich um nicht eßbare Totem handelte, wie um schädliche Tiere, um Regen, Wind u. dgl., so war die Pflicht des Totemclan, dieses Stück Natur zu beherrschen und dessen Schädlichkeit abzuwehren. Die Leistungen eines jeden Clan kamen allen anderen zugute. Da der Clan von seinem Totem nichts oder nur sehr wenig essen durfte, so beschaffte er dieses wertvolle Gut für die anderen und wurde dafür von ihnen mit dem versorgt, was sie selbst als ihre soziale Totempflicht zu besorgen hatten. Im Lichte dieser durch die Intichiumazeremonie vermittelten Auffassung wollte es Frazer scheinen, als wäre man durch das Verbot, von seinem Totem zu essen, verblendet worden, die wichtigere Seite des Verhältnisses zu vernachlässigen, nämlich das Gebot, möglichst viel von dem eßbaren Totem für den Bedarf der anderen herbeizuschaffen.
Frazer nahm die Tradition der Arunta an, daß jeder Totemclan sich ursprünglich ohne Einschränkung von seinem Totem genährt habe. Dann bereitete es Schwierigkeiten, die folgende Entwicklung zu verstehen, die sich damit begnügte, den Totem für andere zu sichern, während man selbst auf seinen Genuß fast verzichtete. Er nahm dann an, diese Einschränkung sei keineswegs aus einer Art von religiösem Respekt hervorgegangen, sondern vielleicht aus der Beobachtung, daß kein Tier seinesgleichen zu verzehren pflege, so daß dieser Abbruch der Identifizierung mit dem Totem der Macht, die man über denselben zu erlangen wünschte, Schaden brächte. Oder aus einem Bestreben, sich das Wesen geneigt zu machen, indem man es selbst verschonte. Frazer verhehlte sich aber die Schwierigkeiten dieser Erklärung nicht (1910, I. Bd., p. 121 ff.), und ebensowenig getraute er sich anzugeben, auf welchem Wege die von den Mythen der Arunta behauptete Gewohnheit, innerhalb des Totem zu heiraten, sich zur Exogamie gewandelt habe.
Die auf das Intichiuma gegründete Theorie Frazers steht und fällt mit der Anerkennung der primitiven Natur der Aruntainstitutionen. Es scheint aber unmöglich, diese letztere gegen die von Durkheim [Fußnote]L'année sociologique, Bd. I, V, VIII und an anderen Stellen. S. besonders die Abhandlung ›Sur le totémisme‹, Bd. V (1902). und Lang (1903 und 1905) vorgebrachten Einwendungen zu halten. Die Arunta scheinen vielmehr die entwickeltsten der australischen Stämme zu sein, eher ein Auflösungsstadium als den Beginn des Totemismus zu repräsentieren. Die Mythen, welche auf Frazer so großen Eindruck gemacht haben, weil sie im Gegensatz zu den heute herrschenden Institutionen die Freiheit betonen, vom Totem zu essen und innerhalb des Totem zu heiraten, würden sich uns leicht als Wunschphantasien erklären, welche in die Vergangenheit projiziert sind, ähnlich wie der Mythus vom goldenen Zeitalter.
γ) Die psychologischen Theorien
Die erste psychologische Theorie Frazers, noch vor seiner Bekanntschaft mit den Beobachtungen von Spencer und Gillen geschaffen, ruhte auf dem Glauben an die »äußerliche Seele« [Fußnote]The Golden Bough (1890), II, p. 332.. Der Totem sollte einen sicheren Zufluchtsort für die Seele darstellen, an dem sie deponiert wird, um den Gefahren, die sie bedrohen, entzogen zu bleiben. Wenn der Primitive seine Seele in seinem Totem untergebracht hatte, so war er selbst unverletzlich, und natürlich hütete er sich, den Träger seiner Seele selbst zu beschädigen. Da er aber nicht wußte, welches Individuum der Tierart sein Seelenträger war, lag es ihm nahe, die ganze Art zu verschonen. Frazer hat diese Ableitung des Totemismus aus dem Seelenglauben später selbst aufgegeben.
Als er mit den Beobachtungen von Spencer und Gillen bekannt wurde, stellte er die andere, soziologische Theorie des Totemismus auf, welche eben vorhin mitgeteilt wurde, aber er fand dann selbst, daß das Motiv, aus dem er den Totemismus abgeleitet, allzu »rationell« sei und daß er dabei eine soziale Organisation vorausgesetzt habe, die allzu kompliziert sei, als daß man sie primitiv heißen dürfe [Fußnote]» It is unlikely that a community of savages should deliberately parcel out the realm of nature into provinces, assign euch province to a particular band of magicians, and bid all the bands to work their magic and weave their spells for the common good.« (Frazer, 1910, Bd. 4, 57.). Die magischen Kooperativgesellschaften erschienen ihm jetzt eher als späte Früchte denn als Keime des Totemismus. Er suchte ein einfacheres Moment, einen primitiven Aberglauben, hinter diesen Bildungen, um aus ihm die Entstehung des Totemismus abzuleiten. Dieses ursprüngliche Moment fand er dann in der merkwürdigen Konzeptionstheorie der Arunta.
Die Arunta heben, wie bereits erwähnt, den Zusammenhang der Konzeption mit dem Geschlechtsakt auf. Wenn ein Weib sich Mutter fühlt, so ist in diesem Augenblick einer der auf Wiedergeburt lauernden Geister von der nächstliegenden Geisterstätte in ihren Leib eingedrungen und wird von ihr als Kind geboren. Dies Kind hat denselben Totem wie alle an der gewissen Stelle lauernden Geister. Diese Konzeptionstheorie kann den Totemismus nicht erklären, denn sie setzt den Totem voraus. Aber wenn man einen Schritt weiter zurückgehen und annehmen will, daß das Weib ursprünglich geglaubt, das Tier, die Pflanze, der Stein, das Objekt, welches ihre Phantasie in dem Moment beschäftigte, da sie sich zuerst Mutter fühlte, sei wirklich in sie eingedrungen und werde dann von ihr in menschlicher Form geboren, dann wäre die Identität eines Menschen mit seinem Totem durch den Glauben der Mutter wirklich begründet, und alle weiteren Totemgebote (mit Ausschluß der Exogamie) ließen sich leicht daraus ableiten. Der Mensch würde sich weigern, von diesem Tier, dieser Pflanze zu essen, weil er damit gleichsam sich selbst essen würde. Er würde sich aber veranlaßt finden, gelegentlich in zeremoniöser Weise etwas von seinem Totem zu genießen, weil er dadurch seine Identifizierung mit dem Totem, welche das Wesentliche am Totemismus ist, verstärken könnte. Beobachtungen von W. H. R. Rivers an den Eingeborenen der Banksinseln schienen die direkte Identifizierung der Menschen mit ihrem Totem auf Grund einer solchen Konzeptionstheorie zu erweisen [Fußnote]Frazer (1910, II, p. 89 und IV, p. 59)..
Die letzte Quelle des Totemismus wäre also die Unwissenheit der Wilden über den Prozeß, wie Menschen und Tiere ihr Geschlecht fortpflanzen. Des besonderen die Unkenntnis der Rolle, welche das Männchen bei der Befruchtung spielt. Diese Unkenntnis muß erleichtert werden durch das lange Intervall, welches sich zwischen den befruchtenden Akt und die Geburt des Kindes (oder das Verspüren der ersten Kindsbewegungen) einschiebt. Der Totemismus ist daher eine Schöpfung nicht des männlichen, sondern des weiblichen Geistes. Die Gelüste ( sick fancies) des schwangeren Weibes sind die Wurzel desselben. » Anything indeed that struck a woman at that mysterious moment of her life when she first knows herself to be a mother might easily be identified by her with the child in her womb. Such maternal fancies, so natural and seemingly so universal, appear to be the root of totemism.« [Fußnote]l. c. IV, p. 63.
Der Haupteinwand gegen diese dritte Frazersche Theorie ist derselbe, der bereits gegen die zweite, soziologische vorgebracht wurde. Die Arunta scheinen sich von den Anfängen des Totemismus weit weg entfernt zu haben. Ihre Verleugnung der Vaterschaft scheint nicht auf primitiver Unwissenheit zu beruhen; sie haben selbst in manchen Stücken väterliche Vererbung. Sie scheinen die Vaterschaft einer Art von Spekulation geopfert zu haben, welche die Ahnengeister zu Ehren bringen will [Fußnote]» That belief is a philosophy far from primitive.« (A. Lang, 1905, p. 192.). Wenn sie den Mythus der unbefleckten Empfängnis durch den Geist zur allgemeinen Konzeptionstheorie erheben, darf man ihnen darum Unwissenheit über die Bedingungen der Fortpflanzung ebensowenig zumuten wie den alten Völkern um die Zeit der Entstehung der christlichen Mythen.
Eine andere psychologische Theorie der Herkunft des Totemismus hat der Holländer G. A. Wilken aufgestellt. Sie stellt eine Verknüpfung des Totemismus mit der Seelenwanderung her. »Dasjenige Tier, in welches die Seelen der Toten nach allgemeinem Glauben übergingen, wurde zum Blutsverwandten, Ahnherrn und als solcher verehrt.« Aber der Glauben an die Tierwanderung der Seelen mag eher aus dem Totemismus abgeleitet sein als umgekehrt [Fußnote]Bei Frazer,1910, IV, p. 45 u. ff.)..
Eine andere Theorie des Totemismus wird von ausgezeichneten amerikanischen Ethnologen, Fr. Boas, Hill-Tout u. a., vertreten. Sie geht von den Beobachtungen an totemistischen Indianerstämmen aus und behauptet, der Totem sei ursprünglich der Schutzgeist eines Ahnen, den dieser durch einen Traum erworben und auf seine Nachkommenschaft vererbt habe. Wir haben schon früher gehört, welche Schwierigkeiten die Ableitung des Totemismus aus der Vererbung von einem Einzelnen her bietet; überdies sollen die australischen Beobachtungen die Zurückführung des Totem auf den Schutzgeist keineswegs unterstützen. [Fußnote]Frazer, l. c., p. 48 .
Für die letzte der psychologischen Theorien, die von Wundt ausgesprochene, sind die beiden Tatsachen entscheidend geworden, daß erstens das ursprüngliche Totemobjekt und das dauernd verbreitetste das Tier ist und daß zweitens unter den Totemtieren wieder die ursprünglichsten mit Seelentieren zusammenfallen. [Fußnote]Wundt, 1912, p. 190. Seelentiere, wie Vögel, Schlange, Eidechse, Maus, eignen sich durch ihre schnelle Beweglichkeit, ihren Flug in der Luft, durch andere Überraschung und Grauen erregende Eigenschaften dazu, als die Träger der den Körper verlassenden Seele erkannt zu werden. Das Totemtier ist ein Abkömmling der Tierverwandlungen der Hauchseele. So mündet hier für Wundt der Totemismus unmittelbar in den Seelenglauben oder Animismus ein.
b) und c) Die Herkunft der Exogamie und ihre Beziehung zum Totemismus
Ich habe die Theorien des Totemismus mit einiger Ausführlichkeit vorgebracht und muß dennoch befürchten, daß ich deren Eindruck durch die immerhin notwendige Verkürzung geschadet habe. In betreff der weiteren Fragen nehme ich mir im Interesse der Leser die Freiheit einer noch weitergehenden Zusammendrängung. Die Diskussionen über Exogamie der Totemvölker werden durch die Natur des dabei verwerteten Materials besonders kompliziert und unübersehbar; man könnte sagen: verworren. Die Ziele dieser Abhandlung gestatten es auch, daß ich mich hier auf Hervorhebung einiger Richtlinien beschränke und für eine gründlichere Verfolgung des Gegenstandes auf die mehrmals zitierten eingehenden Fachschriften verweise.
Die Stellung eines Autors zu den Problemen der Exogamie ist natürlich nicht unabhängig von seiner Parteinahme für diese oder jene Totemtheorie. Einige von diesen Erklärungen des Totemismus lassen jede Anknüpfung an die Exogamie vermissen, so daß die beiden Institutionen glatt auseinanderfallen. So stehen hier zwei Anschauungen einander gegenüber, die eine, welche den ursprünglichen Anschein festhalten will, die Exogamie sei ein wesentliches Stück des totemistischen Systems, und eine andere, welche einen solchen Zusammenhang bestreitet und an ein zufälliges Zusammentreffen der beiden Züge ältester Kulturen glaubt. Frazer hat in seinen späteren Arbeiten diesen letzteren Standpunkt mit Entschiedenheit vertreten.
» I must request the reader to bear constantly in mind that the two institutions of totemism and exogamy are fundamentally distinct inorigin and nature, though they have accidentally crossed and blended in many tribes.« (T. and Ex., I., Vorrede XII.)
Er warnt direkt vor der gegenteiligen Ansicht als einer Quelle unendlicher Schwierigkeiten und Mißverständnisse. Im Gegensatz hiezu haben andere Autoren den Weg gefunden, die Exogamie als notwendige Folge der totemistischen Grundanschauungen zu begreifen. Durkheim hat in seinen Arbeiten (1898 – 1904) ausgeführt, wie das an den Totem geknüpfte Tabu das Verbot mit sich bringen mußte, ein Weib des nämlichen Totem zum geschlechtlichen Verkehr zu gebrauchen. Der Totem ist von demselben Blut wie der Mensch, und darum verbietet der Blutbann (mit Rücksicht auf Defloration und Menstruation) den sexuellen Verkehr mit dem Weibe, das demselben Totem angehört [Fußnote]S. die Kritik der Erörterungen Durkheims bei Frazer, T. and Ex., IV, p. 101.. A. Lang, der sich hierin Durkheim anschließt, meint sogar, es bedürfte nicht des Bluttabu, um das Verbot der Frauen des gleichen Stammes zu bewirken. (Lang, 1905, p. 125.) Das allgemeine Totemtabu, welches z. B. verbietet, im Schatten des Totembaumes zu sitzen, würde hiefür hingereicht haben. A. Lang verficht übrigens auch eine andere Ableitung der Exogamie (s. unten) und läßt es zweifelhaft, wie sich diese beiden Erklärungen zueinander verhalten.
In betreff der zeitlichen Verhältnisse huldigt die Mehrzahl der Autoren der Ansicht, der Totemismus sei die ältere Institution, die Exogamie später hinzugekommen. [Fußnote]Zum Beispiel Frazer, l. c., IV, p. 75: » The totemic clan is a totally different social organism from the exogamous clan, and we have good grounds for thinking that it is far older.«.
Unter den Theorien, welche die Exogamie unabhängig vom Totemismus erklären wollen, seien nur einige hervorgehoben, welche die verschiedenen Einstellungen der Autoren zum Inzestproblem erläutern. McLennan (1865) hatte die Exogamie in geistreicher Weise aus den Überresten von Sitten erraten, welche auf den ehemaligen Frauenraub hindeuteten. Er nahm nun an, daß es in Urzeiten allgemein gebräuchlich gewesen sei, sich das Weib aus einem fremden Stamm zu holen, und die Heirat mit einem Weib aus dem eigenen Stamm sei allmählich unerlaubt geworden, weil sie ungewöhnlich war [Fußnote]» Improper because it was unusual.«. Das Motiv für diese Gewohnheit der Exogamie suchte er in einem Frauenmangel jener primitiven Stämme, der sich aus dem Gebrauch, die meisten weiblichen Kinder bei der Geburt zu töten, ergeben hatte. Wir haben es hier nicht mit der Nachprüfung zu tun, ob die tatsächlichen Verhältnisse die Annahmen McLennans bestätigen. Weit mehr interessiert uns das Argument, daß es unter den Voraussetzungen des Autors doch unerklärlich bliebe, warum sich die männlichen Mitglieder des Stammes auch die wenigen Frauen aus ihrem Blut unzugänglich machen sollten, und die Art, wie hier das Inzestproblem gänzlich beiseite gelassen wird. [Fußnote]Frazer, l. c., IV, p. 71–92.
Im Gegensatz hiezu und offenbar mit mehr Recht haben andere Forscher die Exogamie als eine Institution zur Verhütung des Inzests erfaßt [Fußnote]Vgl. die erste Abhandlung..
Überblickt man die allmählich wachsende Komplikation der australischen Heiratsbeschränkungen, so kann man nicht anders als der Ansicht von Morgan, Frazer, Howitt, Baldwin Spencer [Fußnote]Morgan, 1877. – Frazer, T. and Ex. IV, p 105 ff.). beistimmen, daß diese Einrichtungen das Gepräge zielbewußter Absicht (» deliberate design« nach Frazer) an sich tragen und daß sie das erreichen sollten, was sie tatsächlich geleistet haben. » In no other way does it seem possible to explain in all its details a system at once so complex and so regular.« (Frazer, ibid., p. 106.)
Es ist interessant hervorzuheben, daß die ersten der durch die Einführung von Heiratsklassen erzeugten Beschränkungen die Sexualfreiheit der jüngeren Generation, also den Inzest von Geschwistern und von Söhnen mit ihrer Mutter trafen, während der Inzest zwischen Vater und Tochter erst durch weitergehende Maßregeln aufgehoben wurde. Die Zurückführung der exogamischen Sexualbeschränkungen auf gesetzgeberische Absicht leistet aber nichts für das Verständnis des Motivs, welches diese Institutionen geschaffen hat. Woher stammt in letzter Auflösung die Inzestscheu, welche als die Wurzel der Exogamie erkannt werden muß? Es ist offenbar nicht genügend, sich zur Erklärung der Inzestscheu auf eine instinktive Abneigung gegen sexuellen Verkehr unter Blutsverwandten, d. h. also auf die Tatsache der Inzestscheu zu berufen, wenn die soziale Erfahrung nachweist, daß der Inzest diesem Instinkt zum Trotz kein seltenes Vorkommnis selbst in unserer heutigen Gesellschaft ist, und wenn die historische Erfahrung Fälle kennen lehrt, in denen die inzestuöse Ehe bevorzugten Personen zur Vorschrift gemacht wurde.
Westermarck [Fußnote]Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe, II. Die Ehe. 1909. Dort auch die Verteidigung des Autors gegen ihm bekannt gewordene Einwendungen. machte zur Erklärung der Inzestscheu geltend, »daß zwischen Personen, die von Kindheit an beisammen leben, eine angeborene Abneigung gegen den Geschlechtsverkehr herrscht und daß dieses Gefühl, da diese Personen in der Regel blutsverwandt sind, in Sitte und Gesetz einen natürlichen Ausdruck findet durch den Abscheu vor dem Geschlechtsumgang unter nahen Verwandten«. Havelock Ellis bestritt zwar den triebhaften Charakter dieser Abneigung in seinen Studies in the Psychology of Sex, trat aber sonst im wesentlichen derselben Erklärung bei, indem er äußerte: »Das normale Unterbleiben des Zutagetretens des Paarungstriebes dort, wo es sich um Brüder und Schwestern oder um von Kindheit auf beisammenlebende Mädchen und Knaben handelt, ist eine rein negative Erscheinung, welche daher kommt, daß unter jenen Umständen die den Paarungstrieb erweckenden Vorbedingungen durchaus fehlen müssen ... Zwischen Personen, die von Kindheit zusammen aufgewachsen sind, hat die Gewöhnung alle sinnlichen Reize des Sehens, des Hörens und der Berührung abgestumpft, in die Bahn einer ruhigen Zuneigung gelenkt und ihrer Macht beraubt, die zur Erzeugung geschlechtlicher Tumeszenz erforderliche nötige erethistische Erregung hervorzurufen.«
Es erscheint mir sehr merkwürdig, daß Westermarck diese angeborene Abneigung gegen den Geschlechtsverkehr mit Personen, mit denen man die Kindheit geteilt hat, gleichzeitig als psychische Repräsentanz der biologischen Tatsache ansieht, daß Inzucht eine Schädigung der Gattung bedeutet. Ein derartiger biologischer Instinkt würde in seiner psychologischen Äußerung so weit irregehen, daß er anstatt der für die Fortpflanzung schädlichen Blutsverwandten die in dieser Hinsicht ganz harmlosen Haus- und Herdgenossen träfe. Ich kann es mir aber auch nicht versagen, die ganz ausgezeichnete Kritik mitzuteilen, welche Frazer der Behauptung von Westermarck entgegenstellt. Frazer findet es unbegreiflich, daß das sexuelle Empfinden sich heute so gar nicht gegen den Verkehr mit Herdgenossen sträubt, während die Inzestscheu, die nur ein Abkömmling von diesem Sträuben sein soll, gegenwärtig so übermächtig angewachsen ist. Tiefer dringen aber andere Bemerkungen Frazers, die ich unverkürzt hieher setze, weil sie im Wesen mit den in meinem Aufsatz über das Tabu entwickelten Argumenten zusammentreffen.
»Es ist nicht leicht einzusehen, warum ein tief wurzelnder menschlicher Instinkt die Verstärkung durch ein Gesetz benötigen sollte. Es gibt kein Gesetz, welches den Menschen befiehlt zu essen und zu trinken, oder ihnen verbietet, ihre Hände ins Feuer zu stecken. Die Menschen essen und trinken und halten ihre Hände vom Feuer weg, instinktgemäß, aus Angst vor natürlichen und nicht vor gesetzlichen Strafen, die sie sich durch Beleidigung dieser Triebe zuziehen würden. Das Gesetz verbietet den Menschen nur, was sie unter dem Drängen ihrer Triebe ausführen könnten. Was die Natur selbst verbietet und bestraft, das braucht nicht erst das Gesetz zu verbieten und zu strafen. Wir dürfen daher auch ruhig annehmen, daß Verbrechen, die durch ein Gesetz verboten werden, Verbrechen sind, die viele Menschen aus natürlichen Neigungen gern begehen würden. Wenn es keine solche Neigung gäbe, kämen keine solche Verbrechen vor, und wenn solche Verbrechen nicht begangen würden, wozu brauchte man sie zu verbieten? Anstatt also aus dem gesetzlichen Verbot des Inzests zu schließen, daß eine natürliche Abneigung gegen den Inzest besteht, sollten wir eher den Schluß ziehen, daß ein natürlicher Instinkt zum Inzest treibt und daß, wenn das Gesetz diesen Trieb wie andere natürliche Triebe unterdrückt, dies seinen Grund in der Einsicht zivilisierter Menschen hat, daß die Befriedigung dieser natürlichen Triebe der Gesellschaft Schaden bringt.« [Fußnote]l. c., p. 97
Ich kann dieser kostbaren Argumentation Frazers noch hinzufügen, daß die Erfahrungen der Psychoanalyse die Annahme einer angeborenen Abneigung gegen den Inzestverkehr vollends unmöglich machen. Sie haben im Gegenteile gelehrt, daß die ersten sexuellen Regungen des jugendlichen Menschen regelmäßig inzestuöser Natur sind und daß solche verdrängte Regungen als Triebkräfte der späteren Neurosen eine kaum zu überschätzende Rolle spielen.
Die Auffassung der Inzestscheu als eines angeborenen Instinkts muß also fallengelassen werden. Nicht besser steht es um eine andere Ableitung des Inzestverbots, welche sich zahlreicher Anhänger erfreut, um die Annahme, daß die primitiven Völker frühzeitig bemerkt haben, mit welchen Gefahren die Inzucht ihr Geschlecht bedrohe, und daß sie darum in bewußter Absicht das Inzestverbot erlassen hätten. Die Einwendungen gegen diesen Erklärungsversuch drängen einander [Fußnote]Vgl. Durkheim (1896/97).. Nicht nur, daß das Inzestverbot älter sein muß als alle Haustierwirtschaft, an welcher der Mensch Erfahrungen über die Wirkung der Inzucht auf die Eigenschaften der Rasse machen konnte, sondern die schädlichen Folgen der Inzucht sind auch heute noch nicht über jeden Zweifel sichergestellt und beim Menschen nur schwer nachweisbar. Ferner macht alles, was wir über die heutigen Wilden wissen, es sehr unwahrscheinlich, daß die Gedanken ihrer entferntesten Ahnen bereits mit der Verhütung von Schäden für ihre spätere Nachkommenschaft beschäftigt waren. Es klingt fast lächerlich, wenn man diesen ohne jeden Vorbedacht lebenden Menschenkindern hygienische und eugenische Motive zumuten will, wie sie noch kaum in unserer heutigen Kultur Berücksichtigung gefunden haben [Fußnote]Ch. Darwin meint von den Wilden: » they are not likely to reflect on distant evils to their progeny.«.
Endlich wird man auch geltend machen müssen, daß das aus praktisch hygienischen Motiven gegebene Verbot der Inzucht als eines die Rasse schwächenden Moments ganz unangemessen erscheint, um den tiefen Abscheu zu erklären, welcher sich in unserer Gesellschaft gegen den Inzest erhebt. Wie ich an anderer Stelle dargetan habe [Fußnote]Vgl. die erste Abhandlung., erscheint diese Inzestscheu bei den heute lebenden primitiven Völkern eher noch reger und stärker als bei den zivilisierten.
Während man erwarten konnte, auch für die Ableitung der Inzestscheu die Wahl zu haben zwischen soziologischen, biologischen und psychologischen Erklärungsmöglichkeiten, wobei noch die psychologischen Motive vielleicht als Repräsentanz von biologischen Mächten zu würdigen wären, sieht man sich am Ende der Untersuchung genötigt, dem resignierten Ausspruch Frazers beizutreten: Wir kennen die Herkunft der Inzestscheu nicht und wissen selbst nicht, worauf wir raten sollen. Keine der bisher vorgebrachten Lösungen des Rätsels erscheint uns befriedigend [Fußnote]» Thus the ultimate origin of exogamy and with it the law of incest – since exogamy was devised to prevent incest – remains a problem nearly as dark as ever.« T. and Ex. I, p. 165.).
Ich muß noch eines Versuches erwähnen, die Entstehung der Inzestscheu zu erklären, welcher von ganz anderer Art ist als die bisher betrachteten. Man könnte ihn als eine historische Ableitung bezeichnen. Dieser Versuch knüpft an eine Hypothese von Ch. Darwin über den sozialen Urzustand des Menschen an. Darwin schloß aus den Lebensgewohnheiten der höheren Affen, daß auch der Mensch ursprünglich in kleineren Horden gelebt habe, innerhalb welcher die Eifersucht des ältesten und stärksten Männchens die sexuelle Promiskuität verhinderte. »Wir können in der Tat, nach dem, was wir von der Eifersucht aller Säugetiere wissen, von denen viele mit speziellen Waffen zum Kämpfen mit ihren Nebenbuhlern bewaffnet sind, schließen, daß allgemeine Vermischung der Geschlechter im Naturzustand äußerst unwahrscheinlich ist ... Wenn wir daher im Strome der Zeit weit genug zurückblicken ... und nach den sozialen Gewohnheiten des Menschen, wie er jetzt existiert, schließen, ... ist die wahrscheinlichste Ansicht die, daß der Mensch ursprünglich in kleinen Gesellschaften lebte, jeder Mann mit einer Frau oder, hatte er die Macht, mit mehreren, welche er eifersüchtig gegen alle anderen Männer verteidigte. Oder er mag kein soziales Tier gewesen sein und doch mit mehreren Frauen für sich allein gelebt haben wie der Gorilla; denn alle Eingeborenen ›stimmen darin überein, daß nur ein erwachsenes Männchen in einer Gruppe zu sehen ist. Wächst das junge Männchen heran, so findet ein Kampf um die Herrschaft statt, und der Stärkste setzt sich dann, indem er die anderen getötet oder vertrieben hat, als Oberhaupt der Gesellschaft fest‹ (Dr. Savage in Boston Journal of Nat. Hist. Bd. 5, 1845 bis 1847). Die jüngeren Männchen, welche hiedurch ausgestoßen sind und nun herumwandern, werden auch, wenn sie zuletzt beim Finden einer Gattin erfolgreich sind, die zu enge Inzucht innerhalb der Glieder einer und derselben Familie verhüten.« [Fußnote]Abstammung des Menschen, übersetzt von V. Carus, II. Bd., Kapitel 20, p. 341.
Atkinson [Fußnote]Primal Law (1903) (mit A. Lang, 1903). scheint zuerst erkannt zu haben, daß diese Verhältnisse der Darwinschen Urhorde die Exogamie der jungen Männer praktisch durchsetzen mußten. Jeder dieser Vertriebenen konnte eine ähnliche Horde gründen, in welcher dasselbe Verbot des Geschlechtsverkehrs dank der Eifersucht des Oberhauptes galt, und im Laufe der Zeit würde sich aus diesen Zuständen die jetzt als Gesetz bewußte Regel ergeben haben: Kein Sexualverkehr mit den Herdgenossen. Nach Einsetzung des Totemismus hätte sich die Regel in die andere Form gewandelt: Kein Sexualverkehr innerhalb des Totem.
A. Lang (1905, p. 114 und p. 143) hat sich dieser Erklärung der Exogamie angeschlossen. Er vertritt aber in demselben Buche die andere (Durkheimsche) Theorie, welche die Exogamie als Konsequenz aus den Totemgesetzen hervorgehen läßt. Es ist nicht ganz einfach, die beiden Auffassungen miteinander zu vereinigen; im ersten Falle hätte die Exogamie vor dem Totemismus bestanden, im zweiten wäre sie eine Folge desselben [Fußnote]» If it be granted that exogamy existed in practice, on the lines of Mr. Darwin's theory, before the totem beliefs lent to the practice a sacred sanction, our task is relatively easy. The first practical rule would be that of the jealous Sire, ›No males to touch the females in my camp‹, with expulsion of adolescent sons. In efflux of time that rule, become habitual, would be, ›No marriage within the local group‹. Next let the local groups receive names, such as Emus, Crows, Opossums, Snipes, and the rule becomes, ›No marriage within the local group of animal name; no Snipe to marry a Snipe‹. But, if the primal groups were not exogamous, they would become so, as soon as totemic myths and tabus were developed out of the animal, vegetable, and other names of small local groups.« (1905, p. 143.) (Die Hervorhebung in der Mitte dieser Stelle ist mein Werk.) – In seiner letzten Äußerung über den Gegenstand (1911) teilt A. Lang übrigens mit, daß er die Ableitung der Exogamie aus dem » general totemic« Tabu aufgegeben habe..
3
Einen einzigen Lichtstrahl wirft die psychoanalytische Erfahrung in dieses Dunkel.
Das Verhältnis des Kindes zum Tiere hat viel Ähnlichkeit mit dem des Primitiven zum Tiere. Das Kind zeigt noch keine Spur von jenem Hochmut, welcher dann den erwachsenen Kulturmenschen bewegt, seine eigene Natur durch eine scharfe Grenzlinie von allem anderen Animalischen abzusetzen. Es gesteht dem Tiere ohne Bedenken die volle Ebenbürtigkeit zu; im ungehemmten Bekennen zu seinen Bedürfnissen fühlt es sich wohl dem Tiere verwandter als dem ihm wahrscheinlich rätselhaften Erwachsenen.
In diesem ausgezeichneten Einverständnis zwischen Kind und Tier tritt nicht selten eine merkwürdige Störung auf. Das Kind beginnt plötzlich eine bestimmte Tierart zu fürchten und sich vor der Berührung oder dem Anblick aller einzelnen dieser Art zu schützen. Es stellt sich das klinische Bild einer Tierphobie her, eine der häufigsten unter den psychoneurotischen Erkrankungen dieses Alters und vielleicht die früheste Form solcher Erkrankung. Die Phobie betrifft in der Regel Tiere, für welche das Kind bis dahin ein besonders lebhaftes Interesse gezeigt hatte, sie hat mit dem Einzeltier nichts zu tun. Die Auswahl unter den Tieren, welche Objekte der Phobie werden können, ist unter städtischen Bedingungen nicht groß. Es sind Pferde, Hunde, Katzen, seltener Vögel, auffällig häufig kleinste Tiere wie Käfer und Schmetterlinge. Manchmal werden Tiere, die dem Kind nur aus Bilderbuch und Märchenerzählung bekannt worden sind, Objekte der unsinnigen und unmäßigen Angst, welche sich bei diesen Phobien zeigt; selten gelingt es einmal, die Wege zu erfahren, auf denen sich eine ungewöhnliche Wahl des Angsttieres vollzogen hat. So verdanke ich K. Abraham die Mitteilung eines Falles, in welchem ein Kind seine Angst vor Wespen selbst durch die Angabe aufklärte, die Farbe und Streifung des Wespenleibes hätte es an den Tiger denken lassen, vor dem es sich nach allem Gehörten fürchten durfte.
Die Tierphobien der Kinder sind noch nicht Gegenstand aufmerksamer analytischer Untersuchung geworden, obwohl sie es im hohen Grade verdienen. Die Schwierigkeiten der Analyse mit Kindern in so zartem Alter sind wohl das Motiv der Unterlassung gewesen. Man kann daher nicht behaupten, daß man den allgemeinen Sinn dieser Erkrankungen kennt, und ich meine selbst, daß er sich nicht als einheitlich herausstellen dürfte. Aber einige Fälle von solchen auf größere Tiere gerichteten Phobien haben sich der Analyse zugänglich erwiesen und so dem Untersucher ihr Geheimnis verraten. Es war in jedem Falle das nämliche: die Angst galt im Grunde dem Vater, wenn die untersuchten Kinder Knaben waren, und war nur auf das Tier verschoben worden.
Jeder in der Psychoanalyse Erfahrene hat gewiß solche Fälle gesehen und von ihnen den nämlichen Eindruck empfangen. Doch kann ich mich nur auf wenige ausführliche Publikationen darüber berufen. Es ist dies ein Zufall der Literatur, aus welchem nicht geschlossen werden sollte, daß wir unsere Behauptung überhaupt nur auf vereinzelte Beobachtungen stützen können. Ich erwähne z. B. einen Autor, welcher sich verständnisvoll mit den Neurosen des Kindesalters beschäftigt hat, M. Wulff (Odessa). Er erzählt im Zusammenhange der Krankengeschichte eines neunjährigen Knaben, daß dieser mit vier Jahren an einer Hundephobie gelitten hat. »Als er auf der Straße einen Hund vorbeilaufen sah, weinte er und schrie: ›Lieber Hund, fasse mich nicht, ich will artig sein.‹ Unter ›artig sein‹ meinte er: ›nicht mehr Geige spielen‹ (onanieren).« (Wulff, 1912, p. 15.)
Derselbe Autor resümiert später: »Seine Hundephobie ist eigentlich die auf die Hunde verschobene Angst vor dem Vater, denn seine sonderbare Äußerung: ›Hund, ich will artig sein‹ – d. h. nicht masturbieren – bezieht sich doch eigentlich auf den Vater, der die Masturbation verboten hat.« In einer Anmerkung setzt er dann hinzu, was sich eben so völlig mit meiner Erfahrung deckt und gleichzeitig die Reichlichkeit solcher Erfahrungen bezeugt: »Solche Phobien (Pferdephobien, Hundephobien, Katzen, Hühner und andere Haustiere) sind, glaube ich, im Kindesalter mindestens ebenso verbreitet wie der pavor nocturnus und lassen sich in der Analyse fast immer als eine Verschiebung der Angst von einem der Eltern auf die Tiere entpuppen. Ob die so verbreitete Mäuse- und Rattenphobie denselben Mechanismus hat, möchte ich nicht behaupten.«
Im ersten Band des Jahrbuches für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen teilte ich die ›Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben‹ mit, welche mir der Vater des kleinen Patienten zur Verfügung gestellt hatte. Es war eine Angst vor Pferden, in deren Konsequenz der Knabe sich weigerte, auf die Straße zu gehen. Er äußerte die Befürchtung, das Pferd werde ins Zimmer kommen, werde ihn beißen. Es erwies sich, daß dies die Strafe für seinen Wunsch sein sollte, daß das Pferd umfallen (sterben) möge. Nachdem man dem Knaben durch Zusicherungen die Angst vor dem Vater benommen hatte, ergab es sich, daß er gegen Wünsche ankämpfte, die das Wegsein (Abreisen, Sterben) des Vaters zum Inhalt hatten. Er empfand den Vater, wie er überdeutlich zu erkennen gab, als Konkurrenten in der Gunst der Mutter, auf welche seine keimenden Sexualwünsche in dunkeln Ahnungen gerichtet waren. Er befand sich also in jener typischen Einstellung des männlichen Kindes zu den Eltern, welche wir als den »Ödipuskomplex« bezeichnen und in der wir den Kernkomplex der Neurosen überhaupt erkennen. Was wir neu aus der Analyse des »kleinen Hans« erfahren, ist die für den Totemismus wertvolle Tatsache, daß das Kind unter solchen Bedingungen einen Anteil seiner Gefühle von dem Vater weg auf ein Tier verschiebt.
Die Analyse weist die inhaltlich bedeutsamen wie die zufälligen Assoziationswege nach, auf welchen eine solche Verschiebung vor sich geht. Sie läßt auch die Motive derselben erraten. Der aus der Nebenbuhlerschaft bei der Mutter hervorgehende Haß kann sich im Seelenleben des Knaben nicht ungehemmt ausbreiten, er hat mit der seit jeher bestehenden Zärtlichkeit und Bewunderung für dieselbe Person zu kämpfen, das Kind befindet sich in doppelsinniger – ambivalenter – Gefühlseinstellung gegen den Vater und schafft sich Erleichterung in diesem Ambivalenzkonflikt, wenn es seine feindseligen und ängstlichen Gefühle auf ein Vatersurrogat verschiebt. Die Verschiebung kann den Konflikt allerdings nicht in der Weise erledigen, daß sie eine glatte Scheidung der zärtlichen von den feindseligen Gefühlen herstellt. Der Konflikt setzt sich vielmehr auf das Verschiebungsobjekt fort, die Ambivalenz greift auf dieses letztere über. Es ist unverkennbar, daß der kleine Hans den Pferden nicht nur Angst, sondern auch Respekt und Interesse entgegenbringt. Sowie sich seine Angst ermäßigt hat, identifiziert er sich selbst mit dem gefürchteten Tier, springt als Pferd herum und beißt nun seinerseits den Vater [Fußnote](1909, s. 169).. In einem anderen Auflösungsstadium der Phobie macht es ihm nichts, die Eltern mit anderen großen Tieren zu identifizieren [Fußnote]Die Giraffenphantasie..
Man darf den Eindruck aussprechen, daß in diesen Tierphobien der Kinder gewisse Züge des Totemismus in negativer Ausprägung wiederkehren. Wir verdanken aber S. Ferenczi die vereinzelt schöne Beobachtung eines Falles, den man nur als positiven Totemismus bei einem Kinde bezeichnen kann (1913). Bei dem kleinen Árpád, von dem Ferenczi berichtet, erwachen die totemistischen Interessen allerdings nicht direkt im Zusammenhang des Ödipuskomplexes, sondern auf Grund der narzißtischen Voraussetzung desselben, der Kastrationsangst. Wer aber die Geschichte des kleinen Hans aufmerksam durchsieht, wird auch in dieser die reichlichsten Zeugnisse dafür finden, daß der Vater als der Besitzer des großen Genitales bewundert und als der Bedroher des eigenen Genitales gefürchtet wird. Im Ödipus- wie im Kastrationskomplex spielt der Vater die nämliche Rolle, die des gefürchteten Gegners der infantilen Sexualinteressen. Die Kastration und ihr Ersatz durch die Blendung ist die von ihm drohende Strafe [Fußnote]Über den Ersatz der Kastration durch die auch im Ödipus-Mythus enthaltene Blendung vgl. die Mitteilungen von Reitler (1913), Ferenczi (1913), Rank (1913) und Eder (1913)..
Als der kleine Árpád zweieinhalb Jahre alt war, versuchte er einmal in einem Sommeraufenthalte ins Geflügelhaus zu urinieren, wobei ihn ein Huhn ins Glied biß oder nach seinem Glied schnappte. Als er ein Jahr später an denselben Ort zurückkehrte, wurde er selbst zum Huhn, er interessierte sich nur mehr für das Geflügelhaus und alles, was darin vorging, und gab seine menschliche Sprache gegen Gackern und Krähen auf. Zur Zeit der Beobachtung (fünf Jahre) sprach er wieder, aber beschäftigte sich auch in der Rede ausschließlich nur mit Hühnern und anderem Geflügel. Er spielte mit keinem anderen Spielzeug, sang nur Lieder, in denen etwas vom Federvieh vorkam. Sein Benehmen gegen sein Totemtier war exquisit ambivalent, übermäßiges Hassen und Lieben. Am liebsten spielte er Hühnerschlachten. »Das Schlachten des Federviehs ist ihm überhaupt ein Fest. Er ist imstande, stundenlang um die Tierleichen erregt herumzutanzen.« Aber dann küßte und streichelte er das geschlachtete Tier, reinigte und liebkoste die von ihm selbst mißhandelten Ebenbilder von Hühnern.
Der kleine Árpád sorgte selbst dafür, daß der Sinn seines sonderbaren Treibens nicht verborgen bleiben konnte. Er übersetzte gelegentlich seine Wünsche aus der totemistischen Ausdrucksweise zurück in die des Alltagslebens. »Mein Vater ist der Hahn«, sagte er einmal. »Jetzt bin ich klein, jetzt bin ich ein Küchlein. Wenn ich größer werde, bin ich ein Huhn. Wenn ich noch größer werde, bin ich ein Hahn.« Ein andermal wünscht er sich plötzlich eine »eingemachte Mutter« zu essen (nach der Analogie des eingemachten Huhns). Er war sehr freigebig mit deutlichen Kastrationsandrohungen gegen andere, wie er sie wegen onanistischer Beschäftigung mit seinem Gliede selbst erfahren hatte.
Über die Quelle seines Interesses für das Treiben im Hühnerhof blieb nach Ferenczi kein Zweifel: »Der rege Sexualverkehr zwischen Hahn und Henne, das Eierlegen und das Herauskriechen der jungen Brut« befriedigten seine sexuelle Wißbegierde, die eigentlich dem menschlichen Familienleben galt. Nach dem Vorbild des Hühnerlebens hatte er seine Objektwünsche geformt, wenn er einmal der Nachbarin sagte: »Ich werde Sie heiraten und Ihre Schwester und meine drei Cousinen und die Köchin, nein, statt der Köchin lieber die Mutter.«
Wir werden an späterer Stelle die Würdigung dieser Beobachtung vervollständigen können; heben wir jetzt nur als wertvolle Übereinstimmungen mit dem Totemismus zwei Züge hervor: die volle Identifizierung mit dem Totemtier [Fußnote]In welcher nach Frazer (1910, IV, p. 5) das Wesentliche des Totemismus gegeben ist: » Totemism is an Identification of a man with his totem.« und die ambivalente Gefühlseinstellung gegen dasselbe. Wir halten uns nach diesen Beobachtungen für berechtigt, in die Formel des Totemismus – für den Mann – den Vater an Stelle des Totemtieres einzusetzen. Wir merken dann, daß wir damit keinen neuen oder besonders kühnen Schritt getan haben. Die Primitiven sagen es ja selbst und bezeichnen, soweit noch heute das totemistische System in Kraft besteht, den Totem als ihren Ahnherrn und Urvater. Wir haben nur eine Aussage dieser Völker wörtlich genommen, mit welcher die Ethnologen wenig anzufangen wußten und die sie darum gern in den Hintergrund gerückt haben. Die Psychoanalyse mahnt uns, im Gegenteile gerade diesen Punkt hervorzusuchen und an ihn den Erklärungsversuch des Totemismus zu knüpfen [Fußnote]O. Rank verdanke ich die Mitteilung eines Falles von Hundephobie bei einem intelligenten jungen Manne, dessen Erklärung, wie er zu seinem Leiden gekommen sei, merklich an die oben (S. 138) erwähnte Totemtheorie der Arunta anklingt. Er meinte, von seinem Vater erfahren zu haben, daß seine Mutter während der Schwangerschaft mit ihm einmal vor einem Hunde erschrocken sei..
Das erste Ergebnis unserer Ersetzung ist sehr merkwürdig. Wenn das Totemtier der Vater ist, dann fallen die beiden Hauptgebote des Totemismus, die beiden Tabuvorschriften, die seinen Kern ausmachen, den Totem nicht zu töten und kein Weib, das dem Totem angehört, sexuell zu gebrauchen, inhaltlich zusammen mit den beiden Verbrechen des Ödipus, der seinen Vater tötete und seine Mutter zum Weibe nahm, und mit den beiden Urwünschen des Kindes, deren ungenügende Verdrängung oder deren Wiedererweckung den Kern vielleicht aller Psychoneurosen bildet. Sollte diese Gleichung mehr als ein irreleitendes Spiel des Zufalls sein, so müßte sie uns gestatten, ein Licht auf die Entstehung des Totemismus in unvordenklichen Zeiten zu werfen. Mit anderen Worten, es müßte uns gelingen, wahrscheinlich zu machen, daß das totemistische System sich aus den Bedingungen des Ödipuskomplexes ergeben hat wie die Tierphobie des »kleinen Hans« und die Geflügelperversion des »kleinen Árpád«. Um dieser Möglichkeit nachzugehen, werden wir im folgenden eine Eigentümlichkeit des totemistischen Systems oder, wie wir sagen können, der Totemreligion studieren, welche bisher kaum Erwähnung finden konnte.
4
Der im Jahre 1894 verstorbene W. Robertson Smith, Physiker, Philologe, Bibelkritiker und Altertumsforscher, ein ebenso vielseitiger wie scharfsichtiger und freidenkender Mann, sprach in seinem 1889 veröffentlichten Werke über die Religion der Semiten [Fußnote]W. Robertson Smith, The Religion of the Semites. 1907. die Annahme aus, daß eine eigentümliche Zeremonie, die sogenannte Totemmahlzeit, von allem Anfang an einen integrierenden Bestandteil des totemistischen Systems gebildet habe. Zur Stütze dieser Vermutung stand ihm damals nur eine einzige, aus dem 5. Jahrhundert n. Chr. überlieferte Beschreibung eines solchen Aktes zu Gebote, aber er verstand es, die Annahme durch die Analyse des Opferwesens bei den alten Semiten zu einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu erheben. Da das Opfer eine göttliche Person voraussetzt, handelt es sich dabei um den Rückschluß von einer höheren Phase des religiösen Ritus auf die niedrigste des Totemismus.
Ich will nun versuchen, aus dem ausgezeichneten Buch von Robertson Smith die für unser Interesse entscheidenden Sätze über Ursprung und Bedeutung des Opferritus herauszuheben unter Weglassung aller oft so reizvollen Details und mit konsequenter Hintansetzung aller späteren Entwicklungen. Es ist ganz ausgeschlossen, in einem solchen Auszug dem Leser etwas von der Luzidität oder von der Beweiskraft der Darstellung im Original zu übermitteln.
Robertson Smith führt aus, daß das Opfer am Altar das wesentliche Stück im Ritus der alten Religion gewesen ist. Es spielt in allen Religionen die nämliche Rolle, so daß man seine Entstehung auf sehr allgemeine und überall gleichartig wirkende Ursachen zurückführen muß.
Das Opfer – die heilige Handlung κατ' εξοχήν ( sacrificium, ιερουργία) – bedeutete aber ursprünglich etwas anderes, als was spätere Zeiten darunter verstanden: die Darbringung an die Gottheit, um sie zu versöhnen oder sich geneigt zu machen. (Von dem Nebensinn der Selbstentäußerung ging dann die profane Verwendung des Wortes aus.) Das Opfer war nachweisbar zuerst nichts anderes als » an act of social fellowship between the deity and his worshippers«, ein Akt der Geselligkeit, eine Kommunion der Gläubigen mit ihrem Gotte.
Als Opfer wurden dargebracht eßbare und trinkbare Dinge; dasselbe, wovon der Mensch sich nährte, Fleisch, Zerealien, Früchte, Wein und Öl, das opferte er auch seinem Gotte. Nur in bezug auf das Opferfleisch bestanden Einschränkungen und Abweichungen. Von den Tieropfern speist der Gott gemeinsam mit seinen Anbetern, die vegetabilischen Opfer sind ihm allein überlassen. Es ist kein Zweifel, daß die Tieropfer die älteren sind und einmal die einzigen waren. Die vegetabilischen Opfer sind aus der Darbringung der Erstlinge aller Früchte hervorgegangen und entsprechen einem Tribut an den Herrn des Bodens und des Landes. Das Tieropfer ist aber älter als der Ackerbau.
Es ist aus sprachlichen Überresten gewiß, daß der dem Gott bestimmte Anteil des Opfers zuerst als seine wirkliche Nahrung angesehen wurde. Mit der fortschreitenden Dematerialisierung des göttlichen Wesens wurde diese Vorstellung anstößig; man wich ihr aus, indem man allein den flüssigen Anteil der Mahlzeit der Gottheit zuwies. Später gestattete der Gebrauch des Feuers, welcher das Opferfleisch auf dem Altar in Rauch aufgehen ließ, eine Zurichtung der menschlichen Nahrungsmittel, durch welche sie dem göttlichen Wesen angemessener wurden. Die Substanz des Trinkopfers war ursprünglich das Blut der Opfertiere; Wein wurde später der Ersatz des Blutes. Der Wein galt den Alten als das »Blut der Rebe«, wie ihn unsere Dichter jetzt noch heißen.
Die älteste Form des Opfers, älter als der Gebrauch des Feuers und die Kenntnis des Ackerbaues, war also das Tieropfer, dessen Fleisch und Blut der Gott und seine Anbeter gemeinsam genossen. Es war wesentlich, daß jeder der Teilnehmer seinen Anteil an der Mahlzeit erhalte.
Ein solches Opfer war eine öffentliche Zeremonie, das Fest eines ganzen Clan. Die Religion war überhaupt eine allgemeine Angelegenheit, die religiöse Pflicht ein Stück der sozialen Verpflichtung. Opfer und Festlichkeit fallen bei allen Völkern zusammen, jedes Opfer bringt ein Fest mit sich, und kein Fest kann ohne Opfer gefeiert werden. Das Opferfest war eine Gelegenheit der freudigen Erhebung über die eigenen Interessen, der Betonung der Zusammengehörigkeit untereinander und mit der Gottheit.
Die ethische Macht der öffentlichen Opfermahlzeit ruhte auf uralten Vorstellungen über die Bedeutung des gemeinsamen Essens und Trinkens. Mit einem anderen zu essen und zu trinken war gleichzeitig ein Symbol und eine Bekräftigung von sozialer Gemeinschaft und von Übernahme gegenseitiger Verpflichtungen; die Opfermahlzeit brachte zum direkten Ausdruck, daß der Gott und seine Anbeter Commensalen sind, aber damit waren alle ihre anderen Beziehungen gegeben. Gebräuche, die noch heute unter den Arabern der Wüste in Kraft sind, beweisen, daß das Bindende an der gemeinsamen Mahlzeit nicht ein religiöses Moment ist, sondern der Akt des Essens selbst. Wer den kleinsten Bissen mit einem solchen Beduinen geteilt oder einen Schluck von seiner Milch getrunken hat, der braucht ihn nicht mehr als Feind zu fürchten, sondern darf seines Schutzes und seiner Hilfe sicher sein. Allerdings nicht für ewige Zeiten; strenggenommen nur für so lange, als der gemeinsam genossene Stoff der Annahme nach in seinem Körper verbleibt. So realistisch wird das Band der Vereinigung aufgefaßt; es bedarf der Wiederholung, um es zu verstärken und dauerhaft zu machen.
Warum wird aber dem gemeinsamen Essen und Trinken diese bindende Kraft zugeschrieben? In den primitivsten Gesellschaften gibt es nur ein Band, welches unbedingt und ausnahmslos einigt, das der Stammesgemeinschaft ( kinship). Die Mitglieder dieser Gemeinschaft treten solidarisch füreinander ein, ein Kin ist eine Gruppe von Personen, deren Leben solcherart zu einer physischen Einheit verbunden sind, daß man sie wie Stücke eines gemeinsamen Lebens betrachten kann. Es heißt dann beim Mord eines Einzelnen aus dem Kin nicht: das Blut dieses oder jenes ist vergossen worden, sondern unser Blut ist vergossen worden. Die hebräische Phrase, mit welcher die Stammesverwandtschaft anerkannt wird, lautet: Du bist mein Bein und mein Fleisch. Kinship bedeutet also einen Anteil haben an einer gemeinsamen Substanz. Es ist dann natürlich, daß sie nicht nur auf die Tatsache gegründet wird, daß man ein Teil von der Substanz seiner Mutter ist, von der man geboren und mit deren Milch man genährt wurde, sondern daß auch die Nahrung, die man späterhin genießt und durch die man seinen Körper erneuert, Kinship erwerben und bestärken kann. Teilte man die Mahlzeit mit seinem Gotte, so drückte es die Überzeugung aus, daß man von einem Stoff mit ihm sei, und wen man als Fremden erkannte, mit dem teilte man keine Mahlzeit.
Die Opfermahlzeit war also ursprünglich ein Festmahl von Stammverwandten, dem Gesetze folgend, daß nur Stammverwandte miteinander essen. In unserer Gesellschaft einigt die Mahlzeit die Mitglieder der Familie, aber mit der Familie hat die Opfermahlzeit nichts zu tun. Kinship ist älter als Familienleben; die ältesten uns bekannten Familien umfassen regelmäßig Personen, die verschiedenen Verwandtschaftsverbänden angehören. Die Männer heiraten Frauen aus fremden Clans, die Kinder erben den Clan der Mutter; es besteht keine Stammesverwandtschaft zwischen dem Manne und den übrigen Familienmitgliedern. In einer solchen Familie gibt es keine gemeinsame Mahlzeit. Die Wilden essen noch heute abseits und allein, und die religiösen Speiseverbote des Totemismus machen ihnen oft die Eßgemeinschaft mit ihren Frauen und Kindern unmöglich.
Wenden wir uns nun zum Opfertier. Es gab, wie wir gehört, keine Stammeszusammenkunft ohne Tieropfer, aber – was nun bedeutsam ist – auch kein Schlachten eines Tieres außer für solche feierliche Gelegenheit. Man nährte sich ohne Bedenken von Früchten, Wild und von der Milch der Haustiere, aber religiöse Skrupel machten es dem Einzelnen unmöglich, ein Haustier für seinen eigenen Gebrauch zu töten. Es leidet nicht den leisesten Zweifel, sagt Robertson Smith, daß jedes Opfer ursprünglich Clanopfer war und daß das Töten eines Schlachtopfers ursprünglich zu jenen Handlungen gehörte, die dem Einzelnen verboten sind und nur dann gerechtfertigt werden, wenn der ganze Stamm die Verantwortlichkeit mit übernimmt. Es gibt bei den Primitiven nur eine Klasse von Handlungen, für welche diese Charakteristik zutrifft, nämlich Handlungen, welche an die Heiligkeit des dem Stamme gemeinsamen Blutes rühren. Ein Leben, welches kein Einzelner wegnehmen darf und das nur durch die Zustimmung, unter der Teilnahme aller Clangenossen geopfert werden kann, steht auf derselben Stufe wie das Leben der Stammesgenossen selbst. Die Regel, daß jeder Gast der Opfermahlzeit vom Fleisch des Opfertieres genießen müsse, hat denselben Sinn wie die Vorschrift, daß die Exekution an einem schuldigen Stammesgenossen von dem ganzen Stamm zu vollziehen sei. Mit anderen Worten: Das Opfertier wurde behandelt wie ein Stammverwandter, die opfernde Gemeinde, ihr Gott und das Opfertier waren eines Blutes, Mitglieder eines Clan.
Robertson Smith identifiziert auf Grund einer reichen Evidenz das Opfertier mit dem alten Totemtier. Es gab im späteren Altertum zwei Arten von Opfern, solche von Haustieren, die auch für gewöhnlich gegessen wurden, und ungewöhnliche Opfer von Tieren, die als unrein verboten waren. Die nähere Erforschung zeigt dann, daß diese unreinen Tiere heilige Tiere waren, daß sie den Göttern als Opfer dargebracht wurden, denen sie heilig waren, daß diese Tiere ursprünglich identisch waren mit den Göttern selbst und daß die Gläubigen in irgendeiner Weise beim Opfer ihre Blutsverwandtschaft mit dem Tiere und dem Gotte betonten. Für noch frühere Zeiten entfällt aber dieser Unterschied zwischen gewöhnlichen und »mystischen« Opfern. Alle Tiere sind ursprünglich heilig, ihr Fleisch ist verboten und darf nur bei feierlichen Gelegenheiten unter Teilnahme des ganzen Stammes genossen werden. Das Schlachten des Tieres kommt dem Vergießen von Stammesblut gleich und muß unter den nämlichen Vorsichten und Sicherungen gegen Vorwurf geschehen.
Die Zähmung von Haustieren und das Emporkommen der Viehzucht scheint überall dem reinen und strengen Totemismus der Urzeit ein Ende bereitet zu haben [Fußnote]» The inference is that the domestication to which totemism invariably leads (when there are any animals capable of domestication) is fatal to totemism.« (Jevons, 1902, p. 120.). Aber was in der nun »pastoralen« Religion den Haustieren an Heiligkeit verblieb, ist deutlich genug, um den ursprünglichen Totemcharakter derselben erkennen zu lassen. Noch in späten klassischen Zeiten schrieb der Ritus an verschiedenen Orten dem Opferer vor, nach vollzogenem Opfer die Flucht zu ergreifen, wie um sich einer Ahndung zu entziehen. In Griechenland muß die Idee, daß die Tötung eines Ochsen eigentlich ein Verbrechen sei, einst allgemein geherrscht haben. An dem athenischen Fest der Euphonien wurde nach dem Opfer ein förmlicher Prozeß eingeleitet, bei dem alle Beteiligten zum Verhör kamen. Endlich einigte man sich, die Schuld an der Mordtat auf das Messer abzuwälzen, welches dann ins Meer geworfen wurde.
Trotz der Scheu, welche das Leben des heiligen Tieres als eines Stammesgenossen schützt, wird es zur Notwendigkeit, ein solches Tier von Zeit zu Zeit in feierlicher Gemeinschaft zu töten und Fleisch und Blut desselben unter die Clangenossen zu verteilen. Das Motiv, welches diese Tat gebietet, gibt den tiefsten Sinn des Opferwesens preis. Wir haben gehört, daß in späteren Zeiten jedes gemeinsame Essen, die Teilnahme an der nämlichen Substanz, welche in ihre Körper eindringt, ein heiliges Band zwischen den Commensalen herstellt; in ältesten Zeiten scheint diese Bedeutung nur der Teilnahme an der Substanz eines heiligen Opfers zuzukommen. Das heilige Mysterium des Opfertodes rechtfertigt sich, indem nur auf diesem Wege das heilige Band hergestellt werden kann, welches die Teilnehmer untereinander und mit ihrem Gotte einigt[Fußnote]l. c., p. 113..
Dieses Band ist nichts anderes als das Leben des Opfertieres, welches in seinem Fleisch und in seinem Blute wohnt und durch die Opfermahlzeit allen Teilnehmern mitgeteilt wird. Eine solche Vorstellung liegt allen Blutbündnissen zugrunde, durch die sich noch in späten Zeiten Menschen gegeneinander verpflichten. Die durchaus realistische Auffassung der Blutsgemeinschaft als Identität der Substanz läßt die Notwendigkeit verstehen, sie von Zeit zu Zeit durch den physischen Prozeß der Opfermahlzeit zu erneuern.
Brechen wir hier die Mitteilung der Gedankengänge von Robertson Smith ab, um ihren Kern in gedrängtester Kürze zu resümieren: Als die Idee des Privateigentums aufkam, wurde das Opfer als eine Gabe an die Gottheit, als eine Übertragung aus dem Eigentum des Menschen in das des Gottes aufgefaßt. Allein diese Deutung ließ alle Eigentümlichkeiten des Opferrituals unaufgeklärt. In ältesten Zeiten war das Opfertier selbst heilig, sein Leben unverletzlich gewesen; es konnte nur unter der Teilnahme und Mitschuld des ganzen Stammes und in Gegenwart des Gottes genommen werden, um die heilige Substanz zu liefern, durch deren Genuß die Clangenossen sich ihrer stofflichen Identität untereinander und mit der Gottheit versicherten. Das Opfer war ein Sakrament, das Opfertier selbst ein Stammesgenosse. Es war in Wirklichkeit das alte Totemtier, der primitive Gott selbst, durch dessen Tötung und Verzehrung die Clangenossen ihre Gottähnlichkeit auffrischten und versicherten.
Aus dieser Analyse des Opferwesens zog Robertson Smith den Schluß, daß die periodische Tötung und Aufzehrung des Totem in Zeiten vor der Verehrung anthropomorpher Gottheiten ein bedeutsames Stück der Totemreligion gewesen sei. Das Zeremoniell einer solchen Totemmahlzeit, meinte er, sei uns in der Beschreibung eines Opfers aus späteren Zeiten erhalten. Der hl. Nilus berichtet von einer Opfersitte der Beduinen in der sinaitischen Wüste um das Ende des vierten Jahrhunderts nach Christi Geburt. Das Opfer, ein Kamel, wurde gebunden auf einen rohen Altar von Steinen gelegt; der Anführer des Stammes ließ die Teilnehmer dreimal unter Gesängen um den Altar herumgehen, brachte dem Tiere die erste Wunde bei und trank gierig das hervorquellende Blut; dann stürzte sich die ganze Gemeinde auf das Opfer, hieb mit den Schwertern Stücke des zuckenden Fleisches los und verzehrte sie roh in solcher Hast, daß in der kurzen Zwischenzeit zwischen dem Aufgang des Morgensterns, dem dieses Opfer galt, und dem Erblassen des Gestirns vor den Sonnenstrahlen alles vom Opfertier, Leib, Knochen, Haut, Fleisch und Eingeweide, vertilgt war. Dieser barbarische, von höchster Altertümlichkeit zeugende Ritus war allen Beweismitteln nach kein vereinzelter Gebrauch, sondern die allgemeine, ursprüngliche Form des Totemopfers, die in späterer Zeit die verschiedensten Abschwächungen erfuhr.
Viele Autoren haben sich geweigert, der Konzeption der Totemmahlzeit Gewicht beizulegen, weil sie durch die direkte Beobachtung auf der Stufe des Totemismus nicht erhärtet werden konnte. Robertson Smith hat noch selbst auf die Beispiele hingewiesen, in denen die sakramentale Bedeutung der Opfer gesichert scheint, z. B. bei den Menschenopfern der Azteken, und auf andere, welche an die Bedingungen der Totemmahlzeit erinnern, die Bärenopfer des Bärenstammes der Ouataouaks in Amerika und die Bärenfeste der Ainos in Japan. Frazer hat diese und ähnliche Fälle in den beiden letzterschienenen Abteilungen seines großen Werkes ausführlich mitgeteilt [Fußnote](1912). Ein Indianerstamm in Kalifornien, der einen großen Raubvogel (Bussard) verehrt, tötet diesen in feierlicher Zeremonie einmal im Jahre, worauf er betrauert und seine Haut mit den Federn aufbewahrt wird. Die Zuniindianer in Neumexiko verfahren ebenso mit ihrer heiligen Schildkröte.
In den Intichiumazeremonien der zentralaustralischen Stämme ist ein Zug beobachtet worden, welcher zu den Voraussetzungen von Robertson Smith vortrefflich stimmt. Jeder Stamm, der für die Vermehrung seines Totem, dessen Genuß ihm doch selbst verwehrt ist, Magie treibt, ist gehalten, bei der Zeremonie etwas von seinem Totem selbst zu genießen, ehe derselbe den anderen Stämmen zugänglich wird. Das schönste Beispiel für den sakramentalen Genuß des sonst verbotenen Totem soll sich nach Frazer bei den Bini in Westafrika in Verbindung mit dem Begräbniszeremoniell dieser Stämme finden. (Ibid., II, p. 590.)
Wir aber wollen Robertson Smith in der Annahme folgen, daß die sakramentale Tötung und gemeinsame Aufzehrung des sonst verbotenen Totemtieres ein bedeutungsvoller Zug der Totemreligion gewesen sei [Fußnote]Die von verschiedenen Autoren (Marillier, Hubert und Mauss u. a.) gegen diese Theorie des Opfers vorgebrachten Einwendungen sind mir nicht unbekannt geblieben, haben aber den Eindruck der Lehren von Robertson Smith im wesentlichen nicht beeinträchtigt..
5
Stellen wir uns nun die Szene einer solchen Totemmahlzeit vor und statten sie noch mit einigen wahrscheinlichen Zügen aus, die bisher nicht gewürdigt werden konnten. Der Clan, der sein Totemtier bei feierlichem Anlasse auf grausame Art tötet und es roh verzehrt, Blut, Fleisch und Knochen; dabei sind die Stammesgenossen in die Ähnlichkeit des Totem verkleidet, imitieren es in Lauten und Bewegungen, als ob sie seine und ihre Identität betonen wollten. Es ist das Bewußtsein dabei, daß man eine jedem Einzelnen verbotene Handlung ausführt, die nur durch die Teilnahme aller gerechtfertigt werden kann; es darf sich auch keiner von der Tötung und der Mahlzeit ausschließen. Nach der Tat wird das hingemordete Tier beweint und beklagt. Die Totenklage ist eine zwangsmäßige, durch die Furcht vor einer drohenden Vergeltung erzwungene, ihre Hauptabsicht geht dahin, wie Robertson Smith bei einer analogen Gelegenheit bemerkt, die Verantwortlichkeit für die Tötung von sich abzuwälzen. [Fußnote]1894, p. 412.
Aber nach dieser Trauer folgt die lauteste Festfreude, die Entfesselung aller Triebe und Gestattung aller Befriedigungen. Die Einsicht in das Wesen des Festes fällt uns hier ohne jede Mühe zu.
Ein Fest ist ein gestatteter, vielmehr ein gebotener Exzeß, ein feierlicher Durchbruch eines Verbotes. Nicht weil die Menschen infolge irgendeiner Vorschrift froh gestimmt sind, begehen sie die Ausschreitungen, sondern der Exzeß liegt im Wesen des Festes; die festliche Stimmung wird durch die Freigebung des sonst Verbotenen erzeugt.
Was soll aber die Einleitung zu dieser Festesfreude, die Trauer über den Tod des Totemtieres? Wenn man sich über die Tötung des Totem, die sonst versagt ist, freut, warum trauert man auch über sie?
Wir haben gehört, daß sich die Clangenossen durch den Genuß des Totem heiligen, in ihrer Identifizierung mit ihm und untereinander bestärken. Daß sie das heilige Leben, dessen Träger die Substanz des Totem ist, in sich aufgenommen haben, könnte ja die festliche Stimmung und alles, was aus ihr folgt, erklären.
Die Psychoanalyse hat uns verraten, daß das Totemtier wirklich der Ersatz des Vaters ist, und dazu stimmte wohl der Widerspruch, daß es sonst verboten ist, es zu töten, und daß seine Tötung zur Festlichkeit wird, daß man das Tier tötet und es doch betrauert. Die ambivalente Gefühlseinstellung, welche den Vaterkomplex heute noch bei unseren Kindern auszeichnet und sich oft ins Leben der Erwachsenen fortsetzt, würde sich auch auf den Vaterersatz des Totemtieres erstrecken.
Allein, wenn man die von der Psychoanalyse gegebene Übersetzung des Totem mit der Tatsache der Totemmahlzeit und der Darwinschen Hypothese über den Urzustand der menschlichen Gesellschaft zusammenhält, ergibt sich die Möglichkeit eines tieferen Verständnisses, der Ausblick auf eine Hypothese, die phantastisch erscheinen mag, aber den Vorteil bietet, eine unvermutete Einheit zwischen bisher gesonderten Reihen von Phänomenen herzustellen.
Die Darwinsche Urhorde hat natürlich keinen Raum für die Anfänge des Totemismus. Ein gewalttätiger, eifersüchtiger Vater, der alle Weibchen für sich behält und die heranwachsenden Söhne vertreibt, nichts weiter. Dieser Urzustand der Gesellschaft ist nirgends Gegenstand der Beobachtung geworden. Was wir als primitivste Organisation finden, was noch heute bei gewissen Stämmen in Kraft besteht, das sind Männerverbände, die aus gleichberechtigten Mitgliedern bestehen und den Einschränkungen des totemistischen Systems unterliegen, dabei mütterliche Erblichkeit. Kann das eine aus dem anderen hervorgegangen sein, und auf welchem Wege war es möglich?
Die Berufung auf die Feier der Totemmahlzeit gestattet uns eine Antwort zu geben: Eines Tages [Fußnote]Zu dieser Darstellung, die sonst mißverständlich würde, bitte ich die Schlußsätze der nachfolgenden Anmerkung als Korrektiv hinzuzunehmen. taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint wagten sie und brachten zustande, was dem Einzelnen unmöglich geblieben wäre. (Vielleicht hatte ein Kulturfortschritt, die Handhabung einer neuen Waffe, ihnen das Gefühl der Überlegenheit gegeben.) Daß sie den Getöteten auch verzehrten, ist für den kannibalen Wilden selbstverständlich. Der gewalttätige Urvater war gewiß das beneidete und gefürchtete Vorbild eines jeden aus der Brüderschar gewesen. Nun setzten sie im Akte des Verzehrens die Identifizierung mit ihm durch, eigneten sich ein jeder ein Stück seiner Stärke an. Die Totemmahlzeit, vielleicht das erste Fest der Menschheit, wäre die Wiederholung und die Gedenkfeier dieser denkwürdigen, verbrecherischen Tat, mit welcher so vieles seinen Anfang nahm, die sozialen Organisationen, die sittlichen Einschränkungen und die Religion [Fußnote]Die ungeheuerlich erscheinende Annahme der Überwältigung und Tötung des tyrannischen Vaters durch die Vereinigung der ausgetriebenen Sohne hat sich auch Atkinson als direkte Folgerung aus den Verhältnissen der Darwinschen Urhorde ergeben. » A youthful band of brothers living together in forced celibacy, or at most in polyandrous relation with some single female captive. A horde as yet weak in their impubescence they are, but they would, when strength was gained with time, inevitably wrench by combined attacks, renewed again and again, both wife and life from the paternal tyrant« (1903, p. 220). Atkinson, der übrigens sein Leben in Neu-Caledonien verbrachte und ungewöhnliche Gelegenheit zum Studium der Eingeborenen hatte, beruft sich auch darauf, daß die von Darwin supponierten Zustände der Urhorde bei wilden Rinder- und Pferdeherden leicht zu beobachten sind und regelmäßig zur Tötung des Vatertieres führen. Er nimmt dann weiter an, daß nach der Beseitigung des Vaters ein Zerfall der Horde durch den erbitterten Kampf der siegreichen Söhne untereinander eintritt. Auf diese Weise käme eine neue Organisation der Gesellschaft niemals zustande: » an ever recurring violent succession to the solitary paternal tyrant by sons, whose parricidal hands were so soon again clenched in fratricidal strife« (p. 228). Atkinson, dem die Winke der Psychoanalyse nicht zu Gebote standen und dem die Studien von Robertson Smith nicht bekannt waren, findet einen minder gewaltsamen Übergang von der Urhorde zur nächsten sozialen Stufe, auf welcher zahlreiche Männer in friedlicher Gemeinschaft zusammenleben. Er läßt es die Mutterliebe durchsetzen, daß anfangs nur die jüngsten, später auch andere Söhne in der Horde verbleiben, wofür diese Geduldeten das sexuelle Vorrecht des Vaters in Form der von ihnen geübten Entsagung gegen Mutter und Schwestern anerkennen. So viel über die höchst bemerkenswerte Theorie von Atkinson, ihre Übereinstimmung mit der hier vorgetragenen im wesentlichen Punkte und ihre Abweichung davon, welche den Verzicht auf den Zusammenhang mit so vielem anderen mit sich bringt. Die Unbestimmtheit, die zeitliche Verkürzung und inhaltliche Zusammendrängung der Angaben in meinen obenstehenden Ausführungen darf ich als eine durch die Natur des Gegenstandes geforderte Enthaltung hinstellen. Es wäre ebenso unsinnig, In dieser Materie Exaktheit anzustreben, wie es unbillig wäre, Sicherheiten zu fordern..
Um, von der Voraussetzung absehend, diese Folgen glaubwürdig zu finden, braucht man nur anzunehmen, daß die sich zusammenrottende Brüderschar von denselben einander widersprechenden Gefühlen gegen den Vater beherrscht war, die wir als Inhalt der Ambivalenz des Vaterkomplexes bei jedem unserer Kinder und unserer Neurotiker nachweisen können. Sie haßten den Vater, der ihrem Machtbedürfnis und ihren sexuellen Ansprüchen so mächtig im Wege stand, aber sie liebten und bewunderten ihn auch. Nachdem sie ihn beseitigt, ihren Haß befriedigt und ihren Wunsch nach Identifizierung mit ihm durchgesetzt hatten, mußten sich die dabei überwältigten zärtlichen Regungen zur Geltung bringen [Fußnote]Dieser neuen Gefühlseinstellung mußte auch zugute kommen, daß die Tat keinem der Täter die volle Befriedigung bringen konnte. Sie war in gewisser Hinsicht vergeblich geschehen. Keiner der Söhne konnte ja seinen ursprünglichen Wunsch durchsetzen, die Stelle des Vaters einzunehmen. Der Mißerfolg ist aber, wie wir wissen, der moralischen Reaktion weit günstiger als die Befriedigung.. Es geschah in der Form der Reue, es entstand ein Schuldbewußtsein, welches hier mit der gemeinsam empfundenen Reue zusammenfällt. Der Tote wurde nun stärker, als der Lebende gewesen war; all dies, wie wir es noch heute an Menschenschicksalen sehen. Was er früher durch seine Existenz verhindert hatte, das verboten sie sich jetzt selbst in der psychischen Situation des uns aus den Psychoanalysen so wohl bekannten » nachträglichen Gehorsams«. Sie widerriefen ihre Tat, indem sie die Tötung des Vaterersatzes, des Totem, für unerlaubt erklärten, und verzichteten auf deren Früchte, indem sie sich die freigewordenen Frauen versagten. So schufen sie aus dem Schuldbewußtsein des Sohnes die beiden fundamentalen Tabu des Totemismus, die eben darum mit den beiden verdrängten Wünschen des Ödipuskomplexes übereinstimmen mußten. Wer dawiderhandelte, machte sich der beiden einzigen Verbrechen schuldig, welche die primitive Gesellschaft bekümmerten [Fußnote]» Murder and incest, or offences of a like kind against the sacred law of blood, are in primitive society the only crimes of which the community as such takes cognizance...« (Smith, 1894, p. 419)..
Die beiden Tabu des Totemismus, mit denen die Sittlichkeit der Menschen beginnt, sind psychologisch nicht gleichwertig. Nur das eine, die Schonung des Totemtieres, ruht ganz auf Gefühlsmotiven; der Vater war ja beseitigt, in der Realität war nichts mehr gutzumachen. Das andere aber, das Inzestverbot, hatte auch eine starke praktische Begründung. Das sexuelle Bedürfnis einigt die Männer nicht, sondern entzweit sie. Hatten sich die Brüder verbündet, um den Vater zu überwältigen, so war jeder des anderen Nebenbuhler bei den Frauen. Jeder hätte sie wie der Vater alle für sich haben wollen, und in dem Kampfe aller gegen alle wäre die neue Organisation zugrunde gegangen. Es war kein Überstarker mehr da, der die Rolle des Vaters mit Erfolg hätte aufnehmen können. Somit blieb den Brüdern, wenn sie miteinander leben wollten, nichts übrig, als – vielleicht nach Überwindung schwerer Zwischenfälle – das Inzestverbot aufzurichten, mit welchem sie alle zugleich auf die von ihnen begehrten Frauen verzichteten, um derentwegen sie doch in erster Linie den Vater beseitigt hatten. Sie retteten so die Organisation, welche sie stark gemacht hatte und die auf homosexuellen Gefühlen und Betätigungen ruhen konnte, welche sich in der Zeit der Vertreibung bei ihnen eingestellt haben mochten. Vielleicht war es auch diese Situation, welche den Keim zu den von Bachofen erkannten Institutionen des Mutterrechts legte, bis dieses von der patriarchalischen Familienordnung abgelöst wurde.
An das andere Tabu, welches das Leben des Totemtieres beschützt, knüpft hingegen der Anspruch des Totemismus an, als erster Versuch einer Religion gewertet zu werden. Bot sich dem Empfinden der Söhne das Tier als natürlicher und nächstliegender Ersatz des Vaters, so fand sich in der ihnen zwanghaft gebotenen Behandlung desselben doch noch mehr Ausdruck als das Bedürfnis, ihre Reue zur Darstellung zu bringen. Es konnte mit dem Vatersurrogat der Versuch gemacht werden, das brennende Schuldgefühl zu beschwichtigen, eine Art von Aussöhnung mit dem Vater zu bewerkstelligen. Das totemistische System war gleichsam ein Vertrag mit dem Vater, in dem der letztere all das zusagte, was die kindliche Phantasie vom Vater erwarten durfte, Schutz, Fürsorge und Schonung, wogegen man sich verpflichtete, sein Leben zu ehren, das heißt die Tat an ihm nicht zu wiederholen, durch die der wirkliche Vater zugrunde gegangen war. Es lag auch ein Rechtfertigungsversuch im Totemismus. »Hätte der Vater uns behandelt wie der Totem, wir wären nie in die Versuchung gekommen, ihn zu töten.« So verhalf der Totemismus dazu, die Verhältnisse zu beschönigen und das Ereignis vergessen zu machen, dem er seine Entstehung verdankte.
Es wurden hiebei Züge geschaffen, die fortan für den Charakter der Religion bestimmend blieben. Die Totemreligion war aus dem Schuldbewußtsein der Söhne hervorgegangen als Versuch, dies Gefühl zu beschwichtigen und den beleidigten Vater durch den nachträglichen Gehorsam zu versöhnen. Alle späteren Religionen erweisen sich als Lösungsversuche desselben Problems, variabel je nach dem kulturellen Zustand, in dem sie unternommen werden, und nach den Wegen, die sie einschlagen, aber es sind alle gleichzielende Reaktionen auf dieselbe große Begebenheit, mit der die Kultur begonnen hat und die seitdem die Menschheit nicht zur Ruhe kommen läßt.
Auch ein anderer Charakter, den die Religion treu bewahrt hat, ist damals schon im Totemismus hervorgetreten. Die Ambivalenzspannung war wohl zu groß, um durch irgendeine Veranstaltung ausgeglichen zu werden, oder die psychologischen Bedingungen sind der Erledigung dieser Gefühlsgegensätze überhaupt nicht günstig. Man merkt jedenfalls, daß die dem Vaterkomplex anhaftende Ambivalenz sich auch in den Totemismus und in die Religionen überhaupt fortsetzt. Die Religion des Totem umfaßt nicht nur die Äußerungen der Reue und die Versuche der Versöhnung, sondern dient auch der Erinnerung an den Triumph über den Vater. Die Befriedigung darüber läßt das Erinnerungsfest der Totemmahlzeit einsetzen, bei dem die Einschränkungen des nachträglichen Gehorsams wegfallen, macht es zur Pflicht, das Verbrechen des Vatermordes in der Opferung des Totemtieres immer wieder von neuem zu wiederholen, sooft der festgehaltene Erwerb jener Tat, die Aneignung der Eigenschaften des Vaters, infolge der verändernden Einflüsse des Lebens zu entschwinden droht. Wir werden nicht überrascht sein zu finden, daß auch der Anteil des Sohnestrotzes, oft in den merkwürdigsten Verkleidungen und Umwendungen, in späteren Religionsbildungen wieder auftaucht.
Verfolgen wir in Religion und sittlicher Vorschrift, die im Totemismus noch wenig scharf gesondert sind, bisher die Folgen der in Reue verwandelten zärtlichen Strömung gegen den Vater, so wollen wir doch nicht übersehen, daß im wesentlichen die Tendenzen, welche zum Vatermord gedrängt haben, den Sieg behalten. Die sozialen Brudergefühle, auf denen die große Umwälzung ruht, bewahren von nun an über lange Zeiten den tiefstgehenden Einfluß auf die Entwicklung der Gesellschaft. Sie schaffen sich Ausdruck in der Heiligung des gemeinsamen Blutes, in der Betonung der Solidarität aller Leben desselben Clans. Indem die Brüder sich einander so das Leben zusichern, sprechen sie aus, daß niemand von ihnen vom anderen behandelt werden dürfe wie der Vater von ihnen allen gemeinsam. Sie schließen eine Wiederholung des Vaterschicksals aus. Zum religiös begründeten Verbot, den Totem zu töten, kommt nun das sozial begründete Verbot des Brudermordes hinzu. Es wird dann noch lange währen, bis das Gebot die Einschränkung auf den Stammesgenossen abstreifen und den einfachen Wortlaut annehmen wird: Du sollst nicht morden. Zunächst ist an Stelle der Vaterhorde der Brüderclan getreten, welcher sich durch das Blutband versichert hat. Die Gesellschaft ruht jetzt auf der Mitschuld an dem gemeinsam verübten Verbrechen, die Religion auf dem Schuldbewußtsein und der Reue darüber, die Sittlichkeit teils auf den Notwendigkeiten dieser Gesellschaft, zum anderen Teil auf den vom Schuldbewußtsein geforderten Bußen.
Im Gegensatz zu den neueren und in Anlehnung an die älteren Auffassungen des totemistischen Systems heißt uns also die Psychoanalyse einen innigen Zusammenhang und gleichzeitigen Ursprung von Totemismus und Exogamie vertreten.
6
Ich stehe unter der Einwirkung einer großen Anzahl von starken Motiven, die mich vom Versuche zurückhalten werden, die weitere Entwicklung der Religionen von ihrem Beginn im Totemismus an bis zu ihrem heutigen Stande zu schildern. Ich will nur zwei Fäden hindurch verfolgen, wo ich sie im Gewebe besonders deutlich auftauchen sehe: das Motiv des Totemopfers und das Verhältnis des Sohnes zum Vater [Fußnote]Vgl. die zum Teil von abweichenden Gesichtspunkten beherrschte Arbeit von C. G. Jung (1912)..
Robertson Smith hat uns belehrt, daß die alte Totemmahlzeit in der ursprünglichen Form des Opfers wiederkehrt. Der Sinn der Handlung ist derselbe: die Heiligung durch die Teilnahme an der gemeinsamen Mahlzeit; auch das Schuldbewußtsein ist dabei geblieben, welches nur durch die Solidarität aller Teilnehmer beschwichtigt werden kann. Neu hinzugekommen ist die Stammesgottheit, in deren gedachter Gegenwart das Opfer stattfindet, die an dem Mahle teilnimmt wie ein Stammesgenosse und mit der man sich durch den Genuß am Opfer identifiziert. Wie kommt der Gott in die ihm ursprünglich fremde Situation? Die Antwort könnte lauten, es sei unterdes – unbekannt woher – die Gottesidee aufgetaucht, habe sich das ganze religiöse Leben unterworfen, und wie alles andere, was bestehenbleiben wollte, hätte auch die Totemmahlzeit den Anschluß an das neue System gewinnen müssen. Allein die psychoanalytische Erforschung des einzelnen Menschen lehrt mit einer ganz besonderen Nachdrücklichkeit, daß für jeden der Gott nach dem Vater gebildet ist, daß sein persönliches Verhältnis zu Gott von seinem Verhältnis zum leiblichen Vater abhängt, mit ihm schwankt und sich verwandelt und daß Gott im Grunde nichts anderes ist als ein erhöhter Vater. Die Psychoanalyse rät auch hier wie im Falle des Totemismus, den Gläubigen Glauben zu schenken, die Gott Vater nennen, wie sie den Totem Ahnherrn genannt haben. Wenn die Psychoanalyse irgendwelche Beachtung verdient, so muß, unbeschadet aller anderen Ursprünge und Bedeutungen Gottes, auf welche die Psychoanalyse kein Licht werfen kann, der Vateranteil an der Gottesidee ein sehr gewichtiger sein. Dann wäre aber in der Situation des primitiven Opfers der Vater zweimal vertreten, einmal als Gott und dann als das Totemopfertier, und bei allem Bescheiden mit der geringen Mannigfaltigkeit der psychoanalytischen Lösungen müssen wir fragen, ob das möglich ist und welchen Sinn es haben kann.
Wir wissen, daß mehrfache Beziehungen zwischen dem Gott und dem heiligen Tier (Totem, Opfertier) bestehen: 1. Jedem Gott ist gewöhnlich ein Tier heilig, nicht selten selbst mehrere; 2. in gewissen, besonders heiligen Opfern, den »mystischen«, wurde dem Gotte gerade das ihm geheiligte Tier zum Opfer dargebracht (Smith, 1894); 3. der Gott wurde häufig in der Gestalt eines Tieres verehrt oder, anders gesehen, Tiere genossen göttliche Verehrung lange nach dem Zeitalter des Totemismus; 4. in den Mythen verwandelt sich der Gott häufig in ein Tier, oft in das ihm geheiligte. So läge die Annahme nahe, daß der Gott selbst das Totemtier wäre, sich auf einer späteren Stufe des religiösen Fühlens aus dem Totemtier entwickelt hätte. Aller weiteren Diskussion überhebt uns aber die Erwägung, daß der Totem selbst nichts anderes ist als ein Vaterersatz. So mag er die erste Form des Vaterersatzes sein, der Gott aber eine spätere, in welcher der Vater seine menschliche Gestalt wiedergewonnen. Eine solche Neuschöpfung aus der Wurzel aller Religionsbildung, der Vatersehnsucht, konnte möglich werden, wenn sich im Laufe der Zeiten am Verhältnis zum Vater – und vielleicht auch zum Tiere – Wesentliches geändert hatte.
Solche Veränderungen lassen sich leicht erraten, auch wenn man von dem Beginn einer psychischen Entfremdung von dem Tiere und von der Zersetzung des Totemismus durch die Domestikation absehen will. (S. oben S. 167) In der durch die Beseitigung des Vaters hergestellten Situation lag ein Moment, welches im Laufe der Zeit eine außerordentliche Steigerung der Vatersehnsucht erzeugen mußte. Die Brüder, welche sich zur Tötung des Vaters zusammengetan hatten, waren ja jeder für sich vom Wunsche beseelt gewesen, dem Vater gleich zu werden, und hatten diesem Wunsche durch Einverleibung von Teilen seines Ersatzes in der Totemmahlzeit Ausdruck gegeben. Dieser Wunsch mußte infolge des Druckes, welchen die Bande des Brüderclan auf jeden Teilnehmer übten, unerfüllt bleiben. Es konnte und durfte niemand mehr die Machtvollkommenheit des Vaters erreichen, nach der sie doch alle gestrebt hatten. Somit konnte im Laufe langer Zeiten die Erbitterung gegen den Vater, die zur Tat gedrängt hatte, nachlassen, die Sehnsucht nach ihm wachsen, und es konnte ein Ideal entstehen, welches die Machtfülle und Unbeschränktheit des einst bekämpften Urvaters und die Bereitwilligkeit, sich ihm zu unterwerfen, zum Inhalt hatte. Die ursprüngliche demokratische Gleichstellung aller einzelnen Stammesgenossen war infolge einschneidender kultureller Veränderungen nicht mehr festzuhalten; somit zeigte sich eine Geneigtheit, in Anlehnung an die Verehrung einzelner Menschen, die sich vor anderen hervorgetan hatten, das alte Vaterideal in der Schöpfung von Göttern wiederzubeleben. Daß ein Mensch zum Gott wird und daß ein Gott stirbt, was uns heute als empörende Zumutung erscheint, war ja noch für das Vorstellungsvermögen des klassischen Altertums keineswegs anstößig [Fußnote]» To us moderns, for whom the breach which divides the human and the divine has deepened into an impassible gulf, such mimicry may appear impious, but it was otherwise with the ancients. To their thinking gods and men were akin, for many families traced their descent from a divinity, and the deification of a man probably seemed as little extraordinary to them as the canonization of a saint seems to a modern Catholic.« (Frazer, 1911, II, p. 177.). Die Erhöhung des einst gemordeten Vaters zum Gott, von dem nun der Stamm seine Herkunft ableitete, war aber ein weit ernsthafterer Sühneversuch als seinerzeit der Vertrag mit dem Totem.
Wo sich in dieser Entwicklung die Stelle für die großen Muttergottheiten findet, die vielleicht allgemein den Vatergöttern vorhergegangen sind, weiß ich nicht anzugeben. Sicher scheint aber, daß die Wandlung im Verhältnis zum Vater sich nicht auf das religiöse Gebiet beschränkte, sondern folgerichtig auf die andere durch die Beseitigung des Vaters beeinflußte Seite des menschlichen Lebens, auf die soziale Organisation, übergriff. Mit der Einsetzung der Vatergottheiten wandelte sich die vaterlose Gesellschaft allmählich in die patriarchalisch geordnete um. Die Familie war eine Wiederherstellung der einstigen Urhorde und gab den Vätern auch ein großes Stück ihrer früheren Rechte wieder. Es gab jetzt wieder Väter, aber die sozialen Errungenschaften des Brüderclan waren nicht aufgegeben worden, und der faktische Abstand der neuen Familienväter vom unumschränkten Urvater der Horde war groß genug, um die Fortdauer des religiösen Bedürfnisses, die Erhaltung der ungestillten Vatersehnsucht, zu versichern.
In der Opferszene vor dem Stammesgott ist also der Vater wirklich zweimal enthalten, als Gott und als Totemopfertier. Aber bei dem Versuch, diese Situation zu verstehen, werden wir uns vor Deutungen in acht nehmen, welche sie in flächenhafter Auffassung wie eine Allegorie übersetzen wollen und dabei der historischen Schichtung vergessen. Die zweifache Anwesenheit des Vaters entspricht den zwei einander zeitlich ablösenden Bedeutungen der Szene. Die ambivalente Einstellung gegen den Vater hat hier plastischen Ausdruck gefunden und ebenso der Sieg der zärtlichen Gefühlsregungen des Sohnes über seine feindseligen. Die Szene der Überwältigung des Vaters, seiner größten Erniedrigung, ist hier zum Material für eine Darstellung seines höchsten Triumphes geworden. Die Bedeutung, die das Opfer ganz allgemein gewonnen hat, liegt eben darin, daß es dem Vater die Genugtuung für die an ihm verübte Schmach in derselben Handlung bietet, welche die Erinnerung an diese Untat fortsetzt.
In weiterer Folge verliert das Tier seine Heiligkeit und das Opfer die Beziehung zur Totemfeier; es wird zu einer einfachen Darbringung an die Gottheit, zu einer Selbstentäußerung zugunsten des Gottes. Gott selbst ist jetzt so hoch über den Menschen erhaben, daß man mit ihm nur durch die Vermittlung des Priesters verkehren kann. Gleichzeitig kennt die soziale Ordnung göttergleiche Könige, welche das patriarchalische System auf den Staat übertragen. Wir müssen sagen, die Rache des gestürzten und wiedereingesetzten Vaters ist eine harte geworden, die Herrschaft der Autorität steht auf ihrer Höhe. Die unterworfenen Söhne haben das neue Verhältnis dazu benützt, um ihr Schuldbewußtsein noch weiter zu entlasten. Das Opfer, wie es jetzt ist, fällt ganz aus ihrer Verantwortlichkeit heraus. Gott selbst hat es verlangt und angeordnet. Zu dieser Phase gehören Mythen, in welchen der Gott selbst das Tier tötet, das ihm heilig ist, das er eigentlich selbst ist. Dies ist die äußerste Verleugnung der großen Untat, mit welcher die Gesellschaft und das Schuldbewußtsein begann. Eine zweite Bedeutung dieser letzteren Opferdarstellung ist nicht zu verkennen. Sie drückt die Befriedigung darüber aus, daß man den früheren Vaterersatz zugunsten der höheren Gottesvorstellung verlassen hat. Die flach allegorische Übersetzung der Szene fällt hier ungefähr mit ihrer psychoanalytischen Deutung zusammen. Jene lautet: es werde dargestellt, daß der Gott den tierischen Anteil seines Wesens überwindet [Fußnote]Die Überwindung einer Göttergeneration durch eine andere in den Mythologien bedeutet bekanntlich den historischen Vorgang der Ersetzung eines religiösen Systems durch ein neues, sei es infolge von Eroberung durch ein Fremdvolk oder auf dem Wege psychologischer Entwicklung. Im letzteren Falle nähert sich der Mythus den »funktionalen Phänomenen« im Sinne von H. Silberer. Daß der das Tier tötende Gott ein Libidosymbol ist, wie C. G. Jung (1912) behauptet, setzt einen anderen Begriff der Libido als den bisher verwendeten voraus und erscheint mir überhaupt fragwürdig..
Es wäre indes irrig, wenn man glauben wollte, in diesen Zeiten der erneuerten Vaterautorität seien die feindseligen Regungen, welche dem Vaterkomplex zugehören, völlig verstummt. Aus den ersten Phasen der Herrschaft der beiden neuen Vaterersatzbildungen, der Götter und der Könige, kennen wir vielmehr die energischesten Äußerungen jener Ambivalenz, welche für die Religion charakteristisch bleibt.
Frazer hat in seinem großen Werk The Golden Bough die Vermutung ausgesprochen, daß die ersten Könige der lateinischen Stämme Fremde waren, welche die Rolle einer Gottheit spielten und in dieser Rolle an einem bestimmten Festtage feierlich hingerichtet wurden. Die jährliche Opferung (Variante: Selbstopferung) eines Gottes scheint ein wesentlicher Zug der semitischen Religionen gewesen zu sein. Das Zeremoniell der Menschenopfer an den verschiedensten Stellen der bewohnten Erde läßt wenig Zweifel darüber, daß diese Menschen als Repräsentanten der Gottheit ihr Ende fanden, und in der Ersetzung des lebenden Menschen durch eine leblose Nachahmung (Puppe) läßt sich dieser Opfergebrauch noch in späte Zeiten verfolgen. Das theanthropische Gottesopfer, welches ich hier leider nicht mit der gleichen Vertiefung wie das Tieropfer behandeln kann, wirft ein helles Licht nach rückwärts auf den Sinn der älteren Opferformen. Es bekennt mit kaum zu überbietender Aufrichtigkeit, daß das Objekt der Opferhandlung immer das nämliche war, dasselbe, was nun als Gott verehrt wird, der Vater also. Die Frage nach dem Verhältnis von Tier- und Menschenopfer findet jetzt eine einfache Lösung. Das ursprüngliche Tieropfer war bereits ein Ersatz für ein Menschenopfer, für die feierliche Tötung des Vaters, und als der Vaterersatz seine menschliche Gestalt wiedererhielt, konnte sich das Tieropfer auch wieder in das Menschenopfer verwandeln.
So hatte sich die Erinnerung an jene erste große Opfertat als unzerstörbar erwiesen, trotz aller Bemühungen, sie zu vergessen, und gerade als man sich von ihren Motiven am weitesten entfernen wollte, mußte in der Form des Gottesopfers ihre unentstellte Wiederholung zutage treten. Welche Entwicklungen des religiösen Denkens als Rationalisierungen diese Wiederkehr ermöglicht haben, brauche ich an dieser Stelle nicht auszuführen. Robertson Smith, dem ja unsere Zurückführung des Opfers auf jenes große Ereignis der menschlichen Urgeschichte fernliegt, gibt an, daß die Zeremonien jener Feste, mit denen die alten Semiten den Tod einer Gottheit feierten, als » commemoration of a mythical tragedy« ausgelegt wurden und daß die Klage dabei nicht den Charakter einer spontanen Teilnahme hatte, sondern etwas Zwangsmäßiges, von der Furcht vor dem göttlichen Zorn Gebotenes an sich trug [Fußnote](Religion of the Semites, p. 412): » The mourning is not a spontaneous expression of sympathy with the divine tragedy, but obligatory and enforced by fear of supernatural anger. And a chief object of the mourners is to disclaim responsibility for the god' s death – a point which has already come before us in connection with theanthropic sacrifices, such as the ›ox-murder at Athens‹.«. Wir glauben zu erkennen, daß diese Auslegung im Rechte war und daß die Gefühle der Feiernden in der zugrunde liegenden Situation ihre gute Aufklärung fanden.
Nehmen wir es nun als Tatsache hin, daß auch in der weiteren Entwicklung der Religionen die beiden treibenden Faktoren, das Schuldbewußtsein des Sohnes und der Sohnestrotz, niemals erlöschen. Jeder Lösungsversuch des religiösen Problems, jede Art der Versöhnung der beiden widerstreitenden seelischen Mächte wird allmählich hinfällig, wahrscheinlich unter dem kombinierten Einfluß von historischen Ereignissen, kulturellen Änderungen und inneren psychischen Wandlungen.
Mit immer größerer Deutlichkeit tritt das Bestreben des Sohnes hervor, sich an die Stelle des Vatergottes zu setzen. Mit der Einführung des Ackerbaues hebt sich die Bedeutung des Sohnes in der patriarchalischen Familie. Er getraut sich neuer Äußerungen seiner inzestuösen Libido, die in der Bearbeitung der Mutter Erde eine symbolische Befriedigung findet. Es entstehen die Göttergestalten des Attis, Adonis, Tammuz u. a., Vegetationsgeister und zugleich jugendliche Gottheiten, welche die Liebesgunst mütterlicher Gottheiten genießen, den Mutterinzest dem Vater zum Trotze durchsetzen. Allein das Schuldbewußtsein, welches durch diese Schöpfungen nicht beschwichtigt ist, drückt sich in den Mythen aus, die diesen jugendlichen Geliebten der Muttergöttinnen ein kurzes Leben und eine Bestrafung durch Entmannung oder durch den Zorn des Vatergottes in Tierform bescheiden. Adonis wird durch den Eber getötet, das heilige Tier der Aphrodite; Attis, der Geliebte der Kybele, stirbt an Entmannung [Fußnote]Die Kastrationsangst spielt eine außerordentlich große Rolle in der Störung des Verhältnisses zum Vater bei unseren jugendlichen Neurotikern. Aus der schönen Beobachtung von Ferenczi haben wir ersehen, wie der Knabe seinen Totem in dem Tier erkennt, welches nach seinem kleinen Gliede schnappt. Wenn unsere Kinder von der rituellen Beschneidung erfahren, stellen sie dieselbe der Kastration gleich. Die völkerpsychologische Parallele zu diesem Verhalten der Kinder ist meines Wissens noch nicht ausgeführt worden. Die in der Urzeit und bei primitiven Völkern so häufige Beschneidung gehört dem Zeitpunkt der Männerweihe an, wo sie ihre Bedeutung finden muß, und ist erst sekundär in frühere Lebenszeiten zurückgeschoben worden. Es ist überaus interessant, daß die Beschneidung bei den Primitiven mit Haarabschneiden und Zahnausschlagen kombiniert oder durch sie ersetzt ist und daß unsere Kinder, die von diesem Sachverhalt nichts wissen können, in ihren Angstreaktionen diese beiden Operationen wirklich wie Äquivalente der Kastration behandeln.. Die Beweinung und die Freude über die Auferstehung dieser Götter ist in das Rituale einer anderen Sohnesgottheit übergegangen, welche zu dauerndem Erfolge bestimmt war.
Als das Christentum seinen Einzug in die antike Welt begann, traf es auf die Konkurrenz der Mithrasreligion, und es war für eine Weile zweifelhaft, welcher Gottheit der Sieg zufallen würde.
Die lichtumflossene Gestalt des persischen Götterjünglings ist doch unserem Verständnis dunkel geblieben. Vielleicht darf man aus den Darstellungen der Stiertötungen durch Mithras schließen, daß er jenen Sohn vorstellte, der die Opferung des Vaters allein vollzog und somit die Brüder von der sie drückenden Mitschuld an der Tat erlöste. Es gab einen anderen Weg zur Beschwichtigung dieses Schuldbewußtseins, und diesen beschritt erst Christus. Er ging hin und opferte sein eigenes Leben, und dadurch erlöste er die Brüderschar von der Erbsünde.
Die Lehre von der Erbsünde ist orphischer Herkunft; sie wurde in den Mysterien erhalten und drang von da aus in die Philosophenschulen des griechischen Altertums ein. [Fußnote]Reinach, Cultes Mythes et Religions, (1905–12), II, p. 75 .) Die Menschen waren die Nachkommen von Titanen, welche den jungen Dionysos-Zagreus getötet und zerstückelt hatten; die Last dieses Verbrechens drückte auf sie. In einem Fragment von Anaximander wird gesagt, daß die Einheit der Welt durch ein urzeitliches Verbrechen zerstört worden sei und daß alles, was daraus hervorgegangen, die Strafe dafür weiter tragen muß [Fußnote]» Une sorte de péché proethnique« (Reinach, 1905–12, II, p. 76).. Erinnert die Tat der Titanen durch die Züge der Zusammenrottung, der Tötung und Zerreißung deutlich genug an das von St. Nilus beschriebene Totemopfer – wie übrigens viele andere Mythen des Altertums, z. B. der Tod des Orpheus selbst –, so stört uns hier doch die Abweichung, daß die Mordtat an einem jugendlichen Gotte vollzogen wird.
Im christlichen Mythus ist die Erbsünde des Menschen unzweifelhaft eine Versündigung gegen Gottvater. Wenn nun Christus die Menschen von dem Drucke der Erbsünde erlöst, indem er sein eigenes Leben opfert, so zwingt er uns zu dem Schlusse, daß diese Sünde eine Mordtat war. Nach dem im menschlichen Fühlen tiefgewurzelten Gesetz der Talion kann ein Mord nur durch die Opferung eines anderen Lebens gesühnt werden; die Selbstaufopferung weist auf eine Blutschuld zurück [Fußnote]Die Selbstmordimpulse unserer Neurotiker erweisen sich regelmäßig als Selbstbestrafungen für Todeswünsche, die gegen andere gerichtet sind.. Und wenn dies Opfer des eigenen Lebens die Versöhnung mit Gottvater herbeiführt, so kann das zu sühnende Verbrechen kein anderes als der Mord am Vater gewesen sein.
So bekennt sich denn in der christlichen Lehre die Menschheit am unverhülltesten zu der schuldvollen Tat der Urzeit, weil sie nun im Opfertod des einen Sohnes die ausgiebigste Sühne für sie gefunden hat. Die Versöhnung mit dem Vater ist um so gründlicher, weil gleichzeitig mit diesem Opfer der volle Verzicht auf das Weib erfolgt, um dessentwillen man sich gegen den Vater empört hatte. Aber nun fordert auch das psychologische Verhängnis der Ambivalenz seine Rechte. Mit der gleichen Tat, welche dem Vater die größtmögliche Sühne bietet, erreicht auch der Sohn das Ziel seiner Wünsche gegen den Vater. Er wird selbst zum Gott neben, eigentlich an Stelle des Vaters. Die Sohnesreligion löst die Vaterreligion ab. Zum Zeichen dieser Ersetzung wird die alte Totemmahlzeit als Kommunion wiederbelebt, in welcher nun die Brüderschar vom Fleisch und Blut des Sohnes, nicht mehr des Vaters, genießt, sich durch diesen Genuß heiligt und mit ihm identifiziert. Unser Blick verfolgt durch die Länge der Zeiten die Identität der Totemmahlzeit mit dem Tieropfer, dem theanthropischen Menschenopfer und mit der christlichen Eucharistie und erkennt in all diesen Feierlichkeiten die Nachwirkung jenes Verbrechens, welches die Menschen so sehr bedrückte und auf das sie doch so stolz sein mußten. Die christliche Kommunion ist aber im Grunde eine neuerliche Beseitigung des Vaters, eine Wiederholung der zu sühnenden Tat. Wir merken, wie berechtigt der Satz von Frazer ist, daß » the Christian communion has absorbed within itself a sacrament which is doubtless far older than Christianity« [Fußnote]Frazer (1912, II, p. 51). – Niemand, der mit der Literatur des Gegenstandes vertraut ist, wird annehmen, daß die Zurückführung der christlichen Kommunion auf die Totemmahlzeit eine Idee des Schreibers dieses Aufsatzes sei..
7
Ein Vorgang wie die Beseitigung des Urvaters durch die Brüderschar mußte unvertilgbare Spuren in der Geschichte der Menschheit hinterlassen und sich in desto zahlreicheren Ersatzbildungen zum Ausdruck bringen, je weniger er selbst erinnert werden sollte [Fußnote]Ariel im Sturm: ...................Full fathom five thy father lies: ...................Of his bones are coral made; ...................Those are pearls that were his eyes: ...................Nothing of him that doth fade, ...................But doth suffer a sea-change ...................Into something rich and strange. In der schönen Übersetzung von Schlegel: ...................Fünf Faden tief liegt Vater dein. ...................Sein Gebein wird zu Korallen, ...................Perlen sind die Augen sein. ...................Nichts an ihm, das soll verfallen, ...................Das nicht wandelt Meeres-Hut ...................In ein reich und seltnes Gut..
Ich gehe der Versuchung aus dem Wege, diese Spuren in der Mythologie, wo sie nicht schwer zu finden sind, nachzuweisen, und wende mich einem anderen Gebiete zu, indem ich einem Fingerzeig von S. Reinach in einer inhaltsreichen Abhandlung über den Tod des Orpheus folge [Fußnote]›La Mort d'Orphée‹ in dem hier oft zitierten Buche: Cultes, mythes et religions (1905–12), II, p. 100 ff.)..
In der Geschichte der griechischen Kunst gibt es eine Situation, welche auffällige Ähnlichkeiten und nicht minder tiefgehende Verschiedenheiten mit der von Robertson Smith erkannten Szene der Totemmahlzeit zeigt. Es ist die Situation der ältesten griechischen Tragödie. Eine Schar von Personen, alle gleich benannt und gleich gekleidet, umsteht einen einzigen, von dessen Reden und Handeln sie alle abhängig sind: es ist der Chor und der ursprünglich einzige Heldendarsteller. Spätere Entwicklungen brachten einen zweiten und dritten Schauspieler, um Gegenspieler und Abspaltungen des Helden darzustellen, aber der Charakter des Helden wie sein Verhältnis zum Chor blieben unverändert. Der Held der Tragödie mußte leiden; dies ist noch heute der wesentliche Inhalt einer Tragödie. Er hatte die sogenannte »tragische Schuld« auf sich geladen, die nicht immer leicht zu begründen ist; sie ist oft keine Schuld im Sinne des bürgerlichen Lebens. Zumeist bestand sie in der Auflehnung gegen eine göttliche oder menschliche Autorität, und der Chor begleitete den Helden mit seinen sympathischen Gefühlen, suchte ihn zurückzuhalten, zu warnen, zu mäßigen und beklagte ihn, nachdem er für sein kühnes Unternehmen die als verdient hingestellte Bestrafung gefunden hatte.
Warum muß aber der Held der Tragödie leiden, und was bedeutet seine »tragische« Schuld? Wir wollen die Diskussion durch rasche Beantwortung abschneiden. Er muß leiden, weil er der Urvater, der Held jener großen urzeitlichen Tragödie ist, die hier eine tendenziöse Wiederholung findet, und die tragische Schuld ist jene, die er auf sich nehmen muß, um den Chor von seiner Schuld zu entlasten. Die Szene auf der Bühne ist durch zweckmäßige Entstellung, man könnte sagen: im Dienste raffinierter Heuchelei, aus der historischen Szene hervorgegangen. In jener alten Wirklichkeit waren es gerade die Chorgenossen, die das Leiden des Helden verursachten; hier aber erschöpfen sie sich in Teilnahme und Bedauern, und der Held ist selbst an seinem Leiden schuld. Das auf ihn gewälzte Verbrechen, die Überhebung und Auflehnung gegen eine große Autorität, ist genau dasselbe, was in Wirklichkeit die Genossen des Chors, die Brüderschar, bedrückt. So wird der tragische Held – noch wider seinen Willen – zum Erlöser des Chors gemacht.
Waren speziell in der griechischen Tragödie die Leiden des göttlichen Bockes Dionysos und die Klage des mit ihm sich identifizierenden Gefolges von Böcken der Inhalt der Aufführung, so wird es leicht verständlich, daß das bereits erloschene Drama sich im Mittelalter an der Passion Christi neu entzündete.
So möchte ich denn zum Schlusse dieser mit äußerster Verkürzung geführten Untersuchung das Ergebnis aussprechen, daß im Ödipuskomplex die Anfänge von Religion, Sittlichkeit, Gesellschaft und Kunst zusammentreffen, in voller Übereinstimmung mit der Feststellung der Psychoanalyse, daß dieser Komplex den Kern aller Neurosen bildet, soweit sie bis jetzt unserem Verständnis nachgegeben haben. Es erscheint mir als eine große Überraschung, daß auch diese Probleme des Völkerseelenlebens eine Auflösung von einem einzigen konkreten Punkte her, wie es das Verhältnis zum Vater ist, gestatten sollten. Vielleicht ist selbst ein anderes psychologisches Problem in diesen Zusammenhang einzubeziehen. Wir haben so oft Gelegenheit gehabt, die Gefühlsambivalenz im eigentlichen Sinne, also das Zusammentreffen von Liebe und Haß gegen dasselbe Objekt, an der Wurzel wichtiger Kulturbildungen aufzuzeigen. Wir wissen nichts über die Herkunft dieser Ambivalenz. Man kann die Annahme machen, daß sie ein fundamentales Phänomen unseres Gefühlslebens sei. Aber auch die andere Möglichkeit scheint mir wohl beachtenswert, daß sie, dem Gefühlsleben ursprünglich fremd, von der Menschheit an dem Vaterkomplex [Fußnote]Respektive Elternkomplex. erworben wurde, wo die psychoanalytische Erforschung des Einzelmenschen heute noch ihre stärkste Ausprägung nachweist [Fußnote]Der Mißverständnisse gewöhnt, halte ich es nicht für überflüssig, ausdrücklich hervorzuheben, daß die hier gegebenen Zurückführungen an die komplexe Natur der abzuleitenden Phänomene keineswegs vergessen haben und daß sie nur den Anspruch erheben, zu den bereits bekannten oder noch unerkannten Ursprüngen der Religion, Sittlichkeit und der Gesellschaft ein neues Moment hinzuzufügen, welches sich aus der Berücksichtigung der psychoanalytischen Anforderungen ergibt. Die Synthese zu einem Ganzen der Erklärung muß ich anderen überlassen. Es geht aber diesmal aus der Natur dieses neuen Beitrages hervor, daß er in einer solchen Synthese keine andere als die zentrale Rolle spielen könnte, wenngleich die Überwindung von großen affektiven Widerständen erfordert werden dürfte, ehe man ihm eine solche Bedeutung zugesteht..
Bevor ich nun abschließe, muß ich der Bemerkung Raum geben, daß der hohe Grad von Konvergenz zu einem umfassenden Zusammenhange, den wir in diesen Ausführungen erreicht haben, uns nicht gegen die Unsicherheiten unserer Voraussetzungen und die Schwierigkeiten unserer Resultate verblenden kann. Von den letzteren will ich nur noch zwei behandeln, die sich manchem Leser aufgedrängt haben dürften.
Es kann zunächst niemandem entgangen sein, daß wir überall die Annahme einer Massenpsyche zugrunde legen, in welcher sich die seelischen Vorgänge vollziehen wie im Seelenleben eines Einzelnen. Wir lassen vor allem das Schuldbewußtsein wegen einer Tat über viele Jahrtausende fortleben und in Generationen wirksam bleiben, welche von dieser Tat nichts wissen konnten. Wir lassen einen Gefühlsprozeß, wie er bei Generationen von Söhnen entstehen konnte, die von ihrem Vater mißhandelt wurden, sich auf neue Generationen fortsetzen, welche einer solchen Behandlung gerade durch die Beseitigung des Vaters entzogen worden waren. Dies scheinen allerdings schwerwiegende Bedenken, und jede andere Erklärung scheint den Vorzug zu verdienen, welche solche Voraussetzungen vermeiden kann.
Allein eine weitere Erwägung zeigt, daß wir die Verantwortlichkeit für solche Kühnheit nicht allein zu tragen haben. Ohne die Annahme einer Massenpsyche, einer Kontinuität im Gefühlsleben der Menschen, welche gestattet, sich über die Unterbrechungen der seelischen Akte durch das Vergehen der Individuen hinwegzusetzen, kann die Völkerpsychologie überhaupt nicht bestehen. Setzen sich die psychischen Prozesse der einen Generation nicht auf die nächste fort, müßte jede ihre Einstellung zum Leben neu erwerben, so gäbe es auf diesem Gebiet keinen Fortschritt und so gut wie keine Entwicklung. Es erheben sich nun zwei neue Fragen, wieviel man der psychischen Kontinuität innerhalb der Generationsreihen zutrauen kann und welcher Mittel und Wege sich die eine Generation bedient, um ihre psychischen Zustände auf die nächste zu übertragen. Ich werde nicht behaupten, daß diese Probleme weit genug geklärt sind oder daß die direkte Mitteilung und Tradition, an die man zunächst denkt, für das Erfordernis hinreichen. Im allgemeinen kümmert sich die Völkerpsychologie wenig darum, auf welche Weise die verlangte Kontinuität im Seelenleben der einander ablösenden Generationen hergestellt wird. Ein Teil der Aufgabe scheint durch die Vererbung psychischer Dispositionen besorgt zu werden, welche aber doch gewisser Anstöße im individuellen Leben bedürfen, um zur Wirksamkeit zu erwachen. Es mag dies der Sinn des Dichterwortes sein:
Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.
Das Problem erschiene noch schwieriger, wenn wir zugestehen könnten, daß es seelische Regungen gibt, welche so spurlos unterdrückt werden können, daß sie keine Resterscheinungen zurücklassen. Allein solche gibt es nicht. Die stärkste Unterdrückung muß Raum lassen für entstellte Ersatzregungen und aus ihnen folgende Reaktionen. Dann dürfen wir aber annehmen, daß keine Generation imstande ist, bedeutsamere seelische Vorgänge vor der nächsten zu verbergen. Die Psychoanalyse hat uns nämlich gelehrt, daß jeder Mensch in seiner unbewußten Geistestätigkeit einen Apparat besitzt, der ihm gestattet, die Reaktionen anderer Menschen zu deuten, das heißt die Entstellungen wieder rückgängig zu machen, welche der andere an dem Ausdruck seiner Gefühlsregungen vorgenommen hat. Auf diesem Wege des unbewußten Verständnisses all der Sitten, Zeremonien und Satzungen, welche das ursprüngliche Verhältnis zum Urvater zurückgelassen hatte, mag auch den späteren Generationen die Übernahme jener Gefühlserbschaft gelungen sein.
Ein anderes Bedenken dürfte gerade von seiten der analytischen Denkweise erhoben werden.
Wir haben die ersten Moralvorschriften und sittlichen Beschränkungen der primitiven Gesellschaft als Reaktion auf eine Tat aufgefaßt, welche ihren Urhebern den Begriff des Verbrechens gab. Sie bereuten diese Tat und beschlossen, daß sie nicht mehr wiederholt werden solle und daß ihre Ausführung keinen Gewinn gebracht haben dürfe. Dies schöpferische Schuldbewußtsein ist nun unter uns nicht erloschen. Wir finden es bei den Neurotikern in asozialer Weise wirkend, um neue Moralvorschriften, fortgesetzte Einschränkungen zu produzieren, als Sühne für die begangenen und als Vorsicht gegen neu zu begehende Untaten [Fußnote]Vgl. den zweiten Aufsatz dieser Reihe über das Tabu.. Wenn wir aber bei diesen Neurotikern nach den Taten forschen, welche solche Reaktionen wachgerufen haben, so werden wir enttäuscht. Wir finden nicht Taten, sondern nur Impulse, Gefühlsregungen, welche nach dem Bösen verlangen, aber von der Ausführung abgehalten worden sind. Dem Schuldbewußtsein der Neurotiker liegen nur psychische Realitäten zugrunde, nicht faktische. Die Neurose ist dadurch charakterisiert, daß sie die psychische Realität über die faktische setzt, auf Gedanken ebenso ernsthaft reagiert wie die Normalen nur auf Wirklichkeiten.
Kann es sich bei den Primitiven nicht ähnlich verhalten haben? Wir sind berechtigt, ihnen eine außerordentliche Überschätzung ihrer psychischen Akte als Teilerscheinung ihrer narzißtischen Organisation zuzuschreiben [Fußnote]S. den Aufsatz über ›Animismus, Magie und Allmacht der Gedanken‹.. Demnach könnten die bloßen Impulse von Feindseligkeit gegen den Vater, die Existenz der Wunschphantasie, ihn zu töten und zu verzehren, hingereicht haben, um jene moralische Reaktion zu erzeugen, die Totemismus und Tabu geschaffen hat. Man würde so der Notwendigkeit entgehen, den Beginn unseres kulturellen Besitzes, auf den wir mit Recht so stolz sind, auf ein gräßliches, alle unsere Gefühle beleidigendes Verbrechen zurückzuführen. Die kausale, von jenem Anfang bis in unsere Gegenwart reichende Verknüpfung litte dabei keinen Schaden, denn die psychische Realität wäre bedeutsam genug, um alle diese Folgen zu tragen. Man wird dagegen einwenden, daß ja eine Veränderung der Gesellschaft von der Form der Vaterhorde zu der des Brüderclan wirklich vorgefallen ist. Dies ist ein starkes Argument, aber doch nicht entscheidend. Die Veränderung könnte auf minder gewaltsame Weise erreicht worden sein und doch die Bedingung für das Hervortreten der moralischen Reaktion enthalten haben. Solange der Druck des Urvaters sich fühlbar machte, waren die feindseligen Gefühle gegen ihn berechtigt, und die Reue über sie mußte einen anderen Zeitpunkt abwarten. Ebensowenig ist der zweite Einwand stichhaltig, daß alles, was sich aus der ambivalenten Relation zum Vater ableitet, Tabu und Opfervorschrift, den Charakter des höchsten Ernstes und der vollsten Realität an sich trägt. Auch das Zeremoniell und die Hemmungen der Zwangsneurotiker zeigen diesen Charakter und gehen doch nur auf psychische Realität, auf Vorsatz und nicht auf Ausführungen zurück. Wir müssen uns hüten, aus unserer nüchternen Welt, die voll ist von materiellen Werten, die Geringschätzung des bloß Gedachten und Gewünschten in die nur innerlich reiche Welt des Primitiven und des Neurotikers einzutragen.
Wir stehen hier vor einer Entscheidung, die uns wirklich nicht leicht gemacht ist. Beginnen wir aber mit dem Bekenntnis, daß der Unterschied, der anderen fundamental erscheinen kann, für unser Urteil nicht das Wesentliche des Gegenstandes trifft. Wenn für den Primitiven Wünsche und Impulse den vollen Wert von Tatsachen haben, so ist es an uns, solcher Auffassung verständnisvoll zu folgen, anstatt sie nach unserem Maßstab zu korrigieren. Dann aber wollen wir das Vorbild der Neurose, das uns in diesen Zweifel gebracht hat, selbst schärfer ins Auge fassen. Es ist nicht richtig, daß die Zwangsneurotiker, welche heute unter dem Drucke einer Übermoral stehen, sich nur gegen die psychische Realität von Versuchungen verteidigen und wegen bloß verspürter Impulse bestrafen. Es ist auch ein Stück historischer Realität dabei; in ihrer Kindheit hatten diese Menschen nichts anderes als die bösen Impulse, und insoweit sie in der Ohnmacht des Kindes es konnten, haben sie diese Impulse auch in Handlungen umgesetzt. Jeder von diesen Überguten hatte in der Kindheit seine böse Zeit, eine perverse Phase als Vorläufer und Voraussetzung der späteren übermoralischen. Die Analogie der Primitiven mit den Neurotikern wird also viel gründlicher hergestellt, wenn wir annehmen, daß auch bei den ersteren die psychische Realität, an deren Gestaltung kein Zweifel ist, anfänglich mit der faktischen Realität zusammenfiel, daß die Primitiven das wirklich getan haben, was sie nach allen Zeugnissen zu tun beabsichtigten.
Allzuweit dürfen wir unser Urteil über die Primitiven auch nicht durch die Analogie mit den Neurotikern beeinflussen lassen. Es sind auch die Unterschiede in Rechnung zu ziehen. Gewiß sind bei beiden, Wilden wie Neurotikern, die scharfen Scheidungen zwischen Denken und Tun, wie wir sie ziehen, nicht vorhanden. Allein der Neurotiker ist vor allem im Handeln gehemmt, bei ihm ist der Gedanke der volle Ersatz für die Tat. Der Primitive ist ungehemmt, der Gedanke setzt sich ohneweiters in Tat um, die Tat ist ihm sozusagen eher ein Ersatz des Gedankens, und darum meine ich, ohne selbst für die letzte Sicherheit der Entscheidung einzutreten, man darf in dem Falle, den wir diskutieren, wohl annehmen: »Im Anfang war die Tat.«
Allgemeines über den hysterischen Anfall (1909)
A
Wenn man eine Hysterika, deren Leiden sich in Anfällen äußert, der Psychoanalyse unterzieht, so überzeugt man sich leicht, daß diese Anfälle nichts anderes sind als ins Motorische übersetzte, auf die Motilität projizierte, pantomimisch dargestellte Phantasien. Unbewußte Phantasien zwar, aber sonst von derselben Art, wie man sie in den Tagträumen unmittelbar erfassen, aus den nächtlichen Träumen durch Deutung entwickeln kann. Häufig ersetzt ein Traum einen Anfall, noch häufiger erläutert er ihn, indem die nämliche Phantasie zu verschiedenartigem Ausdruck im Traume wie im Anfalle gelangt. Man sollte nun erwarten, durch die Anschauung des Anfalles zur Kenntnis der in ihm dargestellten Phantasie zu kommen; allein dies gelingt nur selten. In der Regel hat die pantomimische Darstellung der Phantasie unter dem Einflusse der Zensur ganz analoge Entstellungen wie die halluzinatorische des Traumes erfahren, so daß die eine wie die andere zunächst für das eigene Bewußtsein wie für das Verständnis des Zuschauers undurchsichtig geworden ist. Der hysterische Anfall bedarf also der gleichen deutenden Bearbeitung wie wir sie mit den nächtlichen Träumen vornehmen. Aber nicht nur die Mächte, von denen die Entstellung ausgeht, und die Absicht dieser Entstellung, auch die Technik derselben ist die nämliche, die uns durch die Traumdeutung bekannt geworden ist.
1) Der Anfall wird dadurch unverständlich, daß er in demselben Material gleichzeitig mehrere Phantasien zur Darstellung bringt, also durch Verdichtung. Die Gemeinsamen der beiden (oder mehreren) Phantasien bilden wie im Traume den Kern der Darstellung. Die so zur Deckung gebrachten Phantasien sind oft ganz verschiedener Art, z. B. ein rezenter Wunsch und die Wiederbelebung eines infantilen Eindrucks; dieselben Innervationen dienen dann beiden Absichten, oft in der geschicktesten Weise. Hysteriker, die sich der Verdichtung im großen Ausmaße bedienen, finden etwa mit einer einzigen Anfallsform ihr Auslangen; andere drücken eine Mehrheit von pathogenen Phantasien auch durch Vervielfältigung der Anfallsformen aus.
2) Der Anfall wird dadurch undurchsichtig, daß die Kranke die Tätigkeiten beider in der Phantasie auftretenden Personen auszuführen unternimmt, also durch mehrfache Identifizierung. Vergleiche etwa das Beispiel, welches ich in dem Aufsatze ›Hysterische Phantasien und ihre Beziehung zur Bisexualität‹ in Hirschfelds Zeitschrift für Sexualwissenschaft, Bd. I, Nr. 1, erwähnt habe, in dem die Kranke mit der einen Hand (als Mann) das Kleid herunterreißt, während sie es mit der anderen (als Weib) an den Leib preßt.
3) Ganz außerordentlich entstellend wirkt die antagonistische Verkehrung der Innervationen, welche der in der Traumarbeit üblichen Verwandlung eines Elementes in sein Gegenteil analog ist, z. B. wenn im Anfall eine Umarmung dadurch dargestellt wird, daß die Arme krampfhaft nach rückwärts gezogen werden, bis sich die Hände über der Wirbelsäule begegnen. –; Möglicherweise ist der bekannte arc de cercle der großen hysterischen Attacke nichts anderes als eine solche energische Verleugnung einer für den sexuellen Verkehr geeigneten Körperstellung durch antagonistische Innervation.
4) Kaum minder verwirrend und irreführend wirkt dann die Umkehrung in der Zeitfolge innerhalb der dargestellten Phantasie, was wiederum sein volles Gegenstück in manchen Träumen findet, die mit dem Ende der Handlung beginnen, um dann mit deren Anfang zu schließen. So z. B. wenn die Verführungsphantasie einer Hysterika zum Inhalte hat, wie sie lesend in einem Park sitzt, das Kleid ein wenig gehoben, so daß der Fuß sichtbar wird, ein Herr sich ihr nähert, der sie anspricht, sie dann mit ihm an einen anderen Ort geht und dort zärtlich mit ihm verkehrt, und sie diese Phantasie im Anfalle derart spielt, daß sie mit dem Krampfstadium beginnt, welches dem Koitus entspricht, dann aufsteht, in ein anderes Zimmer geht, sich dort hinsetzt, um zu lesen, und dann auf eine imaginäre Anrede Antwort gibt.
Die beiden letztangeführten Entstellungen können uns die Intensität der Widerstände ahnen lassen, denen das Verdrängte noch bei seinem Durchbruche im hysterischen Anfalle Rechnung tragen muß.
B
Das Auftreten der hysterischen Anfälle folgt leichtverständlichen Gesetzen. Da der verdrängte Komplex aus Libidobesetzung und Vorstellungsinhalt (Phantasie) besteht, kann der Anfall wachgerufen werden: 1) assoziativ, wenn der (genügend besetzte) Komplexinhalt durch eine Anknüpfung des bewußten Lebens angespielt wird, 2) organisch, wenn aus inneren somatischen Gründen und durch psychische Beeinflussung von außen die Libidobesetzung über ein gewisses Maß steigt, 3) im Dienste der primären Tendenz, als Ausdruck der »Flucht in die Krankheit«, wenn die Wirklichkeit peinlich oder schreckhaft wird, also zur Tröstung, 4) im Dienste der sekundären Tendenzen, mit denen sich das Kranksein verbündet hat, sobald durch die Produktion des Anfalles ein dem Kranken nützlicher Zweck erreicht werden kann. Im letzteren Falle ist der Anfall für gewisse Personen berechnet, kann für sie zeitlich verschoben werden und macht den Eindruck bewußter Simulation.
C
Die Erforschung der Kindergeschichte Hysterischer lehrt, daß der hysterische Anfall zum Ersatze einer ehemals geübten und seither aufgegebenen autoerotischen Befriedigung bestimmt ist. In einer großen Zahl von Fällen kehrt diese Befriedigung (die Masturbation durch Berührung oder Schenkeldruck, die Zungenbewegung u. dgl.) auch im Anfalle selbst unter Abwendung des Bewußtseins wieder. Das Auftreten des Anfalles durch Libidosteigerung und im Dienste der primären Tendenz als Tröstung wiederholt auch genau die Bedingungen, unter denen diese autoerotische Befriedigung seinerzeit vom Kranken mit Absicht aufgesucht wurde. Die Anamnese des Kranken ergibt folgende Stadien: a) autoerotische Befriedigung ohne Vorstellungsinhalt, b) die nämliche im Anschlusse an eine Phantasie, welche in die Befriedigungsaktion ausläuft, c) Verzicht auf die Aktion mit Beibehaltung der Phantasie, d) Verdrängung dieser Phantasie, die sich dann, entweder unverändert oder modifiziert und neuen Lebenseindrücken angepaßt, im hysterischen Anfalle durchsetzt und e) eventuell selbst die ihr zugehörige, angeblich abgewöhnte Befriedigungsaktion wiederbringt. Ein typischer Zyklus von infantiler Sexualbetätigung –; Verdrängung –; Mißglücken der Verdrängung und Wiederkehr des Verdrängten.
Der unwillkürliche Harnabgang darf gewiß nicht für unvereinbar mit der Diagnose des hysterischen Anfalls gehalten werden; er wiederholt bloß die infantile Form der stürmischen Pollution. Übrigens kann man auch den Zungenbiß bei unzweifelhafter Hysterie antreffen; er widerspricht der Hysterie so wenig wie dem Liebesspiele; sein Auftreten im Anfalle wird erleichtert, wenn die Kranke durch ärztliche Erkundigung auf die differentialdiagnostischen Schwierigkeiten aufmerksam gemacht worden ist. Selbstbeschädigung im hysterischen Anfalle kann (häufiger bei Männern) vorkommen, wo sie einen Unfall des kindlichen Lebens (z. B. den Erfolg einer Rauferei) wiederholt.
Der Bewußtseinsverlust, die Absence des hysterischen Anfalles geht aus jenem flüchtigen, aber unverkennbaren Bewußtseinsentgang hervor, der auf der Höhe einer jeden intensiven Sexualbefriedigung (auch der autoerotischen) zu verspüren ist. Bei der Entstehung hysterischer Absencen aus den Pollutionsanwandlungen junger weiblicher Individuen ist diese Entwicklung am sichersten zu verfolgen. Die sogenannten hypnoiden Zustände, die Absencen während der Träumerei, die bei Hysterischen so häufig sind, lassen die gleiche Herkunft erkennen. Der Mechanismus dieser Absencen ist ein relativ einfacher. Zunächst wird alle Aufmerksamkeit auf den Ablauf des Befriedigungsvorganges eingestellt, und mit dem Eintritte der Befriedigung wird diese ganze Aufmerksamkeitsbesetzung plötzlich aufgehoben, so daß eine momentane Bewußtseinsleere entsteht. Diese sozusagen physiologische Bewußtseinslücke wird dann im Dienste der Verdrängung erweitert, bis sie all das aufnehmen kann, was die verdrängende Instanz von sich weist.
D
Die Einrichtung, welche der verdrängten Libido den Weg zur motorischen Abfuhr im Anfalle weist, ist der bei jedermann, auch beim Weibe, bereitgehaltene Reflexmechanismus der Koitusaktion, den wir bei schrankenloser Hingabe an die Sexualtätigkeit manifest werden sehen. Schon die Alten sagten, der Koitus sei eine »kleine Epilepsie«. Wir dürfen abändern! Der hysterische Krampfanfall ist ein Koitusäquivalent. Die Analogie mit dem epileptischen Anfalle hilft uns wenig, da dessen Genese noch unverstandener ist als die des hysterischen.
Im ganzen setzt der hysterische Anfall, wie die Hysterie überhaupt, beim Weibe ein Stück Sexualbetätigung wieder ein, das in den Kinderjahren bestanden hatte und damals exquisit männlichen Charakter erkennen ließ. Man kann es häufig beobachten, daß gerade Mädchen, die bis in die Jahre der Vorpubertät bubenhaftes Wesen und Neigungen zeigten, von der Pubertät an hysterisch werden. In einer ganzen Reihe von Fällen entspricht die hysterische Neurose nur einer exzessiven Ausprägung jenes typischen Verdrängungsschubes, welcher durch Wegschaffung der männlichen Sexualität das Weib entstehen läßt. (Vgl.: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905 d)
Bemerkungen über die Übertragungsliebe (1915)
Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse III
Jeder Anfänger in der Psychoanalyse bangt wohl zuerst vor den Schwierigkeiten, welche ihm die Deutung der Einfälle des Patienten und die Aufgabe der Reproduktion des Verdrängten bereiten werden. Es steht ihm aber bevor, diese Schwierigkeiten bald gering einzuschätzen und dafür die Überzeugung einzutauschen, daß die einzigen wirklich ernsthaften Schwierigkeiten bei der Handhabung der Übertragung anzutreffen sind.
Von den Situationen, die sich hier ergeben, will ich eine einzige, scharf umschriebene, herausgreifen, sowohl wegen ihrer Häufigkeit und realen Bedeutsamkeit als auch wegen ihres theoretischen Interesses. Ich meine den Fall, daß eine weibliche Patientin durch unzweideutige Andeutungen erraten läßt oder es direkt ausspricht, daß sie sich wie ein anderes sterbliches Weib in den sie analysierenden Arzt verliebt hat. Diese Situation hat ihre peinlichen und komischen Seiten wie ihre ernsthaften; sie ist auch so verwickelt und vielseitig bedingt, so unvermeidlich und so schwer lösbar, daß ihre Diskussion längst ein vitales Bedürfnis der analytischen Technik erfüllt hätte. Aber da wir selbst nicht immer frei sind, die wir über die Fehler der anderen spotten, haben wir uns zur Erfüllung dieser Aufgabe bisher nicht eben gedrängt. Immer wieder stoßen wir hier mit der Pflicht der ärztlichen Diskretion zusammen, die im Leben nicht zu entbehren, in unserer Wissenschaft aber nicht zu brauchen ist. Insoferne die Literatur der Psychoanalytik auch dem realen Leben angehört, ergibt sich hier ein unlösbarer Widerspruch. Ich habe mich kürzlich an einer Stelle über die Diskretion hinausgesetzt und angedeutet, daß die nämliche Übertragungssituation die Entwicklung der psychoanalytischen Therapie um ihr erstes Jahrzehnt verzögert hat [Fußnote]›Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung‹ (1914)..
Für den wohlerzogenen Laien –; ein solcher ist wohl der ideale Kulturmensch der Psychoanalyse gegenüber –; sind Liebesbegebenheiten mit allem anderen inkommensurabel; sie stehen gleichsam auf einem besonderen Blatte, das keine andere Beschreibung verträgt. Wenn sich also die Patientin in den Arzt verliebt hat, wird er meinen, dann kann es nur zwei Ausgänge haben, den selteneren, daß alle Umstände die dauernde legitime Vereinigung der beiden gestatten, und den häufigeren, daß Arzt und Patientin auseinandergehen und die begonnene Arbeit, welche der Herstellung dienen sollte, als durch ein Elementarereignis gestört aufgeben. Gewiß ist auch ein dritter Ausgang denkbar, der sich sogar mit der Fortsetzung der Kur zu vertragen scheint, die Anknüpfung illegitimer und nicht für die Ewigkeit bestimmter Liebesbeziehungen; aber dieser ist wohl durch die bürgerliche Moral wie durch die ärztliche Würde unmöglich gemacht. Immerhin würde der Laie bitten, durch eine möglichst deutliche Versicherung des Analytikers über den Ausschluß dieses dritten Falles beruhigt zu werden.
Es ist evident, daß der Standpunkt des Psychoanalytikers ein anderer sein muß.
Setzen wir den Fall des zweiten Ausganges der Situation, die wir besprechen, Arzt und Patientin gehen auseinander, nachdem sich die Patientin in den Arzt verliebt hat; die Kur wird aufgegeben. Aber der Zustand der Patientin macht bald einen zweiten analytischen Versuch bei einem anderen Arzte notwendig; da stellt es sich denn ein, daß sich die Patientin auch in diesen zweiten Arzt verliebt fühlt, und ebenso, wenn sie wieder abbricht und von neuem anfängt, in den dritten usw. Diese mit Sicherheit eintreffende Tatsache, bekanntlich eine der Grundlagen der psychoanalytischen Theorie, gestattet zwei Verwertungen, eine für den analysierenden Arzt, die andere für die der Analyse bedürftige Patientin.
Für den Arzt bedeutet sie eine kostbare Aufklärung und eine gute Warnung vor einer etwa bei ihm bereitliegenden Gegenübertragung. Er muß erkennen, daß das Verlieben der Patientin durch die analytische Situation erzwungen wird und nicht etwa den Vorzügen seiner Person zugeschrieben werden kann, daß er also gar keinen Grund hat, auf eine solche »Eroberung«, wie man sie außerhalb der Analyse heißen würde, stolz zu sein. Und es ist immer gut, daran gemahnt zu werden. Für die Patientin ergibt sich aber eine Alternative: entweder sie muß auf eine psychoanalytische Behandlung verzichten, oder sie muß sich die Verliebtheit in den Arzt als unausweichliches Schicksal gefallen lassen [Fußnote]Daß die Übertragung sich in anderen und minder zärtlichen Gefühlen äußern kann, ist bekannt und soll in diesem Aufsatze nicht behandelt werden..
Ich zweifle nicht daran, daß sich die Angehörigen der Patientin mit ebensolcher Entschiedenheit für die erste der beiden Möglichkeiten erklären werden wie der analysierende Arzt für die zweite. Aber ich meine, es ist dies ein Fall, in welchem der zärtlichen –; oder vielmehr egoistisch eifersüchtigen –; Sorge der Angehörigen die Entscheidung nicht überlassen werden kann. Nur das Interesse der Kranken sollte den Ausschlag geben. Die Liebe der Angehörigen kann aber keine Neurose heilen. Der Psychoanalytiker braucht sich nicht aufzudrängen, er darf sich aber als unentbehrlich für gewisse Leistungen hinstellen. Wer als Angehöriger die Stellung Tolstois zu diesem Probleme zu der seinigen macht, mag im ungestörten Besitze seiner Frau oder Tochter bleiben und muß es zu ertragen suchen, daß diese auch ihre Neurose und die mit ihr verknüpfte Störung ihrer Liebesfähigkeit beibehält. Es ist schließlich ein ähnlicher Fall wie der der gynäkologischen Behandlung. Der eifersüchtige Vater oder Gatte irrt übrigens groß, wenn er meint, die Patientin werde der Verliebtheit in den Arzt entgehen, wenn er sie zur Bekämpfung ihrer Neurose eine andere als die analytische Behandlung einschlagen läßt. Der Unterschied wird vielmehr nur sein, daß eine solche Verliebtheit, die dazu bestimmt ist, unausgesprochen und unanalysiert zu bleiben, niemals jenen Beitrag zur Herstellung der Kranken leisten wird, den ihr die Analyse abzwingen würde.
Es ist mir bekanntgeworden, daß einzelne Ärzte, welche die Analyse ausüben, die Patienten häufig auf das Erscheinen der Liebesübertragung vorbereiten oder sie sogar auffordern, sich »nur in den Arzt zu verlieben, damit die Analyse vorwärtsgehe«. Ich kann mir nicht leicht eine unsinnigere Technik vorstellen. Man raubt damit dem Phänomen den überzeugenden Charakter der Spontaneität und bereitet sich selbst schwer zu beseitigende Hindernisse.
Zunächst hat es allerdings nicht den Anschein, als ob aus der Verliebtheit in der Übertragung etwas für die Kur Förderliches entstehen könnte. Die Patientin, auch die bisher fügsamste, hat plötzlich Verständnis und Interesse für die Behandlung verloren, will von nichts anderem sprechen und hören als von ihrer Liebe, für die sie Entgegnung fordert; sie hat ihre Symptome aufgegeben oder vernachlässigt sie, ja, sie erklärt sich für gesund. Es gibt einen völligen Wechsel der Szene, wie wenn ein Spiel durch eine plötzlich hereinbrechende Wirklichkeit abgelöst würde, etwa wie wenn sich während einer Theatervorstellung Feuerlärm erhebt. Wer dies als Arzt zum erstenmal erlebt, hat es nicht leicht, die analytische Situation festzuhalten und sich der Täuschung zu entziehen, daß die Behandlung wirklich zu Ende sei.
Mit etwas Besinnung findet man sich dann zurecht. Vor allem gedenkt man des Verdachtes, daß alles, was die Fortsetzung der Kur stört, eine Widerstandsäußerung sein mag. An dem Auftreten der stürmischen Liebesforderung hat der Widerstand unzweifelhaft einen großen Anteil. Man hatte ja die Anzeichen einer zärtlichen Übertragung bei der Patientin längst bemerkt und durfte ihre Gefügigkeit, ihr Eingehen auf die Erklärungen der Analyse, ihr ausgezeichnetes Verständnis und die hohe Intelligenz, die sie dabei erwies, gewiß auf Rechnung einer solchen Einstellung gegen den Arzt schreiben. Nun ist das alles wie weggefegt, die Kranke ist ganz einsichtslos geworden, sie scheint in ihrer Verliebtheit aufzugehen, und diese Wandlung ist ganz regelmäßig in einem Zeitpunkte aufgetreten, da man ihr gerade zumuten mußte, ein besonders peinliches und schwer verdrängtes Stück ihrer Lebensgeschichte zuzugestehen oder zu erinnern. Die Verliebtheit ist also längst dagewesen, aber jetzt beginnt der Widerstand sich ihrer zu bedienen, um die Fortsetzung der Kur zu hemmen, um alles Interesse von der Arbeit abzulenken und um den analysierenden Arzt in eine peinliche Verlegenheit zu bringen.
Sieht man näher zu, so kann man in der Situation auch den Einfluß komplizierender Motive erkennen, zum Teile solcher, die sich der Verliebtheit anschließen, zum anderen Teile aber besonderer Äußerungen des Widerstandes. Von der ersteren Art ist das Bestreben der Patientin, sich ihrer Unwiderstehlichkeit zu versichern, die Autorität des Arztes durch seine Herabsetzung zum Geliebten zu brechen und was sonst als Nebengewinn bei der Liebesbefriedigung winkt. Vom Widerstande darf man vermuten, daß er gelegentlich die Liebeserklärung als Mittel benützt, um den gestrengen Analytiker auf die Probe zu stellen, worauf er im Falle seiner Willfährigkeit eine Zurechtweisung zu erwarten hätte. Vor allem aber hat man den Eindruck, daß der Widerstand als agent provocateur die Verliebtheit steigert und die Bereitwilligkeit zur sexuellen Hingabe übertreibt, um dann desto nachdrücklicher unter Berufung auf die Gefahren einer solchen Zuchtlosigkeit das Wirken der Verdrängung zu rechtfertigen. All dieses Beiwerk, das in reineren Fällen auch wegbleiben kann, ist von Alf. Adler bekanntlich als das Wesentliche des ganzen Vorganges angesehen worden.
Wie muß sich aber der Analytiker benehmen, um nicht an dieser Situation zu scheitern, wenn es für ihn feststeht, daß die Kur trotz dieser Liebesübertragung und durch dieselbe hindurch fortzusetzen ist?
Ich hätte es nun leicht, unter nachdrücklicher Betonung der allgemein gültigen Moral zu postulieren, daß der Analytiker nie und nimmer die ihm angebotene Zärtlichkeit annehmen oder erwidern dürfe. Er müsse vielmehr den Moment für gekommen erachten, um die sittliche Forderung und die Notwendigkeit des Verzichtes vor dem verliebten Weibe zu vertreten und es bei ihr zu erreichen, daß sie von ihrem Verlangen ablasse und mit Überwindung des animalischen Anteils an ihrem Ich die analytische Arbeit fortsetze.
Ich werde aber diese Erwartungen nicht erfüllen, weder den ersten noch den zweiten Teil derselben. Den ersten nicht, weil ich nicht für die Klientel schreibe, sondern für Ärzte, die mit ernsthaften Schwierigkeiten zu ringen haben, und weil ich überdies hier die Moralvorschrift auf ihren Ursprung, das heißt auf Zweckmäßigkeit zurückführen kann. Ich bin diesmal in der glücklichen Lage, das moralische Oktroi ohne Veränderung des Ergebnisses durch Rücksichten der analytischen Technik zu ersetzen.
Noch entschiedener werde ich aber dem zweiten Teile der angedeuteten Erwartung absagen. Zur Triebunterdrückung, zum Verzicht und zur Sublimierung auffordern, sobald die Patientin ihre Liebesübertragung eingestanden hat, hieße nicht analytisch, sondern sinnlos handeln. Es wäre nicht anders, als wollte man mit kunstvollen Beschwörungen einen Geist aus der Unterwelt zum Aufsteigen zwingen, um ihn dann ungefragt wieder hinunterzuschicken. Man hätte ja dann das Verdrängte nur zum Bewußtsein gerufen, um es erschreckt von neuem zu verdrängen. Auch über den Erfolg eines solchen Vorgehens braucht man sich nicht zu täuschen. Gegen Leidenschaften richtet man mit sublimen Redensarten bekanntlich wenig aus. Die Patientin wird nur die Verschmähung empfinden und nicht versäumen, sich für sie zu rächen.
Ebensowenig kann ich zu einem Mittelwege raten, der sich manchen als besonders klug empfehlen würde, welcher darin besteht, daß man die zärtlichen Gefühle der Patientin zu erwidern behauptet und dabei allen körperlichen Betätigungen dieser Zärtlichkeit ausweicht, bis man das Verhältnis in ruhigere Bahnen lenken und auf eine höhere Stufe heben kann. Ich habe gegen dieses Auskunftsmittel einzuwenden, daß die psychoanalytische Behandlung auf Wahrhaftigkeit aufgebaut ist. Darin liegt ein gutes Stück ihrer erziehlichen Wirkung und ihres ethischen Wertes. Es ist gefährlich, dieses Fundament zu verlassen. Wer sich in die analytische Technik eingelebt hat, trifft das dem Arzte sonst unentbehrliche Lügen und Vorspiegeln überhaupt nicht mehr und pflegt sich zu verraten, wenn er es in bester Absicht einmal versucht. Da man vom Patienten strengste Wahrhaftigkeit fordert, setzt man seine ganze Autorität aufs Spiel, wenn man sich selbst von ihm bei einer Abweichung von der Wahrheit ertappen läßt. Außerdem ist der Versuch, sich in zärtliche Gefühle gegen die Patientin gleiten zu lassen, nicht ganz ungefährlich. Man beherrscht sich nicht so gut, daß man nicht plötzlich einmal weiter gekommen wäre, als man beabsichtigt hatte. Ich meine also, man darf die Indifferenz, die man sich durch die Niederhaltung der Gegenübertragung erworben hat, nicht verleugnen.
Ich habe auch bereits erraten lassen, daß die analytische Technik es dem Arzte zum Gebote macht, der liebesbedürftigen Patientin die verlangte Befriedigung zu versagen. Die Kur muß in der Abstinenz durchgeführt werden; ich meine dabei nicht allein die körperliche Entbehrung, auch nicht die Entbehrung von allem, was man begehrt, denn dies würde vielleicht kein Kranker vertragen. Sondern ich will den Grundsatz aufstellen, daß man Bedürfnis und Sehnsucht als zur Arbeit und Veränderung treibende Kräfte bei der Kranken bestehen lassen und sich hüten muß, dieselben durch Surrogate zu beschwichtigen. Anderes als Surrogate könnte man ja nicht bieten, da die Kranke infolge ihres Zustandes, solange ihre Verdrängungen nicht behoben sind, einer wirklichen Befriedigung nicht fähig ist.
Gestehen wir zu, daß der Grundsatz, die analytische Kur solle in der Entbehrung durchgeführt werden, weit über den hier betrachteten Einzelfall hinausreicht und einer eingehenden Diskussion bedarf, durch welche die Grenzen seiner Durchführbarkeit abgesteckt werden sollen. Wir wollen es aber vermeiden, dies hier zu tun, und uns möglichst enge an die Situation halten, von der wir ausgegangen sind. Was würde geschehen, wenn der Arzt anders vorginge und die etwa beiderseits gegebene Freiheit ausnützen würde, um die Liebe der Patientin zu erwidern und ihr Bedürfnis nach Zärtlichkeit zu stillen?
Wenn ihn dabei die Berechnung leiten sollte, durch solches Entgegenkommen würde er sich die Herrschaft über die Patientin sichern und sie so bewegen, die Aufgaben der Kur zu lösen, also ihre dauernde Befreiung von der Neurose zu erwerben, so müßte ihm die Erfahrung zeigen, daß er sich verrechnet hat. Die Patientin würde ihr Ziel erreichen, er niemals das seinige. Es hätte sich zwischen Arzt und Patientin nur wieder abgespielt, was eine lustige Geschichte vom Pastor und vom Versicherungsagenten erzählt. Zu dem ungläubigen und schwerkranken Versicherungsagenten wird auf Betreiben der Angehörigen ein frommer Mann gebracht, der ihn vor seinem Tode bekehren soll. Die Unterhaltung dauert so lange, daß die Wartenden Hoffnung schöpfen. Endlich öffnet sich die Tür des Krankenzimmers. Der Ungläubige ist nicht bekehrt worden, aber der Pastor geht versichert weg.
Es wäre ein großer Triumph für die Patientin, wenn ihre Liebeswerbung Erwiderung fände, und eine volle Niederlage für die Kur. Die Kranke hätte erreicht, wonach alle Kranken in der Analyse streben, etwas zu agieren, im Leben zu wiederholen, was sie nur erinnern, als psychisches Material reproduzieren und auf psychischem Gebiete erhalten soll [Fußnote]S. die vorhergehende Abhandlung über ›Erinnern ...‹ usw., S. 209 f., oben.. Sie würde im weiteren Verlaufe des Liebesverhältnisses alle Hemmungen und pathologischen Reaktionen ihres Liebeslebens zum Vorscheine bringen, ohne daß eine Korrektur derselben möglich wäre, und das peinliche Erlebnis mit Reue und großer Verstärkung ihrer Verdrängungsneigung abschließen. Das Liebesverhältnis macht eben der Beeinflußbarkeit durch die analytische Behandlung ein Ende; eine Vereinigung von beiden ist ein Unding.
Die Gewährung des Liebesverlangens der Patientin ist also ebenso verhängnisvoll für die Analyse wie die Unterdrückung desselben. Der Weg des Analytikers ist ein anderer, ein solcher, für den das reale Leben kein Vorbild liefert. Man hütet sich, von der Liebesübertragung abzulenken, sie zu verscheuchen oder der Patientin zu verleiden; man enthält sich ebenso standhaft jeder Erwiderung derselben. Man hält die Liebesübertragung fest, behandelt sie aber als etwas Unreales, als eine Situation, die in der Kur durchgemacht, auf ihre unbewußten Ursprünge zurückgeleitet werden soll und dazu verhelfen muß, das Verborgenste des Liebeslebens der Kranken dem Bewußtsein und damit der Beherrschung zuzuführen. Je mehr man den Eindruck macht, selbst gegen jede Versuchung gefeit zu sein, desto eher wird man der Situation ihren analytischen Gehalt entziehen können. Die Patientin, deren Sexualverdrängung doch nicht aufgehoben, bloß in den Hintergrund geschoben ist, wird sich dann sicher genug fühlen, um alle Liebesbedingungen, alle Phantasien ihrer Sexualsehnsucht, alle Einzelcharaktere ihrer Verliebtheit zum Vorscheine zu bringen, und von diesen aus dann selbst den Weg zu den infantilen Begründungen ihrer Liebe eröffnen.
Bei einer Klasse von Frauen wird dieser Versuch, die Liebesübertragung für die analytische Arbeit zu erhalten, ohne sie zu befriedigen, allerdings nicht gelingen. Es sind das Frauen von elementarer Leidenschaftlichkeit, welche keine Surrogate verträgt, Naturkinder, die das Psychische nicht für das Materielle nehmen wollen, die nach des Dichters Worten nur zugänglich sind »für Suppenlogik mit Knödelargumenten«. Bei diesen Personen steht man vor der Wahl: entweder Gegenliebe zeigen oder die volle Feindschaft des verschmähten Weibes auf sich laden. In keinem von beiden Fällen kann man die Interessen der Kur wahrnehmen. Man muß sich erfolglos zurückziehen und kann sich etwa das Problem vorhalten, wie sich die Fähigkeit zur Neurose mit so unbeugsamer Liebesbedürftigkeit vereinigt.
Die Art, wie man andere, minder gewalttätige Verliebte allmählich zur analytischen Auffassung nötigt, dürfte sich vielen Analytikern in gleicher Weise ergeben haben. Man betont vor allem den unverkennbaren Anteil des Widerstandes an dieser »Liebe«. Eine wirkliche Verliebtheit würde die Patientin gefügig machen und ihre Bereitwilligkeit steigern, um die Probleme ihres Falles zu lösen, bloß darum, weil der geliebte Mann es fordert. Eine solche würde gern den Weg über die Vollendung der Kur wählen, um sich dem Arzte wertvoll zu machen und die Realität vorzubereiten, in welcher die Liebesneigung ihren Platz finden könnte. Anstatt dessen zeige sich die Patientin eigensinnig und ungehorsam, habe alles Interesse für die Behandlung von sich geworfen und offenbar auch keine Achtung vor den tief begründeten Überzeugungen des Arztes. Sie produziere also einen Widerstand in der Erscheinungsform der Verliebtheit und trage überdies kein Bedenken, ihn in die Situation der sogenannten »Zwickmühle« zu bringen. Denn wenn er ablehne, wozu seine Pflicht und sein Verständnis ihn nötigen, werde sie die Verschmähte spielen können und sich dann aus Rachsucht und Erbitterung der Heilung durch ihn entziehen, wie jetzt infolge der angeblichen Verliebtheit.
Als zweites Argument gegen die Echtheit dieser Liebe führt man die Behauptung ein, daß dieselbe nicht einen einzigen neuen, aus der gegenwärtigen Situation entspringenden Zug an sich trage, sondern sich durchwegs aus Wiederholungen und Abklatschen früherer, auch infantiler Reaktionen zusammensetze. Man macht sich anheischig, dies durch die detaillierte Analyse des Liebesverhaltens der Patientin zu erweisen.
Wenn man zu diesen Argumenten noch das erforderliche Maß von Geduld hinzufügt, gelingt es zumeist, die schwierige Situation zu überwinden und entweder mit einer ermäßigten oder mit der »umgeworfenen« Verliebtheit die Arbeit fortzusetzen, deren Ziel dann die Aufdeckung der infantilen Objektwahl und der sie umspinnenden Phantasien ist. Ich möchte aber die erwähnten Argumente kritisch beleuchten und die Frage aufwerfen, ob wir mit ihnen der Patientin die Wahrheit sagen oder in unserer Notlage zu Verhehlungen und Entstellungen Zuflucht genommen haben. Mit anderen Worten: Ist die in der analytischen Kur manifest werdende Verliebtheit wirklich keine reale zu nennen?
Ich meine, wir haben der Patientin die Wahrheit gesagt, aber doch nicht die ganze, um das Ergebnis unbekümmerte. Von unseren beiden Argumenten ist das erste das stärkere. Der Anteil des Widerstandes an der Übertragungsliebe ist unbestreitbar und sehr beträchtlich. Aber der Widerstand hat diese Liebe doch nicht geschaffen, er findet sie vor, bedient sich ihrer und übertreibt ihre Äußerungen. Die Echtheit des Phänomens wird auch durch den Widerstand nicht entkräftet. Unser zweites Argument ist weit schwächer; es ist wahr, daß diese Verliebtheit aus Neuauflagen alter Züge besteht und infantile Reaktionen wiederholt. Aber dies ist der wesentliche Charakter jeder Verliebtheit. Es gibt keine, die nicht infantile Vorbilder wiederholt. Gerade das, was ihren zwanghaften, ans Pathologische mahnenden Charakter ausmacht, rührt von ihrer infantilen Bedingtheit her. Die Übertragungsliebe hat vielleicht einen Grad von Freiheit weniger als die im Leben vorkommende, normal genannte, läßt die Abhängigkeit von der infantilen Vorlage deutlicher erkennen, zeigt sich weniger schmiegsam und modifikationsfähig, aber das ist auch alles und nicht das Wesentliche.
Woran soll man die Echtheit einer Liebe sonst erkennen? An ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer Brauchbarkeit zur Durchsetzung des Liebeszieles? In diesem Punkte scheint die Übertragungsliebe hinter keiner anderen zurückzustehen; man hat den Eindruck, daß man alles von ihr erreichen könnte.
Resümieren wir also: Man hat kein Anrecht, der in der analytischen Behandlung zutage tretenden Verliebtheit den Charakter einer »echten« Liebe abzustreiten. Wenn sie sowenig normal erscheint, so erklärt sich dies hinreichend aus dem Umstände, daß auch die sonstige Verliebtheit außerhalb der analytischen Kur eher an die abnormen als an die normalen seelischen Phänomene erinnert. Immerhin ist sie durch einige Züge ausgezeichnet, welche ihr eine besondere Stellung sichern. Sie ist 1. durch die analytische Situation provoziert, 2. durch den diese Situation beherrschenden Widerstand in die Höhe getrieben, und 3., sie entbehrt in hohem Grade der Rücksicht auf die Realität, sie ist unkluger, unbekümmerter um ihre Konsequenzen, verblendeter in der Schätzung der geliebten Person, als wir einer normalen Verliebtheit gerne zugestehen wollen. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß gerade diese von der Norm abweichenden Züge das Wesentliche einer Verliebtheit ausmachen.
Für das Handeln des Arztes ist die erste der drei erwähnten Eigenheiten der Übertragungsliebe das Maßgebende. Er hat diese Verliebtheit durch die Einleitung der analytischen Behandlung zur Heilung der Neurose hervorgelockt; sie ist für ihn das unvermeidliche Ergebnis einer ärztlichen Situation, ähnlich wie die körperliche Entblößung eines Kranken oder wie die Mitteilung eines lebenswichtigen Geheimnisses. Damit steht es für ihn fest, daß er keinen persönlichen Vorteil aus ihr ziehen darf. Die Bereitwilligkeit der Patientin ändert nichts daran, wälzt nur die ganze Verantwortlichkeit auf seine eigene Person. Die Kranke war ja, wie er wissen muß, auf keinen anderen Mechanismus der Heilung vorbereitet. Nach glücklicher Überwindung aller Schwierigkeiten gesteht sie oft die Erwartungsphantasie ein, mit der sie in die Kur eingetreten war: Wenn sie sich brav benehme, werde sie am Ende durch die Zärtlichkeit des Arztes belohnt werden.
Für den Arzt vereinigen sich nun ethische Motive mit den technischen, um ihn von der Liebesgewährung an die Kranke zurückzuhalten. Er muß das Ziel im Auge behalten, daß das in seiner Liebesfähigkeit durch infantile Fixierungen behinderte Weib zur freien Verfügung über diese für sie unschätzbar wichtige Funktion gelange, aber sie nicht in der Kur verausgabe, sondern sie fürs reale Leben bereithalte, wenn dessen Forderungen nach der Behandlung an sie herantreten. Er darf nicht die Szene des Hundewettrennens mit ihr aufführen, bei dem ein Kranz von Würsten als Preis ausgesetzt ist und das ein Spaßvogel verdirbt, indem er eine einzelne Wurst in die Rennbahn wirft. Über die fallen die Hunde her und vergessen ans Wettrennen und an den in der Ferne winkenden Kranz für den Sieger. Ich will nicht behaupten, daß es dem Arzte immer leicht wird, sich innerhalb der ihm von Ethik und Technik vorgeschriebenen Schranken zu halten. Besonders der jüngere und noch nicht fest gebundene Mann mag die Aufgabe als eine harte empfinden. Unzweifelhaft ist die geschlechtliche Liebe einer der Hauptinhalte des Lebens und die Vereinigung seelischer und körperlicher Befriedigung im Liebesgenusse geradezu einer der Höhepunkte desselben. Alle Menschen bis auf wenige verschrobene Fanatiker wissen das und richten ihr Leben danach ein; nur in der Wissenschaft ziert man sich, es zuzugestehen. Anderseits ist es eine peinliche Rolle für den Mann, den Abweisenden und Versagenden zu spielen, wenn das Weib um Liebe wirbt, und von einer edlen Frau, die sich zu ihrer Leidenschaft bekennt, geht trotz Neurose und Widerstand ein unvergleichbarer Zauber aus. Nicht das grobsinnliche Verlangen der Patientin stellt die Versuchung her. Dies wirkt ja eher abstoßend und ruft alle Toleranz auf, um es als natürliches Phänomen gelten zu lassen. Die feineren und zielgehemmten Wunschregungen des Weibes sind es vielleicht, die die Gefahr mit sich bringen, Technik und ärztliche Aufgabe über ein schönes Erlebnis zu vergessen.
Und doch bleibt für den Analytiker das Nachgeben ausgeschlossen. So hoch er die Liebe schätzen mag, er muß es höher stellen, daß er die Gelegenheit hat, seine Patientin über eine entscheidende Stufe ihres Lebens zu heben. Sie hat von ihm die Überwindung des Lustprinzips zu lernen, den Verzicht auf eine naheliegende, aber sozial nicht eingeordnete Befriedigung zugunsten einer entfernteren, vielleicht überhaupt unsicheren, aber psychologisch wie sozial untadeligen. Zum Zwecke dieser Überwindung soll sie durch die Urzeiten ihrer seelischen Entwicklung durchgeführt werden und auf diesem Wege jenes Mehr von seelischer Freiheit erwerben, durch welches sich die bewußte Seelentätigkeit –; im systematischen Sinne –; von der unbewußten unterscheidet.
Der analytische Psychotherapeut hat so einen dreifachen Kampf zu führen, in seinem Inneren gegen die Mächte, welche ihn von dem analytischen Niveau herabziehen möchten, außerhalb der Analyse gegen die Gegner, die ihm die Bedeutung der sexuellen Triebkräfte bestreiten und es ihm verwehren, sich ihrer in seiner wissenschaftlichen Technik zu bedienen, und in der Analyse gegen seine Patienten, die sich anfangs wie die Gegner gebärden, dann aber die sie beherrschende Überschätzung des Sexuallebens kundgeben und den Arzt mit ihrer sozial ungebändigten Leidenschaftlichkeit gefangennehmen wollen.
Die Laien, von deren Einstellung zur Psychoanalyse ich eingangs sprach, werden gewiß auch diese Erörterungen über die Übertragungsliebe zum Anlasse nehmen, um die Aufmerksamkeit der Welt auf die Gefährlichkeit dieser therapeutischen Methode zu lenken. Der Psychoanalytiker weiß, daß er mit den explosivsten Kräften arbeitet und derselben Vorsicht und Gewissenhaftigkeit bedarf wie der Chemiker. Aber wann ist dem Chemiker je die Beschäftigung mit den ob ihrer Wirkung unentbehrlichen Explosivstoffen wegen deren Gefährlichkeit untersagt worden? Es ist merkwürdig, daß sich die Psychoanalyse alle Lizenzen erst neu erobern muß, die anderen ärztlichen Tätigkeiten längst zugestanden sind. Ich bin gewiß nicht dafür, daß die harmlosen Behandlungsmethoden aufgegeben werden sollen. Sie reichen für manche Fälle aus, und schließlich kann die menschliche Gesellschaft den furor sanandi ebensowenig brauchen wie irgendeinen anderen Fanatismus. Aber es heißt die Psychoneurosen nach ihrer Herkunft und ihrer praktischen Bedeutung arg unterschätzen, wenn man glaubt, diese Affektionen müßten durch Operationen mit harmlosen Mittelchen zu besiegen sein. Nein, im ärztlichen Handeln wird neben der medicina immer ein Raum bleiben für das ferrum und für das ignis, und so wird auch die kunstgerechte, unabgeschwächte Psychoanalyse nicht zu entbehren sein, die sich nicht scheut, die gefährlichsten seelischen Regungen zu handhaben und zum Wohle des Kranken zu meistern.
Bemerkungen zur Theorie und Praxis der Traumdeutung (1923)
Der zufällige Umstand, daß die letzten Auflagen der Traumdeutung durch Plattendruck hergestellt wurden, veranlaßt mich, nachstehende Bemerkungen selbständig zu machen, die sonst als Abänderungen oder Einschaltungen im Text untergekommen wären.
I
Bei der Deutung eines Traumes in der Analyse hat man die Wahl zwischen verschiedenen technischen Verfahren.
Man kann (a) chronologisch vorgehen und den Träumer seine Einfälle zu den Traumelementen in der Reihenfolge vorbringen lassen, welche diese Elemente in der Erzählung des Traumes einhalten. Dies ist das ursprüngliche, klassische Verhalten, welches ich noch immer für das beste halte, wenn man seine eigenen Träume analysiert.
Oder man kann (b) die Deutungsarbeit an einem einzelnen, ausgezeichneten Element des Traumes ansetzen lassen, das man mitten aus dem Traum herausgreift, z. B. an dem auffälligsten Stück desselben oder an dem, welches die größte Deutlichkeit oder sinnliche Intensität besitzt, oder etwa an eine im Traum enthaltene Rede anknüpfen, von der man erwartet, daß sie zur Erinnerung an eine Rede aus dem Wachleben führen wird.
Man kann (c) überhaupt zunächst vom manifesten Inhalt absehen und dafür an den Träumer die Frage stellen, welche Ereignisse des letzten Tages sich in seiner Assoziation zum erzählten Traum gesellen.
Endlich kann man (d), wenn der Träumer bereits mit der Technik der Deutung vertraut ist, auf jede Vorschrift verzichten und es ihm anheimstellen, mit welchen Einfällen zum Traum er beginnen will. Ich kann nicht behaupten, daß die eine oder die andere dieser Techniken die vorzüglichere ist und allgemein bessere Ergebnisse liefert.
II
Ungleich bedeutsamer ist der Umstand, ob die Deutungsarbeit unter hohem oder niedrigem Widerstandsdruck vor sich geht, worüber der Analytiker ja niemals lange im Zweifel bleibt. Bei hohem Druck bringt man es vielleicht dazu, zu erfahren, von welchen Dingen der Traum handelt, aber man kann nicht erraten, was er über diese Dinge aussagt. Es ist, wie wenn man einem entfernten oder leise geführten Gespräch zuhören würde. Man sagt sich dann, daß von einem Zusammenarbeiten mit dem Träumer nicht gut die Rede sein kann, beschließt, sich nicht viel zu plagen und ihm nicht viel zu helfen, und begnügt sich damit, ihm einige Symbolübersetzungen, die man für wahrscheinlich hält, vorzuschlagen.
Die Mehrzahl der Träume in schwierigen Analysen ist von solcher Art, so daß man aus ihnen nicht viel über Natur und Mechanismus der Traumbildung lernen kann, am wenigsten aber Auskünfte zu der beliebten Frage erhalten wird, wo denn die Wunscherfüllung des Traumes steckt.
Bei ganz extrem hohem Widerstandsdruck ereignet sich das Phänomen, daß die Assoziation des Träumers in die Breite, anstatt in die Tiefe geht. An Stelle der gewünschten Assoziationen zu dem erzählten Traum kommen immer neue Traumstücke zum Vorschein, die selbst assoziationslos bleiben. Nur wenn sich der Widerstand in mäßigen Grenzen hält, kommt das bekannte Bild der Deutungsarbeit zustande, daß die Assoziationen des Träumers von den manifesten Elementen aus zunächst weit divergieren, so daß eine große Anzahl von Themen und Vorstellungskreisen angerührt werden, bis dann eine zweite Reihe von Assoziationen von hier aus rasch zu den gesuchten Traumgedanken konvergiert.
Dann wird auch das Zusammenarbeiten des Analytikers mit dem Träumer möglich; bei hohem Widerstandsdruck wäre es nicht einmal zweckmäßig.
Eine Anzahl von Träumen, die während der Analysen vorfallen, sind unübersetzbar, wenngleich sie nicht gerade den Widerstand zur Schau tragen. Sie stellen freie Bearbeitungen der zugrunde liegenden latenten Traumgedanken vor und sind wohlgelungenen, künstlerisch überarbeiteten Dichtwerken vergleichbar, in denen man die Grundmotive zwar noch kenntlich, aber in beliebiger Durchrüttlung und Umwandlung verwendet findet. Solche Träume dienen in der Kur als Einleitung zu Gedanken und Erinnerungen des Träumers, ohne daß ihr Inhalt selbst in Betracht käme.
III
Man kann Träume von oben und Träume von unten unterscheiden, wenn man diesen Unterschied nicht zu scharf fassen will. Träume von unten sind solche, die durch die Stärke eines unbewußten (verdrängten) Wunsches angeregt werden, der sich eine Vertretung in irgendwelchen Tagesresten verschafft hat. Sie entsprechen Einbrüchen des Verdrängten in das Wachleben. Träume von oben sind Tagesgedanken oder Tagesabsichten gleichzustellen, denen es gelungen ist, sich nächtlicherweile eine Verstärkung aus dem vom Ich abgesprengten Verdrängten zu holen. Die Analyse sieht dann in der Regel von diesem unbewußten Helfer ab und vollzieht die Einreihung der latenten Traumgedanken in das Gefüge des Wachdenkens. Eine Abänderung der Theorie des Traumes wird durch diese Unterscheidung nicht erforderlich.
IV
In manchen Analysen oder während gewisser Strecken einer Analyse zeigt sich eine Sonderung des Traumlebens vom Wachleben, ähnlich wie die Absonderung der Phantasietätigkeit, die eine continued story (einen Tagtraumroman) unterhält, vom Wachdenken. Es knüpft dann ein Traum an den anderen an, nimmt ein Element zum Mittelpunkt, welches im vorhergehenden beiläufig gestreift wurde, u. dgl. Viel häufiger trifft aber der andere Fall zu, daß die Träume nicht aneinanderhängen, sondern sich in aufeinanderfolgende Stücke des Wachdenkens einschalten.
V
Die Deutung eines Traumes zerfällt in zwei Phasen, die Übersetzung und die Beurteilung oder Verwertung desselben. Während der ersten soll man sich durch keinerlei Rücksicht auf die zweite beeinflussen lassen. Es ist, wie wenn man ein Kapitel eines fremdsprachigen Autors vor sich hat, z. B. des Livius. Zuerst will man wissen, was Livius in diesem Kapitel erzählt, erst dann tritt die Diskussion ein, ob das Gelesene ein Geschichtsbericht ist oder eine Sage oder eine Abschweifung des Autors.
Welche Schlüsse darf man aber aus einem richtig übersetzten Traum ziehen? Ich habe den Eindruck, daß die analytische Praxis hierin Irrtümer und Überschätzungen nicht immer vermieden hat, und zwar zum Teil aus übergroßem Respekt vor dem »geheimnisvollen Unbewußten«.
Man vergißt zu leicht daran, daß ein Traum zumeist nur ein Gedanke ist wie ein anderer, ermöglicht durch den Nachlaß der Zensur und die unbewußte Verstärkung und entstellt durch die Einwirkung der Zensur und die unbewußte Bearbeitung.
Greifen wir das Beispiel der sogenannten Genesungsträume heraus. Wenn ein Patient einen solchen Traum gehabt hat, in dem er sich den Einschränkungen der Neurose zu entziehen scheint, z. B. eine Phobie überwindet oder eine Gefühlsbindung aufgibt, so sind wir geneigt zu glauben, er habe einen großen Fortschritt gemacht, sei bereit, sich in eine neue Lebenslage zu fügen, beginne mit seiner Gesundheit zu rechnen usw. Das mag oftmals richtig sein, aber ebensooft haben solche Genesungsträume nur den Wert von Bequemlichkeitsträumen, sie bedeuten den Wunsch, endlich gesund zu sein, um sich ein weiteres Stück der analytischen Arbeit, das sie als bevorstehend fühlen, zu ersparen. In solchem Sinn ereignen sich Genesungsträume z. B. recht häufig, wenn der Patient in eine neue, ihm peinliche Phase der Übertragung eintreten soll. Er benimmt sich dann ganz ähnlich wie manche Neurotiker, die sich nach wenigen Stunden Analyse für geheilt erklären, weil sie allem Unangenehmen entgehen wollen, das in der Analyse noch zur Sprache kommen soll. Auch die Kriegsneurotiker, die auf ihre Symptome verzichteten, weil ihnen die Therapie der Militärärzte das Kranksein noch unbehaglicher zu machen verstand, als sie den Dienst an der Front gefunden hatten, sind denselben ökonomischen Bedingungen gefolgt, und die Heilungen haben sich in beiden Fällen nicht haltbar erwiesen.
VI
Es ist gar nicht so leicht, allgemeine Entscheidungen über den Wert richtig übersetzter Träume zu fällen. Wenn beim Patienten ein Ambivalenzkonflikt besteht, so bedeutet ein feindseliger Gedanke, der in ihm auftaucht, gewiß nicht eine dauernde Überwindung der zärtlichen Regung, also eine Entscheidung des Konflikts, und ebensowenig hat ein Traum vom gleichen feindseligen Inhalt diese Bedeutung. Während eines solchen Ambivalenzkonflikts bringt oft jede Nacht zwei Träume, von denen jeder eine andere Stellung nimmt. Der Fortschritt besteht dann darin, daß eine gründliche Isolierung der beiden kontrastierenden Regungen gelungen ist und jede von ihnen mit Hilfe der unbewußten Verstärkung bis zu ihrem Extrem verfolgt und eingesehen werden kann. Mitunter ist der eine der beiden ambivalenten Träume vergessen worden, man darf sich dann nicht täuschen lassen und annehmen, daß nun die Entscheidung zugunsten der einen Seite gefallen ist. Das Vergessen des einen Traumes zeigt allerdings, daß für den Augenblick die eine Richtung die Oberhand hat, aber das gilt nur für den einen Tag und kann sich ändern. Die nächste Nacht bringt vielleicht die entgegengesetzte Äußerung in den Vordergrund. Wie der Konflikt wirklich steht, kann nur durch die Berücksichtigung aller anderen Kundgebungen auch des Wachlebens erraten werden.
VII
Mit der Frage nach der Wertung der Träume hängt die andere nach ihrer Beeinflußbarkeit durch ärztliche »Suggestion« innig zusammen. Der Analytiker wird vielleicht zuerst erschrecken, wenn er an diese Möglichkeit gemahnt wird; bei näherer Überlegung wird dieser Schreck gewiß der Einsicht weichen, die Beeinflussung der Träume des Patienten sei für den Analytiker nicht mehr Mißgeschick oder Schande als die Lenkung seiner bewußten Gedanken.
Daß der manifeste Inhalt der Träume durch die analytische Kur beeinflußt wird, braucht nicht erst bewiesen zu werden. Das folgt ja schon aus der Einsicht, daß der Traum ans Wachleben anknüpft und Anregungen desselben verarbeitet. Was in der analytischen Kur vorgeht, gehört natürlich auch zu den Eindrücken des Wachlebens und bald zu den stärksten desselben. Es ist also kein Wunder, daß der Patient von Dingen träumt, die der Arzt mit ihm besprochen und deren Erwartung er in ihm geweckt hat. Nicht mehr Wunder jedenfalls, als in der bekannten Tatsache der »experimentellen« Träume enthalten ist.
Das Interesse setzt sich nun dahin fort, ob auch die durch Deutung zu eruierenden latenten Traumgedanken vom Analytiker beeinflußt, suggeriert werden können. Die Antwort darauf muß wiederum lauten: Selbstverständlich ja, denn ein Anteil dieser latenten Traumgedanken entspricht vorbewußten, durchaus bewußtseinsfähigen Gedankenbildungen, mit denen der Träumer eventuell auch im Wachen auf die Anregungen des Arztes hätte reagieren können, mögen die Erwiderungen des Analysierten nun diesen Anregungen gleichgerichtet sein oder ihnen widerstreben. Ersetzt man den Traum durch die in ihm enthaltenen Traumgedanken, so fällt eben die Frage, wieweit man Träume suggerieren kann, mit der allgemeineren, inwieweit der Patient in der Analyse der Suggestion zugänglich ist, zusammen.
Auf den Mechanismus der Traumbildung selbst, auf die eigentliche Traumarbeit gewinnt man nie Einfluß; daran darf man festhalten.
Außer dem besprochenen Anteil der vorbewußten Traumgedanken enthält jeder richtige Traum Hinweise auf die verdrängten Wunschregungen, denen er seine Bildungsmöglichkeit verdankt. Der Zweifler wird zu diesen sagen, sie erscheinen im Traume, weil der Träumer weiß, daß er sie bringen soll, daß sie vom Analytiker erwartet werden. Der Analytiker selbst wird mit gutem Recht anders denken.
Wenn der Traum Situationen bringt, die auf Szenen aus der Vergangenheit des Träumers gedeutet werden können, scheint die Frage besonders bedeutsam, ob auch an diesen Trauminhalten der ärztliche Einfluß beteiligt sein kann. Am dringendsten wird diese Frage bei den sogenannten bestätigenden, der Analyse nachhinkenden Träumen. Bei manchen Patienten bekommt man keine anderen. Sie reproduzieren die vergessenen Erlebnisse ihrer Kindheit erst, nachdem man dieselben aus Symptomen, Einfällen und Andeutungen konstruiert und ihnen dies mitgeteilt hat. Das gibt dann die bestätigenden Träume, gegen welche aber der Zweifel sagt, sie seien ganz ohne Beweiskraft, da sie auf die Anregung des Arztes hin phantasiert sein mögen, anstatt aus dem Unbewußten des Träumers ans Licht gefördert zu sein. Ausweichen kann man in der Analyse dieser mehrdeutigen Situation nicht, denn wenn man bei diesen Patienten nicht deutet, konstruiert und mitteilt, findet man nie den Zugang zu dem bei ihnen Verdrängten.
Die Sachlage gestaltet sich günstig, wenn sich an die Analyse eines solchen nachhinkenden, bestätigenden Traumes unmittelbar Erinnerungsgefühle für das bisher Vergessene knüpfen.
Der Skeptiker hat dann den Ausweg, zu sagen, es seien Erinnerungstäuschungen. Meist sind auch solche Erinnerungsgefühle nicht vorhanden. Das Verdrängte wird nur stückweise durchgelassen, und jede Unvollständigkeit hemmt oder verzögert die Bildung einer Überzeugung. Auch kann es sich um die Reproduktion nicht einer wirklichen, vergessenen Begebenheit, sondern um die Förderung einer unbewußten Phantasie handeln, für welche ein Erinnerungsgefühl niemals zu erwarten ist, aber irgendeinmal ein Gefühl subjektiver Überzeugung möglich bleibt.
Können also die Bestätigungsträume wirklich Erfolge der Suggestion, also Gefälligkeitsträume sein? Die Patienten, welche nur Bestätigungsträume bringen, sind dieselben, bei denen der Zweifel die Rolle des hauptsächlichen Widerstandes spielt. Man macht nicht den Versuch, diesen Zweifel durch Autorität zu überschreien oder ihn mit Argumenten zu erschlagen. Er muß bestehenbleiben, bis er im weiteren Fortgang der Analyse zur Erledigung kommt. Auch der Analytiker darf im einzelnen Falle einen solchen Zweifel festhalten. Was ihn endlich sicher macht, ist gerade die Komplikation der ihm gestellten Aufgabe, die der Lösung eines der »Puzzles« genannten Kinderspiele vergleichbar ist. Dort ist eine farbige Zeichnung, die auf ein Holzbrettchen geklebt ist und genau in einen Holzrahmen paßt, in viele Stücke zerschnitten worden, die von den unregelmäßigsten krummen Linien begrenzt werden. Gelingt es, den unordentlichen Haufen von Holzplättchen, deren jedes ein unverständliches Stück Zeichnung trägt, so zu ordnen, daß die Zeichnung sinnvoll wird, daß nirgends eine Lücke zwischen den Fugen bleibt und daß das Ganze den Rahmen ausfüllt, sind alle diese Bedingungen erfüllt, so weiß man, daß man die Lösung des Puzzle gefunden hat und daß es keine andere gibt.
Ein solcher Vergleich kann natürlich dem Analysierten während der unvollendeten analytischen Arbeit nichts bedeuten. Ich erinnere mich hier an eine Diskussion, die ich mit einem Patienten zu führen hatte, dessen außerordentliche Ambivalenzeinstellung sich im stärksten zwanghaften Zweifel äußerte. Er bestritt die Deutungen seiner Träume nicht und war von deren Übereinstimmung mit den von mir geäußerten Mutmaßungen sehr ergriffen. Aber er fragte, ob diese bestätigenden Träume nicht Ausdruck seiner Gefügigkeit gegen mich sein könnten. Als ich geltend machte, daß diese Träume auch eine Summe von Einzelheiten gebracht hätten, die ich nicht ahnen konnte, und daß sein sonstiges Benehmen in der Kur gerade nicht von Gefügigkeit zeugte, wandte er sich zu einer anderen Theorie und fragte, ob nicht sein narzißtischer Wunsch, gesund zu werden, ihn veranlaßt haben könne, solche Träume zu produzieren, da ich ihm doch die Genesung in Aussicht gestellt habe, wenn er meine Konstruktionen annehmen könne. Ich mußte antworten, mir sei von einem solchen Mechanismus der Traumbildung noch nichts bekanntworden, aber die Entscheidung kam auf anderem Wege. Er erinnerte sich an Träume, die er gehabt, ehe er in die Analyse eintrat, ja, ehe er etwas von ihr erfahren hatte, und die Analyse dieser vom Suggestionsverdacht freien Träume ergab dieselben Deutungen wie der späteren. Sein Zwang zum Widerspruch fand zwar noch den Ausweg, die früheren Träume seien minder deutlich gewesen als die während der Kur vorgefallenen, aber mir genügte die Übereinstimmung. Ich meine, es ist überhaupt gut, gelegentlich daran zu denken, daß die Menschen auch schon zu träumen pflegten, ehe es eine Psychoanalyse gab.
VIII
Es könnte wohl sein, daß es den Träumen in einer Psychoanalyse in ausgiebigerem Maße gelingt, das Verdrängte zum Vorschein zu bringen, als den Träumen außerhalb dieser Situation. Aber es ist nicht zu erweisen, denn die beiden Situationen sind nicht vergleichbar; die Verwertung in der Analyse ist eine Absicht, die dem Traume ursprünglich ganz ferneliegt. Dagegen kann es nicht zweifelhaft sein, daß innerhalb einer Analyse weit mehr des Verdrängten im Anschluß an Träume zutage gefördert wird als mit Hilfe der anderen Methoden; für solche Mehrleistung muß es einen Motor geben, eine unbewußte Macht, welche während des Schlafzustandes besser als sonst imstande ist, die Absichten der Analyse zu unterstützen. Nun kann man hiefür kaum einen anderen Faktor in Anspruch nehmen als die aus dem Elternkomplex stammende Gefügigkeit des Analysierten gegen den Analytiker, also den positiven Anteil der von uns so genannten Übertragung, und in der Tat läßt sich an vielen Träumen, die Vergessenes und Verdrängtes wiederbringen, kein anderer unbewußter Wunsch entdecken, dem man die Triebkraft für die Traumbildung zuschreiben könnte. Will also jemand behaupten, daß die meisten der in der Analyse verwertbaren Träume Gefälligkeitsträume sind und der Suggestion ihre Entstehung verdanken, so ist vom Standpunkt der analytischen Theorie nichts dagegen einzuwenden. Ich brauche dann nur noch auf die Erörterungen in meinen Vorlesungen zur Einführung zu verweisen, in denen das Verhältnis der Übertragung zur Suggestion behandelt und dargetan wird, wie wenig die Anerkennung der Suggestionswirkung in unserem Sinne die Zuverlässigkeit unserer Resultate schädigt.
Ich habe mich in der Schrift Jenseits des Lustprinzips mit dem ökonomischen Problem beschäftigt, wie es den in jeder Hinsicht peinlichen Erlebnissen der frühinfantilen Sexualperiode gelingen kann, sich zu irgendeiner Art von Reproduktion durchzuringen. Ich mußte ihnen im »Wiederholungszwang« einen außerordentlich starken Auftrieb zugestehen, der die im Dienst des Lustprinzips auf ihnen lastende Verdrängung bewältigt, aber doch nicht eher, »als bis die entgegenkommende Arbeit der Kur die Verdrängung gelockert« hat. Hier wäre einzuschalten, daß es die positive Übertragung ist, welche dem Wiederholungszwang diese Hilfe leistet. Es ist dabei zu einem Bündnis der Kur mit dem Wiederholungszwang gekommen, welches sich zunächst gegen das Lustprinzip richtet, aber in letzter Absicht die Herrschaft des Realitätsprinzips aufrichten will. Wie ich dort ausgeführt habe, ereignet es sich nur allzu häufig, daß sich der Wiederholungszwang von den Verpflichtungen dieses Bundes frei macht und sich nicht mit der Wiederkehr des Verdrängten in der Form von Traumbildern begnügt.
IX
Soweit ich bis jetzt sehe, ergeben die Träume bei traumatischer Neurose die einzige wirkliche, die Strafträume die einzige scheinbare Ausnahme von der wunscherfüllenden Tendenz des Traumes. Bei diesen letzteren stellt sich der merkwürdige Tatbestand her, daß eigentlich nichts von den latenten Traumgedanken in den manifesten Trauminhalt aufgenommen wird, sondern daß an deren Stelle etwas ganz anderes tritt, was als eine Reaktionsbildung gegen die Traumgedanken, als Ablehnung und voller Widerspruch gegen sie beschrieben werden muß. Ein solches Einschreiten gegen den Traum kann man nur der kritischen Ichinstanz zutrauen und muß daher annehmen, daß diese, durch die unbewußte Wunscherfüllung gereizt, sich zeitweilig auch während des Schlafzustandes wiederhergestellt hat. Sie hätte auf diesen unerwünschten Trauminhalt auch mit Erwachen reagieren können, fand aber in der Bildung des Straftraumes einen Weg, die Schlafstörung zu vermeiden.
So ist also z. B. für die bekannten Träume des Dichters Rosegger, die ich in der Traumdeutung erwähne, ein unterdrückter Text von hochmütigem, prahlerischem Inhalt zu vermuten, der wirkliche Traum aber hielt ihm vor: »Du bist ein unfähiger Schneidergeselle.« Es wäre natürlich unsinnig, nach einer verdrängten Wunschregung als Triebkraft dieses manifesten Traumes zu suchen; man muß sich mit der Wunscherfüllung der Selbstkritik begnügen.
Das Befremden über einen derartigen Aufbau des Traumes ermäßigt sich, wenn man bedenkt, wie geläufig es der Traumentstellung im Dienste der Zensur ist, für ein einzelnes Element etwas einzusetzen, was in irgendeinem Sinne sein Gegenteil oder Gegensatz ist. Von da ab ist es nur ein kurzer Weg bis zur Ersetzung eines charakteristischen Stückes Trauminhalt durch einen abwehrenden Widerspruch, und ein Schritt weiter führt zur Ersetzung des ganzen anstößigen Trauminhaltes durch den Straftraum. Von dieser mittleren Phase der Verfälschung des manifesten Inhaltes möchte ich ein oder zwei charakteristische Beispiele mitteilen.
Aus dem Traum eines Mädchens mit starker Vaterfixierung, welches sich in der Analyse schwer ausspricht: Sie sitzt im Zimmer mit einer Freundin, nur mit einem Kimono bekleidet. Ein Herr kommt herein, vor dem sie sich geniert. Der Herr sagt aber: »Das ist ja das Mädchen, das wir schon einmal so schön bekleidet gesehen haben.« –; Der Herr bin ich, in weiterer Zurückführung der Vater. Mit dem Traum ist aber nichts zu machen, solange wir uns nicht entschließen, in der Rede des Herrn das wichtigste Element durch seinen Gegensatz zu ersetzen: »Das ist das Mädchen, das ich schon einmal unbekleidet und dann so schön gesehen habe.« Sie hat als Kind von drei bis vier Jahren eine Zeitlang im selben Zimmer mit dem Vater geschlafen, und alle Anzeichen deuten darauf hin, daß sie sich damals im Schlaf aufzudecken pflegte, um dem Vater zu gefallen. Die seitherige Verdrängung ihrer Exhibitionslust motiviert heute ihre Verschlossenheit in der Kur, ihre Unlust, sich unverhüllt zu zeigen.
Aus einer anderen Szene desselben Traumes: Sie liest ihre eigene, im Druck vorliegende Krankengeschichte. Darin steht, daß ein junger Mann seine Geliebte ermordet –; Kakao –; das gehört zur Analerotik. Das letztere ist ein Gedanke, den sie im Traum bei der Erwähnung des Kakao hat. –; Die Deutung dieses Traumstückes ist noch schwieriger als die des vorigen. Man erfährt endlich, daß sie vor dem Einschlafen die ›Geschichte einer infantilen Neurose‹ (fünfte Folge der Sammlung kleiner Schriften) gelesen hat, in welcher eine reale oder phantasierte Koitusbeobachtung der Eltern den Mittelpunkt bildet. Diese Krankengeschichte hat sie schon früher einmal auf die eigene Person bezogen, nicht das einzige Anzeichen, daß auch bei ihr eine solche Beobachtung in Betracht kommt. Der junge Mann, der seine Geliebte ermordet, ist nun eine deutliche Anspielung auf die sadistische Auffassung der Koitusszene, aber das nächste Element, der Kakao, geht weit davon ab. Zum Kakao weiß sie nur zu assoziieren, daß ihre Mutter zu sagen pflegt, vom Kakao bekomme man Kopfweh, auch von anderen Frauen will sie das gleiche gehört haben. Übrigens hat sie sich eine Zeitlang durch ebensolche Kopfschmerzen mit der Mutter identifiziert. Ich kann nun keine andere Verknüpfung der beiden Traumelemente finden als durch die Annahme, daß sie von den Folgerungen aus der Koitusbeobachtung ablenken will. Nein, das hat nichts mit der Kinderzeugung zu tun. Die Kinder kommen von etwas, das man ißt (wie im Märchen), und die Erwähnung der Analerotik, die wie ein Deutungsversuch im Traum aussieht, vervollständigt die zu Hilfe gerufene infantile Theorie durch die Hinzufügung der analen Geburt.
X
Man hört gelegentlich Verwunderung darüber äußern, daß das Ich des Träumers zwei- oder mehrmals im manifesten Traum erscheint, einmal in eigener Person und die anderen Male hinter anderen Personen versteckt. Die sekundäre Bearbeitung hat während der Traumbildung offenbar das Bestreben gehabt, diese Vielheit des Ichs, welche in keine szenische Situation paßt, auszumerzen, durch die Deutungsarbeit wird sie aber wiederhergestellt. Sie ist an sich nicht merkwürdiger als das mehrfache Vorkommen des Ichs in einem wachen Gedanken, zumal wenn sich dabei das Ich in Subjekt und Objekt zerlegt, sich als beobachtende und kritische Instanz dem anderen Anteil gegenüberstellt oder sein gegenwärtiges Wesen mit einem erinnerten, vergangenen, das auch einmal Ich war, vergleicht. So z. B. in den Sätzen: »Wenn ich daran denke, was ich diesem Menschen getan habe« und: »Wenn ich daran denke, daß ich auch einmal ein Kind war.« Daß aber alle Personen, die im Traume vorkommen, als Abspaltungen und Vertretungen des eigenen Ichs zu gelten haben, möchte ich als eine inhaltslose und unberechtigte Spekulation zurückweisen. Es genügt uns, daran festzuhalten, daß die Sonderung des Ichs von einer beobachtenden, kritisierenden, strafenden Instanz (Ichideal) auch für die Traumdeutung in Betracht kommt.
Brief an Romain Rolland (1936)
( Eine erinnerungsstörung auf der akropolis)
Verehrter Freund!
Dringend aufgefordert, etwas Geschriebenes zur Feier Ihres siebzigsten Geburtstages beizutragen, habe ich mich lange bemüht, etwas zu finden, was Ihrer in irgendeinem Sinne würdig wäre, was meiner Bewunderung Ausdruck geben könnte für Ihre Wahrheitsliebe, Ihren Bekennermut, Ihre Menschenfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Oder was die Dankbarkeit für den Dichter bezeugen würde, der mir soviel Genuß und Erhebung geschenkt hat. Es war vergeblich; ich bin um ein Jahrzehnt älter als Sie, meine Produktion ist versiegt. Was ich Ihnen schließlich zu bieten habe, ist die Gabe eines Verarmten, der »einst bessere Tage gesehen hat«.
Sie wissen, meine wissenschaftliche Arbeit hatte sich das Ziel gesetzt, ungewöhnliche, abnorme, pathologische Erscheinungen des Seelenlebens aufzuklären, das heißt, sie auf die hinter ihnen wirkenden psychischen Kräfte zurückzuführen und die dabei tätigen Mechanismen aufzuzeigen. Ich versuchte dies zunächst an der eigenen Person, dann auch an anderen und endlich in kühnem Übergriff auch am Menschengeschlecht im ganzen. Ein solches Phänomen, das ich vor einem Menschenalter, im Jahre 1904, an mir erlebt und nie verstanden hatte, tauchte in den letzten Jahren in meiner Erinnerung immer wieder auf; ich wußte zunächst nicht warum. Ich entschloß mich endlich, das kleine Erlebnis zu analysieren, und teile Ihnen hier das Ergebnis dieser Studie mit. Dabei muß ich Sie natürlich bitten, den Angaben aus meinem persönlichen Leben mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als sie sonst verdienten.
Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis
Ich pflegte damals alljährlich Ende August oder Anfang September mit meinem jüngeren Bruder eine Ferienreise anzutreten, die mehrere Wochen dauerte und uns nach Rom, irgendeiner Gegend des Landes Italien oder an eine Küste des Mittelmeeres führte. Mein Bruder ist zehn Jahre jünger als ich, also gleichaltrig mit Ihnen –; ein Zusammentreffen, das mir erst jetzt auffällt. In diesem Jahr erklärte mein Bruder, seine Geschäfte erlaubten ihm keine längere Abwesenheit, er könnte höchstens eine Woche ausbleiben, wir müßten unsere Reise abkürzen. So beschlossen wir, über Triest nach der Insel Korfu zu fahren und unsere wenigen Urlaubstage dort zu verbringen. In Triest besuchte er einen dort ansässigen Geschäftsfreund, ich begleitete ihn. Der freundliche Mann erkundigte sich auch nach unseren weiteren Absichten, und als er hörte, daß wir nach Korfu wollten, riet er uns dringend ab. »Was wollen Sie um diese Zeit dort machen? Es ist so heiß, daß Sie nichts unternehmen können. Gehen Sie doch lieber nach Athen. Der Lloyddampfer geht heute nachmittags ab, läßt Ihnen drei Tage Zeit, um die Stadt zu sehen, und holt Sie auf seiner Rückfahrt ab. Das wird lohnender und angenehmer sein.«
Als wir den Triestiner verlassen hatten, waren wir beide in merkwürdig übler Stimmung. Wir diskutierten den uns vorgeschlagenen Plan, fanden ihn durchaus unzweckmäßig und sahen nur Hindernisse gegen seine Ausführung, nahmen auch an, daß wir ohne Reisepässe in Griechenland nicht eingelassen würden. Die Stunden bis zur Eröffnung des Lloydbureaus wanderten wir mißvergnügt und unentschlossen in der Stadt herum. Aber als die Zeit gekommen war, gingen wir an den Schalter und lösten Schiffskarten nach Athen, wie selbstverständlich, ohne uns um die vorgeblichen Schwierigkeiten zu kümmern, ja ohne daß wir die Gründe für unsere Entscheidung gegeneinander ausgesprochen hätten. Dies Benehmen war doch sehr sonderbar. Wir anerkannten später, daß wir den Vorschlag, nach Athen anstatt nach Korfu zu gehen, sofort und bereitwilligst angenommen hatten. Warum hatten wir uns also die Zwischenzeit bis zur Öffnung der Schalter durch üble Laune verstört und uns nur Abhaltungen und Schwierigkeiten vorgespiegelt?
Als ich dann am Nachmittag nach der Ankunft auf der Akropolis stand und mein Blick die Landschaft umfaßte, kam mir plötzlich der merkwürdige Gedanke: Also existiert das alles wirklich so, wie wir es auf der Schule gelernt haben?! Genauer beschrieben, die Person, die eine Äußerung tat, sonderte sich, weit schärfer als sonst merklich, von einer anderen, die diese Äußerung wahrnahm, und beide waren verwundert, wenn auch nicht über das gleiche. Die eine benahm sich so, als müßte sie unter dem Eindruck einer unzweifelhaften Beobachtung an etwas glauben, dessen Realität ihr bis dahin unsicher erschienen war. Mit einer mäßigen Übertreibung: als ob jemand, entlang des schottischen Loch Ness spazierend, plötzlich den ans Land gespülten Leib des vielberedeten Ungeheuers vor sich sähe und sich zum Zugeständnis gezwungen fände: Also existiert sie wirklich, die Seeschlange, an die wir nicht geglaubt haben! Die andere Person war aber mit Recht erstaunt, weil sie nicht gewußt hatte, daß die reale Existenz von Athen, der Akropolis und dieser Landschaft jemals ein Gegenstand des Zweifels gewesen war. Sie war eher auf eine Äußerung der Entzückung und Erhebung vorbereitet.
Es liegt nun nahe zu sagen, der befremdliche Gedanke auf der Akropolis wolle nur betonen, es sei doch etwas ganz anderes, wenn man etwas mit eigenen Augen sehe, als wenn man nur davon höre oder lese. Aber das bliebe eine sehr sonderbare Einkleidung eines uninteressanten Gemeinplatzes. Oder man könnte die Behauptung wagen, man habe als Gymnasiast zwar gemeint, man sei von der historischen Wirklichkeit der Stadt Athen und ihrer Geschichte überzeugt gewesen, aber aus jenem Einfall auf der Akropolis erfahre man eben, daß man damals im Unbewußten nicht daran geglaubt habe; erst jetzt habe man sich auch eine »ins Unbewußte reichende« Überzeugung erworben. Eine solche Erklärung klingt sehr tiefsinnig, aber sie ist leichter aufzustellen als zu erweisen, wird auch theoretisch recht angreifbar sein. Nein, ich meine, die beiden Phänomene, die Verstimmung in Triest und der Einfall auf der Akropolis gehören innig zusammen. Das erstere davon ist leichter verständlich und mag uns zur Erklärung des späteren verhelfen.
Das Erlebnis in Triest ist, wie ich merke, auch nur der Ausdruck eines Unglaubens. »Wir sollen Athen zu sehen bekommen? Aber das geht ja nicht, es wird zu schwierig sein.« Die begleitende Verstimmung entspricht dann dem Bedauern darüber, daß es nicht geht. Es wäre ja so schön gewesen! Und nun versteht man, woran man ist. Es ist ein Fall von » too good to be true«, wie er uns so geläufig ist. Ein Fall von jenem Unglauben, der sich so häufig zeigt, wenn man durch eine glückbringende Nachricht überrascht wird, daß man einen Treffer gemacht, einen Preis gewonnen hat, für ein Mädchen, daß der heimlich geliebte Mann bei den Eltern als Bewerber aufgetreten ist, u. dgl.
Ein Phänomen konstatieren, läßt natürlich sofort die Frage nach seiner Verursachung entstehen. Ein solcher Unglaube ist offenbar ein Versuch, ein Stück der Realität abzulehnen, aber es ist etwas daran befremdend. Wir würden gar nicht erstaunt sein, wenn sich ein solcher Versuch gegen ein Stück Realität richten sollte, das Unlust zu bringen droht; unser psychischer Mechanismus ist darauf sozusagen eingerichtet. Aber warum ein derartiger Unglaube gegen etwas, was im Gegenteil hohe Lust verspricht? Ein wirklich paradoxes Verhalten! Ich erinnere mich aber, daß ich bereits früher einmal den ähnlichen Fall jener Personen behandelt habe, die, wie ich es ausdrückte, »am Erfolge scheitern«. Sonst erkrankt man in der Regel an der Versagung, der Nichterfüllung eines lebenswichtigen Bedürfnisses oder Wunsches; bei diesen Personen ist es aber umgekehrt, sie erkranken, gehen selbst daran zugrunde, daß ihnen ein überwältigend starker Wunsch erfüllt worden ist. Die Gegensätzlichkeit der beiden Situationen ist aber nicht so groß, wie es anfangs scheint. Im paradoxen Falle ist einfach eine innere Versagung an die Stelle der äußeren getreten. Man gönnt sich das Glück nicht, die innere Versagung befiehlt, an der äußeren festzuhalten. Warum aber? Weil, so lautet in einer Reihe von Fällen die Antwort, man sich vom Schicksal etwas so Gutes nicht erwarten kann. Also wiederum das » too good to be true«, die Äußerung eines Pessimismus, von dem viele von uns ein großes Stück in sich zu beherbergen scheinen. In anderen Fällen ist es ganz so wie bei denen, die am Erfolg scheitern, ein Schuld- oder Minderwertigkeitsgefühl, das man übersetzen kann: Ich bin eines solchen Glückes nicht würdig, ich verdiene es nicht. Aber diese beiden Motivierungen sind im Grunde das nämliche, die eine nur eine Projektion der anderen. Denn, wie längst bekannt, ist das Schicksal, von dem man sich so schlechte Behandlung erwartet, eine Materialisation unseres Gewissens, des strengen Über-Ichs in uns, in dem sich die strafende Instanz unserer Kindheit niedergeschlagen hat.
Damit wäre, meine ich, unser Benehmen in Triest erklärt. Wir konnten nicht glauben, daß uns die Freude bestimmt sein sollte, Athen zu sehen. Daß das Stück Realität, das wir ablehnen wollten, zunächst nur eine Möglichkeit war, bestimmte die Eigentümlichkeiten unserer damaligen Reaktion. Als wir dann auf der Akropolis standen, war die Möglichkeit zur Wirklichkeit geworden, und derselbe Unglaube fand nun einen veränderten, aber weit deutlicheren Ausdruck. Dieser hätte ohne Entstellung lauten sollen: Ich hätte wirklich nicht geglaubt, daß es mir je gegönnt sein würde, Athen mit meinen eigenen Augen zu sehen, wie es doch jetzt unzweifelhaft der Fall ist! Wenn ich mich erinnere, welche glühende Sehnsucht, zu reisen und die Welt zu sehen, mich in der Gymnasialzeit und später beherrscht hatte und wie spät sie sich in Erfüllung umzusetzen begann, verwundere ich mich dieser Nachwirkung auf der Akropolis nicht; ich war damals achtundvierzig Jahre alt. Ich habe meinen jüngeren Bruder nicht befragt, ob er ähnliches wie ich verspürt. Eine gewisse Scheu lag über dem ganzen Erlebnis, sie hatte schon in Triest unseren Gedankenaustausch behindert.
Wenn ich aber den Sinn meines Einfalls auf der Akropolis richtig erraten habe, er drücke meine freudige Verwunderung darüber aus, daß ich mich jetzt an diesem Ort befinde, so erhebt sich die weitere Frage, warum dieser Sinn im Einfall eine so entstellte und entstellende Einkleidung erfahren hat.
Der wesentliche Inhalt des Gedankens ist auch in der Entstellung erhalten geblieben, es ist ein Unglaube. »Nach dem Zeugnis meiner Sinne stehe ich jetzt auf der Akropolis, allein ich kann es nicht glauben.« Dieser Unglaube, dieser Zweifel an einem Stück der Realität, wird aber in der Äußerung in zweifacher Weise verschoben, erstens in die Vergangenheit gerückt und zweitens von meiner Beziehung zur Akropolis weg auf die Existenz der Akropolis selbst verlegt. So kommt etwas zustande, was der Behauptung gleichkommt, ich hätte früher einmal an der realen Existenz der Akropolis gezweifelt, was meine Erinnerung aber als unrichtig, ja als unmöglich ablehnt.
Die beiden Entstellungen bedeuten zwei voneinander unabhängige Probleme. Man kann versuchen, tiefer in den Umsetzungsprozeß einzudringen. Ohne näher anzugeben, wie ich dazu komme, will ich davon ausgehen, das Ursprüngliche müsse eine Empfindung gewesen sein, daß an der damaligen Situation etwas Unglaubwürdiges und Unwirkliches zu verspüren sei. Die Situation umfaßt meine Person, die Akropolis und meine Wahrnehmung derselben. Ich weiß diesen Zweifel nicht unterzubringen, ich kann ja meine Sinneseindrücke von der Akropolis nicht in Zweifel ziehen. Ich erinnere mich aber, daß ich in der Vergangenheit an etwas gezweifelt, was mit eben dieser Örtlichkeit zu tun hatte, und finde so die Auskunft, den Zweifel in die Vergangenheit zu versetzen. Aber dabei ändert der Zweifel seinen Inhalt. Ich erinnere mich nicht einfach daran, daß ich in frühen Jahren daran gezweifelt, ob ich je die Akropolis selbst sehen werde, sondern ich behaupte, daß ich damals überhaupt nicht an die Realität der Akropolis geglaubt habe. Grade aus diesem Ergebnis der Entstellung ziehe ich den Schluß, daß die gegenwärtige Situation auf der Akropolis ein Element von Zweifel an der Realität enthalten hat. Es ist mir bisher gewiß nicht gelungen, den Hergang klarzumachen, darum will ich kurz abschließend sagen, die ganze anscheinend verworrene und schwer darstellbare psychische Situation löst sich glatt durch die Annahme, daß ich damals auf der Akropolis einen Moment lang das Gefühl hatte –; oder hätte haben können: was ich da sehe, ist nicht wirklich. Man nennt das ein »Entfremdungsgefühl«. Ich machte einen Versuch, mich dessen zu erwehren, und es gelang mir auf Kosten einer falschen Aussage über die Vergangenheit.
Diese Entfremdungen sind sehr merkwürdige, noch wenig verstandene Phänomene. Man beschreibt sie als »Empfindungen«, aber es sind offenbar komplizierte Vorgänge, an bestimmte Inhalte geknüpft und mit Entscheidungen über diese Inhalte verbunden. Bei gewissen psychischen Erkrankungen sehr häufig, sind sie doch auch dem normalen Menschen nicht unbekannt, etwa wie die gelegentlichen Halluzinationen der Gesunden. Aber sie sind doch gewiß Fehlleistungen, von abnormem Aufbau wie die Träume, die ungeachtet ihres regelmäßigen Vorkommens beim Gesunden uns als Vorbilder seelischer Störung gelten. Man beobachtet sie in zweierlei Formen; entweder erscheint uns ein Stück der Realität als fremd oder ein Stück des eigenen Ichs. In letzterem Fall spricht man von »Depersonalisation«; Entfremdungen und Depersonalisationen gehören innig zusammen. Es gibt andere Phänomene, in denen wir gleichsam die positiven Gegenstücke zu ihnen erkennen mögen, die sog. » fausse reconnaissance«, das » déjà vu«, » déjà raconté«, Täuschungen, in denen wir etwas als zu unserem Ich gehörig annehmen wollen, wie wir bei den Entfremdungen etwas von uns auszuschließen bemüht sind. Ein naiv-mystischer, unpsychologischer Erklärungsversuch will die Phänomene des déjà vu als Beweise für frühere Existenzen unseres seelischen Ichs verwerten. Von der Depersonalisation führt der Weg zu der höchst merkwürdigen » double conscience«, die man richtiger »Persönlichkeitsspaltung« benennt. Das ist alles noch so dunkel, so wenig wissenschaftlich bezwungen, daß ich mir verbieten muß, es vor Ihnen weiter zu erörtern.
Es genügt meiner Absicht, wenn ich auf zwei allgemeine Charaktere der Entfremdungsphänomene zurückkomme. Der erste ist, sie dienen alle der Abwehr, wollen etwas vom Ich fernhalten, verleugnen. Nun kommen von zwei Seiten her neue Elemente an das Ich heran, die zur Abwehr auffordern können, aus der realen Außenwelt und aus der Innenwelt der im Ich auftauchenden Gedanken und Regungen. Vielleicht deckt diese Alternative die Unterscheidung zwischen den eigentlichen Entfremdungen und den Depersonalisationen. Es gibt eine außerordentliche Fülle von Methoden, Mechanismen sagen wir, deren sich unser Ich bei der Erledigung seiner Abwehraufgaben bedient. In meiner nächsten Nähe erwächst jetzt eine Arbeit, die sich mit dem Studium dieser Abwehrmethoden beschäftigt; meine Tochter, die Kinderanalytikerin, schreibt eben ein Buch darüber. Von der primitivsten und gründlichsten dieser Methoden, von der »Verdrängung«, hat unsere Vertiefung in die Psychopathologie überhaupt ihren Ausgang genommen. Zwischen der Verdrängung und der normal zu nennenden Abwehr des Peinlich-Unerträglichen durch Anerkennung, Überlegung, Urteil und zweckmäßiges Handeln liegt eine große Reihe von Verhaltungsweisen des Ichs von mehr oder weniger deutlich pathologischem Charakter. Darf ich bei einem Grenzfall einer solchen Abwehr verweilen? Sie kennen das berühmte Klagelied der spanischen Mauren › Ay de mi Alhama‹, das erzählt, wie der König Boabdil die Nachricht vom Fall seiner Stadt Alhama aufnimmt. Er ahnt, daß dieser Verlust das Ende seiner Herrschaft bedeutet. Aber er will es nicht »wahr haben«, er beschließt, die Nachricht als » non arrivé« zu behandeln. Die Strophe lautet:
Cartas le fueron venidas que Alhama era ganada: las cartas echo en el fuego y al mensajero matara.
Man errät leicht, daß an diesem Benehmen des Königs das Bedürfnis mitbeteiligt ist, dem Gefühl seiner Ohnmacht zu widerstreiten. Indem er die Briefe verbrennt und den Boten töten läßt, sucht er noch seine Machtvollkommenheit zu demonstrieren.
Der andere allgemeine Charakter der Entfremdungen, ihre Abhängigkeit von der Vergangenheit, von dem Erinnerungsschatz des Ichs und früheren peinlichen Erlebnissen, die vielleicht seither der Verdrängung anheimgefallen sind, wird ihnen nicht ohne Einspruch zugestanden. Aber grade mein Erlebnis auf der Akropolis, das ja in eine Erinnerungsstörung, eine Verfälschung der Vergangenheit ausgeht, hilft uns dazu, diesen Einfluß aufzuzeigen. Es ist nicht wahr, daß ich in den Gymnasialjahren je an der realen Existenz von Athen gezweifelt habe. Ich habe nur daran gezweifelt, daß ich Athen je werde sehen können. So weit zu reisen, es »so weit zu bringen«, erschien mir als außerhalb jeder Möglichkeit. Das hing mit der Enge und Armseligkeit unserer Lebensverhältnisse in meiner Jugend zusammen. Die Sehnsucht zu reisen war gewiß auch ein Ausdruck des Wunsches, jenem Druck zu entkommen, verwandt dem Drang, der so viel halbwüchsige Kinder dazu antreibt, vom Hause durchzugehen. Es war mir längst klar geworden, daß ein großes Stück der Lust am Reisen in der Erfüllung dieser frühen Wünsche besteht, also in der Unzufriedenheit mit Haus und Familie wurzelt. Wenn man zuerst das Meer sieht, den Ozean überquert, Städte und Länder als Wirklichkeiten erlebt, die so lange ferne, unerreichbare Wunschdinge waren, so fühlt man sich wie ein Held, der unwahrscheinlich große Taten vollbracht hat. Ich hätte damals auf der Akropolis meinen Bruder fragen können: Weißt Du noch, wie wir in unserer Jugend Tag für Tag denselben Weg gegangen sind, von der ...straße ins Gymnasium, am Sonntage dann jedesmal in den Prater oder auf eine der Landpartien, die wir schon so gut kannten, und jetzt sind wir in Athen und stehen auf der Akropolis! Wir haben es wirklich weit gebracht! Und wenn man so Kleines mit Größerem vergleichen darf, hat nicht der erste Napoleon während der Kaiserkrönung in Notre-Dame sich zu einem seiner Brüder gewendet –; es wird wohl der älteste, Josef, gewesen sein –; und bemerkt: »Was würde Monsieur notre Père dazu sagen, wenn er jetzt dabei sein könnte?«
Hier stoßen wir aber auf die Lösung des kleinen Problems, warum wir uns schon in Triest das Vergnügen an der Reise nach Athen verstört hatten. Es muß so sein, daß sich an die Befriedigung, es so weit gebracht zu haben, ein Schuldgefühl knüpft; es ist etwas dabei, was unrecht, was von alters her verboten ist. Das hat mit der kindlichen Kritik am Vater zu tun, mit der Geringschätzung, welche die frühkindliche Überschätzung seiner Person abgelöst hatte. Es sieht aus, als wäre es das Wesentliche am Erfolg, es weiter zu bringen als der Vater, und als wäre es noch immer unerlaubt, den Vater übertreffen zu wollen.
Zu dieser allgemein giltigen Motivierung kommt noch für unseren Fall das besondere Moment hinzu, daß in dem Thema Athen und Akropolis an und für sich ein Hinweis auf die Überlegenheit der Söhne enthalten ist. Unser Vater war Kaufmann gewesen, er besaß keine Gymnasialbildung, Athen konnte ihm nicht viel bedeuten. Was uns im Genuß der Reise nach Athen störte, war also eine Regung der Pietät. Und jetzt werden Sie sich nicht mehr verwundern, daß mich die Erinnerung an das Erlebnis auf der Akropolis so oft heimsucht, seitdem ich selbst alt, der Nachsicht bedürftig geworden bin und nicht mehr reisen kann.
Ich grüße Sie herzlich, Ihr
Sigm. Freud
Jänner 1936.
Charakter und Analerotik (1908)
Unter den Personen, denen man durch psychoanalytische Bemühung Hilfe zu leisten sucht, begegnet man eigentlich recht häufig einem Typus, der durch das Zusammentreffen bestimmter Charaktereigenschaften ausgezeichnet ist, während das Verhalten einer gewissen Körperfunktion und der an ihr beteiligten Organe in der Kindheit dieser Personen die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich weiß heute nicht mehr anzugeben, aus welchen einzelnen Veranlassungen mir der Eindruck erwuchs, daß zwischen jenem Charakter und diesem Organverhalten ein organischer Zusammenhang bestehe, aber ich kann versichern, daß theoretische Erwartung keinen Anteil an diesem Eindrucke hatte.
Infolge gehäufter Erfahrung hat sich der Glaube an solchen Zusammenhang bei mir so sehr verstärkt, daß ich von ihm Mitteilung zu machen wage.
Die Personen, die ich beschreiben will, fallen dadurch auf, daß sie in regelmäßiger Vereinigung die nachstehenden drei Eigenschaften zeigen: sie sind besonders ordentlich, sparsam und eigensinnig. Jedes dieser Worte deckt eigentlich eine kleine Gruppe oder Reihe von miteinander verwandten Charakterzügen. »Ordentlich« begreift sowohl die körperliche Sauberkeit als auch Gewissenhaftigkeit in kleinen Pflichterfüllungen und Verläßlichkeit; das Gegenteil davon wäre: unordentlich, nachlässig. Die Sparsamkeit kann bis zum Geize gesteigert erscheinen; der Eigensinn geht in Trotz über, an den sich leicht Neigung zur Wut und Rachsucht knüpfen. Die beiden letzteren Eigenschaften –; Sparsamkeit und Eigensinn –; hängen fester miteinander als mit dem ersten, dem »ordentlich«, zusammen; sie sind auch das konstantere Stück des ganzen Komplexes, doch erscheint es mir unabweisbar, daß irgendwie alle drei zusammengehören.
Aus der Kleinkindergeschichte dieser Personen erfährt man leicht, daß sie verhältnismäßig lange dazu gebraucht haben, bis sie der infantilen incontinentia alvi Herr geworden sind, und daß sie vereinzeltes Mißglücken dieser Funktion noch in späteren Kinderjahren zu beklagen hatten. Sie scheinen zu jenen Säuglingen gehört zu haben, die sich weigern, den Darm zu entleeren, wenn sie auf den Topf gesetzt werden, weil sie aus der Defäkation einen Lustnebengewinn beziehen [Fußnote]Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, II (1905 d), Studienausgabe, Bd. 5, S. 92 f.; denn sie geben an, daß es ihnen noch in etwas späteren Jahren Vergnügen bereitet hat, den Stuhl zurückzuhalten, und erinnern, wenngleich eher und leichter von ihren Geschwistern als von der eigenen Person, allerlei unziemliche Beschäftigungen mit dem zutage geförderten Kote. Wir schließen aus diesen Anzeichen auf eine überdeutliche erogene Betonung der Afterzone in der von ihnen mitgebrachten Sexualkonstitution; da sich aber nach abgelaufener Kindheit bei diesen Personen nichts mehr von diesen Schwächen und Eigenheiten auffinden läßt, müssen wir annehmen, daß die Analzone ihre erogene Bedeutung im Laufe der Entwicklung eingebüßt hat, und vermuten dann, daß die Konstanz jener Trias von Eigenschaften in ihrem Charakter mit der Aufzehrung der Analerotik in Verbindung gebracht werden darf.
Ich weiß, daß man sich nicht getraut, an einen Sachverhalt zu glauben, solange er unbegreiflich erscheint, der Erklärung nicht irgendeine Anknüpfung bietet. Wenigstens das Grundlegende desselben können wir nun unserem Verständnisse mit Hilfe der Voraussetzungen näherbringen, die in den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905 d) dargelegt sind. Ich suche dort zu zeigen, daß der Sexualtrieb des Menschen hoch zusammengesetzt ist, aus Beiträgen zahlreicher Komponenten und Partialtriebe entsteht. Wesentliche Beiträge zur »Sexualerregung« leisten die peripherischen Erregungen gewisser ausgezeichneter Körperstellen (Genitalien, Mund, After, Blasenausgang), welche den Namen »erogene Zonen« verdienen. Die von diesen Stellen her eintreffenden Erregungsgrößen erfahren aber nicht alle und nicht zu jeder Lebenszeit das gleiche Schicksal. Allgemein gesprochen, kommt nur ein Teil von ihnen dem Sexualleben zugute; ein anderer Teil wird von den sexuellen Zielen abgelenkt und auf andere Ziele gewendet, ein Prozeß, der den Namen »Sublimierung« verdient. Um die Lebenszeit, welche als »sexuelle Latenzperiode« bezeichnet werden darf, vom vollendeten fünften Jahre bis zu den ersten Äußerungen der Pubertät (ums elfte Jahr), werden sogar auf Kosten dieser von erogenen Zonen gelieferten Erregungen im Seelenleben Reaktionsbildungen, Gegenmächte, geschaffen wie Scham, Ekel und Moral, die sich gleichwie Dämme der späteren Betätigung der Sexualtriebe entgegensetzen. Da nun die Analerotik zu jenen Komponenten des Triebes gehört, die im Laufe der Entwicklung und im Sinne unserer heutigen Kulturerziehung für sexuelle Zwecke unverwendbar werden, läge es nahe, in den bei ehemaligen Analerotikern so häufig hervortretenden Charaktereigenschaften –; Ordentlichkeit, Sparsamkeit und Eigensinn –; die nächsten und konstantesten Ergebnisse der Sublimierung der Analerotik zu erkennen [Fußnote]Da gerade die Bemerkungen über die Analerotik des Säuglings in den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie bei unverständigen Lesern besonderen Anstoß erregt haben, gestatte ich mir an dieser Stelle die Einschaltung einer Beobachtung, die ich einem sehr intelligenten Patienten verdanke: »Ein Bekannter, der die Abhandlung über ›Sexualtheorie‹ gelesen hat, spricht über das Buch, erkennt es vollkommen an, nur eine Stelle darin sei ihm –; obwohl er auch diese inhaltlich natürlich billige und begreife –; so grotesk und komisch vorgekommen, daß er sich hingesetzt und eine Viertelstunde darüber gelacht habe. Diese Stelle lautet: ›Es ist eines der besten Vorzeichen späterer Absonderlichkeit oder Nervosität, wenn ein Säugling sich hartnäckig weigert, den Darm zu entleeren, wenn er auf den Topf gesetzt wird, also wenn es dem Pfleger beliebt, sondern diese Funktion seinem eigenen Belieben vorbehält. Es kommt ihm natürlich nicht darauf an, sein Lager schmutzig zu machen; er sorgt nur, daß ihm der Lustnebengewinn bei der Defäkation nicht entgehe.‹ Die Vorstellung dieses auf dem Topfe sitzenden Säuglings, der überlege, ob er sich eine derartige Einschränkung seiner persönlichen Willensfreiheit gefallen lassen solle, und der außerdem sorge, daß ihm der Lustgewinn bei der Defäkation nicht entgehe, habe seine ausgiebige Heiterkeit erregt. –; Etwa zwanzig Minuten später, bei der Jause, beginnt mein Bekannter plötzlich gänzlich unvermittelt: ›Du, mir fällt da gerade, weil ich den Kakao vor mir sehe, eine Idee ein, die ich als Kind immer gehabt habe. Da habe ich mir immer vorgestellt, ich bin der Kakaofabrikant Van Houten‹ (er sprach ›Van Hauten‹ aus), ›und ich habe ein großartiges Geheimnis zur Bereitung dieses Kakaos, und nun bemühen sich alle Leute, mir dieses weltbeglückende Geheimnis zu entreißen, das ich sorgsam hüte. Warum ich gerade auf Van Houten verfallen bin, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat mir seine Reklame am meisten imponiert.‹ Lachend, und ohne noch eigentlich so recht eine tiefere Absicht damit zu verbinden, meinte ich: › Wann haut'n die Mutter?!‹ Erst eine Weile später erkannte ich, daß mein Wortwitz tatsächlich den Schlüssel zu dieser ganzen, plötzlich aufgetauchten Kindheitserinnerung enthielt, die ich nun als glänzendes Beispiel einer Deckphantasie begriff, welche unter Beibehaltung des eigentlich Tatsächlichen (Nahrungsprozeß) und auf Grund phonetischer Assoziationen (› Kakao‹, › Wann haut'n –;‹) das Schuldbewußtsein durch eine komplette Umwertung des Erinnerungsinhaltes beruhigt. (Verlegung von rückwärts nach vorne, Nahrungsabgabe wird zur Nahrungsaufnahme, der beschämende und zu verdeckende Inhalt zum weltbeglückenden Geheimnisse.) Interessant war mir, wie hier auf eine Abwehr hin, die freilich die mildere Form formaler Beanstandung annahm, dem Betreffenden ohne seinen Willen eine Viertelstunde später der schlagendste Beweis aus dem eigenen Unbewußten heraufgereicht wurde.«.
Die innere Notwendigkeit dieses Zusammenhanges ist mir natürlich selbst nicht durchsichtig, doch kann ich einiges anführen, was als Hilfe für ein Verständnis desselben verwertet werden kann. Die Sauberkeit, Ordentlichkeit, Verläßlichkeit macht ganz den Eindruck einer Reaktionsbildung gegen das Interesse am Unsauberen, Störenden, nicht zum Körper Gehörigen (» Dirt is matter in the wrong place«). Den Eigensinn mit dem Defäkationsinteresse in Beziehung zu bringen, scheint keine leichte Aufgabe, doch mag man sich daran erinnern, daß schon der Säugling sich beim Absetzen des Stuhles eigenwillig benehmen kann (s. oben) und daß schmerzhafte Reize auf die mit der erogenen Afterzone verknüpfte Gesäßhaut allgemein der Erziehung dazu dienen, den Eigensinn des Kindes zu brechen, es gefügig zu machen. Zum Ausdrucke des Trotzes und der trotzenden Verhöhnung wird bei uns immer noch wie in alter Zeit eine Aufforderung verwendet, die die Liebkosung der Afterzone zum Inhalte hat, also eigentlich eine von der Verdrängung betroffene Zärtlichkeit bezeichnet. Die Entblößung des Hintern stellt die Abschwächung dieser Rede zur Geste dar; in Goethes Götz von Berlichingen finden sich beide, Rede wie Geste, an passendster Stelle als Ausdruck des Trotzes angebracht.
Am ausgiebigsten erscheinen die Beziehungen, welche sich zwischen den anscheinend so disparaten Komplexen des Geldinteresses und der Defäkation ergeben. Jedem Arzte, der die Psychoanalyse geübt hat, ist es wohl bekannt geworden, daß sich auf diesem Wege die hartnäckigsten und langdauerndsten sogenannten habituellen Stuhlverstopfungen Nervöser beseitigen lassen. Das Erstaunen hierüber wird durch die Erinnerung gemäßigt, daß diese Funktion sich ähnlich gefügig auch gegen die hypnotische Suggestion erwiesen hat. In der Psychoanalyse erzielt man diese Wirkung aber nur dann, wenn man den Geldkomplex der Betreffenden berührt und sie veranlaßt, denselben mit all seinen Beziehungen zum Bewußtsein zu bringen. Man könnte meinen, daß die Neurose hierbei nur einem Winke des Sprachgebrauchs folgt, der eine Person, die das Geld allzu ängstlich zurückhält, » schmutzig« oder » filzig« (englisch: filthy = schmutzig) nennt. Allein dieses wäre eine allzu oberflächliche Würdigung. In Wahrheit ist überall, wo die archaische Denkweise herrschend war oder geblieben ist, in den alten Kulturen, im Mythus, Märchen, Aberglauben, im unbewußten Denken, im Traume und in der Neurose das Geld in innigste Beziehungen zum Drecke gebracht. Es ist bekannt, daß das Gold, welches der Teufel seinen Buhlen schenkt, sich nach seinem Weggehen in Dreck verwandelt, und der Teufel ist doch gewiß nichts anderes als die Personifikation des verdrängten unbewußten Trieblebens [Fußnote]Vgl. die hysterische Besessenheit und die dämonischen Epidemien.. Bekannt ist ferner der Aberglaube, der die Auffindung von Schätzen mit der Defäkation zusammenbringt, und jedermann vertraut ist die Figur des »Dukatenscheißers«. Ja, schon in der altbabylonischen Lehre ist Gold der Kot der Hölle, Mammon = ilu manman[Fußnote]Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des alten Orients, 2. Aufl., 1906, S. 216, und Babylonisches im Neuen Testament, 1905, S. 96, » Mamon ( Mammon) ist babylonisch man-man, ein Beiname Nergals, des Gottes der Unterwelt. Das Gold ist nach orientalischem Mythus, der in die Sagen und Märchen der Völker übergegangen ist, Dreck der Hölle; siehe Monotheistische Strömungen innerhalb der babylonischen Religion, S. 16, Anm. 1.«. Wenn also die Neurose dem Sprachgebrauche folgt, so nimmt sie hier wie anderwärts die Worte in ihrem ursprünglichen, bedeutungsvollen Sinne, und wo sie ein Wort bildlich darzustellen scheint, stellt sie in der Regel nur die alte Bedeutung des Wortes wieder her.
Es ist möglich, daß der Gegensatz zwischen dem Wertvollsten, das der Mensch kennengelernt hat, und dem Wertlosesten, das er als Abfall (» refuse«) von sich wirft, zu dieser bedingten Identifizierung von Gold und Kot geführt hat.
Im Denken der Neurose kommt dieser Gleichstellung wohl noch ein anderer Umstand zu Hilfe. Das ursprünglich erotische Interesse an der Defäkation ist, wie wir ja wissen, zum Erlöschen in reiferen Jahren bestimmt; in diesen Jahren tritt das Interesse am Gelde als ein neues auf, welches der Kindheit noch gefehlt hat; dadurch wird es erleichtert, daß die frühere Strebung, die ihr Ziel zu verlieren im Begriffe ist, auf das neu auftauchende Ziel übergeleitet werde.
Wenn den hier behaupteten Beziehungen zwischen der Analerotik und jener Trias von Charaktereigenschaften etwas Tatsächliches zugrunde liegt, so wird man keine besondere Ausprägung des »Analcharakters« bei Personen erwarten dürfen, die sich die erogene Eignung der Analzone für das reife Leben bewahrt haben, wie z. B. gewisse Homosexuelle. Wenn ich nicht sehr irre, befindet sich die Erfahrung zumeist in guter Übereinstimmung mit diesem Schlusse.
Man müßte überhaupt in Erwägung ziehen, ob nicht auch andere Charakterkomplexe ihre Zugehörigkeit zu den Erregungen von bestimmten erogenen Zonen erkennen lassen. Ich kenne bis jetzt nur noch den unmäßigen »brennenden« Ehrgeiz der einstigen Enuretiker. Für die Bildung des endgültigen Charakters aus den konstitutiven Trieben läßt sich allerdings eine Formel angeben: Die bleibenden Charakterzüge sind entweder unveränderte Fortsetzungen der ursprünglichen Triebe, Sublimierungen derselben oder Reaktionsbildungen gegen dieselben.
Das Motiv der Kästchenwahl (1913)
I
Zwei Szenen aus Shakespeare, eine heitere und eine tragische, haben mir kürzlich den Anlaß zu einer kleinen Problemstellung und Lösung gegeben.
Die heitere ist die Wahl des Freiers zwischen drei Kästchen im Kaufmann von Venedig. Die schöne und kluge Porzia ist durch den Willen ihres Vaters gebunden, nur den von ihren Bewerbern zum Manne zu nehmen, der von drei ihm vorgelegten Kästchen das richtige wählt. Die drei Kästchen sind von Gold, von Silber und von Blei; das richtige ist jenes, welches ihr Bildnis einschließt. Zwei Bewerber sind bereits erfolglos abgezogen, sie hatten Gold und Silber gewählt. Bassanio, der dritte, entscheidet sich für das Blei; er gewinnt damit die Braut, deren Neigung ihm bereits vor der Schicksalsprobe gehört hat. Jeder der Freier hatte seine Entscheidung durch eine Rede motiviert, in welcher er das von ihm bevorzugte Metall anpries, während er die beiden anderen herabsetzte. Die schwerste Aufgabe war dabei dem glücklichen dritten Freier zugefallen; was er zur Verherrlichung des Bleis gegen Gold und Silber sagen kann, ist wenig und klingt gezwungen. Stünden wir in der psychoanalytischen Praxis vor solcher Rede, so würden wir hinter der unbefriedigenden Begründung geheimgehaltene Motive wittern.
Shakespeare hat das Orakel der Kästchenwahl nicht selbst erfunden, er nahm es aus einer Erzählung der Gesta Romanorum, in welcher ein Mädchen dieselbe Wahl vornimmt, um den Sohn des Kaisers zu gewinnen [Fußnote]Brandes (1896).. Auch hier ist das dritte Metall, das Blei, das Glückbringende. Es ist nicht schwer zu erraten, daß hier ein altes Motiv vorliegt, welches nach Deutung, Ableitung und Zurückführung verlangt. Eine erste Vermutung, was wohl die Wahl zwischen Gold, Silber und Blei bedeuten möge, findet bald Bestätigung durch eine Äußerung von Ed. Stucken [Fußnote]Stucken (1907, 655)., der sich in weitausgreifendem Zusammenhang mit dem nämlichen Stoff beschäftigt. Er sagt: »Wer die drei Freier Porzias sind, erhellt aus dem, was sie wählen: Der Prinz von Marokko wählt den goldenen Kasten: er ist die Sonne; der Prinz von Arragon wählt den silbernen Kasten: er ist der Mond; Bassanio wählt den bleiernen Kasten: er ist der Sternenknabe.« Zur Unterstützung dieser Deutung zitiert er eine Episode aus dem estnischen Volksepos Kalewipoeg, in welcher die drei Freier unverkleidet als Sonnen-, Mond- und Sternenjüngling (»des Polarsterns ältestes Söhnchen«) auftreten und die Braut wiederum dem Dritten zufällt.
So führte also unser kleines Problem auf einen Astralmythus! Nur schade, daß wir mit dieser Aufklärung nicht zu Ende gekommen sind. Das Fragen setzt sich weiter fort, denn wir glauben nicht mit manchen Mythenforschern, daß die Mythen vom Himmel herabgelesen worden sind, vielmehr urteilen wir mit O. Rank [Fußnote]Rank (1909, 8 ff.)., daß sie auf den Himmel projiziert wurden, nachdem sie anderswo unter rein menschlichen Bedingungen entstanden waren. Diesem menschlichen Inhalt gilt aber unser Interesse.
Fassen wir unseren Stoff nochmals ins Auge. Im estnischen Epos wie in der Erzählung der Gesta Romanorum handelt es sich um die Wahl eines Mädchens zwischen drei Freiern, in der Szene des Kaufmann von Venedig anscheinend um das nämliche, aber gleichzeitig tritt an dieser letzten Stelle etwas wie eine Umkehrung des Motivs auf: Ein Mann wählt zwischen drei –; Kästchen. Wenn wir es mit einem Traum zu tun hätten, würden wir sofort daran denken, daß die Kästchen auch Frauen sind, Symbole des Wesentlichen an der Frau und darum der Frau selbst, wie Büchsen, Dosen, Schachteln, Körbe usw. Gestatten wir uns, eine solche symbolische Ersetzung auch beim Mythus anzunehmen, so wird die Kästchenszene im Kaufmann von Venedig wirklich zur Umkehrung, die wir vermutet haben. Mit einem Ruck, wie er sonst nur im Märchen beschrieben wird, haben wir unserem Thema das astrale Gewand abgestreift und sehen nun, es behandelt ein menschliches Motiv, die Wahl eines Mannes zwischen drei Frauen.
Dasselbe ist aber der Inhalt einer anderen Szene Shakespeares in einem der erschütterndsten seiner Dramen, keine Brautwahl diesmal, aber doch durch so viel geheime Ähnlichkeiten mit der Kästchenwahl im Kaufmann verknüpft. Der alte König Lear beschließt, noch bei Lebzeiten sein Reich unter seine drei Töchter zu verteilen, je nach Maßgabe der Liebe, die sie für ihn äußern. Die beiden älteren, Goneril und Regan, erschöpfen sich in Beteuerungen und Anpreisungen ihrer Liebe, die dritte, Cordelia, weigert sich dessen. Er hätte diese unscheinbare, wortlose Liebe der Dritten erkennen und belohnen sollen, aber er verkennt sie, verstößt Cordelia und teilt das Reich unter die beiden anderen, zu seinem und zu aller Unheil. Ist das nicht wieder eine Szene der Wahl zwischen drei Frauen, von denen die jüngste die beste, die vorzüglichste ist?
Sofort fallen uns nun aus Mythus, Märchen und Dichtung andere Szenen ein, welche die nämliche Situation zum Inhalt haben: Der Hirte Paris hat die Wahl zwischen drei Göttinnen, von denen er die dritte zur Schönsten erklärt. Aschenputtel ist eine ebensolche Jüngste, die der Königssohn den beiden Älteren vorzieht, Psyche im Märchen des Apulejus ist die jüngste und schönste von drei Schwestern, Psyche, die einerseits als menschlich gewordene Aphrodite verehrt wird, anderseits von dieser Göttin behandelt wird wie Aschenputtel von ihrer Stiefmutter, einen vermischten Haufen von Samenkörnern schlichten soll und es mit Hilfe von kleinen Tieren (Tauben bei Aschenputtel, Ameisen bei Psyche) zustande bringt [Fußnote]Den Hinweis auf diese Übereinstimmungen verdanke ich Dr. O. Rank.. Wer sich weiter im Material umsehen wollte, würde gewiß noch andere Gestaltungen desselben Motivs mit Erhaltung derselben wesentlichen Züge auffinden können.
Begnügen wir uns mit Cordelia, Aphrodite, Aschenputtel und Psyche! Die drei Frauen, von denen die dritte die vorzüglichste ist, sind wohl als irgendwie gleichartig aufzufassen, wenn sie als Schwestern vorgeführt werden. Es soll uns nicht irremachen, wenn es bei Lear die drei Töchter des Wählenden sind, das bedeutet vielleicht nichts anderes, als daß Lear als alter Mann dargestellt werden soll. Den alten Mann kann man nicht leicht anders zwischen drei Frauen wählen lassen; darum werden diese zu seinen Töchtern.
Wer sind aber diese drei Schwestern und warum muß die Wahl auf die dritte fallen? Wenn wir diese Frage beantworten könnten, wären wir im Besitz der gesuchten Deutung. Nun haben wir uns bereits einmal der Anwendung psychoanalytischer Techniken bedient, als wir uns die drei Kästchen symbolisch als drei Frauen aufklärten. Haben wir den Mut, ein solches Verfahren fortzusetzen, so betreten wir einen Weg, der zunächst ins Unvorhergesehene, Unbegreifliche, auf Umwegen vielleicht zu einem Ziele führt.
Es darf uns auffallen, daß jene vorzügliche Dritte in mehreren Fällen außer ihrer Schönheit noch gewisse Besonderheiten hat. Es sind Eigenschaften, die nach irgendeiner Einheit zu streben scheinen; wir dürfen gewiß nicht erwarten, sie in allen Beispielen gleich gut ausgeprägt zu finden. Cordelia macht sich unkenntlich, unscheinbar wie das Blei, sie bleibt stumm, sie »liebt und schweigt«. Aschenputtel verbirgt sich, so daß sie nicht aufzufinden ist. Wir dürfen vielleicht das Sichverbergen dem Verstummen gleichsetzen. Dies wären allerdings nur zwei Fälle von den fünf, die wir herausgesucht haben. Aber eine Andeutung davon findet sich merkwürdigerweise auch noch bei zwei anderen. Wir haben uns ja entschlossen, die widerspenstig ablehnende Cordelia dem Blei zu vergleichen. Von diesem heißt es in der kurzen Rede des Bassanio während der Kästchenwahl, eigentlich so ganz unvermittelt:
Thy paleness moves me more than eloquence ( plainness nach anderer Leseart).
Also: Deine Schlichtheit geht mir näher als der beiden anderen schreiendes Wesen. Gold und Silber sind »laut«, das Blei ist stumm, wirklich wie Cordelia, die »liebt und schweigt« [Fußnote]In der Schlegelschen Übersetzung gebt diese Anspielung ganz verloren, ja sie wird zur Gegenseite gewendet: »Dein schlichtes Wesen spricht beredt mich an.«.
In den altgriechischen Erzählungen des Parisurteils ist von einer solchen Zurückhaltung der Aphrodite nichts enthalten. Jede der drei Göttinnen spricht zu dem Jüngling und sucht ihn durch Verheißungen zu gewinnen. Aber in einer ganz modernen Bearbeitung derselben Szene kommt der uns auffällig gewordene Zug der Dritten sonderbarerweise wieder zum Vorschein. Im Libretto der Schönen Helena erzählt Paris, nachdem er von den Werbungen der beiden anderen Göttinnen berichtet, wie sich Aphrodite in diesem Wettkampf um den Schönheitspreis benommen:
Und die Dritte –; ja die Dritte –; Stand daneben und blieb stumm. Ihr mußt' ich den Apfel geben usw.
Entschließen wir uns, die Eigentümlichkeit unserer Dritten in der »Stummheit« konzentriert zu sehen, so sagt uns die Psychoanalyse: Stummheit ist im Traume eine gebräuchliche Darstellung des Todes [Fußnote]Auch in Stekels Sprache des Traumes unter den Todessymbolen angeführt (1911, 351)..
Vor mehr als zehn Jahren teilte mir ein hochintelligenter Mann einen Traum mit, den er als Beweis für die telepathische Natur der Träume verwerten wollte. Er sah einen abwesenden Freund, von dem er überlange keine Nachricht erhalten hatte, und machte ihm eindringliche Vorwürfe über sein Stillschweigen. Der Freund gab keine Antwort. Es stellte sich dann heraus, daß er ungefähr um die Zeit des Traumes durch Selbstmord geendet hatte. Lassen wir das Problem der Telepathie beiseite; daß die Stummheit im Traume zur Darstellung des Todes wird, scheint hier nicht zweifelhaft. Auch das Sichverbergen, Unauffindbarsein, wie es der Märchenprinz dreimal beim Aschenputtel erlebt, ist im Traume ein unverkennbares Todessymbol; nicht minder die auffällige Blässe, an welche die paleness des Bleis in der einen Leseart des Shakespeareschen Textes erinnert [Fußnote]Stekel, l. c.. Die Übertragung dieser Deutungen aus der Sprache des Traumes auf die Ausdrucksweise des uns beschäftigenden Mythus wird uns aber wesentlich erleichtert, wenn wir wahrscheinlich machen können, daß die Stummheit auch in anderen Produktionen, die nicht Träume sind, als Zeichen des Totseins gedeutet werden muß.
Ich greife hier das neunte der Grimmschen Volksmärchen heraus, welches die Überschrift hat: ›Die zwölf Brüder‹ [Fußnote]S. 50 der Reclamausgabe, Bd. 1.. Ein König und eine Königin hatten zwölf Kinder, lauter Buben. Da sagte der König, wenn das dreizehnte Kind ein Mädchen ist, müssen die Buben sterben. In Erwartung dieser Geburt läßt er zwölf Särge machen. Die zwölf Söhne flüchten mit Hilfe der Mutter in einen versteckten Wald und schwören jedem Mädchen den Tod, das sie begegnen sollten.
Ein Mädchen wird geboren, wächst heran und erfährt einmal von der Mutter, daß es zwölf Brüder gehabt hat. Es beschließt sie aufzusuchen und findet im Walde den Jüngsten, der sie erkennt, aber verbergen möchte wegen des Eides der Brüder. Die Schwester sagt: Ich will gerne sterben, wenn ich damit meine zwölf Brüder erlösen kann. Die Brüder nehmen sie aber herzlich auf, sie bleibt bei ihnen und besorgt ihnen das Haus.
In einem kleinen Garten bei dem Haus wachsen zwölf Lilienblumen; die bricht das Mädchen ab, um jedem Bruder eine zu schenken. In diesem Augenblicke werden die Brüder in Raben verwandelt und verschwinden mit Haus und Garten. –; Die Raben sind Seelenvögel, die Tötung der zwölf Brüder durch ihre Schwester wird durch das Abpflücken der Blumen von neuem dargestellt wie zu Eingang durch die Särge und das Verschwinden der Brüder. Das Mädchen, das wiederum bereit ist, seine Brüder vom Tod zu erlösen, erfährt nun als Bedingung, daß sie sieben Jahre stumm sein muß, kein einziges Wort sprechen darf. Sie unterzieht sich dieser Probe, durch die sie selbst in Lebensgefahr gerät, d. h. sie stirbt selbst für die Brüder, wie sie es vor dem Zusammentreffen mit den Brüdern gelobt hat. Durch die Einhaltung der Stummheit gelingt ihr endlich die Erlösung der Raben.
Ganz ähnlich werden im Märchen von den ›sechs Schwänen‹ die in Vögel verwandelten Brüder durch die Stummheit der Schwester erlöst, d. h. wiederbelebt. Das Mädchen hat den festen Entschluß gefaßt, seine Brüder zu erlösen, und »wenn es auch sein Leben kostete«, und bringt als Gemahlin des Königs wiederum ihr eigenes Leben in Gefahr, weil sie gegen böse Anklagen ihre Stummheit nicht aufgeben will.
Wir würden sicherlich aus den Märchen noch andere Beweise erbringen können, daß die Stummheit als Darstellung des Todes verstanden werden muß. Wenn wir diesem Anzeichen folgen dürfen, so wäre die dritte unserer Schwestern, zwischen denen die Wahl stattfindet, eine Tote. Sie kann aber auch etwas anderes sein, nämlich der Tod selbst, die Todesgöttin. Vermöge einer gar nicht seltenen Verschiebung werden die Eigenschaften, die eine Gottheit den Menschen zuteilt, ihr selbst zugeschrieben. Am wenigsten wird uns solche Verschiebung bei der Todesgöttin befremden, denn in der modernen Auffassung und Darstellung, die hier vorweggenommen würde, ist der Tod selbst nur ein Toter.
Wenn aber die dritte der Schwestern die Todesgöttin ist, so kennen wir die Schwestern. Es sind die Schicksalsschwestern, die Moiren oder Parzen oder Nornen, deren dritte Atropos heißt: die Unerbittliche.
II
Stellen wir die Sorge, wie die gefundene Deutung in unseren Mythus einzufügen ist, einstweilen beiseite, und holen wir uns bei den Mythologen Belehrung über Rolle und Herkunft der Schicksalsgöttinnen [Fußnote]Das folgende nach Roschers Lexikon der griechischen und römischen Mythologie unter den entsprechenden Titeln..
Die älteste griechische Mythologie kennt nur eine Μοίρα als Personifikation des unentrinnbaren Schicksals (bei Homer). Die Fortentwicklung dieser einen Moira zu einem Schwesterverein von drei (seltener zwei) Gottheiten erfolgte wahrscheinlich in Anlehnung an andere Göttergestalten, denen die Moiren nahestehen, die Chariten und die Horen.
Die Horen sind ursprünglich Gottheiten der himmlischen Gewässer, die Regen und Tau spenden, der Wolken, aus denen der Regen niederfällt, und da diese Wolken als Gespinst erfaßt werden, ergibt sich für diese Göttinnen der Charakter der Spinnerinnen, der dann an den Moiren fixiert wird. In den von der Sonne verwöhnten Mittelmeerländern ist es der Regen, von dem die Fruchtbarkeit des Bodens abhängig wird, und darum wandeln sich die Horen zu Vegetationsgottheiten. Man dankt ihnen die Schönheit der Blumen und den Reichtum der Früchte, stattet sie mit einer Fülle von liebenswürdigen und anmutigen Zügen aus. Sie werden zu den göttlichen Vertreterinnen der Jahreszeiten und erwerben vielleicht durch diese Beziehung ihre Dreizahl, wenn die heilige Natur der Drei zu deren Aufklärung nicht genügen sollte. Denn diese alten Völker unterschieden zuerst nur drei Jahreszeiten: Winter, Frühling und Sommer. Der Herbst kam erst in späten griechisch-römischen Zeiten hinzu; dann bildete die Kunst häufig vier Horen ab.
Die Beziehung zur Zeit blieb den Horen erhalten; sie wachten später über die Tageszeiten wie zuerst über die Zeiten des Jahres; endlich sank ihr Name zur Bezeichnung der Stunde ( heure, ora) herab. Die den Horen und Moiren wesensverwandten Nornen der deutschen Mythologie tragen diese Zeitbedeutung in ihren Namen zur Schau [Fußnote][Sie heißen Urd (das Gewordene), Skuld (das Werdensollende) und Verdandi (das Werdende), d. h. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.]. Es konnte aber nicht ausbleiben, daß das Wesen dieser Gottheiten tiefer erfaßt und in das Gesetzmäßige im Wandel der Zeiten verlegt wurde; die Horen wurden so zu Hüterinnen des Naturgesetzes und der heiligen Ordnung, welche mit unabänderlicher Reihenfolge in der Natur das gleiche wiederkehren läßt.
Diese Erkenntnis der Natur wirkte zurück auf die Auffassung des menschlichen Lebens. Der Naturmythus wandelte sich zum Menschenmythus; aus den Wettergöttinnen wurden Schicksalsgottheiten. Aber diese Seite der Horen kam erst in den Moiren zum Ausdruck, die über die notwendige Ordnung im Menschenleben so unerbittlich wachen wie die Horen über die Gesetzmäßigkeit der Natur. Das unabwendbar Strenge des Gesetzes, die Beziehung zu Tod und Untergang, die an den lieblichen Gestalten der Horen vermieden worden waren, sie prägten sich nun an den Moiren aus, als ob der Mensch den ganzen Ernst des Naturgesetzes erst dann empfände, wenn er die eigene Person ihm unterordnen soll.
Die Namen der drei Spinnerinnen haben auch bei den Mythologen bedeutsames Verständnis gefunden. Die zweite, Lachesis, scheint das »innerhalb der Gesetzmäßigkeit des Schicksals Zufällige« zu bezeichnen [Fußnote]J. Roscher nach Preller-Robert. –; wir würden sagen: das Erleben –; wie Atropos das Unabwendbare, den Tod, und dann bliebe für Klotho die Bedeutung der verhängnisvollen, mitgebrachten Anlage.
Und nun ist es Zeit, zu dem der Deutung unterliegenden Motiv der Wahl zwischen drei Schwestern zurückzukehren. Mit tiefem Mißvergnügen werden wir bemerken, wie unverständlich die betrachteten Situationen werden, wenn wir in sie die gefundene Deutung einsetzen, und welche Widersprüche zum scheinbaren Inhalt derselben sich dann ergeben. Die dritte der Schwestern soll die Todesgöttin sein, der Tod selbst, und im Parisurteil ist es die Liebesgöttin, im Märchen des Apulejus eine dieser letzteren vergleichbare Schönheit, im Kaufmann die schönste und klügste Frau, im Lear die einzig treue Tochter. Kann ein Widerspruch vollkommener gedacht werden? Doch vielleicht ist diese unwahrscheinliche Steigerung ganz in der Nähe. Sie liegt wirklich vor, wenn in unserem Motiv jedesmal zwischen den Frauen frei gewählt wird und wenn die Wahl dabei auf den Tod fallen soll, den doch niemand wählt, dem man durch ein Verhängnis zum Opfer fällt.
Indes Widersprüche von einer gewissen Art, Ersetzungen durch das volle kontradiktorische Gegenteil bereiten der analytischen Deutungsarbeit keine ernste Schwierigkeit. Wir werden uns hier nicht darauf berufen, daß Gegensätze in den Ausdrucksweisen des Unbewußten wie im Traume so häufig durch eines und das nämliche Element dargestellt werden. Aber wir werden daran denken, daß es Motive im Seelenleben gibt, welche die Ersetzung durch das Gegenteil als sogenannte Reaktionsbildung herbeiführen, und können den Gewinn unserer Arbeit gerade in der Aufdeckung solcher verborgener Motive suchen. Die Schöpfung der Moiren ist der Erfolg einer Einsicht, welche den Menschen mahnt, auch er sei ein Stück der Natur und darum dem unabänderlichen Gesetz des Todes unterworfen. Gegen diese Unterwerfung mußte sich etwas im Menschen sträuben, der nur höchst ungern auf seine Ausnahmsstellung verzichtet. Wir wissen, daß der Mensch seine Phantasietätigkeit zur Befriedigung seiner von der Realität unbefriedigten Wünsche verwendet. So lehnte sich denn seine Phantasie gegen die im Moirenmythus verkörperte Einsicht auf und schuf den davon abgeleiteten Mythus, in dem die Todesgöttin durch die Liebesgöttin und was ihr an menschlichen Gestaltungen gleichkommt, ersetzt ist. Die dritte der Schwestern ist nicht mehr der Tod, sie ist die schönste, beste, begehrenswerteste, liebenswerteste der Frauen. Und diese Ersetzung war technisch keineswegs schwer; sie war durch eine alte Ambivalenz vorbereitet, sie vollzog sich längs eines uralten Zusammenhanges, der noch nicht lange vergessen sein konnte. Die Liebesgöttin selbst, die jetzt an die Stelle der Todesgöttin trat, war einst mit ihr identisch gewesen. Noch die griechische Aphrodite entbehrte nicht völlig der Beziehungen zur Unterwelt, obwohl sie ihre chthonische Rolle längst an andere Göttergestalten, an die Persephone, die dreigestaltige Artemis-Hekate, abgegeben hatte. Die großen Muttergottheiten der orientalischen Völker scheinen aber alle ebensowohl Zeugerinnen wie Vernichterinnen, Göttinnen des Lebens und der Befruchtung wie Todesgöttinnen gewesen zu sein. So greift die Ersetzung durch ein Wunschgegenteil bei unserem Motiv auf eine uralte Identität zurück.
Dieselbe Erwägung beantwortet uns die Frage, woher der Zug der Wahl in den Mythus von den drei Schwestern geraten ist. Es hat hier wiederum eine Wunschverkehrung stattgefunden. Wahl steht an der Stelle von Notwendigkeit, von Verhängnis. So überwindet der Mensch den Tod, den er in seinem Denken anerkannt hat. Es ist kein stärkerer Triumph der Wunscherfüllung denkbar. Man wählt dort, wo man in Wirklichkeit dem Zwange gehorcht, und die man wählt, ist nicht die Schreckliche, sondern die Schönste und Begehrenswerteste.
Bei näherem Zusehen merken wir freilich, daß die Entstellungen des ursprünglichen Mythus nicht gründlich genug sind, um sich nicht durch Resterscheinungen zu verraten. Die freie Wahl zwischen den drei Schwestern ist eigentlich keine freie Wahl, denn sie muß notwendigerweise die dritte treffen, wenn nicht, wie im Lear, alles Unheil aus ihr entstehen soll. Die Schönste und Beste, welche anstelle der Todesgöttin getreten ist, hat Züge behalten, die an das Unheimliche streifen, so daß wir aus ihnen das Verborgene erraten konnten [Fußnote]Auch die Psyche des Apulejus hat reichlich Züge bewahrt, welche an ihre Beziehung zum Tode mahnen. Ihre Hochzeit wird gerüstet wie eine Leichenfeier, sie muß in die Unterwelt hinabsteigen und versinkt nachher in einen totenähnlichen Schlaf (O. Rank). Über die Bedeutung der Psyche als Frühlingsgottheit und als »Braut des Todes« siehe Zinzow (1881). In einem anderen Grimmschen Märchen (Nr. 179, ›Die Gänsehirtin am Brunnen‹) findet sich wie beim Aschenputtel die Abwechslung von schöner und häßlicher Gestalt der dritten Tochter, in der man wohl eine Andeutung von deren Doppelnatur –; vor und nach der Ersetzung –; erblicken darf. Diese dritte wird von ihrem Vater nach einer Probe verstoßen, welche mit der im König Lear fast zusammenfällt. Sie soll wie die anderen Schwestern angeben, wie lieb sie den Vater hat, findet aber keinen anderen Ausdruck ihrer Liebe als den Vergleich mit dem Salze. (Freundliche Mitteilung von Dr. Hanns Sachs.).
Wir haben bisher den Mythus und seine Wandlung verfolgt und hoffen die geheimen Gründe dieser Wandlung aufgezeigt zu haben. Nun darf uns wohl die Verwendung des Motivs beim Dichter interessieren. Wir bekommen den Eindruck, als ginge beim Dichter eine Reduktion des Motivs auf den ursprünglichen Mythus vor sich, so daß der ergreifende, durch die Entstellung abgeschwächte Sinn des letzteren von uns wieder verspürt wird. Durch diese Reduktion der Entstellung, die teilweise Rückkehr zum Ursprünglichen, erziele der Dichter die tiefere Wirkung, die er bei uns erzeugt.
Um Mißverständnissen vorzubeugen, will ich sagen, ich habe nicht die Absicht zu widersprechen, daß das Drama vom König Lear die beiden weisen Lehren einschärfen wolle, man solle auf sein Gut und seine Rechte nicht zu Lebzeiten verzichten und man müsse sich hüten, Schmeichelei für bare Münze zu nehmen. Diese und ähnliche Mahnungen ergeben sich wirklich aus dem Stück, aber es erscheint mir ganz unmöglich, die ungeheure Wirkung des Lear aus dem Eindruck dieses Gedankeninhaltes zu erklären oder anzunehmen, daß die persönlichen Motive des Dichters mit der Absicht, diese Lehren vorzutragen, erschöpft seien. Auch die Auskunft, der Dichter habe uns die Tragödie der Undankbarkeit vorspielen wollen, deren Bisse er wohl am eigenen Leibe verspürt, und die Wirkung des Spieles beruhe auf dem rein formalen Moment der künstlerischen Einkleidung, scheint mir das Verständnis nicht zu ersetzen, welches uns durch die Würdigung des Motivs der Wahl zwischen den drei Schwestern eröffnet wird.
Lear ist ein alter Mann. Wir sagten schon, darum erscheinen die drei Schwestern als seine Töchter. Das Vaterverhältnis, aus dem so viel fruchtbare dramatische Antriebe erfließen könnten, wird im Drama weiter nicht verwertet. Lear ist aber nicht nur ein Alter, sondern auch ein Sterbender. Die so absonderliche Voraussetzung der Erbteilung verliert dann alles Befremdende. Dieser dem Tode Verfallene will aber auf die Liebe des Weibes nicht verzichten, er will hören, wie sehr er geliebt wird. Nun denke man an die erschütternde letzte Szene, einen der Höhepunkte der Tragik im modernen Drama: Lear trägt den Leichnam der Cordelia auf die Bühne. Cordelia ist der Tod. Wenn man die Situation umkehrt, wird sie uns verständlich und vertraut. Es ist die Todesgöttin, die den verstorbenen Helden vom Kampfplatze wegträgt, wie die Walküre in der deutschen Mythologie. Ewige Weisheit im Gewand des uralten Mythus rät dem alten Manne, der Liebe zu entsagen, den Tod zu wählen, sich mit der Notwendigkeit des Sterbens zu befreunden.
Der Dichter bringt uns das alte Motiv näher, indem er die Wahl zwischen den drei Schwestern von einem Gealterten und Sterbenden vollziehen läßt. Die regressive Bearbeitung, die er so mit dem durch Wunschverwandlung entstellten Mythus vorgenommen, läßt dessen alten Sinn so weit durchschimmern, daß uns vielleicht auch eine flächenhafte, allegorische Deutung der drei Frauengestalten des Motivs ermöglicht wird. Man könnte sagen, es seien die drei für den Mann unvermeidlichen Beziehungen zum Weibe, die hier dargestellt sind: Die Gebärerin, die Genossin und die Verderberin. Oder die drei Formen, zu denen sich ihm das Bild der Mutter im Lauf des Lebens wandelt: Die Mutter selbst, die Geliebte, die er nach deren Ebenbild gewählt, und zuletzt die Mutter Erde, die ihn wieder aufnimmt. Der alte Mann aber hascht vergebens nach der Liebe des Weibes, wie er sie zuerst von der Mutter empfangen; nur die dritte der Schicksalsfrauen, die schweigsame Todesgöttin, wird ihn in ihre Arme nehmen.
Das ökonomische Problem des Masochismus (1924)
Man hat ein Recht dazu, die Existenz der masochistischen Strebung im menschlichen Triebleben als ökonomisch rätselhaft zu bezeichnen. Denn wenn das Lustprinzip die seelischen Vorgänge in solcher Weise beherrscht, daß Vermeidung von Unlust und Gewinnung von Lust deren nächstes Ziel wird, so ist der Masochismus unverständlich. Wenn Schmerz und Unlust nicht mehr Warnungen, sondern selbst Ziele sein können, ist das Lustprinzip lahmgelegt, der Wächter unseres Seelenlebens gleichsam narkotisiert.
Der Masochismus erscheint uns so im Lichte einer großen Gefahr, was für seinen Widerpart, den Sadismus, in keiner Weise gilt. Wir fühlen uns versucht, das Lustprinzip den Wächter unseres Lebens anstatt nur unseres Seelenlebens zu heißen. Aber dann stellt sich die Aufgabe her, das Verhältnis des Lustprinzips zu den beiden Triebarten, die wir unterschieden haben, den Todestrieben und den erotischen (libidinösen) Lebenstrieben, zu untersuchen, und wir können in der Würdigung des masochistischen Problems nicht weitergehen, ehe wir nicht diesem Rufe gefolgt sind.
Wir haben, wie erinnerlich [Fußnote]Jenseits des Lustprinzips I., das Prinzip, welches alle seelischen Vorgänge beherrscht, als Spezialfall der Fechnerschen Tendenz zur Stabilität aufgefaßt und somit dem seelischen Apparat die Absicht zugeschrieben, die ihm zuströmende Erregungssumme zu nichts zu machen oder wenigstens nach Möglichkeit niedrigzuhalten. Barbara Low hat für dies supponierte Bestreben den Namen Nirwanaprinzip vorgeschlagen, den wir akzeptieren. Aber wir haben das Lust-Unlustprinzip unbedenklich mit diesem Nirwanaprinzip identifiziert. Jede Unlust müßte also mit einer Erhöhung, jede Lust mit einer Erniedrigung der im Seelischen vorhandenen Reizspannung zusammenfallen, das Nirwana- (und das mit ihm angeblich identische Lust-)prinzip würde ganz im Dienst der Todestriebe stehen, deren Ziel die Überführung des unsteten Lebens in die Stabilität des anorganischen Zustandes ist, und würde die Funktion haben, vor den Ansprüchen der Lebenstriebe, der Libido, zu warnen, welche den angestrebten Ablauf des Lebens zu stören versuchen. Allein diese Auffassung kann nicht richtig sein. Es scheint, daß wir Zunahme und Abnahme der Reizgrößen direkt in der Reihe der Spannungsgefühle empfinden, und es ist nicht zu bezweifeln, daß es lustvolle Spannungen und unlustige Entspannungen gibt. Der Zustand der Sexualerregung ist das aufdringlichste Beispiel einer solchen lustvollen Reizvergrößerung, aber gewiß nicht das einzige. Lust und Unlust können also nicht auf Zunahme oder Abnahme einer Quantität, die wir Reizspannung heißen, bezogen werden, wenngleich sie offenbar mit diesem Moment viel zu tun haben. Es scheint, daß sie nicht an diesem quantitativen Faktor hängen, sondern an einem Charakter desselben, den wir nur als qualitativ bezeichnen können. Wir wären viel weiter in der Psychologie, wenn wir anzugeben wüßten, welches dieser qualitative Charakter ist. Vielleicht ist es der Rhythmus, der zeitliche Ablauf in den Veränderungen, Steigerungen und Senkungen der Reizquantität; wir wissen es nicht.
Auf jeden Fall müssen wir innewerden, daß das dem Todestrieb zugehörige Nirwanaprinzip im Lebewesen eine Modifikation erfahren hat, durch die es zum Lustprinzip wurde, und werden es von nun an vermeiden, die beiden Prinzipien für eines zu halten. Von welcher Macht diese Modifikation ausging, ist, wenn man dieser Überlegung überhaupt folgen will, nicht schwer zu erraten. Es kann nur der Lebenstrieb, die Libido, sein, der sich in solcher Weise seinen Anteil an der Regulierung der Lebensvorgänge neben dem Todestrieb erzwungen hat. Wir erhalten so eine kleine, aber interessante Beziehungsreihe: das Nirwanaprinzip drückt die Tendenz des Todestriebes aus, das Lustprinzip vertritt den Anspruch der Libido und dessen Modifikation, das Realitätsprinzip, den Einfluß der Außenwelt.
Keines dieser drei Prinzipien wird eigentlich vom anderen außer Kraft gesetzt. Sie wissen sich in der Regel miteinander zu vertragen, wenngleich es gelegentlich zu Konflikten führen muß, daß von einer Seite die quantitative Herabminderung der Reizbelastung, von der anderen ein qualitativer Charakter derselben und endlich ein zeitlicher Aufschub der Reizabfuhr und ein zeitweiliges Gewährenlassen der Unlustspannung zum Ziel gesetzt ist.
Der Schluß aus diesen Erörterungen ist, daß die Bezeichnung des Lustprinzips als Wächter des Lebens nicht abgelehnt werden kann.
Kehren wir zum Masochismus zurück. Er tritt unserer Beobachtung in drei Gestalten entgegen, als eine Bedingtheit der Sexualerregung, als ein Ausdruck des femininen Wesens und als eine Norm des Lebensverhaltens ( behaviour). Man kann dementsprechend einen erogenen, femininen und moralischen Masochismus unterscheiden. Der erstere, der erogene Masochismus, die Schmerzlust, liegt auch den beiden anderen Formen zugrunde, er ist biologisch und konstitutionell zu begründen, bleibt unverständlich, wenn man sich nicht zu einigen Annahmen über ganz dunkle Verhältnisse entschließt. Die dritte, in gewisser Hinsicht wichtigste Erscheinungsform des Masochismus ist als meist unbewußtes Schuldgefühl erst neuerlich von der Psychoanalyse gewürdigt worden, läßt aber bereits eine volle Aufklärung und Einreihung in unsere sonstige Erkenntnis zu. Der feminine Masochismus dagegen ist unserer Beobachtung am besten zugänglich, am wenigsten rätselhaft und in all seinen Beziehungen zu übersehen. Mit ihm mag unsere Darstellung beginnen.
Wir kennen diese Art des Masochismus beim Manne (auf den ich mich aus Gründen des Materials hier beschränke) in zureichender Weise aus den Phantasien masochistischer (häufig darum impotenter) Personen, die entweder in den onanistischen Akt auslaufen oder für sich allein die Sexualbefriedigung darstellen. Mit den Phantasien stimmen vollkommen überein die realen Veranstaltungen masochistischer Perverser, sei es, daß sie als Selbstzweck durchgeführt werden oder zur Herstellung der Potenz und Einleitung des Geschlechtsakts dienen. In beiden Fällen –; die Veranstaltungen sind ja nur die spielerische Ausführung der Phantasien –; ist der manifeste Inhalt: geknebelt, gebunden, in schmerzhafter Weise geschlagen, gepeitscht, irgendwie mißhandelt, zum unbedingten Gehorsam gezwungen, beschmutzt, erniedrigt zu werden. Weit seltener und nur mit großen Einschränkungen werden auch Verstümmelungen in diesen Inhalt aufgenommen. Die nächste, bequem zu erreichende Deutung ist, daß der Masochist wie ein kleines, hilfloses und abhängiges Kind behandelt werden will, besonders aber wie ein schlimmes Kind. Es ist überflüssig, Kasuistik anzuführen, das Material ist sehr gleichartig, jedem Beobachter, auch dem Nichtanalytiker, zugänglich. Hat man aber Gelegenheit, Fälle zu studieren, in denen die masochistischen Phantasien eine besonders reiche Verarbeitung erfahren haben, so macht man leicht die Entdeckung, daß sie die Person in eine für die Weiblichkeit charakteristische Situation versetzen, also Kastriertwerden, Koitiertwerden oder Gebären bedeuten. Ich habe darum diese Erscheinungsform des Masochismus den femininen, gleichsam a potiori[Fußnote]vom Stärkeren, Mächtigeren her, genannt, obwohl so viele seiner Elemente auf das Infantilleben hinweisen. Diese Übereinanderschichtung des Infantilen und des Femininen wird später ihre einfache Aufklärung finden. Die Kastration oder die sie vertretende Blendung hat oft in den Phantasien ihre negative Spur in der Bedingung hinterlassen, daß gerade den Genitalien oder den Augen kein Schaden geschehen darf. (Die masochistischen Quälereien machen übrigens selten einen so ernsthaften Eindruck wie die –; phantasierten oder inszenierten –; Grausamkeiten des Sadismus.) Im manifesten Inhalt der masochistischen Phantasien kommt auch ein Schuldgefühl zum Ausdruck, indem angenommen wird, daß die betreffende Person etwas verbrochen habe (was unbestimmt gelassen wird), was durch alle die schmerzhaften und quälerischen Prozeduren gesühnt werden soll. Das sieht wie eine oberflächliche Rationalisierung der masochistischen Inhalte aus, es steckt aber die Beziehung zur infantilen Masturbation dahinter. Anderseits leitet dieses Schuldmoment zur dritten, moralischen Form des Masochismus über.
Der beschriebene feminine Masochismus ruht ganz auf dem primären, erogenen, der Schmerzlust, deren Erklärung nicht ohne weit rückgreifende Erwägungen gelingt.
Ich habe in den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie im Abschnitt über die Quellen der infantilen Sexualität die Behauptung aufgestellt, »daß die Sexualerregung als Nebenwirkung bei einer großen Reihe innerer Vorgänge entsteht, sobald die Intensität dieser Vorgänge nur gewisse quantitative Grenzen überstiegen hat«. Ja, daß vielleicht »nichts Bedeutsameres im Organismus vorfällt, was nicht seine Komponente zur Erregung des Sexualtriebes abzugeben hätte«. Demnach müßte auch die Schmerz- und Unlusterregung diese Folge haben. Diese libidinöse Miterregung bei Schmerz- und Unlustspannung wäre ein infantiler physiologischer Mechanismus, der späterhin versiegt. Sie würde in den verschiedenen Sexualkonstitutionen eine verschieden große Ausbildung erfahren, jedenfalls die physiologische Grundlage abgeben, die dann als erogener Masochismus psychisch überbaut wird.
Die Unzulänglichkeit dieser Erklärung zeigt sich aber darin, daß in ihr kein Licht auf die regelmäßigen und intimen Beziehungen des Masochismus zu seinem Widerpart im Triebleben, dem Sadismus, geworfen wird. Geht man ein Stück weiter zurück bis zur Annahme der zwei Triebarten, die wir uns im Lebewesen wirksam denken, so kommt man zu einer anderen, aber der obigen nicht widersprechenden Ableitung. Die Libido trifft in (vielzelligen) Lebewesen auf den dort herrschenden Todes- oder Destruktionstrieb, welcher dies Zellenwesen zersetzen und jeden einzelnen Elementarorganismus in den Zustand der anorganischen Stabilität (wenn diese auch nur relativ sein mag) überführen möchte. Sie hat die Aufgabe, diesen destruierenden Trieb unschädlich zu machen, und entledigt sich ihrer, indem sie ihn zum großen Teil und bald mit Hilfe eines besonderen Organsystems, der Muskulatur, nach außen ableitet, gegen die Objekte der Außenwelt richtet. Er heiße dann Destruktionstrieb, Bemächtigungstrieb, Wille zur Macht. Ein Anteil dieses Triebes wird direkt in den Dienst der Sexualfunktion gestellt, wo er Wichtiges zu leisten hat. Dies ist der eigentliche Sadismus. Ein anderer Anteil macht diese Verlegung nach außen nicht mit, er verbleibt im Organismus und wird dort mit Hilfe der erwähnten sexuellen Miterregung libidinös gebunden; in ihm haben wir den ursprünglichen, erogenen Masochismus zu erkennen.
Es fehlt uns jedes physiologische Verständnis dafür, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln sich diese Bändigung des Todestriebes durch die Libido vollziehen mag. Im psychoanalytischen Gedankenkreis können wir nur annehmen, daß eine sehr ausgiebige, in ihren Verhältnissen variable Vermischung und Verquickung der beiden Triebarten zustande kommt, so daß wir überhaupt nicht mit reinen Todes- und Lebenstrieben, sondern nur mit verschiedenwertigen Vermengungen derselben rechnen sollten. Der Triebvermischung mag unter gewissen Einwirkungen eine Entmischung derselben entsprechen. Wie groß die Anteile der Todestriebe sind, welche sich solcher Bändigung durch die Bindung an libidinöse Zusätze entziehen, läßt sich derzeit nicht erraten.
Wenn man sich über einige Ungenauigkeit hinaussetzen will, kann man sagen, der im Organismus wirkende Todestrieb –; der Ursadismus –; sei mit dem Masochismus identisch. Nachdem sein Hauptanteil nach außen auf die Objekte verlegt worden ist, verbleibt als sein Residuum im Inneren der eigentliche, erogene Masochismus, der einerseits eine Komponente der Libido geworden ist, anderseits noch immer das eigene Wesen zum Objekt hat. So wäre dieser Masochismus ein Zeuge und Überrest jener Bildungsphase, in der die für das Leben so wichtige Legierung von Todestrieb und Eros geschah. Wir werden nicht erstaunt sein zu hören, daß unter bestimmten Verhältnissen der nach außen gewendete, projizierte Sadismus oder Destruktionstrieb wieder introjiziert, nach innen gewendet werden kann, solcherart in seine frühere Situation regrediert. Er ergibt dann den sekundären Masochismus, der sich zum ursprünglichen hinzuaddiert.
Der erogene Masochismus macht alle Entwicklungsphasen der Libido mit und entnimmt ihnen seine wechselnden psychischen Umkleidungen. Die Angst, vom Totemtier (Vater) gefressen zu werden, stammt aus der primitiven, oralen Organisation, der Wunsch, vom Vater geschlagen zu werden, aus der darauffolgenden sadistisch-analen Phase; als Niederschlag der phallischen Organisationsstufe [Fußnote]S. ›Die infantile Genitalorganisation‹ (1923 e). tritt die Kastration, obwohl später verleugnet, in den Inhalt der masochistischen Phantasien ein, von der endgültigen Genitalorganisation leiten sich natürlich die für die Weiblichkeit charakteristischen Situationen des Koitiertwerdens und des Gebärens ab. Auch die Rolle der Nates [Fußnote]Hinterbacken im Masochismus ist, abgesehen von der offenkundigen Realbegründung, leicht zu verstehen. Die Nates sind die erogen bevorzugte Körperpartie der sadistisch-analen Phase wie die Mamma der oralen, der Penis der genitalen.
Die dritte Form des Masochismus, der moralische Masochismus, ist vor allem dadurch bemerkenswert, daß sie ihre Beziehung zu dem, was wir als Sexualität erkennen, gelockert hat. An allen masochistischen Leiden haftet sonst die Bedingung, daß sie von der geliebten Person ausgehen, auf ihr Geheiß erduldet werden; diese Einschränkung ist beim moralischen Masochismus fallengelassen. Das Leiden selbst ist das, worauf es ankommt; ob es von einer geliebten oder gleichgültigen Person verhängt wird, spielt keine Rolle; es mag auch von unpersönlichen Mächten oder Verhältnissen verursacht sein, der richtige Masochist hält immer seine Wange hin, wo er Aussicht hat, einen Schlag zu bekommen. Es liegt sehr nahe, in der Erklärung dieses Verhaltens die Libido beiseite zu lassen und sich auf die Annahme zu beschränken, daß hier der Destruktionstrieb wieder nach innen gewendet wurde und nun gegen das eigene Selbst wütet, aber es sollte doch einen Sinn haben, daß der Sprachgebrauch die Beziehung dieser Norm des Lebensverhaltens zur Erotik nicht aufgegeben hat und auch solche Selbstbeschädiger Masochisten heißt.
Einer technischen Gewöhnung getreu wollen wir uns zuerst mit der extremen, unzweifelhaft pathologischen Form dieses Masochismus beschäftigen. Ich habe an anderer Stelle [Fußnote]Das Ich und das Es. ausgeführt, daß wir in der analytischen Behandlung auf Patienten stoßen, deren Benehmen gegen die Einflüsse der Kur uns nötigt, ihnen ein »unbewußtes« Schuldgefühl zuzuschreiben. Ich habe dort angegeben, woran man diese Personen erkennt (»die negative therapeutische Reaktion«), und auch nicht verhehlt, daß die Stärke einer solchen Regung einen der schwersten Widerstände und die größte Gefahr für den Erfolg unserer ärztlichen oder erzieherischen Absichten bedeutet. Die Befriedigung dieses unbewußten Schuldgefühls ist der vielleicht mächtigste Posten des in der Regel zusammengesetzten Krankheitsgewinnes, der Kräftesumme, welche sich gegen die Genesung sträubt und das Kranksein nicht aufgeben will; das Leiden, das die Neurose mit sich bringt, ist gerade das Moment, durch das sie der masochistischen Tendenz wertvoll wird. Es ist auch lehrreich zu erfahren, daß gegen alle Theorie und Erwartung eine Neurose, die allen therapeutischen Bemühungen getrotzt hat, verschwinden kann, wenn die Person in das Elend einer unglücklichen Ehe geraten ist, ihr Vermögen verloren oder eine bedrohliche organische Erkrankung erworben hat. Eine Form des Leidens ist dann durch eine andere abgelöst worden, und wir sehen, es kam nur darauf an, ein gewisses Maß von Leiden festhalten zu können.
Das unbewußte Schuldgefühl wird uns von den Patienten nicht leicht geglaubt. Sie wissen zu gut, in welchen Qualen (Gewissensbissen) sich ein bewußtes Schuldgefühl, Schuldbewußtsein, äußert, und können darum nicht zugeben, daß sie ganz analoge Regungen in sich beherbergen sollten, von denen sie so gar nichts verspüren. Ich meine, wir tragen ihrem Einspruch in gewissem Maße Rechnung, wenn wir auf die ohnehin psychologisch inkorrekte Benennung »unbewußtes Schuldgefühl« verzichten und dafür »Strafbedürfnis« sagen, womit wir den beobachteten Sachverhalt ebenso treffend decken. Wir können uns aber nicht abhalten lassen, dies unbewußte Schuldgefühl nach dem Muster des bewußten zu beurteilen und zu lokalisieren.
Wir haben dem Über-Ich die Funktion des Gewissens zugeschrieben und im Schuldbewußtsein den Ausdruck einer Spannung zwischen Ich und Über-Ich erkannt. Das Ich reagiert mit Angstgefühlen (Gewissensangst) auf die Wahrnehmung, daß es hinter den von seinem Ideal, dem Über-Ich, gestellten Anforderungen zurückgeblieben ist. Nun verlangen wir zu wissen, wie das Über-Ich zu dieser anspruchsvollen Rolle gekommen ist und warum das Ich im Falle einer Differenz mit seinem Ideal sich fürchten muß.
Wenn wir gesagt haben, das Ich finde seine Funktion darin, die Ansprüche der drei Instanzen, denen es dient, miteinander zu vereinbaren, sie zu versöhnen, so können wir hinzufügen, es hat auch dabei sein Vorbild, dem es nachstreben kann, im Über-Ich. Dies Über-Ich ist nämlich ebensosehr der Vertreter des Es wie der Außenwelt. Es ist dadurch entstanden, daß die ersten Objekte der libidinösen Regungen des Es, das Elternpaar, ins Ich introjiziert wurden, wobei die Beziehung zu ihnen desexualisiert wurde, eine Ablenkung von den direkten Sexualzielen erfuhr. Auf diese Art wurde erst die Überwindung des Ödipuskomplexes ermöglicht. Das Über-Ich behielt nun wesentliche Charaktere der introjizierten Personen bei, ihre Macht, Strenge, Neigung zur Beaufsichtigung und Bestrafung. Wie an anderer Stelle ausgeführt [Fußnote]Das Ich und das Es., ist es leicht denkbar, daß durch die Triebentmischung, welche mit einer solchen Einführung ins Ich einhergeht, die Strenge eine Steigerung erfuhr. Das Über-Ich, das in ihm wirksame Gewissen, kann nun hart, grausam, unerbittlich gegen das von ihm behütete Ich werden. Der kategorische Imperativ Kants ist so der direkte Erbe des Ödipuskomplexes.
Die nämlichen Personen aber, welche im Über-Ich als Gewissensinstanz weiterwirken, nachdem sie aufgehört haben, Objekte der libidinösen Regungen des Es zu sein, gehören aber auch der realen Außenwelt an. Dieser sind sie entnommen worden; ihre Macht, hinter der sich alle Einflüsse der Vergangenheit und Überlieferung verbergen, war eine der fühlbarsten Äußerungen der Realität. Dank diesem Zusammenfallen wird das Über-Ich, der Ersatz des Ödipuskomplexes, auch zum Repräsentanten der realen Außenwelt und so zum Vorbild für das Streben des Ichs.
Der Ödipuskomplex erweist sich so, wie bereits historisch gemutmaßt wurde [Fußnote]Totem und Tabu (1912–;13), Abschnitt IV., als die Quelle unserer individuellen Sittlichkeit (Moral). Im Laufe der Kindheitsentwicklung, welche zur fortschreitenden Loslösung von den Eltern führt, tritt deren persönliche Bedeutung für das Über-Ich zurück. An die von ihnen erübrigten Imagines schließen dann die Einflüsse von Lehrern, Autoritäten, selbstgewählten Vorbildern und sozial anerkannten Helden an, deren Personen von dem resistenter gewordenen Ich nicht mehr introjiziert zu werden brauchen. Die letzte Gestalt dieser mit den Eltern beginnenden Reihe ist die dunkle Macht des Schicksals, welches erst die wenigsten von uns unpersönlich zu erfassen vermögen. Wenn der holländische Dichter Multatuli [Fußnote]Ed. Douwes Dekker (1820–;1887). die Μοι̃ρα [Fußnote]Schicksal der Griechen durch das Götterpaar Λόγος καὶ ’Ανάγκη [Fußnote]Vernunft/Einsicht und Notwendigkeit ersetzt, so ist dagegen wenig einzuwenden; aber alle, die die Leitung des Weltgeschehens der Vorsehung, Gott oder Gott und der Natur übertragen, erwecken den Verdacht, daß sie diese äußersten und fernsten Gewalten immer noch wie ein Elternpaar –; mythologisch –; empfinden und sich mit ihnen durch libidinöse Bindungen verknüpft glauben. Ich habe im Ich und Es den Versuch gemacht, auch die reale Todesangst der Menschen von einer solchen elterlichen Auffassung des Schicksals abzuleiten. Es scheint sehr schwer, sich von ihr frei zu machen.
Nach diesen Vorbereitungen können wir zur Würdigung des moralischen Masochismus zurückkehren. Wir sagten, die betreffenden Personen erwecken durch ihr Benehmen –; in der Kur und im Leben –; den Eindruck, als seien sie übermäßig moralisch gehemmt, ständen unter der Herrschaft eines besonders empfindlichen Gewissens, obwohl ihnen von solcher Übermoral nichts bewußt ist. Bei näherem Eingehen bemerken wir wohl den Unterschied, der eine solche unbewußte Fortsetzung der Moral vom moralischen Masochismus trennt. Bei der ersteren fällt der Akzent auf den gesteigerten Sadismus des Über-Ichs, dem das Ich sich unterwirft, beim letzteren hingegen auf den eigenen Masochismus des Ichs, der nach Strafe, sei es vom Über-Ich, sei es von den Elternmächten draußen, verlangt. Unsere anfängliche Verwechslung darf entschuldigt werden, denn beide Male handelt es sich um eine Relation zwischen dem Ich und dem Über-Ich oder ihm gleichstehenden Mächten; in beiden Fällen kommt es auf ein Bedürfnis hinaus, das durch Strafe und Leiden befriedigt wird. Es ist dann ein kaum gleichgültiger Nebenumstand, daß der Sadismus des Über-Ichs meist grell bewußt wird, während das masochistische Streben des Ichs in der Regel der Person verborgen bleibt und aus ihrem Verhalten erschlossen werden muß.
Die Unbewußtheit des moralischen Masochismus leitet uns auf eine naheliegende Spur. Wir konnten den Ausdruck »unbewußtes Schuldgefühl« übersetzen als Strafbedürfnis von Seiten einer elterlichen Macht. Nun wissen wir, daß der in Phantasien so häufige Wunsch, vom Vater geschlagen zu werden, dem anderen sehr nahesteht, in passive (feminine) sexuelle Beziehung zu ihm zu treten, und nur eine regressive Entstellung desselben ist. Setzen wir diese Aufklärung in den Inhalt des moralischen Masochismus ein, so wird dessen geheimer Sinn uns offenbar. Gewissen und Moral sind durch die Überwindung, Desexualisierung, des Ödipuskomplexes entstanden; durch den moralischen Masochismus wird die Moral wieder sexualisiert, der Ödipuskomplex neu belebt, eine Regression von der Moral zum Ödipuskomplex angebahnt. Dies geschieht weder zum Vorteil der Moral noch des Individuums. Der einzelne kann zwar neben seinem Masochismus sein volles oder ein gewisses Maß von Sittlichkeit bewahrt haben, es kann aber auch ein gutes Stück seines Gewissens an den Masochismus verlorengegangen sein. Andererseits schafft der Masochismus die Versuchung zum »sündhaften« Tun, welches dann durch die Vorwürfe des sadistischen Gewissens (wie bei so vielen russischen Charaktertypen) oder durch die Züchtigung der großen Elternmacht des Schicksals gesühnt werden muß. Um die Bestrafung durch diese letzte Elternvertretung zu provozieren, muß der Masochist das Unzweckmäßige tun, gegen seinen eigenen Vorteil arbeiten, die Aussichten zerstören, die sich ihm in der realen Welt eröffnen, und eventuell seine eigene reale Existenz vernichten.
Die Rückwendung des Sadismus gegen die eigene Person ereignet sich regelmäßig bei der kulturellen Triebunterdrückung, welche einen großen Teil der destruktiven Triebkomponenten der Person von der Verwendung im Leben abhält. Man kann sich vorstellen, daß dieser zurückgetretene Anteil des Destruktionstriebes als eine Steigerung des Masochismus im Ich zum Vorschein kommt. Die Phänomene des Gewissens lassen aber erraten, daß die von der Außenwelt wiederkehrende Destruktion auch ohne solche Verwandlung vom Über-Ich aufgenommen wird und dessen Sadismus gegen das Ich erhöht. Der Sadismus des Über-Ichs und der Masochismus des Ichs ergänzen einander und vereinigen sich zur Hervorrufung derselben Folgen. Ich meine, nur so kann man verstehen, daß aus der Triebunterdrückung –; häufig oder ganz allgemein –; ein Schuldgefühl resultiert und daß das Gewissen um so strenger und empfindlicher wird, je mehr sich die Person der Aggression gegen andere enthält. Man könnte erwarten, daß ein Individuum, welches von sich weiß, daß es kulturell unerwünschte Aggressionen zu vermeiden pflegt, darum ein gutes Gewissen hat und sein Ich minder mißtrauisch überwacht. Man stellt es gewöhnlich so dar, als sei die sittliche Anforderung das Primäre und der Triebverzicht ihre Folge. Dabei bleibt die Herkunft der Sittlichkeit unerklärt. In Wirklichkeit scheint es umgekehrt zuzugehen; der erste Triebverzicht ist ein durch äußere Mächte erzwungener, und er schafft erst die Sittlichkeit, die sich im Gewissen ausdrückt und weiteren Triebverzicht fordert.
So wird der moralische Masochismus zum klassischen Zeugen für die Existenz der Triebvermischung. Seine Gefährlichkeit rührt daher, daß er vom Todestrieb abstammt, jenem Anteil desselben entspricht, welcher der Auswärtswendung als Destruktionstrieb entging. Aber da er anderseits die Bedeutung einer erotischen Komponente hat, kann auch die Selbstzerstörung der Person nicht ohne libidinöse Befriedigung erfolgen.
Das Tabu der Virginität (1918)
Wenige Einzelheiten des Sexuallebens primitiver Völker wirken so befremdend auf unser Gefühl wie deren Einschätzung der Virginität, der weiblichen Unberührtheit. Uns erscheint die Wertschätzung der Virginität von Seiten des werbenden Mannes so feststehend und selbstverständlich, daß wir beinahe in Verlegenheit geraten, wenn wir dieses Urteil begründen sollen. Die Forderung, das Mädchen dürfe in die Ehe mit dem einen Manne nicht die Erinnerung an Sexualverkehr mit einem anderen mitbringen, ist ja nichts anderes als die konsequente Fortführung des ausschließlichen Besitzrechtes auf ein Weib, welches das Wesen der Monogamie ausmacht, die Erstreckung dieses Monopols auf die Vergangenheit.
Es fällt uns dann nicht schwer, was zuerst ein Vorurteil zu sein schien, aus unseren Meinungen über das Liebesleben des Weibes zu rechtfertigen. Wer zuerst die durch lange Zeit mühselig zurückgehaltene Liebessehnsucht der Jungfrau befriedigt und dabei die Widerstände überwunden hat, die in ihr durch die Einflüsse von Milieu und Erziehung aufgebaut waren, der wird von ihr in ein dauerndes Verhältnis gezogen, dessen Möglichkeit sich keinem anderen mehr eröffnet. Auf Grund dieses Erlebnisses stellt sich bei der Frau ein Zustand von Hörigkeit her, der die ungestörte Fortdauer ihres Besitzes verbürgt und sie widerstandsfähig macht gegen neue Eindrücke und fremde Versuchungen.
Den Ausdruck »geschlechtliche Hörigkeit« hat 1892 v. Krafft-Ebing zur Bezeichnung der Tatsache gewählt, daß eine Person einen ungewöhnlich hohen Grad von Abhängigkeit und Unselbständigkeit gegen eine andere Person erwerben kann, mit welcher sie im Sexualverkehr steht. Diese Hörigkeit kann gelegentlich sehr weit gehen, bis zum Verlust jedes selbständigen Willens und bis zur Erduldung der schwersten Opfer am eigenen Interesse; der Autor hat aber nicht versäumt zu bemerken, daß ein gewisses Maß solcher Abhängigkeit »durchaus notwendig ist, wenn die Verbindung einige Dauer haben soll«. Ein solches Maß von sexueller Hörigkeit ist in der Tat unentbehrlich zur Aufrechterhaltung der kulturellen Ehe und zur Hintanhaltung der sie bedrohenden polygamen Tendenzen, und in unserer sozialen Gemeinschaft wird dieser Faktor regelmäßig in Anrechnung gebracht.
Ein »ungewöhnlicher Grad von Verliebtheit und Charakterschwäche« einerseits, uneingeschränkter Egoismus beim anderen Teil, aus diesem Zusammentreffen leitet v. Krafft-Ebing die Entstehung der sexuellen Hörigkeit ab. Analytische Erfahrungen gestatten es aber nicht, sich mit diesem einfachen Erklärungsversuch zu begnügen. Man kann vielmehr erkennen, daß die Größe des überwundenen Sexualwiderstandes das entscheidende Moment ist, dazu die Konzentration und Einmaligkeit des Vorganges der Überwindung. Die Hörigkeit ist demgemäß ungleich häufiger und intensiver beim Weibe als beim Manne, bei letzterem aber in unseren Zeiten immerhin häufiger als in der Antike. Wo wir die sexuelle Hörigkeit bei Männern studieren konnten, erwies sie sich als Erfolg der Überwindung einer psychischen Impotenz durch ein bestimmtes Weib, an welches der betreffende Mann von da an gebunden blieb. Viele auffällige Eheschließungen und manches tragische Schicksal –; selbst von weitreichendem Belange –; scheint in diesem Hergange seine Aufklärung zu finden.
Das nun zu erwähnende Verhalten primitiver Völker beschreibt man nicht richtig, wenn man aussagt, sie legten keinen Wert auf die Virginität, und zum Beweise dafür vorbringt, daß sie die Defloration der Mädchen außerhalb der Ehe und vor dem ersten ehelichen Verkehre vollziehen lassen. Es scheint im Gegenteile, daß auch für sie die Defloration ein bedeutungsvoller Akt ist, aber sie ist Gegenstand eines Tabu, eines religiös zu nennenden Verbotes, geworden. Anstatt sie dem Bräutigam und späteren Ehegatten des Mädchens vorzubehalten, fordert die Sitte, daß dieser einer solchen Leistung ausweiche[Fußnote]Crawley (1902); Bartels-Ploß (1891); verschiedene Stellen in Frazer (1911) und Havelock Ellis..
Es liegt nicht in meiner Absicht, die literarischen Zeugnisse für den Bestand dieses Sittenverbotes vollständig zu sammeln, die geographische Verbreitung desselben zu verfolgen und alle Formen, in denen es sich äußert, aufzuzählen. Ich begnüge mich also mit der Feststellung, daß eine solche, außerhalb der späteren Ehe fallende Beseitigung des Hymens bei den heute lebenden primitiven Völkern etwas sehr Verbreitetes ist. So äußert Crawley (1902, 347): » This marriage ceremony consists in perforation of the hymen by some appointed person other than the husband; it is most common in the lowest stages of culture, especially in Australia.«
Wenn aber die Defloration nicht durch den ersten ehelichen Verkehr erfolgen soll, so muß sie vorher –; auf irgendeine Weise und von irgendwelcher Seite –; vorgenommen worden sein. Ich werde einige Stellen aus Crawleys obenerwähntem Buche anführen, welche über diese Punkte Auskunft geben, die uns aber auch zu einigen kritischen Bemerkungen berechtigen.
Ibid., 191: »Bei den Dieri und einigen Nachbarstämmen (in Australien) ist es allgemeiner Brauch, das Hymen zu zerstören, wenn das Mädchen die Pubertät erreicht hat. Bei den Portland- und Glenelg-Stämmen fällt es einer alten Frau zu, dies bei der Braut zu tun, und mitunter werden auch weiße Männer in solcher Absicht aufgefordert, Mädchen zu entjungfern.« [Fußnote]» Thus in the Dieri and neighbouring tribes (in Australia) it is the universal custom when a girl reaches puberty to rupture the hymen. (Journ. Anthrop. Inst., Bd. 24, 169.) In the Portland and Glenelg tribes this is done to the bride by an old woman; and sometimes white men are asked for this reason to deflower maidens (Brough Smith, Bd. 2, 319).«
Ibid., 307: »Die absichtliche Zerreißung des Hymens wird manchmal in der Kindheit, gewöhnlich aber zur Zeit der Pubertät ausgeführt... Sie wird oft –; wie in Australien –; mit einem offiziellen Begattungsakte kombiniert.« [Fußnote]» The artificial rupture of the hymen sometimes takes place in infancy, but generally at puberty... It is often combined, as in Australia, with a ceremonial act of intercourse.«
Ibid., 348: (Von australischen Stämmen, bei denen die bekannten exogamischen Heiratsbeschränkungen bestehen, nach Mitteilung von Spencer und Gillen:) »Das Hymen wird künstlich durchbohrt, und die Männer, die bei dieser Operation zugegen waren, führen dann in festgesetzter Reihenfolge einen (wohlgemerkt: zeremoniellen) Koitus mit dem Mädchen aus... Der ganze Vorgang hat sozusagen zwei Akte: Die Zerstörung des Hymens und darauf den Geschlechtsverkehr.« [Fußnote]» The hymen is artificially perforated, and then the assisting men have access (ceremonial, be it observed) to the girl in a stated order... The act is in two parts, perforation and intercourse.«
Ibid., 349: »Bei den Massai (im äquatorialen Afrika) gehört die Vornahme dieser Operation zu den wichtigsten Vorbereitungen für die Ehe. Bei den Sakais (Malaien), den Battas (Sumatra) und den Alfoers auf Celebes wird die Defloration vom Vater der Braut ausgeführt. Auf den Philippinen gab es bestimmte Männer, die den Beruf hatten, Bräute zu deflorieren, falls das Hymen nicht schon in der Kindheit von einer dazu beauftragten alten Frau zerstört worden war. Bei einigen Eskimostämmen wurde die Entjungferung der Braut dem Angekok oder Priester überlassen.« [Fußnote]» An important preliminary of marriage amongst the Masai (in Equatorial Africa) is the performance of this operation on the girl. (J.Thomson, 258.) This defloration is performed by the father of the bride amongst the Sakais (Malay), Battas (Sumatra), and Alfoers of Celebes. (Ploß und Bartels, Bd. 2, 490.) In the Philippines there were certain men whose profession it was to deflower brides, in case the hymen had not been ruptured in childhood by an old woman who was sometimes employed for this. (Featherman, Bd. 2, 474.) The defloration of the bride was amongst some Eskimo tribes entrusted to the angekok, or priest. (Ibid., Bd. 3, 406.)
Die Bemerkungen, die ich angekündigt habe, beziehen sich auf zwei Punkte. Es ist erstens zu bedauern, daß in diesen Angaben nicht sorgfältiger zwischen der bloßen Zerstörung des Hymens ohne Koitus und dem Koitus zum Zwecke solcher Zerstörung unterschieden wird. Nur an einer Stelle hörten wir ausdrücklich, daß der Vorgang sich in zwei Akte zerlegt, in die (manuelle oder instrumentale) Defloration und den darauffolgenden Geschlechtsakt. Das sonst sehr reichliche Material bei Bartels-Ploß wird für unsere Zwecke nahezu unbrauchbar, weil in dieser Darstellung die psychologische Bedeutsamkeit des Deflorationsaktes gegen dessen anatomischen Erfolg völlig verschwindet. Zweitens möchte man gerne darüber belehrt werden, wodurch sich der »zeremonielle« (rein formale, feierliche, offizielle) Koitus bei diesen Gelegenheiten vom regelrechten Geschlechtsverkehr unterscheidet. Die Autoren, zu denen ich Zugang hatte, waren entweder zu schämig, sich darüber zu äußern, oder haben wiederum die psychologische Bedeutung solcher sexueller Details unterschätzt. Wir können hoffen, daß die Originalberichte der Reisenden und Missionäre ausführlicher und unzweideutiger sind, aber bei der heutigen Unzugänglichkeit dieser meist fremdländischen Literatur kann ich nichts Sicheres darüber sagen. Übrigens darf man sich über die Zweifel in diesem zweiten Punkte mit der Erwägung hinwegsetzen, daß ein zeremonieller Scheinkoitus doch nur den Ersatz und vielleicht die Ablösung für einen in früheren Zeiten voll ausgeführten darstellen würde [Fußnote]Für zahlreiche andere Fälle von Hochzeitszeremoniell leidet es keinen Zweifel, daß anderen Personen als dem Bräutigam, z. B. den Gehilfen und Gefährten desselben (den »Kranzelherren« unserer Sitte), die sexuelle Verfügung über die Braut voll eingeräumt wird..
Zur Erklärung dieses Tabu der Virginität kann man verschiedenartige Momente heranziehen, die ich in flüchtiger Darstellung würdigen will. Bei der Defloration der Mädchen wird in der Regel Blut vergossen; der erste Erklärungsversuch beruft sich denn auch auf die Blutscheu der Primitiven, die das Blut für den Sitz des Lebens halten. Dieses Bluttabu ist durch vielfache Vorschriften, die mit der Sexualität nichts zu tun haben, erwiesen, es hängt offenbar mit dem Verbote, nicht zu morden, zusammen und bildet eine Schutzwehr gegen den ursprünglichen Blutdurst, die Mordlust des Urmenschen. Bei dieser Auffassung wird das Tabu der Virginität mit dem fast ausnahmslos eingehaltenen Tabu der Menstruation zusammengebracht. Der Primitive kann das rätselhafte Phänomen des blutigen Monatsflusses nicht von sadistischen Vorstellungen fernehalten. Die Menstruation, zumal die erste, deutet er als den Biß eines geisterhaften Tieres, vielleicht als Zeichen des sexuellen Verkehrs mit diesem Geist. Gelegentlich gestattet ein Bericht, diesen Geist als den eines Ahnen zu erkennen, und dann verstehen wir in Anlehnung an andere Einsichten [Fußnote]Siehe Totem und Tabu (1912-13)., daß das menstruierende Mädchen als Eigentum dieses Ahnengeistes tabu ist.
Von anderer Seite werden wir aber gewarnt, den Einfluß eines Moments wie die Blutscheu nicht zu überschätzen. Diese hat es doch nicht vermocht, Gebräuche wie die Beschneidung der Knaben und die noch grausamere der Mädchen (Exzision der Klitoris und der kleinen Labien), die zum Teile bei den nämlichen Völkern geübt werden, zu unterdrücken oder die Geltung von anderem Zeremoniell, bei dem Blut vergossen wird, aufzuheben. Es wäre also auch nicht zu verwundern, wenn sie bei der ersten Kohabitation zugunsten des Ehemannes überwunden würde.
Eine zweite Erklärung sieht gleichfalls vom Sexuellen ab, greift aber viel weiter ins Allgemeine aus. Sie führt an, daß der Primitive die Beute einer beständig lauernden Angstbereitschaft ist, ganz ähnlich, wie wir es in der psychoanalytischen Neurosenlehre vom Angstneurotiker behaupten. Diese Angstbereitschaft wird sich am stärksten bei allen Gelegenheiten zeigen, die irgendwie vom Gewohnten abweichen, die etwas Neues, Unerwartetes, Unverstandenes, Unheimliches mit sich bringen. Daher stammt auch das weit in die späteren Religionen hineinreichende Zeremoniell, das mit dem Beginne jeder neuen Verrichtung, dem Anfange jedes Zeitabschnittes, dem Erstlingsertrag von Mensch, Tier und Frucht verknüpft ist. Die Gefahren, von denen sich der Ängstliche bedroht glaubt, treten niemals stärker in seiner Erwartung auf als zu Beginn der gefahrvollen Situation, und dann ist es auch allein zweckmäßig, sich gegen sie zu schützen. Der erste Sexualverkehr in der Ehe hat nach seiner Bedeutung gewiß einen Anspruch darauf, von diesen Vorsichtsmaßregeln eingeleitet zu werden. Die beiden Erklärungsversuche, der aus der Blutscheu und der aus der Erstlingsangst, widersprechen einander nicht, verstärken einander vielmehr. Der erste Sexualverkehr ist gewiß ein bedenklicher Akt, um so mehr, wenn bei ihm Blut fließen muß.
Eine dritte Erklärung –; es ist die von Crawley bevorzugte –; macht darauf aufmerksam, daß das Tabu der Virginität in einen großen, das ganze Sexualleben umfassenden Zusammenhang gehört. Nicht nur der erste Koitus mit dem Weibe ist tabu, sondern der Sexualverkehr überhaupt; beinahe könnte man sagen, das Weib sei im ganzen tabu. Das Weib ist nicht nur tabu in den besonderen, aus seinem Geschlechtsleben abfolgenden Situationen der Menstruation, der Schwangerschaft, der Entbindung und des Kindbettes, auch außerhalb derselben unterliegt der Verkehr mit dem Weibe so ernsthaften und so reichlichen Einschränkungen, daß wir allen Grund haben, die angebliche Sexualfreiheit der Wilden zu bezweifeln. Es ist richtig, daß die Sexualität der Primitiven bei bestimmten Anlässen sich über alle Hemmungen hinaussetzt; gewöhnlich aber scheint sie stärker durch Verbote eingeschnürt als auf höheren Kulturstufen. Sowie der Mann etwas Besonderes unternimmt, eine Expedition, eine Jagd, einen Kriegszug, muß er sich vom Weibe, zumal vom Sexualverkehr mit dem Weibe fernhalten; es würde sonst seine Kraft lähmen und ihm Mißerfolg bringen. Auch in den Gebräuchen des täglichen Lebens ist ein Streben nach dem Auseinanderhalten der Geschlechter unverkennbar. Weiber leben mit Weibern, Männer mit Männern zusammen; ein Familienleben in unserem Sinne soll es bei vielen primitiven Stämmen kaum geben. Die Trennung geht mitunter so weit, daß das eine Geschlecht die persönlichen Namen des anderen Geschlechts nicht aussprechen darf, daß die Frauen eine Sprache mit besonderem Wortschatze entwickeln. Das sexuelle Bedürfnis darf diese Trennungsschranken immer wieder von neuem durchbrechen, aber bei manchen Stämmen müssen selbst die Zusammenkünfte der Ehegatten außerhalb des Hauses und im Geheimen stattfinden.
Wo der Primitive ein Tabu hingesetzt hat, da fürchtet er eine Gefahr, und es ist nicht abzuweisen, daß sich in all diesen Vermeidungsvorschriften eine prinzipielle Scheu vor dem Weibe äußert. Vielleicht ist diese Scheu darin begründet, daß das Weib anders ist als der Mann, ewig unverständlich und geheimnisvoll, fremdartig und darum feindselig erscheint. Der Mann fürchtet, vom Weibe geschwächt, mit dessen Weiblichkeit angesteckt zu werden und sich dann untüchtig zu zeigen. Die erschlaffende, Spannungen lösende Wirkung des Koitus mag für diese Befürchtung vorbildlich sein und die Wahrnehmung des Einflusses, den das Weib durch den Geschlechtsverkehr auf den Mann gewinnt, die Rücksicht, die es sich dadurch erzwingt, die Ausbreitung dieser Angst rechtfertigen. An all dem ist nichts, was veraltet wäre, was nicht unter uns weiterlebte.
Viele Beobachter der heute lebenden Primitiven haben das Urteil gefällt, daß deren Liebesstreben verhältnismäßig schwach sei und niemals die Intensitäten erreiche, die wir bei der Kulturmenschheit zu finden gewohnt sind. Andere haben dieser Schätzung widersprochen, aber jedenfalls zeugen die aufgezählten Tabugebräuche von der Existenz einer Macht, die sich der Liebe widersetzt, indem sie das Weib als fremd und feindselig ablehnt.
In Ausdrücken, welche sich nur wenig von der gebräuchlichen Terminologie der Psychoanalyse unterscheiden, legt Crawley dar, daß jedes Individuum sich durch ein » taboo of personal isolation« von den anderen absondert und daß gerade die kleinen Unterschiede bei sonstiger Ähnlichkeit die Gefühle von Fremdheit und Feindseligkeit zwischen ihnen begründen. Es wäre verlockend, dieser Idee nachzugehen und aus diesem »Narzißmus der kleinen Unterschiede« die Feindseligkeit abzuleiten, die wir in allen menschlichen Beziehungen erfolgreich gegen die Gefühle von Zusammengehörigkeit streiten und das Gebot der allgemeinen Menschenliebe überwältigen sehen. Von der Begründung der narzißtischen, reichlich mit Geringschätzung versetzten Ablehnung des Weibes durch den Mann glaubt die Psychoanalyse ein Hauptstück erraten zu haben, indem sie auf den Kastrationskomplex und dessen Einfluß auf die Beurteilung des Weibes verweist.
Wir merken indes, daß wir mit diesen letzten Erwägungen weit über unser Thema hinausgegriffen haben. Das allgemeine Tabu des Weibes wirft kein Licht auf die besonderen Vorschriften für den ersten Sexualakt mit dem jungfräulichen Individuum. Hier bleiben wir auf die beiden ersten Erklärungen der Blutscheu und der Erstlingsscheu angewiesen, und selbst von diesen müßten wir aussagen, daß sie den Kern des in Rede stehenden Tabugebotes nicht treffen. Diesem liegt ganz offenbar die Absicht zugrunde, gerade dem späteren Ehemanne etwas zu versagen oder zu ersparen, was von dem ersten Sexualakt nicht loszulösen ist, wiewohl sich nach unserer eingangs gemachten Bemerkung von dieser selben Beziehung eine besondere Bindung des Weibes an diesen einen Mann ableiten müßte.
Es ist diesmal nicht unsere Aufgabe, die Herkunft und letzte Bedeutung der Tabuvorschriften zu erörtern. Ich habe dies in meinem Buche Totem und Tabu getan, dort die Bedingung einer ursprünglichen Ambivalenz für das Tabu gewürdigt und die Entstehung desselben aus den vorzeitlichen Vorgängen verfochten, welche zur Gründung der menschlichen Familie geführt haben. Aus den heute beobachteten Tabugebräuchen der Primitiven läßt sich eine solche Vorbedeutung nicht mehr erkennen. Wir vergessen bei solcher Forderung allzu leicht, daß auch die primitivsten Völker in einer von der urzeitlichen weit entfernten Kultur leben, die zeitlich ebenso alt ist wie die unsrige und gleichfalls einer späteren, wenn auch andersartigen Entwicklungsstufe entspricht.
Wir finden heute das Tabu bei den Primitiven bereits zu einem kunstvollen System ausgesponnen, ganz wie es unsere Neurotiker in ihren Phobien entwickeln, und alte Motive durch neuere, harmonisch zusammenstimmende, ersetzt. Mit Hinwegsetzung über jene genetischen Probleme wollen wir darum auf die Einsicht zurückgreifen, daß der Primitive dort ein Tabu anbringt, wo er eine Gefahr befürchtet. Diese Gefahr ist, allgemein gefaßt, eine psychische, denn der Primitive ist nicht dazu gedrängt, hier zwei Unterscheidungen vorzunehmen, die uns als unausweichlich erscheinen. Er sondert die materielle Gefahr nicht von der psychischen und die reale nicht von der imaginären. In seiner konsequent durchgeführten animistischen Weltauffassung stammt ja jede Gefahr aus der feindseligen Absicht eines gleich ihm beseelten Wesens, sowohl die Gefahr, die von einer Naturkraft droht, wie die von anderen Menschen oder Tieren. Anderseits aber ist er gewohnt, seine eigenen inneren Regungen von Feindseligkeit in die Außenwelt zu projizieren, sie also den Objekten, die er als unliebsam oder auch nur als fremd empfindet, zuzuschieben. Als Quelle solcher Gefahren wird nun auch das Weib erkannt und der erste Sexualakt mit dem Weibe als eine besonders intensive Gefahr ausgezeichnet.
Ich glaube nun, wir werden einigen Aufschluß darüber erhalten, welches diese gesteigerte Gefahr ist und warum sie gerade den späteren Ehemann bedroht, wenn wir das Verhalten der heute lebenden Frauen unserer Kulturstufe unter den gleichen Verhältnissen genauer untersuchen. Ich stelle als das Ergebnis dieser Untersuchung voran, daß eine solche Gefahr wirklich besteht, so daß der Primitive sich mit dem Tabu der Virginität gegen eine richtig geahnte, wenn auch psychische Gefahr verteidigt.
Wir schätzen es als die normale Reaktion ein, daß die Frau nach dem Koitus auf der Höhe der Befriedigung den Mann umarmend an sich preßt, sehen darin einen Ausdruck ihrer Dankbarkeit und eine Zusage dauernder Hörigkeit. Wir wissen aber, es ist keineswegs die Regel, daß auch der erste Verkehr dies Benehmen zur Folge hätte; sehr häufig bedeutet er bloß eine Enttäuschung für das Weib, das kühl und unbefriedigt bleibt, und es bedarf gewöhnlich längerer Zeit und häufigerer Wiederholung des Sexualaktes, bis sich bei diesem die Befriedigung auch für das Weib einstellt. Von diesen Fällen bloß anfänglicher und bald vorübergehender Frigidität führt eine stetige Reihe bis zu dem unerfreulichen Ergebnis einer stetig anhaltenden Frigidität, die durch keine zärtliche Bemühung des Mannes überwunden wird. Ich glaube, diese Frigidität des Weibes ist noch nicht genügend verstanden und fordert bis auf jene Fälle, die man der ungenügenden Potenz des Mannes zur Last legen muß, die Aufklärung, womöglich durch ihr nahestehende Erscheinungen, heraus.
Die so häufigen Versuche, vor dem ersten Sexualverkehr die Flucht zu ergreifen, möchte ich hier nicht heranziehen, weil sie mehrdeutig und in erster Linie, wenn auch nicht durchaus, als Ausdruck des allgemeinen weiblichen Abwehrbestrebens aufzufassen sind. Dagegen glaube ich, daß gewisse pathologische Fälle ein Licht auf das Rätsel der weiblichen Frigidität werfen, in denen die Frau nach dem ersten, ja nach jedem neuerlichen Verkehr ihre Feindseligkeit gegen den Mann unverhohlen zum Ausdruck bringt, indem sie ihn beschimpft, die Hand gegen ihn erhebt oder ihn tatsächlich schlägt. In einem ausgezeichneten Falle dieser Art, den ich einer eingehenden Analyse unterziehen konnte, geschah dies, obwohl die Frau den Mann sehr liebte, den Koitus selbst zu fordern pflegte und in ihm unverkennbar hohe Befriedigung fand. Ich meine, daß diese sonderbare konträre Reaktion der Erfolg der nämlichen Regungen ist, die sich für gewöhnlich nur als Frigidität äußern können, das heißt imstande sind, die zärtliche Reaktion aufzuhalten, ohne sich dabei selbst zur Geltung zu bringen. In dem pathologischen Falle ist sozusagen in seine beiden Komponenten zerlegt, was sich bei der weit häufigeren Frigidität zu einer Hemmungswirkung vereinigt, ganz ähnlich, wie wir es an den sogenannten »zweizeitigen« Symptomen der Zwangsneurose längst erkannt haben. Die Gefahr, welche so durch die Defloration des Weibes regegemacht wird, bestünde darin, sich die Feindseligkeit desselben zuzuziehen, und gerade der spätere Ehemann hätte allen Grund, sich solcher Feindschaft zu entziehen.
Die Analyse läßt nun ohne Schwierigkeit erraten, welche Regungen des Weibes am Zustandekommen jenes paradoxen Verhaltens beteiligt sind, in dem ich die Aufklärung der Frigidität zu finden erwarte. Der erste Koitus macht eine Reihe solcher Regungen mobil, die für die erwünschte weibliche Einstellung unverwendbar sind, von denen einige sich auch bei späterem Verkehr nicht zu wiederholen brauchen. In erster Linie wird man hier an den Schmerz denken, welcher der Jungfrau bei der Defloration zugefügt wird, ja vielleicht geneigt sein, dies Moment für entscheidend zu halten und von der Suche nach anderen abzustehen. Man kann aber eine solche Bedeutung nicht gut dem Schmerze zuschreiben, muß vielmehr an seine Stelle die narzißtische Kränkung setzen, die aus der Zerstörung eines Organs erwächst und die in dem Wissen um die Herabsetzung des sexuellen Wertes der Deflorierten selbst eine rationelle Vertretung findet. Die Hochzeitsgebräuche der Primitiven enthalten aber eine Warnung vor solcher Überschätzung. Wir haben gehört, daß in manchen Fällen das Zeremoniell ein zweizeitiges ist; nach der (mit Hand oder Instrument) durchgeführten Zerreißung des Hymens folgt noch ein offizieller Koitus oder Scheinverkehr mit den Vertretern des Mannes, und dies beweist uns, daß der Sinn der Tabuvorschrift durch die Vermeidung der anatomischen Defloration nicht erfüllt ist, daß dem Ehemann noch etwas anderes erspart werden soll als die Reaktion der Frau auf die schmerzhafte Verletzung.
Wir finden als weiteren Grund für die Enttäuschung durch den ersten Koitus, daß für ihn, beim Kulturweibe wenigstens, Erwartung und Erfüllung nicht zusammenstimmen können. Der Sexualverkehr war bisher aufs stärkste mit dem Verbot assoziiert, der legale und erlaubte Verkehr wird darum nicht als das nämliche empfunden. Wie innig diese Verknüpfung sein kann, erhellt in beinahe komischer Weise aus dem Bestreben so vieler Bräute, die neuen Liebesbeziehungen vor allen Fremden, ja selbst vor den Eltern geheimzuhalten, wo eine wirkliche Nötigung dazu nicht besteht und ein Einspruch nicht zu erwarten ist. Die Mädchen sagen es offen, daß ihre Liebe an Wert für sie verliert, wenn andere davon wissen. Gelegentlich kann dies Motiv übermächtig werden und die Entwicklung der Liebesfähigkeit in der Ehe überhaupt verhindern. Die Frau findet ihre zärtliche Empfindlichkeit erst in einem unerlaubten, geheimzuhaltenden Verhältnis wieder, wo sie sich allein des eigenen unbeeinflußten Willens sicher weiß.
Indes, auch dieses Motiv führt nicht tief genug; außerdem läßt es, an Kulturbedingungen gebunden, eine gute Beziehung zu den Zuständen der Primitiven vermissen. Um so bedeutungsvoller ist das nächste, auf der Entwicklungsgeschichte der Libido fußende Moment. Es ist uns durch die Bemühungen der Analyse bekannt geworden, wie regelmäßig und wie mächtig die frühesten Unterbringungen der Libido sind. Es handelt sich dabei um festgehaltene Sexualwünsche der Kindheit, beim Weibe zumeist um Fixierung der Libido an den Vater oder an den ihn ersetzenden Bruder, Wünsche, die häufig genug auf anderes als den Koitus gerichtet waren oder ihn nur als unscharf erkanntes Ziel einschlossen. Der Ehemann ist sozusagen immer nur ein Ersatzmann, niemals der Richtige; den ersten Satz auf die Liebesfähigkeit der Frau hat ein anderer, in typischen Fällen der Vater, er höchstens den zweiten. Es kommt nun darauf an, wie intensiv diese Fixierung ist und wie zähe sie festgehalten wird, damit der Ersatzmann als unbefriedigend abgelehnt werde. Die Frigidität steht somit unter den genetischen Bedingungen der Neurose. Je mächtiger das psychische Element im Sexualleben der Frau ist, desto widerstandsfähiger wird sich ihre Libidoverteilung gegen die Erschütterung des ersten Sexualaktes erweisen, desto weniger überwältigend wird ihre körperliche Besitznahme wirken können. Die Frigidität mag sich dann als neurotische Hemmung festsetzen oder den Boden für die Entwicklung anderer Neurosen abgeben, und auch nur mäßige Herabsetzungen der männlichen Potenz kommen dabei als Helfer sehr in Betracht.
Dem Motiv des früheren Sexualwunsches scheint die Sitte der Primitiven Rechnung zu tragen, welche die Defloration einem Ältesten, Priester, heiligen Mann, also einem Vaterersatz (siehe oben), überträgt. Von hier aus scheint mir ein gerader Weg zum vielbestrittenen jus primae noctis des mittelalterlichen Gutsherrn zu führen. A. J. Storfer (1911) hat dieselbe Auffassung vertreten, überdies die weitverbreitete Institution der »Tobiasehe« (der Sitte der Enthaltsamkeit in den ersten drei Nächten) als eine Anerkennung der Vorrechte des Patriarchen gedeutet, wie vor ihm bereits C. G. Jung (1909). Es entspricht dann nur unserer Erwartung, wenn wir unter den mit der Defloration betrauten Vatersurrogaten auch das Götterbild finden. In manchen Gegenden von Indien mußte die Neuvermählte das Hymen dem hölzernen Lingam opfern, und nach dem Berichte des heiligen Augustinus bestand im römischen Heiratszeremoniell (seiner Zeit?) dieselbe Sitte mit der Abschwächung, daß sich die junge Frau auf den riesigen Steinphallus des Priapus nur zu setzen brauchte [Fußnote]Ploß und Bartels (1891, Bd. I, XII) und Dulaure (1905, 142)..
In noch tiefere Schichten greift ein anderes Motiv zurück, welches nachweisbar an der paradoxen Reaktion gegen den Mann die Hauptschuld trägt und dessen Einfluß sich nach meiner Meinung noch in der Frigidität der Frau äußert. Durch den ersten Koitus werden beim Weibe noch andere alte Regungen als die beschriebenen aktiviert, die der weiblichen Funktion und Rolle überhaupt widerstreben.
Wir wissen aus der Analyse vieler neurotischer Frauen, daß sie ein frühes Stadium durchmachen, in dem sie den Bruder um das Zeichen der Männlichkeit beneiden und sich wegen seines Fehlens (eigentlich seiner Verkleinerung) benachteiligt und zurückgesetzt fühlen. Wir ordnen diesen »Penisneid« dem »Kastrationskomplex« ein. Wenn man unter »männlich« das Männlichseinwollen mitversteht, so paßt auf dieses Verhalten die Bezeichnung »männlicher Protest«, die Alf. Adler geprägt hat, um diesen Faktor zum Träger der Neurose überhaupt zu proklamieren. In dieser Phase machen die Mädchen aus ihrem Neid und der daraus abgeleiteten Feindseligkeit gegen den begünstigten Bruder oft kein Hehl: sie versuchen es auch, aufrechtstehend wie der Bruder zu urinieren, um ihre angebliche Gleichberechtigung zu vertreten. In dem bereits erwähnten Falle von uneingeschränkter Aggression gegen den sonst geliebten Mann nach dem Koitus konnte ich feststellen, daß diese Phase vor der Objektwahl bestanden hatte. Erst später wandte sich die Libido des kleinen Mädchens dem Vater zu, und dann wünschte sie sich anstatt des Penis –; ein Kind [Fußnote]Siehe: ›Über Triebumsetzungen insbesondere der Analerotik‹ (1917 c)..
Ich würde nicht überrascht sein, wenn sich in anderen Fällen die Zeitfolge dieser Regungen umgekehrt fände und dies Stück des Kastrationskomplexes erst nach erfolgter Objektwahl zur Wirkung käme. Aber die männliche Phase des Weibes, in der es den Knaben um den Penis beneidet, ist jedenfalls die entwicklungsgeschichtlich frühere und steht dem ursprünglichen Narzißmus näher als der Objektliebe.
Vor einiger Zeit gab mir ein Zufall Gelegenheit, den Traum einer Neuvermählten zu erfassen, der sich als Reaktion auf ihre Entjungferung erkennen ließ. Er verriet ohne Zwang den Wunsch des Weibes, den jungen Ehemann zu kastrieren und seinen Penis bei sich zu behalten. Es war gewiß auch Raum für die harmlosere Deutung, es sei die Verlängerung und Wiederholung des Aktes gewünscht worden, allein manche Einzelheiten des Traumes gingen über diesen Sinn hinaus, und der Charakter wie das spätere Benehmen der Träumerin legten Zeugnis für die ernstere Auffassung ab. Hinter diesem Penisneid kommt nun die feindselige Erbitterung des Weibes gegen den Mann zum Vorschein, die in den Beziehungen der Geschlechter niemals ganz zu verkennen ist und von der in den Bestrebungen und literarischen Produktionen der » Emanzipierten« die deutlichsten Anzeichen vorliegen. Diese Feindseligkeit des Weibes führt Ferenczi –; ich weiß nicht, ob als erster –; in einer paläobiologischen Spekulation bis auf die Epoche der Differenzierung der Geschlechter zurück. Anfänglich, meint er, fand die Kopulation zwischen zwei gleichartigen Individuen statt, von denen sich aber eines zum stärkeren entwickelte und das schwächere zwang, die geschlechtliche Vereinigung zu erdulden. Die Erbitterung über dies Unterlegensein setze sich noch in der heutigen Anlage des Weibes fort. Ich halte es für vorwurfsfrei, sich solcher Spekulationen zu bedienen, solange man es vermeidet, sie zu überwerten.
Nach dieser Aufzählung der Motive für die in der Frigidität spurweise fortgesetzte paradoxe Reaktion des Weibes auf die Defloration darf man es zusammenfassend aussprechen, daß sich die unfertige Sexualität des Weibes an dem Manne entlädt, der sie zuerst den Sexualakt kennen lehrt. Dann ist aber das Tabu der Virginität sinnreich genug, und wir verstehen die Vorschrift, welche gerade den Mann solche Gefahren vermeiden heißt, der in ein dauerndes Zusammenleben mit dieser Frau eintreten soll. Auf höheren Kulturstufen ist die Schätzung dieser Gefahr gegen die Verheißung der Hörigkeit und gewiß auch gegen andere Motive und Verlockungen zurückgetreten; die Virginität wird als ein Gut betrachtet, auf welches der Mann nicht verzichten soll. Aber die Analyse der Ehestörungen lehrt, daß die Motive, welche das Weib dazu nötigen wollen, Rache für ihre Defloration zu nehmen, auch im Seelenleben des Kulturweibes nicht ganz erloschen sind. Ich meine, es muß dem Beobachter auffallen, in einer wie ungewöhnlich großen Anzahl von Fällen das Weib in einer ersten Ehe frigid bleibt und sich unglücklich fühlt, während sie nach Lösung dieser Ehe ihrem zweiten Manne eine zärtliche und beglückende Frau wird. Die archaische Reaktion hat sich sozusagen am ersten Objekt erschöpft.
Das Tabu der Virginität ist aber auch sonst in unserem Kulturleben nicht untergegangen. Die Volksseele weiß von ihm, und Dichter haben sich gelegentlich dieses Stoff es bedient. Anzengruber stellt in einer Komödie dar, wie sich ein einfältiger Bauernbursche abhalten läßt, die ihm zugedachte Braut zu heiraten, weil sie »a Dirn' is, was ihrem ersten 's Leben kost'«. Er willigt darum ein, daß sie einen anderen heirate, und will sie dann als Wittfrau nehmen, wo sie ungefährlich ist. Der Titel des Stückes: Das Jungferngift erinnert daran, daß Schlangenbändiger die Giftschlange vorerst in ein Tüchlein beißen lassen, um sie dann ungefährdet zu handhaben [Fußnote]Eine meisterhaft knappe Erzählung von A. Schnitzler (›Das Schicksal des Freiherrn v. Leisenbogh‹) verdient trotz der Abweichung in der Situation hier angereiht zu werden. Der durch einen Unfall verunglückte Liebhaber einer in der Liebe vielerfahrenen Schauspielerin hat ihr gleichsam eine neue Virginität geschaffen, indem er den Todesfluch über den Mann ausspricht, der sie zuerst nach ihm besitzen wird. Das mit diesem Tabu belegte Weib getraut sich auch eine Weile des Liebesverkehres nicht. Nachdem sie sich aber in einen Sänger verliebt hat, greift sie zur Auskunft, vorher dem Freiherrn v. Leisenbogh eine Nacht zu schenken, der sich seit Jahren erfolglos um sie bemüht. An ihm erfüllt sich auch der Fluch; er wird vom Schlag getroffen, sobald er das Motiv seines unverhofften Liebesglückes erfährt..
Das Tabu der Virginität und ein Stück seiner Motivierung hat seine mächtigste Darstellung in einer bekannten dramatischen Gestalt gefunden, in der Judith in Hebbels Tragödie Judith und Holofernes. Judith ist eine jener Frauen, deren Virginität durch ein Tabu geschützt ist. Ihr erster Mann wurde in der Brautnacht durch eine rätselhafte Angst gelähmt und wagte es nie mehr, sie zu berühren. »Meine Schönheit ist die der Tollkirsche«, sagt sie. »Ihr Genuß bringt Wahnsinn und Tod.« Als der assyrische Feldherr ihre Stadt bedrängt, faßt sie den Plan, ihn durch ihre Schönheit zu verführen und zu verderben, verwendet so ein patriotisches Motiv zur Verdeckung eines sexuellen. Nach der Defloration durch den gewaltigen, sich seiner Stärke und Rücksichtslosigkeit rühmenden Mann findet sie in ihrer Empörung die Kraft, ihm den Kopf abzuschlagen, und wird so zur Befreierin ihres Volkes. Köpfen ist uns als symbolischer Ersatz für Kastrieren wohlbekannt; danach ist Judith das Weib, das den Mann kastriert, von dem sie defloriert wurde, wie es auch der von mir berichtete Traum einer Neuvermählten wollte. Hebbel hat die patriotische Erzählung aus den Apokryphen des Alten Testaments in klarer Absichtlichkeit sexualisiert, denn dort kann Judith nach ihrer Rückkehr rühmen, daß sie nicht verunreinigt worden ist, auch fehlt im Text der Bibel jeder Hinweis auf ihre unheimliche Hochzeitsnacht. Wahrscheinlich hat er aber mit dem Feingefühl des Dichters das uralte Motiv verspürt, das in jene tendenziöse Erzählung eingegangen war, und dem Stoff nur seinen früheren Gehalt wiedergegeben.
J. Sadger (1912) hat in einer trefflichen Analyse ausgeführt, wie Hebbel durch seinen eigenen Elternkomplex in seiner Stoffwahl bestimmt wurde und wie er dazu kam, so regelmäßig im Kampfe der Geschlechter für das Weib Partei zu nehmen und sich in dessen verborgenste Seelenregungen einzufühlen. Er zitiert auch die Motivierung, die der Dichter selbst für die von ihm eingeführte Abänderung des Stoffes gegeben hat, und findet sie mit Recht gekünstelt und wie dazu bestimmt, etwas dem Dichter selbst Unbewußtes nur äußerlich zu rechtfertigen und im Grunde zu verdecken. Sadgers Erklärung, warum die nach der biblischen Erzählung verwitwete Judith zur jungfräulichen Witwe werden mußte, will ich nicht antasten. Er weist auf die Absicht der kindlichen Phantasie hin, den sexuellen Verkehr der Eltern zu verleugnen und die Mutter zur unberührten Jungfrau zu machen. Aber ich setze fort: Nachdem der Dichter die Jungfräulichkeit seiner Heldin festgelegt hatte, verweilte seine nachfühlende Phantasie bei der feindseligen Reaktion, die durch die Verletzung der Virginität ausgelöst wird.
Wir dürfen also abschließend sagen: Die Defloration hat nicht nur die eine kulturelle Folge, das Weib dauernd an den Mann zu fesseln; sie entfesselt auch eine archaische Reaktion von Feindseligkeit gegen den Mann, welche pathologische Formen annehmen kann, die sich häufig genug durch Hemmungserscheinungen im Liebesleben der Ehe äußern, und der man es zuschreiben darf, daß zweite Ehen so oft besser geraten als die ersten. Das befremdende Tabu der Virginität, die Scheu, mit welcher bei den Primitiven der Ehemann der Defloration aus dem Wege geht, finden in dieser feindseligen Reaktion ihre volle Rechtfertigung.
Es ist nun interessant, daß man als Analytiker Frauen begegnen kann, bei denen die entgegengesetzten Reaktionen von Hörigkeit und Feindseligkeit beide zum Ausdruck gekommen und in inniger Verknüpfung miteinander geblieben sind. Es gibt solche Frauen, die mit ihren Männern völlig zerfallen scheinen und doch nur vergebliche Bemühungen machen können, sich von ihnen zu lösen. Sooft sie es versuchen, ihre Liebe einem anderen Manne zuzuwenden, tritt das Bild des ersten, doch nicht mehr geliebten hemmend dazwischen. Die Analyse lehrt dann, daß diese Frauen allerdings noch in Hörigkeit an ihren ersten Männern hängen, aber nicht mehr aus Zärtlichkeit. Sie kommen von ihnen nicht frei, weil sie ihre Rache an ihnen nicht vollendet, in ausgeprägten Fällen die rachsüchtige Regung sich nicht einmal zum Bewußtsein gebracht haben.
Das Unbewußte (1915)
Wir haben aus der Psychoanalyse erfahren, das Wesen des Prozesses der Verdrängung bestehe nicht darin, eine den Trieb repräsentierende Vorstellung aufzuheben, zu vernichten, sondern sie vom Bewußtwerden abzuhalten. Wir sagen dann, sie befinde sich im Zustande des »Unbewußten«, und haben gute Beweise dafür vorzubringen, daß sie auch unbewußt Wirkungen äußern kann, auch solche, die endlich das Bewußtsein erreichen. Alles Verdrängte muß unbewußt bleiben, aber wir wollen gleich eingangs feststellen, daß das Verdrängte nicht alles Unbewußte deckt. Das Unbewußte hat den weiteren Umfang; das Verdrängte ist ein Teil des Unbewußten.
Wie sollen wir zur Kenntnis des Unbewußten kommen? Wir kennen es natürlich nur als Bewußtes, nachdem es eine Umsetzung oder Übersetzung in Bewußtes erfahren hat. Die psychoanalytische Arbeit läßt uns alltäglich die Erfahrung machen, daß solche Übersetzung möglich ist. Es wird hiezu erfordert, daß der Analysierte gewisse Widerstände überwinde, die nämlichen, welche es seinerzeit durch Abweisung vom Bewußten zu einem Verdrängten gemacht haben.
I. Die Rechtfertigung des Unbewußten
Die Berechtigung, ein unbewußtes Seelisches anzunehmen und mit dieser Annahme wissenschaftlich zu arbeiten, wird uns von vielen Seiten bestritten. Wir können dagegen anführen, daß die Annahme des Unbewußten notwendig und legitim ist und daß wir für die Existenz des Unbewußten mehrfache Beweise besitzen. Sie ist notwendig, weil die Daten des Bewußtseins in hohem Grade lückenhaft sind; sowohl bei Gesunden als bei Kranken kommen häufig psychische Akte vor, welche zu ihrer Erklärung andere Akte voraussetzen, für die aber das Bewußtsein nicht zeugt. Solche Akte sind nicht nur die Fehlhandlungen und die Träume bei Gesunden, alles, was man psychische Symptome und Zwangserscheinungen heißt, bei Kranken –; unsere persönlichste tägliche Erfahrung macht uns mit Einfällen bekannt, deren Herkunft wir nicht kennen, und mit Denkresultaten, deren Ausarbeitung uns verborgen geblieben ist. Alle diese bewußten Akte blieben zusammenhanglos und unverständlich, wenn wir den Anspruch festhalten wollen, daß wir auch alles durchs Bewußtsein erfahren müssen, was an seelischen Akten in uns vorgeht, und ordnen sich in einen aufzeigbaren Zusammenhang ein, wenn wir die erschlossenen unbewußten Akte interpolieren. Gewinn an Sinn und Zusammenhang ist aber ein vollberechtigtes Motiv, das uns über die unmittelbare Erfahrung hinaus führen darf. Zeigt es sich dann noch, daß wir auf die Annahme des Unbewußten ein erfolgreiches Handeln aufbauen können, durch welches wir den Ablauf der bewußten Vorgänge zweckdienlich beeinflussen, so haben wir in diesem Erfolg einen unanfechtbaren Beweis für die Existenz des Angenommenen gewonnen. Man muß sich dann auf den Standpunkt stellen, es sei nichts anderes als eine unhaltbare Anmaßung, zu fordern, daß alles, was im Seelischen vorgeht, auch dem Bewußtsein bekannt werden müsse.
Man kann weitergehen und zur Unterstützung eines unbewußten psychischen Zustandes anführen, daß das Bewußtsein in jedem Moment nur einen geringen Inhalt umfaßt, so daß der größte Teil dessen, was wir bewußte Kenntnis heißen, sich ohnedies über die längsten Zeiten im Zustande der Latenz, also in einem Zustande von psychischer Unbewußtheit, befinden muß. Der Widerspruch gegen das Unbewußte würde mit Rücksicht auf alle unsere latenten Erinnerungen völlig unbegreiflich werden. Wir stoßen dann auf den Einwand, daß diese latenten Erinnerungen nicht mehr als psychisch zu bezeichnen seien, sondern den Resten von somatischen Vorgängen entsprechen, aus denen das Psychische wieder hervorgehen kann. Es liegt nahe zu erwidern, die latente Erinnerung sei im Gegenteil ein unzweifelhafter Rückstand eines psychischen Vorganges. Wichtiger ist es aber sich klarzumachen, daß der Einwand auf der nicht ausgesprochenen, aber von vornherein fixierten Gleichstellung des Bewußten mit dem Seelischen ruht. Diese Gleichstellung ist entweder eine petitio principii, welche die Frage, ob alles Psychische auch bewußt sein müsse, nicht zuläßt, oder eine Sache der Konvention, der Nomenklatur. In letzterem Charakter ist sie natürlich wie jede Konvention unwiderlegbar. Es bleibt nur die Frage offen, ob sie sich als so zweckmäßig erweist, daß man sich ihr anschließen muß. Man darf antworten, die konventionelle Gleichstellung des Psychischen mit dem Bewußten ist durchaus unzweckmäßig. Sie zerreißt die psychischen Kontinuitäten, stürzt uns in die unlösbaren Schwierigkeiten des psycho-physischen Parallelismus, unterliegt dem Vorwurf, daß sie ohne einsichtliche Begründung die Rolle des Bewußtseins überschätzt, und nötigt uns, das Gebiet der psychologischen Forschung vorzeitig zu verlassen, ohne uns von anderen Gebieten her Entschädigung bringen zu können.
Immerhin ist es klar, daß die Frage, ob man die unabweisbaren latenten Zustände des Seelenlebens als unbewußte seelische oder als physische auffassen soll, auf einen Wortstreit hinauszulaufen droht. Es ist darum ratsam, das in den Vordergrund zu rücken, was uns von der Natur dieser fraglichen Zustände mit Sicherheit bekannt ist. Nun sind sie uns nach ihren physischen Charakteren vollkommen unzugänglich; keine physiologische Vorstellung, kein chemischer Prozeß kann uns eine Ahnung von ihrem Wesen vermitteln. Auf der anderen Seite steht fest, daß sie mit den bewußten seelischen Vorgängen die ausgiebigste Berührung haben; sie lassen sich mit einer gewissen Arbeitsleistung in sie umsetzen, durch sie ersetzen, und sie können mit all den Kategorien beschrieben werden, die wir auf die bewußten Seelenakte anwenden, als Vorstellungen, Strebungen, Entschließungen u. dgl. Ja, von manchen dieser latenten Zustände müssen wir aussagen, sie unterscheiden sich von den bewußten eben nur durch den Wegfall des Bewußtseins. Wir werden also nicht zögern, sie als Objekte psychologischer Forschung und in innigstem Zusammenhang mit den bewußten seelischen Akten zu behandeln.
Die hartnäckige Ablehnung des psychischen Charakters der latenten seelischen Akte erklärt sich daraus, daß die meisten der in Betracht kommenden Phänomene außerhalb der Psychoanalyse nicht Gegenstand des Studiums geworden sind. Wer die pathologischen Tatsachen nicht kennt, die Fehlhandlungen der Normalen als Zufälligkeiten gelten läßt und sich bei der alten Weisheit bescheidet, Träume seien Schäume, der braucht dann nur noch einige Rätsel der Bewußtseinspsychologie zu vernachlässigen, um sich die Annahme unbewußter seelischer Tätigkeit zu ersparen. Übrigens haben die hypnotischen Experimente, besonders die posthypnotische Suggestion, Existenz und Wirkungsweise des seelisch Unbewußten bereits vor der Zeit der Psychoanalyse sinnfällig demonstriert.
Die Annahme des Unbewußten ist aber auch eine völlig legitime, insofern wir bei ihrer Aufstellung keinen Schritt von unserer gewohnten, für korrekt gehaltenen Denkweise abweichen. Das Bewußtsein vermittelt jedem einzelnen von uns nur die Kenntnis von eigenen Seelenzuständen; daß auch ein anderer Mensch ein Bewußtsein hat, ist ein Schluß, der per analogiam auf Grund der wahrnehmbaren Äußerungen und Handlungen dieses anderen gezogen wird, um uns dieses Benehmen des anderen verständlich zu machen. (Psychologisch richtiger ist wohl die Beschreibung, daß wir ohne besondere Überlegung jedem anderen außer uns unsere eigene Konstitution, und also auch unser Bewußtsein, beilegen und daß diese Identifizierung die Voraussetzung unseres Verständnisses ist.) Dieser Schluß –; oder diese Identifizierung –; wurde einst vom Ich auf andere Menschen, Tiere, Pflanzen, Unbelebtes und auf das Ganze der Welt ausgedehnt und erwies sich als brauchbar, solange die Ähnlichkeit mit dem Einzel-Ich eine überwältigend große war, wurde aber in dem Maße unverläßlicher, als sich das andere vom Ich entfernte. Unsere heutige Kritik wird bereits beim Bewußtsein der Tiere unsicher, verweigert sich dem Bewußtsein der Pflanzen und weist die Annahme eines Bewußtseins des Unbelebten der Mystik zu. Aber auch, wo die ursprüngliche Identifizierungsneigung die kritische Prüfung bestanden hat, bei dem uns nächsten menschlichen anderen, ruht die Annahme eines Bewußtseins auf einem Schluß und kann nicht die unmittelbare Sicherheit unseres eigenen Bewußtseins teilen.
Die Psychoanalyse fordert nun nichts anderes, als daß dieses Schlußverfahren auch gegen die eigene Person gewendet werde, wozu eine konstitutionelle Neigung allerdings nicht besteht. Geht man so vor, so muß man sagen, alle die Akte und Äußerungen, die ich an mir bemerke und mit meinem sonstigen psychischen Leben nicht zu verknüpfen weiß, müssen beurteilt werden, als ob sie einer anderen Person angehörten, und sollen durch ein ihr zugeschriebenes Seelenleben Aufklärung finden. Die Erfahrung zeigt auch, daß man dieselben Akte, denen man bei der eigenen Person die psychische Anerkennung verweigert, bei anderen sehr wohl zu deuten, d. h. in den seelischen Zusammenhang einzureihen versteht. Unsere Forschung wird hier offenbar durch ein besonderes Hindernis von der eigenen Person abgelenkt und an deren richtiger Erkenntnis behindert.
Dies trotz inneren Widerstrebens gegen die eigene Person gewendete Schlußverfahren führt nun nicht zur Aufdeckung eines Unbewußten, sondern korrekterweise zur Annahme eines anderen, zweiten Bewußtseins, welches mit dem mir bekannten in meiner Person vereinigt ist. Allein hier findet die Kritik berechtigten Anlaß, einiges einzuwerfen. Erstens ist ein Bewußtsein, von dem der eigene Träger nichts weiß, noch etwas anderes als ein fremdes Bewußtsein, und es wird fraglich, ob ein solches Bewußtsein, dem der wichtigste Charakter abgeht, überhaupt noch Diskussion verdient. Wer sich gegen die Annahme eines unbewußten Psychischen gesträubt hat, der wird nicht zufrieden sein können, dafür ein unbewußtes Bewußtsein einzutauschen. Zweitens weist die Analyse darauf hin, daß die einzelnen latenten Seelenvorgänge, die wir erschließen, sich eines hohen Grades von gegenseitiger Unabhängigkeit erfreuen, so als ob sie miteinander nicht in Verbindung stünden und nichts voneinander wüßten. Wir müssen also bereit sein, nicht nur ein zweites Bewußtsein in uns anzunehmen, sondern auch ein drittes, viertes, vielleicht eine unabschließbare Reihe von Bewußtseinszuständen, die sämtlich uns und miteinander unbekannt sind. Drittens kommt als schwerstes Argument in Betracht, daß wir durch die analytische Untersuchung erfahren, ein Teil dieser latenten Vorgänge besitze Charaktere und Eigentümlichkeiten, welche uns fremd, selbst unglaublich erscheinen und den uns bekannten Eigenschaften des Bewußtseins direkt zuwiderlaufen. Somit werden wir Grund haben, den gegen die eigene Person gewendeten Schluß dahin abzuändern, er beweise uns nicht ein zweites Bewußtsein in uns, sondern die Existenz von psychischen Akten, welche des Bewußtseins entbehren. Wir werden auch die Bezeichnung eines »Unterbewußtseins« als inkorrekt und irreführend ablehnen dürfen. Die bekannten Fälle von » double conscience« (Bewußtseinsspaltung) beweisen nichts gegen unsere Auffassung. Sie lassen sich am zutreffendsten beschreiben als Fälle von Spaltung der seelischen Tätigkeiten in zwei Gruppen, wobei sich dann das nämliche Bewußtsein alternierend dem einen oder dem anderen Lager zuwendet.
Es bleibt uns in der Psychoanalyse gar nichts anderes übrig, als die seelischen Vorgänge für an sich unbewußt zu erklären und ihre Wahrnehmung durch das Bewußtsein mit der Wahrnehmung der Außenwelt durch die Sinnesorgane zu vergleichen. Wir hoffen sogar aus diesem Vergleich einen Gewinn für unsere Erkenntnis zu ziehen. Die psychoanalytische Annahme der unbewußten Seelentätigkeit erscheint uns einerseits als eine weitere Fortbildung des primitiven Animismus, der uns überall Ebenbilder unseres Bewußtseins vorspiegelte, und anderseits als die Fortsetzung der Korrektur, die Kant an unserer Auffassung der äußeren Wahrnehmung vorgenommen hat. Wie Kant uns gewarnt hat, die subjektive Bedingtheit unserer Wahrnehmung nicht zu übersehen und unsere Wahrnehmung nicht für identisch mit dem unerkennbaren Wahrgenommenen zu halten, so mahnt die Psychoanalyse, die Bewußtseinswahrnehmung nicht an die Stelle des unbewußten psychischen Vorganges zu setzen, welcher ihr Objekt ist. Wie das Physische, so braucht auch das Psychische nicht in Wirklichkeit so zu sein, wie es uns erscheint. Wir werden uns aber mit Befriedigung auf die Erfahrung vorbereiten, daß die Korrektur der inneren Wahrnehmung nicht ebenso große Schwierigkeit bietet wie die der äußeren, daß das innere Objekt minder unerkennbar ist als die Außenwelt.
II. Die Vieldeutigkeit des Unbewußten und der topische Gesichtspunkt
Ehe wir weitergehen, wollen wir die wichtige, aber auch beschwerliche Tatsache feststellen, daß die Unbewußtheit nur ein Merkmal des Psychischen ist, welches für dessen Charakteristik keineswegs ausreicht. Es gibt psychische Akte von sehr verschiedener Dignität, die doch in dem Charakter, unbewußt zu sein, übereinstimmen. Das Unbewußte umfaßt einerseits Akte, die bloß latent, zeitweilig unbewußt sind, sich aber sonst von den bewußten in nichts unterscheiden, und anderseits Vorgänge wie die verdrängten, die, wenn sie bewußt würden, sich von den übrigen bewußten aufs grellste abheben müßten. Es würde allen Mißverständnissen ein Ende machen, wenn wir von nun an bei der Beschreibung der verschiedenartigen psychischen Akte ganz davon absehen würden, ob sie bewußt oder unbewußt sind, und sie bloß nach ihrer Beziehung zu den Trieben und Zielen, nach ihrer Zusammensetzung und Angehörigkeit zu den einander übergeordneten psychischen Systemen klassifizieren und in Zusammenhang bringen würden. Dies ist aber aus verschiedenen Gründen undurchführbar, und somit können wir der Zweideutigkeit nicht entgehen, daß wir die Worte bewußt und unbewußt bald im deskriptiven Sinne gebrauchen, bald im systematischen, wo sie dann Zugehörigkeit zu bestimmten Systemen und Begabung mit gewissen Eigenschaften bedeuten. Man könnte noch den Versuch machen, die Verwirrung dadurch zu vermeiden, daß man die erkannten psychischen Systeme mit willkürlich gewählten Namen bezeichnet, in denen die Bewußtheit nicht gestreift wird. Allein man müßte vorher Rechenschaft ablegen, worauf man die Unterscheidung der Systeme gründet, und könnte dabei die Bewußtheit nicht umgehen, da sie den Ausgangspunkt aller unserer Untersuchungen bildet. Wir können vielleicht einige Abhilfe von dem Vorschlag erwarten, wenigstens in der Schrift Bewußtsein durch die Darstellung Bw und Unbewußtes durch die entsprechende Abkürzung Ubw zu ersetzen, wenn wir die beiden Worte im systematischen Sinne gebrauchen.
In positiver Darstellung sagen wir nun als Ergebnis der Psychoanalyse aus, daß ein psychischer Akt im allgemeinen zwei Zustandsphasen durchläuft, zwischen welche eine Art Prüfung ( Zensur) eingeschaltet ist. In der ersten Phase ist er unbewußt und gehört dem System Ubw an; wird er bei der Prüfung von der Zensur abgewiesen, so ist ihm der Übergang in die zweite Phase versagt; er heißt dann »verdrängt« und muß unbewußt bleiben. Besteht er aber diese Prüfung, so tritt er in die zweite Phase ein und wird dem zweiten System zugehörig, welches wir das System Bw nennen wollen. Sein Verhältnis zum Bewußtsein ist aber durch diese Zugehörigkeit noch nicht eindeutig bestimmt. Er ist noch nicht bewußt, wohl aber bewußtseinsfähig (nach dem Ausdruck von J. Breuer), d. h., er kann nun ohne besonderen Widerstand beim Zutreffen gewisser Bedingungen Objekt des Bewußtseins werden. Mit Rücksicht auf diese Bewußtseinsfähigkeit heißen wir das System Bw auch das » Vorbewußte«. Sollte es sich herausstellen, daß auch das Bewußtwerden des Vorbewußten durch eine gewisse Zensur mitbestimmt wird, so werden wir die Systeme Vbw und Bw strenger voneinander sondern. Vorläufig genüge es festzuhalten, daß das System Vbw die Eigenschaften des Systems Bw teilt und daß die strenge Zensur am Übergang vom Ubw zum Vbw (oder Bw) ihres Amtes waltet.
Mit der Aufnahme dieser (zwei oder drei) psychischen Systeme hat sich die Psychoanalyse einen Schritt weiter von der deskriptiven Bewußtseinspsychologie entfernt, sich eine neue Fragestellung und einen neuen Inhalt beigelegt. Sie unterschied sich von der Psychologie bisher hauptsächlich durch die dynamische Auffassung der seelischen Vorgänge; nun kommt hinzu, daß sie auch die psychische Topik berücksichtigen und von einem beliebigen seelischen Akt angeben will, innerhalb welchen Systems oder zwischen welchen Systemen er sich abspielt. Wegen dieses Bestrebens hat sie auch den Namen einer Tiefenpsychologie erhalten. Wir werden hören, daß sie auch noch um einen anderen Gesichtspunkt bereichert werden kann.
Wollen wir mit einer Topik der seelischen Akte Ernst machen, so müssen wir unser Interesse einer an dieser Stelle auftauchenden Zweifelsfrage zuwenden. Wenn ein psychischer Akt (beschränken wir uns hier auf einen solchen von der Natur einer Vorstellung) die Umsetzung aus dem System Ubw in das System Bw (oder Vbw) erfährt, sollen wir annehmen, daß mit dieser Umsetzung eine neuerliche Fixierung, gleichsam eine zweite Niederschrift der betreffenden Vorstellung verbunden ist, die also auch in einer neuen psychischen Lokalität enthalten sein kann und neben welcher die ursprüngliche, unbewußte Niederschrift fortbesteht? Oder sollen wir eher glauben, daß die Umsetzung in einer Zustandsänderung besteht, welche sich an dem nämlichen Material und an derselben Lokalität vollzieht? Diese Frage kann abstrus erscheinen, muß aber aufgeworfen werden, wenn wir uns von der psychischen Topik, der psychischen Tiefendimension, eine bestimmtere Idee bilden wollen. Sie ist schwierig, weil sie über das rein Psychologische hinausgeht und die Beziehungen des seelischen Apparates zur Anatomie streift. Wir wissen, daß solche Beziehungen im gröbsten existieren. Es ist ein unerschütterliches Resultat der Forschung, daß die seelische Tätigkeit an die Funktion des Gehirns gebunden ist wie an kein anderes Organ. Ein Stück weiter –; es ist nicht bekannt, wie weit –; führt die Entdeckung von der Ungleichwertigkeit der Gehirnteile und deren Sonderbeziehung zu bestimmten Körperteilen und geistigen Tätigkeiten. Aber alle Versuche, von da aus eine Lokalisation der seelischen Vorgänge zu erraten, alle Bemühungen, die Vorstellungen in Nervenzellen aufgespeichert zu denken und die Erregungen auf Nervenfasern wandern zu lassen, sind gründlich gescheitert. Dasselbe Schicksal würde einer Lehre bevorstehen, die etwa den anatomischen Ort des Systems Bw, der bewußten Seelentätigkeit, in der Hirnrinde erkennen und die unbewußten Vorgänge in die subkortikalen Hirnpartien versetzen wollte. Es klafft hier eine Lücke, deren Ausfüllung derzeit nicht möglich ist, auch nicht zu den Aufgaben der Psychologie gehört. Unsere psychische Topik hat vorläufig nichts mit der Anatomie zu tun; sie bezieht sich auf Regionen des seelischen Apparats, wo immer sie im Körper gelegen sein mögen, und nicht auf anatomische Örtlichkeiten.
Unsere Arbeit ist also in dieser Hinsicht frei und darf nach ihren eigenen Bedürfnissen vorgehen. Es wird auch förderlich sein, wenn wir uns daran mahnen, daß unsere Annahmen zunächst nur den Wert von Veranschaulichungen beanspruchen. Die erstere der beiden in Betracht gezogenen Möglichkeiten, nämlich daß die bw Phase der Vorstellung eine neue, an anderem Orte befindliche Niederschrift derselben bedeute, ist unzweifelhaft die gröbere, aber auch die bequemere. Die zweite Annahme, die einer bloß funktionellen Zustandsänderung, ist die von vornherein wahrscheinlichere, aber sie ist minder plastisch, weniger leicht zu handhaben. Mit der ersten, der topischen Annahme ist die einer topischen Trennung der Systeme Ubw und Bw und die Möglichkeit verknüpft, daß eine Vorstellung gleichzeitig an zwei Stellen des psychischen Apparats vorhanden sei, ja, daß sie, wenn durch die Zensur ungehemmt, regelmäßig von dem einen Ort an den anderen vorrücke, eventuell ohne ihre erste Niederlassung oder Niederschrift zu verlieren. Das mag befremdlich aussehen, kann sich aber an Eindrücke aus der psychoanalytischen Praxis anlehnen.
Wenn man einem Patienten eine seinerzeit von ihm verdrängte Vorstellung, die man erraten hat, mitteilt, so ändert dies zunächst an seinem psychischen Zustand nichts. Es hebt vor allem nicht die Verdrängung auf, macht deren Folgen nicht rückgängig, wie man vielleicht erwarten konnte, weil die früher unbewußte Vorstellung nun bewußt geworden ist. Man wird im Gegenteil zunächst nur eine neuerliche Ablehnung der verdrängten Vorstellung erzielen. Der Patient hat aber jetzt tatsächlich dieselbe Vorstellung in zweifacher Form an verschiedenen Stellen seines seelischen Apparats, erstens hat er die bewußte Erinnerung an die Gehörspur der Vorstellung durch die Mitteilung, zweitens trägt er daneben, wie wir mit Sicherheit wissen, die unbewußte Erinnerung an das Erlebte in der früheren Form in sich. In Wirklichkeit tritt nun eine Aufhebung der Verdrängung nicht eher ein, als bis die bewußte Vorstellung sich nach Überwindung der Widerstände mit der unbewußten Erinnerungsspur in Verbindung gesetzt hat. Erst durch das Bewußtmachen dieser letzteren selbst wird der Erfolg erreicht. Damit schiene ja für oberflächliche Erwägung erwiesen, daß bewußte und unbewußte Vorstellungen verschiedene und topisch gesonderte Niederschriften des nämlichen Inhaltes sind. Aber die nächste Überlegung zeigt, daß die Identität der Mitteilung mit der verdrängten Erinnerung des Patienten nur eine scheinbare ist. Das Gehörthaben und das Erlebthaben sind zwei nach ihrer psychologischen Natur ganz verschiedene Dinge, auch wenn sie den nämlichen Inhalt haben.
Wir sind also zunächst nicht imstande, zwischen den beiden erörterten Möglichkeiten zu entscheiden. Vielleicht treffen wir späterhin auf Momente, welche für eine von beiden den Ausschlag geben können. Vielleicht steht uns die Entdeckung bevor, daß unsere Fragestellung unzureichend war und daß die Unterscheidung der unbewußten Vorstellung von der bewußten noch ganz anders zu bestimmen ist.
III. Unbewußte Gefühle
Wir haben die vorstehende Diskussion auf Vorstellungen eingeschränkt und können nun eine neue Frage aufwerfen, deren Beantwortung zur Klärung unserer theoretischen Ansichten beitragen muß. Wir sagten, es gäbe bewußte und unbewußte Vorstellungen; gibt es aber auch unbewußte Triebregungen, Gefühle, Empfindungen, oder ist es diesmal sinnlos, solche Zusammensetzungen zu bilden?
Ich meine wirklich, der Gegensatz von bewußt und unbewußt hat auf den Trieb keine Anwendung. Ein Trieb kann nie Objekt des Bewußtseins werden, nur die Vorstellung, die ihn repräsentiert. Er kann aber auch im Unbewußten nicht anders als durch die Vorstellung repräsentiert sein. Würde der Trieb sich nicht an eine Vorstellung heften oder nicht als ein Affektzustand zum Vorschein kommen, so könnten wir nichts von ihm wissen. Wenn wir aber doch von einer unbewußten Triebregung oder einer verdrängten Triebregung reden, so ist dies eine harmlose Nachlässigkeit des Ausdrucks. Wir können nichts anderes meinen als eine Triebregung, deren Vorstellungsrepräsentanz unbewußt ist, denn etwas anderes kommt nicht in Betracht.
Man sollte meinen, die Antwort auf die Frage nach den unbewußten Empfindungen, Gefühlen, Affekten sei ebenso leicht zu geben. Zum Wesen eines Gefühls gehört es doch, daß es verspürt, also dem Bewußtsein bekannt wird. Die Möglichkeit einer Unbewußtheit würde also für Gefühle, Empfindungen, Affekte völlig entfallen. Wir sind aber in der psychoanalytischen Praxis gewöhnt, von unbewußter Liebe, Haß, Wut usw. zu sprechen und finden selbst die befremdliche Vereinigung »unbewußtes Schuldbewußtsein« oder eine paradoxe »unbewußte Angst« unvermeidlich. Geht dieser Sprachgebrauch an Bedeutung über den im Falle des »unbewußten Triebes« hinaus?
Der Sachverhalt ist hier wirklich ein anderer. Es kann zunächst vorkommen, daß eine Affekt- oder Gefühlsregung wahrgenommen, aber verkannt wird. Sie ist durch die Verdrängung ihrer eigentlichen Repräsentanz zur Verknüpfung mit einer anderen Vorstellung genötigt worden und wird nun vom Bewußtsein für die Äußerung dieser letzteren gehalten. Wenn wir den richtigen Zusammenhang wiederherstellen, heißen wir die ursprüngliche Affektregung eine »unbewußte«, obwohl ihr Affekt niemals unbewußt war, nur ihre Vorstellung der Verdrängung erlegen ist. Der Gebrauch der Ausdrücke »unbewußter Affekt« und »unbewußtes Gefühl« weist überhaupt auf die Schicksale des quantitativen Faktors der Triebregung infolge der Verdrängung zurück (s. die Abhandlung über Verdrängung). Wir wissen, daß dies Schicksal ein dreifaches sein kann; der Affekt bleibt entweder –; ganz oder teilweise –; als solcher bestehen, oder er erfährt eine Verwandlung in einen qualitativ anderen Affektbetrag, vor allem in Angst, oder er wird unterdrückt, d. h. seine Entwicklung überhaupt verhindert. (Diese Möglichkeiten sind an der Traumarbeit vielleicht noch leichter zu studieren als bei den Neurosen.) Wir wissen auch, daß die Unterdrückung der Affektentwicklung das eigentliche Ziel der Verdrängung ist und daß deren Arbeit unabgeschlossen bleibt, wenn das Ziel nicht erreicht wird. In allen Fällen, wo der Verdrängung die Hemmung der Affektentwicklung gelingt, heißen wir die Affekte, die wir im Redressement der Verdrängungsarbeit wieder einsetzen, »unbewußte«. Dem Sprachgebrauch ist also die Konsequenz nicht abzustreiten; es besteht aber im Vergleiche mit der unbewußten Vorstellung der bedeutsame Unterschied, daß die unbewußte Vorstellung nach der Verdrängung als reale Bildung im System Ubw bestehenbleibt, während dem unbewußten Affekt ebendort nur eine Ansatzmöglichkeit, die nicht zur Entfaltung kommen durfte, entspricht. Strenggenommen und obwohl der Sprachgebrauch tadellos bleibt, gibt es also keine unbewußten Affekte, wie es unbewußte Vorstellungen gibt. Es kann aber sehr wohl im System Ubw Affektbildungen geben, die wie andere bewußt werden. Der ganze Unterschied rührt daher, daß Vorstellungen Besetzungen –; im Grunde von Erinnerungsspuren –; sind, während die Affekte und Gefühle Abfuhrvorgängen entsprechen, deren letzte Äußerungen als Empfindungen wahrgenommen werden. Im gegenwärtigen Zustand unserer Kenntnis von den Affekten und Gefühlen können wir diesen Unterschied nicht klarer ausdrücken.
Die Feststellung, daß es der Verdrängung gelingen kann, die Umsetzung der Triebregung in Affektäußerung zu hemmen, ist für uns von besonderem Interesse. Sie zeigt uns, daß das System Bw normalerweise die Affektivität wie den Zugang zur Motilität beherrscht, und hebt den Wert der Verdrängung, indem sie als deren Folgen nicht nur die Abhaltung vom Bewußtsein, sondern auch von der Affektentwicklung und von der Motivierung der Muskeltätigkeit aufzeigt. Wir können auch in umgekehrter Darstellung sagen: Solange das System Bw Affektivität und Motilität beherrscht, heißen wir den psychischen Zustand des Individuums normal. Indes ist ein Unterschied in der Beziehung des herrschenden Systems zu den beiden einander nahestehenden Abfuhraktionen unverkennbar [Fußnote]Die Affektivität äußert sich wesentlich in motorischer (sekretorischer, gefäßregulierender) Abfuhr zur (inneren) Veränderung des eigenen Körpers ohne Beziehung zur Außenwelt, die Motilität in Aktionen, die zur Veränderung der Außenwelt bestimmt sind.. Während die Herrschaft des Bw über die willkürliche Motilität fest gegründet ist, dem Ansturm der Neurose regelmäßig widersteht und erst in der Psychose zusammenbricht, ist die Beherrschung der Affektentwicklung durch Bw minder gefestigt. Noch innerhalb des normalen Lebens läßt sich ein beständiges Ringen der beiden Systeme Bw und Ubw um den Primat in der Affektivität erkennen, grenzen sich gewisse Einflußsphären voneinander ab und stellen sich Vermengungen der wirksamen Kräfte her.
Die Bedeutung des Systems Bw ( Vbw) für die Zugänge zur Affektentbindung und Aktion macht uns auch die Rolle verständlich, welche in der Krankheitsgestaltung der Ersatzvorstellung zufällt. Es ist möglich, daß die Affektentwicklung direkt vom System Ubw ausgeht, in diesem Falle hat sie immer den Charakter der Angst, gegen welche alle »verdrängten« Affekte eingetauscht werden. Häufig aber muß die Triebregung warten, bis sie eine Ersatzvorstellung im System Bw gefunden hat. Dann ist die Affektentwicklung von diesem bewußten Ersatz her ermöglicht und der qualitative Charakter des Affekts durch dessen Natur bestimmt. Wir haben behauptet, daß bei der Verdrängung eine Trennung des Affekts von seiner Vorstellung stattfindet, worauf beide ihren gesonderten Schicksalen entgegengehen. Das ist deskriptiv unbestreitbar; der wirkliche Vorgang aber ist in der Regel, daß ein Affekt so lange nicht zustande kommt, bis nicht der Durchbruch zu einer neuen Vertretung im System Bw gelungen ist.
IV. Topik und Dynamik der Verdrängung
Wir haben das Resultat erhalten, daß die Verdrängung im wesentlichen ein Vorgang ist, der sich an Vorstellungen an der Grenze der Systeme Ubw und Vbw ( Bw) vollzieht, und können nun einen neuerlichen Versuch machen, diesen Vorgang eingehender zu beschreiben. Es muß sich dabei um eine Entziehung von Besetzung handeln, aber es fragt sich, in welchem System findet die Entziehung statt, und welchem System gehört die entzogene Besetzung an.
Die verdrängte Vorstellung bleibt im Ubw aktionsfähig; sie muß also ihre Besetzung behalten haben. Das Entzogene muß etwas anderes sein. Nehmen wir den Fall der eigentlichen Verdrängung vor (des Nachdrängens), wie sie sich an der vorbewußten oder selbst bereits bewußten Vorstellung abspielt, dann kann die Verdrängung nur darin bestehen, daß der Vorstellung die (vor)bewußte Besetzung entzogen wird, die dem System Vbw angehört. Die Vorstellung bleibt dann unbesetzt, oder sie erhält Besetzung vom Ubw her, oder sie behält die ubw Besetzung, die sie schon früher hatte. Also Entziehung der vorbewußten, Erhaltung der unbewußten Besetzung oder Ersatz der vorbewußten Besetzung durch eine unbewußte. Wir bemerken übrigens, daß wir dieser Betrachtung wie unabsichtlich die Annahme zugrunde gelegt haben, der Übergang aus dem System Ubw in ein nächstes geschehe nicht durch eine neue Niederschrift, sondern durch eine Zustandsänderung, einen Wandel in der Besetzung. Die funktionale Annahme hat hier die topische mit leichter Mühe aus dem Felde geschlagen.
Dieser Vorgang der Libidoentziehung reicht aber nicht aus, um einen anderen Charakter der Verdrängung begreiflich zu machen. Es ist nicht einzusehen, warum die besetzt gebliebene oder vom Ubw her mit Besetzung versehene Vorstellung nicht den Versuch erneuern sollte, kraft ihrer Besetzung in das System Vbw einzudringen. Dann müßte sich die Libidoentziehung an ihr wiederholen, und dasselbe Spiel würde sich unabgeschlossen fortsetzen, das Ergebnis aber nicht das der Verdrängung sein. Ebenso würde der besprochene Mechanismus der Entziehung vorbewußter Besetzung versagen, wenn es sich um die Darstellung der Urverdrängung handelt; in diesem Falle liegt ja eine unbewußte Vorstellung vor, die noch keine Besetzung vom Vbw erhalten hat, der eine solche also auch nicht entzogen werden kann.
Wir bedürfen also hier eines anderen Vorganges, welcher im ersten Falle die Verdrängung unterhält, im zweiten ihre Herstellung und Fortdauer besorgt, und können diesen nur in der Annahme einer Gegenbesetzung finden, durch welche sich das System Vbw gegen das Andrängen der unbewußten Vorstellung schützt. Wie sich eine solche Gegenbesetzung, die im System Vbw vor sich geht, äußert, werden wir an klinischen Beispielen sehen. Sie ist es, welche den Daueraufwand einer Urverdrängung repräsentiert, aber auch deren Dauerhaftigkeit verbürgt. Die Gegenbesetzung ist der alleinige Mechanismus der Urverdrängung; bei der eigentlichen Verdrängung (dem Nachdrängen) kommt die Entziehung der vbw Besetzung hinzu. Es ist sehr wohl möglich, daß gerade die der Vorstellung entzogene Besetzung zur Gegenbesetzung verwendet wird.
Wir merken, wie wir allmählich dazu gekommen sind, in der Darstellung psychischer Phänomene einen dritten Gesichtspunkt zur Geltung zu bringen, außer dem dynamischen und dem topischen den ökonomischen, der die Schicksale der Erregungsgrößen zu verfolgen und eine wenigstens relative Schätzung derselben zu gewinnen strebt. Wir werden es nicht unbillig finden, die Betrachtungsweise, welche die Vollendung der psychoanalytischen Forschung ist, durch einen besonderen Namen auszuzeichnen. Ich schlage vor, daß es eine metapsychologische Darstellung genannt werden soll, wenn es uns gelingt, einen psychischen Vorgang nach seinen dynamischen, topischen und ökonomischen Beziehungen zu beschreiben. Es ist vorherzusagen, daß es uns bei dem gegenwärtigen Stand unserer Einsichten nur an vereinzelten Stellen gelingen wird.
Machen wir einen zaghaften Versuch, eine metapsychologische Beschreibung des Verdrängungsvorganges bei den drei bekannten Übertragungsneurosen zu geben. Wir dürfen dabei »Besetzung« durch »Libido« ersetzen, weil es sich ja, wie wir wissen, um die Schicksale von Sexualtrieben handelt.
Eine erste Phase des Vorganges bei der Angsthysterie wird häufig übersehen, vielleicht auch wirklich übergangen, ist aber bei sorgfältiger Beobachtung gut kenntlich. Sie besteht darin, daß Angst auftritt, ohne daß wahrgenommen würde, wovor. Es ist anzunehmen, daß im Ubw eine Liebesregung vorhanden war, die nach der Umsetzung ins System Vbw verlangte; aber die von diesem System her ihr zugewendete Besetzung zog sich nach Art eines Fluchtversuches von ihr zurück, und die unbewußte Libidobesetzung der zurückgewiesenen Vorstellung wurde als Angst abgeführt. Bei einer etwaigen Wiederholung des Vorganges wurde ein erster Schritt zur Bewältigung der unliebsamen Angstentwicklung unternommen. Die fliehende Besetzung wendete sich einer Ersatzvorstellung zu, die einerseits assoziativ mit der abgewiesenen Vorstellung zusammenhing, anderseits durch die Entfernung von ihr der Verdrängung entzogen war ( Verschiebungsersatz) und eine Rationalisierung der noch unhemmbaren Angstentwicklung gestattete. Die Ersatzvorstellung spielt nun für das System Bw ( Vbw) die Rolle einer Gegenbesetzung, indem sie es gegen das Auftauchen der verdrängten Vorstellung im Bw versichert, anderseits ist sie die Ausgangsstelle der nun erst recht unhemmbaren Angstaffektentbindung oder benimmt sich als solche. Die klinische Beobachtung zeigt, daß z. B. das an der Tierphobie leidende Kind nun unter zweierlei Bedingungen Angst verspürt, erstens wenn die verdrängte Liebesregung eine Verstärkung erfährt, und zweitens wenn das Angsttier wahrgenommen wird. Die Ersatzvorstellung benimmt sich in dem einen Falle wie die Stelle einer Überleitung aus dem System Ubw in das System Bw, im anderen wie eine selbständige Quelle der Angstentbindung. Die Ausdehnung der Herrschaft des Systems Bw pflegt sich darin zu äußern, daß die erste Erregungsweise der Ersatzvorstellung gegen die zweite immer mehr zurücktritt. Vielleicht benimmt sich am Ende das Kind so, als hätte es gar keine Neigung zu dem Vater, wäre ganz von ihm frei geworden, und als hätte es wirklich Angst vor dem Tier. Nur daß diese Tierangst, aus der unbewußten Triebquelle gespeist, sich widerspenstig und übergroß gegen alle Beeinflussungen aus dem System Bw erweist und dadurch ihre Herkunft aus dem System Ubw verrät.
Die Gegenbesetzung aus dem System Bw hat also in der zweiten Phase der Angsthysterie zur Ersatzbildung geführt. Derselbe Mechanismus findet bald eine neuerliche Anwendung. Der Verdrängungsvorgang ist, wie wir wissen, noch nicht abgeschlossen und findet ein weiteres Ziel in der Aufgabe, die vom Ersatz ausgehende Angstentwicklung zu hemmen. Dies geschieht in der Weise, daß die gesamte assoziierte Umgebung der Ersatzvorstellung mit besonderer Intensität besetzt wird, so daß sie eine hohe Empfindlichkeit gegen Erregung bezeigen kann. Eine Erregung irgendeiner Stelle dieses Vorbaues muß zufolge der Verknüpfung mit der Ersatzvorstellung den Anstoß zu einer geringen Angstentwicklung geben, welche nun als Signal benützt wird, um durch neuerliche Flucht der Besetzung den weiteren Fortgang der Angstentwicklung zu hemmen. Je weiter weg vom gefürchteten Ersatz die empfindlichen und wachsamen Gegenbesetzungen angebracht sind, desto präziser kann der Mechanismus funktionieren, der die Ersatzvorstellung isolieren und neue Erregungen von ihr abhalten soll. Diese Vorsichten schützen natürlich nur gegen Erregungen, die von außen, durch die Wahrnehmung an die Ersatzvorstellung herantreten, aber niemals gegen die Triebregung, die von der Verbindung mit der verdrängten Vorstellung her die Ersatzvorstellung trifft. Sie beginnen also erst zu wirken, wenn der Ersatz die Vertretung des Verdrängten gut übernommen hat, und können niemals ganz verläßlich wirken. Bei jedem Ansteigen der Trieberregung muß der schützende Wall um die Ersatzvorstellung um ein Stück weiter hinausverlegt werden. Die ganze Konstruktion, die in analoger Weise bei den anderen Neurosen hergestellt wird, trägt den Namen einer Phobie. Der Ausdruck der Flucht vor bewußter Besetzung der Ersatzvorstellung sind die Vermeidungen, Verzichte und Verbote, an denen man die Angsthysterie erkennt. Überschaut man den ganzen Vorgang, so kann man sagen, die dritte Phase hat die Arbeit der zweiten in größerem Ausmaß wiederholt. Das System Bw schützt sich jetzt gegen die Aktivierung der Ersatzvorstellung durch die Gegenbesetzung der Umgebung, wie es sich vorhin durch die Besetzung der Ersatzvorstellung gegen das Auftauchen der verdrängten Vorstellung gesichert hatte. Die Ersatzbildung durch Verschiebung hat sich in solcher Weise fortgesetzt. Man muß auch hinzufügen, daß das System Bw früher nur eine kleine Stelle besaß, die eine Einbruchspforte der verdrängten Triebregung war, die Ersatzvorstellung nämlich, daß aber am Ende der ganze phobische Vorbau einer solchen Enklave des unbewußten Einflusses entspricht. Man kann ferner den interessanten Gesichtspunkt hervorheben, daß durch den ganzen ins Werk gesetzten Abwehrmechanismus eine Projektion der Triebgefahr nach außen erreicht worden ist. Das Ich benimmt sich so, als ob ihm die Gefahr der Angstentwicklung nicht von einer Triebregung, sondern von einer Wahrnehmung her drohte, und darf darum gegen diese äußere Gefahr mit den Fluchtversuchen der phobischen Vermeidungen reagieren. Eines gelingt bei diesem Vorgang der Verdrängung: die Entbindung von Angst läßt sich einigermaßen eindämmen, aber nur unter schweren Opfern an persönlicher Freiheit. Fluchtversuche vor Triebansprüchen sind aber im allgemeinen nutzlos, und das Ergebnis der phobischen Flucht bleibt doch unbefriedigend.
Von den Verhältnissen, die wir bei der Angsthysterie erkannt haben, gilt ein großer Anteil auch für die beiden anderen Neurosen, so daß wir die Erörterung auf die Unterschiede und die Rolle der Gegenbesetzung beschränken können. Bei der Konversionshysterie wird die Triebbesetzung der verdrängten Vorstellung in die Innervation des Symptoms umgesetzt. Inwieweit und unter welchen Umständen die unbewußte Vorstellung durch diese Abfuhr zur Innervation drainiert ist, so daß sie ihr Andrängen gegen das System Bw aufgeben kann, diese und ähnliche Fragen bleiben besser einer speziellen Untersuchung der Hysterie vorbehalten. Die Rolle der Gegenbesetzung, die vom System Bw ( Vbw) ausgeht, ist bei der Konversionshysterie deutlich und kommt in der Symptombildung zum Vorschein. Die Gegenbesetzung ist es, welche die Auswahl trifft, auf welches Stück der Triebrepräsentanz die ganze Besetzung derselben konzentriert werden darf. Dies zum Symptom erlesene Stück erfüllt die Bedingung, daß es dem Wunschziel der Triebregung ebensosehr Ausdruck gibt wie dem Abwehr- oder Strafbestreben des Systems Bw; es wird also überbesetzt und von beiden Seiten her gehalten wie die Ersatzvorstellung der Angsthysterie. Wir können aus diesem Verhältnis ohne weiteres den Schluß ziehen, daß der Verdrängungsaufwand des Systems Bw nicht so groß zu sein braucht wie die Besetzungsenergie des Symptoms, denn die Stärke der Verdrängung wird durch die aufgewendete Gegenbesetzung gemessen, und das Symptom stützt sich nicht nur auf die Gegenbesetzung, sondern auch auf die in ihm verdichtete Triebbesetzung aus dem System Ubw.
Für die Zwangsneurose hätten wir den in der vorigen Abhandlung enthaltenen Bemerkungen nur hinzuzufügen, daß hier die Gegenbesetzung des Systems Bw am sinnfälligsten in den Vordergrund tritt. Sie ist es, die als Reaktionsbildung organisiert die erste Verdrängung besorgt und an welcher später der Durchbruch der verdrängten Vorstellung erfolgt. Man darf der Vermutung Raum geben, daß es an dem Vorwiegen der Gegenbesetzung und Ausfallen einer Abfuhr liegt, wenn das Werk der Verdrängung bei Angsthysterie und Zwangsneurose weit weniger geglückt erscheint als bei der Konversionshysterie.
V. Die besonderen Eigenschaften des Systems Ubw
Eine neue Bedeutung erhält die Unterscheidung der beiden psychischen Systeme, wenn wir darauf aufmerksam werden, daß die Vorgänge des einen Systems, des Ubw, Eigenschaften zeigen, die sich in dem nächst höheren nicht wiederfinden.
Der Kern des Ubw besteht aus Triebrepräsentanzen, die ihre Besetzung abführen wollen, also aus Wunschregungen. Diese Triebregungen sind einander koordiniert, bestehen unbeeinflußt nebeneinander, widersprechen einander nicht. Wenn zwei Wunschregungen gleichzeitig aktiviert werden, deren Ziele uns unvereinbar erscheinen müssen, so ziehen sich die beiden Regungen nicht etwa voneinander ab oder heben einander auf, sondern sie treten zur Bildung eines mittleren Zieles, eines Kompromisses, zusammen.
Es gibt in diesem System keine Negation, keinen Zweifel, keine Grade von Sicherheit. All dies wird erst durch die Arbeit der Zensur zwischen Ubw und Vbw eingetragen. Die Negation ist ein Ersatz der Verdrängung von höherer Stufe. Im Ubw gibt es nur mehr oder weniger stark besetzte Inhalte.
Es herrscht eine weit größere Beweglichkeit der Besetzungsintensitäten. Durch den Prozeß der Verschiebung kann eine Vorstellung den ganzen Betrag ihrer Besetzung an eine andere abgeben, durch den der Verdichtung die ganze Besetzung mehrerer anderer an sich nehmen. Ich habe vorgeschlagen, diese beiden Prozesse als Anzeichen des sogenannten psychischen Primärvorganges anzusehen. Im System Vbw herrscht der Sekundärvorgang[Fußnote]S. die Ausführungen im VII. Abschnitt der Traumdeutung, welche sich auf die von J. Breuer in den Studien über Hysterie entwickelten Ideen stützt.; wo ein solcher Primärvorgang sich an Elementen des Systems Vbw abspielen darf, erscheint er »komisch« und erregt Lachen.
Die Vorgänge des Systems Ubw sind zeitlos, d. h., sie sind nicht zeitlich geordnet, werden durch die verlaufende Zeit nicht abgeändert, haben überhaupt keine Beziehung zur Zeit. Auch die Zeitbeziehung ist an die Arbeit des Bw-Systems geknüpft.
Ebensowenig kennen die Ubw-Vorgänge eine Rücksicht auf die Realität. Sie sind dem Lustprinzip unterworfen; ihr Schicksal hängt nur davon ab, wie stark sie sind, und ob sie die Anforderungen der Lust-Unlustregulierung erfüllen.
Fassen wir zusammen: Widerspruchslosigkeit, Primärvorgang (Beweglichkeit der Besetzungen), Zeitlosigkeit und Ersetzung der äußeren Realität durch die psychische sind die Charaktere, die wir an zum System Ubw gehörigen Vorgängen zu finden erwarten dürfen [Fußnote]Die Erwähnung eines anderen bedeutsamen Vorrechtes des Ubw sparen wir für einen anderen Zusammenhang auf..
Die unbewußten Vorgänge werden für uns nur unter den Bedingungen des Träumens und der Neurosen erkennbar, also dann, wenn Vorgänge des höheren Vbw-Systems durch eine Erniedrigung (Regression) auf eine frühere Stufe zurückversetzt werden. An und für sich sind sie unerkennbar, auch existenzunfähig, weil das System Ubw sehr frühzeitig von dem Vbw überlagert wird, welches den Zugang zum Bewußtsein und zur Motilität an sich gerissen hat. Die Abfuhr des Systems Ubw geht in die Körperinnervation zur Affektentwicklung, aber auch dieser Entladungsweg wird ihm, wie wir gehört haben, vom Vbw streitig gemacht. Für sich allein könnte das Ubw-System unter normalen Verhältnissen keine zweckmäßige Muskelaktion zustande bringen, mit Ausnahme jener, die als Reflexe bereits organisiert sind.
Die volle Bedeutung der beschriebenen Charaktere des Systems Ubw könnte uns erst einleuchten, wenn wir sie den Eigenschaften des Systems Vbw gegenüberstellen und an ihnen messen würden. Allein dies würde uns so weitab führen, daß ich vorschlage, wiederum einen Aufschub gutzuheißen und die Vergleichung der beiden Systeme erst im Anschluß an die Würdigung des höheren Systems vorzunehmen. Nur das Allerdringendste soll schon jetzt seine Erwähnung finden.
Die Vorgänge des Systems Vbw zeigen –; und zwar gleichgültig, ob sie bereits bewußt oder nur bewußtseinsfähig sind –; eine Hemmung der Abfuhrneigung von den besetzten Vorstellungen. Wenn der Vorgang von einer Vorstellung auf eine andere übergeht, so hält die erstere einen Teil ihrer Besetzung fest, und nur ein kleiner Anteil erfährt die Verschiebung. Verschiebungen und Verdichtungen wie beim Primärvorgang sind ausgeschlossen oder sehr eingeschränkt. Dieses Verhältnis hat J. Breuer veranlaßt, zwei verschiedene Zustände der Besetzungsenergie im Seelenleben anzunehmen, einen tonisch gebundenen und einen frei beweglichen, der Abfuhr zustrebenden. Ich glaube, daß diese Unterscheidung bis jetzt unsere tiefste Einsicht in das Wesen der nervösen Energie darstellt, und sehe nicht, wie man um sie herumkommen soll. Es wäre ein dringendes Bedürfnis der metapsychologischen Darstellung –; vielleicht aber noch ein allzu gewagtes Unternehmen –;, an dieser Stelle die Diskussion fortzuführen.
Dem System Vbw fallen ferner zu die Herstellung einer Verkehrsfähigkeit unter den Vorstellungsinhalten, so daß sie einander beeinflussen können, die zeitliche Anordnung derselben, die Einführung der einen Zensur oder mehrerer Zensuren, die Realitätsprüfung und das Realitätsprinzip. Auch das bewußte Gedächtnis scheint ganz am Vbw zu hängen, es ist scharf von den Erinnerungsspuren zu scheiden, in denen sich die Erlebnisse des Ubw fixieren, und entspricht wahrscheinlich einer besonderen Niederschrift, wie wir sie für das Verhältnis der bewußten zur unbewußten Vorstellung annehmen wollten, aber bereits verworfen haben. In diesem Zusammenhang werden wir auch die Mittel finden, unserem Schwanken in der Benennung des höheren Systems, das wir jetzt richtungslos bald Vbw, bald Bw heißen, ein Ende zu machen.
Es wird auch die Warnung am Platze sein, nicht voreilig zu verallgemeinern, was wir hier über die Verteilung der seelischen Leistungen an die beiden Systeme zutage gefördert haben. Wir beschreiben die Verhältnisse, wie sie sich beim reifen Menschen zeigen, bei dem das System Vbw strenggenommen nur als Vorstufe der höheren Organisation funktioniert. Welchen Inhalt und welche Beziehungen dies System während der individuellen Entwicklung hat und welche Bedeutung ihm beim Tiere zukommt, das soll nicht aus unserer Beschreibung abgeleitet, sondern selbständig erforscht werden. Wir müssen auch beim Menschen darauf gefaßt sein, etwa krankhafte Bedingungen zu finden, unter denen die beiden Systeme Inhalt wie Charaktere ändern oder selbst miteinander tauschen.
VI. Der Verkehr der beiden Systeme
Es wäre doch unrecht, sich vorzustellen, daß das Ubw in Ruhe verbleibt, während die ganze psychische Arbeit vom Vbw geleistet wird, daß das Ubw etwas Abgetanes, ein rudimentäres Organ, ein Residuum der Entwicklung sei. Oder anzunehmen, daß sich der Verkehr der beiden Systeme auf den Akt der Verdrängung beschränkt, indem das Vbw alles, was ihm störend erscheint, in den Abgrund des Ubw wirft. Das Ubw ist vielmehr lebend, entwicklungsfähig und unterhält eine Anzahl von anderen Beziehungen zum Vbw, darunter auch die der Kooperation. Man muß zusammenfassend sagen, das Ubw setzt sich in die sogenannten Abkömmlinge fort, es ist den Einwirkungen des Lebens zugänglich, beeinflußt beständig das Vbw und ist seinerseits sogar Beeinflussungen von seiten des Vbw unterworfen.
Das Studium der Abkömmlinge des Ubw wird unseren Erwartungen einer schematisch reinlichen Scheidung zwischen den beiden psychischen Systemen eine gründliche Enttäuschung bereiten. Das wird gewiß Unzufriedenheit mit unseren Ergebnissen erwecken und wahrscheinlich dazu benützt werden, den Wert unserer Art der Trennung der psychischen Vorgänge in Zweifel zu ziehen. Allein wir werden geltend machen, daß wir keine andere Aufgabe haben, als die Ergebnisse der Beobachtung in Theorie umzusetzen, und die Verpflichtung von uns weisen, auf den ersten Anlauf eine glatte und durch Einfachheit sich empfehlende Theorie zu erreichen. Wir vertreten deren Komplikationen, solange sie sich der Beobachtung adäquat erweisen, und geben die Erwartung nicht auf, gerade durch sie zur endlichen Erkenntnis eines Sachverhaltes geleitet zu werden, der, an sich einfach, den Komplikationen der Realität gerecht werden kann.
Unter den Abkömmlingen der ubw Triebregungen vom beschriebenen Charakter gibt es welche, die entgegengesetzte Bestimmungen in sich vereinigen. Sie sind einerseits hochorganisiert, widerspruchsfrei, haben allen Erwerb des Systems Bw verwertet und würden sich für unser Urteil von den Bildungen dieses Systems kaum unterscheiden. Anderseits sind sie unbewußt und unfähig, bewußt zu werden. Sie gehören also qualitativ zum System Vbw, faktisch aber zum Ubw. Ihre Herkunft bleibt das für ihr Schicksal Entscheidende. Man muß sie mit den Mischlingen menschlicher Rassen vergleichen, die im großen und ganzen bereits den Weißen gleichen, ihre farbige Abkunft aber durch den einen oder anderen auffälligen Zug verraten und darum von der Gesellschaft ausgeschlossen bleiben und keines der Vorrechte der Weißen genießen. Solcher Art sind die Phantasiebildungen der Normalen wie der Neurotiker, die wir als Vorstufen der Traum- wie der Symptombildung erkannt haben und die trotz ihrer hohen Organisation verdrängt bleiben und als solche nicht bewußt werden können. Sie kommen nahe ans Bewußtsein heran, bleiben ungestört, solange sie keine intensive Besetzung haben, werden aber zurückgeworfen, sobald sie eine gewisse Höhe der Besetzung überschreiten. Ebensolche höher organisierte Abkömmlinge des Ubw sind die Ersatzbildungen, denen aber der Durchbruch zum Bewußtsein dank einer günstigen Relation gelingt, wie z. B. durch das Zusammentreffen mit einer Gegenbesetzung des Vbw.
Wenn wir an anderer Stelle die Bedingungen des Bewußtwerdens eingehender untersuchen, wird uns ein Teil der hier auftauchenden Schwierigkeiten lösbar werden. Hier mag es uns vorteilhaft erscheinen, der bisherigen vom Ubw her aufsteigenden Betrachtung eine vom Bewußtsein ausgehende gegenüberzustellen. Dem Bewußtsein tritt die ganze Summe der psychischen Vorgänge als das Reich des Vorbewußten entgegen. Ein sehr großer Anteil dieses Vorbewußten stammt aus dem Unbewußten, hat den Charakter der Abkömmlinge desselben und unterliegt einer Zensur, ehe er bewußt werden kann. Ein anderer Anteil des Vbw ist ohne Zensur bewußtseinsfähig. Wir gelangen hier zu einem Widerspruch gegen eine frühere Annahme. In der Betrachtung der Verdrängung wurden wir genötigt, die für das Bewußtwerden entscheidende Zensur zwischen die Systeme Ubw und Vbw zu verlegen. Jetzt wird uns eine Zensur zwischen Vbw und Bw nahegelegt. Wir tun aber gut daran, in dieser Komplikation keine Schwierigkeit zu erblicken, sondern anzunehmen, daß jedem Übergang von einem System zum nächst höheren, also jedem Fortschritt zu einer höheren Stufe psychischer Organisation eine neue Zensur entspreche. Die Annahme einer fortlaufenden Erneuerung der Niederschriften ist damit allerdings abgetan.
Der Grund all dieser Schwierigkeiten ist darin zu suchen, daß die Bewußtheit, der einzige uns unmittelbar gegebene Charakter der psychischen Vorgänge, sich zur Systemunterscheidung in keiner Weise eignet. Abgesehen davon, daß das Bewußte nicht immer bewußt, sondern zeitweilig auch latent ist, hat uns die Beobachtung gezeigt, daß vieles, was die Eigenschaften des Systems Vbw teilt, nicht bewußt wird, und haben wir noch zu erfahren, daß das Bewußtwerden durch gewisse Richtungen seiner Aufmerksamkeit eingeschränkt ist. Das Bewußtsein hat so weder zu den Systemen noch zur Verdrängung ein einfaches Verhältnis. Die Wahrheit ist, daß nicht nur das psychisch Verdrängte dem Bewußtsein fremd bleibt, sondern auch ein Teil der unser Ich beherrschenden Regungen, also der stärkste funktionelle Gegensatz des Verdrängten. In dem Maße, als wir uns zu einer metapsychologischen Betrachtung des Seelenlebens durchringen wollen, müssen wir lernen, uns von der Bedeutung des Symptoms »Bewußtheit« zu emanzipieren.
Solange wir noch an diesem haften, sehen wir unsere Allgemeinheiten regelmäßig durch Ausnahmen durchbrochen. Wir sehen, daß Abkömmlinge des Ubw als Ersatzbildungen und als Symptome bewußt werden, in der Regel nach großen Entstellungen gegen das Unbewußte, aber oft mit Erhaltung vieler zur Verdrängung auffordernden Charaktere. Wir finden, daß viele vorbewußte Bildungen unbewußt bleiben, die, sollten wir meinen, ihrer Natur nach sehr wohl bewußt werden dürften. Wahrscheinlich macht sich bei ihnen die stärkere Anziehung des Ubw geltend. Wir werden darauf hingewiesen, die bedeutsamere Differenz nicht zwischen dem Bewußten und dem Vorbewußten, sondern zwischen dem Vorbewußten und dem Unbewußten zu suchen. Das Ubw wird an der Grenze des Vbw durch die Zensur zurückgewiesen, Abkömmlinge desselben können diese Zensur umgehen, sich hoch organisieren, im Vbw bis zu einer gewissen Intensität der Besetzung heranwachsen, werden aber dann, wenn sie diese überschritten haben und sich dem Bewußtsein aufdrängen wollen, als Abkömmlinge des Ubw erkannt und an der neuen Zensurgrenze zwischen Vbw und Bw neuerlich verdrängt. Die erstere Zensur funktioniert so gegen das Ubw selbst, die letztere gegen die vbw Abkömmlinge desselben. Man könnte meinen, die Zensur habe sich im Laufe der individuellen Entwicklung um ein Stück vorgeschoben.
In der psychoanalytischen Kur erbringen wir den unanfechtbaren Beweis für die Existenz der zweiten Zensur, der zwischen den Systemen Vbw und Bw. Wir fordern den Kranken auf, reichlich Abkömmlinge des Ubw zu bilden, verpflichten ihn dazu, die Einwendungen der Zensur gegen das Bewußtwerden dieser vorbewußten Bildungen zu überwinden, und bahnen uns durch die Besiegung dieser Zensur den Weg zur Aufhebung der Verdrängung, die das Werk der früheren Zensur ist. Fügen wir noch die Bemerkung an, daß die Existenz der Zensur zwischen Vbw und Bw uns mahnt, das Bewußtwerden sei kein bloßer Wahrnehmungsakt, sondern wahrscheinlich auch eine Überbesetzung, ein weiterer Fortschritt der psychischen Organisation.
Wenden wir uns zum Verkehr des Ubw mit den anderen Systemen, weniger um Neues festzustellen, als um nicht das Sinnfälligste zu übergehen. An den Wurzeln der Triebtätigkeit kommunizieren die Systeme aufs ausgiebigste miteinander. Ein Anteil der hier erregten Vorgänge geht durch das Ubw wie durch eine Vorbereitungsstufe durch und erreicht die höchste psychische Ausbildung im Bw, ein anderer wird als Ubw zurückgehalten. Das Ubw wird aber auch von den aus der äußeren Wahrnehmung stammenden Erlebnissen getroffen. Alle Wege von der Wahrnehmung zum Ubw bleiben in der Norm frei; erst die vom Ubw weiterführenden Wege unterliegen der Sperrung durch die Verdrängung.
Es ist sehr bemerkenswert, daß das Ubw eines Menschen mit Umgehung des Bw auf das Ubw eines anderen reagieren kann. Die Tatsache verdient eingehendere Untersuchung, besonders nach der Richtung, ob sich vorbewußte Tätigkeit dabei ausschließen läßt, ist aber als Beschreibung unbestreitbar.
Der Inhalt des Systems Vbw (oder Bw) entstammt zu einem Teile dem Triebleben (durch Vermittlung des Ubw), zum anderen Teile der Wahrnehmung. Es ist zweifelhaft, inwieweit die Vorgänge dieses Systems eine direkte Einwirkung auf das Ubw äußern können; die Erforschung pathologischer Fälle zeigt oft eine kaum glaubliche Selbständigkeit und Unbeeinflußbarkeit des Ubw. Ein völliges Auseinandergehen der Strebungen, ein absoluter Zerfall der beiden Systeme, ist überhaupt die Charakteristik des Krankseins. Allein die psychoanalytische Kur ist auf die Beeinflussung des Ubw vom Bw her gebaut und zeigt jedenfalls, daß solche, wiewohl mühsam, nicht unmöglich ist. Die zwischen beiden Systemen vermittelnden Abkömmlinge des Ubw bahnen uns, wie schon erwähnt, den Weg zu dieser Leistung. Wir dürfen aber wohl annehmen, daß die spontan erfolgende Veränderung des Ubw von Seiten des Bw ein schwieriger und langsam verlaufender Prozeß ist.
Eine Kooperation zwischen einer vorbewußten und einer unbewußten, selbst intensiv verdrängten Regung kann zustande kommen, wenn es die Situation ergibt, daß die unbewußte Regung gleichsinnig mit einer der herrschenden Strebungen wirken kann. Die Verdrängung wird für diesen Fall aufgehoben, die verdrängte Aktivität als Verstärkung der vom Ich beabsichtigten zugelassen. Das Unbewußte wird für diese eine Konstellation ichgerecht, ohne daß sonst an seiner Verdrängung etwas abgeändert würde. Der Erfolg des Ubw ist bei dieser Kooperation unverkennbar; die verstärkten Strebungen benehmen sich doch anders als die normalen, sie befähigen zu besonders vollkommener Leistung, und sie zeigen gegen Widersprüche eine ähnliche Resistenz wie etwa die Zwangssymptome.
Den Inhalt des Ubw kann man einer psychischen Urbevölkerung vergleichen. Wenn es beim Menschen ererbte psychische Bildungen, etwas dem Instinkt der Tiere Analoges gibt, so macht dies den Kern des Ubw aus. Dazu kommt später das während der Kindheitsentwicklung als unbrauchbar Beseitigte hinzu, was seiner Natur nach von dem Ererbten nicht verschieden zu sein braucht. Eine scharfe und endgültige Scheidung des Inhaltes der beiden Systeme stellt sich in der Regel erst mit dem Zeitpunkte der Pubertät her.
VII. Die Agnoszierung des Unbewußten
Soviel, als wir in den vorstehenden Erörterungen zusammengetragen haben, läßt sich etwa über das Ubw aussagen, solange man nur aus der Kenntnis des Traumlebens und der Übertragungsneurosen schöpft. Es ist gewiß nicht viel, macht stellenweise den Eindruck des Ungeklärten und Verwirrenden und läßt vor allem die Möglichkeit vermissen, das Ubw an einen bereits bekannten Zusammenhang anzuordnen oder es in ihn einzureihen. Erst die Analyse einer der Affektionen, die wir narzißtische Psychoneurosen heißen, verspricht uns Auffassungen zu liefern, durch welche uns das rätselvolle Ubw nähergerückt und gleichsam greifbar gemacht wird.
Seit einer Arbeit von Abraham (1908), welche der gewissenhafte Autor auf meine Anregung zurückgeführt hat, versuchen wir die Dementia praecox Kraepelins (Schizophrenie Bleulers) durch ihr Verhalten zum Gegensatz von Ich und Objekt zu charakterisieren. Bei den Übertragungsneurosen (Angst- und Konversionshysterie, Zwangsneurose) lag nichts vor, was diesen Gegensatz in den Vordergrund gerückt hätte. Man wußte zwar, daß die Versagung des Objekts den Ausbruch der Neurose herbeiführt und daß die Neurose den Verzicht auf das reale Objekt involviert, auch daß die dem realen Objekt entzogene Libido auf ein phantasiertes Objekt und von da aus auf ein verdrängtes zurückgeht (Introversion). Aber die Objektbesetzung überhaupt wird bei ihnen mit großer Energie festgehalten, und die feinere Untersuchung des Verdrängungsvorganges hat uns anzunehmen genötigt, daß die Objektbesetzung im System Ubw trotz der Verdrängung –; vielmehr infolge derselben –; fortbesteht. Die Fähigkeit zur Übertragung, welche wir bei diesen Affektionen therapeutisch ausnützen, setzt ja die ungestörte Objektbesetzung voraus.
Bei der Schizophrenie hat sich uns dagegen die Annahme aufgedrängt, daß nach dem Prozesse der Verdrängung die abgezogene Libido kein neues Objekt suche, sondern ins Ich zurücktrete, daß also hier die Objektbesetzungen aufgegeben und ein primitiver objektloser Zustand von Narzißmus wiederhergestellt werde. Die Unfähigkeit dieser Patienten zur Übertragung –; soweit der Krankheitsprozeß reicht –;, ihre daraus folgende therapeutische Unzugänglichkeit, die ihnen eigentümliche Ablehnung der Außenwelt, das Auftreten von Zeichen einer Überbesetzung des eigenen Ichs, der Ausgang in völlige Apathie, all diese klinischen Charaktere scheinen zu der Annahme eines Aufgebens der Objektbesetzungen trefflich zu stimmen. Von seiten des Verhältnisses der beiden psychischen Systeme wurde allen Beobachtern auffällig, daß bei der Schizophrenie vieles als bewußt geäußert wird, was wir bei den Übertragungsneurosen erst durch Psychoanalyse im Ubw nachweisen müssen. Aber es gelang zunächst nicht, zwischen der Ich-Objektbeziehung und den Bewußtseinsrelationen eine verständliche Verknüpfung herzustellen.
Das Gesuchte scheint sich auf folgendem unvermuteten Wege zu ergeben. Bei den Schizophrenen beobachtet man, zumal in den so lehrreichen Anfangsstadien, eine Anzahl von Veränderungen der Sprache, von denen einige es verdienen, unter einem bestimmten Gesichtspunkt betrachtet zu werden. Die Ausdrucksweise wird oft Gegenstand einer besonderen Sorgfalt, sie wird »gewählt«, »geziert«. Die Sätze erfahren eine besondere Desorganisation des Aufbaues, durch welche sie uns unverständlich werden, so daß wir die Äußerungen der Kranken für unsinnig halten. Im Inhalt dieser Äußerungen wird oft eine Beziehung zu Körperorganen oder Körperinnervationen in den Vordergrund gerückt. Dem kann man anreihen, daß in solchen Symptomen der Schizophrenie, welche hysterischen oder zwangsneurotischen Ersatzbildungen gleichen, doch die Beziehung zwischen dem Ersatz und dem Verdrängten Eigentümlichkeiten zeigt, welche uns bei den beiden genannten Neurosen befremden würden.
Herr Dr. V. Tausk (Wien) hat mir einige seiner Beobachtungen bei beginnender Schizophrenie zur Verfügung gestellt, die durch den Vorzug ausgezeichnet sind, daß die Kranke selbst noch die Aufklärung ihrer Reden geben wollte. Ich will nun an zweien seiner Beispiele zeigen, welche Auffassung ich zu vertreten beabsichtige, zweifle übrigens nicht daran, daß es jedem Beobachter leicht sein würde, solches Material in Fülle vorzubringen.
Eine der Kranken Tausks, ein Mädchen, das nach einem Zwist mit ihrem Geliebten auf die Klinik gebracht wurde, klagt:
Die Augen sind nicht richtig, sie sind verdreht. Das erläutert sie selbst, indem sie in geordneter Sprache eine Reihe von Vorwürfen gegen den Geliebten vorbringt. »Sie kann ihn gar nicht verstehen, er sieht jedesmal anders aus, er ist ein Heuchler, ein Augenverdreher, er hat ihr die Augen verdreht, jetzt hat sie verdrehte Augen, es sind nicht mehr ihre Augen, sie sieht die Welt jetzt mit anderen Augen.«
Die Äußerungen der Kranken zu ihrer unverständlichen Rede haben den Wert einer Analyse, da sie deren Äquivalent in allgemein verständlicher Ausdrucksweise enthalten; sie geben gleichzeitig Aufschluß über Bedeutung und über Genese der schizophrenen Wortbildung. In Übereinstimmung mit Tausk hebe ich aus diesem Beispiel hervor, daß die Beziehung zum Organ (zum Auge) sich zur Vertretung des ganzen Inhaltes aufgeworfen hat. Die schizophrene Rede hat hier einen hypochondrischen Zug, sie ist Organsprache geworden.
Eine zweite Mitteilung derselben Kranken: »Sie steht in der Kirche, plötzlich gibt es ihr einen Ruck, sie muß sich anders stellen, als stellte sie jemand, als würde sie gestellt.«
Dazu die Analyse durch eine neue Reihe von Vorwürfen gegen den Geliebten, »der ordinär ist, der sie, die vom Hause aus fein war, auch ordinär gemacht hat. Er hat sie sich ähnlich gemacht, indem er sie glauben machte, er sei ihr überlegen; nun sei sie so geworden, wie er ist, weil sie glaubte, sie werde besser sein, wenn sie ihm gleich werde. Er hat sich verstellt, sie ist jetzt so wie er (Identifizierung!), er hat sie verstellt.«
Die Bewegung des »Sich-anders-Stellen«, bemerkt Tausk, ist eine Darstellung des Wortes »verstellen« und der Identifizierung mit dem Geliebten. Ich hebe wiederum die Prävalenz jenes Elements des ganzen Gedankenganges hervor, welches eine körperliche Innervation (vielmehr deren Empfindung) zum Inhalt hat. Eine Hysterika hätte übrigens im ersten Falle krampfhaft die Augen verdreht, im zweiten den Ruck wirklich ausgeführt, anstatt den Impuls dazu oder die Sensation davon zu verspüren, und in beiden Fällen hätte sie keinen bewußten Gedanken dabei gehabt und wäre auch nachträglich nicht imstande gewesen, solche zu äußern.
Soweit zeugen diese beiden Beobachtungen für das, was wir hypochondrische oder Organsprache genannt haben. Sie mahnen aber auch, was uns wichtiger erscheint, an einen anderen Sachverhalt, der sich beliebig oft z. B. an den in Bleulers Monographie gesammelten Beispielen nachweisen und in eine bestimmte Formel fassen läßt. Bei der Schizophrenie werden die Worte demselben Prozeß unterworfen, der aus den latenten Traumgedanken die Traumbilder macht, den wir den psychischen Primärvorgang geheißen haben. Sie werden verdichtet und übertragen einander ihre Besetzungen restlos durch Verschiebung; der Prozeß kann so weit gehen, daß ein einziges, durch mehrfache Beziehungen dazu geeignetes Wort die Vertretung einer ganzen Gedankenkette übernimmt. Die Arbeiten von Bleuler, Jung und ihren Schülern haben gerade für diese Behauptung reichliches Material ergeben [Fußnote]Gelegentlich behandelt die Traumarbeit die Worte wie die Dinge und schafft dann sehr ähnliche »schizophrene« Reden oder Wortneubildungen..
Ehe wir aus solchen Eindrücken einen Schluß ziehen, wollen wir noch der feinen, aber doch befremdlich wirkenden Unterschiede zwischen der schizophrenen und der hysterischen und zwangsneurotischen Ersatzbildung gedenken. Ein Patient, den ich gegenwärtig beobachte, läßt sich durch den schlechten Zustand seiner Gesichtshaut von allen Interessen des Lebens abziehen. Er behauptet, Mitesser zu haben und tiefe Löcher im Gesicht, die ihm jedermann ansieht. Die Analyse weist nach, daß er seinen Kastrationskomplex an seiner Haut abspielt. Er beschäftigte sich zunächst reuelos mit seinen Mitessern, deren Ausdrücken ihm große Befriedigung bereitete, weil dabei etwas herausspritzte, wie er sagt. Dann begann er zu glauben, daß überall dort, wo er einen Comedo beseitigt hatte, eine tiefe Grube entstanden sei, und er machte sich die heftigsten Vorwürfe, durch sein »beständiges Herumarbeiten mit der Hand« seine Haut für alle Zeiten verdorben zu haben. Es ist evident, daß ihm das Auspressen des Inhaltes der Mitesser ein Ersatz für die Onanie ist. Die Grube, die darauf durch seine Schuld entsteht, ist das weibliche Genitale, d. h. die Erfüllung der durch die Onanie provozierten Kastrationsdrohung (resp. der sie vertretenden Phantasie). Diese Ersatzbildung hat trotz ihres hypochondrischen Charakters viel Ähnlichkeit mit einer hysterischen Konversion, und doch wird man das Gefühl haben, daß hier etwas anderes vorgehen müsse, daß man solche Ersatzbildung einer Hysterie nicht zutrauen dürfe, noch ehe man sagen kann, worin die Verschiedenheit begründet ist. Ein winziges Grübchen wie eine Hautpore wird ein Hysteriker kaum zum Symbol der Vagina nehmen, die er sonst mit allen möglichen Gegenständen vergleicht, welche einen Hohlraum umschließen. Auch meinen wir, daß die Vielheit der Grübchen ihn abhalten wird, sie als Ersatz für das weibliche Genitale zu verwenden. Ähnliches gilt für einen jugendlichen Patienten, über den Tausk vor Jahren der Wiener Psychoanalytischen Gesellschaft berichtet hat. Er benahm sich sonst ganz wie ein Zwangsneurotiker, verbrauchte Stunden für seine Toilette u. dgl. Es war aber an ihm auffällig, daß er widerstandslos die Bedeutung seiner Hemmungen mitteilen konnte. Beim Anziehen der Strümpfe störte ihn z. B. die Idee, daß er die Maschen des Gewebes, also Löcher, auseinanderziehen müsse, und jedes Loch war ihm Symbol der weiblichen Geschlechtsöffnung. Auch dies ist einem Zwangsneurotiker nicht zuzutrauen; ein solcher, aus der Beobachtung von R. Reitler, der am gleichen Verweilen beim Strumpfanziehen litt, fand nach Überwindung der Widerstände die Erklärung, daß der Fuß ein Penissymbol sei, das Überziehen des Strumpfes ein onanistischer Akt, und er mußte den Strumpf fortgesetzt an- und ausziehen, zum Teil, um das Bild der Onanie zu vervollkommnen, zum Teil, um sie ungeschehen zu machen.
Fragen wir uns, was der schizophrenen Ersatzbildung und dem Symptom den befremdlichen Charakter verleiht, so erfassen wir endlich, daß es das Überwiegen der Wortbeziehung über die Sachbeziehung ist. Zwischen dem Ausdrücken eines Mitessers und einer Ejakulation aus dem Penis besteht eine recht geringe Sachähnlichkeit, eine noch geringere zwischen den unzähligen seichten Hautporen und der Vagina; aber im ersten Falle spritzt beide Male etwas heraus, und für den zweiten gilt wörtlich der zynische Satz: »Loch ist Loch.« Die Gleichheit des sprachlichen Ausdruckes, nicht die Ähnlichkeit der bezeichneten Dinge, hat den Ersatz vorgeschrieben. Wo die beiden –; Wort und Ding –; sich nicht decken, weicht die schizophrene Ersatzbildung von der bei den Übertragungsneurosen ab.
Setzen wir diese Einsicht mit der Annahme zusammen, daß bei der Schizophrenie die Objektbesetzungen aufgegeben werden. Wir müssen dann modifizieren: die Besetzung der Wortvorstellungen der Objekte wird festgehalten. Was wir die bewußte Objektvorstellung heißen durften, zerlegt sich uns jetzt in die Wortvorstellung und in die Sachvorstellung, die in der Besetzung, wenn nicht der direkten Sacherinnerungsbilder, doch entfernterer und von ihnen abgeleiteter Erinnerungsspuren besteht. Mit einem Male glauben wir nun zu wissen, wodurch sich eine bewußte Vorstellung von einer unbewußten unterscheidet. Die beiden sind nicht, wie wir gemeint haben, verschiedene Niederschriften desselben Inhaltes an verschiedenen psychischen Orten, auch nicht verschiedene funktionelle Besetzungszustände an demselben Orte, sondern die bewußte Vorstellung umfaßt die Sachvorstellung plus der zugehörigen Wortvorstellung, die unbewußte ist die Sachvorstellung allein. Das System Ubw enthält die Sachbesetzungen der Objekte, die ersten und eigentlichen Objektbesetzungen; das System Vbw entsteht, indem diese Sachvorstellung durch die Verknüpfung mit den ihr entsprechenden Wortvorstellungen überbesetzt wird. Solche Überbesetzungen, können wir vermuten, sind es, welche eine höhere psychische Organisation herbeiführen und die Ablösung des Primärvorganges durch den im Vbw herrschenden Sekundärvorgang ermöglichen. Wir können jetzt auch präzise ausdrücken, was die Verdrängung bei den Übertragungsneurosen der zurückgewiesenen Vorstellung verweigert: Die Übersetzung in Worte, welche mit dem Objekt verknüpft bleiben sollen. Die nicht in Worte gefaßte Vorstellung oder der nicht überbesetzte psychische Akt bleibt dann im Ubw als verdrängt zurück.
Ich darf darauf aufmerksam machen, wie frühzeitig wir bereits die Einsicht besessen haben, die uns heute einen der auffälligsten Charaktere der Schizophrenie verständlich macht. Auf den letzten Seiten der 1900 veröffentlichten Traumdeutung ist ausgeführt, daß die Denkvorgänge, d. i. die von den Wahrnehmungen entfernteren Besetzungsakte, an sich qualitätslos und unbewußt sind und ihre Fähigkeit, bewußt zu werden, nur durch die Verknüpfung mit den Resten der Wortwahrnehmungen erlangen. Die Wortvorstellungen entstammen ihrerseits der Sinneswahrnehmung in gleicher Weise wie die Sachvorstellungen, so daß man die Frage aufwerfen könnte, warum die Objektvorstellungen nicht mittels ihrer eigenen Wahrnehmungsreste bewußt werden können. Aber wahrscheinlich geht das Denken in Systemen vor sich, die von den ursprünglichen Wahrnehmungsresten so weit entfernt sind, daß sie von deren Qualitäten nichts mehr erhalten haben und zum Bewußtwerden einer Verstärkung durch neue Qualitäten bedürfen. Außerdem können durch die Verknüpfung mit Worten auch solche Besetzungen mit Qualität versehen werden, die aus den Wahrnehmungen selbst keine Qualität mitbringen konnten, weil sie bloß Relationen zwischen den Objektvorstellungen entsprechen. Solche erst durch Worte faßbar gewordene Relationen sind ein Hauptbestandteil unserer Denkvorgänge. Wir verstehen, daß die Verknüpfung mit Wortvorstellungen noch nicht mit dem Bewußtwerden zusammenfällt, sondern bloß die Möglichkeit dazu gibt, daß sie also kein anderes System als das des Vbw charakterisiert. Nun merken wir aber, daß wir mit diesen Erörterungen unser eigentliches Thema verlassen und mitten in die Probleme des Vorbewußten und Bewußten geraten, die wir zweckmäßigerweise einer gesonderten Behandlung vorbehalten.
Bei der Schizophrenie, die wir ja hier auch nur so weit berühren, als uns zur allgemeinen Erkennung des Ubw unerläßlich scheint, muß uns der Zweifel auftauchen, ob der hier Verdrängung genannte Vorgang überhaupt noch etwas mit der Verdrängung bei den Übertragungsneurosen gemein hat. Die Formel, die Verdrängung sei ein Vorgang zwischen dem System Ubw und dem Vbw (oder Bw) mit dem Erfolg der Fernhaltung vom Bewußtsein, bedarf jedenfalls einer Abänderung, um den Fall der Dementia praecox und anderer narzißtischer Affektionen miteinschließen zu können. Aber der Fluchtversuch des Ichs, der sich in der Abziehung der bewußten Besetzung äußert, bleibt immerhin als das Gemeinsame bestehen. Um wie vieles gründlicher und tiefgreifender dieser Fluchtversuch, diese Flucht des Ichs bei den narzißtischen Neurosen ins Werk gesetzt wird, lehrt die oberflächlichste Überlegung.
Wenn diese Flucht bei der Schizophrenie in der Einziehung der Triebbesetzung von den Stellen besteht, welche die unbewußte Objektvorstellung repräsentieren, so mag es befremdlich erscheinen, daß der dem System Vbw angehörige Teil derselben Objektvorstellung –; die ihr entsprechenden Wortvorstellungen –; vielmehr eine intensivere Besetzung erfahren sollen. Man könnte eher erwarten, daß die Wortvorstellung als der vorbewußte Anteil den ersten Stoß der Verdrängung auszuhalten hat und daß sie ganz und gar unbesetzbar wird, nachdem sich die Verdrängung bis zu den unbewußten Sachvorstellungen fortgesetzt hat. Dies ist allerdings eine Schwierigkeit des Verständnisses. Es ergibt sich die Auskunft, daß die Besetzung der Wortvorstellung nicht zum Verdrängungsakt gehört, sondern den ersten der Herstellungs- oder Heilungsversuche darstellt, welche das klinische Bild der Schizophrenie so auffällig beherrschen. Diese Bemühungen wollen die verlorenen Objekte wiedergewinnen, und es mag wohl sein, daß sie in dieser Absicht den Weg zum Objekt über den Wortanteil desselben einschlagen, wobei sie sich aber dann mit den Worten an Stelle der Dinge begnügen müssen. Unsere seelische Tätigkeit bewegt sich ja ganz allgemein in zwei entgegengesetzten Verlaufsrichtungen, entweder von den Trieben her durch das System Ubw zur bewußten Denkarbeit oder auf Anregung von außen durch das System des Bw und Vbw bis zu den ubw Besetzungen des Ichs und der Objekte. Dieser zweite Weg muß trotz der vorgefallenen Verdrängung passierbar bleiben und steht den Bemühungen der Neurose, ihre Objekte wiederzugewinnen, ein Stück weit offen. Wenn wir abstrakt denken, sind wir in Gefahr, die Beziehungen der Worte zu den unbewußten Sachvorstellungen zu vernachlässigen, und es ist nicht zu leugnen, daß unser Philosophieren dann eine unerwünschte Ähnlichkeit in Ausdruck und Inhalt mit der Arbeitsweise der Schizophrenen gewinnt. Anderseits kann man von der Denkweise der Schizophrenen die Charakteristik versuchen, sie behandeln konkrete Dinge, als ob sie abstrakte wären.
Wenn wir wirklich das Ubw agnosziert und den Unterschied einer unbewußten Vorstellung von einer vorbewußten richtig bestimmt haben, so werden unsere Untersuchungen von vielen anderen Stellen her zu dieser Einsicht zurückführen müssen.
Das Unheimliche (1919)
I
Der Psychoanalytiker verspürt nur selten den Antrieb zu ästhetischen Untersuchungen, auch dann nicht, wenn man die Ästhetik nicht auf die Lehre vom Schönen einengt, sondern sie als Lehre von den Qualitäten unseres Fühlens beschreibt. Er arbeitet in anderen Schichten des Seelenlebens und hat mit den zielgehemmten, gedämpften, von so vielen begleitenden Konstellationen abhängigen Gefühlsregungen, die zumeist der Stoff der Ästhetik sind, wenig zu tun. Hie und da trifft es sich doch, daß er sich für ein bestimmtes Gebiet der Ästhetik interessieren muß, und dann ist dies gewöhnlich ein abseits liegendes, von der ästhetischen Fachliteratur vernachlässigtes.
Ein solches ist das »Unheimliche«. Kein Zweifel, daß es zum Schreckhaften, Angst- und Grauenerregenden gehört, und ebenso sicher ist es, daß dies Wort nicht immer in einem scharf zu bestimmenden Sinne gebraucht wird, so daß es eben meist mit dem Angsterregenden überhaupt zusammenfällt. Aber man darf doch erwarten, daß ein besonderer Kern vorhanden ist, der die Verwendung eines besonderen Begriffswortes rechtfertigt. Man möchte wissen, was dieser gemeinsame Kern ist, der etwa gestattet, innerhalb des Ängstlichen ein »Unheimliches« zu unterscheiden.
Darüber findet man nun so viel wie nichts in den ausführlichen Darstellungen der Ästhetik, die sich überhaupt lieber mit den schönen, großartigen, anziehenden, also mit den positiven Gefühlsarten, ihren Bedingungen und den Gegenständen, die sie hervorrufen, als mit den gegensätzlichen, abstoßenden, peinlichen beschäftigen. Von Seiten der ärztlich-psychologischen Literatur kenne ich nur die eine, inhaltsreiche, aber nicht erschöpfende Abhandlung von E. Jentsch [Fußnote]›Zur Psychologie des Unheimlichen‹ (1906).. Allerdings muß ich gestehen, daß aus leicht zu erratenden, in der Zeit liegenden Gründen die Literatur zu diesem kleinen Beitrag, insbesondere die fremdsprachige, nicht gründlich herausgesucht wurde, weshalb er denn auch ohne jeden Anspruch auf Priorität vor den Leser tritt. Als Schwierigkeit beim Studium des Unheimlichen betont Jentsch mit vollem Recht, daß die Empfindlichkeit für diese Gefühlsqualität bei verschiedenen Menschen so sehr verschieden angetroffen wird. Ja, der Autor dieser neuen Unternehmung muß sich einer besonderen Stumpfheit in dieser Sache anklagen, wo große Feinfühligkeit eher am Platze wäre. Er hat schon lange nichts erlebt oder kennengelernt, was ihm den Eindruck des Unheimlichen gemacht hätte, muß sich erst in das Gefühl hineinversetzen, die Möglichkeit desselben in sich wachrufen. Indes sind Schwierigkeiten dieser Art auch auf vielen anderen Gebieten der Ästhetik mächtig; man braucht darum die Erwartung nicht aufzugeben, daß sich die Fälle werden herausheben lassen, in denen der fragliche Charakter von den meisten widerspruchslos anerkannt wird.
Man kann nun zwei Wege einschlagen: nachsuchen, welche Bedeutung die Sprachentwicklung in dem Worte »unheimlich« niedergelegt hat, oder zusammentragen, was an Personen und Dingen, Sinneseindrücken, Erlebnissen und Situationen das Gefühl des Unheimlichen in uns wachruft, und den verhüllten Charakter des Unheimlichen aus einem allen Fällen Gemeinsamen erschließen. Ich will gleich verraten, daß beide Wege zum nämlichen Ergebnis führen, das Unheimliche sei jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht. Wie das möglich ist, unter welchen Bedingungen das Vertraute unheimlich, schreckhaft werden kann, das wird aus dem Weiteren ersichtlich werden. Ich bemerke noch, daß diese Untersuchung in Wirklichkeit den Weg über eine Sammlung von Einzelfällen genommen und erst später die Bestätigung durch die Aussage des Sprachgebrauches gefunden hat. In dieser Darstellung werde ich aber den umgekehrten Weg gehen.
Das deutsche Wort »unheimlich« ist offenbar der Gegensatz zu heimlich, heimisch, vertraut, und der Schluß liegt nahe, es sei etwas eben darum schreckhaft, weil es nicht bekannt und vertraut ist. Natürlich ist aber nicht alles schreckhaft, was neu und nicht vertraut ist; die Beziehung ist nicht umkehrbar. Man kann nur sagen, was neuartig ist, wird leicht schreckhaft und unheimlich; einiges Neuartige ist schreckhaft, durchaus nicht alles. Zum Neuen und Nichtvertrauten muß erst etwas hinzukommen, was es zum Unheimlichen macht.
Jentsch ist im ganzen bei dieser Beziehung des Unheimlichen zum Neuartigen, Nichtvertrauten, stehengeblieben. Er findet die wesentliche Bedingung für das Zustandekommen des unheimlichen Gefühls in der intellektuellen Unsicherheit. Das Unheimliche wäre eigentlich immer etwas, worin man sich sozusagen nicht auskennt. Je besser ein Mensch in der Umwelt orientiert ist, desto weniger leicht wird er von den Dingen oder Vorfällen in ihr den Eindruck der Unheimlichkeit empfangen.
Wir haben es leicht zu urteilen, daß diese Kennzeichnung nicht erschöpfend ist, und versuchen darum, über die Gleichung unheimlich = nicht vertraut hinauszugehen. Wir wenden uns zunächst an andere Sprachen. Aber die Wörterbücher, in denen wir nachschlagen, sagen uns nichts Neues, vielleicht nur darum nicht, weil wir selbst Fremdsprachige sind. Ja, wir gewinnen den Eindruck, daß vielen Sprachen ein Wort für diese besondere Nuance des Schreckhaften abgeht [Fußnote]Für die nachstehenden Auszüge bin ich Herrn Dr. Th. Reik zu Dank verpflichtet..
Lateinisch (nach K. E. Georges, Kl. Deutschlatein. Wörterbuch 1898): ein unheimlicher Ort –; locus suspectus; in unheimlicher Nachtzeit –; intempesta nocte.
Griechisch (Wörterbücher von Rost und von Schenkl): ξένος; –; also fremd, fremdartig.
Englisch (aus den Wörterbüchern von Lucas, Bellows, Flügel, Muret-Sanders): uncomfortable, uneasy, gloomy, dismal, uncanny, ghastly, von einem Hause: haunted, von einem Menschen: a repulsive fellow.
Französisch (Sachs-Villatte): inquiétant, sinistre, lugubre, mal à son aise.
Spanisch (Tollhausen 1889): sospechoso, de mal aguëro, lúgubre, siniestro.
Das Italienische und Portugiesische scheinen sich mit Worten zu begnügen, die wir als Umschreibungen bezeichnen würden. Im Arabischen und Hebräischen fällt unheimlich mit dämonisch, schaurig zusammen.
Kehren wir darum zur deutschen Sprache zurück.
In Daniel Sanders' Wörterbuch der Deutschen Sprache 1860 finden sich folgende Angaben zum Worte heimlich, die ich hier ungekürzt abschreiben und aus denen ich die eine und die andere Stelle durch Unterstreichung hervorheben will (Bd. 1, S. 729):
Heimlich, a. (-keit, f. -en): 1. auch Heimelich, heimelig, zum Hause gehörig, nicht fremd, vertraut, zahm, traut und traulich, anheimelnd etc. ( a) (veralt.) zum Haus, zur Familie gehörig oder: wie dazu gehörig betrachtet, vgl. lat. familiaris, vertraut: Die Heimlichen, die Hausgenossen; Der heimliche Rath. 1. Mos. 41, 45; 2. Sam. 23, 23. 1 Chr. 12, 25. Weish. 8, 4., wofür jetzt: Geheimer (s. d 1.) Rath üblich ist, s. Heimlicher –; ( b) von Thieren zahm, sich den Menschen traulich anschließend. Ggstz. wild, z. B.: Thier, die weder wild noch heimlich sind, etc. Eppendorf. 88; Wilde Thier . . . so man sie h. und gewohnsam um die Leute aufzeucht. 92. So diese Thierle von Jugend bei den Menschen erzogen, werden sie ganz h., freundlich etc., Stumpf 608 a etc. –; So noch: So h. ist's (das Lamm) und frißt aus meiner Hand. Hölty; Ein schöner, heimelicher (s. c) Vogel bleibt der Storch immerhin. Linck, Schi. 146. s. Häuslich 1. etc. –; ( c) traut, traulich anheimelnd; das Wohlgefühl stiller Befriedigung etc., behaglicher Ruhe u. sichern Schutzes, wie das umschlossne, wohnliche Haus erregend (vgl. Geheuer): Ist dir's h. noch im Lande, wo die Fremden deine Wälder roden? Alexis H. 1, 1, 289; Es war ihr nicht allzu h. bei ihm. Brentano Wehm. 92; Auf einem hohen h-en Schattenpfade . . ., längs dem rieselnden rauschenden und plätschernden Waldbach. Forster B. 1, 417. Die H-keit der Heimath zerstören. Gervinus Lit. 5, 375. So vertraulich und h. habe ich nicht leicht ein Plätzchen gefunden. G[oethe], 14, 14; Wir dachten es uns so bequem, so artig, so gemüthlich und h. 15, 9; In stiller H-keit, umzielt von engen Schranken. Haller; Einer sorglichen Hausfrau, die mit dem Wenigsten eine vergnügliche H-keit (Häuslichkeit) zu schaffen versteht. Hartmann Unst. 1, 188; Desto h-er kam ihm jetzt der ihm erst kurz noch so fremde Mann vor. Kerner 540; Die protestantischen Besitzer fühlen sich . . . nicht h. unter ihren katholischen Unterthanen. Kohl. Irl. 1, 172; Wenns h. wird und leise / die Abendstille nur an deiner Zelle lauscht. Tiedge 2, 39; Still und lieb und h., als sie sich / zum Ruhen einen Platz nur wünschen möchten. W[ieland], 11, 144; Es war ihm garnicht h. dabei 27. 170, etc. –; Auch: Der Platz war so still, so einsam, so schatten-h. Scherr Pilg. 1, 170; Die ab- und zuströmenden Fluthwellen, träumend und wiegenlied-h. Körner, Sch. 3, 320, etc. –; Vgl. namentl. Un-h. –; Namentl. bei schwäb., schwzr. Schriftst. oft dreisilbig: Wie 'heimelich' war es dann Ivo Abends wieder, als er zu Hause lag. Auerbach, D. 1, 249; In dem Haus ist mir's so heimelig gewesen. 4. 307; Die warme Stube, der heimelige Nachmittag. Gotthelf, Sch. 127, 148; Das ist das wahre Heimelig, wenn der Mensch so von Herzen fühlt, wie wenig er ist, wie groß der Herr ist. 147; Wurde man nach und nach recht gemüthlich und heimelig mit einander. U. 1, 297; Die trauliche Heimeligkeit. 380, 2, 86; Heimelicher wird es mir wohl nirgends werden als hier. 327; Pestalozzi 4, 240; Was von ferne herkommt . . . lebt gw. nicht ganz heimelig (heimatlich, freundnachbarlich) mit den Leuten. 325; Die Hütte, wo / er sonst so heimelig, so froh / . . . im Kreis der Seinen oft gesessen. Reithard 20; Da klingt das Horn des Wächters so heimelig vom Thurm / da ladet seine Stimme so gastlich. 49; Es schläft sich da so lind und warm / so wunderheim'lig ein. 23, etc. –; Diese Weise verdiente allgemein zu werden, um das gute Wort vor dem Veralten wegen nahe liegender Verwechslung mit 2 zu bewahren, vgl.: 'Die Zecks sind alle h. (2)' H.? . . Was verstehen sie unter h.? . . –; 'Nun . . . es kommt mir mit ihnen vor, wie mit einem zugegrabenen Brunnen oder einem ausgetrockneten Teich. Man kann nicht darüber gehen, ohne daß es Einem immer ist, als könnte da wieder einmal Wasser zum Vorschein kommen.' Wir nennen das un-h.; Sie nennen's h. Worin finden Sie denn, daß diese Familie etwas Verstecktes und Unzuverlässiges hat? etc. Gutzkow R. 2, 61 [Fußnote]Sperrdruck (auch im folgenden) vom Referenten.. –; ( d) (s. c) namentl. schles.: fröhlich, heiter, auch vom Wetter, s. Adelung und Weinhold.
2. versteckt, verborgen gehalten, so daß man Andre nicht davon oder darum wissen lassen, es ihnen verbergen will, vgl. Geheim ( 2.), von welchem erst nhd. Ew. es doch zumal in der älteren Sprache, z. B. in der Bibel, wie Hiob 11, 6; 15, 8; Weish. 2, 22; 1. Kor. 2, 7 etc., und so auch H-keit statt Geheimnis. Matth. 13, 35 etc., nicht immer genau geschieden wird: H. (hinter Jemandes Rücken) Etwas thun, treiben; Sich h. davon schleichen; H-e Zusammenkünfte, Verabredungen; Mit h-er Schadenfreude zusehen; H. seufzen, weinen; H. thun, als ob man etwas zu verbergen hätte; H-e Liebschaft, Liebe, Sünde; H-e Orte (die der Wohlstand zu verhüllen gebietet). 1. Sam. 5, 6; Das h-e Gemach (Abtritt). 2. Kön. 10, 27; W[ieland], 5, 256 etc., auch: Der h-e Stuhl. Zinkgräf 1, 249; In Graben, in H-keiten werfen. 3, 75; Rollenhagen Fr. 83 etc. –; Führte h. vor Laomedon / die Stuten vor. B[ürger], 161 b etc. –; Ebenso versteckt, h., hinterlistig und boshaft gegen grausame Herren . . . wie offen, frei, theilnehmend und dienstwillig gegen den leidenden Freund. Burmeister gB 2, 157; Du sollst mein h. Heiligstes noch wissen. Chamisso 4, 56; Die h-e Kunst (der Zauberei). 3, 224; Wo die öffentliche Ventilation aufhören muß, fängt die h-e Machination an. Forster, Br. 2, 135; Freiheit ist die leise Parole h. Verschworener, das laute Feldgeschrei der öffentlich Umwälzenden. G[oethe], 4, 222; Ein heilig, h. Wirken. 15; Ich habe Wurzeln / die sind gar h., / im tiefen Boden / bin ich gegründet. 2, 109; Meine h-e Tücke (vgl. Heimtücke). 30, 344; Empfängt er es nicht offenbar und gewissenhaft, so mag er es h. und gewissenlos ergreifen. 39, 33; Ließ h. und geheimnisvoll achromatische Fernröhre zusammensetzen. 375; Von nun an, will ich, sei nichts H-es / mehr unter uns. Sch[iller], 369 b. –; Jemandes H-keiten entdecken, offenbaren, verrathen; H-keiten hinter meinem Rücken zu brauen. Alexis. H. 2, 3, 168; Zu meiner Zeit / befliß man sich der H-keit. Hagedorn 3, 92; Die H-keit und das Gepuschele unter der Hand. Immermann, M. 3, 289; Der H-keit (des verborgnen Golds) unmächtigen Bann / kann nur die Hand der Einsicht lösen. Novalis. 1, 69; / Sag' an, wo du sie . . . verbirgst, in welches Ortes verschwiegener H. Sch[iller], 495 b; Ihr Bienen, die ihr knetet / der H-keiten Schloß (Wachs zum Siegeln). Tieck, Cymb. 3, 2; Erfahren in seltnen H-keiten (Zauberkünsten). Schlegel Sh. 6, 102 etc., vgl. Geheimnis L[essing], 10: 291 ff.
Zsstzg. s. 1c, so auch nam. der Ggstz.: Un-: unbehagliches, banges Grauen erregend: Der schier ihm un-h., gespenstisch erschien. Chamisso 3, 238; Der Nacht un-h., bange Stunden. 4, 148; Mir war schon lang' un-h., ja graulich zu Muthe. 242; Nun fängts mir an, un-h. zu werden. G[oethe], 6, 330; . . . Empfindet ein u-es Grauen. Heine, Verm. 1, 51; Un-h. und starr wie ein Steinbild. Reis, 1, 10; Den u-en Nebel, Haarrauch geheißen. Immermann M., 3, 299; Diese blassen Jungen sind un-h. und brauen Gott weiß was Schlimmes. Laube, Band. 1, 119; Un-h. nennt man Alles, was im Geheimnis, im Verborgnen . . . bleiben sollte und hervorgetreten ist. Schelling, 2, 2, 649 etc. –; Das Göttliche zu verhüllen, mit einer gewissen U-keit zu umgeben 658, etc. –; Unüblich als Ggstz. von (2), wie es Campe ohne Beleg anführt.
Aus diesem langen Zitat ist für uns am interessantesten, daß das Wörtchen heimlich unter den mehrfachen Nuancen seiner Bedeutung auch eine zeigt, in der es mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Das Heimliche wird dann zum Unheimlichen; vgl. das Beispiel von Gutzkow: »Wir nennen das unheimlich, Sie nennen's heimlich.« Wir werden überhaupt daran gemahnt, daß dies Wort heimlich nicht eindeutig ist, sondern zwei Vorstellungskreisen zugehört, die, ohne gegensätzlich zu sein, einander doch recht fremd sind, dem des Vertrauten, Behaglichen und dem des Versteckten, Verborgengehaltenen. Unheimlich sei nur als Gegensatz zur ersten Bedeutung; nicht auch zur zweiten gebräuchlich. Wir erfahren bei Sanders nichts darüber, ob nicht doch eine genetische Beziehung zwischen diesen zwei Bedeutungen anzunehmen ist. Hingegen werden wir auf eine Bemerkung von Schelling aufmerksam, die vom Inhalt des Begriffes Unheimlich etwas ganz Neues aussagt, auf das unsere Erwartung gewiß nicht eingestellt war. Unheimlich sei alles, was ein Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte und hervorgetreten ist.
Ein Teil der so angeregten Zweifel wird durch die Angaben in Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1877 (Bd. 4, 2. Teil, 873 ff.) geklärt:
Heimlich; adj. und adv. vernaculus, occultus; mhd. heimelich, heimlich.
S. 874: In etwas anderem sinne: es ist mir heimlich, wohl, frei von furcht . . .
[3] b) heimlich ist auch der von gespensterhaften freie ort . . .
S. 875: β) vertraut; freundlich, zutraulich.
4. aus dem heimatlichen, häuslichen entwickelt sich weiter der begriff des fremden augen entzogenen, verborgenen, geheimen, eben auch in mehrfacher beziehung ausgebildet . . .
S. 876:
»links am see liegt eine matte heimlich im gehölz.« Schiller, Tell I, 4.
. . . frei und für den modernen Sprachgebrauch ungewöhnlich . . . heimlich ist zu einem verbum des verbergens gestellt: er verbirgt mich heimlich in seinem gezelt. ps. 27, 5. (. . . heimliche orte am menschlichen Körper, pudenda . . . welche leute nicht stürben, die wurden geschlagen an heimlichen orten. 1 Samuel 5, 12 . . .)
c) beamtete, die wichtige und geheim zu haltende ratschlage in Staatssachen ertheilen, heiszen heimliche räthe, das adjektiv nach heutigem Sprachgebrauch durch geheim (s. d.) ersetzt: . . . (Pharao) nennet ihn (Joseph) den heimlichen rath. 1. Mos. 41, 45;
S. 878: 6. heimlich für die erkenntnis, mystisch, allegorisch: heimliche bedeutung, mysticus, divinus, occultus, figuratus.
S. 878: anders ist heimlich im folgenden, der erkenntnis entzogen, unbewuszt: . . .
dann aber ist heimlich auch verschlossen, undurchdringlich in bezug auf erforschung: . . .
»merkst du wohl? sie trauen uns nicht, fürchten des Friedländers heimlich gesicht.« Wallensteins lager, 2. aufz. [Szene]
9. die bedeutung des versteckten, gefährlichen, die in der vorigen nummer hervortritt, entwickelt sich noch weiter, so dasz heimlich den sinn empfängt, den sonst unheimlich (gebildet nach heimlich, 3 b, sp. 874) hat: »mir ist zu Zeiten wie dem menschen der in nacht wandelt und an gespenster glaubt, jeder winkel ist ihm heimlich und schauerhaft.« Klinger, theater, 3, 298.
Also heimlich ist ein Wort, das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt, bis es endlich mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich. Halten wir dies noch nicht recht geklärte Ergebnis mit der Definition des Unheimlichen von Schelling zusammen. Die Einzeluntersuchung der Fälle des Unheimlichen wird uns diese Andeutungen verständlich machen.
II
Wenn wir jetzt an die Musterung der Personen und Dinge, Eindrücke, Vorgänge und Situationen herangehen, die das Gefühl des Unheimlichen in besonderer Stärke und Deutlichkeit in uns zu erwecken vermögen, so ist die Wahl eines glücklichen ersten Beispiels offenbar das nächste Erfordernis. E. Jentsch hat als ausgezeichneten Fall den »Zweifel an der Beseelung eines anscheinend lebendigen Wesens und umgekehrt darüber, ob ein lebloser Gegenstand nicht etwa beseelt sei« hervorgehoben und sich dabei auf den Eindruck von Wachsfiguren, kunstvollen Puppen und Automaten berufen. Er reiht dem das Unheimliche des epileptischen Anfalls und der Äußerungen des Wahnsinnes an, weil durch sie in dem Zuschauer Ahnungen von automatischen –; mechanischen –; Prozessen geweckt werden, die hinter dem gewohnten Bilde der Beseelung verborgen sein mögen. Ohne nun von dieser Ausführung des Autors voll überzeugt zu sein, wollen wir unsere eigene Untersuchung an ihn anknüpfen, weil er uns im weiteren an einen Dichter mahnt, dem die Erzeugung unheimlicher Wirkungen so gut wie keinem anderen gelungen ist.
»Einer der sichersten Kunstgriffe, leicht unheimliche Wirkungen durch Erzählungen hervorzurufen«, schreibt Jentsch, »beruht nun darauf, daß man den Leser im Ungewissen darüber läßt, ob er in einer bestimmten Figur eine Person oder etwa einen Automaten vor sich habe, und zwar so, daß diese Unsicherheit nicht direkt in den Brennpunkt seiner Aufmerksamkeit tritt, damit er nicht veranlaßt werde, die Sache sofort zu untersuchen und klarzustellen, da hiedurch, wie gesagt, die besondere Gefühlswirkung leicht schwindet. E. T. A. Hoffmann hat in seinen Phantasiestücken dieses psychologische Manöver wiederholt mit Erfolg zur Geltung gebracht.«
Diese gewiß richtige Bemerkung zielt vor allem auf die Erzählung ›Der Sandmann‹ in den Nachtstücken (dritter Band der Grisebachschen Ausgabe von Hoffmanns sämtlichen Werken), aus welcher die Figur der Puppe Olimpia in den ersten Akt der Offenbachschen Oper Hoffmanns Erzählungen gelangt ist. Ich muß aber sagen –; und ich hoffe, die meisten Leser der Geschichte werden mir beistimmen, –; daß das Motiv der belebt scheinenden Puppe Olimpia keineswegs das einzige ist, welches für die unvergleichlich unheimliche Wirkung der Erzählung verantwortlich gemacht werden muß, ja nicht einmal dasjenige, dem diese Wirkung in erster Linie zuzuschreiben wäre. Es kommt dieser Wirkung auch nicht zustatten, daß die Olimpia-Episode vom Dichter selbst eine leise Wendung ins Satirische erfährt und von ihm zum Spott auf die Liebesüberschätzung von seiten des jungen Mannes gebraucht wird. Im Mittelpunkt der Erzählung steht vielmehr ein anderes Moment, nach dem sie auch den Namen trägt und das an den entscheidenden Stellen immer wieder hervorgekehrt wird: das Motiv des Sandmannes, der den Kindern die Augen ausreißt.
Der Student Nathaniel, mit dessen Kindheitserinnerungen die phantastische Erzählung anhebt, kann trotz seines Glückes in der Gegenwart die Erinnerungen nicht bannen, die sich ihm an den rätselhaft erschreckenden Tod des geliebten Vaters knüpfen. An gewissen Abenden pflegte die Mutter die Kinder mit der Mahnung zeitig zu Bette zu schicken: Der Sandmann kommt, und wirklich hört das Kind dann jedesmal den schweren Schritt eines Besuchers, der den Vater für diesen Abend in Anspruch nimmt. Die Mutter, nach dem Sandmann befragt, leugnet dann zwar, daß ein solcher anders denn als Redensart existiert, aber eine Kinderfrau weiß greifbarere Auskunft zu geben: »Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bette gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, daß sie blutig zum Kopfe herausspringen, die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen, die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen, damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf.«
Obwohl der kleine Nathaniel alt und verständig genug war, um so schauerliche Zutaten zur Figur des Sandmannes abzuweisen, so setzte sich doch die Angst vor diesem selbst in ihm fest. Er beschloß zu erkunden, wie der Sandmann aussehe, und verbarg sich eines Abends, als er wieder erwartet wurde, im Arbeitszimmer des Vaters. In dem Besucher erkennt er dann den Advokaten Coppelius, eine abstoßende Persönlichkeit, vor der sich die Kinder zu scheuen pflegten, wenn er gelegentlich als Mittagsgast erschien, und identifiziert nun diesen Coppelius mit dem gefürchteten Sandmann. Für den weiteren Fortgang dieser Szene macht es der Dichter bereits zweifelhaft, ob wir es mit einem ersten Delirium des angstbesessenen Knaben oder mit einem Bericht zu tun haben, der als real in der Darstellungswelt der Erzählung aufzufassen ist. Vater und Gast machen sich an einem Herd mit flammender Glut zu schaffen. Der kleine Lauscher hört Coppelius rufen: »Augen her, Augen her«, verrät sich durch seinen Aufschrei und wird von Coppelius gepackt, der ihm glutrote Körner aus der Flamme in die Augen streuen will, um sie dann auf den Herd zu werfen. Der Vater bittet die Augen des Kindes frei. Eine tiefe Ohnmacht und lange Krankheit beenden das Erlebnis. Wer sich für die rationalistische Deutung des Sandmannes entscheidet, wird in dieser Phantasie des Kindes den fortwirkenden Einfluß jener Erzählung der Kinderfrau nicht verkennen. Anstatt der Sandkörner sind es glutrote Flammenkörner, die dem Kinde in die Augen gestreut werden sollen, in beiden Fällen, damit die Augen herausspringen. Bei einem weiteren Besuche des Sandmannes ein Jahr später wird der Vater durch eine Explosion im Arbeitszimmer getötet; der Advokat Coppelius verschwindet vom Orte, ohne eine Spur zu hinterlassen.
Diese Schreckgestalt seiner Kinderjahre glaubt nun der Student Nathaniel in einem herumziehenden italienischen Optiker Giuseppe Coppola zu erkennen, der ihm in der Universitätsstadt Wettergläser zum Kauf anbietet und nach seiner Ablehnung hinzusetzt: »Ei, nix Wetterglas, nix Wetterglas! –; hab auch sköne Oke –; sköne Oke.« Das Entsetzen des Studenten wird beschwichtigt, da sich die angebotenen Augen als harmlose Brillen herausstellen; er kauft dem Coppola ein Taschenperspektiv ab und späht mit dessen Hilfe in die gegenüberliegende Wohnung des Professors Spalanzani, wo er dessen schöne, aber rätselhaft wortkarge und unbewegte Tochter Olimpia erblickt. In diese verliebt er sich bald so heftig, daß er seine kluge und nüchterne Braut über sie vergißt. Aber Olimpia ist ein Automat, an dem Spalanzani das Räderwerk gemacht und dem Coppola –; der Sandmann –; die Augen eingesetzt hat. Der Student kommt hinzu, wie die beiden Meister sich um ihr Werk streiten; Der Optiker hat die hölzerne, augenlose Puppe davongetragen, und der Mechaniker, Spalanzani, wirft Nathaniel die auf dem Boden liegenden blutigen Augen Olimpias an die Brust, von denen er sagt, daß Coppola sie dem Nathaniel gestohlen. Dieser wird von einem neuerlichen Wahnsinnsanfall ergriffen, in dessen Delirium sich die Reminiszenz an den Tod des Vaters mit dem frischen Eindruck verbindet: »Hui –; hui –; hui! –; Feuerkreis –; Feuerkreis! Dreh' dich, Feuerkreis –; lustig –; lustig! Holzpüppchen hui, schön Holzpüppchen dreh' dich –;.« Damit wirft er sich auf den Professor, den angeblichen Vater Olimpias, und will ihn erwürgen.
Aus langer, schwerer Krankheit erwacht, scheint Nathaniel endlich genesen. Er gedenkt, seine wiedergefundene Braut zu heiraten. Sie ziehen beide eines Tages durch die Stadt, auf deren Markt der hohe Ratsturm seinen Riesenschatten wirft. Das Mädchen schlägt ihrem Bräutigam vor, auf den Turm zu steigen, während der das Paar begleitende Bruder der Braut unten verbleibt. Oben zieht eine merkwürdige Erscheinung von etwas, was sich auf der Straße heranbewegt, die Aufmerksamkeit Claras auf sich. Nathaniel betrachtet dasselbe Ding durch Coppolas Perspektiv, das er in seiner Tasche findet, wird neuerlich vom Wahnsinn ergriffen, und mit den Worten: Holzpüppchen, dreh' dich, will er das Mädchen in die Tiefe schleudern. Der durch ihr Geschrei herbeigeholte Bruder rettet sie und eilt mit ihr herab. Oben läuft der Rasende mit dem Ausruf herum: Feuerkreis, dreh' dich, dessen Herkunft wir ja verstehen. Unter den Menschen, die sich unten ansammeln, ragt der Advokat Coppelius hervor, der plötzlich wieder erschienen ist. Wir dürfen annehmen, daß es der Anblick seiner Annäherung war, der den Wahnsinn bei Nathaniel zum Ausbruch brachte. Man will hinauf, um sich des Rasenden zu bemächtigen, aber Coppelius lacht: »Wartet nur, der kommt schon herunter von selbst.« Nathaniel bleibt plötzlich stehen, wird den Coppelius gewahr und wirft sich mit dem gellenden Schrei: »Ja! Sköne Oke –; Sköne Oke« über das Geländer herab. Sowie er mit zerschmettertem Kopf auf dem Straßenpflaster liegt, ist der Sandmann im Gewühl verschwunden.
Diese kurze Nacherzählung wird wohl keinen Zweifel darüber bestehen lassen, daß das Gefühl des Unheimlichen direkt an der Gestalt des Sandmannes, also an der Vorstellung, der Augen beraubt zu werden, haftet und daß eine intellektuelle Unsicherheit im Sinne von Jentsch mit dieser Wirkung nichts zu tun hat. Der Zweifel an der Beseeltheit, den wir bei der Puppe Olimpia gelten lassen mußten, kommt bei diesem stärkeren Beispiel des Unheimlichen überhaupt nicht in Betracht. Der Dichter erzeugt zwar in uns anfänglich eine Art von Unsicherheit, indem er uns, gewiß nicht ohne Absicht, zunächst nicht erraten läßt, ob er uns in die reale Welt oder in eine ihm beliebige phantastische Welt einführen wird. Er hat ja bekanntlich das Recht, das eine oder das andere zu tun, und wenn er z. B. eine Welt, in der Geister, Dämonen und Gespenster agieren, zum Schauplatz seiner Darstellungen gewählt hat, wie Shakespeare im Hamlet, Macbeth und in anderem Sinne im Sturm und im Sommernachtstraum, so müssen wir ihm darin nachgeben und diese Welt seiner Voraussetzung für die Dauer unserer Hingegebenheit wie eine Realität behandeln. Aber im Verlaufe der Hoffmannschen Erzählung schwindet dieser Zweifel, wir merken, daß der Dichter uns selbst durch die Brille oder das Perspektiv des dämonischen Optikers schauen lassen will, ja daß er vielleicht in höchsteigener Person durch solch ein Instrument geguckt hat. Der Schluß der Erzählung macht es ja klar, daß der Optiker Coppola wirklich der Advokat Coppelius [Fußnote]Zur Ableitung des Namens: Coppella = Probiertiegel (die chemischen Operationen, bei denen der Vater verunglückt); coppo = Augenhöhle (nach einer Bemerkung von Frau Dr. Rank). und also auch der Sandmann ist.
Eine »intellektuelle Unsicherheit« kommt hier nicht mehr in Frage: wir wissen jetzt, daß uns nicht die Phantasiegebilde eines Wahnsinnigen vorgeführt werden sollen, hinter denen wir in rationalistischer Überlegenheit den nüchternen Sachverhalt erkennen mögen, und –; der Eindruck des Unheimlichen hat sich durch diese Aufklärung nicht im mindesten verringert. Eine intellektuelle Unsicherheit leistet uns also nichts für das Verständnis dieser unheimlichen Wirkung.
Hingegen mahnt uns die psychoanalytische Erfahrung daran, daß es eine schreckliche Kinderangst ist, die Augen zu beschädigen oder zu verlieren. Vielen Erwachsenen ist diese Ängstlichkeit verblieben, und sie fürchten keine andere Organverletzung so sehr wie die des Auges. Ist man doch auch gewohnt zu sagen, daß man etwas behüten werde wie seinen Augapfel. Das Studium der Träume, der Phantasien und Mythen hat uns dann gelehrt, daß die Angst um die Augen, die Angst zu erblinden, häufig genug ein Ersatz für die Kastrationsangst ist. Auch die Selbstblendung des mythischen Verbrechers Ödipus ist nur eine Ermäßigung für die Strafe der Kastration, die ihm nach der Regel der Talion [Fußnote]Wiedervergeltung allein angemessen wäre. Man mag es versuchen, in rationalistischer Denkweise die Zurückführung der Augenangst auf die Kastrationsangst abzulehnen; man findet es begreiflich, daß ein so kostbares Organ wie das Auge von einer entsprechend großen Angst bewacht wird, ja man kann weitergehend behaupten, daß kein tieferes Geheimnis und keine andere Bedeutung sich hinter der Kastrationsangst verberge. Aber man wird damit doch nicht der Ersatzbeziehung gerecht, die sich in Traum, Phantasie und Mythus zwischen Auge und männlichem Glied kundgibt, und kann dem Eindruck nicht widersprechen, daß ein besonders starkes und dunkles Gefühl sich gerade gegen die Drohung, das Geschlechtsglied einzubüßen erhebt, und daß dieses Gefühl erst der Vorstellung vom Verlust anderer Organe den Nachhall verleiht. Jeder weitere Zweifel schwindet dann, wenn man aus den Analysen an Neurotikern die Details des »Kastrationskomplexes« erfahren und dessen großartige Rolle in ihrem Seelenleben zur Kenntnis genommen hat.
Auch würde ich keinem Gegner der psychoanalytischen Auffassung raten, sich für die Behauptung, die Augenangst sei etwas vom Kastrationskomplex Unabhängiges, gerade auf die Hoffmannsche Erzählung vom ›Sandmann‹ zu berufen. Denn warum ist die Augenangst hier mit dem Tode des Vaters in innigste Beziehung gebracht? Warum tritt der Sandmann jedesmal als Störer der Liebe auf? Er entzweit den unglücklichen Studenten mit seiner Braut und ihrem Bruder, der sein bester Freund ist, er vernichtet sein zweites Liebesobjekt, die schöne Puppe Olimpia, und zwingt ihn selbst zum Selbstmord, wie er unmittelbar vor der beglückenden Vereinigung mit seiner wiedergewonnenen Clara steht. Diese sowie viele andere Züge der Erzählung erscheinen willkürlich und bedeutungslos, wenn man die Beziehung der Augenangst zur Kastration ablehnt, und werden sinnreich, sowie man für den Sandmann den gefürchteten Vater einsetzt, von dem man die Kastration erwartet [Fußnote]In der Tat hat die Phantasiebearbeitung des Dichters die Elemente des Stoffes nicht so wild herumgewirbelt, daß man ihre ursprüngliche Anordnung nicht wiederherstellen könnte. In der Kindergeschichte stellen der Vater und Coppelius die durch Ambivalenz in zwei Gegensätze zerlegte Vater-Imago dar; der eine droht mit der Blendung (Kastration), der andere, der gute Vater, bittet die Augen des Kindes frei. Das von der Verdrängung am stärksten betroffene Stück des Komplexes, der Todeswunsch gegen den bösen Vater, findet seine Darstellung in dem Tod des guten Vaters, der dem Coppelius zur Last gelegt wird. Diesem Väterpaar entsprechen in der späteren Lebensgeschichte des Studenten der Professor Spalanzani und der Optiker Coppola, der Professor an sich eine Figur der Vaterreihe, Coppola als identisch mit dem Advokaten Coppelius erkannt. Wie sie damals zusammen am geheimnisvollen Herd arbeiteten, so haben sie nun gemeinsam die Puppe Olimpia verfertigt; der Professor heißt auch der Vater Olimpias. Durch diese zweimalige Gemeinsamkeit verraten sie sich als Spaltungen der Vater-Imago, d. h. sowohl der Mechaniker als auch der Optiker sind der Vater der Olimpia wie des Nathaniel. In der Schreckensszene der Kinderzeit hatte Coppelius, nachdem er auf die Blendung des Kleinen verzichtet, ihm probeweise Arme und Beine abgeschraubt, also wie ein Mechaniker an einer Puppe an ihm gearbeitet. Dieser sonderbare Zug, der ganz aus dem Rahmen der Sandmannvorstellung heraustritt, bringt ein neues Äquivalent der Kastration ins Spiel; er weist aber auch auf die innere Identität des Coppelius mit seinem späteren Widerpart, dem Mechaniker Spalanzani, hin und bereitet uns für die Deutung der Olimpia vor. Diese automatische Puppe kann nichts anderes sein als die Materialisation von Nathaniels femininer Einstellung zu seinem Vater in früher Kindheit. Ihre Väter –; Spalanzani und Coppola –; sind ja nur neue Auflagen, Reinkarnationen von Nathaniels Väterpaar; die sonst unverständliche Angabe des Spalanzani, daß der Optiker dem Nathaniel die Augen gestohlen (s. oben), um sie der Puppe einzusetzen, gewinnt so als Beweis für die Identität von Olimpia und Nathaniel ihre Bedeutung. Olimpia ist sozusagen ein von Nathaniel losgelöster Komplex, der ihm als Person entgegentritt; die Beherrschung durch diesen Komplex findet in der unsinnig zwanghaften Liebe zur Olimpia ihren Ausdruck. Wir haben das Recht, diese Liebe eine narzißtische zu heißen, und verstehen, daß der ihr Verfallene sich dem realen Liebesobjekt entfremdet. Wie psychologisch richtig es aber ist, daß der durch den Kastrationskomplex an den Vater fixierte Jüngling der Liebe zum Weibe unfähig wird, zeigen zahlreiche Krankenanalysen, deren Inhalt zwar weniger phantastisch, aber kaum minder traurig ist als die Geschichte des Studenten Nathaniel. E. T. A. Hoffmann war das Kind einer unglücklichen Ehe. Als er drei Jahre war, trennte sich der Vater von seiner kleinen Familie und lebte nie wieder mit ihr vereint. Nach den Belegen, die E. Grisebach in der biographischen Einleitung zu Hoffmanns Werken beibringt, war die Beziehung zum Vater immer eine der wundesten Stellen in des Dichters Gefühlsleben.
Wir würden es also wagen, das Unheimliche des Sandmannes auf die Angst des kindlichen Kastrationskomplexes zurückzuführen. Sowie aber die Idee auftaucht, ein solches infantiles Moment für die Entstehung des unheimlichen Gefühls in Anspruch zu nehmen, werden wir auch zum Versuch getrieben, dieselbe Ableitung für andere Beispiele des Unheimlichen in Betracht zu ziehen. Im Sandmann findet sich noch das Motiv der belebt scheinenden Puppe, das Jentsch hervorgehoben hat. Nach diesem Autor ist es eine besonders günstige Bedingung für die Erzeugung unheimlicher Gefühle, wenn eine intellektuelle Unsicherheit geweckt wird, ob etwas belebt oder leblos sei, und wenn das Leblose die Ähnlichkeit mit dem Lebenden zu weit treibt. Natürlich sind wir aber gerade mit den Puppen vom Kindlichen nicht weit entfernt. Wir erinnern uns, daß das Kind im frühen Alter des Spielens überhaupt nicht scharf zwischen Belebtem und Leblosem unterscheidet und daß es besonders gern seine Puppe wie ein lebendes Wesen behandelt. Ja, man hört gelegentlich von einer Patientin erzählen, sie habe noch im Alter von acht Jahren die Überzeugung gehabt, wenn sie ihre Puppen auf eine gewisse Art, möglichst eindringlich, anschauen würde, müßten diese lebendig werden. Das infantile Moment ist also auch hier leicht nachzuweisen; aber merkwürdig, im Falle des Sandmannes handelte es sich um die Erweckung einer alten Kinderangst, bei der lebenden Puppe ist von Angst keine Rede, das Kind hat sich vor dem Beleben seiner Puppen nicht gefürchtet, vielleicht es sogar gewünscht. Die Quelle des unheimlichen Gefühls wäre also hier nicht eine Kinderangst, sondern ein Kinderwunsch oder auch nur ein Kinderglaube. Das scheint ein Widerspruch; möglicherweise ist es nur eine Mannigfaltigkeit, die späterhin unserem Verständnis förderlich werden kann.
E. T. A. Hoffmann ist der unerreichte Meister des Unheimlichen in der Dichtung. Sein Roman Die Elixiere des Teufels weist ein ganzes Bündel von Motiven auf, denen man die unheimliche Wirkung der Geschichte zuschreiben möchte. Der Inhalt des Romans ist zu reichhaltig und verschlungen, als daß man einen Auszug daraus wagen könnte. Zu Ende des Buches, wenn die dem Leser bisher vorenthaltenen Voraussetzungen der Handlung nachgetragen werden, ist das Ergebnis nicht die Aufklärung des Lesers, sondern eine volle Verwirrung desselben. Der Dichter hat zu viel Gleichartiges gehäuft; der Eindruck des Ganzen leidet nicht darunter, wohl aber das Verständnis. Man muß sich damit begnügen, die hervorstechendsten unter jenen unheimlich wirkenden Motiven herauszuheben, um zu untersuchen, ob auch für sie eine Ableitung aus infantilen Quellen zulässig ist. Es sind dies das Doppelgängertum in all seinen Abstufungen und Ausbildungen, also das Auftreten von Personen, die wegen ihrer gleichen Erscheinung für identisch gehalten werden müssen, die Steigerung dieses Verhältnisses durch Überspringen seelischer Vorgänge von einer dieser Personen auf die andere –; was wir Telepathie heißen würden –;, so daß der eine das Wissen, Fühlen und Erleben des anderen mitbesitzt, die Identifizierung mit einer anderen Person, so daß man an seinem Ich irre wird oder das fremde Ich an die Stelle des eigenen versetzt, also Ich-Verdopplung, Ich-Teilung, Ich-Vertauschung –; und endlich die beständige Wiederkehr des Gleichen, die Wiederholung der nämlichen Gesichtszüge, Charaktere, Schicksale, verbrecherischen Taten, ja der Namen durch mehrere aufeinanderfolgende Generationen.
Das Motiv des Doppelgängers hat in einer gleichnamigen Arbeit von O. Rank eine eingehende Würdigung gefunden [Fußnote]O. Rank, ›Der Doppelgänger« (1914).. Dort werden die Beziehungen des Doppelgängers zum Spiegel- und Schattenbild, zum Schutzgeist, zur Seelenlehre und zur Todesfurcht untersucht, es fällt aber auch helles Licht auf die überraschende Entwicklungsgeschichte des Motivs. Denn der Doppelgänger war ursprünglich eine Versicherung gegen den Untergang des Ichs, eine »energische Dementierung der Macht des Todes« (O. Rank), und wahrscheinlich war die »unsterbliche« Seele der erste Doppelgänger des Leibes. Die Schöpfung einer solchen Verdopplung zur Abwehr gegen die Vernichtung hat ihr Gegenstück in einer Darstellung der Traumsprache, welche die Kastration durch Verdopplung oder Vervielfältigung des Genitalsymbols auszudrücken liebt; sie wird in der Kultur der alten Ägypter ein Antrieb für die Kunst, das Bild des Verstorbenen in dauerhaftem Stoff zu formen. Aber diese Vorstellungen sind auf dem Boden der uneingeschränkten Selbstliebe entstanden, des primären Narzißmus, welcher das Seelenleben des Kindes wie des Primitiven beherrscht, und mit der Überwindung dieser Phase ändert sich das Vorzeichen des Doppelgängers, aus einer Versicherung des Fortlebens wird er zum unheimlichen Vorboten des Todes.
Die Vorstellung des Doppelgängers braucht nicht mit diesem uranfänglichen Narzißmus unterzugehen; denn sie kann aus den späteren Entwicklungsstufen des Ichs neuen Inhalt gewinnen. Im Ich bildet sich langsam eine besondere Instanz heraus, welche sich dem übrigen Ich entgegenstellen kann, die der Selbstbeobachtung und Selbstkritik dient, die Arbeit der psychischen Zensur leistet und unserem Bewußtsein als »Gewissen« bekannt wird. Im pathologischen Falle des Beachtungswahnes wird sie isoliert, vom Ich abgespalten, dem Arzte bemerkbar. Die Tatsache, daß eine solche Instanz vorhanden ist, welche das übrige Ich wie ein Objekt behandeln kann, also daß der Mensch der Selbstbeobachtung fähig ist, macht es möglich, die alte Doppelgängervorstellung mit neuem Inhalt zu erfüllen und ihr mancherlei zuzuweisen, vor allem all das, was der Selbstkritik als zugehörig zum alten überwundenen Narzißmus der Urzeit erscheint [Fußnote]Ich glaube, wenn die Dichter klagen, daß zwei Seelen in des Menschen Brust wohnen, und wenn die Populärpsychologen von der Spaltung des Ichs im Menschen reden, so schwebt ihnen diese Entzweiung, der Ich-Psychologie angehörig, zwischen der kritischen Instanz und dem Ich-Rest vor und nicht die von der Psychoanalyse aufgedeckte Gegensätzlichkeit zwischen dem Ich und dem unbewußten Verdrängten. Der Unterschied wird allerdings dadurch verwischt, daß sich unter dem von der Ich-Kritik Verworfenen zunächst die Abkömmlinge des Verdrängten befinden..
Aber nicht nur dieser der Ich-Kritik anstößige Inhalt kann dem Doppelgänger einverleibt werden, sondern ebenso alle unterbliebenen Möglichkeiten der Geschicksgestaltung, an denen die Phantasie noch festhalten will, und alle Ich-Strebungen, die sich infolge äußerer Ungunst nicht durchsetzen konnten, sowie alle die unterdrückten Willensentscheidungen, die die Illusion des freien Willens ergeben haben [Fußnote]In der H. H. Ewersschen Dichtung Der Student von Prag, von welcher die Ranksche Studie über den Doppelgänger ausgegangen ist, hat der Held der Geliebten versprochen, seinen Duellgegner nicht zu töten. Auf dem Wege zum Duellplatz begegnet ihm aber der Doppelgänger, welcher den Nebenbuhler bereits erledigt hat..
Nachdem wir aber so die manifeste Motivierung der Doppelgängergestalt betrachtet haben, müssen wir uns sagen: Nichts von alledem macht uns den außerordentlich hohen Grad von Unheimlichkeit, der ihr anhaftet, verständlich, und aus unserer Kenntnis der pathologischen Seelenvorgänge dürfen wir hinzusetzen, nichts von diesem Inhalt könnte das Abwehrbestreben erklären, das ihn als etwas Fremdes aus dem Ich hinausprojiziert. Der Charakter des Unheimlichen kann doch nur daher rühren, daß der Doppelgänger eine den überwundenen seelischen Urzeiten angehörige Bildung ist, die damals allerdings einen freundlicheren Sinn hatte. Der Doppelgänger ist zum Schreckbild geworden, wie die Götter nach dem Sturz ihrer Religion zu Dämonen werden (Heine, Die Götter im Exil).
Die anderen bei Hoffmann verwendeten Ich-Störungen sind nach dem Muster des Doppelgängermotivs leicht zu beurteilen. Es handelt sich bei ihnen um ein Rückgreifen auf einzelne Phasen in der Entwicklungsgeschichte des Ich-Gefühls, um eine Regression in Zeiten, da das Ich sich noch nicht scharf von der Außenwelt und vom anderen abgegrenzt hatte. Ich glaube, daß diese Motive den Eindruck des Unheimlichen mitverschulden, wenngleich es nicht leicht ist, ihren Anteil an diesem Eindruck isoliert herauszugreifen.
Das Moment der Wiederholung des Gleichartigen wird als Quelle des unheimlichen Gefühls vielleicht nicht bei jedermann Anerkennung finden. Nach meinen Beobachtungen ruft es unter gewissen Bedingungen und in Kombination mit bestimmten Umständen unzweifelhaft ein solches Gefühl hervor, das überdies an die Hilflosigkeit mancher Traumzustände mahnt. Als ich einst an einem heißen Sommernachmittag die mir unbekannten, menschenleeren Straßen einer italienischen Kleinstadt durchstreifte, geriet ich in eine Gegend, über deren Charakter ich nicht lange in Zweifel bleiben konnte. Es waren nur geschminkte Frauen an den Fenstern der kleinen Häuser zu sehen, und ich beeilte mich, die enge Straße durch die nächste Einbiegung zu verlassen. Aber nachdem ich eine Weile führerlos herumgewandert war, fand ich mich plötzlich in derselben Straße wieder, in der ich nun Aufsehen zu erregen begann, und meine eilige Entfernung hatte nur die Folge, daß ich auf einem neuen Umwege zum drittenmal dahingeriet. Dann aber erfaßte mich ein Gefühl, das ich nur als unheimlich bezeichnen kann, und ich war froh, als ich unter Verzicht auf weitere Entdeckungsreisen auf die kürzlich von mir verlassene Piazza zurückfand. Andere Situationen, die die unbeabsichtigte Wiederkehr mit der eben beschriebenen gemein haben und sich in den anderen Punkten gründlich von ihr unterscheiden, haben doch dasselbe Gefühl von Hilflosigkeit und Unheimlichkeit zur Folge. Zum Beispiel, wenn man sich im Hochwald, etwa vom Nebel überrascht, verirrt hat und nun trotz aller Bemühungen, einen markierten oder bekannten Weg zu finden, wiederholt zu der einen, durch eine bestimmte Formation gekennzeichneten Stelle zurückkommt. Oder wenn man im unbekannten, dunkeln Zimmer wandert, um die Tür oder den Lichtschalter aufzusuchen und dabei zum xtenmal mit demselben Möbelstück zusammenstößt, eine Situation, die Mark Twain allerdings durch groteske Übertreibung in eine unwiderstehlich komische umgewandelt hat.
An einer anderen Reihe von Erfahrungen erkennen wir auch mühelos, daß es nur das Moment der unbeabsichtigten Wiederholung ist, welches das sonst Harmlose unheimlich macht und uns die Idee des Verhängnisvollen, Unentrinnbaren aufdrängt, wo wir sonst nur von »Zufall« gesprochen hätten. So ist es z. B. gewiß ein gleichgültiges Erlebnis, wenn man für seine in einer Garderobe abgegebenen Kleider einen Schein mit einer gewissen Zahl –; sagen wir: 62 –; erhält oder wenn man findet, daß die zugewiesene Schiffskabine diese Nummer trägt. Aber dieser Eindruck ändert sich, wenn beide an sich indifferenten Begebenheiten nahe aneinanderrücken, so daß einem die Zahl 62 mehrmals an demselben Tage entgegentritt, und wenn man dann etwa gar die Beobachtung machen sollte, daß alles, was eine Zahlenbezeichnung trägt, Adressen, Hotelzimmer, Eisenbahnwagen u. dgl. immer wieder die nämliche Zahl, wenigstens als Bestandteil, wiederbringt. Man findet das »unheimlich«, und wer nicht stich- und hiebfest gegen die Versuchungen des Aberglaubens ist, wird sich geneigt finden, dieser hartnäckigen Wiederkehr der einen Zahl eine geheime Bedeutung zuzuschreiben, etwa einen Hinweis auf das ihm bestimmte Lebensalter darin zu sehen. Oder wenn man eben mit dem Studium der Schriften des großen Physiologen E. Hering beschäftigt ist und nun wenige Tage auseinander Briefe von zwei Personen dieses Namens aus verschiedenen Ländern empfängt, während man bis dahin niemals mit Leuten, die so heißen, in Beziehung getreten war. Ein geistvoller Naturforscher hat vor kurzem den Versuch unternommen, Vorkommnisse solcher Art gewissen Gesetzen unterzuordnen, wodurch der Eindruck des Unheimlichen aufgehoben werden müßte. Ich getraue mich nicht zu entscheiden, ob es ihm gelungen ist [Fußnote]P. Kammerer, Das Gesetz der Serie (1919)..
Wie das Unheimliche der gleichartigen Wiederkehr aus dem infantilen Seelenleben abzuleiten ist, kann ich hier nur andeuten und muß dafür auf eine bereitliegende ausführliche Darstellung in anderem Zusammenhange verweisen. Im seelisch Unbewußten läßt sich nämlich die Herrschaft eines von den Triebregungen ausgehenden Wiederholungszwanges erkennen, der wahrscheinlich von der innersten Natur der Triebe selbst abhängt, stark genug ist, sich über das Lustprinzip hinauszusetzen, gewissen Seiten des Seelenlebens den dämonischen Charakter verleiht, sich in den Strebungen des kleinen Kindes noch sehr deutlich äußert und ein Stück vom Ablauf der Psychoanalyse des Neurotikers beherrscht. Wir sind durch alle vorstehenden Erörterungen darauf vorbereitet, daß dasjenige als unheimlich verspürt werden wird, was an diesen inneren Wiederholungszwang mahnen kann.
Nun, denke ich aber, ist es Zeit, uns von diesen immerhin schwierig zu beurteilenden Verhältnissen abzuwenden und unzweifelhafte Fälle des Unheimlichen aufzusuchen, von deren Analyse wir die endgültige Entscheidung über die Geltung unserer Annahme erwarten dürfen.
Im ›Ring des Polykrates‹ wendet sich der Gast mit Grausen, weil er merkt, daß jeder Wunsch des Freundes sofort in Erfüllung geht, jede seiner Sorgen vom Schicksal unverzüglich aufgehoben wird. Der Gastfreund ist ihm »unheimlich« geworden. Die Auskunft, die er selbst gibt, daß der allzu Glückliche den Neid der Götter zu fürchten habe, erscheint uns noch undurchsichtig, ihr Sinn ist mythologisch verschleiert. Greifen wir darum ein anderes Beispiel aus weit schlichteren Verhältnissen heraus: In der Krankengeschichte eines Zwangsneurotikers [Fußnote]›Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose‹. habe ich erzählt, daß dieser Kranke einst einen Aufenthalt in einer Wasserheilanstalt genommen hatte, aus dem er sich eine große Besserung holte. Er war aber so klug, diesen Erfolg nicht der Heilkraft des Wassers, sondern der Lage seines Zimmers zuzuschreiben, welches der Kammer einer liebenswürdigen Pflegerin unmittelbar benachbart war. Als er dann zum zweitenmal in diese Anstalt kam, verlangte er dasselbe Zimmer wieder, mußte aber hören, daß es bereits von einem alten Herrn besetzt sei, und gab seinem Unmut darüber in den Worten Ausdruck: Dafür soll ihn aber der Schlag treffen. Vierzehn Tage später erlitt der alte Herr wirklich einen Schlaganfall. Für meinen Patienten war dies ein »unheimliches« Erlebnis. Der Eindruck des Unheimlichen wäre noch stärker gewesen, wenn eine viel kürzere Zeit zwischen jener Äußerung und dem Unfall gelegen wäre oder wenn der Patient über zahlreiche ganz ähnliche Erlebnisse hätte berichten können. In der Tat war er um solche Bestätigungen nicht verlegen, aber nicht er allein, alle Zwangsneurotiker, die ich studiert habe, wußten Analoges von sich zu erzählen. Sie waren gar nicht überrascht, regelmäßig der Person zu begegnen, an die sie eben –; vielleicht nach langer Pause –; gedacht hatten; sie pflegten regelmäßig am Morgen einen Brief von einem Freund zu bekommen, wenn sie am Abend vorher geäußert hatten: Von dem hat man aber jetzt lange nichts gehört, und besonders Unglücks- oder Todesfälle ereigneten sich nur selten, ohne eine Weile vorher durch ihre Gedanken gehuscht zu sein. Sie pflegten diesem Sachverhalt in der bescheidensten Weise Ausdruck zu geben, indem sie behaupteten, »Ahnungen« zu haben, die »meistens« eintreffen.
Eine der unheimlichsten und verbreitetsten Formen des Aberglaubens ist die Angst vor dem »bösen Blick«, welcher bei dem Hamburger Augenarzt S. Seligmann [Fußnote]Der böse Blick und Verwandtes (1910 u. 1911). eine gründliche Behandlung gefunden hat. Die Quelle, aus welcher diese Angst schöpft, scheint niemals verkannt worden zu sein. Wer etwas Kostbares und doch Hinfälliges besitzt, fürchtet sich vor dem Neid der anderen, indem er jenen Neid auf sie projiziert, den er im umgekehrten Falle empfunden hätte. Solche Regungen verrät man durch den Blick, auch wenn man ihnen den Ausdruck in Worten versagt, und wenn jemand durch auffällige Kennzeichen, besonders unerwünschter Art, vor den anderen hervorsticht, traut man ihm zu, daß sein Neid eine besondere Stärke erreichen und dann auch diese Stärke in Wirkung umsetzen wird. Man fürchtet also eine geheime Absicht zu schaden, und auf gewisse Anzeichen hin nimmt man an, daß dieser Absicht auch die Kraft zu Gebote steht.
Die letzterwähnten Beispiele des Unheimlichen hängen von dem Prinzip ab, das ich, der Anregung eines Patienten folgend, die »Allmacht der Gedanken« benannt habe. Wir können nun nicht mehr verkennen, auf welchem Boden wir uns befinden. Die Analyse der Fälle des Unheimlichen hat uns zur alten Weltauffassung des Animismus zurückgeführt, die ausgezeichnet war durch die Erfüllung der Welt mit Menschengeistern, durch die narzißtische Überschätzung der eigenen seelischen Vorgänge, die Allmacht der Gedanken und die darauf aufgebaute Technik der Magie, die Zuteilung von sorgfältig abgestuften Zauberkräften an fremde Personen und Dinge ( Mana), sowie durch alle die Schöpfungen, mit denen sich der uneingeschränkte Narzißmus jener Entwicklungsperiode gegen den unverkennbaren Einspruch der Realität zur Wehr setzte. Es scheint, daß wir alle in unserer individuellen Entwicklung eine diesem Animismus der Primitiven entsprechende Phase durchgemacht haben, daß sie bei keinem von uns abgelaufen ist, ohne noch äußerungsfähige Reste und Spuren zu hinterlassen, und daß alles, was uns heute als »unheimlich« erscheint, die Bedingung erfüllt, daß es an diese Reste animistischer Seelentätigkeit rührt und sie zur Äußerung anregt [Fußnote]Vgl. hiezu den Abschnitt III ›Animismus, Magie und Allmacht der Gedanken‹ in des Verf. Buch Totem und Tabu (1912–;13). Dort auch die Bemerkung: »Es scheint, daß wir den Charakter des ›Unheimlichen‹ solchen Eindrücken verleihen, welche die Allmacht der Gedanken und die animistische Denkweise überhaupt bestätigen wollen, während wir uns bereits im Urteil von ihr abgewendet haben.«.
Hier ist nun der Platz für zwei Bemerkungen, in denen ich den wesentlichen Inhalt dieser kleinen Untersuchung niederlegen möchte. Erstens, wenn die psychoanalytische Theorie in der Behauptung recht hat, daß jeder Affekt einer Gefühlsregung, gleichgültig von welcher Art, durch die Verdrängung in Angst verwandelt wird, so muß es unter den Fällen des Ängstlichen eine Gruppe geben, in der sich zeigen läßt, daß dies Ängstliche etwas wiederkehrendes Verdrängtes ist. Diese Art des Ängstlichen wäre eben das Unheimliche, und dabei muß es gleichgültig sein, ob es ursprünglich selbst ängstlich war oder von einem anderen Affekt getragen. Zweitens, wenn dies wirklich die geheime Natur des Unheimlichen ist, so verstehen wir, daß der Sprachgebrauch das Heimliche in seinen Gegensatz, das Unheimliche übergehen läßt (S. 250 f.), denn dies Unheimliche ist wirklich nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozeß der Verdrängung entfremdet worden ist. Die Beziehung auf die Verdrängung erhellt uns jetzt auch die Schellingsche Definition, das Unheimliche sei etwas, was im Verborgenen hätte bleiben sollen und hervorgetreten ist.
Es erübrigt uns nur noch, die Einsicht, die wir gewonnen haben, an der Erklärung einiger anderer Fälle des Unheimlichen zu erproben.
Im allerhöchsten Grade unheimlich erscheint vielen Menschen, was mit dem Tod, mit Leichen und mit der Wiederkehr der Toten, mit Geistern und Gespenstern, zusammenhängt. Wir haben ja gehört, daß manche moderne Sprachen unseren Ausdruck: ein unheimliches Haus gar nicht anders wiedergeben können als durch die Umschreibung: ein Haus, in dem es spukt. Wir hätten eigentlich unsere Untersuchung mit diesem, vielleicht stärksten Beispiel von Unheimlichkeit beginnen können, aber wir taten es nicht, weil hier das Unheimliche zu sehr mit dem Grauenhaften vermengt und zum Teil von ihm gedeckt ist. Aber auf kaum einem anderen Gebiete hat sich unser Denken und Fühlen seit den Urzeiten so wenig verändert, ist das Alte unter dünner Decke so gut erhalten geblieben, wie in unserer Beziehung zum Tode. Zwei Momente geben für diesen Stillstand gute Auskunft: Die Stärke unserer ursprünglichen Gefühlsreaktionen und die Unsicherheit unserer wissenschaftlichen Erkenntnis. Unsere Biologie hat es noch nicht entscheiden können, ob der Tod das notwendige Schicksal jedes Lebewesens oder nur ein regelmäßiger, vielleicht aber vermeidlicher Zufall innerhalb des Lebens ist. Der Satz: alle Menschen müssen sterben, paradiert zwar in den Lehrbüchern der Logik als Vorbild einer allgemeinen Behauptung, aber keinem Menschen leuchtet er ein, und unser Unbewußtes hat jetzt sowenig Raum wie vormals für die Vorstellung der eigenen Sterblichkeit. Die Religionen bestreiten noch immer der unableugbaren Tatsache des individuellen Todes ihre Bedeutung und setzen die Existenz über das Lebensende hinaus fort; die staatlichen Gewalten meinen die moralische Ordnung unter den Lebenden nicht aufrechterhalten zu können, wenn man auf die Korrektur des Erdenlebens durch ein besseres Jenseits verzichten soll; auf den Anschlagsäulen unserer Großstädte werden Vorträge angekündigt, welche Belehrungen spenden wollen, wie man sich mit den Seelen der Verstorbenen in Verbindung setzen kann, und es ist unleugbar, daß mehrere der feinsten Köpfe und schärfsten Denker unter den Männern der Wissenschaft, zumal gegen das Ende ihrer eigenen Lebenszeit, geurteilt haben, daß es an Möglichkeiten für solchen Verkehr nicht fehle. Da fast alle von uns in diesem Punkt noch so denken wie die Wilden, ist es auch nicht zu verwundern, daß die primitive Angst vor dem Toten bei uns noch so mächtig ist und bereitliegt, sich zu äußern, sowie irgend etwas ihr entgegenkommt. Wahrscheinlich hat sie auch noch den alten Sinn, der Tote sei zum Feind des Überlebenden geworden und beabsichtige, ihn mit sich zu nehmen, als Genossen seiner neuen Existenz. Eher könnte man bei dieser Unveränderlichkeit der Einstellung zum Tode fragen, wo die Bedingung der Verdrängung bleibt, die erfordert wird, damit das Primitive als etwas Unheimliches wiederkehren könne. Aber die besteht doch auch; offiziell glauben die sogenannten Gebildeten nicht mehr an das Sichtbarwerden der Verstorbenen als Seelen, haben deren Erscheinung an entlegene und selten verwirklichte Bedingungen geknüpft, und die ursprünglich höchst zweideutige, ambivalente Gefühlseinstellung zum Toten ist für die höheren Schichten des Seelenlebens zur eindeutigen der Pietät abgeschwächt worden [Fußnote]Vgl.: ›Das Tabu und die Ambivalenz‹, in Totem und Tabu..
Es bedarf jetzt nur noch weniger Ergänzungen, denn mit dem Animismus, der Magie und Zauberei, der Allmacht der Gedanken, der Beziehung zum Tode, der unbeabsichtigten Wiederholung und dem Kastrationskomplex haben wir den Umfang der Momente, die das Ängstliche zum Unheimlichen machen, so ziemlich erschöpft.
Wir heißen auch einen lebenden Menschen unheimlich, und zwar dann, wenn wir ihm böse Absichten zutrauen. Aber das reicht nicht hin, wir müssen noch hinzutun, daß diese seine Absichten, uns zu schaden, sich mit Hilfe besonderer Kräfte verwirklichen werden. Der » Gettatore« ist ein gutes Beispiel hiefür, diese unheimliche Gestalt des romanischen Aberglaubens, die Albrecht Schaeffer in dem Buche Josef Montfort mit poetischer Intuition und tiefem psychoanalytischen Verständnis zu einer sympathischen Figur umgeschaffen hat. Aber mit diesen geheimen Kräften stehen wir bereits wieder auf dem Boden des Animismus. Die Ahnung solcher Geheimkräfte ist es, die dem frommen Gretchen den Mephisto so unheimlich werden läßt:
Sie fühlt, daß ich ganz sicher ein Genie, Vielleicht wohl gar der Teufel bin.
Das Unheimliche der Fallsucht, des Wahnsinns, hat denselben Ursprung. Der Laie sieht hier die Äußerung von Kräften vor sich, die er im Nebenmenschen nicht vermutet hat, deren Regung er aber in entlegenen Winkeln der eigenen Persönlichkeit dunkel zu spüren vermag. Das Mittelalter hatte konsequenterweise und psychologisch beinahe korrekt alle diese Krankheitsäußerungen der Wirkung von Dämonen zugeschrieben. Ja, ich würde mich nicht verwundern zu hören, daß die Psychoanalyse, die sich mit der Aufdeckung dieser geheimen Kräfte beschäftigt, vielen Menschen darum selbst unheimlich geworden ist. In einem Falle, als mir die Herstellung eines seit vielen Jahren siechen Mädchens –; wenn auch nicht sehr rasch –; gelungen war, habe ich's von der Mutter der für lange Zeit Geheilten selbst gehört.
Abgetrennte Glieder, ein abgehauener Kopf, eine vom Arm gelöste Hand wie in einem Märchen von Hauff, Füße, die für sich allein tanzen wie in dem erwähnten Buche von A. Schaeffer, haben etwas ungemein Unheimliches an sich, besonders wenn ihnen wie im letzten Beispiel noch eine selbständige Tätigkeit zugestanden wird. Wir wissen schon, daß diese Unheimlichkeit von der Annäherung an den Kastrationskomplex herrührt. Manche Menschen würden die Krone der Unheimlichkeit der Vorstellung zuweisen, scheintot begraben zu werden. Allein die Psychoanalyse hat uns gelehrt, daß diese schreckende Phantasie nur die Umwandlung einer anderen ist, die ursprünglich nichts Schreckhaftes war, sondern von einer gewissen Lüsternheit getragen wurde, nämlich der Phantasie vom Leben im Mutterleib.
Tragen wir noch etwas Allgemeines nach, was strenggenommen bereits in unseren bisherigen Behauptungen über den Animismus und die überwundenen Arbeitsweisen des seelischen Apparats enthalten ist, aber doch einer besonderen Hervorhebung würdig scheint, daß es nämlich oft und leicht unheimlich wirkt, wenn die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit verwischt wird, wenn etwas real vor uns hintritt, was wir bisher für phantastisch gehalten haben, wenn ein Symbol die volle Leistung und Bedeutung des Symbolisierten übernimmt und dergleichen mehr. Hierauf beruht auch ein gutes Stück der Unheimlichkeit, die den magischen Praktiken anhaftet. Das Infantile daran, was auch das Seelenleben der Neurotiker beherrscht, ist die Überbetonung der psychischen Realität im Vergleich zur materiellen, ein Zug, welcher sich der Allmacht der Gedanken anschließt. Mitten in der Absperrung des Weltkrieges kam eine Nummer des englischen Magazins Strand in meine Hände, in der ich unter anderen ziemlich überflüssigen Produktionen eine Erzählung las, wie ein junges Paar eine möblierte Wohnung bezieht, in der sich ein seltsam geformter Tisch mit holzgeschnitzten Krokodilen befindet. Gegen Abend pflegt sich dann ein unerträglicher, charakteristischer Gestank in der Wohnung zu verbreiten, man stolpert im Dunkeln über irgend etwas, man glaubt zu sehen, wie etwas Undefinierbares über die Treppe huscht, kurz, man soll erraten, daß infolge der Anwesenheit dieses Tisches gespenstische Krokodile im Hause spuken oder daß die hölzernen Scheusale im Dunkeln Leben bekommen oder etwas Ähnliches. Es war eine recht einfältige Geschichte, aber ihre unheimliche Wirkung verspürte man als ganz hervorragend.
Zum Schlusse dieser gewiß noch unvollständigen Beispielsammlung soll eine Erfahrung aus der psychoanalytischen Arbeit erwähnt werden, die, wenn sie nicht auf einem zufälligen Zusammentreffen beruht, die schönste Bekräftigung unserer Auffassung des Unheimlichen mit sich bringt. Es kommt oft vor, daß neurotische Männer erklären, das weibliche Genitale sei ihnen etwas Unheimliches. Dieses Unheimliche ist aber der Eingang zur alten Heimat des Menschenkindes, zur Örtlichkeit, in der jeder einmal und zuerst geweilt hat. »Liebe ist Heimweh«, behauptet ein Scherzwort, und wenn der Träumer von einer Örtlichkeit oder Landschaft noch im Traume denkt: Das ist mir bekannt, da war ich schon einmal, so darf die Deutung dafür das Genitale oder den Leib der Mutter einsetzen. Das Unheimliche ist also auch in diesem Falle das ehemals Heimische, Altvertraute. Die Vorsilbe » un« an diesem Worte ist aber die Marke der Verdrängung.
III
Schon während der Lektüre der vorstehenden Erörterungen werden sich beim Leser Zweifel geregt haben, denen jetzt gestattet werden soll, sich zu sammeln und laut zu werden.
Es mag zutreffen, daß das Unheimliche das Heimliche-Heimische ist, das eine Verdrängung erfahren hat und aus ihr wiedergekehrt ist, und daß alles Unheimliche diese Bedingung erfüllt. Aber mit dieser Stoffwahl scheint das Rätsel des Unheimlichen nicht gelöst. Unser Satz verträgt offenbar keine Umkehrung. Nicht alles, was an verdrängte Wunschregungen und überwundene Denkweisen der individuellen Vorzeit und der Völkerurzeit mahnt, ist darum auch unheimlich.
Auch wollen wir es nicht verschweigen, daß sich fast zu jedem Beispiel, welches unseren Satz erweisen sollte, ein analoges finden läßt, das ihm widerspricht. Die abgehauene Hand z. B. im Hauffschen Märchen ›Die Geschichte von der abgehauenen Hand‹ wirkt gewiß unheimlich, was wir auf den Kastrationskomplex zurückgeführt haben. Aber in der Erzählung des Herodot vom Schatz des Rhampsenit läßt der Meisterdieb, den die Prinzessin bei der Hand festhalten will, ihr die abgehauene Hand seines Bruders zurück, und andere werden wahrscheinlich ebenso wie ich urteilen, daß dieser Zug keine unheimliche Wirkung hervorruft. Die prompte Wunscherfüllung im ›Ring des Polykrates‹ wirkt auf uns sicherlich ebenso unheimlich wie auf den König von Ägypten selbst. Aber in unseren Märchen wimmelt es von sofortigen Wunscherfüllungen, und das Unheimliche bleibt dabei aus. Im Märchen von den drei Wünschen läßt sich die Frau durch den Wohlgeruch einer Bratwurst verleiten zu sagen, daß sie auch so ein Würstchen haben möchte. Sofort liegt es vor ihr auf dem Teller. Der Mann wünscht im Ärger, daß es der Vorwitzigen an der Nase hängen möge. Flugs baumelt es an ihrer Nase. Das ist sehr eindrucksvoll, aber nicht im geringsten unheimlich. Das Märchen stellt sich überhaupt ganz offen auf den animistischen Standpunkt der Allmacht von Gedanken und Wünschen, und ich wüßte doch kein echtes Märchen zu nennen, in dem irgendetwas Unheimliches vorkäme. Wir haben gehört, daß es in hohem Grade unheimlich wirkt, wenn leblose Dinge, Bilder, Puppen, sich beleben, aber in den Andersenschen Märchen leben die Hausgeräte, die Möbel, der Zinnsoldat, und nichts ist vielleicht vom Unheimlichen entfernter. Auch die Belebung der schönen Statue des Pygmalion wird man kaum als unheimlich empfinden.
Scheintod und Wiederbelebung von Toten haben wir als sehr unheimliche Vorstellungen kennengelernt. Dergleichen ist aber wiederum im Märchen sehr gewöhnlich; wer wagte es unheimlich zu nennen, wenn z. B. Schneewittchen die Augen wieder aufschlägt? Auch die Erweckung von Toten in den Wundergeschichten, z. B. des Neuen Testaments, ruft Gefühle hervor, die nichts mit dem Unheimlichen zu tun haben. Die unbeabsichtigte Wiederkehr des Gleichen, die uns so unzweifelhafte unheimliche Wirkungen ergeben hat, dient doch in einer Reihe von Fällen anderen, und zwar sehr verschiedenen Wirkungen. Wir haben schon einen Fall kennengelernt, in dem sie als Mittel zur Hervorrufung des komischen Gefühls gebraucht wird, und können Beispiele dieser Art häufen. Andere Male wirkt sie als Verstärkung u. dgl., ferner: woher rührt die Unheimlichkeit der Stille, des Alleinseins, der Dunkelheit? Deuten diese Momente nicht auf die Rolle der Gefahr bei der Entstehung des Unheimlichen, wenngleich es dieselben Bedingungen sind, unter denen wir die Kinder am häufigsten Angst äußern sehen? Und können wir wirklich das Moment der intellektuellen Unsicherheit ganz vernachlässigen, da wir doch seine Bedeutung für das Unheimliche des Todes zugegeben haben?
So müssen wir wohl bereit sein anzunehmen, daß für das Auftreten des unheimlichen Gefühls noch andere als die von uns vorangestellten stofflichen Bedingungen maßgebend sind. Man könnte zwar sagen, mit jener ersten Feststellung sei das psychoanalytische Interesse am Problem des Unheimlichen erledigt, der Rest erfordere wahrscheinlich eine ästhetische Untersuchung. Aber damit würden wir dem Zweifel das Tor öffnen, welchen Wert unsere Einsicht in die Herkunft des Unheimlichen vom verdrängten Heimischen eigentlich beanspruchen darf.
Eine Beobachtung kann uns den Weg zur Lösung dieser Unsicherheiten weisen. Fast alle Beispiele, die unseren Erwartungen widersprechen, sind dem Bereich der Fiktion, der Dichtung, entnommen. Wir erhalten so einen Wink, einen Unterschied zu machen zwischen dem Unheimlichen, das man erlebt, und dem Unheimlichen, das man sich bloß vorstellt oder von dem man liest.
Das Unheimliche des Erlebens hat weit einfachere Bedingungen, umfaßt aber weniger zahlreiche Fälle. Ich glaube, es fügt sich ausnahmslos unserem Lösungsversuch, läßt jedesmal die Zurückführung auf altvertrautes Verdrängtes zu. Doch ist auch hier eine wichtige und psychologisch bedeutsame Scheidung des Materials vorzunehmen, die wir am besten an geeigneten Beispielen erkennen werden.
Greifen wir das Unheimliche der Allmacht der Gedanken, der prompten Wunscherfüllung, der geheimen schädigenden Kräfte, der Wiederkehr der Toten heraus. Die Bedingung, unter der hier das Gefühl des Unheimlichen entsteht, ist nicht zu verkennen. Wir –; oder unsere primitiven Urahnen –; haben dereinst diese Möglichkeiten für Wirklichkeit gehalten, waren von der Realität dieser Vorgänge überzeugt. Heute glauben wir nicht mehr daran, wir haben diese Denkweisen überwunden, aber wir fühlen uns dieser neuen Überzeugungen nicht ganz sicher, die alten leben noch in uns fort und lauern auf Bestätigung. Sowie sich nun etwas in unserem Leben ereignet, was diesen alten abgelegten Überzeugungen eine Bestätigung zuzuführen scheint, haben wir das Gefühl des Unheimlichen, zu dem man das Urteil ergänzen kann: Also ist es doch wahr, daß man einen anderen durch den bloßen Wunsch töten kann, daß die Toten weiterleben und an der Stätte ihrer früheren Tätigkeit sichtbar werden u. dgl.! Wer im Gegenteil diese animistischen Überzeugungen bei sich gründlich und endgültig erledigt hat, für den entfällt das Unheimliche dieser Art. Das merkwürdigste Zusammentreffen von Wunsch und Erfüllung, die rätselhafteste Wiederholung ähnlicher Erlebnisse an demselben Ort oder zum gleichen Datum, die täuschendsten Gesichtswahrnehmungen und verdächtigsten Geräusche werden ihn nicht irremachen, keine Angst in ihm erwecken, die man als Angst vor dem »Unheimlichen« bezeichnen kann. Es handelt sich hier also rein um eine Angelegenheit der Realitätsprüfung, um eine Frage der materiellen Realität [Fußnote]Da auch das Unheimliche des Doppelgängers von dieser Gattung ist, wird es interessant, die Wirkung zu erfahren, wenn uns einmal das Bild der eigenen Persönlichkeit ungerufen und unvermutet entgegentritt. E. Mach berichtet zwei solcher Beobachtungen in der Analyse der Empfindungen (1900, 3). Er erschrak das eine Mal nicht wenig, als er erkannte, daß das gesehene Gesicht das eigene sei, das andere Mal fällte er ein sehr ungünstiges Urteil über den anscheinend Fremden, der in seinen Omnibus einstieg, »Was steigt doch da für ein herabgekommener Schulmeister ein.« –; Ich kann ein ähnliches Abenteuer erzählen: Ich saß allein im Abteil des Schlafwagens, als bei einem heftigeren Ruck der Fahrtbewegung die zur anstoßenden Toilette führende Tür aufging und ein älterer Herr im Schlafrock, die Reisemütze auf dem Kopfe, bei mir eintrat. Ich nahm an, daß er sich beim Verlassen des zwischen zwei Abteilen befindlichen Kabinetts in der Richtung geirrt hatte und fälschlich in mein Abteil gekommen war, sprang auf, um ihn aufzuklären, erkannte aber bald verdutzt, daß der Eindringling mein eigenes, vom Spiegel in der Verbindungstür entworfenes Bild war. Ich weiß noch, daß mir die Erscheinung gründlich mißfallen hatte. Anstatt also über den Doppelgänger zu erschrecken, hatten beide –; Mach wie ich –; ihn einfach nicht agnosziert. Ob aber das Mißfallen dabei nicht doch ein Rest jener archaischen Reaktion war, die den Doppelgänger als unheimlich empfindet?.
Anders verhält es sich mit dem Unheimlichen, das von verdrängten infantilen Komplexen ausgeht, vom Kastrationskomplex, der Mutterleibsphantasie usw., nur daß reale Erlebnisse, welche diese Art von Unheimlichem erwecken, nicht sehr häufig sein können. Das Unheimliche des Erlebens gehört zumeist der früheren Gruppe an, für die Theorie ist aber die Unterscheidung der beiden sehr bedeutsam. Beim Unheimlichen aus infantilen Komplexen kommt die Frage der materiellen Realität gar nicht in Betracht, die psychische Realität tritt an deren Stelle. Es handelt sich um wirkliche Verdrängung eines Inhalts und um die Wiederkehr des Verdrängten, nicht um die Aufhebung des Glaubens an die Realität dieses Inhalts. Man könnte sagen, in dem einen Falle sei ein gewisser Vorstellungsinhalt, im anderen der Glaube an seine (materielle) Realität verdrängt. Aber die letztere Ausdrucksweise dehnt wahrscheinlich den Gebrauch des Terminus »Verdrängung« über seine rechtmäßigen Grenzen aus. Es ist korrekter, wenn wir einer hier spürbaren psychologischen Differenz Rechnung tragen und den Zustand, in dem sich die animistischen Überzeugungen des Kulturmenschen befinden, als ein –; mehr oder weniger vollkommenes –; Überwundensein bezeichnen. Unser Ergebnis lautete dann: Das Unheimliche des Erlebens kommt zustande, wenn verdrängte infantile Komplexe durch einen Eindruck wieder belebt werden oder wenn überwundene primitive Überzeugungen wieder bestätigt scheinen. Endlich darf man sich durch die Vorliebe für glatte Erledigung und durchsichtige Darstellung nicht vom Bekenntnis abhalten lassen, daß die beiden hier aufgestellten Arten des Unheimlichen im Erleben nicht immer scharf zu sondern sind. Wenn man bedenkt, daß die primitiven Überzeugungen auf das innigste mit den infantilen Komplexen zusammenhängen und eigentlich in ihnen wurzeln, wird man sich über diese Verwischung der Abgrenzungen nicht viel verwundern.
Das Unheimliche der Fiktion –; der Phantasie, der Dichtung –; verdient in der Tat eine gesonderte Betrachtung. Es ist vor allem weit reichhaltiger als das Unheimliche des Erlebens, es umfaßt dieses in seiner Gänze und dann noch anderes, was unter den Bedingungen des Erlebens nicht vorkommt. Der Gegensatz zwischen Verdrängtem und Überwundenem kann nicht ohne tiefgreifende Modifikation auf das Unheimliche der Dichtung übertragen werden, denn das Reich der Phantasie hat ja zur Voraussetzung seiner Geltung, daß sein Inhalt von der Realitätsprüfung enthoben ist. Das paradox klingende Ergebnis ist, daß in der Dichtung vieles nicht unheimlich ist, was unheimlich wäre, wenn es sich imLeben ereignete, und daß in der Dichtung viele Möglichkeiten bestehen, unheimliche Wirkungen zu erzielen, die fürs Leben wegfallen.
Zu den vielen Freiheiten des Dichters gehört auch die, seine Darstellungswelt nach Belieben so zu wählen, daß sie mit der uns vertrauten Realität zusammenfällt oder sich irgendwie von ihr entfernt. Wir folgen ihm in jedem Falle. Die Welt des Märchens z. B. hat den Boden der Realität von vornherein verlassen und sich offen zur Annahme der animistischen Überzeugungen bekannt. Wunscherfüllungen, geheime Kräfte, Allmacht der Gedanken, Belebung des Leblosen, die im Märchen ganz gewöhnlich sind, können hier keine unheimliche Wirkung äußern, denn für die Entstehung des unheimlichen Gefühls ist, wie wir gehört haben, der Urteilsstreit erforderlich, ob das überwundene Unglaubwürdige nicht doch real möglich ist, eine Frage, die durch die Voraussetzungen der Märchenwelt überhaupt aus dem Wege geräumt ist. So verwirklicht das Märchen, das uns die meisten Beispiele von Widerspruch gegen unsere Lösung des Unheimlichen geliefert hat, den zuerst erwähnten Fall, daß im Reiche der Fiktion vieles nicht unheimlich ist, was unheimlich wirken müßte, wenn es sich im Leben ereignete. Dazu kommen fürs Märchen noch andere Momente, die später kurz berührt werden sollen.
Der Dichter kann sich auch eine Welt erschaffen haben, die, minder phantastisch als die Märchenwelt, sich von der realen doch durch die Aufnahme von höheren geistigen Wesen, Dämonen oder Geistern Verstorbener scheidet. Alles Unheimliche, was diesen Gestalten anhaften könnte, entfällt dann, soweit die Voraussetzungen dieser poetischen Realität reichen. Die Seelen der Danteschen Hölle oder die Geistererscheinungen in Shakespeares Hamlet, Macbeth, Julius Caesar mögen düster und schreckhaft genug sein, aber unheimlich sind sie im Grunde ebensowenig wie etwa die heitere Götterwelt Homers. Wir passen unser Urteil den Bedingungen dieser vom Dichter fingierten Realität an und behandeln Seelen, Geister und Gespenster, als wären sie vollberechtigte Existenzen, wie wir es selbst in der materiellen Realität sind. Auch dies ist ein Fall, in dem Unheimlichkeit erspart wird.
Anders nun, wenn der Dichter sich dem Anscheine nach auf den Boden der gemeinen Realität gestellt hat. Dann übernimmt er auch alle Bedingungen, die im Erleben für die Entstehung des unheimlichen Gefühls gelten, und alles was im Leben unheimlich wirkt, wirkt auch so in der Dichtung. Aber in diesem Falle kann der Dichter auch das Unheimliche weit über das im Erleben mögliche Maß hinaus steigern und vervielfältigen, indem er solche Ereignisse vorfallen läßt, die in der Wirklichkeit nicht oder nur sehr selten zur Erfahrung gekommen wären. Er verrät uns dann gewissermaßen an unseren für überwunden gehaltenen Aberglauben, er betrügt uns, indem er uns die gemeine Wirklichkeit verspricht und dann doch über diese hinausgeht. Wir reagieren auf seine Fiktionen so, wie wir auf eigene Erlebnisse reagiert hätten; wenn wir den Betrug merken, ist es zu spät, der Dichter hat seine Absicht bereits erreicht, aber ich muß behaupten, er hat keine reine Wirkung erzielt. Bei uns bleibt ein Gefühl von Unbefriedigung, eine Art von Groll über die versuchte Täuschung, wie ich es besonders deutlich nach der Lektüre von Schnitzlers Erzählung Die Weissagung und ähnlichen mit dem Wunderbaren liebäugelnden Produktionen verspürt habe. Der Dichter hat dann noch ein Mittel zur Verfügung, durch welches er sich dieser unserer Auflehnung entziehen und gleichzeitig die Bedingungen für das Erreichen seiner Absichten verbessern kann. Es besteht darin, daß er uns lange Zeit über nicht erraten läßt, welche Voraussetzungen er eigentlich für die von ihm angenommene Welt gewählt hat, oder daß er kunstvoll und arglistig einer solchen entscheidenden Aufklärung bis zum Ende ausweicht. Im ganzen wird aber hier der vorhin angekündigte Fall verwirklicht, daß die Fiktion neue Möglichkeiten des unheimlichen Gefühls erschafft, die im Erleben wegfallen würden.
Alle diese Mannigfaltigkeiten beziehen sich strenggenommen nur auf das Unheimliche, das aus dem Überwundenen entsteht. Das Unheimliche aus verdrängten Komplexen ist resistenter, es bleibt in der Dichtung –; von einer Bedingung abgesehen –; ebenso unheimlich wie im Erleben. Das andere Unheimliche, das aus dem Überwundenen, zeigt diesen Charakter im Erleben und in der Dichtung, die sich auf den Boden der materiellen Realität stellt, kann ihn aber in den fiktiven, vom Dichter geschaffenen Realitäten einbüßen.
Es ist offenkundig, daß die Freiheiten des Dichters und damit die Vorrechte der Fiktion in der Hervorrufung und Hemmung des unheimlichen Gefühls durch die vorstehenden Bemerkungen nicht erschöpft werden. Gegen das Erleben verhalten wir uns im allgemeinen gleichmäßig passiv und unterliegen der Einwirkung des Stofflichen. Für den Dichter sind wir aber in besonderer Weise lenkbar; durch die Stimmung, in die er uns versetzt, durch die Erwartungen, die er in uns erregt, kann er unsere Gefühlsprozesse von dem einen Erfolg ablenken und auf einen anderen einstellen und kann aus demselben Stoff oft sehr verschiedenartige Wirkungen gewinnen. Dies ist alles längst bekannt und wahrscheinlich von den berufenen Ästhetikern eingehend gewürdigt worden. Wir sind auf dieses Gebiet der Forschung ohne rechte Absicht geführt worden, indem wir der Versuchung nachgaben, den Widerspruch gewisser Beispiele gegen unsere Ableitung des Unheimlichen aufzuklären. Zu einzelnen dieser Beispiele wollen wir darum auch zurückkehren.
Wir fragten vorhin, warum die abgehauene Hand im Schatz des Rhampsenit nicht unheimlich wirke wie etwa in der Hauffschen ›Geschichte von der abgehauenen Hand‹. Die Frage erscheint uns jetzt bedeutsamer, da wir die größere Resistenz des Unheimlichen aus der Quelle verdrängter Komplexe erkannt haben. Die Antwort ist leicht zu geben. Sie lautet, daß wir in dieser Erzählung nicht auf die Gefühle der Prinzessin, sondern auf die überlegene Schlauheit des »Meisterdiebes« eingestellt werden. Der Prinzessin mag das unheimliche Gefühl dabei nicht erspart worden sein, wir wollen es selbst für glaubhaft halten, daß sie in Ohnmacht gefallen ist, aber wir verspüren nichts Unheimliches, denn wir versetzen uns nicht in sie, sondern in den anderen. Durch eine andere Konstellation wird uns der Eindruck des Unheimlichen in der Nestroyschen Posse Der Zerrissene erspart, wenn der Geflüchtete, der sich für einen Mörder hält, aus jeder Falltür, deren Deckel er aufhebt, das vermeintliche Gespenst des Ermordeten aufsteigen sieht und verzweifelt ausruft: Ich hab' doch nur einen umgebracht. Zu was diese gräßliche Multiplikation? Wir kennen die Vorbedingungen dieser Szene, teilen den Irrtum des »Zerrissenen« nicht, und darum wirkt, was für ihn unheimlich sein muß, auf uns mit unwiderstehlicher Komik. Sogar ein »wirkliches« Gespenst wie das in O. Wildes Erzählung Der Geist von Canterville muß all seiner Ansprüche, wenigstens Grauen zu erregen, verlustig werden, wenn der Dichter sich den Scherz macht, es zu ironisieren und hänseln zu lassen. So unabhängig kann in der Welt der Fiktion die Gefühlswirkung von der Stoffwahl sein. In der Welt der Märchen sollen Angstgefühle, also auch unheimliche Gefühle überhaupt nicht erweckt werden. Wir verstehen das und sehen darum auch über die Anlässe hinweg, bei denen etwas Derartiges möglich wäre.
Von der Einsamkeit, Stille und Dunkelheit können wir nichts anderes sagen, als daß dies wirklich die Momente sind, an welche die bei den meisten Menschen nie ganz erlöschende Kinderangst geknüpft ist. Die psychoanalytische Forschung hat sich mit dem Problem derselben an anderer Stelle auseinandergesetzt.
Der Dichter und das Phantasieren (1908)
Uns Laien hat es immer mächtig gereizt zu wissen, woher diese merkwürdige Persönlichkeit, der Dichter, seine Stoffe nimmt –; etwa im Sinne der Frage, die jener Kardinal an den Ariosto richtete –; und wie er es zustande bringt, uns mit ihnen so zu ergreifen, Erregungen in uns hervorzurufen, deren wir uns vielleicht nicht einmal für fähig gehalten hätten. Unser Interesse hiefür wird nur gesteigert durch den Umstand, daß der Dichter selbst, wenn wir ihn befragen, uns keine oder keine befriedigende Auskunft gibt, und wird gar nicht gestört durch unser Wissen, daß die beste Einsicht in die Bedingungen der dichterischen Stoffwahl und in das Wesen der poetischen Gestaltungskunst nichts dazu beitragen würde, uns selbst zu Dichtern zu machen.
Wenn wir wenigstens bei uns oder bei unsersgleichen eine dem Dichten irgendwie verwandte Tätigkeit auffinden könnten! Die Untersuchung derselben ließe uns hoffen, eine erste Aufklärung über das Schaffen des Dichters zu gewinnen. Und wirklich, dafür ist Aussicht vorhanden –; die Dichter selbst lieben es ja, den Abstand zwischen ihrer Eigenart und allgemein menschlichem Wesen zu verringern; sie versichern uns so häufig, daß in jedem Menschen ein Dichter stecke und daß der letzte Dichter erst mit dem letzten Menschen sterben werde.
Sollten wir die ersten Spuren dichterischer Betätigung nicht schon beim Kinde suchen? Die liebste und intensivste Beschäftigung des Kindes ist das Spiel. Vielleicht dürfen wir sagen: Jedes spielende Kind benimmt sich wie ein Dichter, indem es sich eine eigene Welt erschafft oder, richtiger gesagt, die Dinge seiner Welt in eine neue, ihm gefällige Ordnung versetzt. Es wäre dann unrecht zu meinen, es nähme diese Welt nicht ernst; im Gegenteil, es nimmt sein Spiel sehr ernst, es verwendet große Affektbeträge darauf. Der Gegensatz zu Spiel ist nicht Ernst, sondern –; Wirklichkeit. Das Kind unterscheidet seine Spielwelt sehr wohl, trotz aller Affektbesetzung, von der Wirklichkeit und lehnt seine imaginierten Objekte und Verhältnisse gerne an greifbare und sichtbare Dinge der wirklichen Welt an. Nichts anderes als diese Anlehnung unterscheidet das »Spielen« des Kindes noch vom »Phantasieren«.
Der Dichter tut nun dasselbe wie das spielende Kind; er erschafft eine Phantasiewelt, die er sehr ernst nimmt, d. h. mit großen Affektbeträgen ausstattet, während er sie von der Wirklichkeit scharf sondert. Und die Sprache hat diese Verwandtschaft von Kinderspiel und poetischem Schaffen festgehalten, indem sie solche Veranstaltungen des Dichters, welche der Anlehnung an greifbare Objekte bedürfen, welche der Darstellung fähig sind, als Spiele: Lustspiel, Trauerspiel, und die Person, welche sie darstellt, als Schauspieler bezeichnet. Aus der Unwirklichkeit der dichterischen Welt ergeben sich aber sehr wichtige Folgen für die künstlerische Technik, denn vieles, was als real nicht Genuß bereiten könnte, kann dies doch im Spiele der Phantasie, viele an sich eigentlich peinliche Erregungen können für den Hörer und Zuschauer des Dichters zur Quelle der Lust werden.
Verweilen wir einer anderen Beziehung wegen noch einen Augenblick bei dem Gegensatze von Wirklichkeit und Spiel! Wenn das Kind herangewachsen ist und aufgehört hat zu spielen, wenn es sich durch Jahrzehnte seelisch bemüht hat, die Wirklichkeiten des Lebens mit dem erforderlichen Ernste zu erfassen, so kann es eines Tages in eine seelische Disposition geraten, welche den Gegensatz zwischen Spiel und Wirklichkeit wieder aufhebt. Der Erwachsene kann sich darauf besinnen, mit welchem hohen Ernst er einst seine Kinderspiele betrieb, und indem er nun seine vorgeblich ernsten Beschäftigungen jenen Kinderspielen gleichstellt, wirft er die allzu schwere Bedrückung durch das Leben ab und erringt sich den hohen Lustgewinn des Humors.
Der Heranwachsende hört also auf zu spielen, er verzichtet scheinbar auf den Lustgewinn, den er aus dem Spiele bezog. Aber wer das Seelenleben des Menschen kennt, der weiß, daß ihm kaum etwas anderes so schwer wird wie der Verzicht auf einmal gekannte Lust. Eigentlich können wir auf nichts verzichten, wir vertauschen nur eines mit dem andern; was ein Verzicht zu sein scheint, ist in Wirklichkeit eine Ersatz- oder Surrogatbildung. So gibt auch der Heranwachsende, wenn er aufhört zu spielen, nichts anderes auf als die Anlehnung an reale Objekte; anstatt zu spielen, phantasiert er jetzt. Er baut sich Luftschlösser, schafft das, was man Tagträume nennt. Ich glaube, daß die meisten Menschen zu Zeiten ihres Lebens Phantasien bilden. Es ist das eine Tatsache, die man lange Zeit übersehen und deren Bedeutung man darum nicht genug gewürdigt hat.
Das Phantasieren der Menschen ist weniger leicht zu beobachten als das Spielen der Kinder. Das Kind spielt zwar auch allein oder es bildet mit anderen Kindern ein geschlossenes psychisches System zum Zwecke des Spieles, aber wenn es auch den Erwachsenen nichts vorspielt, so verbirgt es doch sein Spielen nicht vor ihnen. Der Erwachsene aber schämt sich seiner Phantasien und versteckt sie vor anderen, er hegt sie als seine eigensten Intimitäten, er würde in der Regel lieber seine Vergehungen eingestehen als seine Phantasien mitteilen. Es mag vorkommen, daß er sich darum für den einzigen hält, der solche Phantasien bildet, und von der allgemeinen Verbreitung ganz ähnlicher Schöpfungen bei anderen nichts ahnt. Dies verschiedene Verhalten des Spielenden und des Phantasierenden findet seine gute Begründung in den Motiven der beiden einander doch fortsetzenden Tätigkeiten.
Das Spielen des Kindes wurde von Wünschen dirigiert, eigentlich von dem einen Wunsche, der das Kind erziehen hilft, vom Wunsche: groß und erwachsen zu sein. Es spielt immer »groß sein«, imitiert im Spiele, was ihm vom Leben der Großen bekannt geworden ist. Es hat nun keinen Grund, diesen Wunsch zu verbergen. Anders der Erwachsene; dieser weiß einerseits, daß man von ihm erwartet, nicht mehr zu spielen oder zu phantasieren, sondern in der wirklichen Welt zu handeln, und anderseits sind unter den seine Phantasien erzeugenden Wünschen manche, die es überhaupt zu verbergen nottut; darum schämt er sich seines Phantasierens als kindisch und als unerlaubt.
Sie werden fragen, woher man denn über das Phantasieren der Menschen so genau Bescheid wisse, wenn es von ihnen mit soviel Geheimtun verhüllt wird. Nun, es gibt eine Gattung von Menschen, denen zwar nicht ein Gott, aber eine strenge Göttin –; die Notwendigkeit –; den Auftrag erteilt hat zu sagen, was sie leiden und woran sie sich erfreuen. Es sind dies die Nervösen, die dem Arzte, von dem sie Herstellung durch psychische Behandlung erwarten, auch ihre Phantasien eingestehen müssen; aus dieser Quelle stammt unsere beste Kenntnis, und wir sind dann zu der wohl begründeten Vermutung gelangt, daß unsere Kranken uns nichts anderes mitteilen, als was wir auch von den Gesunden erfahren könnten.
Gehen wir daran, einige der Charaktere des Phantasierens kennenzulernen. Man darf sagen, der Glückliche phantasiert nie, nur der Unbefriedigte. Unbefriedigte Wünsche sind die Triebkräfte der Phantasien, und jede einzelne Phantasie ist eine Wunscherfüllung, eine Korrektur der unbefriedigenden Wirklichkeit. Die treibenden Wünsche sind verschieden je nach Geschlecht, Charakter und Lebensverhältnissen der phantasierenden Persönlichkeit; sie lassen sich aber ohne Zwang nach zwei Hauptrichtungen gruppieren. Es sind entweder ehrgeizige Wünsche, welche der Erhöhung der Persönlichkeit dienen, oder erotische. Beim jungen Weibe herrschen die erotischen Wünsche fast ausschließend, denn sein Ehrgeiz wird in der Regel vom Liebesstreben aufgezehrt; beim jungen Manne sind neben den erotischen die eigensüchtigen und ehrgeizigen Wünsche vordringlich genug. Doch wollen wir nicht den Gegensatz beider Richtungen, sondern vielmehr deren häufige Vereinigung betonen; wie in vielen Altarbildern in einer Ecke das Bildnis des Stifters sichtbar ist, so können wir an den meisten ehrgeizigen Phantasien in irgendeinem Winkel die Dame entdecken, für die der Phantast all diese Heldentaten vollführt, der er alle Erfolge zu Füßen legt. Sie sehen, hier liegen genug starke Motive zum Verbergen vor; dem wohlerzogenen Weibe wird ja überhaupt nur ein Minimum von erotischer Bedürftigkeit zugebilligt, und der junge Mann soll das Übermaß von Selbstgefühl, welches er aus der Verwöhnung der Kindheit mitbringt, zum Zwecke der Einordnung in die an ähnlich anspruchsvollen Individuen so reiche Gesellschaft unterdrücken lernen.
Die Produkte dieser phantasierenden Tätigkeit, die einzelnen Phantasien, Luftschlösser oder Tagträume dürfen wir uns nicht als starr und unveränderlich vorstellen. Sie schmiegen sich vielmehr den wechselnden Lebenseindrücken an, verändern sich mit jeder Schwankung der Lebenslage, empfangen von jedem wirksamen neuen Eindrucke eine sogenannte »Zeitmarke«. Das Verhältnis der Phantasie zur Zeit ist überhaupt sehr bedeutsam. Man darf sagen: eine Phantasie schwebt gleichsam zwischen drei Zeiten, den drei Zeitmomenten unseres Vorstellens. Die seelische Arbeit knüpft an einen aktuellen Eindruck, einen Anlaß in der Gegenwart an, der imstande war, einen der großen Wünsche der Person zu wecken, greift von da aus auf die Erinnerung eines früheren, meist infantilen, Erlebnisses zurück, in dem jener Wunsch erfüllt war, und schafft nun eine auf die Zukunft bezogene Situation, welche sich als die Erfüllung jenes Wunsches darstellt, eben den Tagtraum oder die Phantasie, die nun die Spuren ihrer Herkunft vom Anlasse und von der Erinnerung an sich trägt. Also Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges wie an der Schnur des durchlaufenden Wunsches aneinandergereiht.
Das banalste Beispiel mag Ihnen meine Aufstellung erläutern. Nehmen Sie den Fall eines armen und verwaisten Jünglings an, welchem Sie die Adresse eines Arbeitgebers genannt haben, bei dem er vielleicht eine Anstellung finden kann. Auf dem Wege dahin mag er sich in einem Tagtraum ergehen, wie er angemessen aus seiner Situation entspringt. Der Inhalt dieser Phantasie wird etwa sein, daß er dort angenommen wird, seinem neuen Chef gefällt, sich im Geschäfte unentbehrlich macht, in die Familie des Herrn gezogen wird, das reizende Töchterchen des Hauses heiratet und dann selbst als Mitbesitzer wie später als Nachfolger das Geschäft leitet. Und dabei hat sich der Träumer ersetzt, was er in der glücklichen Kindheit besessen: das schützende Haus, die liebenden Eltern und die ersten Objekte seiner zärtlichen Neigung. Sie sehen an solchem Beispiele, wie der Wunsch einen Anlaß der Gegenwart benützt, um sich nach dem Muster der Vergangenheit ein Zukunftsbild zu entwerfen.
Es wäre noch vielerlei über die Phantasien zu sagen; ich will mich aber auf die knappsten Andeutungen beschränken. Das Überwuchern und Übermächtigwerden der Phantasien stellt die Bedingungen für den Verfall in Neurose oder Psychose her; die Phantasien sind auch die nächsten seelischen Vorstufen der Leidenssymptome, über welche unsere Kranken klagen. Hier zweigt ein breiter Seitenweg zur Pathologie ab.
Nicht übergehen kann ich aber die Beziehung der Phantasien zum Traume. Auch unsere nächtlichen Träume sind nichts anderes als solche Phantasien, wie wir durch die Deutung der Träume evident machen können [Fußnote]Vgl. des Verfassers Traumdeutung (1900 a).. Die Sprache hat in ihrer unübertrefflichen Weisheit die Frage nach dem Wesen der Träume längst entschieden, indem sie die luftigen Schöpfungen Phantasierender auch » Tagträume« nennen ließ. Wenn trotz dieses Fingerzeiges der Sinn unserer Träume uns zumeist undeutlich bleibt, so rührt dies von dem einen Umstände her, daß nächtlicherweise auch solche Wünsche in uns rege werden, deren wir uns schämen und die wir vor uns selbst verbergen müssen, die eben darum verdrängt, ins Unbewußte geschoben wurden. Solchen verdrängten Wünschen und ihren Abkömmlingen kann nun kein anderer als ein arg entstellter Ausdruck gegönnt werden. Nachdem die Aufklärung der Traumentstellung der wissenschaftlichen Arbeit gelungen war, fiel es nicht mehr schwer zu erkennen, daß die nächtlichen Träume ebensolche Wunscherfüllungen sind wie die Tagträume, die uns allen so wohlbekannten Phantasien.
Soviel von den Phantasien, und nun zum Dichter! Dürfen wir wirklich den Versuch machen, den Dichter mit dem »Träumer am hellichten Tag«, seine Schöpfungen mit Tagträumen zu vergleichen? Da drängt sich wohl eine erste Unterscheidung auf; wir müssen die Dichter, die fertige Stoffe übernehmen wie die alten Epiker und Tragiker, sondern von jenen, die ihre Stoffe frei zu schaffen scheinen. Halten wir uns an die letzteren und suchen wir für unsere Vergleichung nicht gerade jene Dichter aus, die von der Kritik am höchsten geschätzt werden, sondern die anspruchsloseren Erzähler von Romanen, Novellen und Geschichten, die dafür die zahlreichsten und eifrigsten Leser und Leserinnen finden. An den Schöpfungen dieser Erzähler muß uns vor allem ein Zug auffällig werden; sie alle haben einen Helden, der im Mittelpunkt des Interesses steht, für den der Dichter unsere Sympathie mit allen Mitteln zu gewinnen sucht und den er wie mit einer besonderen Vorsehung zu beschützen scheint. Wenn ich am Ende eines Romankapitels den Helden bewußtlos, aus schweren Wunden blutend verlassen habe, so bin ich sicher, ihn zu Beginn des nächsten in sorgsamster Pflege und auf dem Wege der Herstellung zu finden, und wenn der erste Band mit dem Untergange des Schiffes im Seesturme geendigt hat, auf dem unser Held sich befand, so bin ich sicher, zu Anfang des zweiten Bandes von seiner wunderbaren Rettung zu lesen, ohne die der Roman ja keinen Fortgang hätte. Das Gefühl der Sicherheit, mit dem ich den Helden durch seine gefährlichen Schicksale begleite, ist das nämliche, mit dem ein wirklicher Held sich ins Wasser stürzt, um einen Ertrinkenden zu retten, oder sich dem feindlichen Feuer aussetzt, um eine Batterie zu stürmen, jenes eigentliche Heldengefühl, dem einer unserer besten Dichter den köstlichen Ausdruck geschenkt hat: »Es kann dir nix g'schehen.« (Anzengruber.) Ich meine aber, an diesem verräterischen Merkmal der Unverletzlichkeit erkennt man ohne Mühe –; Seine Majestät das Ich, den Helden aller Tagträume wie aller Romane.
Noch andere typische Züge dieser egozentrischen Erzählungen deuten auf die gleiche Verwandtschaft hin. Wenn sich stets alle Frauen des Romans in den Helden verlieben, so ist das kaum als Wirklichkeitsschilderung aufzufassen, aber leicht als notwendiger Bestand des Tagtraumes zu verstehen. Ebenso wenn die anderen Personen des Romans sich scharf in gute und böse scheiden, unter Verzicht auf die in der Realität zu beobachtende Buntheit menschlicher Charaktere; die »guten« sind eben die Helfer, die »bösen« aber die Feinde und Konkurrenten des zum Helden gewordenen Ichs.
Wir verkennen nun keineswegs, daß sehr viele dichterische Schöpfungen sich von dem Vorbilde des naiven Tagtraumes weit entfernt halten, aber ich kann doch die Vermutung nicht unterdrücken, daß auch die extremsten Abweichungen durch eine lückenlose Reihe von Übergängen mit diesem Modelle in Beziehung gesetzt werden könnten. Noch in vielen der sogenannten psychologischen Romane ist mir aufgefallen, daß nur eine Person, wiederum der Held, von innen geschildert wird; in ihrer Seele sitzt gleichsam der Dichter und schaut die anderen Personen von außen an. Der psychologische Roman verdankt im ganzen wohl seine Besonderheit der Neigung des modernen Dichters, sein Ich durch Selbstbeobachtung in Partial-Ichs zu zerspalten und demzufolge die Konfliktströmungen seines Seelenlebens in mehreren Helden zu personifizieren. In einem ganz besonderen Gegensatze zum Typus des Tagtraumes scheinen die Romane zu stehen, die man als »exzentrische« bezeichnen könnte, in denen die als Held eingeführte Person die geringste tätige Rolle spielt, vielmehr wie ein Zuschauer die Taten und Leiden der anderen an sich vorüberziehen sieht. Solcher Art sind mehrere der späteren Romane Zolas. Doch muß ich bemerken, daß die psychologische Analyse nicht dichtender, in manchen Stücken von der sogenannten Norm abweichender Individuen uns analoge Variationen der Tagträume kennengelehrt hat, in denen sich das Ich mit der Rolle des Zuschauers bescheidet.
Wenn unsere Gleichstellung des Dichters mit dem Tagträumer, der poetischen Schöpfung mit dem Tagtraum, wertvoll werden soll, so muß sie sich vor allem in irgendeiner Art fruchtbar erweisen. Versuchen wir etwa, unseren vorhin aufgestellten Satz von der Beziehung der Phantasie zu den drei Zeiten und zum durchlaufenden Wunsche auf die Werke der Dichter anzuwenden und die Beziehungen zwischen dem Leben des Dichters und seinen Schöpfungen mit dessen Hilfe zu studieren. Man hat in der Regel nicht gewußt, mit welchen Erwartungsvorstellungen man an dieses Problem herangehen soll; häufig hat man sich diese Beziehung viel zu einfach vorgestellt. Von der an den Phantasien gewonnenen Einsicht her müßten wir folgenden Sachverhalt erwarten: Ein starkes aktuelles Erlebnis weckt im Dichter die Erinnerung an ein früheres, meist der Kindheit angehöriges Erlebnis auf, von welchem nun der Wunsch ausgeht, der sich in der Dichtung seine Erfüllung schafft; die Dichtung selbst läßt sowohl Elemente des frischen Anlasses als auch der alten Erinnerung erkennen.
Erschrecken Sie nicht über die Kompliziertheit dieser Formel; ich vermute, daß sie sich in Wirklichkeit als ein zu dürftiges Schema erweisen wird, aber eine erste Annäherung an den realen Sachverhalt könnte doch in ihr enthalten sein, und nach einigen Versuchen, die ich unternommen habe, sollte ich meinen, daß eine solche Betrachtungsweise dichterischer Produktionen nicht unfruchtbar ausfallen kann. Sie vergessen nicht, daß die vielleicht befremdende Betonung der Kindheitserinnerung im Leben des Dichters sich in letzter Linie von der Voraussetzung ableitet, daß die Dichtung wie der Tagtraum Fortsetzung und Ersatz des einstigen kindlichen Spielens ist.
Versäumen wir nicht, auf jene Klasse von Dichtungen zurückzugreifen, in denen wir nicht freie Schöpfungen, sondern Bearbeitungen fertiger und bekannter Stoffe erblicken müssen. Auch dabei verbleibt dem Dichter ein Stück Selbständigkeit, das sich in der Auswahl des Stoffes und in der oft weitgehenden Abänderung desselben äußern darf. Soweit die Stoffe aber gegeben sind, entstammen sie dem Volksschatze an Mythen, Sagen und Märchen. Die Untersuchung dieser völkerpsychologischen Bildungen ist nun keineswegs abgeschlossen, aber es ist z. B. von den Mythen durchaus wahrscheinlich, daß sie den entstellten Überresten von Wunschphantasien ganzer Nationen, den Säkularträumen der jungen Menschheit, entsprechen.
Sie werden sagen, daß ich Ihnen von den Phantasien weit mehr erzählt habe als vom Dichter, den ich doch im Titel meines Vortrages vorangestellt. Ich weiß das und versuche es durch den Hinweis auf den heutigen Stand unserer Erkenntnis zu entschuldigen. Ich konnte Ihnen nur Anregungen und Aufforderungen bringen, die von dem Studium der Phantasien her auf das Problem der dichterischen Stoffwahl übergreifen. Das andere Problem, mit welchen Mitteln der Dichter bei uns die Affektwirkungen erziele, die er durch seine Schöpfungen hervorruft, haben wir überhaupt noch nicht berührt. Ich möchte Ihnen wenigstens noch zeigen, welcher Weg von unseren Erörterungen über die Phantasien zu den Problemen der poetischen Effekte führt.
Sie erinnern sich, wir sagten, daß der Tagträumer seine Phantasien vor anderen sorgfältig verbirgt, weil er Gründe verspürt, sich ihrer zu schämen. Ich füge nun hinzu, selbst wenn er sie uns mitteilen würde, könnte er uns durch solche Enthüllung keine Lust bereiten. Wir werden von solchen Phantasien, wenn wir sie erfahren, abgestoßen oder bleiben höchstens kühl gegen sie. Wenn aber der Dichter uns seine Spiele vorspielt oder uns das erzählt, was wir für seine persönlichen Tagträume zu erklären geneigt sind, so empfinden wir hohe, wahrscheinlich aus vielen Quellen zusammenfließende Lust. Wie der Dichter das zustande bringt, das ist sein eigenstes Geheimnis; in der Technik der Überwindung jener Abstoßung, die gewiß mit den Schranken zu tun hat, welche sich zwischen jedem einzelnen Ich und den anderen erheben, liegt die eigentliche Ars poetica. Zweierlei Mittel dieser Technik können wir erraten: Der Dichter mildert den Charakter des egoistischen Tagtraumes durch Abänderungen und Verhüllungen und besticht uns durch rein formalen, d. h. ästhetischen Lustgewinn, den er uns in der Darstellung seiner Phantasien bietet. Man nennt einen solchen Lustgewinn, der uns geboten wird, um mit ihm die Entbindung größerer Lust aus tiefer reichenden psychischen Quellen zu ermöglichen, eine Verlockungsprämie oder eine Vorlust. Ich bin der Meinung, daß alle ästhetische Lust, die uns der Dichter verschafft, den Charakter solcher Vorlust trägt und daß der eigentliche Genuß des Dichtwerkes aus der Befreiung von Spannungen in unserer Seele hervorgeht. Vielleicht trägt es sogar zu diesem Erfolge nicht wenig bei, daß uns der Dichter in den Stand setzt, unsere eigenen Phantasien nunmehr ohne jeden Vorwurf und ohne Schämen zu genießen. Hier stünden wir nun am Eingange neuer, interessanter und verwickelter Untersuchungen, aber, wenigstens für diesmal, am Ende unserer Erörterungen.
Der Familienroman der Neurotiker (1909)
Die Ablösung des heranwachsenden Individuums von der Autorität der Eltern ist eine der notwendigsten, aber auch schmerzlichsten Leistungen der Entwicklung. Es ist durchaus notwendig, daß sie sich vollziehe, und man darf annehmen, jeder normal gewordene Mensch habe sie in einem gewissen Maß zustande gebracht. Ja, der Fortschritt der Gesellschaft beruht überhaupt auf dieser Gegensätzlichkeit der beiden Generationen. Anderseits gibt es eine Klasse von Neurotikern, in deren Zustand man die Bedingtheit erkennt, daß sie an dieser Aufgabe gescheitert sind.
Für das kleine Kind sind die Eltern zunächst die einzige Autorität und die Quelle alles Glaubens. Ihnen, das heißt dem gleichgeschlechtlichen Teile, gleich zu werden, groß zu werden wie Vater und Mutter, ist der intensivste, folgenschwerste Wunsch dieser Kinderjahre. Mit der zunehmenden intellektuellen Entwicklung kann es aber nicht ausbleiben, daß das Kind allmählich die Kategorien kennenlernt, in die seine Eltern gehören. Es lernt andere Eltern kennen, vergleicht sie mit den seinigen und bekommt so ein Recht, an der ihnen zugeschriebenen Unvergleichlichkeit und Einzigkeit zu zweifeln. Kleine Ereignisse im Leben des Kindes, die eine unzufriedene Stimmung bei ihm hervorrufen, geben ihm den Anlaß, mit der Kritik der Eltern einzusetzen und die gewonnene Kenntnis, daß andere Eltern in mancher Hinsicht vorzuziehen seien, zu dieser Stellungnahme gegen seine Eltern zu verwerten. Aus der Neurosenpsychologie wissen wir, daß dabei unter anderen die intensivsten Regungen sexueller Rivalität mitwirken. Der Gegenstand dieser Anlässe ist offenbar das Gefühl der Zurücksetzung. Nur zu oft ergeben sich Gelegenheiten, bei denen das Kind zurückgesetzt wird oder sich wenigstens zurückgesetzt fühlt, wo es die volle Liebe der Eltern vermißt, besonders aber bedauert, sie mit anderen Geschwistern teilen zu müssen. Die Empfindung, daß die eigenen Neigungen nicht voll erwidert werden, macht sich dann in der aus frühen Kinderjahren oft bewußt erinnerten Idee Luft, man sei ein Stiefkind oder ein angenommenes Kind. Viele nicht neurotisch gewordene Menschen entsinnen sich sehr häufig an solche Gelegenheiten, wo sie –; meist durch Lektüre beeinflußt –; das feindselige Benehmen der Eltern in dieser Weise auffaßten und erwiderten. Es zeigt sich aber hier bereits der Einfluß des Geschlechts, indem der Knabe bei weitem mehr Neigung zu feindseligen Regungen gegen seinen Vater als gegen seine Mutter zeigt und eine viel intensivere Neigung, sich von jenem als von dieser frei zu machen. Die Phantasietätigkeit der Mädchen mag sich in diesem Punkte viel schwächer erweisen. In diesen bewußt erinnerten Seelenregungen der Kinderjahre finden wir das Moment, welches uns das Verständnis des Mythus ermöglicht.
Selten bewußt erinnert, aber fast immer durch die Psychoanalyse nachzuweisen ist dann die weitere Entwicklungsstufe dieser beginnenden Entfremdung von den Eltern, die man mit dem Namen: Familienromane der Neurotiker bezeichnen kann. Es gehört nämlich durchaus zum Wesen der Neurose und auch jeder höheren Begabung eine ganz besondere Tätigkeit der Phantasie, die sich zunächst in den kindlichen Spielen offenbart und die nun, ungefähr von der Zeit der Vorpubertät angefangen, sich des Themas der Familienbeziehungen bemächtigt. Ein charakteristisches Beispiel dieser besonderen Phantasietätigkeit ist das bekannte Tagträumen[Fußnote]Vgl. darüber Freud, ›Hysterische Phantasien und ihre Beziehung zur Bisexualität‹, wo auch auf die Literatur zu diesem Thema verwiesen ist., das weit über die Pubertät hinaus fortgesetzt wird. Eine genaue Beobachtung dieser Tagträume lehrt, daß sie der Erfüllung von Wünschen, der Korrektur des Lebens dienen und vornehmlich zwei Ziele kennen: das erotische und das ehrgeizige (hinter dem aber meist auch das erotische steckt). Um die angegebene Zeit beschäftigt sich nun die Phantasie des Kindes mit der Aufgabe, die geringgeschätzten Eltern loszuwerden und durch in der Regel sozial höher stehende zu ersetzen. Dabei wird das zufällige Zusammentreffen mit wirklichen Erlebnissen (die Bekanntschaft des Schloßherrn oder Gutsbesitzers auf dem Lande, der Fürstlichkeit in der Stadt) ausgenützt. Solche zufällige Erlebnisse erwecken den Neid des Kindes, der dann den Ausdruck in einer Phantasie findet, welche beide Eltern durch vornehmere ersetzt. In der Technik der Ausführung solcher Phantasien, die natürlich um diese Zeit bewußt sind, kommt es auf die Geschicklichkeit und das Material an, das dem Kinde zur Verfügung steht. Auch handelt es sich darum, ob die Phantasien mit einem großen oder geringen Bemühen, die Wahrscheinlichkeit zu erreichen, ausgearbeitet sind. Dieses Stadium wird zu einer Zeit erreicht, wo dem Kinde die Kenntnis der sexuellen Bedingungen der Herkunft noch fehlt.
Kommt dann die Kenntnis der verschiedenartigen sexuellen Beziehungen von Vater und Mutter dazu, begreift das Kind, daß pater semper incertus est, während die Mutter certissima ist, so erfährt der Familienroman eine eigentümliche Einschränkung: er begnügt sich nämlich damit, den Vater zu erhöhen, die Abkunft von der Mutter aber als etwas Unabänderliches nicht weiter in Zweifel zu ziehen. Dieses zweite (sexuelle) Stadium des Familienromans wird auch von einem zweiten Motiv getragen, das dem ersten (asexuellen) Stadium fehlte. Mit der Kenntnis der geschlechtlichen Vorgänge entsteht die Neigung, sich erotische Situationen und Beziehungen auszumalen, wozu als Triebkraft die Lust tritt, die Mutter, die Gegenstand der höchsten sexuellen Neugierde ist, in die Situation von geheimer Untreue und geheimen Liebesverhältnissen zu bringen. In dieser Weise werden jene ersten gleichsam asexuellen Phantasien auf die Höhe der jetzigen Erkenntnis gebracht.
Übrigens zeigt sich das Motiv der Rache und Vergeltung, das früher im Vordergrunde stand, auch hier. Diese neurotischen Kinder sind es ja auch meist, die bei der Abgewöhnung sexueller Unarten von den Eltern bestraft wurden und die sich nun durch solche Phantasien an ihren Eltern rächen.
Ganz besonders sind es später geborene Kinder, die vor allem ihre Vordermänner durch derartige Dichtungen (ganz wie in historischen Intrigen) ihres Vorzuges berauben, ja die sich oft nicht scheuen, der Mutter ebensoviele Liebesverhältnisse anzudichten, als Konkurrenten vorhanden sind. Eine interessante Variante dieses Familienromans ist es dann, wenn der dichtende Held für sich selbst zur Legitimität zurückkehrt, während er die anderen Geschwister auf diese Art als illegitim beseitigt. Dabei kann noch ein besonderes Interesse den Familienroman dirigieren, der mit seiner Vielseitigkeit und mannigfachen Verwendbarkeit allerlei Bestrebungen entgegenkommt. So beseitigt der kleine Phantast zum Beispiel auf diese Weise die verwandtschaftliche Beziehung zu einer Schwester, die ihn etwa sexuell angezogen hat.
Wer sich von dieser Verderbtheit des kindlichen Gemütes mit Schaudern abwendete, ja selbst die Möglichkeit solcher Dinge bestreiten wollte, dem sei bemerkt, daß alle diese anscheinend so feindseligen Dichtungen eigentlich nicht so böse gemeint sind und unter leichter Verkleidung die erhalten gebliebene ursprüngliche Zärtlichkeit des Kindes für seine Eltern bewahren. Es ist nur scheinbare Treulosigkeit und Undankbarkeit; denn wenn man die häufigste dieser Romanphantasien, den Ersatz beider Eltern oder nur des Vaters durch großartigere Personen, im Detail durchgeht, so macht man die Entdeckung, daß diese neuen und vornehmen Eltern durchwegs mit Zügen ausgestattet sind, die von realen Erinnerungen an die wirklichen niederen Eltern herrühren, so daß das Kind den Vater eigentlich nicht beseitigt, sondern erhöht. Ja, das ganze Bestreben, den wirklichen Vater durch einen vornehmeren zu ersetzen, ist nur der Ausdruck der Sehnsucht des Kindes nach der verlorenen glücklichen Zeit, in der ihm sein Vater als der vornehmste und stärkste Mann, seine Mutter als die liebste und schönste Frau erschienen ist. Er wendet sich vom Vater, den er jetzt erkennt, zurück zu dem, an den er in früheren Kinderjahren geglaubt hat, und die Phantasie ist eigentlich nur der Ausdruck des Bedauerns, daß diese glückliche Zeit entschwunden ist. Die Überschätzung der frühesten Kindheitsjahre tritt also in diesen Phantasien wieder in ihr volles Recht. Ein interessanter Beitrag zu diesem Thema ergibt sich aus dem Studium der Träume. Die Traumdeutung lehrt nämlich, daß auch noch in späteren Jahren in Träumen vom Kaiser oder von der Kaiserin diese erlauchten Persönlichkeiten Vater und Mutter bedeuten [Fußnote]Die Traumdeutung, 8. Aufl., S. 242.. Die kindliche Überschätzung der Eltern ist also auch im Traum des normalen Erwachsenen erhalten.
Der Humor (1927)
In meiner Schrift über den Witz und seine Beziehung zum Unbewußten (1905 c) habe ich den Humor eigentlich nur vom ökonomischen Gesichtspunkt behandelt. Es lag mir daran, die Quelle der Lust am Humor zu finden, und ich meine, ich habe gezeigt, daß der humoristische Lustgewinn aus erspartem Gefühlsaufwand hervorgeht.
Der humoristische Vorgang kann sich in zweierlei Weisen vollziehen, entweder an einer einzigen Person, die selbst die humoristische Einstellung einnimmt, während der zweiten Person die Rolle des Zuschauers und Nutznießers zufällt, oder zwischen zwei Personen, von denen die eine am humoristischen Vorgang gar keinen Anteil hat, die zweite aber diese Person zum Objekt ihrer humoristischen Betrachtung macht. Wenn, um beim gröbsten Beispiel zu verweilen, der Delinquent, der am Montag zum Galgen geführt wird, die Äußerung tut: »Na, die Woche fängt gut an«, so entwickelt er selbst den Humor, der humoristische Vorgang vollendet sich an seiner Person und trägt ihm offenbar eine gewisse Genugtuung ein. Mich, den unbeteiligten Zuhörer, trifft gewissermaßen eine Fernwirkung der humoristischen Leistung des Verbrechers; ich verspüre, vielleicht ähnlich wie er, den humoristischen Lustgewinn.
Der zweite Fall liegt vor, wenn z. B. ein Dichter oder Schilderer das Gehaben von realen oder erfundenen Personen in humoristischer Weise beschreibt. Diese Personen brauchen selbst keinen Humor zu zeigen, die humoristische Einstellung ist allein Sache dessen, der sie zum Objekt nimmt, und der Leser oder Zuhörer wird wiederum wie im vorigen Falle des Genusses am Humor teilhaftig. Zusammenfassend kann man also sagen, man kann die humoristische Einstellung –; worin immer diese bestehen mag –; gegen die eigene oder gegen fremde Personen wenden; es ist anzunehmen, daß sie dem, der es tut, einen Lustgewinn bringt; ein ähnlicher Lustgewinn fällt dem –; unbeteiligten –; Zuhörer zu.
Die Genese des humoristischen Lustgewinns erfassen wir am besten, wenn wir uns dem Vorgang beim Zuhörer zuwenden, vor dem ein anderer Humor entwickelt. Er sieht diesen anderen in einer Situation, die es erwarten läßt, daß er die Anzeichen eines Affekts produzieren wird; er wird sich ärgern, klagen, Schmerz äußern, sich schrecken, grausen, vielleicht selbst verzweifeln, und der Zuschauer-Zuhörer ist bereit, ihm darin zu folgen, die gleichen Gefühlsregungen bei sich entstehen zu lassen. Aber diese Gefühlsbereitschaft wird enttäuscht, der andere äußert keinen Affekt, sondern macht einen Scherz; aus dem ersparten Gefühlsaufwand wird nun beim Zuhörer die humoristische Lust.
So weit kommt man leicht, aber man sagt sich auch bald, daß es der Vorgang beim anderen, beim »Humoristen« ist, der die größere Aufmerksamkeit verdient. Kein Zweifel, das Wesen des Humors besteht darin, daß man sich die Affekte erspart, zu denen die Situation Anlaß gäbe, und sich mit einem Scherz über die Möglichkeit solcher Gefühlsäußerungen hinaussetzt. Insofern muß der Vorgang beim Humoristen mit dem beim Zuhörer übereinstimmen, richtiger gesagt, der Vorgang beim Zuhörer muß den beim Humoristen kopiert haben. Aber wie bringt der Humorist jene psychische Einstellung zustande, die ihm die Affektentbindung überflüssig macht, was geht bei »der humoristischen Einstellung« dynamisch in ihm vor? Offenbar ist die Lösung des Problems beim Humoristen zu suchen, beim Zuhörer ist nur ein Nachklang, eine Kopie dieses unbekannten Prozesses anzunehmen.
Es ist Zeit, daß wir uns mit einigen Charakteren des Humors vertraut machen. Der Humor hat nicht nur etwas Befreiendes wie der Witz und die Komik, sondern auch etwas Großartiges und Erhebendes, welche Züge an den beiden anderen Arten des Lustgewinns aus intellektueller Tätigkeit nicht gefunden werden. Das Großartige liegt offenbar im Triumph des Narzißmus, in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs. Das Ich verweigert es, sich durch die Veranlassungen aus der Realität kränken, zum Leiden nötigen zu lassen, es beharrt dabei, daß ihm die Traumen der Außenwelt nicht nahegehen können, ja es zeigt, daß sie ihm nur Anlässe zu Lustgewinn sind. Dieser letzte Zug ist für den Humor durchaus wesentlich. Nehmen wir an, der am Montag zur Hinrichtung geführte Verbrecher hätte gesagt: Ich mach' mir nichts daraus, was liegt denn daran, wenn ein Kerl wie ich aufgehängt wird, die Welt wird darum nicht zugrunde gehen, –; so müßten wir urteilen, diese Rede enthält zwar diese großartige Überlegenheit über die reale Situation, sie ist weise und berechtigt, aber sie verrät auch nicht die Spur von Humor, ja sie ruht auf einer Einschätzung der Realität, die der des Humors direkt zuwiderläuft. Der Humor ist nicht resigniert, er ist trotzig, er bedeutet nicht nur den Triumph des Ichs, sondern auch den des Lustprinzips, das sich hier gegen die Ungunst der realen Verhältnisse zu behaupten vermag.
Durch diese beiden letzten Züge, die Abweisung des Anspruchs der Realität und die Durchsetzung des Lustprinzips nähert sich der Humor den regressiven oder reaktionären Prozessen, die uns in der Psychopathologie so ausgiebig beschäftigen. Mit seiner Abwehr der Leidensmöglichkeit nimmt er einen Platz ein in der großen Reihe jener Methoden, die das menschliche Seelenleben ausgebildet hat, um sich dem Zwang des Leidens zu entziehen, einer Reihe, die mit der Neurose anhebt, im Wahnsinn gipfelt und in die der Rausch, die Selbstversenkung, die Ekstase einbezogen sind. Der Humor dankt diesem Zusammenhange eine Würde, die z. B. dem Witze völlig abgeht, denn dieser dient entweder nur dem Lustgewinn, oder er stellt den Lustgewinn in den Dienst der Aggression. Worin besteht nun die humoristische Einstellung, durch die man sich dem Leiden verweigert, die Unüberwindlichkeit des Ichs durch die reale Welt betont, das Lustprinzip siegreich behauptet, all dies aber, ohne wie andere Verfahren gleicher Absicht den Boden seelischer Gesundheit aufzugeben? Die beiden Leistungen scheinen doch unvereinbar miteinander.
Wenn wir uns an die Situation wenden, daß sich jemand gegen andere humoristisch einstellt, so liegt die Auffassung nahe, die ich auch bereits im Buch über den Witz zaghaft angedeutet habe, er benehme sich gegen sie wie der Erwachsene gegen das Kind, indem er die Interessen und Leiden, die diesem groß erscheinen, in ihrer Nichtigkeit erkenne und belächle. Der Humorist gewinne also seine Überlegenheit daher, daß er sich in die Rolle des Erwachsenen, gewissermaßen in die Vateridentifizierung begebe und die anderen zu Kindern herabdrücke. Diese Annahme deckt wohl den Sachverhalt, aber sie erscheint kaum zwingend. Man fragt sich, wie kommt der Humorist dazu, sich diese Rolle anzumaßen.
Aber man erinnert sich an die andere, wahrscheinlich ursprünglichere und bedeutsamere Situation des Humors, daß jemand die humoristische Einstellung gegen seine eigene Person richtet, um sich solcherart seiner Leidensmöglichkeiten zu erwehren. Hat es einen Sinn zu sagen, jemand behandle sich selbst wie ein Kind und spiele gleichzeitig gegen dies Kind die Rolle des überlegenen Erwachsenen?
Ich meine, wir geben dieser wenig plausiblen Vorstellung einen starken Rückhalt, wenn wir in Betracht ziehen, was wir aus pathologischen Erfahrungen über die Struktur unseres Ichs gelernt haben. Dieses Ich ist nichts Einfaches, sondern beherbergt als seinen Kern eine besondere Instanz, das Über-Ich, mit dem es manchmal zusammenfließt, so daß wir die beiden nicht zu unterscheiden vermögen, während es sich in anderen Verhältnissen scharf von ihm sondert. Das Über-Ich ist genetisch Erbe der Elterninstanz, es hält das Ich oft in strenger Abhängigkeit, behandelt es wirklich noch, wie einst in frühen Jahren die Eltern –; oder der Vater –; das Kind behandelt haben. Wir erhalten also eine dynamische Aufklärung der humoristischen Einstellung, wenn wir annehmen, sie bestehe darin, daß die Person des Humoristen den psychischen Akzent von ihrem Ich abgezogen und auf ihr Über-Ich verlegt habe. Diesem so geschwellten Über-Ich kann nun das Ich winzig klein erscheinen, alle seine Interessen geringfügig, und es mag dem Über-Ich bei dieser neuen Energieverteilung leicht werden, die Reaktionsmöglichkeiten des Ichs zu unterdrücken.
Unserer gewohnten Ausdrucksweise treu, werden wir anstatt Verlegung des psychischen Akzents zu sagen haben: Verschiebung großer Besetzungsmengen. Es fragt sich dann, ob wir uns solche ausgiebige Verschiebungen von einer Instanz des seelischen Apparats auf eine andere vorstellen dürfen. Es sieht wie eine neue ad hoc gemachte Annahme aus, doch dürfen wir uns erinnern, daß wir wiederholt, wenn auch nicht oft genug, bei unseren Versuchen einer metapsychologischen Vorstellung des seelischen Geschehens mit einem solchen Faktor gerechnet haben. So nahmen wir z. B. an, der Unterschied zwischen einer gewöhnlichen erotischen Objektbesetzung und dem Zustand einer Verliebtheit bestehe darin, daß in letzterem Falle ungleich mehr Besetzung auf das Objekt übergeht, das Ich sich gleichsam nach dem Objekt entleert. Beim Studium einiger Fälle von Paranoia konnte ich feststellen, daß die Verfolgungsideen frühzeitig gebildet werden und lange Zeit bestehen, ohne eine merkliche Wirkung zu äußern, bis sie dann auf einen bestimmten Anlaß hin die Besetzungsgrößen erhalten, die sie dominant werden lassen. Auch die Heilung solcher paranoischer Anfälle dürfte weniger in einer Auflösung und Korrektur der Wahnideen als in der Entziehung der ihnen verliehenen Besetzung bestehen. Die Abwechslung von Melancholie und Manie, von grausamer Unterdrückung des Ichs durch das Über-Ich und von Befreiung des Ichs nach solchem Druck hat uns den Eindruck eines solchen Besetzungswandels gemacht, den man übrigens auch zur Erklärung einer ganzen Reihe von Erscheinungen des normalen Seelenlebens heranziehen müßte. Wenn dies bisher in so geringem Ausmaß geschehen ist, so liegt der Grund dafür in der von uns geübten, eher lobenswerten Zurückhaltung. Das Gebiet, auf dem wir uns sicher fühlen, ist das der Pathologie des Seelenlebens; hier machen wir unsere Beobachtungen, erwerben wir unsere Überzeugungen. Eines Urteils über das Normale getrauen wir uns vorläufig insoweit, als wir in den Isolierungen und Verzerrungen des Krankhaften das Normale erraten. Wenn diese Scheu einmal überwunden ist, werden wir erkennen, eine wie große Rolle für das Verständnis der seelischen Vorgänge den statischen Verhältnissen wie dem dynamischen Wechsel in der Quantität der Energiebesetzung zukommt.
Ich meine also, die hier vorgeschlagene Möglichkeit, daß die Person in einer bestimmten Lage plötzlich ihr Über-Ich überbesetzt und nun von diesem aus die Reaktionen des Ichs abändert, verdient es, festgehalten zu werden. Was ich für den Humor vermute, findet auch eine bemerkenswerte Analogie auf dem verwandten Gebiet des Witzes. Als die Entstehung des Witzes mußte ich annehmen, daß ein vorbewußter Gedanke für einen Moment der unbewußten Bearbeitung überlassen wird, der Witz sei also der Beitrag zur Komik, den das Unbewußte leiste. Ganz ähnlich wäre der Humor der Beitrag zur Komik durch die Vermittlung des Über-Ichs.
Wir kennen das Über-Ich sonst als einen gestrengen Herrn. Man wird sagen, es stimmt schlecht zu diesem Charakter, daß es sich herbeiläßt, dem Ich einen kleinen Lustgewinn zu ermöglichen. Es ist richtig, daß die humoristische Lust nie die Intensität der Lust am Komischen oder am Witz erreicht, sich niemals im herzhaften Lachen ausgibt; es ist auch wahr, daß das Über-Ich, wenn es die humoristische Einstellung herbeiführt, eigentlich die Realität abweist und einer Illusion dient. Aber dieser wenig intensiven Lust schreiben wir –; ohne recht zu wissen warum –; einen hochwertigen Charakter zu, wir empfinden sie als besonders befreiend und erhebend. Der Scherz, den der Humor macht, ist ja auch nicht das Wesentliche, er hat nur den Wert einer Probe; die Hauptsache ist die Absicht, welche der Humor ausführt, ob er sich nun an der eigenen oder an fremden Personen betätigt. Er will sagen: Sieh' her, das ist nun die Welt, die so gefährlich aussieht. Ein Kinderspiel, gerade gut, einen Scherz darüber zu machen!
Wenn es wirklich das Über-Ich ist, das im Humor so liebevoll tröstlich zum eingeschüchterten Ich spricht, so wollen wir daran gemahnt sein, daß wir über das Wesen des Über-Ichs noch allerlei zu lernen haben. Übrigens sind nicht alle Menschen der humoristischen Einstellung fähig, es ist eine köstliche und seltene Begabung, und vielen fehlt selbst die Fähigkeit, die ihnen vermittelte humoristische Lust zu genießen. Und endlich, wenn das Über-Ich durch den Humor das Ich zu trösten und vor Leiden zu bewahren strebt, hat es damit seiner Abkunft von der Elterninstanz nicht widersprochen.
Der Moses des Michelangelo (1914)
Ich schicke voraus, daß ich kein Kunstkenner bin, sondern Laie. Ich habe oft bemerkt, daß mich der Inhalt eines Kunstwerkes stärker anzieht als dessen formale und technische Eigenschaften, auf welche doch der Künstler in erster Linie Wert legt. Für viele Mittel und manche Wirkungen der Kunst fehlt mir eigentlich das richtige Verständnis. Ich muß dies sagen, um mir eine nachsichtige Beurteilung meines Versuches zu sichern.
Aber Kunstwerke üben eine starke Wirkung auf mich aus, insbesondere Dichtungen und Werke der Plastik, seltener Malereien. Ich bin so veranlaßt worden, bei den entsprechenden Gelegenheiten lange vor ihnen zu verweilen, und wollte sie auf meine Weise erfassen, d. h. mir begreiflich machen, wodurch sie wirken. Wo ich das nicht kann, z. B. in der Musik, bin ich fast genußunfähig. Eine rationalistische oder vielleicht analytische Anlage sträubt sich in mir dagegen, daß ich ergriffen sein und dabei nicht wissen solle, warum ich es bin und was mich ergreift.
Ich bin dabei auf die anscheinend paradoxe Tatsache aufmerksam geworden, daß gerade einige der großartigsten und überwältigendsten Kunstschöpfungen unserem Verständnis dunkel geblieben sind. Man bewundert sie, man fühlt sich von ihnen bezwungen, aber man weiß nicht zu sagen, was sie vorstellen. Ich bin nicht belesen genug, um zu wissen, ob dies schon bemerkt worden ist oder ob nicht ein Ästhetiker gefunden hat, solche Ratlosigkeit unseres begreifenden Verstandes sei sogar eine notwendige Bedingung für die höchsten Wirkungen, die ein Kunstwerk hervorrufen soll. Ich könnte mich nur schwer entschließen, an diese Bedingung zu glauben.
Nicht etwa daß die Kunstkenner oder Enthusiasten keine Worte fänden, wenn sie uns ein solches Kunstwerk anpreisen. Sie haben deren genug, sollte ich meinen. Aber vor einer solchen Meisterschöpfung des Künstlers sagt in der Regel jeder etwas anderes und keiner das, was dem schlichten Bewunderer das Rätsel löst. Was uns so mächtig packt, kann nach meiner Auffassung doch nur die Absicht des Künstlers sein, insofern es ihm gelungen ist, sie in dem Werke auszudrücken und von uns erfassen zu lassen. Ich weiß, daß es sich um kein bloß verständnismäßiges Erfassen handeln kann; es soll die Affektlage, die psychische Konstellation, welche beim Künstler die Triebkraft zur Schöpfung abgab, bei uns wieder hervorgerufen werden. Aber warum soll die Absicht des Künstlers nicht angebbar und in Worte zu fassen sein wie irgendeine andere Tatsache des seelischen Lebens? Vielleicht daß dies bei den großen Kunstwerken nicht ohne Anwendung der Analyse gelingen wird. Das Werk selbst muß doch diese Analyse ermöglichen, wenn es der auf uns wirksame Ausdruck der Absichten und Regungen des Künstlers ist. Und um diese Absicht zu erraten, muß ich doch vorerst den Sinn und Inhalt des im Kunstwerk Dargestellten herausfinden, also es deuten können. Es ist also möglich, daß ein solches Kunstwerk der Deutung bedarf und daß ich erst nach Vollziehung derselben erfahren kann, warum ich einem so gewaltigen Eindruck unterlegen bin. Ich hege selbst die Hoffnung, daß dieser Eindruck keine Abschwächung erleiden wird, wenn uns eine solche Analyse geglückt ist.
Nun denke man an den Hamlet, das über dreihundert Jahre alte Meisterstück Shakespeares [Fußnote]Vielleicht 1602 zuerst gespielt.. Ich verfolge die psychoanalytische Literatur und schließe mich der Behauptung an, daß erst die Psychoanalyse durch die Zurückführung des Stoffes auf das Ödipus-Thema das Rätsel der Wirkung dieser Tragödie gelöst hat. Aber vorher, welche Überfülle von verschiedenen, miteinander unverträglichen Deutungsversuchen, welche Auswahl von Meinungen über den Charakter des Helden und die Absichten des Dichters! Hat Shakespeare unsere Teilnahme für einen Kranken in Anspruch genommen oder für einen unzulänglichen Minderwertigen oder für einen Idealisten, der nur zu gut ist für die reale Welt? Und wie viele dieser Deutungen lassen uns so kalt, daß sie für die Erklärung der Wirkung der Dichtung nichts leisten können und uns eher darauf verweisen, deren Zauber allein auf den Eindruck der Gedanken und den Glanz der Sprache zu begründen! Und doch, sprechen nicht gerade diese Bemühungen dafür, daß ein Bedürfnis verspürt wird, eine weitere Quelle dieser Wirkung aufzufinden?'
Ein anderes dieser rätselvollen und großartigen Kunstwerke ist die Marmorstatue des Moses, in der Kirche von S. Pietro in Vincoli zu Rom von Michelangelo aufgestellt, bekanntlich nur ein Teilstück jenes riesigen Grabdenkmals, welches der Künstler für den gewaltigen Papstherrn Julius II. errichten sollte [Fußnote]Nach Henry Thode ist die Statue in den Jahren 1512 bis 1516 ausgeführt worden.. Ich freue mich jedesmal, wenn ich eine Äußerung über diese Gestalt lese wie: sie sei »die Krone der modernen Skulptur« (Herman Grimm). Denn ich habe von keinem Bildwerk je eine stärkere Wirkung erfahren. Wie oft bin ich die steile Treppe vom unschönen Corso Cavour hinaufgestiegen zu dem einsamen Platz, auf dem die verlassene Kirche steht, habe immer versucht, dem verächtlich-zürnenden Blick des Heros standzuhalten, und manchmal habe ich mich dann behutsam aus dem Halbdunkel des Innenraumes geschlichen, als gehörte ich selbst zu dem Gesindel, auf das sein Auge gerichtet ist, das keine Überzeugung festhalten kann, das nicht warten und nicht vertrauen will und jubelt, wenn es die Illusion des Götzenbildes wieder bekommen hat.
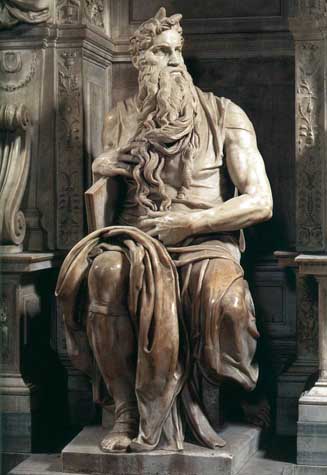
Michelangelo: Mosesstatue
Aber warum nenne ich diese Statue rätselvoll? Es besteht nicht der leiseste Zweifel, daß sie Moses darstellt, den Gesetzgeber der Juden, der die Tafeln mit den heiligen Geboten hält. Soviel ist sicher, aber auch nichts darüber hinaus. Ganz kürzlich erst (1912) hat ein Kunstschriftsteller (Max Sauerlandt) den Ausspruch machen können: »Über kein Kunstwerk der Welt sind so widersprechende Urteile gefällt worden wie über diesen panköpfigen Moses. Schon die einfache Interpretation der Figur bewegt sich in vollkommenen Widersprüchen ...« An der Hand einer Zusammenstellung, die nur um fünf Jahre zurückliegt, werde ich darlegen, welche Zweifel sich an die Auffassung der Figur des Moses knüpfen, und es wird nicht schwer sein zu zeigen, daß hinter ihnen das Wesentliche und Beste zum Verständnis dieses Kunstwerkes verhüllt liegt [Fußnote]Thode (1908)..
I
Der Moses des Michelangelo ist sitzend dargestellt, den Rumpf nach vorne gerichtet, den Kopf mit dem mächtigen Bart und den Blick nach links gewendet, den rechten Fuß auf dem Boden ruhend, den linken aufgestellt, so daß er nur mit den Zehen den Boden berührt, den rechten Arm mit den Tafeln und einem Teil des Bartes in Beziehung; der linke Arm ist in den Schoß gelegt. Wollte ich eine genauere Beschreibung geben, so müßte ich dem vorgreifen, was ich später vorzubringen habe. Die Beschreibungen der Autoren sind mitunter in merkwürdiger Weise unzutreffend. Was nicht verstanden war, wurde auch ungenau wahrgenommen oder wiedergegeben. H. Grimm sagt, daß die rechte Hand, »unter deren Arme die Gesetzestafeln ruhen, in den Bart greife«. Ebenso W. Lübke: »Erschüttert greift er mit der Rechten in den herrlich herabflutenden Bart ...«; Springer: »Die eine (linke) Hand drückt Moses an den Leib, mit der anderen greift er wie unbewußt in den mächtig wallenden Bart.« C. Justi findet, daß die Finger der (rechten) Hand mit dem Bart spielen, »wie der zivilisierte Mensch in der Aufregung mit der Uhrkette«. Das Spielen mit dem Bart hebt auch Müntz hervor. H. Thode spricht von der »ruhig festen Haltung der rechten Hand auf den aufgestemmten Tafeln«. Selbst in der rechten Hand erkennt er nicht ein Spiel der Aufregung, wie Justi und ähnlich Boito wollen. »Die Hand verharrt so, wie sie den Bart greifend, gehalten ward, ehe der Titan den Kopf zur Seite wandte.« Jakob Burkhardt stellt aus, »daß der berühmte linke Arm im Grunde nichts anderes zu tun habe, als diesen Bart an den Leib zu drücken«.
Wenn die Beschreibungen nicht übereinstimmen, werden wir uns über die Verschiedenheit in der Auffassung einzelner Züge der Statue nicht verwundern. Ich meine zwar, wir können den Gesichtsausdruck des Moses nicht besser charakterisieren als Thode, der eine »Mischung von Zorn, Schmerz und Verachtung« aus ihm las, »den Zorn in den dräuend zusammengezogenen Augenbrauen, den Schmerz in dem Blick der Augen, die Verachtung in der vorgeschobenen Unterlippe und den herabgezogenen Mundwinkeln«. Aber andere Bewunderer müssen mit anderen Augen gesehen haben. So hatte Dupaty geurteilt: Ce front auguste semble n'être qu'un voile transparent, qui couvre à peine un esprit immense[Fußnote]Bei Thode, l. c, 197.. Dagegen meint Lübke: »In dem Kopfe würde man vergebens den Ausdruck höherer Intelligenz suchen; nichts als die Fähigkeit eines ungeheuren Zornes, einer alles durchsetzenden Energie spricht sich in der zusammengedrängten Stirne aus.« Noch weiter entfernt sich in der Deutung des Gesichtsausdruckes Guillaume (1876), der keine Erregung darin fand, »nur stolze Einfachheit, beseelte Würde, Energie des Glaubens. Moses' Blick gehe in die Zukunft, er sehe die Dauer seiner Rasse, die Unveränderlichkeit seines Gesetzes voraus.« Ähnlich läßt Müntz »die Blicke Moses' weit über das Menschengeschlecht hinschweifen; sie seien auf die Mysterien gerichtet, die er als Einziger gewahrt hat«. Ja, für Steinmann ist dieser Moses »nicht mehr der starre Gesetzgeber, nicht mehr der fürchterliche Feind der Sünde mit dem Jehovazorn, sondern der königliche Priester, welchen das Alter nicht berühren darf, der segnend und weissagend, den Abglanz der Ewigkeit auf der Stirne, von seinem Volke den letzten Abschied nimmt«.
Es hat noch andere gegeben, denen der Moses des Michelangelo überhaupt nichts sagte und die ehrlich genug waren, es zu äußern. So ein Rezensent in der Quarterly Review 1858: » There is an absence of meaning in the general conception, which precludes the idea of a self-sufficing whole ...« Und man ist erstaunt zu erfahren, daß noch andere nichts an dem Moses zu bewundern fanden, sondern sich auflehnten gegen ihn, die Brutalität der Gestalt anklagten und die Tierähnlichkeit des Kopfes.
Hat der Meister wirklich so undeutliche oder zweideutige Schrift in den Stein geschrieben, daß so verschiedenartige Lesungen möglich wurden?
Es erhebt sich aber eine andere Frage, welcher sich die erwähnten Unsicherheiten leicht unterordnen. Hat Michelangelo in diesem Moses ein »zeitloses Charakter- und Stimmungsbild« schaffen wollen, oder hat er den Helden in einem bestimmten, dann aber höchst bedeutsamen Moment seines Lebens dargestellt? Eine Mehrzahl von Beurteilern entscheidet sich für das letztere und weiß auch die Szene aus dem Leben Moses' anzugeben, welche der Künstler für die Ewigkeit festgebannt hat. Es handelt sich hier um die Herabkunft vom Sinai, woselbst er die Gesetzestafeln von Gott in Empfang genommen hat, und um die Wahrnehmung, daß die Juden unterdes ein goldenes Kalb gemacht haben, das sie jubelnd umtanzen. Auf dieses Bild ist sein Blick gerichtet, dieser Anblick ruft die Empfindungen hervor, die in seinen Mienen ausgedrückt sind und die gewaltige Gestalt alsbald in die heftigste Aktion versetzen werden. Michelangelo hat den Moment der letzten Zögerung, der Ruhe vor dem Sturm, zur Darstellung gewählt; im nächsten wird Moses aufspringen –; der linke Fuß ist schon vom Boden abgehoben –; die Tafeln zu Boden schmettern und seinen Grimm über die Abtrünnigen entladen.
In Einzelheiten dieser Deutung weichen auch deren Vertreter voneinander ab.
Jak. Burkhardt: »Moses scheint in dem Momente dargestellt, da er die Verehrung des goldenen Kalbes erblickt und aufspringen will. Es lebt in seiner Gestalt die Vorbereitung zu einer gewaltigen Bewegung, wie man sie von der physischen Macht, mit der er ausgestattet ist, nur mit Zittern erwarten mag.«
W. Lübke: »Als sähen die blitzenden Augen eben den Frevel der Verehrung des goldenen Kalbes, so gewaltsam durchzuckt eine innere Bewegung die ganze Gestalt. Erschüttert greift er mit der Rechten in den herrlich herabflutenden Bart, als wolle er seiner Bewegung noch einen Augenblick Herr bleiben, um dann um so zerschmetternder loszufahren.«
Springer schließt sich dieser Ansicht an, nicht ohne ein Bedenken vorzutragen, welches weiterhin noch unsere Aufmerksamkeit beanspruchen wird: »Durchglüht von Kraft und Eifer kämpft der Held nur mühsam die innere Erregung nieder ... Man denkt daher unwillkürlich an eine dramatische Szene und meint, Moses sei in dem Augenblick dargestellt, wie er die Verehrung des goldenen Kalbes erblickt und im Zorn aufspringen will. Diese Vermutung trifft zwar schwerlich die wahre Absicht des Künstlers, da ja Moses, wie die übrigen fünf sitzenden Statuen des Oberbaues [Fußnote]Vom Grabdenkmal des Papstes nämlich. vorwiegend dekorativ wirken sollte; sie darf aber als ein glänzendes Zeugnis für die Lebensfülle und das persönliche Wesen der Mosesgestalt gelten.«
Einige Autoren, die sich nicht gerade für die Szene des goldenen Kalbes entscheiden, treffen doch mit dieser Deutung in dem wesentlichen Punkte zusammen, daß dieser Moses im Begriffe sei aufzuspringen und zur Tat überzugehen.
Herman Grimm: »Eine Hoheit erfüllt sie« (diese Gestalt), »ein Selbstbewußtsein, ein Gefühl, als stünden diesem Manne die Donner des Himmels zu Gebote, doch er bezwänge sich, ehe er sie entfesselte, erwartend, ob die Feinde, die er vernichten will, ihn anzugreifen wagten. Er sitzt da, als wollte er eben aufspringen, das Haupt stolz aus den Schultern in die Höhe gereckt, mit der Hand, unter deren Arme die Gesetzestafeln ruhen, in den Bart greifend, der in schweren Strömen auf die Brust sinkt, mit weit atmenden Nüstern und mit einem Munde, auf dessen Lippen die Worte zu zittern scheinen.«
Heath Wilson sagt, Moses' Aufmerksamkeit sei durch etwas erregt, er sei im Begriffe aufzuspringen, doch zögere er noch. Der Blick, in dem Entrüstung und Verachtung gemischt seien, könne sich noch in Mitleid verändern.
Wölfflin spricht von »gehemmter Bewegung«. Der Hemmungsgrund liegt hier im Willen der Person selbst, es ist der letzte Moment des Ansichhaltens vor dem Losbrechen, d. h. vor dem Aufspringen.
Am eingehendsten hat C. Justi die Deutung auf die Wahrnehmung des goldenen Kalbes begründet und sonst nicht beachtete Einzelheiten der Statue in Zusammenhang mit dieser Auffassung gebracht. Er lenkt unseren Blick auf die in der Tat auffällige Stellung der beiden Gesetzestafeln, welche im Begriffe seien, auf den Steinsitz herabzugleiten: »Er« (Moses) »könnte also entweder in der Richtung des Lärmes schauen mit dem Ausdruck böser Ahnungen, oder es wäre der Anblick des Gräuels selbst, der ihn wie ein betäubender Schlag trifft. Durchbebt von Abscheu und Schmerz hat er sich niedergelassen [Fußnote]Es ist zu bemerken, daß die sorgfältige Anordnung des Mantels um die Beine der sitzenden Gestalt dieses erste Stück der Auslegung Justis unhaltbar macht. Man müßte vielmehr annehmen, es sei dargestellt, wie Moses im ruhigen erwartungslosen Dasitzen durch eine plötzliche Wahrnehmung aufgeschreckt werde.. Er war auf dem Berge vierzig Tage und Nächte geblieben, also ermüdet. Das Ungeheure, ein großes Schicksal, Verbrechen, selbst ein Glück kann zwar in einem Augenblick wahrgenommen, aber nicht gefaßt werden nach Wesen, Tiefe, Folgen. Einen Augenblick scheint ihm sein Werk zerstört, er verzweifelt an diesem Volke. In solchen Augenblicken verrät sich der innere Aufruhr in unwillkürlichen kleinen Bewegungen. Er läßt die beiden Tafeln, die er in der Rechten hielt, auf den Steinsitz herabrutschen, sie sind über Eck zu stehen gekommen, vom Unterarm an die Seite der Brust gedrückt. Die Hand aber fährt an Brust und Bart, bei der Wendung des Halses nach rechts muß sie den Bart nach der linken Seite ziehen und die Symmetrie dieser breiten männlichen Zierde aufheben; es sieht aus, als spielten die Finger mit dem Bart, wie der zivilisierte Mensch in der Aufregung mit der Uhrkette. Die Linke gräbt sich in den Rock am Bauch (im alten Testament sind die Eingeweide Sitz der Affekte). Aber das linke Bein ist bereits zurückgezogen und das rechte vorgesetzt; im nächsten Augenblick wird er auffahren, die psychische Kraft von der Empfindung auf den Willen überspringen, der rechte Arm sich bewegen, die Tafeln werden zu Boden fallen und Ströme Blutes die Schmach des Abfalls sühnen ...« »Es ist hier noch nicht der Spannungsmoment der Tat. Noch waltet der Seelenschmerz fast lähmend.«
Ganz ähnlich äußert sich Fritz Knapp; nur daß er die Eingangssituation dem vorhin geäußerten Bedenken entzieht, auch die angedeutete Bewegung der Tafeln konsequenter weiterführt: »Ihn, der soeben noch mit seinem Gotte allein war, lenken irdische Geräusche ab. Er hört Lärm, das Geschrei von gesungenen Tanzreigen weckt ihn aus dem Traume. Das Auge, der Kopf wenden sich hin zu dem Geräusch. Schrecken, Zorn, die ganze Furie wilder Leidenschaften durchfahren im Moment die Riesengestalt. Die Gesetzestafeln fangen an herabzugleiten, sie werden zur Erde fallen und zerbrechen, wenn die Gestalt auffährt, um die donnernden Zornesworte in die Massen des abtrünnigen Volkes zu schleudern ... Dieser Moment höchster Spannung ist gewählt ...« Knapp betont also die Vorbereitung zur Handlung und bestreitet die Darstellung der anfänglichen Hemmung infolge der übergewaltigen Erregung.
Wir werden nicht in Abrede stellen, daß Deutungsversuche wie die letzterwähnten von Justi und Knapp etwas ungemein Ansprechendes haben. Sie verdanken diese Wirkung dem Umstande, daß sie nicht bei dem Gesamteindruck der Gestalt stehenbleiben, sondern einzelne Charaktere derselben würdigen, welche man sonst, von der Allgemeinwirkung überwältigt und gleichsam gelähmt, zu beachten versäumt. Die entschiedene Seitenwendung von Kopf und Augen der im übrigen nach vorne gerichteten Figur stimmt gut zu der Annahme, daß dort etwas erblickt wird, was plötzlich die Aufmerksamkeit des Ruhenden auf sich zieht. Der vom Boden abgehobene Fuß läßt kaum eine andere Deutung zu als die einer Vorbereitung zum Aufspringen [Fußnote]Obwohl der linke Fuß des ruhig sitzenden Giuliano in der Medicikapelle ähnlich abgehoben ist., und die ganz sonderbare Haltung der Tafeln, die doch etwas Hochheiliges sind und nicht wie ein beliebiges Beiwerk irgendwie im Raum untergebracht werden dürfen, findet ihre gute Aufklärung in der Annahme, sie glitten infolge der Erregung ihres Trägers herab und würden dann zu Boden fallen. So wüßten wir also, daß diese Statue des Moses einen bestimmten bedeutsamen Moment aus dem Leben des Mannes darstellt, und wären auch nicht in Gefahr, diesen Moment zu verkennen.
Allein zwei Bemerkungen von Thode entreißen uns wieder, was wir schon zu besitzen glaubten. Dieser Beobachter sagt, er sehe die Tafeln nicht herabgleiten, sondern »fest verharren«. Er konstatiert »die ruhig feste Haltung der rechten Hand auf den aufgestemmten Tafeln«. Blicken wir selbst hin, so müssen wir Thode ohne Rückhalt recht geben. Die Tafeln sind festgestellt und nicht in Gefahr zu gleiten. Die rechte Hand stützt sie oder stützt sich auf sie. Dadurch ist ihre Aufstellung zwar nicht erklärt, aber sie wird für die Deutung von Justi und anderen unverwendbar.
Eine zweite Bemerkung trifft noch entscheidender. Thode mahnt daran, daß »diese Statue als eine von sechsen gedacht war und daß sie sitzend dargestellt ist. Beides widerspricht der Annahme, Michelangelo habe einen bestimmten historischen Moment fixieren wollen. Denn, was das erste anbetrifft, so schloß die Aufgabe, nebeneinander sitzende Figuren als Typen menschlichen Wesens ( Vita activa! Vita contemplativa!) zu geben, die Vorstellung einzelner historischer Vorgänge aus. Und bezüglich des zweiten widerspricht die Darstellung des Sitzens, welche durch die gesamte künstlerische Konzeption des Denkmals bedingt war, dem Charakter jenes Vorganges, nämlich dem Herabsteigen vom Berge Sinai zu dem Lager«.
Machen wir uns dies Bedenken Thodes zu eigen; ich meine, wir werden seine Kraft noch steigern können. Der Moses sollte mit fünf (in einem späteren Entwurf drei) anderen Statuen das Postament des Grabmals zieren. Sein nächstes Gegenstück hätte ein Paulus werden sollen. Zwei der anderen, die Vita activa und contemplativa sind als Lea und Rahel an dem heute vorhandenen, kläglich verkümmerten Monument ausgeführt worden, allerdings stehend. Diese Zugehörigkeit des Moses zu einem Ensemble macht die Annahme unmöglich, daß die Figur in dem Beschauer die Erwartung erwecken solle, sie werde nun gleich von ihrem Sitze aufspringen, etwa davonstürmen und auf eigene Faust Lärm schlagen. Wenn die anderen Figuren nicht gerade auch in der Vorbereitung zu so heftiger Aktion dargestellt waren –; was sehr unwahrscheinlich ist –;, so würde es den übelsten Eindruck machen, wenn gerade die eine uns die Illusion geben könnte, sie werde ihren Platz und ihre Genossen verlassen, also sich ihrer Aufgabe im Gefüge des Denkmals entziehen. Das ergäbe eine grobe Inkohärenz, die man dem großen Künstler nicht ohne die äußerste Nötigung zumuten dürfte. Eine in solcher Art davonstürmende Figur wäre mit der Stimmung, welche das ganze Grabmonument erwecken soll, aufs äußerste unverträglich.
Also dieser Moses darf nicht aufspringen wollen, er muß in hehrer Ruhe verharren können wie die anderen Figuren, wie das beabsichtigte (dann nicht von Michelangelo ausgeführte) Bild des Papstes selbst. Dann aber kann der Moses, den wir betrachten, nicht die Darstellung des von Zorn erfaßten Mannes sein, der vom Sinai herabkommend, sein Volk abtrünnig findet und die heiligen Tafeln hinwirft, daß sie zerschmettern. Und wirklich, ich weiß mich an meine Enttäuschung zu erinnern, wenn ich bei früheren Besuchen in S. Pietro in Vincoli mich vor die Statue hinsetzte in der Erwartung, ich werde nun sehen, wie sie auf dem aufgestellten Fuß emporschnellen, wie sie die Tafeln zu Boden schleudern und ihren Zorn entladen werde. Nichts davon geschah; anstatt dessen wurde der Stein immer starrer, eine fast erdrückende heilige Stille ging von ihm aus, und ich mußte fühlen, hier sei etwas dargestellt, was unverändert so bleiben könne, dieser Moses werde ewig so dasitzen und so zürnen.
Wenn wir aber die Deutung der Statue mit dem Moment vor dem losbrechenden Zorn beim Anblick des Götzenbildes aufgeben müssen, so bleibt uns wenig mehr übrig, als eine der Auffassungen anzunehmen, welche in diesem Moses ein Charakterbild erkennen wollen. Am ehesten von Willkür frei und am besten auf die Analyse der Bewegungsmotive der Gestalt gestützt erscheint dann das Urteil von Thode: »Hier, wie immer, ist es ihm um die Gestaltung eines Charaktertypus zu tun. Er schafft das Bild eines leidenschaftlichen Führers der Menschheit, der, seiner göttlichen gesetzgebenden Aufgabe bewußt, dem unverständigen Widerstand der Menschen begegnet. Einen solchen Mann der Tat zu kennzeichnen, gab es kein anderes Mittel, als die Energie des Willens zu verdeutlichen, und dies war möglich durch die Veranschaulichung einer die scheinbare Ruhe durchdringenden Bewegung, wie sie in der Wendung des Kopfes, der Anspannung der Muskeln, der Stellung des linken Beines sich äußert. Es sind dieselben Erscheinungen wie bei dem vir activus der Medicikapelle Giuliano. Diese allgemeine Charakteristik wird weiter vertieft durch die Hervorhebung des Konfliktes, in welchen ein solcher die Menschheit gestaltender Genius zu der Allgemeinheit tritt: die Affekte des Zornes, der Verachtung, des Schmerzes gelangen zu typischem Ausdruck. Ohne diesen war das Wesen eines solchen Übermenschen nicht zu verdeutlichen. Nicht ein Historienbild, sondern einen Charaktertypus unüberwindlicher Energie, welche die widerstrebende Welt bändigt, hat Michelangelo geschaffen, die in der Bibel gegebenen Züge, die eigenen inneren Erlebnisse, Eindrücke der Persönlichkeit Julius', und wie ich glaube auch solche der Savonarolaschen Kampfestätigkeit gestaltend.«
In die Nähe dieser Ausführungen kann man etwa die Bemerkung von Knackfuß rücken: Das Hauptgeheimnis der Wirkung des Moses liege in dem künstlerischen Gegensatz zwischen dem inneren Feuer und der äußerlichen Ruhe der Haltung.
Ich finde nichts in mir, was sich gegen die Erklärung von Thode sträuben würde, aber ich vermisse irgend etwas. Vielleicht, daß sich ein Bedürfnis äußert nach einer innigeren Beziehung zwischen dem Seelenzustand des Helden und dem in seiner Haltung ausgedrückten Gegensatz von »scheinbarer Ruhe« und »innerer Bewegtheit«.
II
Lange bevor ich etwas von der Psychoanalyse hören konnte, erfuhr ich, daß ein russischer Kunstkenner, Ivan Lermolieff, dessen erste Aufsätze 1874 bis 1876 in deutscher Sprache veröffentlicht wurden, eine Umwälzung in den Galerien Europas hervorgerufen hatte, indem er die Zuteilung vieler Bilder an die einzelnen Maler revidierte, Kopien von Originalen mit Sicherheit unterscheiden lehrte und aus den von ihren früheren Bezeichnungen frei gewordenen Werken neue Künstlerindividualitäten konstruierte. Er brachte dies zustande, indem er vom Gesamteindruck und von den großen Zügen eines Gemäldes absehen hieß und die charakteristische Bedeutung von untergeordneten Details hervorhob, von solchen Kleinigkeiten wie die Bildung der Fingernägel, der Ohrläppchen, des Heiligenscheines und anderer unbeachteter Dinge, die der Kopist nachzuahmen vernachlässigt und die doch jeder Künstler in einer ihn kennzeichnenden Weise ausführt. Es hat mich dann sehr interessiert zu erfahren, daß sich hinter dem russischen Pseudonym ein italienischer Arzt, namens Morelli, verborgen hatte. Er ist 1891 als Senator des Königreiches Italien gestorben. Ich glaube, sein Verfahren ist mit der Technik der ärztlichen Psychoanalyse nahe verwandt. Auch diese ist gewöhnt, aus geringgeschätzten oder nicht beachteten Zügen, aus dem Abhub –; dem » refuse« –; der Beobachtung, Geheimes und Verborgenes zu erraten.
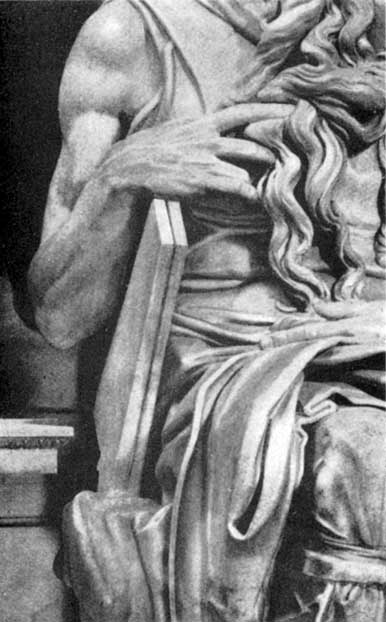
Michelangelo: Mosesstatue –; Detail
An zwei Stellen der Mosesfigur finden sich nun Details, die bisher nicht beachtet, ja eigentlich noch nicht richtig beschrieben worden sind. Sie betreffen die Haltung der rechten Hand und die Stellung der beiden Tafeln. Man darf sagen, daß diese Hand in sehr eigentümlicher, gezwungener, Erklärung heischender Weise zwischen den Tafeln und dem –; Bart des zürnenden Helden vermittelt. Es ist gesagt worden, daß sie mit den Fingern im Barte wühlt, mit den Strängen desselben spielt, während sie sich mit dem Kleinfingerrand auf die Tafeln stützt. Aber dies trifft offenbar nicht zu. Es verlohnt sich, sorgfältiger ins Auge zu fassen, was die Finger dieser rechten Hand tun, und den mächtigen Bart, zu dem sie in Beziehung treten, genau zu beschreiben.
Man sieht dann mit aller Deutlichkeit: Der Daumen dieser Hand ist versteckt, der Zeigefinger, und dieser allein, ist mit dem Bart in wirksamer Berührung. Er drückt sich so tief in die weichen Haarmassen ein, daß sie ober und unter ihm (kopfwärts und bauchwärts vom drückenden Finger) über sein Niveau hervorquellen. Die anderen drei Finger stemmen sich, in den kleinen Gelenken gebeugt, an die Brustwand, sie werden von der äußersten rechten Flechte des Bartes, die über sie hinwegsetzt, bloß gestreift. Sie haben sich dem Barte sozusagen entzogen. Man kann also nicht sagen, die rechte Hand spiele mit dem Bart oder wühle in ihm; nichts anderes ist richtig, als daß der eine Zeigefinger über einen Teil des Bartes gelegt ist und eine tiefe Rinne in ihm hervorruft. Mit einem Finger auf seinen Bart drücken, ist gewiß eine sonderbare und schwer verständliche Geste.
Der viel bewunderte Bart des Moses läuft von Wangen, Oberlippe und Kinn in einer Anzahl von Strängen herab, die man noch in ihrem Verlauf voneinander unterscheiden kann. Einer der äußersten rechten Haarsträhne, der von der Wange ausgeht, läuft auf den oberen Rand des lastenden Zeigefingers zu, von dem er aufgehalten wird. Wir können annehmen, er gleitet zwischen diesem und dem verdeckten Daumen weiter herab. Der ihm entsprechende Strang der linken Seite fließt fast ohne Ablenkung bis weit auf die Brust herab. Die dicke Haarmasse nach innen von diesem letzteren Strang, von ihm bis zur Mittellinie reichend, hat das auffälligste Schicksal erfahren. Sie kann der Wendung des Kopfes nach links nicht folgen, sie ist genötigt, einen sich weich aufrollenden Bogen, ein Stück einer Guirlande, zu bilden, welche die inneren rechten Haarmassen überkreuzt. Sie wird nämlich von dem Druck des rechten Zeigefingers festgehalten, obwohl sie links von der Mittellinie entsprungen ist und eigentlich den Hauptanteil der linken Barthälfte darstellt. Der Bart erscheint so in seiner Hauptmasse nach rechts geworfen, obwohl der Kopf scharf nach links gewendet ist. An der Stelle, wo der rechte Zeigefinger sich eindrückt, hat sich etwas wie ein Wirbel von Haaren gebildet; hier liegen Stränge von links über solchen von rechts, beide durch den gewalttätigen Finger komprimiert. Erst jenseits von dieser Stelle brechen die von ihrer Richtung abgelenkten Haarmassen frei hervor, um nun senkrecht herabzulaufen, bis ihre Enden von der im Schoß ruhenden, geöffneten linken Hand aufgenommen werden.
Ich gebe mich keiner Täuschung über die Einsichtlichkeit meiner Beschreibung hin und getraue mich keines Urteils darüber, ob uns der Künstler die Auflösung jenes Knotens im Bart wirklich leicht gemacht hat. Aber über diesen Zweifel hinweg bleibt die Tatsache bestehen, daß der Druck des Zeigefingers der rechten Hand hauptsächlich Haarstränge der linken Barthälfte betrifft und daß durch diese übergreifende Einwirkung der Bart zurückgehalten wird, die Wendung des Kopfes und Blickes nach der linken Seite mitzumachen. Nun darf man fragen, was diese Anordnung bedeuten soll und welchen Motiven sie ihr Dasein verdankt. Wenn es wirklich Rücksichten der Linienführung und Raumausfüllung waren, die den Künstler dazu bewogen haben, die herabwallende Bartmasse des nach links schauenden Moses nach rechts herüber zu streichen, wie sonderbar ungeeignet erscheint als Mittel hiefür der Druck des einen Fingers? Und wer, der aus irgendeinem Grund seinen Bart auf die andere Seite gedrängt hat, würde dann darauf verfallen, durch den Druck eines Fingers die eine Barthälfte über der anderen zu fixieren? Vielleicht aber bedeuten diese im Grunde geringfügigen Züge nichts, und wir zerbrechen uns den Kopf über Dinge, die dem Künstler gleichgültig waren?
Setzen wir unter der Voraussetzung fort, daß auch diese Details eine Bedeutung haben. Es gibt dann eine Lösung, welche die Schwierigkeiten aufhebt und uns einen neuen Sinn ahnen läßt. Wenn an der Figur des Moses die linken Bartstränge unter dem Druck des rechten Zeigefingers liegen, so läßt sich dies vielleicht als der Rest einer Beziehung zwischen der rechten Hand und der linken Barthälfte verstehen, welche in einem früheren Momente als dem dargestellten eine weit innigere war. Die rechte Hand hatte vielleicht den Bart weit energischer angefaßt, war bis zum linken Rand desselben vorgedrungen, und als sie sich in die Haltung zurückzog, welche wir jetzt an der Statue sehen, folgte ihr ein Teil des Bartes nach und legt nun Zeugnis ab von der Bewegung, die hier abgelaufen ist. Die Bartguirlande wäre die Spur des von dieser Hand zurückgelegten Weges.
So hätten wir also eine Rückbewegung der rechten Hand erschlossen. Die eine Annahme nötigt uns andere wie unvermeidlich auf. Unsere Phantasie vervollständigt den Vorgang, von dem die durch die Bartspur bezeugte Bewegung ein Stück ist, und führt uns zwanglos zur Auffassung zurück, welche den ruhenden Moses durch den Lärm des Volkes und den Anblick des goldenen Kalbes aufschrecken läßt. Er saß ruhig da, den Kopf mit dem herabwallenden Bart nach vorne gerichtet, die Hand hatte wahrscheinlich nichts mit dem Barte zu tun. Da schlägt das Geräusch an sein Ohr, er wendet Kopf und Blick nach der Richtung, aus der die Störung kommt, erschaut die Szene und versteht sie. Nun packen ihn Zorn und Empörung, er möchte aufspringen, die Frevler bestrafen, vernichten. Die Wut, die sich von ihrem Objekt noch entfernt weiß, richtet sich unterdes als Geste gegen den eigenen Leib. Die ungeduldige, zur Tat bereite Hand greift nach vorne in den Bart, welcher der Wendung des Kopfes gefolgt war, preßt ihn mit eisernem Griffe zwischen Daumen und Handfläche mit den zusammenschließenden Fingern, eine Gebärde von einer Kraft und Heftigkeit, die an andere Darstellungen Michelangelos erinnern mag. Dann aber tritt, wir wissen noch nicht wie und warum, eine Änderung ein, die vorgestreckte, in den Bart versenkte Hand wird eilig zurückgezogen, ihr Griff gibt den Bart frei, die Finger lösen sich von ihm, aber so tief waren sie in ihn eingegraben, daß sie bei ihrem Rückzug einen mächtigen Strang von der linken Seite nach rechts herüberziehen, wo er unter dem Druck des einen, längsten und obersten Fingers die rechten Bartflechten überlagern muß. Und diese neue Stellung, die nur durch die Ableitung aus der ihr vorhergehenden verständlich ist, wird jetzt festgehalten.
Es ist Zeit, uns zu besinnen. Wir haben angenommen, daß die rechte Hand zuerst außerhalb des Bartes war, daß sie sich dann in einem Moment hoher Affektspannung nach links herüberstreckte, um den Bart zu packen, und daß sie endlich wieder zurückfuhr, wobei sie einen Teil des Bartes mitnahm. Wir haben mit dieser rechten Hand geschaltet, als ob wir frei über sie verfügen dürften. Aber dürfen wir dies? Ist diese Hand denn frei? Hat sie nicht die heiligen Tafeln zu halten oder zu tragen, sind ihr solche mimische Exkursionen nicht durch ihre wichtige Aufgabe untersagt? Und weiter, was soll sie zu der Rückbewegung veranlassen, wenn sie einem starken Motiv gefolgt war, um ihre anfängliche Lage zu verlassen?
Das sind nun wirklich neue Schwierigkeiten. Allerdings gehört die rechte Hand zu den Tafeln. Wir können hier auch nicht in Abrede stellen, daß uns ein Motiv fehlt, welches die rechte Hand zu dem erschlossenen Rückzug veranlassen könnte. Aber wie wäre es, wenn sich beide Schwierigkeiten miteinander lösen ließen und erst dann einen ohne Lücke verständlichen Vorgang ergeben würden? Wenn gerade etwas, was an den Tafeln geschieht, uns die Bewegungen der Hand aufklärte?

An diesen Tafeln ist einiges zu bemerken, was bisher der Beobachtung nicht wert gefunden wurde. Man sagte: Die Hand stützt sich auf die Tafeln oder: die Hand stützt die Tafeln. Man sieht auch ohneweiters die beiden rechteckigen, aneinander gelegten Tafeln auf der Kante stehen. Schaut man näher zu, so findet man, daß der untere Rand der Tafeln anders gebildet ist als der obere, schräg nach vorne geneigte. Dieser obere ist geradlinig begrenzt, der untere aber zeigt in seinem vordem Anteil einen Vorsprung wie ein Horn, und gerade mit diesem Vorsprung berühren die Tafeln den Steinsitz. Was kann die Bedeutung dieses Details sein, welches übrigens an einem großen Gipsabguß in der Sammlung der Wiener Akademie der bildenden Künste ganz unrichtig wiedergegeben ist? Es ist kaum zweifelhaft, daß dieses Horn den der Schrift nach oberen Rand der Tafeln auszeichnen soll. Nur der obere Rand solcher rechteckigen Tafeln pflegt abgerundet oder ausgeschweift zu sein. Die Tafeln stehen also hier auf dem Kopf. Das ist nun eine sonderbare Behandlung so heiliger Gegenstände. Sie sind auf den Kopf gestellt und werden fast auf einer Spitze balanciert. Welches formale Moment kann bei dieser Gestaltung mitwirken? Oder soll auch dieses Detail dem Künstler gleichgültig gewesen sein?
Da stellt sich nun die Auffassung ein, daß auch die Tafeln durch eine abgelaufene Bewegung in diese Position gekommen sind, daß diese Bewegung abhängig war von der erschlossenen Ortsveränderung der rechten Hand und daß sie dann ihrerseits diese Hand zu ihrer späteren Rückbewegung gezwungen hat. Die Vorgänge an der Hand und die an den Tafeln setzen sich zu folgender Einheit zusammen: Anfänglich, als die Gestalt in Ruhe dasaß, trug sie die Tafeln aufrecht unter dem rechten Arm. Die rechte Hand faßte deren untere Ränder und fand dabei eine Stütze an dem nach vorn gerichteten Vorsprung. Diese Erleichterung des Tragens erklärt ohneweiters, warum die Tafeln umgekehrt gehalten waren. Dann kam der Moment, in dem die Ruhe durch das Geräusch gestört wurde. Moses wendete den Kopf hin, und als er die Szene erschaut hatte, machte sich der Fuß zum Aufspringen bereit, die Hand ließ ihren Griff an den Tafeln los und fuhr nach links und oben in den Bart, wie um ihr Ungestüm am eigenen Leibe zu betätigen. Die Tafeln waren nun dem Druck des Armes anvertraut, der sie an die Brustwand pressen sollte. Aber diese Fixierung reichte nicht aus, sie begannen nach vorn und unten zu gleiten, der früher horizontal gehaltene obere Rand richtete sich nach vorn und abwärts, der seiner Stütze beraubte untere Rand näherte sich mit seiner vorderen Spitze dem Steinsitz. Einen Augenblick weiter, und die Tafeln hätten sich um den neu gefundenen Stützpunkt drehen müssen, mit dem früher oberen Rande zuerst den Boden erreichen und an ihm zerschellen. Um dies zu verhüten, fährt die rechte Hand zurück und entläßt den Bart, von dem ein Teil ohne Absicht mitgezogen wird, erreicht noch den Rand der Tafeln und stützt sie nahe ihrer hinteren, jetzt zur obersten gewordenen Ecke. So leitet sich das sonderbar gezwungen scheinende Ensemble von Bart, Hand und auf die Spitze gestelltem Tafelpaar aus der einen leidenschaftlichen Bewegung der Hand und deren gut begründeten Folgen ab. Will man die Spuren des abgelaufenen Bewegungssturmes rückgängig machen, so muß man die vordere obere Ecke der Tafeln heben und in die Bildebene zurückschieben, damit die vordere untere Ecke (mit dem Vorsprung) vom Steinsitz entfernen, die Hand senken und sie unter den nun horizontal stehenden unteren Tafelrand führen.



Ich habe mir von Künstlerhand drei Zeichnungen machen lassen, welche meine Beschreibung verdeutlichen sollen. Die dritte derselben gibt die Statue wieder, wie wir sie sehen; die beiden anderen stellen Vorstadien dar, welche meine Deutung postuliert, die erste das der Ruhe, die zweite das der höchsten Spannung, der Bereitschaft zum Aufspringen, der Abwendung der Hand von den Tafeln und des beginnenden Herabgleitens derselben. Es ist nun bemerkenswert, wie die beiden von meinem Zeichner ergänzten Darstellungen die unzutreffenden Beschreibungen früherer Autoren zu Ehren bringen. Ein Zeitgenosse Michelangelos, Condivi, sagte: »Moses, der Herzog und Kapitän der Hebräer, sitzt in der Stellung eines sinnenden Weisen, hält unter dem rechten Arm die Gesetzestafeln und stützt mit der linken Hand das Kinn (!), wie einer, der müde und voll von Sorgen.« Das ist nun an der Statue Michelangelos nicht zu sehen, aber es deckt sich fast mit der Annahme, welche der ersten Zeichnung zugrunde liegt. W. Lübke hatte wie andere Beobachter geschrieben: »Erschüttert greift er mit der Rechten in den herrlich herabflutenden Bart ...« Das ist nun unrichtig, wenn man es auf die Abbildung der Statue bezieht, trifft aber für unsere zweite Zeichnung zu. Justi und Knapp haben, wie erwähnt, gesehen, daß die Tafeln im Herabgleiten sind und in der Gefahr schweben zu zerbrechen. Sie mußten sich von Thode berichtigen lassen, daß die Tafeln durch die rechte Hand sicher fixiert seien, aber sie hätten recht, wenn sie nicht die Statue, sondern unser mittleres Stadium beschreiben würden. Man könnte fast meinen, diese Autoren hätten sich von dem Gesichtsbild der Statue frei gemacht und hätten unwissentlich eine Analyse der Bewegungsmotive derselben begonnen, durch welche sie zu denselben Anforderungen geführt wurden, wie wir sie bewußter und ausdrücklicher aufgestellt haben.
III
Wenn ich nicht irre, wird es uns jetzt gestattet sein, die Früchte unserer Bemühung zu ernten. Wir haben gehört, wie vielen, die unter dem Eindruck der Statue standen, sich die Deutung aufgedrängt hat, sie stelle Moses dar unter der Einwirkung des Anblicks, daß sein Volk abgefallen sei und um ein Götzenbild tanze. Aber diese Deutung mußte aufgegeben werden, denn sie fand ihre Fortsetzung in der Erwartung, er werde im nächsten Moment aufspringen, die Tafeln zertrümmern und das Werk der Rache vollbringen. Dies widersprach aber der Bestimmung der Statue als Teilstück des Grabdenkmals Julius II. neben drei oder fünf anderen sitzenden Figuren. Wir dürfen nun diese verlassene Deutung wieder aufnehmen, denn unser Moses wird nicht aufspringen und die Tafeln nicht von sich schleudern. Was wir an ihm sehen, ist nicht die Einleitung zu einer gewaltsamen Aktion, sondern der Rest einer abgelaufenen Bewegung. Er wollte es in einem Anfall von Zorn, aufspringen, Rache nehmen, an die Tafeln vergessen, aber er hat die Versuchung überwunden, er wird jetzt so sitzen bleiben in gebändigter Wut, in mit Verachtung gemischtem Schmerz. Er wird auch die Tafeln nicht wegwerfen, daß sie am Stein zerschellen, denn gerade ihretwegen hat er seinen Zorn bezwungen, zu ihrer Rettung seine Leidenschaft beherrscht. Als er sich seiner leidenschaftlichen Empörung überließ, mußte er die Tafeln vernachlässigen, die Hand, die sie trug, von ihnen abziehen. Da begannen sie herabzugleiten, gerieten in Gefahr zu zerbrechen. Das mahnte ihn. Er gedachte seiner Mission und verzichtete für sie auf die Befriedigung seines Affekts. Seine Hand fuhr zurück und rettete die sinkenden Tafeln, noch ehe sie fallen konnten. In dieser Stellung blieb er verharrend, und so hat ihn Michelangelo als Wächter des Grabmals dargestellt.
Eine dreifache Schichtung drückt sich in seiner Figur in vertikaler Richtung aus. In den Mienen des Gesichts spiegeln sich die Affekte, welche die herrschenden geworden sind, in der Mitte der Figur sind die Zeichen der unterdrückten Bewegung sichtbar, der Fuß zeigt noch die Stellung der beabsichtigten Aktion, als wäre die Beherrschung von oben nach unten vorgeschritten. Der linke Arm, von dem noch nicht die Rede war, scheint seinen Anteil an unserer Deutung zu fordern. Seine Hand ist mit weicher Gebärde in den Schoß gelegt und umfängt wie liebkosend die letzten Enden des herabfallenden Bartes. Es macht den Eindruck, als wollte sie die Gewaltsamkeit aufheben, mit der einen Moment vorher die andere Hand den Bart mißhandelt hatte.
Nun wird man uns aber entgegenhalten: Das ist also doch nicht der Moses der Bibel, der wirklich in Zorn geriet und die Tafeln hinwarf, daß sie zerbrachen. Das wäre ein ganz anderer Moses von der Empfindung des Künstlers, der sich dabei herausgenommen hätte, den heiligen Text zu emendieren und den Charakter des göttlichen Mannes zu verfälschen. Dürfen wir Michelangelo diese Freiheit zumuten, die vielleicht nicht weit von einem Frevel am Heiligen liegt?
Die Stelle der Heiligen Schrift, in welcher das Benehmen Moses' bei der Szene des goldenen Kalbes berichtet wird, lautet folgendermaßen (ich bitte um Verzeihung, daß ich mich in anachronistischer Weise der Übersetzung Luthers bediene):
(II. B. Kap. 32.) »7) Der Herr sprach aber zu Mose: Geh', steig hinab; denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat's verderbt. 8) Sie sind schnell von dem Wege getreten, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossen Kalb gemacht, und haben's angebetet, und ihm geopfert, und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. 9) Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, daß es ein halsstarrig Volk ist. 10) Und nun laß mich, daß mein Zorn über sie ergrimme, und sie vertilge; so will ich dich zum großen Volk machen. 11) Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott und sprach: Ach, Herr, warum will dein Zorn ergrimmen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand hast aus Ägyptenland geführt? ...
... 14) Also gereuete den Herrn das Übel, das er dräuete seinem Volk zu tun. 15) Moses wandte sich, und stieg vom Berge, und hatte zwo Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, die waren geschrieben auf beiden Seiten. 16) Und Gott hatte sie selbst gemacht, und selber die Schrift drein gegraben. 17) Da nun Josua hörte des Volkes Geschrei, daß sie jauchzeten, sprach er zu Mose: Es ist ein Geschrei im Lager wie im Streit. 18) Er antwortete: Es ist nicht ein Geschrei gegeneinander derer die obsiegen und unterliegen, sondern ich höre ein Geschrei eines Siegestanzes. 19) Als er aber nahe zum Lager kam, und das Kalb und den Reigen sah, ergrimmte er mit Zorn, und warf die Tafeln aus seiner Hand, und zerbrach sie unten am Berge; 20) und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und zerschmelzte es mit Feuer, und zermalmte es mit Pulver, und stäubte es aufs Wasser, und gab's den Kindern Israels zu trinken; ...
... 30) Des Morgens sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan; nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht eure Sünde versöhnen möge. 31) Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan, und haben sich güldene Götter gemacht. 32) Nun vergib ihnen ihre Sünde; wo nicht, so tilge mich auch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. 33) Der Herr sprach zu Mose: Was? Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündiget. 34) So gehe nun hin und führe das Volk, dahin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde ihre Sünde wohl heimsuchen, wenn meine Zeit kommt heimzusuchen. 35) Also strafte der Herr das Volk, daß sie das Kalb hatten gemacht, welches Aaron gemacht hatte.«
Unter dem Einfluß der modernen Bibelkritik wird es uns unmöglich, diese Stelle zu lesen, ohne in ihr die Anzeichen ungeschickter Zusammensetzung aus mehreren Quellberichten zu finden. In Vers 8 teilt der Herr selbst Moses mit, daß das Volk abgefallen sei und sich ein Götzenbild gemacht habe. Moses bittet für die Sünder. Doch benimmt er sich in Vers 18 gegen Josua, als wüßte er es nicht, und wallt im plötzlichen Zorn auf (Vers 19), wie er die Szene des Götzendienstes erblickt. In Vers 14 hat er die Verzeihung Gottes für sein sündiges Volk bereits erlangt, doch begibt er sich Vers 31 ff. wieder auf den Berg, um diese Verzeihung zu erflehen, berichtet dem Herrn von dem Abfall des Volkes und erhält die Versicherung des Strafaufschubes. Vers 35 bezieht sich auf eine Bestrafung des Volkes durch Gott, von der nichts mitgeteilt wird, während in den Versen zwischen 20 und 30 das Strafgericht, das Moses selbst vollzogen hat, geschildert wurde. Es ist bekannt, daß die historischen Partien des Buches, welches vom Auszug handelt, von noch auffälligeren Inkongruenzen und Widersprüchen durchsetzt sind.
Für die Menschen der Renaissance gab es solche kritische Einstellung zum Bibeltexte natürlich nicht, sie mußten den Bericht als einen zusammenhängenden auffassen und fanden dann wohl, daß er der darstellenden Kunst keine gute Anknüpfung bot. Der Moses der Bibelstelle war von dem Götzendienst des Volkes bereits unterrichtet worden, hatte sich auf die Seite der Milde und Verzeihung gestellt und erlag dann doch einem plötzlichen Wutanfall, als er des goldenen Kalbes und der tanzenden Menge ansichtig wurde. Es wäre also nicht zu verwundern, wenn der Künstler, der die Reaktion des Helden auf diese schmerzliche Überraschung darstellen wollte, sich aus inneren Motiven von dem Bibeltext unabhängig gemacht hätte. Auch war solche Abweichung vom Wortlaut der Heiligen Schrift aus geringeren Motiven keineswegs ungewöhnlich oder dem Künstler versagt. Ein berühmtes Gemälde des Parmigianino in seiner Vaterstadt zeigt uns den Moses, wie er auf der Höhe eines Berges sitzend die Tafeln zu Boden schleudert, obwohl der Bibelvers ausdrücklich besagt: er zerbrach sie am Fuße des Berges. Schon die Darstellung eines sitzenden Moses findet keinen Anhalt am Bibeltext und scheint eher jenen Beurteilern recht zu geben, welche annahmen, daß die Statue Michelangelos kein bestimmtes Moment aus dem Leben des Helden festzuhalten beabsichtige.
Wichtiger als die Untreue gegen den heiligen Text ist wohl die Umwandlung, die Michelangelo nach unserer Deutung mit dem Charakter des Moses vorgenommen hat. Der Mann Moses war nach den Zeugnissen der Tradition jähzornig und Aufwallungen von Leidenschaft unterworfen. In einem solchen Anfalle von heiligem Zorne hatte er den Ägypter erschlagen, [d]er einen Israeliten mißhandelte, und mußte deshalb aus dem Lande in die Wüste fliehen. In einem ähnlichen Affektausbruch zerschmetterte er die beiden Tafeln, die Gott selbst beschrieben hatte. Wenn die Tradition solche Charakterzüge berichtet, ist sie wohl tendenzlos und hat den Eindruck einer großen Persönlichkeit, die einmal gelebt hat, erhalten. Aber Michelangelo hat an das Grabdenkmal des Papstes einen anderen Moses hingesetzt, welcher dem historischen oder traditionellen Moses überlegen ist. Er hat das Motiv der zerbrochenen Gesetzestafeln umgearbeitet, er läßt sie nicht durch den Zorn Moses' zerbrechen, sondern diesen Zorn durch die Drohung, daß sie zerbrechen könnten, beschwichtigen oder wenigstens auf dem Wege zur Handlung hemmen. Damit hat er etwas Neues, Übermenschliches in die Figur des Moses gelegt, und die gewaltige Körpermasse und kraftstrotzende Muskulatur der Gestalt wird nur zum leiblichen Ausdrucksmittel für die höchste psychische Leistung, die einem Menschen möglich ist, für das Niederringen der eigenen Leidenschaft zugunsten und im Auftrage einer Bestimmung, der man sich geweiht hat.
Hier darf die Deutung der Statue Michelangelos ihr Ende erreichen.
Man kann noch die Frage aufwerfen, welche Motive in dem Künstler tätig waren, als er den Moses, und zwar einen so umgewandelten Moses, für das Grabdenkmal des Papstes Julius II. bestimmte. Von vielen Seiten wurde übereinstimmend darauf hingewiesen, daß diese Motive in dem Charakter des Papstes und im Verhältnis des Künstlers zu ihm zu suchen seien. Julius II. war Michelangelo darin verwandt, daß er Großes und Gewaltiges zu verwirklichen suchte, vor allem das Große der Dimension. Er war ein Mann der Tat, sein Ziel war angebbar, er strebte nach der Einigung Italiens unter der Herrschaft des Papsttums. Was erst mehrere Jahrhunderte später einem Zusammenwirken von anderen Mächten gelingen sollte, das wollte er allein erreichen, ein Einzelner in der kurzen Spanne Zeit und Herrschaft, die ihm gegönnt war, ungeduldig mit gewalttätigen Mitteln. Er wußte Michelangelo als seinesgleichen zu schätzen, aber er ließ ihn oft leiden unter seinem Jähzorn und seiner Rücksichtslosigkeit. Der Künstler war sich der gleichen Heftigkeit des Strebens bewußt und mag als tiefer blickender Grübler die Erfolglosigkeit geahnt haben, zu der sie beide verurteilt waren. So brachte er seinen Moses an dem Denkmal des Papstes an, nicht ohne Vorwurf gegen den Verstorbenen, zur Mahnung für sich selbst, sich mit dieser Kritik über die eigene Natur erhebend.
IV
Im Jahre 1863 hat ein Engländer W. Watkiss Lloyd dem Moses von Michelangelo ein kleines Büchlein gewidmet. Als es mir gelang, dieser Schrift von 46 Seiten habhaft zu werden, nahm ich ihren Inhalt mit gemischten Empfindungen zur Kenntnis. Es war eine Gelegenheit, wieder an der eigenen Person zu erfahren, was für unwürdige infantile Motive zu unserer Arbeit im Dienste einer großen Sache beizutragen pflegen. Ich bedauerte, daß Lloyd so vieles vorweggenommen hatte, was mir als Ergebnis meiner eigenen Bemühung wertvoll war, und erst in zweiter Instanz konnte ich mich über die unerwartete Bestätigung freuen. An einem entscheidenden Punkte trennen sich allerdings unsere Wege.
Lloyd hat zuerst bemerkt, daß die gewöhnlichen Beschreibungen der Figur unrichtig sind, daß Moses nicht im Begriffe ist aufzustehen [Fußnote]But he is not rising or preparing to rise; the bust is fully uprigbt, not thrown forward for the alteration of balance preparatory for such a movement ... (S. 10)., daß die rechte Hand nicht in den Bart greift, daß nur deren Zeigefinger noch auf dem Barte ruht [Fußnote]Such a description is altogether erroneous; the fillets of the beard are detained by the right hand, but they are not held, nor grasped, enclosed or taken hold of. They are even detained but momentarily –; momentarily engaged, they are on the point of being free for disengagement (S. 11).. Er hat auch, was weit mehr besagen will, eingesehen, daß die dargestellte Haltung der Gestalt nur durch die Rückbeziehung auf einen früheren, nicht dargestellten, Moment aufgeklärt werden kann, und daß das Herüberziehen der linken Bartstränge nach rechts andeuten solle, die rechte Hand und die linke Hälfte des Bartes seien vorher in inniger, natürlich vermittelter Beziehung gewesen. Aber er schlägt einen anderen Weg ein, um diese mit Notwendigkeit erschlossene Nachbarschaft wieder herzustellen, er läßt nicht die Hand in den Bart gefahren, sondern den Bart bei der Hand gewesen sein. Er erklärt, man müsse sich vorstellen, »der Kopf der Statue sei einen Moment vor der plötzlichen Störung voll nach rechts gewendet gewesen über der Hand, welche damals wie jetzt die Gesetztafeln hält«. Der Druck auf die Hohlhand (durch die Tafeln) läßt deren Finger sich natürlich unter den herabwallenden Locken öffnen, und die plötzliche Wendung des Kopfes nach der anderen Seite hat zur Folge, daß ein Teil der Haarstränge für einen Augenblick von der nicht bewegten Hand zurückgehalten wird und jene Haarguirlande bildet, die als Wegspur (» wake«) verstanden werden soll.
Von der anderen Möglichkeit einer früheren Annäherung von rechter Hand und linker Barthälfte läßt sich Lloyd durch eine Erwägung zurückhalten, welche beweist, wie nahe er an unserer Deutung vorbeigegangen ist. Es sei nicht möglich, daß der Prophet, selbst nicht in höchster Erregung, die Hand vorgestreckt haben könne, um seinen Bart so beiseitezuziehen. In dem Falle wäre die Haltung der Finger eine ganz andere geworden, und überdies hätten infolge dieser Bewegung die Tafeln herabfallen müssen, welche nur vom Druck der rechten Hand gehalten werden, es sei denn, man mute der Gestalt, um die Tafeln auch dann noch zu erhalten, eine sehr ungeschickte Bewegung zu, deren Vorstellung eigentlich eine Entwürdigung enthalte. (» Unless clutched by a gesture so awkward, that to imagine it is profanation.«)
Es ist leicht zu sehen, worin die Versäumnis des Autors liegt. Er hat die Auffälligkeiten des Bartes richtig als Anzeichen einer abgelaufenen Bewegung gedeutet, es aber dann unterlassen, denselben Schluß auf die nicht weniger gezwungenen Einzelheiten in der Stellung der Tafeln anzuwenden. Er verwertet nur die Anzeichen vom Bart, nicht auch die von den Tafeln, deren Stellung er als die ursprüngliche hinnimmt. So verlegt er sich den Weg zu einer Auffassung wie die unsrige, welche durch die Wertung gewisser unscheinbarer Details zu einer überraschenden Deutung der ganzen Figur und ihrer Absichten gelangt.
Wie nun aber, wenn wir uns beide auf einem Irrwege befänden? Wenn wir Einzelheiten schwer und bedeutungsvoll aufnehmen würden, die dem Künstler gleichgültig waren, die er rein willkürlich oder auf gewisse formale Anlässe hin nur eben so gestaltet hätte, wie sie sind, ohne etwas Geheimes in sie hineinzulegen? Wenn wir dem Los so vieler Interpreten verfallen wären, die deutlich zu sehen glauben, was der Künstler weder bewußt noch unbewußt schaffen gewollt hat? Darüber kann ich nicht entscheiden. Ich weiß nicht zu sagen, ob es angeht, einem Künstler wie Michelangelo, in dessen Werken soviel Gedankeninhalt nach Ausdruck ringt, eine solche naive Unbestimmtheit zuzutrauen, und ob dies gerade für die auffälligen und sonderbaren Züge der Mosesstatue annehmbar ist. Endlich darf man noch in aller Schüchternheit hinzufügen, daß sich in die Verschuldung dieser Unsicherheit der Künstler mit dem Interpreten zu teilen habe. Michelangelo ist oft genug in seinen Schöpfungen bis an die äußerste Grenze dessen, was die Kunst ausdrücken kann, gegangen; vielleicht ist es ihm auch beim Moses nicht völlig geglückt, wenn es seine Absicht war, den Sturm heftiger Erregung aus den Anzeichen erraten zu lassen, die nach seinem Ablauf in der Ruhe zurückblieben.
Nachtrag zur Arbeit über den Moses des Michelangelo
(1927)
Mehrere Jahre nach dem Erscheinen meiner Arbeit über den Moses des Michelangelo, die 1914 in der Zeitschrift Imago –; ohne Nennung meines Namens –; abgedruckt wurde, geriet durch die Güte von E. Jones eine Nummer des Burlington Magazine for Connoisseurs in meine Hand (Nr. CCXVII, Vol. XXXVIII., April 1921), durch welche mein Interesse von neuem auf die vorgeschlagene Deutung der Statue gelenkt werden mußte. In dieser Nummer findet sich ein kurzer Artikel von H. P. Mitchell über zwei Bronzen des zwölften Jahrhunderts, gegenwärtig im Ashmolean Museum, Oxford, die einem hervorragenden Künstler jener Zeit, Nicholas von Verdun, zugeschrieben werden. Von diesem Manne sind noch andere Werke in Tournay, Arras und Klosterneuburg bei Wien erhalten; als sein Meisterwerk gilt der Schrein der Heiligen Drei Könige in Köln.
Eine der beiden von Mitchell gewürdigten Statuetten ist nun ein Moses (über 23 Zentimeter hoch), über jeden Zweifel gekennzeichnet durch die ihm beigegebenen Gesetzestafeln. Auch dieser Moses ist sitzend dargestellt, von einem faltigen Mantel umhüllt, sein Gesicht zeigt einen leidenschaftlich bewegten, vielleicht bekümmerten Ausdruck, und seine rechte Hand umgreift den langen Kinnbart und preßt dessen Strähne zwischen Hohlhand und Daumen wie in einer Zange zusammen, führt also dieselbe Bewegung aus, die in Figur 2 meiner Abhandlung als Vorstufe jener Stellung supponiert wird, in welcher wir jetzt den Moses des Michelangelo erstarrt sehen.

Mosesstatuette, Nicholas von Verdun zugeschrieben
Ein Blick auf die beistehende Abbildung läßt den Hauptunterschied der beiden, durch mehr als drei Jahrhunderte getrennten Darstellungen erkennen. Der Moses des lothringischen Künstlers hält die Tafeln mit seiner linken Hand bei ihrem oberen Rand und stützt sie auf sein Knie; überträgt man die Tafeln auf die andere Seite und vertraut sie dem rechten Arm an, so hat man die Ausgangssituation für den Moses des Michelangelo hergestellt. Wenn meine Auffassung der Geste des In-den-Bart-Greifens zulässig ist, so gibt uns der Moses aus dem Jahre 1180 einen Moment aus dem Sturm der Leidenschaften wieder, die Statue in S. Pietro in Vincoli aber die Ruhe nach dem Sturme.
Ich glaube, daß der hier mitgeteilte Fund die Wahrscheinlichkeit der Deutung erhöht, die ich in meiner Arbeit 1914 versucht habe. Vielleicht ist es einem Kunstkenner möglich, die zeitliche Kluft zwischen dem Moses des Nicholas von Verdun und dem des Meisters der italienischen Renaissance durch den Nachweis von Mosestypen aus der Zwischenzeit auszufüllen.
Der Realitätsverlust bei Neurose und Psychose (1924)
Ich habe kürzlich [Fußnote]›Neurose und Psychose‹ (1924 b). einen der unterscheidenden Züge zwischen Neurose und Psychose dahin bestimmt, daß bei ersterer das Ich in Abhängigkeit von der Realität ein Stück des Es (Trieblebens) unterdrückt, während sich dasselbe Ich bei der Psychose im Dienste des Es von einem Stück der Realität zurückzieht. Für die Neurose wäre also die Übermacht des Realeinflusses, für die Psychose die des Es maßgebend. Der Realitätsverlust wäre für die Psychose von vorneherein gegeben; für die Neurose, sollte man meinen, wäre er vermieden.
Das stimmt nun aber gar nicht zur Erfahrung, die wir alle machen können, daß jede Neurose das Verhältnis des Kranken zur Realität irgendwie stört, daß sie ihm ein Mittel ist, sich von ihr zurückzuziehen und in ihren schweren Ausbildungen direkt eine Flucht aus dem realen Leben bedeutet. Dieser Widerspruch erscheint bedenklich, allein er ist leicht zu beseitigen, und seine Aufklärung wird unser Verständnis der Neurose nur gefördert haben.
Der Widerspruch besteht nämlich nur so lange, als wir die Eingangssituation der Neurose ins Auge fassen, in welcher das Ich im Dienst der Realität die Verdrängung einer Triebregung vornimmt. Das ist aber noch nicht die Neurose selbst. Diese besteht vielmehr in den Vorgängen, welche dem geschädigten Anteil des Es eine Entschädigung bringen, also in der Reaktion gegen die Verdrängung und im Mißglücken derselben. Die Lockerung des Verhältnisses zur Realität ist dann die Folge dieses zweiten Schrittes in der Neurosenbildung, und es sollte uns nicht verwundern, wenn die Detailuntersuchung zeigte, daß der Realitätsverlust gerade jenes Stück der Realität betrifft, über dessen Anforderung die Triebverdrängung erfolgte.
Die Charakteristik der Neurose als Erfolg einer mißglückten Verdrängung ist nichts Neues. Wir haben es immer so gesagt, und nur infolge des neuen Zusammenhanges war es notwendig, es zu wiederholen.
Das nämliche Bedenken wird übrigens in besonders eindrucksvoller Weise wiederauftreten, wenn es sich um einen Fall von Neurose handelt, dessen Veranlassung (»die traumatische Szene«) bekannt ist und an dem man sehen kann, wie sich die Person von einem solchen Erlebnis abwendet und es der Amnesie überantwortet. Ich will zum Beispiel auf einen vor langen Jahren analysierten Fall zurückgreifen [Fußnote]In den Studien über Hysterie (1895)., in dem das in ihren Schwager verliebte Mädchen am Totenbett der Schwester durch die Idee erschüttert wird: »Nun ist er frei und kann dich heiraten.« Diese Szene wird sofort vergessen und damit der Regressionsvorgang eingeleitet, der zu den hysterischen Schmerzen führt. Es ist aber gerade hier lehrreich, zu sehen, auf welchem Wege die Neurose den Konflikt zu erledigen versucht. Sie entwertet die reale Veränderung, indem sie den in Betracht kommenden Triebanspruch, also die Liebe zum Schwager, verdrängt. Die psychotische Reaktion wäre gewesen, die Tatsache des Todes der Schwester zu verleugnen.
Man könnte nun erwarten, daß sich bei der Entstehung der Psychose etwas dem Vorgang bei der Neurose Analoges ereignet, natürlich zwischen anderen Instanzen. Also daß auch bei der Psychose zwei Schritte deutlich werden, von denen der erste das Ich diesmal von der Realität losreißt, der zweite aber den Schaden wiedergutmachen will und nun die Beziehung zur Realität auf Kosten des Es wiederherstellt. Wirklich ist auch etwas Analoges an der Psychose zu beobachten; es gibt auch hier zwei Schritte, von denen der zweite den Charakter der Reparation an sich trägt, aber dann weicht die Analogie einer viel weitergehenden Gleichsinnigkeit der Vorgänge. Der zweite Schritt der Psychose will auch den Realitätsverlust ausgleichen, aber nicht auf Kosten einer Einschränkung des Es wie bei der Neurose auf Kosten der Realbeziehung, sondern auf einem anderen, mehr selbstherrlichen Weg durch Schöpfung einer neuen Realität, welche nicht mehr den nämlichen Anstoß bietet wie die verlassene. Der zweite Schritt wird also bei der Neurose wie bei der Psychose von denselben Tendenzen getragen, er dient in beiden Fällen dem Machtbestreben des Es, das sich von der Realität nicht zwingen läßt. Neurose wie Psychose sind also beide Ausdruck der Rebellion des Es gegen die Außenwelt, seiner Unlust oder, wenn man will, seiner Unfähigkeit, sich der realen Not, der ’Ανάγκη, anzupassen. Neurose und Psychose unterscheiden sich weit mehr voneinander in der ersten, einleitenden Reaktion als in dem auf sie folgenden Reparationsversuch.
Der anfängliche Unterschied kommt dann im Endergebnis in der Art zum Ausdruck, daß bei der Neurose ein Stück der Realität fluchtartig vermieden, bei der Psychose aber umgebaut wird. Oder: Bei der Psychose folgt auf die anfängliche Flucht eine aktive Phase des Umbaues, bei der Neurose auf den anfänglichen Gehorsam ein nachträglicher Fluchtversuch. Oder noch anders ausgedrückt: Die Neurose verleugnet die Realität nicht, sie will nur nichts von ihr wissen; die Psychose verleugnet sie und sucht sie zu ersetzen. Normal oder »gesund« heißen wir ein Verhalten, welches bestimmte Züge beider Reaktionen vereinigt, die Realität sowenig verleugnet wie die Neurose, sich aber dann wie die Psychose um ihre Abänderung bemüht. Dies zweckmäßige, normale Verhalten führt natürlich zu einer äußeren Arbeitsleistung an der Außenwelt und begnügt sich nicht wie bei der Psychose mit der Herstellung innerer Veränderungen; es ist nicht mehr autoplastisch, sondern alloplastisch.
Die Umarbeitung der Realität geschieht bei der Psychose an den psychischen Niederschlägen der bisherigen Beziehungen zu ihr, also an den Erinnerungsspuren, Vorstellungen und Urteilen, die man bisher von ihr gewonnen hatte und durch welche sie im Seelenleben vertreten war. Aber diese Beziehung war nie eine abgeschlossene, sie wurde fortlaufend durch neue Wahrnehmungen bereichert und abgeändert. Somit stellt sich auch für die Psychose die Aufgabe her, sich solche Wahrnehmungen zu verschaffen, wie sie der neuen Realität entsprechen würden, was in gründlichster Weise auf dem Wege der Halluzination erreicht wird. Wenn die Erinnerungstäuschungen, Wahnbildungen und Halluzinationen bei so vielen Formen und Fällen von Psychose den peinlichsten Charakter zeigen und mit Angstentwicklung verbunden sind, so ist das wohl ein Anzeichen dafür, daß sich der ganze Umbildungsprozeß gegen heftig widerstrebende Kräfte vollzieht. Man darf sich den Vorgang nach dem uns besser bekannten Vorbild der Neurose konstruieren. Hier sehen wir, daß jedesmal mit Angst reagiert wird, sooft der verdrängte Trieb einen Vorstoß macht, und daß das Ergebnis des Konflikts doch nur ein Kompromiß und als Befriedigung unvollkommen ist. Wahrscheinlich drängt sich bei der Psychose das abgewiesene Stück der Realität immer wieder dem Seelenleben auf, wie bei der Neurose der verdrängte Trieb, und darum sind auch die Folgen in beiden Fällen die gleichen. Die Erörterung der verschiedenen Mechanismen, welche bei den Psychosen die Abwendung von der Realität und den Wiederaufbau einer solchen bewerkstelligen sollen, sowie des Ausmaßes von Erfolg, das sie erzielen können, ist eine noch nicht in Angriff genommene Aufgabe der speziellen Psychiatrie.
Es ist also eine weitere Analogie zwischen Neurose und Psychose, daß bei beiden die Aufgabe, die im zweiten Schritt in Angriff genommen wird, teilweise mißlingt, indem sich der verdrängte Trieb keinen vollen Ersatz schaffen kann (Neurose) und die Realitätsvertretung sich nicht in die befriedigenden Formen umgießen läßt. (Wenigstens nicht bei allen Formen der psychischen Erkrankungen.) Aber die Akzente sind in den zwei Fällen anders verteilt. Bei der Psychose ruht der Akzent ganz auf dem ersten Schritt, der an sich krankhaft ist und nur zu Kranksein führen kann, bei der Neurose hingegen auf dem zweiten, dem Mißlingen der Verdrängung, während der erste Schritt gelingen kann und auch im Rahmen der Gesundheit ungezählte Male gelungen ist, wenn auch nicht ganz ohne Kosten zu machen und Anzeichen des erforderten psychischen Aufwandes zu hinterlassen. Diese Differenzen und vielleicht noch viele andere sind die Folge der topischen Verschiedenheit in der Ausgangssituation des pathogenen Konflikts, ob das Ich darin seiner Anhänglichkeit an die reale Welt oder seiner Abhängigkeit vom Es nachgegeben hat.
Die Neurose begnügt sich in der Regel damit, das betreffende Stück der Realität zu vermeiden und sich gegen das Zusammentreffen mit ihm zu schützen. Der scharfe Unterschied zwischen Neurose und Psychose wird aber dadurch abgeschwächt, daß es auch bei der Neurose an Versuchen nicht fehlt, die unerwünschte Realität durch eine wunschgerechtere zu ersetzen. Die Möglichkeit hiezu gibt die Existenz einer Phantasiewelt, eines Gebietes, das seinerzeit bei der Einsetzung des Realitätsprinzips von der realen Außenwelt abgesondert wurde, seither nach Art einer »Schonung« von den Anforderungen der Lebensnotwendigkeit freigehalten wird und das dem Ich nicht unzugänglich ist, aber ihm nur lose anhängt. Aus dieser Phantasiewelt entnimmt die Neurose das Material für ihre Wunschneubildungen und findet es dort gewöhnlich auf dem Wege der Regression in eine befriedigendere reale Vorzeit.
Es ist kaum zweifelhaft, daß die Phantasiewelt bei der Psychose die nämliche Rolle spielt, daß sie auch hier die Vorratskammer darstellt, aus der der Stoff oder die Muster für den Aufbau der neuen Realität geholt werden. Aber die neue, phantastische Außenwelt der Psychose will sich an die Stelle der äußeren Realität setzen, die der Neurose hingegen lehnt sich wie das Kinderspiel gern an ein Stück der Realität an –; ein anderes als das, wogegen sie sich wehren mußte –;, verleiht ihm eine besondere Bedeutung und einen geheimen Sinn, den wir nicht immer ganz zutreffend einen symbolischen heißen. So kommt für beide, Neurose wie Psychose, nicht nur die Frage des Realitätsverlustes, sondern auch die eines Realitätsersatzes in Betracht.
Der Untergang des Ödipuskomplexes (1924)
Immer mehr enthüllt der Ödipuskomplex seine Bedeutung als das zentrale Phänomen der frühkindlichen Sexualperiode. Dann geht er unter, er erliegt der Verdrängung, wie wir sagen, und ihm folgt die Latenzzeit. Es ist aber noch nicht klar geworden, woran er zugrunde geht; die Analysen scheinen zu lehren: an den vorfallenden schmerzhaften Enttäuschungen. Das kleine Mädchen, das sich für die bevorzugte Geliebte des Vaters halten will, muß einmal eine harte Züchtigung durch den Vater erleben und sieht sich aus allen Himmeln gestürzt. Der Knabe, der die Mutter als sein Eigentum betrachtet, macht die Erfahrung, daß sie Liebe und Sorgfalt von ihm weg auf einen neu Angekommenen richtet. Die Überlegung vertieft den Wert dieser Einwirkungen, indem sie betont, daß solche peinliche Erfahrungen, die dem Inhalt des Komplexes widerstreiten, unvermeidlich sind. Auch wo nicht besondere Ereignisse, wie die als Proben erwähnten, vorfallen, muß das Ausbleiben der erhofften Befriedigung, die fortgesetzte Versagung des gewünschten Kindes, es dahin bringen, daß sich der kleine Verliebte von seiner hoffnungslosen Neigung abwendet. Der Ödipuskomplex ginge so zugrunde an seinem Mißerfolg, dem Ergebnis seiner inneren Unmöglichkeit.
Eine andere Auffassung wird sagen, der Ödipuskomplex muß fallen, weil die Zeit für seine Auflösung gekommen ist, wie die Milchzähne ausfallen, wenn die definitiven nachrücken. Wenn der Ödipuskomplex auch von den meisten Menschenkindern individuell durchlebt wird, so ist er doch ein durch die Heredität bestimmtes, von ihr angelegtes Phänomen, welches programmgemäß vergehen muß, wenn die nächste vorherbestimmte Entwicklungsphase einsetzt. Es ist dann ziemlich gleichgültig, auf welche Anlässe hin das geschieht oder ob solche überhaupt nicht ausfindig zu machen sind.
Beiden Auffassungen kann man ihr Recht nicht abstreiten. Sie vertragen sich aber auch miteinander; es bleibt Raum für die ontogenetische neben der weiter schauenden phylogenetischen. Auch dem ganzen Individuum ist es ja schon bei seiner Geburt bestimmt zu sterben, und seine Organanlage enthält vielleicht bereits den Hinweis, woran. Doch bleibt es von Interesse zu verfolgen, wie dies mitgebrachte Programm ausgeführt wird, in welcher Weise zufällige Schädlichkeiten die Disposition ausnützen.
Unser Sinn ist neuerlich für die Wahrnehmung geschärft worden, daß die Sexualentwicklung des Kindes bis zu einer Phase fortschreitet, in der das Genitale bereits die führende Rolle übernommen hat. Aber dies Genitale ist allein das männliche, genauer bezeichnet, der Penis, das weibliche ist unentdeckt geblieben. Diese phallische Phase, gleichzeitig die des Ödipuskomplexes, entwickelt sich nicht weiter zur endgültigen Genitalorganisation, sondern sie versinkt und wird von der Latenzzeit abgelöst. Ihr Ausgang vollzieht sich aber in typischer Weise und in Anlehnung an regelmäßig wiederkehrende Geschehnisse.
Wenn das (männliche) Kind sein Interesse dem Genitale zugewendet hat, so verrät es dies auch durch ausgiebige manuelle Beschäftigung mit demselben und muß dann die Erfahrung machen, daß die Erwachsenen mit diesem Tun nicht einverstanden sind. Es tritt mehr oder minder deutlich, mehr oder weniger brutal, die Drohung auf, daß man ihn dieses von ihm hochgeschätzten Teiles berauben werde. Meist sind es Frauen, von denen die Kastrationsdrohung ausgeht, häufig suchen sie ihre Autorität dadurch zu verstärken, daß sie sich auf den Vater oder den Doktor berufen, der nach ihrer Versicherung die Strafe vollziehen wird. In einer Anzahl von Fällen nehmen die Frauen selbst eine symbolische Milderung der Androhung vor, indem sie nicht die Beseitigung des eigentlich passiven Genitales, sondern die der aktiv sündigenden Hand ankündigen. Ganz besonders häufig geschieht es, daß das Knäblein nicht darum von der Kastrationsdrohung betroffen wird, weil es mit der Hand am Penis spielt, sondern weil es allnächtlich sein Lager näßt und nicht rein zu bekommen ist. Die Pflegepersonen benehmen sich so, als wäre diese nächtliche Inkontinenz Folge von und Beweis für allzueifrige Beschäftigung mit dem Penis, und haben wahrscheinlich recht darin. Jedenfalls ist das andauernde Bettnässen der Pollution des Erwachsenen gleichzustellen, ein Ausdruck der nämlichen Genitalerregung, welche das Kind um diese Zeit zur Masturbation gedrängt hat.
Die Behauptung ist nun, daß die phallische Genitalorganisation des Kindes an dieser Kastrationsdrohung zugrunde geht. Allerdings nicht sofort und nicht ohne daß weitere Einwirkungen dazukommen. Denn der Knabe schenkt der Drohung zunächst keinen Glauben und keinen Gehorsam. Die Psychoanalyse hat neuerlichen Wert auf zweierlei Erfahrungen gelegt, die keinem Kinde erspart bleiben und durch die es auf den Verlust wertgeschätzter Körperteile vorbereitet sein sollte, auf die zunächst zeitweilige, später einmal endgültige Entziehung der Mutterbrust und auf die täglich erforderte Abtrennung des Darminhaltes. Aber man merkt nichts davon, daß diese Erfahrungen beim Anlaß der Kastrationsdrohung zur Wirkung kommen würden. Erst nachdem eine neue Erfahrung gemacht worden ist, beginnt das Kind mit der Möglichkeit einer Kastration zu rechnen, auch dann nur zögernd, widerwillig und nicht ohne das Bemühen, die Tragweite der eigenen Beobachtung zu verkleinern.
Die Beobachtung, welche den Unglauben des Kindes endlich bricht, ist die des weiblichen Genitales. Irgend einmal bekommt das auf seinen Penisbesitz stolze Kind die Genitalregion eines kleinen Mädchens zu Gesicht und muß sich von dem Mangel eines Penis bei einem ihm so ähnlichen Wesen überzeugen. Damit ist auch der eigene Penisverlust vorstellbar geworden, die Kastrationsdrohung gelangt nachträglich zur Wirkung.
Wir dürfen nicht so kurzsichtig sein wie die mit der Kastration drohende Pflegeperson und sollen nicht übersehen, daß sich das Sexualleben des Kindes um diese Zeit keineswegs in der Masturbation erschöpft. Es steht nachweisbar in der Ödipuseinstellung zu seinen Eltern, die Masturbation ist nur die genitale Abfuhr der zum Komplex gehörigen Sexualerregung und wird dieser Beziehung ihre Bedeutung für alle späteren Zeiten verdanken. Der Ödipuskomplex bot dem Kinde zwei Möglichkeiten der Befriedigung, eine aktive und eine passive. Es konnte sich in männlicher Weise an die Stelle des Vaters setzen und wie er mit der Mutter verkehren, wobei der Vater bald als Hindernis empfunden wurde, oder es wollte die Mutter ersetzen und sich vom Vater lieben lassen, wobei die Mutter überflüssig wurde. Worin der befriedigende Liebesverkehr bestehe, darüber mochte das Kind nur sehr unbestimmte Vorstellungen haben; gewiß spielte aber der Penis dabei eine Rolle, denn dies bezeugten seine Organgefühle. Zum Zweifel am Penis des Weibes war noch kein Anlaß. Die Annahme der Kastrationsmöglichkeit, die Einsicht, daß das Weib kastriert sei, machte nun beiden Möglichkeiten der Befriedigung aus dem Ödipuskomplex ein Ende. Beide brachten ja den Verlust des Penis mit sich, die eine, männliche, als Straffolge, die andere, weibliche, als Voraussetzung. Wenn die Liebesbefriedigung auf dem Boden des Ödipuskomplexes den Penis kosten soll, so muß es zum Konflikt zwischen dem narzißtischen Interesse an diesem Körperteile und der libidinösen Besetzung der elterlichen Objekte kommen. In diesem Konflikt siegt normalerweise die erstere Macht; das Ich des Kindes wendet sich vom Ödipuskomplex ab.
Ich habe an anderer Stelle ausgeführt, in welcher Weise dies vor sich geht. Die Objektbesetzungen werden aufgegeben und durch Identifizierung ersetzt. Die ins Ich introjizierte Vater- oder Elternautorität bildet dort den Kern des Über-Ichs, welches vom Vater die Strenge entlehnt, sein Inzestverbot perpetuiert und so das Ich gegen die Wiederkehr der libidinösen Objektbesetzung versichert. Die dem Ödipuskomplex zugehörigen libidinösen Strebungen werden zum Teil desexualisiert und sublimiert, was wahrscheinlich bei jeder Umsetzung in Identifizierung geschieht, zum Teil zielgehemmt und in zärtliche Regungen verwandelt. Der ganze Prozeß hat einerseits das Genitale gerettet, die Gefahr des Verlustes von ihm abgewendet, anderseits es lahmgelegt, seine Funktion aufgehoben. Mit ihm setzt die Latenzzeit ein, die nun die Sexualentwicklung des Kindes unterbricht.
Ich sehe keinen Grund, der Abwendung des Ichs vom Ödipuskomplex den Namen einer »Verdrängung« zu versagen, obwohl spätere Verdrängungen meist unter der Beteiligung des Über-Ichs zustande kommen werden, welches hier erst gebildet wird. Aber der beschriebene Prozeß ist mehr als eine Verdrängung, er kommt, wenn ideal vollzogen, einer Zerstörung und Aufhebung des Komplexes gleich. Es liegt nahe anzunehmen, daß wir hier auf die niemals ganz scharfe Grenzscheide zwischen Normalem und Pathologischem gestoßen sind. Wenn das Ich wirklich nicht viel mehr als eine Verdrängung des Komplexes erreicht hat, dann bleibt dieser im Es unbewußt bestehen und wird später seine pathogene Wirkung äußern.
Solche Zusammenhänge zwischen phallischer Organisation, Ödipuskomplex, Kastrationsdrohung, Über-Ichbildung und Latenzperiode läßt die analytische Beobachtung erkennen oder erraten. Sie rechtfertigen den Satz, daß der Ödipuskomplex an der Kastrationsdrohung zugrunde geht. Aber damit ist das Problem nicht erledigt, es bleibt Raum für eine theoretische Spekulation, welche das gewonnene Resultat umwerfen oder in ein neues Licht rücken kann. Ehe wir aber diesen Weg beschreiten, müssen wir uns einer Frage zuwenden, welche sich während unserer bisherigen Erörterungen erhoben hat und so lange zur Seite gedrängt wurde. Der beschriebene Vorgang bezieht sich, wie ausdrücklich gesagt, nur auf das männliche Kind. Wie vollzieht sich die entsprechende Entwicklung beim kleinen Mädchen?
Unser Material wird hier –; unverständlicherweise –; weit dunkler und lückenhafter. Auch das weibliche Geschlecht entwickelt einen Ödipuskomplex, ein Über-Ich und eine Latenzzeit. Kann man ihm auch eine phallische Organisation und einen Kastrationskomplex zusprechen? Die Antwort lautet bejahend, aber es kann nicht dasselbe sein wie beim Knaben. Die feministische Forderung nach Gleichberechtigung der Geschlechter trägt hier nicht weit, der morphologische Unterschied muß sich in Verschiedenheiten der psychischen Entwicklung äußern. Die Anatomie ist das Schicksal, um ein Wort Napoleons zu variieren. Die Klitoris des Mädchens benimmt sich zunächst ganz wie ein Penis, aber das Kind nimmt durch die Vergleichung mit einem männlichen Gespielen wahr, daß es »zu kurz gekommen« ist, und empfindet diese Tatsache als Benachteiligung und Grund zur Minderwertigkeit. Es tröstet sich noch eine Weile mit der Erwartung, später, wenn es heranwächst, ein ebenso großes Anhängsel wie ein Bub zu bekommen. Hier zweigt dann der Männlichkeitskomplex des Weibes ab. Seinen aktuellen Mangel versteht das weibliche Kind aber nicht als Geschlechtscharakter, sondern erklärt ihn durch die Annahme, daß es früher einmal ein ebenso großes Glied besessen und dann durch Kastration verloren hat. Es scheint diesen Schluß nicht von sich auf andere, erwachsene Frauen auszudehnen, sondern diesen, ganz im Sinne der phallischen Phase, ein großes und vollständiges, also männliches Genitale zuzumuten. Es ergibt sich also der wesentliche Unterschied, daß das Mädchen die Kastration als vollzogene Tatsache akzeptiert, während sich der Knabe vor der Möglichkeit ihrer Vollziehung fürchtet.
Mit der Ausschaltung der Kastrationsangst entfällt auch ein mächtiges Motiv zur Aufrichtung des Über-Ichs und zum Abbruch der infantilen Genitalorganisation. Diese Veränderungen scheinen weit eher als beim Knaben Erfolg der Erziehung, der äußeren Einschüchterung zu sein, die mit dem Verlust des Geliebtwerdens droht. Der Ödipuskomplex des Mädchens ist weit eindeutiger als der des kleinen Penisträgers, er geht nach meiner Erfahrung nur selten über die Substituierung der Mutter und die feminine Einstellung zum Vater hinaus. Der Verzicht auf den Penis wird nicht ohne einen Versuch der Entschädigung vertragen. Das Mädchen gleitet –; man möchte sagen: längs einer symbolischen Gleichung –; vom Penis auf das Kind hinüber, sein Ödipuskomplex gipfelt in dem lange festgehaltenen Wunsch, vom Vater ein Kind als Geschenk zu erhalten, ihm ein Kind zu gebären. Man hat den Eindruck, daß der Ödipuskomplex dann langsam verlassen wird, weil dieser Wunsch sich nie erfüllt. Die beiden Wünsche nach dem Besitz eines Penis und eines Kindes bleiben im Unbewußten stark besetzt erhalten und helfen dazu, das weibliche Wesen für seine spätere geschlechtliche Rolle bereitzumachen. Die geringere Stärke des sadistischen Beitrages zum Sexualtrieb, die man wohl mit der Verkümmerung des Penis zusammenbringen darf, erleichtert die Verwandlung der direkt sexuellen Strebungen in zielgehemmte zärtliche. Im ganzen muß man aber zugestehen, daß unsere Einsichten in diese Entwicklungsvorgänge beim Mädchen unbefriedigend, lücken- und schattenhaft sind.
Ich zweifle nicht daran, daß die hier beschriebenen zeitlichen und kausalen Beziehungen zwischen Ödipuskomplex, Sexualeinschüchterung (Kastrationsdrohung), Über-Ichbildung und Eintritt der Latenzzeit von typischer Art sind; ich will aber nicht behaupten, daß dieser Typus der einzig mögliche ist. Abänderungen in der Zeitfolge und in der Verkettung dieser Vorgänge müssen für die Entwicklung des Individuums sehr bedeutungsvoll werden.
Seit der Veröffentlichung von O. Ranks interessanter Studie über das Trauma der Geburt kann man auch das Resultat dieser kleinen Untersuchung, der Ödipuskomplex des Knaben gehe an der Kastrationsangst zugrunde, nicht ohne weitere Diskussion hinnehmen. Es erscheint mir aber vorzeitig, heute in diese Diskussion einzugehen, vielleicht auch unzweckmäßig, die Kritik oder Würdigung der Rankschen Auffassung an solcher Stelle zu beginnen.
Die « kulturelle » Sexualmoral und die moderne Nervosität (1908)
In seiner kürzlich veröffentlichten Sexualethik[Fußnote](1907). verweilt v. Ehrenfels bei der Unterscheidung der »natürlichen« und der »kulturellen« Sexualmoral. Als natürliche Sexualmoral sei diejenige zu verstehen, unter deren Herrschaft ein Menschenstamm sich andauernd bei Gesundheit und Lebenstüchtigkeit zu erhalten vermag, als kulturelle diejenige, deren Befolgung die Menschen vielmehr zu intensiver und produktiver Kulturarbeit anspornt. Dieser Gegensatz werde am besten durch die Gegenüberstellung von konstitutivem und kulturellem Besitz eines Volkes erläutert. Indem ich für die weitere Würdigung dieses bedeutsamen Gedankenganges auf die Schrift von v. Ehrenfels selbst verweise, will ich aus ihr nur so viel herausheben, als es für die Anknüpfung meines eigenen Beitrages bedarf.
Die Vermutung liegt nahe, daß unter der Herrschaft einer kulturellen Sexualmoral Gesundheit und Lebenstüchtigkeit der einzelnen Menschen Beeinträchtigungen ausgesetzt sein können und daß endlich diese Schädigung der Individuen durch die ihnen auferlegten Opfer einen so hohen Grad erreiche, daß auf diesem Umwege auch das kulturelle Endziel in Gefahr geriete. v. Ehrenfels weist auch wirklich der unsere gegenwärtige abendländische Gesellschaft beherrschenden Sexualmoral eine Reihe von Schäden nach, für die er sie verantwortlich machen muß, und obwohl er ihre hohe Eignung zur Förderung der Kultur voll anerkennt, gelangt er dazu, sie als reformbedürftig zu verurteilen. Für die uns beherrschende kulturelle Sexualmoral sei charakteristisch die Übertragung femininer Anforderungen auf das Geschlechtsleben des Mannes und die Verpönung eines jeden Sexualverkehres mit Ausnahme des ehelich-monogamen. Die Rücksicht auf die natürliche Verschiedenheit der Geschlechter nötige dann allerdings dazu, Vergehungen des Mannes minder rigoros zu ahnden und somit tatsächlich eine doppelte Moral für den Mann zuzulassen. Eine Gesellschaft aber, die sich auf diese doppelte Moral einläßt, kann es in »Wahrheitsliebe, Ehrlichkeit und Humanität« [Fußnote]Sexualethik, S. 32 ff. nicht über ein bestimmtes, eng begrenztes Maß hinausbringen, muß ihre Mitglieder zur Verhüllung der Wahrheit, zur Schönfärberei, zum Selbstbetruge wie zum Betrügen anderer anleiten. Noch schädlicher wirkt die kulturelle Sexualmoral, indem sie durch die Verherrlichung der Monogamie den Faktor der virilen Auslese lahmlegt, durch dessen Einfluß allein eine Verbesserung der Konstitution zu gewinnen sei, da die vitale Auslese bei den Kulturvölkern durch Humanität und Hygiene auf ein Minimum herabgedrückt werde [Fußnote]Ibid., S. 35..
Unter den der kulturellen Sexualmoral zur Last gelegten Schädigungen vermißt nun der Arzt die eine, deren Bedeutung hier ausführlich erörtert werden soll. Ich meine die auf sie zurückzuführende Förderung der modernen, das heißt in unserer gegenwärtigen Gesellschaft sich rasch ausbreitenden Nervosität. Gelegentlich macht ein nervös Kranker selbst den Arzt auf den in der Verursachung des Leidens zu beachtenden Gegensatz von Konstitution und Kulturanforderung aufmerksam, indem er äußert: »Wir in unserer Familie sind alle nervös geworden, weil wir etwas Besseres sein wollten, als wir nach unserer Herkunft sein können.« Auch wird der Arzt häufig genug durch die Beobachtung nachdenklich gemacht, daß gerade die Nachkommen solcher Väter der Nervosität verfallen, die, aus einfachen und gesunden ländlichen Verhältnissen stammend, Abkömmlinge roher aber kräftiger Familien, als Eroberer in die Großstadt kommen und ihre Kinder in einem kurzen Zeitraum auf ein kulturell hohes Niveau sich erheben lassen. Vor allem aber haben die Nervenärzte selbst laut den Zusammenhang der »wachsenden Nervosität« mit dem modernen Kulturleben proklamiert. Worin sie die Begründung dieser Abhängigkeit suchen, soll durch einige Auszüge aus Äußerungen hervorragender Beobachter dargetan werden.
W. Erb (1893): »Die ursprünglich gestellte Frage lautet nun dahin, ob die Ihnen vorgeführten Ursachen der Nervosität in unserem modernen Dasein in so gesteigertem Maße gegeben sind, daß sie eine erhebliche Zunahme derselben erklärlich machen –; und diese Frage darf wohl unbedenklich bejaht werden, wie ein flüchtiger Blick auf unser modernes Leben und seine Gestaltung zeigen wird.«
»Schon aus einer Reihe allgemeiner Tatsachen geht dies deutlich hervor: die außerordentlichen Errungenschaften der Neuzeit, die Entdeckungen und Erfindungen auf allen Gebieten, die Erhaltung des Fortschrittes gegenüber der wachsenden Konkurrenz sind nur erworben worden durch große geistige Arbeit und können nur mit solcher erhalten werden. Die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit des Einzelnen im Kampfe ums Dasein sind erheblich gestiegen, und nur mit Aufbietung all seiner geistigen Kräfte kann er sie befriedigen; zugleich sind die Bedürfnisse des Einzelnen, die Ansprüche an Lebensgenuß in allen Kreisen gewachsen, ein unerhörter Luxus hat sich auf Bevölkerungsschichten ausgebreitet, die früher davon ganz unberührt waren; die Religionslosigkeit, die Unzufriedenheit und Begehrlichkeit haben in weiten Volkskreisen zugenommen; durch den ins Ungemessene gesteigerten Verkehr, durch die weltumspannenden Drahtnetze des Telegraphen und Telephons haben sich die Verhältnisse in Handel und Wandel total verändert: alles geht in Hast und Aufregung vor sich, die Nacht wird zum Reisen, der Tag für die Geschäfte benützt, selbst die »Erholungsreisen« werden zu Strapazen für das Nervensystem; große politische, industrielle, finanzielle Krisen tragen ihre Aufregung in viel weitere Bevölkerungskreise als früher; ganz allgemein ist die Anteilnahme am politischen Leben geworden: politische, religiöse, soziale Kämpfe, das Parteitreiben, die Wahlagitationen, das ins Maßlose gesteigerte Vereinswesen erhitzen die Köpfe und zwingen die Geister zu immer neuen Anstrengungen und rauben die Zeit zur Erholung, Schlaf und Ruhe; das Leben in den großen Städten ist immer raffinierter und unruhiger geworden. Die erschlafften Nerven suchen ihre Erholung in gesteigerten Reizen, in stark gewürzten Genüssen, um dadurch noch mehr zu ermüden; die moderne Literatur beschäftigt sich vorwiegend mit den bedenklichsten Problemen, die alle Leidenschaften aufwühlen, die Sinnlichkeit und Genußsucht, die Verachtung aller ethischen Grundsätze und aller Ideale fördern; sie bringt pathologische Gestalten, psychopathisch-sexuelle, revolutionäre und andere Probleme vor den Geist des Lesers; unser Ohr wird von einer in großen Dosen verabreichten, aufdringlichen und lärmenden Musik erregt und überreizt, die Theater nehmen alle Sinne mit ihren aufregenden Darstellungen gefangen; auch die bildenden Künste wenden sich mit Vorliebe dem Abstoßenden, Häßlichen und Aufregenden zu und scheuen sich nicht, auch das Gräßlichste, was die Wirklichkeit bietet, in abstoßender Realität vor unser Auge zu stellen.«
»So zeigt dies allgemeine Bild schon eine Reihe von Gefahren in unserer modernen Kulturentwicklung; es mag im einzelnen noch durch einige Züge vervollständigt werden!«
Binswanger (1896): »Man hat speziell die Neurasthenie als eine durchaus moderne Krankheit bezeichnet, und Beard, dem wir zuerst eine übersichtliche Darstellung derselben verdanken, glaubte, daß er eine neue, speziell auf amerikanischem Boden erwachsene Nervenkrankheit entdeckt habe. Diese Annahme war natürlich eine irrige; wohl aber kennzeichnet die Tatsache, daß zuerst ein amerikanischer Arzt die eigenartigen Züge dieser Krankheit auf Grund einer reichen Erfahrung erfassen und festhalten konnte, die nahen Beziehungen, welche das moderne Leben, das ungezügelte Hasten und Jagen nach Geld und Besitz, die ungeheuren Fortschritte auf technischem Gebiete, welche alle zeitlichen und räumlichen Hindernisse des Verkehrslebens illusorisch gemacht haben, zu dieser Krankheit aufweisen.«
v. Krafft-Ebing (1895, 11): »Die Lebensweise unzähliger Kulturmenschen weist heutzutage eine Fülle von antihygienischen Momenten auf, die es ohne weiteres begreifen lassen, daß die Nervosität in fataler Weise um sich greift, denn diese schädlichen Momente wirken zunächst und zumeist aufs Gehirn. In den politischen und sozialen, speziell den merkantilen, industriellen, agrarischen Verhältnissen der Kulturnationen haben sich eben im Laufe der letzten Jahrzehnte Änderungen vollzogen, die Beruf, bürgerliche Stellung, Besitz gewaltig umgeändert haben, und zwar auf Kosten des Nervensystems, das gesteigerten sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen durch vermehrte Verausgabung an Spannkraft bei vielfach ungenügender Erholung gerecht werden muß.«
Ich habe an diesen –; und vielen anderen ähnlich klingenden –; Lehren auszusetzen, nicht daß sie irrtümlich sind, sondern daß sie sich unzulänglich erweisen, die Einzelheiten in der Erscheinung der nervösen Störungen aufzuklären, und daß sie gerade das bedeutsamste der ätiologisch wirksamen Momente außer acht lassen. Sieht man von den unbestimmteren Arten, »nervös« zu sein, ab und faßt die eigentlichen Formen des nervösen Krankseins ins Auge, so reduziert sich der schädigende Einfluß der Kultur im wesentlichen auf die schädliche Unterdrückung des Sexuallebens der Kulturvölker (oder Schichten) durch die bei ihnen herrschende »kulturelle« Sexualmoral.
Den Beweis für diese Behauptung habe ich in einer Reihe fachmännischer Arbeiten zu erbringen gesucht [Fußnote]Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Wien 1906. (4. Aufl., 1922.); er kann hier nicht wiederholt werden, doch will ich die wichtigsten Argumente aus meinen Untersuchungen auch an dieser Stelle anführen.
Geschärfte klinische Beobachtung gibt uns das Recht, von den nervösen Krankheitszuständen zwei Gruppen zu unterscheiden, die eigentlichen Neurosen und die Psychoneurosen. Bei den ersteren scheinen die Störungen (Symptome), mögen sie sich in den körperlichen oder in den seelischen Leistungen äußern, toxischer Natur zu sein: sie verhalten sich ganz ähnlich wie die Erscheinungen bei übergroßer Zufuhr oder bei Entbehrung gewisser Nervengifte. Diese Neurosen –; meist als Neurasthenie zusammengefaßt –; können nun, ohne daß die Mithilfe einer erblichen Belastung erforderlich wäre, durch gewisse schädliche Einflüsse des Sexuallebens erzeugt werden, und zwar korrespondiert die Form der Erkrankung mit der Art dieser Schädlichkeiten, so daß man oft genug das klinische Bild ohne weiteres zum Rückschluß auf die besondere sexuelle Ätiologie verwenden kann. Eine solche regelmäßige Entsprechung wird aber zwischen der Form der nervösen Erkrankung und den anderen schädigenden Kultureinflüssen, welche die Autoren als krankmachend anklagen, durchaus vermißt. Man darf also den sexuellen Faktor für den wesentlichen in der Verursachung der eigentlichen Neurosen erklären.
Bei den Psychoneurosen ist der hereditäre Einfluß bedeutsamer, die Verursachung minder durchsichtig. Ein eigentümliches Untersuchungsverfahren, das als Psychoanalyse bekannt ist, hat aber gestattet zu erkennen, daß die Symptome dieser Leiden (der Hysterie, Zwangsneurose usw.) psychogen sind, von der Wirksamkeit unbewußter (verdrängter) Vorstellungskomplexe abhängen. Dieselbe Methode hat uns aber auch diese unbewußten Komplexe kennen gelehrt und uns gezeigt, daß sie, ganz allgemein gesprochen, sexuellen Inhalt haben; sie entspringen den Sexualbedürfnissen unbefriedigter Menschen und stellen für sie eine Art von Ersatzbefriedigung dar. Somit müssen wir in allen Momenten, welche das Sexualleben schädigen, seine Betätigung unterdrücken, seine Ziele verschieben, pathogene Faktoren auch der Psychoneurosen erblicken.
Der Wert der theoretischen Unterscheidung zwischen den toxischen und den psychogenen Neurosen wird natürlich durch die Tatsache nicht beeinträchtigt, daß an den meisten nervösen Personen Störungen von beiderlei Herkunft zu beobachten sind.
Wer nun mit mir bereit ist, die Ätiologie der Nervosität vor allem in schädigenden Einwirkungen auf das Sexualleben zu suchen, der wird auch den nachstehenden Erörterungen folgen wollen, welche das Thema der wachsenden Nervosität in einen allgemeineren Zusammenhang einzufügen bestimmt sind.
Unsere Kultur ist ganz allgemein auf der Unterdrückung von Trieben aufgebaut. Jeder Einzelne hat ein Stück seines Besitzes, seiner Machtvollkommenheit, der aggressiven und vindikativen Neigungen seiner Persönlichkeit abgetreten; aus diesen Beiträgen ist der gemeinsame Kulturbesitz an materiellen und ideellen Gütern entstanden. Außer der Lebensnot sind es wohl die aus der Erotik abgeleiteten Familiengefühle, welche die einzelnen Individuen zu diesem Verzichte bewogen haben. Der Verzicht ist ein im Laufe der Kulturentwicklung progressiver gewesen; die einzelnen Fortschritte desselben wurden von der Religion sanktioniert; das Stück Triebbefriedigung, auf das man verzichtet hatte, wurde der Gottheit zum Opfer gebracht; das so erworbene Gemeingut für »heilig« erklärt. Wer kraft seiner unbeugsamen Konstitution diese Triebunterdrückung nicht mitmachen kann, steht der Gesellschaft als »Verbrecher«, als » outlaw« gegenüber, insofern nicht seine soziale Position und seine hervorragenden Fähigkeiten ihm gestatten, sich in ihr als großer Mann, als »Held« durchzusetzen.
Der Sexualtrieb –; oder richtiger gesagt: die Sexualtriebe, denn eine analytische Untersuchung lehrt, daß der Sexualtrieb aus vielen Komponenten, Partialtrieben, zusammengesetzt ist –; ist beim Menschen wahrscheinlich stärker ausgebildet als bei den meisten höheren Tieren und jedenfalls stetiger, da er die Periodizität fast völlig überwunden hat, an die er sich bei den Tieren gebunden zeigt. Er stellt der Kulturarbeit außerordentlich große Kraftmengen zur Verfügung, und dies zwar infolge der bei ihm besonders ausgeprägten Eigentümlichkeit, sein Ziel verschieben zu können, ohne wesentlich an Intensität abzunehmen. Man nennt diese Fähigkeit, das ursprünglich sexuelle Ziel gegen ein anderes, nicht mehr sexuelles, aber psychisch mit ihm verwandtes, zu vertauschen, die Fähigkeit zur Sublimierung. Im Gegensatze zu dieser Verschiebbarkeit, in welcher sein kultureller Wert besteht, kommt beim Sexualtrieb auch besonders hartnäckige Fixierung vor, durch die er unverwertbar wird und gelegentlich zu den sogenannten Abnormitäten entartet. Die ursprüngliche Stärke des Sexualtriebes ist wahrscheinlich bei den einzelnen Individuen verschieden groß; sicherlich schwankend ist der von ihm zur Sublimierung geeignete Betrag. Wir stellen uns vor, daß es zunächst durch die mitgebrachte Organisation entschieden ist, ein wie großer Anteil des Sexualtriebes sich beim Einzelnen als sublimierbar und verwertbar erweisen wird; außerdem gelingt es den Einflüssen des Lebens und der intellektuellen Beeinflussung des seelischen Apparates, einen weiteren Anteil zur Sublimierung zu bringen. Ins Unbegrenzte fortzusetzen ist dieser Verschiebungsprozeß aber sicherlich nicht, so wenig wie die Umsetzung der Wärme in mechanische Arbeit bei unseren Maschinen. Ein gewisses Maß direkter sexueller Befriedigung scheint für die allermeisten Organisationen unerläßlich, und die Versagung dieses individuell variablen Maßes straft sich durch Erscheinungen, die wir infolge ihrer Funktionsschädlichkeit und ihres subjektiven Unlustcharakters zum Kranksein rechnen müssen.
Weitere Ausblicke eröffnen sich, wenn wir die Tatsache in Betracht ziehen, daß der Sexualtrieb des Menschen ursprünglich gar nicht den Zwecken der Fortpflanzung dient, sondern bestimmte Arten der Lustgewinnung zum Ziele hat [Fußnote]Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905 d).. Er äußert sich so in der Kindheit des Menschen, wo er sein Ziel der Lustgewinnung nicht nur an den Genitalien, sondern auch an anderen Körperstellen (erogenen Zonen) erreicht und darum von anderen als diesen bequemen Objekten absehen darf. Wir heißen dieses Stadium das des Autoerotismus und weisen der Erziehung die Aufgabe, es einzuschränken, zu, weil das Verweilen bei demselben den Sexualtrieb für später unbeherrschbar und unverwertbar machen würde. Die Entwicklung des Sexualtriebes geht dann vom Autoerotismus zur Objektliebe und von der Autonomie der erogenen Zonen zur Unterordnung derselben unter das Primat der in den Dienst der Fortpflanzung gestellten Genitalien. Während dieser Entwicklung wird ein Anteil der vom eigenen Körper gelieferten Sexualerregung als unbrauchbar für die Fortpflanzungsfunktion gehemmt und im günstigen Falle der Sublimierung zugeführt. Die für die Kulturarbeit verwertbaren Kräfte werden so zum großen Teile durch die Unterdrückung der sogenannt perversen Anteile der Sexualerregung gewonnen.
Mit Bezug auf diese Entwicklungsgeschichte des Sexualtriebes könnte man also drei Kulturstufen unterscheiden: eine erste, auf welcher die Betätigung des Sexualtriebes auch über die Ziele der Fortpflanzung hinaus frei ist; eine zweite, auf welcher alles am Sexualtrieb unterdrückt ist bis auf das, was der Fortpflanzung dient, und eine dritte, auf welcher nur die legitime Fortpflanzung als Sexualziel zugelassen wird. Dieser dritten Stufe entspricht unsere gegenwärtige »kulturelle« Sexualmoral.
Nimmt man die zweite dieser Stufen zum Niveau, so muß man zunächst konstatieren, daß eine Anzahl von Personen aus Gründen der Organisation den Anforderungen derselben nicht genügt. Bei ganzen Reihen von Individuen hat sich die erwähnte Entwicklung des Sexualtriebes vom Autoerotismus zur Objektliebe mit dem Ziel der Vereinigung der Genitalien nicht korrekt und nicht genug durchgreifend vollzogen, und aus diesen Entwicklungsstörungen ergeben sich zweierlei schädliche Abweichungen von der normalen, das heißt kulturförderlichen Sexualität, die sich zueinander nahezu wie positiv und negativ verhalten. Es sind dies zunächst –; abgesehen von den Personen mit überstarkem und unhemmbarem Sexualtrieb überhaupt –; die verschiedenen Gattungen der Perversen, bei denen eine infantile Fixierung auf ein vorläufiges Sexualziel das Primat der Fortpflanzungsfunktion aufgehalten hat, und die Homosexuellen oder Invertierten, bei denen auf noch nicht ganz aufgeklärte Weise das Sexualziel vom entgegengesetzten Geschlecht abgelenkt worden ist. Wenn die Schädlichkeit dieser beiden Arten von Entwicklungsstörung geringer ausfällt, als man hätte erwarten können, so ist diese Erleichterung gerade auf die komplexe Zusammensetzung des Sexualtriebes zurückzuführen, welche auch dann noch eine brauchbare Endgestaltung des Sexuallebens ermöglicht, wenn ein oder mehrere Komponenten des Triebes sich von der Entwicklung ausgeschlossen haben. Die Konstitution der von der Inversion Betroffenen, der Homosexuellen, zeichnet sich sogar häufig durch eine besondere Eignung des Sexualtriebes zur kulturellen Sublimierung aus.
Stärkere und zumal exklusive Ausbildungen der Perversionen und der Homosexualität machen allerdings deren Träger sozial unbrauchbar und unglücklich, so daß selbst die Kulturanforderungen der zweiten Stufe als eine Quelle des Leidens für einen gewissen Anteil der Menschheit anerkannt werden müssen. Das Schicksal dieser konstitutiv von den anderen abweichenden Personen ist ein mehrfaches, je nachdem sie einen absolut starken oder schwächeren Geschlechtstrieb mitbekommen haben. Im letzteren Falle, bei allgemein schwachem Sexualtrieb, gelingt den Perversen die völlige Unterdrückung jener Neigungen, welche sie in Konflikt mit der Moralforderung ihrer Kulturstufe bringen. Aber dies bleibt auch, ideell betrachtet, die einzige Leistung, die ihnen gelingt, denn für diese Unterdrückung ihrer sexuellen Triebe verbrauchen sie die Kräfte, die sie sonst an die Kulturarbeit wenden würden. Sie sind gleichsam in sich gehemmt und nach außen gelähmt. Es trifft für sie zu, was wir später von der Abstinenz der Männer und Frauen, die auf der dritten Kulturstufe gefordert wird, wiederholen werden.
Bei intensiverem, aber perversem Sexualtrieb sind zwei Fälle des Ausganges möglich. Der erste, weiter nicht zu betrachtende, ist der, daß die Betroffenen pervers bleiben und die Konsequenzen ihrer Abweichung vom Kulturniveau zu tragen haben. Der zweite Fall ist bei weitem interessanter –; er besteht darin, daß unter dem Einflusse der Erziehung und der sozialen Anforderungen allerdings eine Unterdrückung der perversen Triebe erreicht wird, aber eine Art von Unterdrückung, die eigentlich keine solche ist, die besser als ein Mißglücken der Unterdrückung bezeichnet werden kann. Die gehemmten Sexualtriebe äußern sich zwar dann nicht als solche: darin besteht der Erfolg –; aber sie äußern sich auf andere Weisen, die für das Individuum genau ebenso schädlich sind und es für die Gesellschaft ebenso unbrauchbar machen wie die unveränderte Befriedigung jener unterdrückten Triebe: darin liegt dann der Mißerfolg des Prozesses, der auf die Dauer den Erfolg mehr als bloß aufwiegt. Die Ersatzerscheinungen, die hier infolge der Triebunterdrückung auftreten, machen das aus, was wir als Nervosität, spezieller als Psychoneurosen (siehe eingangs) beschreiben. Die Neurotiker sind jene Klasse von Menschen, die es bei widerstrebender Organisation unter dem Einflusse der Kulturanforderungen zu einer nur scheinbaren und immer mehr mißglückenden Unterdrückung ihrer Triebe bringen und die darum ihre Mitarbeiterschaft an den Kulturwerken nur mit großem Kräfteaufwand, unter innerer Verarmung, aufrechterhalten oder zeitweise als Kranke aussetzen müssen. Die Neurosen aber habe ich als das »Negativ« der Perversionen bezeichnet, weil sich bei ihnen die perversen Regungen nach der Verdrängung aus dem Unbewußten des Seelischen äußern, weil sie dieselben Neigungen wie die positiv Perversen im »verdrängten« Zustand enthalten.
Die Erfahrung lehrt, daß es für die meisten Menschen eine Grenze gibt, über die hinaus ihre Konstitution der Kulturanforderung nicht folgen kann. Alle, die edler sein wollen, als ihre Konstitution es ihnen gestattet, verfallen der Neurose; sie hätten sich wohler befunden, wenn es ihnen möglich geblieben wäre, schlechter zu sein. Die Einsicht, daß Perversion und Neurose sich wie positiv und negativ zueinander verhalten, findet oft eine unzweideutige Bekräftigung durch Beobachtung innerhalb der nämlichen Generation. Recht häufig ist von Geschwistern der Bruder ein sexuell Perverser, die Schwester, die mit dem schwächeren Sexualtrieb als Weib ausgestattet ist, eine Neurotika, deren Symptome aber dieselben Neigungen ausdrücken wie die Perversionen des sexuell aktiveren Bruders, und dementsprechend sind überhaupt in vielen Familien die Männer gesund, aber in sozial unerwünschtem Maße unmoralisch, die Frauen edel und überverfeinert, aber –; schwer nervös. Es ist eine der offenkundigen sozialen Ungerechtigkeiten, wenn der kulturelle Standard von allen Personen die nämliche Führung des Sexuallebens fordert, die den einen dank ihrer Organisation mühelos gelingt, während sie den anderen die schwersten psychischen Opfer auferlegt, eine Ungerechtigkeit freilich, die zumeist durch Nichtbefolgung der Moralvorschriften vereitelt wird.
Wir haben unseren Betrachtungen bisher die Forderung der zweiten von uns supponierten Kulturstufe zugrunde gelegt, derzufolge jede sogenannte perverse Sexualbetätigung verpönt, der normal genannte Sexualverkehr hingegen freigelassen wird. Wir haben gefunden, daß auch bei dieser Verteilung von sexueller Freiheit und Einschränkung eine Anzahl von Individuen als pervers beiseite geschoben, eine andere, die sich bemühen, nicht pervers zu sein, während sie es konstitutiv sein sollten, in die Nervosität gedrängt wird. Es ist nun leicht, den Erfolg vorherzusagen, der sich einstellen wird, wenn man die Sexualfreiheit weiter einschränkt und die Kulturforderung auf das Niveau der dritten Stufe erhöht, also jede andere Sexualbetätigung als die in legitimer Ehe verpönt. Die Zahl der Starken, die sich in offenen Gegensatz zur Kulturforderung stellen, wird in außerordentlichem Maße vermehrt werden, und ebenso die Zahl der Schwächeren, die sich in ihrem Konflikte zwischen dem Drängen der kulturellen Einflüsse und dem Widerstände ihrer Konstitution in neurotisches Kranksein –; flüchten.
Setzen wir uns vor, drei hier entspringende Fragen zu beantworten: 1.) welche Aufgabe die Kulturforderung der dritten Stufe an den Einzelnen stellt, 2.) ob die zugelassene legitime Sexualbefriedigung eine annehmbare Entschädigung für den sonstigen Verzicht zu bieten vermag, 3.) in welchem Verhältnisse die etwaigen Schädigungen durch diesen Verzicht zu dessen kulturellen Ausnützungen stehen.
Die Beantwortung der ersten Frage rührt an ein oftmals behandeltes, hier nicht zu erschöpfendes Problem, das der sexuellen Abstinenz. Was unsere dritte Kulturstufe von dem Einzelnen fordert, ist die Abstinenz bis zur Ehe für beide Geschlechter, die lebenslange Abstinenz für alle solche, die keine legitime Ehe eingehen. Die allen Autoritäten genehme Behauptung, die sexuelle Abstinenz sei nicht schädlich und nicht gar schwer durchzuführen, ist vielfach auch von Ärzten vertreten worden. Man darf sagen, die Aufgabe der Bewältigung einer so mächtigen Regung wie des Sexualtriebes anders als auf dem Wege der Befriedigung ist eine, die alle Kräfte eines Menschen in Anspruch nehmen kann. Die Bewältigung durch Sublimierung, durch Ablenkung der sexuellen Triebkräfte vom sexuellen Ziele weg auf höhere kulturelle Ziele gelingt einer Minderzahl, und wohl auch dieser nur zeitweilig, am wenigsten leicht in der Lebenszeit feuriger Jugendkraft. Die meisten anderen werden neurotisch oder kommen sonst zu Schaden. Die Erfahrung zeigt, daß die Mehrzahl der unsere Gesellschaft zusammensetzenden Personen der Aufgabe der Abstinenz konstitutionell nicht gewachsen ist. Wer auch bei milderer Sexualeinschränkung erkrankt wäre, erkrankt unter den Anforderungen unserer heutigen kulturellen Sexualmoral um so eher und um so intensiver, denn gegen die Bedrohung des normalen Sexualstrebens durch fehlerhafte Anlagen und Entwicklungsstörungen kennen wir keine bessere Sicherung als die Sexualbefriedigung selbst. Je mehr jemand zur Neurose disponiert ist, desto schlechter verträgt er die Abstinenz; die Partialtriebe, die sich der normalen Entwicklung im oben niedergelegten Sinne entzogen haben, sind nämlich auch gleichzeitig um soviel unhemmbarer geworden. Aber auch diejenigen, welche bei den Anforderungen der zweiten Kulturstufe gesund geblieben wären, werden nun in großer Anzahl der Neurose zugeführt. Denn der psychische Wert der Sexualbefriedigung erhöht sich mit ihrer Versagung; die gestaute Libido wird nun in den Stand gesetzt, irgendeine der selten fehlenden schwächeren Stellen im Aufbau der vita sexualis auszuspüren, um dort zur neurotischen Ersatzbefriedigung in Form krankhafter Symptome durchzubrechen. Wer in die Bedingtheit nervöser Erkrankung einzudringen versteht, verschafft sich bald die Überzeugung, daß die Zunahme der nervösen Erkrankungen in unserer Gesellschaft von der Steigerung der sexuellen Einschränkung herrührt.
Wir rücken dann der Frage näher, ob nicht der Sexualverkehr in legitimer Ehe eine volle Entschädigung für die Einschränkung vor der Ehe bieten kann. Das Material zur verneinenden Beantwortung dieser Frage drängt sich da so reichlich auf, daß uns die knappste Fassung zur Pflicht wird. Wir erinnern vor allem daran, daß unsere kulturelle Sexualmoral auch den sexuellen Verkehr in der Ehe selbst beschränkt, indem sie den Eheleuten den Zwang auferlegt, sich mit einer meist sehr geringen Anzahl von Kinderzeugungen zu begnügen. Infolge dieser Rücksicht gibt es befriedigenden Sexualverkehr in der Ehe nur durch einige Jahre, natürlich noch mit Abzug der zur Schonung der Frau aus hygienischen Gründen erforderten Zeiten. Nach diesen drei, vier oder fünf Jahren versagt die Ehe, insofern sie die Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse versprochen hat; denn alle Mittel, die sich bisher zur Verhütung der Konzeption ergeben haben, verkümmern den sexuellen Genuß, stören die feinere Empfindlichkeit beider Teile oder wirken selbst direkt krankmachend; mit der Angst vor den Folgen des Geschlechtsverkehres schwindet zuerst die körperliche Zärtlichkeit der Ehegatten füreinander, in weiterer Folge meist auch die seelische Zuneigung, die bestimmt war, das Erbe der anfänglichen stürmischen Leidenschaft zu übernehmen. Unter der seelischen Enttäuschung und körperlichen Entbehrung, die so das Schicksal der meisten Ehen wird, finden sich beide Teile auf den früheren Zustand vor der Ehe zurückversetzt, nur um eine Illusion verarmt und von neuem auf ihre Festigkeit, den Sexualtrieb zu beherrschen und abzulenken, angewiesen. Es soll nicht untersucht werden, inwieweit diese Aufgabe nun dem Manne im reiferen Lebensalter gelingt; erfahrungsgemäß bedient er sich nun recht häufig des Stückes Sexualfreiheit, welches ihm auch von der strengsten Sexualordnung, wenngleich nur stillschweigend und widerwillig, eingeräumt wird; die für den Mann in unserer Gesellschaft geltende »doppelte« Sexualmoral ist das beste Eingeständnis, daß die Gesellschaft selbst, welche die Vorschriften erlassen hat, nicht an deren Durchführbarkeit glaubt. Die Erfahrung zeigt aber auch, daß die Frauen, denen als den eigentlichen Trägerinnen der Sexualinteressen des Menschen die Gabe der Sublimierung des Triebes nur in geringem Maße zugeteilt ist, denen als Ersatz des Sexualobjektes zwar der Säugling, aber nicht das heranwachsende Kind genügt, daß die Frauen, sage ich, unter den Enttäuschungen der Ehe an schweren und das Leben dauernd trübenden Neurosen erkranken. Die Ehe hat unter den heutigen kulturellen Bedingungen längst aufgehört, das Allheilmittel gegen die nervösen Leiden des Weibes zu sein; und wenn wir Ärzte auch noch immer in solchen Fällen zu ihr raten, so wissen wir doch, daß im Gegenteil ein Mädchen recht gesund sein muß, um die Ehe zu »vertragen«, und raten unseren männlichen Klienten dringend ab, ein bereits vor der Ehe nervöses Mädchen zur Frau zu nehmen. Das Heilmittel gegen die aus der Ehe entspringende Nervosität wäre vielmehr die eheliche Untreue; je strenger eine Frau erzogen ist, je ernsthafter sie sich der Kulturforderung unterworfen hat, desto mehr fürchtet sie aber diesen Ausweg, und im Konflikte zwischen ihren Begierden und ihrem Pflichtgefühl sucht sie ihre Zuflucht wiederum –; in der Neurose. Nichts anderes schützt ihre Tugend so sicher wie die Krankheit. Der eheliche Zustand, auf den der Sexualtrieb des Kulturmenschen während seiner Jugend vertröstet wurde, kann also die Anforderungen seiner eigenen Lebenszeit nicht decken; es ist keine Rede davon, daß er für den früheren Verzicht entschädigen könnte.
Auch wer diese Schädigungen durch die kulturelle Sexualmoral zugibt, kann zur Beantwortung unserer dritten Frage geltend machen, daß der kulturelle Gewinn aus der soweit getriebenen Sexualeinschränkung diese Leiden, die in schwerer Ausprägung doch nur eine Minderheit betreffen, wahrscheinlich mehr als bloß aufwiegt. Ich erkläre mich für unfähig, Gewinn und Verlust hier richtig gegeneinander abzuwägen, aber zur Einschätzung der Verlustseite könnte ich noch allerlei anführen. Auf das vorhin gestreifte Thema der Abstinenz zurückgreifend, muß ich behaupten, daß die Abstinenz noch andere Schädigungen bringt als die der Neurosen und daß diese Neurosen meist nicht nach ihrer vollen Bedeutung veranschlagt werden.
Die Verzögerung der Sexualentwicklung und Sexualbetätigung, welche unsere Erziehung und Kultur anstrebt, ist zunächst gewiß unschädlich; sie wird zur Notwendigkeit, wenn man in Betracht zieht, in wie späten Jahren erst die jungen Leute gebildeter Stände zu selbständiger Geltung und zum Erwerb zugelassen werden. Man wird hier übrigens an den intimen Zusammenhang aller unserer kulturellen Institutionen und an die Schwierigkeit gemahnt, ein Stück derselben ohne Rücksicht auf das Ganze abzuändern. Die Abstinenz weit über das zwanzigste Jahr hinaus ist aber für den jungen Mann nicht mehr unbedenklich und führt zu anderen Schädigungen, auch wo sie nicht zur Nervosität führt. Man sagt zwar, der Kampf mit dem mächtigen Triebe und die dabei erforderliche Betonung aller ethischen und ästhetischen Mächte im Seelenleben »stähle« den Charakter, und dies ist für einige besonders günstig organisierte Naturen richtig; zuzugeben ist auch, daß die in unserer Zeit so ausgeprägte Differenzierung der individuellen Charaktere erst mit der Sexualeinschränkung möglich geworden ist. Aber in der weitaus größeren Mehrheit der Fälle zehrt der Kampf gegen die Sinnlichkeit die verfügbare Energie des Charakters auf und dies gerade zu einer Zeit, in welcher der junge Mann all seiner Kräfte bedarf, um sich seinen Anteil und Platz in der Gesellschaft zu erobern. Das Verhältnis zwischen möglicher Sublimierung und notwendiger sexueller Betätigung schwankt natürlich sehr für die einzelnen Individuen und sogar für die verschiedenen Berufsarten. Ein abstinenter Künstler ist kaum recht möglich, ein abstinenter junger Gelehrter gewiß keine Seltenheit. Der letztere kann durch Enthaltsamkeit freie Kräfte für sein Studium gewinnen, beim ersteren wird wahrscheinlich seine künstlerische Leistung durch sein sexuelles Erleben mächtig angeregt werden. Im allgemeinen habe ich nicht den Eindruck gewonnen, daß die sexuelle Abstinenz energische, selbständige Männer der Tat oder originelle Denker, kühne Befreier und Reformer heranbilden helfe, weit häufiger brave Schwächlinge, welche später in die große Masse eintauchen, die den von starken Individuen gegebenen Impulsen widerstrebend zu folgen pflegt.
Daß der Sexualtrieb im ganzen sich eigenwillig und ungefügig benimmt, kommt auch in den Ergebnissen der Abstinenzbemühung zum Ausdruck. Die Kulturerziehung strebe etwa nur seine zeitweilige Unterdrückung bis zur Eheschließung an und beabsichtige ihn dann freizulassen, um sich seiner zu bedienen. Aber gegen den Trieb gelingen die extremen Beeinflussungen leichter noch als die Mäßigungen; die Unterdrückung ist sehr oft zu weit gegangen und hat das unerwünschte Resultat ergeben, daß der Sexualtrieb nach seiner Freilassung dauernd geschädigt erscheint. Darum ist oft volle Abstinenz während der Jugendzeit nicht die beste Vorbereitung für die Ehe beim jungen Manne. Die Frauen ahnen dies und ziehen unter ihren Bewerbern diejenigen vor, die sich schon bei anderen Frauen als Männer bewährt haben. Ganz besonders greifbar sind die Schädigungen, welche durch die strenge Forderung der Abstinenz bis zur Ehe am Wesen der Frau hervorgerufen werden. Die Erziehung nimmt die Aufgabe, die Sinnlichkeit des Mädchens bis zu seiner Verehelichung zu unterdrücken, offenbar nicht leicht, denn sie arbeitet mit den schärfsten Mitteln. Sie untersagt nicht nur den sexuellen Verkehr, setzt hohe Prämien auf die Erhaltung der weiblichen Unschuld, sondern sie entzieht das reifende weibliche Individuum auch der Versuchung, indem sie es in Unwissenheit über alles Tatsächliche der ihm bestimmten Rolle erhält und keine Liebesregung, die nicht zur Ehe führen kann, bei ihm duldet. Der Erfolg ist, daß die Mädchen, wenn ihnen das Verlieben plötzlich von den elterlichen Autoritäten gestattet wird, die psychische Leistung nicht zustande bringen und ihrer eigenen Gefühle unsicher in die Ehe gehen. Infolge der künstlichen Verzögerung der Liebesfunktion bereiten sie dem Manne, der all sein Begehren für sie aufgespart hat, nur Enttäuschungen; mit ihren seelischen Gefühlen hängen sie noch den Eltern an, deren Autorität die Sexualunterdrückung bei ihnen geschaffen hat, und im körperlichen Verhalten zeigen sie sich frigid, was jeden höherwertigen Sexualgenuß beim Manne verhindert. Ich weiß nicht, ob der Typus der anästhetischen Frau auch außerhalb der Kulturerziehung vorkommt, halte es aber für wahrscheinlich. Jedenfalls wird er durch die Erziehung geradezu gezüchtet, und diese Frauen, die ohne Lust empfangen, zeigen dann wenig Bereitwilligkeit, des öfteren mit Schmerzen zu gebären. So werden durch die Vorbereitung zur Ehe die Zwecke der Ehe selbst vereitelt; wenn dann die Entwicklungsverzögerung bei der Frau überwunden ist und auf der Höhe ihrer weiblichen Existenz die volle Liebesfähigkeit bei ihr erwacht, ist ihr Verhältnis zum Ehemanne längst verdorben; es bleibt ihr als Lohn für ihre bisherige Gefügigkeit die Wahl zwischen ungestilltem Sehnen, Untreue oder Neurose.
Das sexuelle Verhalten eines Menschen ist oft vorbildlich für seine ganze sonstige Reaktionsweise in der Welt. Wer als Mann sein Sexualobjekt energisch erobert, dem trauen wir ähnliche rücksichtslose Energie auch in der Verfolgung anderer Ziele zu. Wer hingegen auf die Befriedigung seiner starken sexuellen Triebe aus allerlei Rücksichten verzichtet, der wird sich auch anderwärts im Leben eher konziliant und resigniert als tatkräftig benehmen. Eine spezielle Anwendung dieses Satzes von der Vorbildlichkeit des Sexuallebens für andere Funktionsausübung kann man leicht am ganzen Geschlechte der Frauen konstatieren. Die Erziehung versagt ihnen die intellektuelle Beschäftigung mit den Sexualproblemen, für die sie doch die größte Wißbegierde mitbringen, schreckt sie mit der Verurteilung, daß solche Wißbegierde unweiblich und Zeichen sündiger Veranlagung sei. Damit sind sie vom Denken überhaupt abgeschreckt, wird das Wissen für sie entwertet. Das Denkverbot greift über die sexuelle Sphäre hinaus, zum Teil infolge der unvermeidlichen Zusammenhänge, zum Teil automatisch, ganz ähnlich wie das religiöse Denkverbot bei Männern, das loyale bei braven Untertanen. Ich glaube nicht, daß der biologische Gegensatz zwischen intellektueller Arbeit und Geschlechtstätigkeit den »physiologischen Schwachsinn« der Frau erklärt, wie Moebius es in seiner vielfach widersprochenen Schrift dargetan hat. Dagegen meine ich, daß die unzweifelhafte Tatsache der intellektuellen Inferiorität so vieler Frauen auf die zur Sexualunterdrückung erforderliche Denkhemmung zurückzuführen ist.
Man unterscheidet viel zu wenig strenge, wenn man die Frage der Abstinenz behandelt, zwei Formen derselben, die Enthaltung von jeder Sexualbetätigung überhaupt und die Enthaltung vom sexuellen Verkehre mit dem anderen Geschlechte. Vielen Personen, die sich der gelungenen Abstinenz rühmen, ist dieselbe nur mit Hilfe der Masturbation und ähnlicher Befriedigungen möglich geworden, die an die autoerotischen Sexualtätigkeiten der frühen Kindheit anknüpfen. Aber gerade dieser Beziehung wegen sind diese Ersatzmittel zur sexuellen Befriedigung keineswegs harmlos; sie disponieren zu den zahlreichen Formen von Neurosen und Psychosen, für welche die Rückbildung des Sexuallebens zu seinen infantilen Formen die Bedingung ist. Die Masturbation entspricht auch keineswegs den idealen Anforderungen der kulturellen Sexualmoral und treibt darum die jungen Menschen in die nämlichen Konflikte mit dem Erziehungsideale, denen sie durch die Abstinenz entgehen wollten. Sie verdirbt ferner den Charakter durch Verwöhnung auf mehr als eine Weise, erstens, indem sie bedeutsame Ziele mühelos, auf bequemen Wegen, anstatt durch energische Kraftanspannung erreichen lehrt, also nach dem Prinzipe der sexuellen Vorbildlichkeit, und zweitens, indem sie in den die Befriedigung begleitenden Phantasien das Sexualobjekt zu einer Vorzüglichkeit erhebt, die in der Realität nicht leicht wiedergefunden wird. Konnte doch ein geistreicher Schriftsteller (Karl Kraus in der Wiener Fackel), den Spieß umdrehend, die Wahrheit in dem Zynismus aussprechen: Der Koitus ist nur ein ungenügendes Surrogat für die Onanie!
Die Strenge der Kulturforderung und die Schwierigkeit der Abstinenzaufgabe haben zusammengewirkt, um die Vermeidung der Vereinigung der Genitalien verschiedener Geschlechter zum Kerne der Abstinenz zu machen und andere Arten der sexuellen Betätigung zu begünstigen, die sozusagen einem Halbgehorsam gleichkommen. Seitdem der normale Sexualverkehr von der Moral –; und wegen der Infektionsmöglichkeiten auch von der Hygiene –; so unerbittlich verfolgt wird, haben die sogenannten perversen Arten des Verkehrs zwischen beiden Geschlechtern, bei denen andere Körperstellen die Rolle der Genitalien übernehmen, an sozialer Bedeutung unzweifelhaft zugenommen. Diese Betätigungen können aber nicht so harmlos beurteilt werden wie analoge Überschreitungen im Liebesverkehre, sie sind ethisch verwerflich, da sie die Liebesbeziehungen zweier Menschen aus einer ernsten Sache zu einem bequemen Spiele ohne Gefahr und ohne seelische Beteiligung herabwürdigen. Als weitere Folge der Erschwerung des normalen Sexuallebens ist die Ausbreitung homosexueller Befriedigung anzuführen; zu all denen, die schon nach ihrer Organisation Homosexuelle sind oder in der Kindheit dazu wurden, kommt noch die große Anzahl jener hinzu, bei denen in reiferen Jahren wegen der Absperrung des Hauptstromes der Libido der homosexuelle Seitenarm breit geöffnet wird.
Alle diese unvermeidlichen und unbeabsichtigten Konsequenzen der Abstinenzforderung treffen in dem einen Gemeinsamen zusammen, daß sie die Vorbereitung für die Ehe gründlich verderben, die doch nach der Absicht der kulturellen Sexualmoral die alleinige Erbin der sexuellen Strebungen werden sollte. Alle die Männer, die infolge masturbatorischer oder perverser Sexualübung ihre Libido auf andere als die normalen Situationen und Bedingungen der Befriedigung eingestellt haben, entwickeln in der Ehe eine verminderte Potenz. Auch die Frauen, denen es nur durch ähnliche Hilfen möglich blieb, ihre Jungfräulichkeit zu bewahren, zeigen sich in der Ehe für den normalen Verkehr anästhetisch. Die mit herabgesetzter Liebesfähigkeit beider Teile begonnene Ehe verfällt dem Auflösungsprozesse nur noch rascher als eine andere. Infolge der geringen Potenz des Mannes wird die Frau nicht befriedigt, bleibt auch dann anästhetisch, wenn ihre aus der Erziehung mitgebrachte Disposition zur Frigidität durch mächtiges sexuelles Erleben überwindbar gewesen wäre. Ein solches Paar findet auch die Kinderverhütung schwieriger als ein gesundes, da die geschwächte Potenz des Mannes die Anwendung der Verhütungsmittel schlecht verträgt. In solcher Ratlosigkeit wird der sexuelle Verkehr als die Quelle aller Verlegenheiten bald aufgegeben und damit die Grundlage des Ehelebens verlassen.
Ich fordere alle Kundigen auf zu bestätigen, daß ich nicht übertreibe, sondern Verhältnisse schildere, die ebenso arg in beliebiger Häufigkeit zu beobachten sind. Es ist wirklich für den Uneingeweihten ganz unglaublich, wie selten sich normale Potenz beim Manne und wie häufig sich Frigidität bei der weiblichen Hälfte der Ehepaare findet, die unter der Herrschaft unserer kulturellen Sexualmoral stehen, mit welchen Entsagungen, oft für beide Teile, die Ehe verbunden ist und worauf das Eheleben, das so sehnsüchtig erstrebte Glück, sich einschränkt. Daß unter diesen Verhältnissen der Ausgang in Nervosität der nächstliegende ist, habe ich schon ausgeführt; ich will aber noch hinzusetzen, in welcher Weise eine solche Ehe auf die in ihr entsprungenen –; einzigen oder wenig zahlreichen –; Kinder fortwirkt. Es kommt da der Anschein einer erblichen Übertragung zustande, der sich bei schärferem Zusehen in die Wirkung mächtiger infantiler Eindrücke auflöst. Die von ihrem Manne unbefriedigte neurotische Frau ist als Mutter überzärtlich und überängstlich gegen das Kind, auf das sie ihr Liebesbedürfnis überträgt, und weckt in demselben die sexuelle Frühreife. Das schlechte Einverständnis zwischen den Eltern reizt dann das Gefühlsleben des Kindes auf, läßt es im zartesten Alter Liebe, Haß und Eifersucht intensiv empfinden. Die strenge Erziehung, die keinerlei Betätigung des so früh geweckten Sexuallebens duldet, stellt die unterdrückende Macht bei, und dieser Konflikt in diesem Alter enthält alles, was es zur Verursachung der lebenslangen Nervosität bedarf.
Ich komme nun auf meine frühere Behauptung zurück, daß man bei der Beurteilung der Neurosen zumeist nicht deren volle Bedeutung in Betracht zieht. Ich meine damit nicht die Unterschätzung dieser Zustände, die sich in leichtsinnigem Beiseiteschieben von Seiten der Angehörigen und in großtuerischen Versicherungen von Seiten der Ärzte äußert, einige Wochen Kaltwasserkur oder einige Monate Ruhe und Erholung könnten den Zustand beseitigen. Das sind nur mehr Meinungen von ganz unwissenden Ärzten und Laien, zumeist nur Reden, dazu bestimmt, den Leidenden einen kurzlebigen Trost zu bieten. Es ist vielmehr bekannt, daß eine chronische Neurose, auch wenn sie die Existenzfähigkeit nicht völlig aufhebt, eine schwere Lebensbelastung des Individuums vorstellt, etwa im Range einer Tuberkulose oder eines Herzfehlers. Auch könnte man sich damit abfinden, wenn die neurotischen Erkrankungen etwa nur eine Anzahl von immerhin schwächeren Individuen von der Kulturarbeit ausschließen und den anderen die Teilnahme daran um den Preis von bloß subjektiven Beschwerden gestatten würden. Ich möchte vielmehr auf den Gesichtspunkt aufmerksam machen, daß die Neurose, soweit sie reicht und bei wem immer sie sich findet, die Kulturabsicht zu vereiteln weiß und somit eigentlich die Arbeit der unterdrückten kulturfeindlichen Seelenkräfte besorgt, so daß die Gesellschaft nicht einen mit Opfern erkauften Gewinn, sondern gar keinen Gewinn verzeichnen darf, wenn sie die Gefügigkeit gegen ihre weitgehenden Vorschriften mit der Zunahme der Nervosität bezahlt. Gehen wir z. B. auf den so häufigen Fall einer Frau ein, die ihren Mann nicht liebt, weil sie nach den Bedingungen ihrer Eheschließung und den Erfahrungen ihres Ehelebens ihn zu lieben keinen Grund hat, die ihren Mann aber durchaus lieben möchte, weil dies allein dem Ideal der Ehe, zu dem sie erzogen wurde, entspricht. Sie wird dann alle Regungen in sich unterdrücken, die der Wahrheit Ausdruck geben wollen und ihrem Idealbestreben widersprechen, und wird besondere Mühe aufwenden, eine liebevolle, zärtliche und sorgsame Gattin zu spielen. Neurotische Erkrankung wird die Folge dieser Selbstunterdrückung sein, und diese Neurose wird binnen kurzer Zeit an dem ungeliebten Manne Rache genommen haben und bei ihm genausoviel Unbefriedigung und Sorge hervorrufen, als sich nur aus dem Eingeständnisse des wahren Sachverhaltes ergeben hätte. Dieses Beispiel ist für die Leistungen der Neurose geradezu typisch. Ein ähnliches Mißlingen der Kompensation beobachtet man auch nach der Unterdrückung anderer, nicht direkt sexueller, kulturfeindlicher Regungen. Wer z. B. in der gewaltsamen Unterdrückung einer konstitutionellen Neigung zur Härte und Grausamkeit ein Überguter geworden ist, dem wird häufig dabei so viel an Energie entzogen, daß er nicht alles ausführt, was seinen Kompensationsregungen entspricht, und im ganzen doch eher weniger an Gutem leistet, als er ohne Unterdrückung zustande gebracht hätte.
Nehmen wir noch hinzu, daß mit der Einschränkung der sexuellen Betätigung bei einem Volke ganz allgemein eine Zunahme der Lebensängstlichkeit und der Todesangst einhergeht, welche die Genußfähigkeit der Einzelnen stört und ihre Bereitwilligkeit, für irgendwelche Ziele den Tod auf sich zu nehmen, aufhebt, welche sich in der verminderten Neigung zur Kinderzeugung äußert, und dieses Volk oder diese Gruppe von Menschen vom Anteile an der Zukunft ausschließt, so darf man wohl die Frage aufwerfen, ob unsere »kulturelle« Sexualmoral der Opfer wert ist, welche sie uns auferlegt, zumal, wenn man sich vom Hedonismus nicht genug frei gemacht hat, um nicht ein gewisses Maß von individueller Glücksbefriedigung unter die Ziele unserer Kulturentwicklung aufzunehmen. Es ist gewiß nicht Sache des Arztes, selbst mit Reformvorschlägen hervorzutreten; ich meinte aber, ich könnte die Dringlichkeit solcher unterstützen, wenn ich die v. Ehrenfelssche Darstellung der Schädigungen durch unsere »kulturelle« Sexualmoral um den Hinweis auf deren Bedeutung für die Ausbreitung der modernen Nervosität erweitere.
Die Disposition zur Zwangsneurose (1913)
(Ein Beitrag zum Problem der Neurosenwahl)
Das Problem, warum und wieso ein Mensch an einer Neurose erkranken kann, gehört gewiß zu jenen, die von der Psychoanalyse beantwortet werden sollen. Es ist aber wahrscheinlich, daß diese Antwort erst über ein anderes und spezielleres wird gegeben werden können, über das Problem, warum diese und jene Person gerade an der einen bestimmten Neurose, und an keiner anderen, erkranken muß. Dies ist das Problem der Neurosenwahl.
Was wissen wir bis jetzt zu diesem Problem? Eigentlich ist hier nur ein einziger allgemeiner Satz gesichert. Wir unterscheiden die für die Neurosen in Betracht kommenden Krankheitsursachen in solche, die der Mensch ins Leben mitbringt, und solche, die das Leben an ihn heranbringt, konstitutionelle und akzidentelle, durch deren Zusammenwirken erst in der Regel die Krankheitsverursachung hergestellt wird. Nun besagt der eben angekündigte Satz, daß die Gründe für die Entscheidung der Neurosenwahl durchwegs von der ersteren Art sind, also von der Natur der Dispositionen, und unabhängig von den pathogen wirkenden Erlebnissen.
Worin suchen wir die Herkunft dieser Dispositionen? Wir sind aufmerksam darauf geworden, daß die in Betracht kommenden psychischen Funktionen –; vor allem die Sexualfunktion, aber ebenso verschiedene wichtige Ichfunktionen –; eine lange und komplizierte Entwicklung durchzumachen haben, bis sie zu dem für den normalen Erwachsenen charakteristischen Zustand gelangen. Wir nehmen nun an, daß diese Entwicklungen nicht immer so tadellos vollzogen werden, daß die gesamte Funktion der fortschrittlichen Veränderung unterliege. Wo ein Stück derselben die vorige Stufe festhält, da ergibt sich eine sogenannte »Fixierungsstelle«, zu welcher die Funktion im Falle der Erkrankung durch äußerliche Störung regredieren kann.
Unsere Dispositionen sind also Entwicklungshemmungen. Die Analogie mit den Tatsachen der allgemeinen Pathologie anderer Krankheiten bestärkt uns in dieser Auffassung. Bei der Frage, welche Faktoren solche Störungen der Entwicklung hervorrufen können, macht aber die psychoanalytische Arbeit halt und überläßt dies Problem der biologischen Forschung [Fußnote]Seitdem die Arbeiten von W. Fließ die Bedeutung bestimmter Zeitgrößen für die Biologie aufgedeckt haben, ist es denkbar geworden, daß sich Entwicklungsstörung auf zeitliche Abänderung von Entwicklungsschüben zurückführt..
Mit Hilfe dieser Voraussetzungen haben wir uns bereits vor einigen Jahren an das Problem der Neurosenwahl herangewagt. Unsere Arbeitsrichtung, welche dahin geht, die normalen Verhältnisse aus ihren Störungen zu erraten, hat uns dazu geführt, einen ganz besonderen und unerwarteten Angriffspunkt zu wählen. Die Reihenfolge, in welcher die Hauptformen der Psychoneurosen gewöhnlich aufgeführt werden –; Hysterie, Zwangsneurose, Paranoia, Dementia praecox –;, entspricht (wenn auch nicht völlig genau) der Zeitfolge, in der diese Affektionen im Leben hervorbrechen. Die hysterischen Krankheitsformen können schon in der ersten Kindheit beobachtet werden, die Zwangsneurose offenbart ihre ersten Symptome gewöhnlich in der zweiten Periode der Kindheit (von sechs bis acht Jahren an); die beiden anderen, von mir als Paraphrenie zusammengefaßten Psychoneurosen zeigen sich erst nach der Pubertät und im Alter der Reife. Diese zuletzt auftretenden Affektionen haben sich nun unserer Forschung nach den in die Neurosenwahl auslaufenden Dispositionen zuerst zugänglich erwiesen. Die ihnen beiden eigentümlichen Charaktere des Größenwahns, der Abwendung von der Welt der Objekte und der Erschwerung der Übertragung haben uns zum Schlusse genötigt, daß deren disponierende Fixierung in einem Stadium der Libidoentwicklung vor der Herstellung der Objektwahl, also in der Phase des Autoerotismus und des Narzißmus zu suchen ist. Diese so spät auftretenden Erkrankungsformen gehen also auf sehr frühzeitige Hemmungen und Fixierungen zurück.
Demnach würden wir darauf hingewiesen, die Disposition für Hysterie und Zwangsneurose, die beiden eigentlichen Übertragungsneurosen mit frühzeitiger Symptombildung, in den jüngeren Phasen der Libidoentwicklung zu vermuten. Allein worin wäre hier die Entwicklungshemmung zu finden und vor allem, welches wäre der Phasenunterschied, der die Disposition zur Zwangsneurose im Gegensatz zur Hysterie begründen sollte? Darüber war lange nichts zu erfahren, und meine früher unternommenen Versuche, diese beiden Dispositionen zu erraten, z. B. daß die Hysterie durch Passivität, die Zwangsneurose durch Aktivität im infantilen Erleben bedingt sein sollte, mußten bald als verfehlt abgewiesen werden.
Ich kehre nun auf den Boden der klinischen Einzelbeobachtung zurück. Ich habe lange Zeit hindurch eine Kranke studiert, deren Neurose eine ungewöhnliche Wandlung durchgemacht hatte. Dieselbe begann nach einem traumatischen Erlebnis als glatte Angsthysterie und behielt diesen Charakter durch einige Jahre bei. Eines Tages aber verwandelte sie sich plötzlich in eine Zwangsneurose von der schwersten Art. Ein solcher Fall mußte nach mehr als einer Richtung bedeutsam werden. Einerseits konnte er vielleicht den Wert eines bilinguen Dokuments beanspruchen und zeigen, wie ein identischer Inhalt von den beiden Neurosen in verschiedenen Sprachen ausgedrückt wird. Anderseits drohte er, unserer Theorie der Disposition durch Entwicklungshemmung überhaupt zu widersprechen, wenn man sich nicht zur Annahme entschließen wollte, daß eine Person auch mehr als eine einzige schwache Stelle in ihrer Libidoentwicklung mitbringen könne. Ich sagte mir, daß man kein Recht habe, diese letztere Möglichkeit abzuweisen, war aber auf das Verständnis dieses Krankheitsfalles sehr gespannt.
Als dieses im Laufe der Analyse kam, mußte ich sehen, daß die Sachlage ganz anders war, als ich sie mir vorgestellt hatte. Die Zwangsneurose war nicht eine weitere Reaktion auf das nämliche Trauma, welches zuerst die Angsthysterie hervorgerufen hatte, sondern auf ein zweites Erlebnis, welches das erste völlig entwertet hatte. (Also eine –; allerdings noch diskutierbare –; Ausnahme von unserem Satze, der die Unabhängigkeit der Neurosenwahl vom Erleben behauptet.) Ich kann leider –; aus bekannten Motiven –; auf die Krankengeschichte des Falles nicht so weit eingehen, wie ich gern möchte, sondern muß mich auf nachstehende Mitteilungen beschränken. Die Patientin war bis zu ihrer Erkrankung eine glückliche, fast völlig befriedigte Frau gewesen. Sie wünschte sich Kinder aus Motiven infantiler Wunschfixierung und erkrankte, als sie erfuhr, daß sie von ihrem ausschließend geliebten Manne keine Kinder bekommen könne. Die Angsthysterie, mit welcher sie auf diese Versagung reagierte, entsprach, wie sie bald selbst verstehen lernte, der Abweisung von Versuchungsphantasien, in denen sich der festgehaltene Wunsch nach einem Kinde durchsetzte. Sie tat nun alles dazu, um ihren Mann nicht erraten zu lassen, daß sie infolge der durch ihn determinierten Versagung erkrankt sei. Aber ich habe nicht ohne gute Gründe behauptet, daß jeder Mensch in seinem eigenen Unbewußten ein Instrument besitzt, mit dem er die Äußerungen des Unbewußten beim anderen zu deuten vermag; der Mann verstand ohne Geständnis oder Erklärung, was die Angst seiner Frau bedeute, kränkte sich darüber, ohne es zu zeigen, und reagierte nun seinerseits neurotisch, indem er –; zum erstenmal –; beim Eheverkehr versagte. Unmittelbar darauf reiste er ab, die Frau hielt ihn für dauernd impotent geworden und produzierte die ersten Zwangssymptome an dem Tage vor seiner erwarteten Rückkunft.
Der Inhalt ihrer Zwangsneurose bestand in einem peinlichen Wasch- und Reinlichkeitszwang und in höchst energischen Schutzmaßregeln gegen böse Schädigungen, welche andere von ihr zu befürchten hätten, also in Reaktionsbildungen gegen analerotische und sadistische Regungen. In solchen Formen mußte sich ihr Sexualbedürfnis äußern, nachdem ihr Genitalleben durch die Impotenz des für sie einzigen Mannes eine volle Entwertung erfahren hatte.
An diesen Punkt hat das kleine, von mir neugebildete Stückchen Theorie angeknüpft, welches natürlich nur scheinbar auf dieser einen Beobachtung ruht, in Wirklichkeit eine große Summe früherer Eindrücke zusammenfaßt, die aber erst nach dieser letzten Erfahrung fähig wurden, eine Einsicht zu ergeben. Ich sagte mir, daß mein Entwicklungsschema der libidinösen Funktion einer neuen Einschaltung bedarf. Ich hatte zuerst nur unterschieden die Phase des Autoerotismus, in welcher die einzelnen Partialtriebe, jeder für sich, ihre Lustbefriedigung am eigenen Leibe suchen, und dann die Zusammenfassung aller Partialtriebe zur Objektwahl unter dem Primat der Genitalien im Dienste der Fortpflanzung. Die Analyse der Paraphrenien hat uns, wie bekannt, genötigt, dazwischen ein Stadium des Narzißmus einzuschieben, in dem die Objektwahl bereits erfolgt ist, aber das Objekt noch mit dem eigenen Ich zusammenfällt. Und nun sehen wir die Notwendigkeit ein, ein weiteres Stadium vor der Endgestaltung gelten zu lassen, in dem die Partialtriebe bereits zur Objektwahl zusammengefaßt sind, das Objekt sich der eigenen Person schon als eine fremde gegenüberstellt, aber der Primat der Genitalzonen noch nicht aufgerichtet ist. Die Partialtriebe, welche diese prägenitale Organisation des Sexuallebens beherrschen, sind vielmehr die analerotischen und die sadistischen.
Ich weiß, daß jede solche Aufstellung zunächst befremdend klingt. Erst durch die Aufdeckung ihrer Beziehungen zu unserem bisherigen Wissen wird sie uns vertraut, und am Ende ist ihr Schicksal häufig, daß sie als eine geringfügige, längst geahnte Neuerung erkannt wird. Wenden wir uns also mit ähnlichen Erwartungen zur Diskussion der »prägenitalen Sexualordnung«.
a) Es ist bereits vielen Beobachtern aufgefallen und zuletzt mit besonderer Schärfe von E. Jones hervorgehoben worden, welche außerordentliche Rolle die Regungen von Haß und Analerotik in der Symptomatologie der Zwangsneurose spielen. (Jones, 1913.) Dies leitet sich nun unmittelbar aus unserer Aufstellung ab, wenn es diese Partialtriebe sind, welche in der Neurose die Vertretung der Genitaltriebe wieder übernommen haben, deren Vorgänger sie in der Entwicklung waren.
Hier fügt sich nun das bisher zurückgehaltene Stück aus der Krankengeschichte unseres Falles ein. Das Sexualleben der Patientin begann im zartesten Kindesalter mit sadistischen Schlagephantasien. Nach deren Unterdrückung setzte eine ungewöhnlich lange Latenzzeit ein, in welcher das Mädchen eine hochreichende moralische Entwicklung durchmachte, ohne zum weiblichen Sexualempfinden zu erwachen. Mit der in jungen Jahren geschlossenen Ehe begann eine Periode normaler Sexualbetätigung als glückliche Frau, die durch eine Reihe von Jahren anhielt, bis die erste große Versagung die hysterische Neurose brachte. Mit der darauffolgenden Entwertung des Genitallebens sank ihr Sexualleben, wie erwähnt, auf die infantile Stufe des Sadismus zurück.
Es ist nicht schwer, den Charakter zu bestimmen, in welchem sich dieser Fall von Zwangsneurose von den häufigeren anderen unterscheidet, die in jüngeren Jahren beginnen und von da an chronisch mit mehr oder weniger auffälligen Exazerbationen verlaufen. In diesen anderen Fällen wird die Sexualorganisation, welche die Disposition zur Zwangsneurose enthält, einmal hergestellt, nie wieder völlig überwunden; in unserem Falle ist sie zuerst durch die höhere Entwicklungsstufe abgelöst und dann durch Regression von dieser her wieder aktiviert worden.
b) Wenn wir von unserer Aufstellung aus den Anschluß an biologische Zusammenhänge suchen, dürfen wir nicht vergessen, daß der Gegensatz von männlich und weiblich, welcher von der Fortpflanzungsfunktion eingeführt wird, auf der Stufe der prägenitalen Objektwahl noch nicht vorhanden sein kann. An seiner Statt finden wir den Gegensatz von Strebungen mit aktivem und passivem Ziel, der sich späterhin mit dem Gegensatz der Geschlechter verlöten wird. Die Aktivität wird vom gemeinen Bemächtigungstrieb beigestellt, den wir eben Sadismus heißen, wenn wir ihn im Dienste der Sexualfunktion finden; er hat auch im vollentwickelten normalen Sexualleben wichtige Helferdienste zu verrichten. Die passive Strömung wird von der Analerotik gespeist, deren erogene Zone der alten, undifferenzierten Kloake entspricht. Die Betonung dieser Analerotik auf der prägenitalen Organisationsstufe wird beim Manne eine bedeutsame Prädisposition zur Homosexualität hinterlassen, wenn die nächste Stufe der Sexualfunktion, die des Primats der Genitalien, erreicht wird. Der Aufbau dieser letzten Phase über der vorigen und die dabei erfolgende Umarbeitung der Libidobesetzungen bietet der analytischen Forschung die interessantesten Aufgaben.
Man kann der Meinung sein, daß man sich allen hier in Betracht kommenden Schwierigkeiten und Komplikationen entzieht, wenn man eine prägenitale Organisation des Sexuallebens verleugnet und das Sexualleben mit der Genital- und Fortpflanzungsfunktion zusammenfallen, wie auch mit ihr beginnen läßt. Von den Neurosen würde man dann mit Rücksicht auf die nicht mißverständlichen Ergebnisse der analytischen Forschung aussagen, daß sie durch den Prozeß der Sexualverdrängung dazu genötigt werden, sexuelle Strebungen durch andere, nicht sexuelle Triebe auszudrücken, die letzteren also kompensatorisch zu sexualisieren. Wenn man so verfährt, hat man sich aber außerhalb der Psychoanalyse begeben. Man steht wieder dort, wo man sich vor der Psychoanalyse befand, und muß auf das durch sie vermittelte Verständnis des Zusammenhanges zwischen Gesundheit, Perversion und Neurose verzichten. Die Psychoanalyse steht und fällt mit der Anerkennung der sexuellen Partialtriebe, der erogenen Zonen und der so gewonnenen Ausdehnung des Begriffes »Sexualfunktion« im Gegensatz zur engeren »Genitalfunktion«. Übrigens reicht die Beobachtung der normalen Entwicklung des Kindes für sich allein hin, um eine solche Versuchung zurückzuweisen.
c) Auf dem Gebiete der Charakterentwicklung müssen wir denselben Triebkräften begegnen, deren Spiel wir in den Neurosen aufgedeckt haben. Eine scharfe theoretische Scheidung der beiden wird aber durch den einen Umstand geboten, daß beim Charakter wegfällt, was dem Neurosenmechanismus eigentümlich ist, das Mißglücken der Verdrängung und die Wiederkehr des Verdrängten. Bei der Charakterbildung tritt die Verdrängung entweder nicht in Aktion oder sie erreicht glatt ihr Ziel, das Verdrängte durch Reaktionsbildungen und Sublimierungen zu ersetzen. Darum sind die Prozesse der Charakterbildung undurchsichtiger und der Analyse unzugänglicher als die neurotischen.
Gerade auf dem Gebiete der Charakterentwicklung begegnet uns aber eine gute Analogie zu dem von uns beschriebenen Krankheitsfalle, also eine Bekräftigung der prägenitalen sadistisch-analerotischen Sexualorganisation. Es ist bekannt und hat den Menschen viel Stoff zur Klage gegeben, daß die Frauen häufig, nachdem sie ihre Genitalfunktionen aufgegeben haben, ihren Charakter in eigentümlicher Weise verändern. Sie werden zänkisch, quälerisch und rechthaberisch, kleinlich und geizig, zeigen also typische sadistische und analerotische Züge, die ihnen vorher in der Epoche der Weiblichkeit nicht eigen waren. Lustspieldichter und Satiriker haben zu allen Zeiten ihre Invektiven gegen den »alten Drachen« gerichtet, zu dem das holde Mädchen, die liebende Frau, die zärtliche Mutter geworden ist. Wir verstehen, daß diese Charakterwandlung der Regression des Sexuallebens auf die prägenitale, sadistisch-analerotische Stufe entspricht, in welcher wir die Disposition zur Zwangsneurose gefunden haben. Sie wäre also nicht nur die Vorläuferin der genitalen Phase, sondern oft genug auch ihre Nachfolge und Ablösung, nachdem die Genitalien ihre Funktion erfüllt haben.
Der Vergleich einer solchen Charakterveränderung mit der Zwangsneurose ist sehr eindrucksvoll. In beiden Fällen das Werk der Regression, aber im ersten Falle volle Regression nach glatt vollzogener Verdrängung (oder Unterdrückung); im Falle der Neurose: Konflikt, Bemühung, die Regression nicht gelten zu lassen, Reaktionsbildungen gegen dieselbe und Symptombildungen durch Kompromisse von beiden Seiten her, Spaltung der psychischen Tätigkeiten in bewußtseinsfähige und unbewußte.
d) Unsere Aufstellung einer prägenitalen Sexualorganisation ist nach zwei Richtungen hin unvollständig. Sie nimmt erstens keine Rücksicht auf das Verhalten anderer Partialtriebe, an dem manches der Erforschung und Erwähnung wert wäre, und begnügt sich, das auffällige Primat von Sadismus und Analerotik herauszuheben. Besonders vom Wißtrieb gewinnt man häufig den Eindruck, als ob er im Mechanismus der Zwangsneurose den Sadismus geradezu ersetzen könnte. Er ist ja im Grunde ein sublimierter, ins Intellektuelle gehobener Sprößling des Bemächtigungstriebes, seine Zurückweisung in der Form des Zweifels nimmt im Bilde der Zwangsneurose einen breiten Raum ein.
Ein zweiter Mangel ist weit bedeutsamer. Wir wissen, daß die entwicklungsgeschichtliche Disposition für eine Neurose nur dann vollständig ist, wenn sie die Phase der Ichentwicklung, in welcher die Fixierung eintritt, ebenso berücksichtigt wie die der Libidoentwicklung. Unsere Aufstellung hat sich aber nur auf die letztere bezogen, sie enthält also nicht die ganze Kenntnis, die wir fordern dürfen. Die Entwicklungsstadien der Ichtriebe sind uns bis jetzt sehr wenig bekannt; ich weiß nur von einem vielversprechenden Versuch von Ferenczi (1913), sich diesen Fragen zu nähern. Ich weiß nicht, ob es zu gewagt erscheint, wenn ich den vorhandenen Spuren folgend die Annahme ausspreche, daß ein zeitliches Voraneilen der Ichentwicklung vor der Libidoentwicklung in die Disposition zur Zwangsneurose einzutragen ist. Eine solche Voreiligkeit würde von den Ichtrieben her zur Objektwahl nötigen, während die Sexualfunktion ihre letzte Gestaltung noch nicht erreicht hat, und somit eine Fixierung auf der Stufe der prägenitalen Sexualordnung hinterlassen. Erwägt man, daß die Zwangsneurotiker eine Übermoral entwickeln müssen, um ihre Objektliebe gegen die hinter ihr lauernde Feindseligkeit zu verteidigen, so wird man geneigt sein, ein gewisses Maß von diesem Voraneilen der Ichentwicklung als typisch für die menschliche Natur hinzustellen und die Fähigkeit zur Entstehung der Moral in dem Umstand begründet zu finden, daß nach der Entwicklung der Haß der Vorläufer der Liebe ist. Vielleicht ist dies die Bedeutung eines Satzes von W. Stekel, der mir seinerzeit unfaßbar erschien, daß der Haß und nicht die Liebe die primäre Gefühlsbeziehung zwischen den Menschen sei [Fußnote]W. Stekel (1911. 536)..
e) Für die Hysterie erübrigt nach dem Vorstehenden die innige Beziehung zur letzten Phase der Libidoentwicklung, die durch den Primat der Genitalien und die Einführung der Fortpflanzungsfunktion ausgezeichnet ist. Dieser Erwerb unterliegt in der hysterischen Neurose der Verdrängung, mit welcher eine Regression auf die prägenitale Stufe nicht verbunden ist. Die Lücke in der Bestimmung der Disposition infolge unserer Unkenntnis der Ichentwicklung ist hier noch fühlbarer als bei der Zwangsneurose.
Hingegen ist es nicht schwer nachzuweisen, daß eine andere Regression auf ein früheres Niveau auch der Hysterie zukommt. Die Sexualität des weiblichen Kindes steht, wie wir wissen, unter der Herrschaft eines männlichen Leitorgans (der Klitoris) und benimmt sich vielfach wie die des Knaben. Ein letzter Entwicklungsschub zur Zeit der Pubertät muß diese männliche Sexualität wegschaffen und die von der Kloake abgeleitete Vagina zur herrschenden erogenen Zone erheben. Es ist nun sehr gewöhnlich, daß in der hysterischen Neurose der Frauen eine Reaktivierung dieser verdrängten männlichen Sexualität statthat, gegen welche sich dann der Abwehrkampf von Seiten der ichgerechten Triebe richtet. Doch erscheint es mir vorzeitig, an dieser Stelle in die Diskussion der Probleme der hysterischen Disposition einzutreten.
Die Freudsche psychoanalytische Methode (1904 )
Die eigentümliche Methode der Psychotherapie, die Freud ausübt und als Psychoanalyse bezeichnet, ist aus dem sogenannten kathartischen Verfahren hervorgegangen, über welches er seinerzeit in den Studien über Hysterie 1895 in Gemeinschaft mit J. Breuer berichtet hat. Die kathartische Therapie war eine Erfindung Breuers, der mit ihrer Hilfe zuerst etwa ein Dezennium vorher eine hysterische Kranke hergestellt und dabei Einsicht in die Pathogenese ihrer Symptome gewonnen hatte. Infolge einer persönlichen Anregung Breuers nahm dann Freud das Verfahren wieder auf und erprobte es an einer größeren Anzahl von Kranken.
Das kathartische Verfahren setzte voraus, daß der Patient hypnotisierbar sei, und beruhte auf der Erweiterung des Bewußtseins, die in der Hypnose eintritt. Es setzte sich die Beseitigung der Krankheitssymptome zum Ziele und erreichte dies, indem es den Patienten sich in den psychischen Zustand zurückversetzen ließ, in welchem das Symptom zum erstenmal aufgetreten war. Es tauchten dann bei dem hypnotisierten Kranken Erinnerungen, Gedanken und Impulse auf, die in seinem Bewußtsein bisher ausgefallen waren, und wenn er diese seine seelischen Vorgänge unter intensiven Affektäußerungen dem Arzte mitgeteilt hatte, war das Symptom überwunden, die Wiederkehr desselben aufgehoben. Diese regelmäßig zu wiederholende Erfahrung erläuterten die beiden Autoren in ihrer gemeinsamen Arbeit dahin, daß das Symptom an Stelle von unterdrückten und nicht zum Bewußtsein gelangten psychischen Vorgängen stehe, also eine Umwandlung (»Konversion«) der letzteren darstelle. Die therapeutische Wirksamkeit ihres Verfahrens erklärten sie sich aus der Abfuhr des bis dahin gleichsam »eingeklemmten« Affektes, der an den unterdrückten seelischen Aktionen gehaftet hatte (»Abreagieren«). Das einfache Schema des therapeutischen Eingriffes komplizierte sich aber nahezu allemal, indem sich zeigte, daß nicht ein einzelner (»traumatischer«) Eindruck, sondern meist eine schwer zu übersehende Reihe von solchen an der Entstehung des Symptoms beteiligt sei.
Der Hauptcharakter der kathartischen Methode, der sie in Gegensatz zu allen anderen Verfahren der Psychotherapie setzt, liegt also darin, daß bei ihr die therapeutische Wirksamkeit nicht einem suggestiven Verbot des Arztes übertragen wird. Sie erwartet vielmehr, daß die Symptome von selbst verschwinden werden, wenn es dem Eingriff, der sich auf gewisse Voraussetzungen über den psychischen Mechanismus beruft, gelungen ist, seelische Vorgänge zu einem andern als dem bisherigen Verlaufe zu bringen, der in die Symptombildung eingemündet hat.
Die Abänderungen, welche Freud an dem kathartischen Verfahren Breuers vornahm, waren zunächst Änderungen der Technik; diese brachten aber neue Ergebnisse und haben in weiterer Folge zu einer andersartigen, wiewohl der früheren nicht widersprechenden Auffassung der therapeutischen Arbeit genötigt.
Hatte die kathartische Methode bereits auf die Suggestion verzichtet, so unternahm Freud den weiteren Schritt, auch die Hypnose aufzugeben. Er behandelt gegenwärtig seine Kranken, indem er sie ohne andersartige Beeinflussung eine bequeme Rückenlage auf einem Ruhebett einnehmen läßt, während er selbst, ihrem Anblick entzogen, auf einem Stuhle hinter ihnen sitzt. Auch den Verschluß der Augen fordert er von ihnen nicht und vermeidet jede Berührung sowie jede andere Prozedur, die an Hypnose mahnen könnte. Eine solche Sitzung verläuft also wie ein Gespräch zwischen zwei gleich wachen Personen, von denen die eine sich jede Muskelanstrengung und jeden ablenkenden Sinneseindruck erspart, die sie in der Konzentration ihrer Aufmerksamkeit auf ihre eigene seelische Tätigkeit stören könnten.
Da das Hypnotisiertwerden, trotz aller Geschicklichkeit des Arztes, bekanntlich in der Willkür des Patienten liegt und eine große Anzahl neurotischer Personen durch kein Verfahren in Hypnose zu versetzen ist, so war durch den Verzicht auf die Hypnose die Anwendbarkeit des Verfahrens auf eine uneingeschränkte Anzahl von Kranken gesichert. Anderseits fiel die Erweiterung des Bewußtseins weg, welche dem Arzt gerade jenes psychische Material an Erinnerungen und Vorstellungen geliefert hatte, mit dessen Hilfe sich die Umsetzung der Symptome und die Befreiung der Affekte vollziehen ließ. Wenn für diesen Ausfall kein Ersatz zu schaffen war, konnte auch von einer therapeutischen Einwirkung keine Rede sein.
Einen solchen völlig ausreichenden Ersatz fand nun Freud in den Einfällen der Kranken, das heißt in den ungewollten, meist als störend empfundenen und darum unter gewöhnlichen Verhältnissen beseitigten Gedanken, die den Zusammenhang einer beabsichtigten Darstellung zu durchkreuzen pflegen. Um sich dieser Einfälle zu bemächtigen, fordert er die Kranken auf, sich in ihren Mitteilungen gehenzulassen, »wie man es etwa in einem Gespräche tut, bei welchem man aus dem Hundertsten in das Tausendste gerät«. Er schärft ihnen, ehe er sie zur detaillierten Erzählung ihrer Krankengeschichte auffordert, ein, alles mit zu sagen, was ihnen dabei durch den Kopf geht, auch wenn sie meinen, es sei unwichtig oder es gehöre nicht dazu, oder es sei unsinnig. Mit besonderem Nachdrucke aber wird von ihnen verlangt, daß sie keinen Gedanken oder Einfall darum von der Mitteilung ausschließen, weil ihnen diese Mitteilung beschämend oder peinlich ist. Bei den Bemühungen, dieses Material an sonst vernachlässigten Einfällen zu sammeln, machte nun Freud die Beobachtungen, die für seine ganze Auffassung bestimmend geworden sind. Schon bei der Erzählung der Krankengeschichte stellen sich bei den Kranken Lücken der Erinnerung heraus, sei es, daß tatsächliche Vorgänge vergessen worden, sei es, daß zeitliche Beziehungen verwirrt oder Kausalzusammenhänge zerrissen worden sind, so daß sich unbegreifliche Effekte ergeben. Ohne Amnesie irgendeiner Art gibt es keine neurotische Krankengeschichte. Drängt man den Erzählenden, diese Lücken seines Gedächtnisses durch angestrengte Arbeit der Aufmerksamkeit auszufüllen, so merkt man, daß die hiezu sich einstellenden Einfälle von ihm mit allen Mitteln der Kritik zurückgedrängt werden, bis er endlich das direkte Unbehagen verspürt, wenn sich die Erinnerung wirklich eingestellt hat. Aus dieser Erfahrung schließt Freud, daß die Amnesien das Ergebnis eines Vorganges sind, den er Verdrängung heißt und als dessen Motiv er Unlustgefühle erkennt. Die psychischen Kräfte, welche diese Verdrängung herbeigeführt haben, meint er in dem Widerstand, der sich gegen die Wiederherstellung erhebt, zu verspüren.
Das Moment des Widerstandes ist eines der Fundamente seiner Theorie geworden. Die sonst unter allerlei Vorwänden (wie sie die obige Formel aufzählt) beseitigten Einfälle betrachtet er aber als Abkömmlinge der verdrängten psychischen Gebilde (Gedanken und Regungen), als Entstellungen derselben infolge des gegen ihre Reproduktion bestehenden Widerstandes.
Je größer der Widerstand, desto ausgiebiger diese Entstellung. In dieser Beziehung der unbeabsichtigten Einfälle zum verdrängten psychischen Material ruht nun ihr Wert für die therapeutische Technik. Wenn man ein Verfahren besitzt, welches ermöglicht, von den Einfällen aus zu dem Verdrängten, von den Entstellungen zum Entstellten zu gelangen, so kann man auch ohne Hypnose das früher Unbewußte im Seelenleben dem Bewußtsein zugänglich machen.
Freud hat darauf eine Deutungskunst ausgebildet, welcher diese Leistung zufällt, die gleichsam aus den Erzen der unbeabsichtigten Einfälle den Metallgehalt an verdrängten Gedanken darstellen soll. Objekt dieser Deutungsarbeit sind nicht allein die Einfälle des Kranken, sondern auch seine Träume, die den direktesten Zugang zur Kenntnis des Unbewußten eröffnen, seine unbeabsichtigten wie planlosen Handlungen (Symptomhandlungen) und die Irrungen seiner Leistungen im Alltagsleben (Versprechen, Vergreifen u. dgl.). Die Details dieser Deutungs- oder Übersetzungstechnik sind von Freud noch nicht veröffentlicht worden. Es sind nach seinen Andeutungen eine Reihe von empirisch gewonnenen Regeln, wie aus den Einfällen das unbewußte Material zu konstruieren ist, Anweisungen, wie man es zu verstehen habe, wenn die Einfälle des Patienten versagen, und Erfahrungen über die wichtigsten typischen Widerstände, die sich im Laufe einer solchen Behandlung einstellen. Ein umfangreiches Buch über Traumdeutung, 1900 von Freud publiziert, ist als Vorläufer einer solchen Einführung in die Technik anzusehen.
Man könnte aus diesen Andeutungen über die Technik der psychoanalytischen Methode schließen, daß deren Erfinder sich überflüssige Mühe verursacht und unrecht getan hat, das wenig komplizierte hypnotische Verfahren zu verlassen. Aber einerseits ist die Technik der Psychoanalyse viel leichter auszuüben, wenn man sie einmal erlernt hat, als es bei einer Beschreibung den Anschein hat, anderseits führt kein anderer Weg zum Ziele, und darum ist der mühselige Weg noch der kürzeste. Der Hypnose ist vorzuwerfen, daß sie den Widerstand verdeckt und dadurch dem Arzt den Einblick in das Spiel der psychischen Kräfte verwehrt hat. Sie räumt aber mit dem Widerstande nicht auf, sondern weicht ihm nur aus und ergibt darum nur unvollständige Auskünfte und nur vorübergehende Erfolge.
Die Aufgabe, welche die psychoanalytische Methode zu lösen bestrebt ist, läßt sich in verschiedenen Formeln ausdrücken, die aber ihrem Wesen nach äquivalent sind. Man kann sagen: Aufgabe der Kur sei, die Amnesien aufzuheben. Wenn alle Erinnerungslücken ausgefüllt, alle rätselhaften Effekte des psychischen Lebens aufgeklärt sind, ist der Fortbestand, ja eine Neubildung des Leidens unmöglich gemacht. Man kann die Bedingung anders fassen: es seien alle Verdrängungen rückgängig zu machen; der psychische Zustand ist dann derselbe, in dem alle Amnesien ausgefüllt sind. Weittragender ist eine andere Fassung: es handle sich darum, das Unbewußte dem Bewußtsein zugänglich zu machen, was durch Überwindung der Widerstände geschieht. Man darf aber dabei nicht vergessen, daß ein solcher Idealzustand auch beim normalen Menschen nicht besteht und daß man nur selten in die Lage kommen kann, die Behandlung annähernd so weit zu treiben. So wie Gesundheit und Krankheit nicht prinzipiell geschieden, sondern nur durch eine praktisch bestimmbare Summationsgrenze gesondert sind, so wird man sich auch nie etwas anderes zum Ziel der Behandlung setzen als die praktische Genesung des Kranken, die Herstellung seiner Leistungs- und Genußfähigkeit. Bei unvollständiger Kur oder unvollkommenem Erfolge derselben erreicht man vor allem eine bedeutende Hebung des psychischen Allgemeinzustandes, während die Symptome, aber mit geminderter Bedeutung für den Kranken, fortbestehen können, ohne ihn zu einem Kranken zu stempeln.
Das therapeutische Verfahren bleibt, von geringen Modifikationen abgesehen, das nämliche für alle Symptombilder der vielgestaltigen Hysterie und ebenso für alle Ausbildungen der Zwangsneurose. Von einer unbeschränkten Anwendbarkeit desselben ist aber keine Rede. Die Natur der psychoanalytischen Methode schafft Indikationen und Gegenanzeigen sowohl von Seiten der zu behandelnden Personen als auch mit Rücksicht auf das Krankheitsbild. Am günstigsten für die Psychoanalyse sind die chronischen Fälle von Psychoneurosen mit wenig stürmischen oder gefahrdrohenden Symptomen, also zunächst alle Arten der Zwangsneurose, Zwangsdenken und Zwangshandeln, und Fälle von Hysterie, in denen Phobien und Abulien die Hauptrolle spielen, weiterhin aber auch alle somatischen Ausprägungen der Hysterie, insoferne nicht, wie bei der Anorexie, rasche Beseitigung der Symptome zur Hauptaufgabe des Arztes wird. Bei akuten Fällen von Hysterie wird man den Eintritt eines ruhigeren Stadiums abzuwarten haben; in allen Fällen, bei denen die nervöse Erschöpfung obenan steht, wird man ein Verfahren vermeiden, welches selbst Anstrengung erfordert, nur langsame Fortschritte zeitigt und auf die Fortdauer der Symptome eine Zeitlang keine Rücksicht nehmen kann.
An die Person, die man mit Vorteil der Psychoanalyse unterziehen soll, sind mehrfache Forderungen zu stellen. Sie muß erstens eines psychischen Normalzustandes fähig sein; in Zeiten der Verworrenheit oder melancholischer Depression ist auch bei einer Hysterie nichts auszurichten. Man darf ferner ein gewisses Maß natürlicher Intelligenz und ethischer Entwicklung fordern; bei wertlosen Personen läßt den Arzt bald das Interesse im Stiche, welches ihn zur Vertiefung in das Seelenleben des Kranken befähigt. Ausgeprägte Charakterverbildungen, Züge von wirklich degenerativer Konstitution äußern sich bei der Kur als Quelle von kaum zu überwindenden Widerständen. Insoweit setzt überhaupt die Konstitution eine Grenze für die Heilbarkeit durch Psychotherapie. Auch eine Altersstufe in der Nähe des fünften Dezenniums schafft ungünstige Bedingungen für die Psychoanalyse. Die Masse des psychischen Materials ist dann nicht mehr zu bewältigen, die zur Herstellung erforderliche Zeit wird zu lang, und die Fähigkeit, psychische Vorgänge rückgängig zu machen, beginnt zu erlahmen.
Trotz aller dieser Einschränkungen ist die Anzahl der für die Psychoanalyse geeigneten Personen eine außerordentlich große und die Erweiterung unseres therapeutischen Könnens durch dieses Verfahren nach den Behauptungen Freuds eine sehr beträchtliche. Freud beansprucht lange Zeiträume, ein halbes Jahr bis drei Jahre, für eine wirksame Behandlung; er gibt aber die Auskunft, daß er bisher infolge verschiedener leicht zu erratender Umstände meist nur in die Lage gekommen ist, seine Behandlung an sehr schweren Fällen zu erproben, Personen mit vieljähriger Krankheitsdauer und völliger Leistungsunfähigkeit, die, durch alle Behandlungen getäuscht, gleichsam eine letzte Zuflucht bei seinem neuen und viel angezweifelten Verfahren gesucht haben. In Fällen leichterer Erkrankung dürfte sich die Behandlungsdauer sehr verkürzen und ein außerordentlicher Gewinn an Vorbeugung für die Zukunft erzielen lassen.
Die Handhabung der Traumdeutung in der Psychoanalyse (1911)
Das Zentralblatt für Psychoanalyse hat sich nicht nur die eine Aufgabe gesetzt, über die Fortschritte der Psychoanalyse zu orientieren und selbst kleinere Beiträge zur Veröffentlichung zu bringen, sondern möchte auch den anderen Aufgaben genügen, das bereits Erkannte in klarer Fassung dem Lernenden vorzulegen und dem Anfänger in der analytischen Behandlung durch geeignete Anweisungen Aufwand an Zeit und Mühe zu ersparen. Es werden darum in dieser Zeitschrift von nun an auch Aufsätze didaktischer Natur und technischen Inhaltes erscheinen, an denen es nicht wesentlich ist, ob sie auch etwas Neues mitteilen.
Die Frage, die ich heute zu behandeln gedenke, ist nicht die nach der Technik der Traumdeutung. Es soll nicht erörtert werden, wie man Träume zu deuten und deren Deutung zu verwerten habe, sondern nur, welchen Gebrauch man bei der psychoanalytischen Behandlung von Kranken von der Kunst der Traumdeutung machen solle. Man kann dabei gewiß in verschiedener Weise vorgehen, aber die Antwort auf technische Fragen ist in der Psychoanalyse niemals selbstverständlich. Wenn es vielleicht mehr als nur einen guten Weg gibt, so gibt es doch sehr viele schlechte, und eine Vergleichung verschiedener Techniken kann nur aufklärend wirken, auch wenn sie nicht zur Entscheidung für eine bestimmte Methode führen sollte.
Wer von der Traumdeutung her zur analytischen Behandlung kommt, der wird sein Interesse für den Inhalt der Träume festhalten und darum jeden Traum, den ihm der Kranke erzählt, zur möglichst vollständigen Deutung bringen wollen. Er wird aber bald merken können, daß er sich nun unter ganz andersartigen Verhältnissen befindet und daß er mit den nächsten Aufgaben der Therapie in Kollision gerät, wenn er seinen Vorsatz durchführen will. Erwies sich etwa der erste Traum des Patienten als vortrefflich brauchbar für die Anknüpfung der ersten an den Kranken zu richtenden Aufklärungen, so stellen sich alsbald Träume ein, die so lang und so dunkel sind, daß ihre Deutung in der begrenzten Arbeitsstunde eines Tages nicht zu Ende gebracht werden kann. Setzt der Arzt diese Deutungsarbeit durch die nächsten Tage fort, so wird ihm unterdes von neuen Träumen berichtet, die zurückgestellt werden müssen, bis er den ersten Traum für erledigt halten kann. Gelegentlich ist die Traumproduktion so reichlich und der Fortschritt des Kranken im Verständnis der Träume dabei so zögernd, daß der Analytiker sich der Idee nicht erwehren kann, diese Art der Darreichung des Materials sei nur eine Äußerung des Widerstandes, welcher sich der Erfahrung bedient, daß die Kur den ihr so gebotenen Stoff nicht bewältigen kann. Unterdes ist die Kur aber ein ganzes Stück hinter der Gegenwart zurückgeblieben und hat den Kontakt mit der Aktualität eingebüßt. Einer solchen Technik muß man die Regel entgegenhalten, daß es für die Behandlung von größter Bedeutung ist, die jeweilige psychische Oberfläche des Kranken zu kennen, darüber orientiert zu sein, welche Komplexe und welche Widerstände derzeit bei ihm regegemacht sind und welche bewußte Reaktion dagegen sein Benehmen leiten wird. Dieses therapeutische Ziel darf kaum jemals zugunsten des Interesses an der Traumdeutung hintangesetzt werden.
Wie soll man es also mit der Traumdeutung in der Analyse halten, wenn man jener Regel eingedenk bleiben will? Etwa so: Man begnüge sich jedesmal mit dem Ergebnis an Deutung, welches in einer Stunde zu gewinnen ist, und halte es nicht für einen Verlust, daß man den Inhalt des Traumes nicht vollständig erkannt hat. Am nächsten Tage setze man die Deutungsarbeit nicht wie selbstverständlich fort, sondern erst dann, wenn man merkt, daß inzwischen nichts anderes sich beim Kranken in den Vordergrund gedrängt hat. Man mache also von der Regel, immer das zu nehmen, was dem Kranken zunächst in den Sinn kommt, zugunsten einer unterbrochenen Traumdeutung keine Ausnahme. Haben sich neue Träume eingestellt, ehe man die früheren zu Ende gebracht, so wende man sich diesen rezenteren Produktionen zu und mache sich aus der Vernachlässigung der älteren keinen Vorwurf. Sind die Träume gar zu umfänglich und weitschweifig geworden, so verzichte man bei sich von vornherein auf eine vollständige Lösung. Man hüte sich im allgemeinen davor, ein ganz besonderes Interesse für die Deutung der Träume an den Tag zu legen oder im Kranken die Meinung zu erwecken, daß die Arbeit stillestehen müsse, wenn er keine Träume bringe. Man läuft sonst Gefahr, den Widerstand auf die Traumproduktion zu lenken und ein Versiegen der Träume hervorzurufen. Der Analysierte muß vielmehr zur Überzeugung erzogen werden, daß die Analyse in jedem Falle Material zu ihrer Fortsetzung findet, gleichgültig ob er Träume beibringt oder nicht und in welchem Ausmaße man sich mit ihnen beschäftigt.
Man wird nun fragen: Verzichtet man nicht auf zuviel wertvolles Material zur Aufdeckung des Unbewußten, wenn man die Traumdeutung nur unter solchen methodischen Einschränkungen ausübt? Darauf ist folgendes zu erwidern: Der Verlust ist keineswegs so groß, wie es bei geringer Vertiefung in den Sachverhalt erscheinen wird. Man mache sich einerseits klar, daß irgend ausführliche Traumproduktionen bei schweren Fällen von Neurosen nach allen Voraussetzungen als prinzipiell nicht vollständig lösbar beurteilt werden müssen. Ein solcher Traum baut sich oft über dem gesamten pathogenen Material des Falles auf, welches Arzt und Patient noch nicht kennen (sogenannte Programmträume, biographische Träume); er ist gelegentlich einer Übersetzung des ganzen Inhalts der Neurose in die Traumsprache gleichzustellen. Beim Versuch, einen solchen Traum zu deuten, werden alle noch unangetastet vorhandenen Widerstände zur Wirkung kommen und der Einsicht bald eine Grenze setzen. Die vollständige Deutung eines solchen Traumes fällt eben zusammen mit der Ausführung der ganzen Analyse. Hat man ihn zu Beginn der Analyse notiert, so kann man ihn etwa am Ende derselben, nach vielen Monaten, verstehen. Es ist derselbe Fall wie beim Verständnis eines einzelnen Symptoms (des Hauptsymptoms etwa). Die ganze Analyse dient der Aufklärung desselben; während der Behandlung muß man der Reihe nach bald dies, bald jenes Stück der Symptombedeutung zu erfassen suchen, bis man all diese Stücke zusammensetzen kann. Mehr darf man also auch von einem zu Anfang der Analyse vorfallenden Traume nicht verlangen; man muß sich zufriedengeben, wenn man aus dem Deutungsversuch zunächst eine einzelne pathogene Wunschregung errät.
Man verzichtet also auf nichts Erreichbares, wenn man die Absicht einer vollständigen Traumdeutung aufgibt. Man verliert aber auch in der Regel nichts, wenn man die Deutung eines älteren Traumes abbricht, um sich einem rezenteren zuzuwenden. Wir haben aus schönen Beispielen voll gedeuteter Träume erfahren, daß mehrere aufeinanderfolgende Szenen desselben Traumes den nämlichen Inhalt haben können, der sich in ihnen etwa mit steigender Deutlichkeit durchsetzt. Wir haben ebenso gelernt, daß mehrere in derselben Nacht vorfallende Träume nichts anderes zu sein brauchen als Versuche, denselben Inhalt in verschiedener Ausdrucksweise darzustellen. Wir können ganz allgemein versichert sein, daß jede Wunschregung, die sich heute einen Traum schafft, in einem anderen Traume wiederkehren wird, solange sie nicht verstanden und der Herrschaft des Unbewußten entzogen ist. So wird auch oft der beste Weg, um die Deutung eines Traumes zu vervollständigen, darin bestehen, daß man ihn verläßt, um sich dem neuen Traume zu widmen, der das nämliche Material in vielleicht zugänglicherer Form wiederaufnimmt. Ich weiß, daß es nicht nur für den Analysierten, sondern auch für den Arzt eine starke Zumutung ist, die bewußten Zielvorstellungen bei der Behandlung aufzugeben und sich ganz einer Leitung zu überlassen, die uns doch immer wieder als »zufällig« erscheint. Aber ich kann versichern, es lohnt sich jedesmal, wenn man sich entschließt, seinen eigenen theoretischen Behauptungen Glauben zu schenken, und sich dazu überwindet, die Herstellung des Zusammenhanges der Führung des Unbewußten nicht streitig zu machen.
Ich plädiere also dafür, daß die Traumdeutung in der analytischen Behandlung nicht als Kunst um ihrer selbst willen betrieben werden soll, sondern daß ihre Handhabung jenen technischen Regeln unterworfen werde, welche die Ausführung der Kur überhaupt beherrschen. Natürlich kann man es gelegentlich auch anders machen und seinem theoretischen Interesse ein Stück weit nachgehen. Man muß dabei aber immer wissen, was man tut. Ein anderer Fall ist noch in Betracht zu ziehen, der sich ergeben hat, seitdem wir zu unserem Verständnis der Traumsymbolik größeres Zutrauen haben und uns von den Einfällen der Patienten unabhängiger wissen. Ein besonders geschickter Traumdeuter kann sich etwa in der Lage befinden, daß er jeden Traum des Patienten durchschaut, ohne diesen zur mühsamen und zeitraubenden Bearbeitung des Traumes anhalten zu müssen. Für einen solchen Analytiker entfallen also alle Konflikte zwischen den Anforderungen der Traumdeutung und jenen der Therapie. Er wird sich auch versucht fühlen, die Traumdeutung jedesmal voll auszunützen und dem Patienten alles mitzuteilen, was er aus seinen Träumen erraten hat. Dabei hat er aber eine Methodik der Behandlung eingeschlagen, die von der regulären nicht unerheblich abweicht, wie ich in anderem Zusammenhange dartun werde. Dem Anfänger in der psychoanalytischen Behandlung ist jedenfalls zu widerraten, daß er sich diesen außergewöhnlichen Fall zum Vorbild nehme.
Gegen die allerersten Träume, die ein Patient in der analytischen Behandlung mitteilt, solange er selbst noch nichts von der Technik der Traumübersetzung gelernt hat, verhält sich jeder Analytiker wie jener von uns angenommene überlegene Traumdeuter. Diese initialen Träume sind sozusagen naiv, sie verraten dem Zuhörer sehr viel, ähnlich wie die Träume sogenannt gesunder Menschen. Es entsteht nun die Frage, soll der Arzt auch sofort dem Kranken alles übersetzen, was er selbst aus dem Traume herausgelesen hat. Diese Frage soll aber hier nicht beantwortet werden, denn sie ist offenbar der umfassenderen Frage untergeordnet, in welchen Phasen der Behandlung und in welchem Tempo der Kranke in die Kenntnis des ihm seelisch Verhüllten vom Arzte eingeführt werden soll. Je mehr dann der Patient von der Übung der Traumdeutung erlernt hat, desto dunkler werden in der Regel seine späteren Träume. Alles erworbene Wissen um den Traum dient auch der Traumbildung als Warnung.
In den »wissenschaftlichen« Arbeiten über den Traum, die trotz der Ablehnung der Traumdeutung einen neuen Impuls durch die Psychoanalyse empfangen haben, findet man immer wieder eine recht überflüssige Sorgfalt auf die getreue Erhaltung des Traumtextes verlegt, der angeblich vor den Entstellungen und Usuren der nächsten Tagesstunden bewahrt werden muß. Auch manche Psychoanalytiker scheinen sich ihrer Einsicht in die Bedingungen der Traumbildung nicht konsequent genug zu bedienen, wenn sie dem Behandelten den Auftrag geben, jeden Traum unmittelbar nach dem Erwachen schriftlich zu fixieren. Diese Maßregel ist in der Therapie überflüssig; auch bedienen sich die Kranken der Vorschrift gern, um sich im Schlafe zu stören und einen großen Eifer dort anzubringen, wo er nicht von Nutzen sein kann. Hat man nämlich auf solche Weise mühselig einen Traumtext gerettet, der sonst vom Vergessen verzehrt worden wäre, so kann man sich doch leicht überzeugen, daß für den Kranken damit nichts erreicht ist. Zu dem Text stellen sich die Einfälle nicht ein, und der Effekt ist der nämliche, als ob der Traum nicht erhalten geblieben wäre. Der Arzt hat allerdings in dem einen Falle etwas erfahren, was ihm im anderen entgangen wäre. Aber es ist nicht dasselbe, ob der Arzt oder ob der Patient etwas weiß; die Bedeutung dieses Unterschiedes für die Technik der Psychoanalyse soll ein anderes Mal von uns gewürdigt werden.
Ich will endlich noch einen besonderen Typus von Träumen erwähnen, die ihren Bedingungen nach nur in einer psychoanalytischen Kur vorkommen können und die den Anfänger befremden oder irreführen mögen. Es sind dies die sogenannten nachhinkenden oder bestätigenden Träume, die der Deutung leicht zugänglich sind und als Übersetzung nichts anderes ergeben, als was die Kur in den letzten Tagen aus dem Material der Tageseinfälle erschlossen hatte. Es sieht dann so aus, als hätte der Patient die Liebenswürdigkeit gehabt, gerade das in Traumform zu bringen, was man ihm unmittelbar vorher »suggeriert« hat. Der geübtere Analytiker hat allerdings Schwierigkeiten, seinem Patienten solche Liebenswürdigkeiten zuzumuten; er greift solche Träume als erwünschte Bestätigungen auf und konstatiert, daß sie nur unter bestimmten Bedingungen der Beeinflussung durch die Kur beobachtet werden. Die weitaus zahlreichsten Träume eilen ja der Kur voran, so daß sich aus ihnen nach Abzug von allem bereits Bekannten und Verständlichen ein mehr oder minder deutlicher Hinweis auf etwas, was bisher verborgen war, ergibt.
Die Ichspaltung im Abwehrvorgang (1940)
Ich befinde mich einen Moment lang in der interessanten Lage, nicht zu wissen, ob das, was ich mitteilen will, als längst bekannt und selbstverständlich oder als völlig neu und befremdend gewertet werden soll. Ich glaube aber eher das letztere.
Es ist mir endlich aufgefallen, daß das jugendliche Ich der Person, die man Jahrzehnte später als analytischen Patienten kennenlernt, sich in bestimmten Situationen der Bedrängnis in merkwürdiger Weise benommen hat. Die Bedingung hiefür kann man allgemein und eher unbestimmt angeben, wenn man sagt, es geschieht unter der Einwirkung eines psychischen Traumas. Ich ziehe es vor, einen scharf umschriebenen Einzelfall hervorzuheben, der gewiß nicht alle Möglichkeiten der Verursachung deckt. Das Ich des Kindes befinde sich also im Dienste eines mächtigen Triebanspruchs, den zu befriedigen es gewohnt ist, und wird plötzlich durch ein Erlebnis geschreckt, das ihn lehrt, die Fortsetzung dieser Befriedigung werde eine schwer erträgliche reale Gefahr zur Folge haben. Es soll sich nun entscheiden: entweder die reale Gefahr anerkennen, sich vor ihr beugen und auf die Triebbefriedigung verzichten, oder die Realität verleugnen, sich glauben machen, daß kein Grund zum Fürchten besteht, damit es an der Befriedigung festhalten kann. Es ist also ein Konflikt zwischen dem Anspruch des Triebes und dem Einspruch der Realität. Das Kind tut aber keines von beiden, oder vielmehr, es tut gleichzeitig beides, was auf dasselbe hinauskommt. Es antwortet auf den Konflikt mit zwei entgegengesetzten Reaktionen, beide giltig und wirksam. Einerseits weist es mit Hilfe bestimmter Mechanismen die Realität ab und läßt sich nichts verbieten, anderseits anerkennt es im gleichen Atem die Gefahr der Realität, nimmt die Angst vor ihr als Leidenssymptom auf sich und sucht sich später ihrer zu erwehren. Man muß zugeben, das ist eine sehr geschickte Lösung der Schwierigkeit. Beide streitende Parteien haben ihr Teil bekommen; der Trieb darf seine Befriedigung behalten, der Realität ist der gebührende Respekt gezollt worden. Aber umsonst ist bekanntlich nur der Tod. Der Erfolg wurde erreicht auf Kosten eines Einrisses im Ich, der nie wieder verheilen, aber sich mit der Zeit vergrößern wird. Die beiden entgegengesetzten Reaktionen auf den Konflikt bleiben als Kern einer Ichspaltung bestehen. Der ganze Vorgang erscheint uns so sonderbar, weil wir die Synthese der Ichvorgänge für etwas Selbstverständliches halten. Aber wir haben offenbar darin unrecht. Die so außerordentlich wichtige synthetische Funktion des Ichs hat ihre besonderen Bedingungen und unterliegt einer ganzen Reihe von Störungen.
Es kann nur von Vorteil sein, wenn ich in diese schematische Darstellung die Daten einer besonderen Krankengeschichte einsetze. Ein Knabe hat im Alter zwischen drei und vier Jahren das weibliche Genitale kennengelernt durch Verführung von Seiten eines älteren Mädchens. Nach Abbruch dieser Beziehungen setzt er die so empfangene sexuelle Anregung in eifriger manueller Onanie fort, wird aber bald von der energischen Kinderpflegerin ertappt und mit der Kastration bedroht, deren Ausführung, wie gewöhnlich, dem Vater zugeschoben wird. Die Bedingungen für eine ungeheure Schreckwirkung sind in diesem Falle gegeben. Die Kastrationsdrohung für sich allein muß nicht viel Eindruck machen, das Kind verweigert ihr den Glauben, es kann sich nicht leicht vorstellen, daß eine Trennung von dem so hoch eingeschätzten Körperteil möglich ist. Beim Anblick des weiblichen Genitales hätte sich das Kind von einer solchen Möglichkeit überzeugen können, aber das Kind hatte damals den Schluß nicht gezogen, weil die Abneigung dagegen zu groß und kein Motiv vorhanden war, das ihn erzwang. Im Gegenteile, was sich etwa an Unbehagen regte, wurde durch die Auskunft beschwichtigt, was da fehlt, wird noch kommen, es –; das Glied –; wird ihr später wachsen. Wer genug kleine Knaben beobachtet hat, kann sich an eine solche Äußerung beim Anblick des Genitales der kleinen Schwester erinnern. Anders aber, wenn beide Momente zusammengetroffen sind. Dann weckt die Drohung die Erinnerung an die für harmlos gehaltene Wahrnehmung und findet in ihr die gefürchtete Bestätigung. Der Knabe glaubt jetzt zu verstehen, warum das Genitale des Mädchens keinen Penis zeigte, und wagt es nicht mehr zu bezweifeln, daß seinem eigenen Genitale das gleiche widerfahren kann. Er muß fortan an die Realität der Kastrationsgefahr glauben.
Die gewöhnliche, die als normal geltende Folge des Kastrationsschrecks ist nun, daß der Knabe der Drohung nachgibt, im vollen oder wenigstens im partiellen Gehorsam –; indem er nicht mehr die Hand ans Genitale führt –;, entweder sofort oder nach längerem Kampf, also auf die Befriedigung des Triebes ganz oder teilweise verzichtet. Wir sind aber darauf vorbereitet, daß unser Patient sich anders zu helfen wußte. Er schuf sich einen Ersatz für den vermißten Penis des Weibes, einen Fetisch. Damit hatte er zwar die Realität verleugnet, aber seinen eigenen Penis gerettet. Wenn er nicht anerkennen mußte, daß das Weib ihren Penis verloren hatte, so büßte die ihm erteilte Drohung ihre Glaubwürdigkeit ein, dann brauchte er auch für seinen Penis nicht zu fürchten, konnte ungestört seine Masturbation fortsetzen. Dieser Akt unseres Patienten imponiert uns als eine Abwendung von der Realität, als ein Vorgang, den wir gern der Psychose vorbehalten möchten. Er ist auch nicht viel anders, aber wir wollen doch unser Urteil suspendieren, denn bei näherer Betrachtung entdecken wir einen nicht unwichtigen Unterschied. Der Knabe hat nicht einfach seiner Wahrnehmung widersprochen, einen Penis dorthin halluziniert, wo keiner zu sehen war, sondern er hat nur eine Wertverschiebung vorgenommen, die Penisbedeutung einem anderen Körperteil übertragen, wobei ihm –; in hier nicht anzuführender Weise –; der Mechanismus der Regression zu Hilfe kam. Freilich betraf diese Verschiebung nur den Körper des Weibes, für den eigenen Penis änderte sich nichts.
Diese, man möchte sagen, kniffige Behandlung der Realität entscheidet über das praktische Benehmen des Knaben. Er betreibt seine Masturbation weiter, als ob sie seinem Penis keine Gefahr bringen könnte, aber gleichzeitig entwickelt er in vollem Widerspruch zu seiner anscheinenden Tapferkeit oder Unbekümmertheit ein Symptom, welches beweist, daß er diese Gefahr doch anerkennt. Es ist ihm angedroht worden, daß der Vater ihn kastrieren wird, und unmittelbar nachher, gleichzeitig mit der Schöpfung des Fetisch, tritt bei ihm eine intensive Angst vor der Bestrafung durch den Vater auf, die ihn lange beschäftigen wird, die er nur mit dem ganzen Aufwand seiner Männlichkeit bewältigen und überkompensieren kann. Auch diese Angst vor dem Vater schweigt von der Kastration. Mit Hilfe der Regression auf eine orale Phase erscheint sie als Angst, vom Vater gefressen zu werden. Es ist unmöglich, hier nicht eines urtümlichen Stücks der griechischen Mythologie zu gedenken, das berichtet, wie der alte Vatergott Kronos seine Kinder verschlingt und auch den jüngsten Sohn Zeus verschlingen will und wie der durch die List der Mutter gerettete Zeus später den Vater entmannt. Um aber zu unserem Fall zurückzukehren, fügen wir hinzu, daß er noch ein anderes, wenn auch geringfügiges Symptom produzierte, das er bis auf den heutigen Tag festgehalten hat, eine ängstliche Empfindlichkeit seiner beiden kleinen Zehen gegen Berührung, als ob in dem sonstigen Hin und Her von Verleugnung und Anerkennung der Kastration doch noch ein deutlicherer Ausdruck zukäme. . .
Die infantile Genitalorganisation (1923)
(Eine einschaltung in die sexualtheorie)
Es ist recht bezeichnend für die Schwierigkeit der Forschungsarbeit in der Psychoanalyse, daß es möglich ist, allgemeine Züge und charakteristische Verhältnisse trotz unausgesetzter jahrzehntelanger Beobachtung zu übersehen, bis sie einem endlich einmal unverkennbar entgegentreten; eine solche Vernachlässigung auf dem Gebiet der infantilen Sexualentwicklung möchte ich durch die nachstehenden Bemerkungen gutmachen.
Den Lesern meiner Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905 d) wird es bekannt sein, daß ich in den späteren Ausgaben dieser Schrift niemals eine Umarbeitung vorgenommen, sondern die ursprüngliche Anordnung gewahrt habe und den Fortschritten unserer Einsicht durch Einschaltungen und Abänderungen des Textes gerecht geworden bin. Dabei mag es oft vorgekommen sein, daß das Alte und das Neuere sich nicht gut zu einer widerspruchsfreien Einheit verschmelzen ließen. Anfänglich ruhte ja der Akzent auf der Darstellung der fundamentalen Verschiedenheit im Sexualleben der Kinder und der Erwachsenen, später drängten sich die prägenitalen Organisationen der Libido in den Vordergrund und die merkwürdige und folgenschwere Tatsache des zweizeitigen Ansatzes der Sexualentwicklung. Endlich nahm die infantile Sexualforschung unser Interesse in Anspruch, und von ihr aus ließ sich die weitgehende Annäherung des Ausganges der kindlichen Sexualität (um das fünfte Lebensjahr) an die Endgestaltung beim Erwachsenen erkennen. Dabei bin ich in der letzten Auflage der Sexualtheorie (1922) stehengeblieben.
Auf Seite 63 derselben erwähne ich, daß »häufig oder regelmäßig bereits in den Kinderjahren eine Objektwahl vollzogen wird, wie wir sie als charakteristisch für die Entwicklungsphase der Pubertät hingestellt haben, in der Weise, daß sämtliche Sexualstrebungen die Richtung auf eine einzige Person nehmen, an der sie ihre Ziele erreichen wollen. Dies ist dann die größte Annäherung an die definitive Gestaltung des Sexuallebens nach der Pubertät, die in den Kinderjahren möglich ist. Der Unterschied von letzterer liegt nur noch darin, daß die Zusammenfassung der Partialtriebe und deren Unterordnung unter das Primat der Genitalien in der Kindheit nicht oder nur sehr unvollkommen durchgesetzt wird. Die Herstellung dieses Primats im Dienste der Fortpflanzung ist also die letzte Phase, welche die Sexualorganisation durchläuft.«
Mit dem Satz, das Primat der Genitalien sei in der frühinfantilen Periode nicht oder nur sehr unvollkommen durchgeführt, würde ich mich heute nicht mehr zufriedengeben. Die Annäherung des kindlichen Sexuallebens an das der Erwachsenen geht viel weiter und bezieht sich nicht nur auf das Zustandekommen einer Objektwahl. Wenn es auch nicht zu einer richtigen Zusammenfassung der Partialtriebe unter das Primat der Genitalien kommt, so gewinnt doch auf der Höhe des Entwicklungsganges der infantilen Sexualität das Interesse an den Genitalien und die Genitalbetätigung eine dominierende Bedeutung, die hinter der in der Reifezeit wenig zurücksteht. Der Hauptcharakter dieser » infantilen Genitalorganisation« ist zugleich ihr Unterschied von der endgültigen Genitalorganisation der Erwachsenen. Er liegt darin, daß für beide Geschlechter nur ein Genitale, das männliche, eine Rolle spielt. Es besteht also nicht ein Genitalprimat, sondern ein Primat des Phallus.
Leider können wir diese Verhältnisse nur für das männliche Kind beschreiben, in die entsprechenden Vorgänge beim kleinen Mädchen fehlt uns die Einsicht. Der kleine Knabe nimmt sicherlich den Unterschied von Männern und Frauen wahr, aber er hat zunächst keinen Anlaß, ihn mit einer Verschiedenheit ihrer Genitalien zusammenzubringen. Es ist ihm natürlich, ein ähnliches Genitale, wie er es selbst besitzt, bei allen anderen Lebewesen, Menschen und Tieren, vorauszusetzen, ja wir wissen, daß er auch an unbelebten Dingen nach einem seinem Gliede analogen Gebilde forscht [Fußnote]Es ist übrigens merkwürdig, ein wie geringes Maß von Aufmerksamkeit der andere Teil des männlichen Genitales, das Säckchen mit seinen Einschlüssen, beim Kinde auf sich zieht. Aus den Analysen könnte man nicht erraten, daß noch etwas anderes als der Penis zum Genitale gehört.. Dieser leicht erregte, veränderliche, an Empfindungen so reiche Körperteil beschäftigt das Interesse des Knaben in hohem Grade und stellt seinem Forschertrieb unausgesetzt neue Aufgaben. Er möchte ihn auch bei anderen Personen sehen, um ihn mit seinem eigenen zu vergleichen, er benimmt sich, als ob ihm vorschwebte, daß dieses Glied größer sein könnte und sollte; die treibende Kraft, welche dieser männliche Teil später in der Pubertät entfalten wird, äußert sich um diese Lebenszeit wesentlich als Forschungsdrang, als sexuelle Neugierde. Viele der Exhibitionen und Aggressionen, welche das Kind vornimmt und die man im späteren Alter unbedenklich als Äußerungen von Lüsternheit beurteilen würde, erweisen sich der Analyse als Experimente im Dienste der Sexualforschung angestellt.
Im Laufe dieser Untersuchungen gelangt das Kind zur Entdeckung, daß der Penis nicht ein Gemeingut aller ihm ähnlichen Wesen sei. Der zufällige Anblick der Genitalien einer kleinen Schwester oder Gespielin gibt hiezu den Anstoß; scharfsinnige Kinder haben schon vorher aus ihren Wahrnehmungen beim Urinieren der Mädchen, weil sie eine andere Stellung sehen und ein anderes Geräusch hören, den Verdacht geschöpft, daß hier etwas anders sei, und dann versucht, solche Beobachtungen in aufklärender Weise zu wiederholen. Es ist bekannt, wie sie auf die ersten Eindrücke des Penismangels reagieren. Sie leugnen diesen Mangel, glauben doch ein Glied zu sehen, beschönigen den Widerspruch zwischen Beobachtung und Vorurteil durch die Auskunft, es sei noch klein und werde erst wachsen, und kommen dann langsam zu dem affektiv bedeutsamen Schluß, es sei doch wenigstens vorhanden gewesen und dann weggenommen worden. Der Penismangel wird als Ergebnis einer Kastration erfaßt, und das Kind steht nun vor der Aufgabe, sich mit der Beziehung der Kastration zu seiner eigenen Person auseinanderzusetzen. Die weiteren Entwicklungen sind zu sehr allgemein bekannt, als daß es notwendig wäre, sie hier zu wiederholen. Es scheint mir nur, daß man die Bedeutung des Kastrationskomplexes erst richtig würdigen kann, wenn man seine Entstehung in der Phase des Phallusprimats mitberücksichtigt[Fußnote]Es ist mit Recht darauf hingewiesen worden, daß das Kind die Vorstellung einer narzißtischen Schädigung durch Körperverlust aus dem Verlieren der Mutterbrust nach dem Saugen, aus der täglichen Abgabe der Fäzes, ja schon aus der Trennung vom Mutterleib bei der Geburt gewinnt. Von einem Kastrationskomplex sollte man aber doch erst sprechen, wenn sich diese Vorstellung eines Verlustes mit dem männlichen Genitale verknüpft hat..
Es ist auch bekannt, wieviel Herabwürdigung des Weibes, Grauen vor dem Weib, Disposition zur Homosexualität sich aus der endlichen Überzeugung von der Penislosigkeit des Weibes ableitet. Ferenczi hat kürzlich mit vollem Recht das mythologische Symbol des Grausens, das Medusenhaupt, auf den Eindruck des penislosen weiblichen Genitales zurückgeführt [Fußnote]Ferenczi (1923). Ich möchte hinzufügen, daß im Mythos das Genitale der Mutter gemeint ist. Athene, die das Medusenhaupt an ihrem Panzer trägt, wird eben dadurch das unnahbare Weib, dessen Anblick jeden Gedanken an sexuelle Annäherung erstickt..
Doch darf man nicht glauben, daß das Kind seine Beobachtung, manche weibliche Personen besitzen keinen Penis, so rasch und bereitwillig verallgemeinert; dem steht schon die Annahme, daß die Penislosigkeit die Folge der Kastration als einer Strafe sei, im Wege. Im Gegenteile, das Kind meint, nur unwürdige weibliche Personen, die sich wahrscheinlich ähnlicher unerlaubter Regungen schuldig gemacht haben wie es selbst, hätten das Genitale eingebüßt. Respektierte Frauen aber wie die Mutter behalten den Penis noch lange. Weibsein fällt eben für das Kind noch nicht mit Penismangel zusammen [Fußnote]Aus der Analyse einer jungen Frau erfuhr ich, daß sie, die keinen Vater und mehrere Tanten hatte, bis weit in die Latenzzeit an dem Penis der Mutter und einiger Tanten festhielt. Eine schwachsinnige Tante aber hielt sie für kastriert, wie sie sich selbst empfand.. Erst später, wenn das Kind die Probleme der Entstehung und Geburt der Kinder angreift und errät, daß nur Frauen Kinder gebären können, wird auch die Mutter des Penis verlustig, und mitunter werden ganz komplizierte Theorien aufgebaut, die den Umtausch des Penis gegen ein Kind erklären sollen. Das weibliche Genitale scheint dabei niemals entdeckt zu werden. Wie wir wissen, lebt das Kind im Leib (Darm) der Mutter und wird durch den Darmausgang geboren. Mit diesen letzten Theorien greifen wir über die Zeitdauer der infantilen Sexualperiode hinaus.
Es ist nicht unwichtig, sich vorzuhalten, welche Wandlungen die uns geläufige geschlechtliche Polarität während der kindlichen Sexualentwicklung durchmacht. Ein erster Gegensatz wird mit der Objektwahl, die ja Subjekt und Objekt voraussetzt, eingeführt. Auf der Stufe der prägenitalen sadistisch-analen Organisation ist von männlich und weiblich noch nicht zu reden, der Gegensatz von aktiv und passiv ist der herrschende [Fußnote]Siehe: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.. Auf der nun folgenden Stufe der infantilen Genitalorganisation gibt es zwar ein männlich, aber kein weiblich; der Gegensatz lautet hier: männliches Genitale oder kastriert. Erst mit der Vollendung der Entwicklung zur Zeit der Pubertät fällt die sexuelle Polarität mit männlich und weiblich zusammen. Das Männliche faßt das Subjekt, die Aktivität und den Besitz des Penis zusammen, das Weibliche setzt das Objekt und die Passivität fort. Die Vagina wird nun als Herberge des Penis geschätzt, sie tritt das Erbe des Mutterleibes an.
Die psychoanalytische Technik (1940)
[Aus : ABRIß der psychoanalyse]
Der Traum ist also eine Psychose, mit allen Ungereimtheiten, Wahnbildungen, Sinnestäuschungen einer solchen. Eine Psychose zwar von kurzer Dauer, harmlos, selbst mit einer nützlichen Funktion betraut, von der Zustimmung der Person eingeleitet, durch einen Willensakt von ihr beendet. Aber doch eine Psychose, und wir lernen an ihr, daß selbst eine so tiefgehende Veränderung des Seelenlebens rückgängig werden, der normalen Funktion Raum geben kann. Ist es dann kühn zu hoffen, daß es möglich sein müßte, auch die gefürchteten spontanen Erkrankungen des Seelenlebens unserem Einfluß zu unterwerfen und sie zur Heilung zu bringen?
Wir wissen schon manches zur Vorbereitung für diese Unternehmung. Nach unserer Voraussetzung hat das Ich die Aufgabe, den Ansprüchen seiner drei Abhängigkeiten von der Realität, dem Es und dem Über-Ich zu genügen und dabei doch seine Organisation aufrechtzuhalten, seine Selbständigkeit zu behaupten. Die Bedingung der in Rede stehenden Krankheitszustände kann nur eine relative oder absolute Schwächung des Ichs sein, die ihm die Erfüllung seiner Aufgaben unmöglich macht. Die schwerste Anforderung an das Ich ist wahrscheinlich die Niederhaltung der Triebansprüche des Es, wofür es große Aufwände an Gegenbesetzungen zu unterhalten hat. Es kann aber auch der Anspruch des Über-Ichs so stark und so unerbittlich werden, daß das Ich seinen anderen Aufgaben wie gelähmt gegenübersteht. Wir ahnen, in den ökonomischen Konflikten, die sich hier ergeben, machen Es und Über-Ich oft gemeinsame Sache gegen das bedrängte Ich, das sich zur Erhaltung seiner Norm an die Realität anklammern will. Werden die beiden ersteren zu stark, so gelingt es ihnen, die Organisation des Ichs aufzulockern und zu verändern, so daß seine richtige Beziehung zur Realität gestört oder selbst aufgehoben wird. Wir haben es am Traum gesehen; wenn sich das Ich von der Realität der Außenwelt ablöst, verfällt es unter dem Einfluß der Innenwelt in die Psychose.
Auf diese Einsichten gründen wir unseren Heilungsplan. Das Ich ist durch den inneren Konflikt geschwächt, wir müssen ihm zur Hilfe kommen. Es ist wie in einem Bürgerkrieg, der durch den Beistand eines Bundesgenossen von außen entschieden werden soll. Der analytische Arzt und das geschwächte Ich des Kranken sollen, an die reale Außenwelt angelehnt, eine Partei bilden gegen die Feinde, die Triebansprüche des Es und die Gewissensansprüche des Über-Ichs. Wir schließen einen Vertrag miteinander. Das kranke Ich verspricht uns vollste Aufrichtigkeit, d. h. die Verfügung über allen Stoff, den ihm seine Selbstwahrnehmung liefert, wir sichern ihm strengste Diskretion zu und stellen unsere Erfahrung in der Deutung des vom Unbewußten beeinflußten Materials in seinen Dienst. Unser Wissen soll sein Unwissen gutmachen, soll seinem Ich die Herrschaft über verlorene Bezirke des Seelenlebens wiedergeben. In diesem Vertrag besteht die analytische Situation.
Schon nach diesem Schritt erwartet uns die erste Enttäuschung, die erste Mahnung zur Bescheidenheit. Soll das Ich des Kranken ein wertvoller Bundesgenosse bei unserer gemeinsamen Arbeit sein, so muß es sich trotz aller Bedrängnis durch die ihm feindlichen Mächte ein gewisses Maß von Zusammenhalt, ein Stück Einsicht für die Anforderungen der Wirklichkeit bewahrt haben. Aber das ist vom Ich des Psychotikers nicht zu erwarten, dieses kann einen solchen Vertrag nicht einhalten, ja kaum ihn eingehen. Es wird sehr bald unsere Person und die Hilfe, die wir ihm anbieten, zu den Anteilen der Außenwelt geworfen haben, die ihm nichts mehr bedeuten. Somit erkennen wir, daß wir darauf verzichten müssen, unseren Heilungsplan beim Psychotiker zu versuchen. Vielleicht für immer verzichten, vielleicht nur zeitweilig, bis wir einen anderen, für ihn tauglicheren Plan gefunden haben.
Es gibt aber eine andere Klasse von psychisch Kranken, die den Psychotikern offenbar sehr nahestehen, die ungeheure Anzahl der schwer leidenden Neurotiker. Die Krankheitsbedingungen wie die pathogenen Mechanismen müssen bei ihnen dieselben sein oder wenigstens sehr ähnlich. Aber ihr Ich hat sich widerstandsfähiger gezeigt, ist weniger desorganisiert worden. Viele von ihnen konnten sich trotz all ihrer Beschwerden und der von ihnen verursachten Unzulänglichkeiten noch im realen Leben behaupten. Diese Neurotiker mögen sich bereit zeigen, unsere Hilfe anzunehmen. Wir wollen unser Interesse auf sie beschränken und versuchen, wie weit und auf welchen Wegen wir sie »heilen« können.
Mit den Neurotikern schließen wir also den Vertrag: volle Aufrichtigkeit gegen strenge Diskretion. Das macht den Eindruck, als strebten wir nur die Stellung eines weltlichen Beichtvaters an. Aber der Unterschied ist groß, denn wir wollen von ihm nicht nur hören, was er weiß und vor anderen verbirgt, sondern er soll uns auch erzählen, was er nicht weiß. In dieser Absicht geben wir ihm eine nähere Bestimmung dessen, was wir unter Aufrichtigkeit verstehen. Wir verpflichten ihn auf die analytische Grundregel, die künftighin sein Verhalten gegen uns beherrschen soll. Er soll uns nicht nur mitteilen, was er absichtlich und gern sagt, was ihm wie in einer Beichte Erleichterung bringt, sondern auch alles andere, was ihm seine Selbstbeobachtung liefert, alles was ihm in den Sinn kommt, auch wenn es ihm unangenehm zu sagen ist, auch wenn es ihm unwichtig oder sogar unsinnig erscheint. Gelingt es ihm, nach dieser Anweisung seine Selbstkritik auszuschalten, so liefert er uns eine Fülle von Material, Gedanken, Einfällen, Erinnerungen, die bereits unter dem Einfluß des Unbewußten stehen, oft direkte Abkömmlinge desselben sind und die uns also in den Stand setzen, das bei ihm verdrängte Unbewußte zu erraten und durch unsere Mitteilung die Kenntnis seines Ichs von seinem Unbewußten zu erweitern.
Aber weit entfernt davon, daß die Rolle seines Ichs sich darauf beschränken würde, in passivem Gehorsam uns das verlangte Material zu bringen und unsere Übersetzung desselben gläubig hinzunehmen. Es ereignet sich manches andere, einiges, was wir voraussehen durften, anderes, was uns überraschen muß. Das Merkwürdigste ist, daß der Patient nicht dabei bleibt, den Analytiker im Lichte der Realität zu betrachten als den Helfer und Berater, den man überdies für seine Mühewaltung entlohnt und der sich selbst gern mit der Rolle etwa eines Bergführers auf einer schwierigen Gebirgstour begnügen würde, sondern daß er in ihm eine Wiederkehr –; Reinkarnation –; einer wichtigen Person aus seiner Kindheit, Vergangenheit erblickt und darum Gefühle und Reaktionen auf ihn überträgt, die sicherlich diesem Vorbild gegolten haben. Diese Tatsache der Übertragung erweist sich bald als ein Moment von ungeahnter Bedeutung, einerseits ein Hilfsmittel von unersetzlichem Wert, anderseits eine Quelle ernster Gefahren. Diese Übertragung ist ambivalent, sie umfaßt positive, zärtliche wie negative, feindselige Einstellungen gegen den Analytiker, der in der Regel an die Stelle eines Elternteils, des Vaters oder der Mutter, gesetzt wird. Solange sie positiv ist, leistet sie uns die besten Dienste. Sie verändert die ganze analytische Situation, drängt die rationelle Absicht, gesund und leidensfrei zu werden, zur Seite. An ihre Stelle tritt die Absicht, dem Analytiker zu gefallen, seinen Beifall, seine Liebe zu gewinnen. Sie wird die eigentliche Triebfeder der Mitarbeit des Patienten, das schwache Ich wird stark, unter ihrem Einfluß bringt er Leistungen zustande, die ihm sonst unmöglich wären, stellt seine Symptome ein, wird anscheinend gesund, nur dem Analytiker zuliebe. Der Analytiker mag sich beschämt eingestehen, daß er eine schwierige Unternehmung begonnen, ohne zu ahnen, welch außerordentliche Machtmittel sich ihm zur Verfügung stellen würden.
Das Verhältnis der Übertragung bringt außerdem noch zwei andere Vorteile mit sich. Setzt der Patient den Analytiker an die Stelle seines Vaters (seiner Mutter), so räumt er ihm auch die Macht ein, die sein Über-Ich über sein Ich ausübt, denn diese Eltern sind ja der Ursprung des Über-Ichs gewesen. Das neue Über-Ich hat nun Gelegenheit zu einer Art von Nacherziehung des Neurotikers, es kann Mißgriffe korrigieren, die sich die Eltern in ihrer Erziehung zuschulden kommen ließen. Hier setzt allerdings die Warnung ein, den neuen Einfluß nicht zu mißbrauchen. Sosehr es den Analytiker verlocken mag, Lehrer, Vorbild und Ideal für andere zu werden, Menschen nach seinem Vorbild zu schaffen, er darf nicht vergessen, daß dies nicht seine Aufgabe im analytischen Verhältnis ist, ja daß er seiner Aufgabe untreu wird, wenn er sich von seiner Neigung fortreißen läßt. Er wiederholt dann nur einen Fehler der Eltern, die die Unabhängigkeit des Kindes durch ihren Einfluß erdrückt hatten, ersetzt nur die frühere Abhängigkeit durch eine neuere. Der Analytiker soll aber bei allen Bemühungen zu bessern und zu erziehen die Eigenart des Patienten respektieren. Das Maß von Beeinflussung, dessen er sich legitimerweise getraut, wird durch den Grad der Entwicklungshemmung bestimmt werden, den er bei dem Patienten vorfindet. Manche Neurotiker sind so infantil geblieben, daß sie auch in der Analyse nur wie Kinder behandelt werden können.
Ein anderer Vorteil der Übertragung ist noch, daß der Patient uns in ihr mit plastischer Deutlichkeit ein wichtiges Stück seiner Lebensgeschichte vorführt, über das er uns wahrscheinlich sonst nur ungenügende Auskunft gegeben hätte. Er agiert gleichsam vor uns, anstatt uns zu berichten.
Und nun zur anderen Seite des Verhältnisses. Da die Übertragung die Beziehung zu den Eltern reproduziert, übernimmt sie auch deren Ambivalenz. Es ist kaum zu vermeiden, daß die positive Einstellung zum Analytiker eines Tages in die negative, feindselige umschlägt. Auch diese ist gewöhnlich eine Wiederholung der Vergangenheit. Die Gefügigkeit gegen den Vater (wenn es sich um ihn handelte), das Werben um seine Gunst wurzelte in einem erotischen auf seine Person gerichteten Wunsch. Irgendeinmal drängt sich dieser Anspruch auch in der Übertragung hervor und besteht auf Befriedigung. Er kann in der analytischen Situation nur auf Versagung stoßen. Reale sexuelle Beziehungen zwischen Patienten und Analytiker sind ausgeschlossen, auch die feineren Weisen der Befriedigung wie Bevorzugung, Intimität usw. werden vom Analytiker nur in spärlichem Ausmaß gewährt. Solche Verschmähung wird zum Anlaß der Umwandlung genommen, wahrscheinlich ging dasselbe in der Kindheit des Patienten vor sich.
Die Heilerfolge, die unter der Herrschaft der positiven Übertragung zustande kamen, stehen im Verdacht, suggestiver Natur zu sein. Gewinnt die negative Übertragung die Oberhand, so werden sie wie Spreu vor dem Wind hinweggeweht. Man merkt mit Schrecken, daß alle Mühe und Arbeit bisher vergeblich war. Ja, auch was man für einen bleibenden intellektuellen Gewinn des Patienten halten durfte, sein Verständnis für die Psychoanalyse, sein Vertrauen in deren Wirksamkeit sind plötzlich verschwunden. Er benimmt sich wie das Kind, das kein eigenes Urteil hat, das blind dem glaubt, dem seine Liebe gehört, und keinem Fremden. Offenbar besteht die Gefahr dieser Übertragungszustände darin, daß der Patient ihre Natur verkennt und sie für neue reale Erlebnisse hält anstatt für Spiegelungen der Vergangenheit. Verspürt er (oder sie) das starke erotische Bedürfnis, das sich hinter der positiven Übertragung birgt, so glaubt er, sich leidenschaftlich verliebt zu haben; schlägt die Übertragung um, so hält er sich für beleidigt und vernachlässigt, haßt den Analytiker als seinen Feind und ist bereit, die Analyse aufzugeben. In beiden extremen Fällen hat er den Vertrag vergessen, den er zu Eingang der Behandlung angenommen hatte, ist er für die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit unbrauchbar geworden. Der Analytiker hat die Aufgabe, den Patienten jedesmal aus der gefahrdrohenden Illusion zu reißen, ihm immer wieder zu zeigen, daß es eine Spiegelung der Vergangenheit ist, was er für ein neues reales Leben hält. Und damit er nicht in einen Zustand gerate, der ihn unzugänglich für alle Beweismittel macht, sorgt man dafür, daß weder die Verliebtheit noch die Feindseligkeit eine extreme Höhe erreichen. Man tut dies, indem man ihn frühzeitig auf diese Möglichkeiten vorbereitet und deren erste Anzeichen nicht unbeachtet läßt. Solche Sorgfalt in der Handhabung der Übertragung pflegt sich reichlich zu lohnen. Gelingt es, wie zumeist, den Patienten über die wirkliche Natur der Übertragungsphänomene zu belehren, so hat man seinem Widerstand eine mächtige Waffe aus der Hand geschlagen, Gefahren in Gewinne verwandelt, denn was der Patient in den Formen der Übertragung erlebt hat, das vergißt er nicht wieder, das hat für ihn stärkere Überzeugungskraft als alles auf andere Art Erworbene.
Es ist uns sehr unerwünscht, wenn der Patient außerhalb der Übertragung agiert, anstatt zu erinnern; das für unsere Zwecke ideale Verhalten wäre, wenn er sich außerhalb der Behandlung möglichst normal benähme und seine abnormen Reaktionen nur in der Übertragung äußerte.
Unser Weg, das geschwächte Ich zu stärken, geht von der Erweiterung seiner Selbsterkenntnis aus. Wir wissen, dies ist nicht alles, aber es ist der erste Schritt. Der Verlust an solcher Kenntnis bedeutet für das Ich Einbuße an Macht und Einfluß, er ist das nächste greifbare Anzeichen dafür, daß es von den Anforderungen des Es und des Über-Ichs eingeengt und behindert ist. Somit ist das erste Stück unserer Hilfeleistung eine intellektuelle Arbeit von unserer Seite und eine Aufforderung zur Mitarbeit daran für den Patienten; Wir wissen, diese erste Tätigkeit soll uns den Weg bahnen zu einer anderen, schwierigeren Aufgabe. Wir werden den dynamischen Anteil derselben auch während der Einleitung nicht aus den Augen verlieren. Den Stoff für unsere Arbeit gewinnen wir aus verschiedenen Quellen, aus dem, was uns seine Mitteilungen und freien Assoziationen andeuten, was er uns in seinen Übertragungen zeigt, was wir aus der Deutung seiner Träume entnehmen, was er durch seine Fehlleistungen verrät. All das Material verhilft uns zu Konstruktionen über das, was mit ihm vorgegangen ist und was er vergessen hat, wie über das, was jetzt in ihm vorgeht, ohne daß er es versteht. Wir versäumen dabei aber nie, unser Wissen und sein Wissen strenge auseinanderzuhalten. Wir vermeiden es, ihm, was wir oft sehr frühzeitig erraten haben, sofort mitzuteilen oder ihm alles mitzuteilen, was wir glauben erraten zu haben. Wir überlegen uns sorgfältig, wann wir ihn zum Mitwisser einer unserer Konstruktionen machen sollen, warten einen Moment ab, der uns der geeignete zu sein scheint, was nicht immer leicht zu entscheiden ist. In der Regel verzögern wir die Mitteilung einer Konstruktion, die Aufklärung, bis er sich selbst derselben so weit genähert hat, daß ihm nur ein Schritt, allerdings die entscheidende Synthese, zu tun übrigbleibt. Würden wir anders verfahren, ihn mit unseren Deutungen überfallen, ehe er für sie vorbereitet ist, so bliebe die Mitteilung entweder erfolglos, oder sie würde einen heftigen Ausbruch von Widerstand hervorrufen, der die Fortsetzung der Arbeit erschweren oder selbst in Frage stellen könnte. Haben wir aber alles richtig vorbereitet, so erreichen wir oft, daß der Patient unsere Konstruktion unmittelbar bestätigt und den vergessenen inneren oder äußeren Vorgang selbst erinnert. Je genauer sich die Konstruktion mit den Einzelheiten des Vergessenen deckt, desto leichter wird ihm seine Zustimmung. Unser Wissen in diesem Stück ist dann auch sein Wissen geworden.
Mit der Erwähnung des Widerstandes sind wir an den zweiten wichtigeren Teil unserer Aufgabe herangekommen. Wir haben schon gehört, daß sich das Ich gegen das Eindringen unerwünschter Elemente aus dem unbewußten und verdrängten Es durch Gegenbesetzungen schützt, deren Intaktheit eine Bedingung seiner normalen Funktion ist. Je bedrängter sich das Ich nun fühlt, desto krampfhafter beharrt es, gleichsam verängstigt, auf diesen Gegenbesetzungen, um seinen Restbestand vor weiteren Einbrüchen zu beschützen. Diese defensive Tendenz stimmt aber durchaus nicht zu den Absichten unserer Behandlung. Wir wollen im Gegenteil, daß das Ich, durch die Sicherheit unserer Hilfe kühn geworden, den Angriff wage, um das Verlorene wiederzuerobern. Dabei bekommen wir nun die Stärke dieser Gegenbesetzungen als Widerstände gegen unsere Arbeit zu spüren. Das Ich schreckt vor solchen Unternehmungen zurück, die gefährlich scheinen und mit Unlust drohen, es muß beständig angeeifert und beschwichtigt werden, um sich uns nicht zu verweigern. Diesen Widerstand, der die ganze Behandlung über anhält und sich bei jedem neuen Stück der Arbeit erneuert, heißen wir, nicht ganz korrekt, den Verdrängungswiderstand. Wir werden hören, daß es nicht der einzige ist, der uns bevorsteht. Es ist interessant, daß sich in dieser Situation die Parteibildung gewissermaßen umkehrt, denn das Ich sträubt sich gegen unsere Anregung, das Unbewußte aber, sonst unser Gegner, leistet uns Hilfe, denn es hat einen natürlichen »Auftrieb«, es verlangt nichts so sehr, als über die ihm gesetzten Grenzen ins Ich und bis zum Bewußtsein vorzudringen. Der Kampf, der sich entspinnt, wenn wir unsere Absicht erreichen und das Ich zur Überwindung seiner Widerstände bewegen können, vollzieht sich unter unserer Leitung und mit unserer Hilfeleistung. Es ist gleichgiltig, welchen Ausgang er nimmt, ob er dazu führt, daß das Ich einen bisher zurückgewiesenen Triebanspruch nach neuerlicher Prüfung annimmt, oder ob es ihn wiederum, diesmal endgültig, verwirft. In beiden Fällen ist eine dauernde Gefahr beseitigt, der Umfang des Ichs erweitert und ein kostspieliger Aufwand überflüssig gemacht worden.
Die Überwindung der Widerstände ist der Teil unserer Arbeit, der die meiste Zeit und die größte Mühe in Anspruch nimmt. Er lohnt sich aber auch, denn er bringt eine vorteilhafte Ichveränderung zustande, die sich unabhängig vom Erfolg der Übertragung erhalten und im Leben bewähren wird. Gleichzeitig haben wir auch an der Beseitigung jener Ichveränderung gearbeitet, die sich unter dem Einfluß des Unbewußten hergestellt hatte, denn wann immer wir solche Abkömmlinge desselben im Ich nachweisen konnten, haben wir ihre illegitime Herkunft aufgezeigt und das Ich zu ihrer Verwerfung angeregt. Wir erinnern uns, es war eine der Vorbedingungen unserer vertragsmäßigen Hilfeleistung, daß eine solche Ichveränderung durch das Eindringen unbewußter Elemente ein gewisses Ausmaß nicht überstiegen habe.
Je weiter unsere Arbeit fortschreitet und je tiefer sich unsere Einsicht in das Seelenleben des Neurotikers gestaltet, desto deutlicher drängt sich uns die Kenntnis zweier neuer Momente auf, die als Quellen des Widerstandes die größte Beachtung fordern. Beide sind dem Kranken völlig unbekannt, beide konnten beim Abschluß unseres Vertrages nicht berücksichtigt werden; sie gehen auch nicht vom Ich des Patienten aus. Man kann sie unter dem gemeinsamen Namen: Krankheits- oder Leidensbedürfnis zusammenfassen, aber sie sind verschiedener Herkunft, wenn auch sonst verwandter Natur. Das erste dieser beiden Momente ist das Schuldgefühl oder Schuldbewußtsein, wie es mit Hinwegsetzung über die Tatsache genannt wird, daß der Kranke es nicht verspürt und nicht erkennt. Es ist offenbar der Beitrag zum Widerstand, den ein besonders hart und grausam gewordenes Über-Ich leistet. Das Individuum soll nicht gesund werden, sondern krank bleiben, denn es verdient nichts Besseres. Dieser Widerstand stört eigentlich unsere intellektuelle Arbeit nicht, aber er macht sie unwirksam, ja, er gestattet oft, daß wir eine Form des neurotischen Leidens aufheben, ist aber sofort bereit, sie durch eine andere, eventuell durch eine somatische Erkrankung zu ersetzen. Dieses Schuldbewußtsein erklärt auch die gelegentlich beobachtete Heilung oder Besserung schwerer Neurosen durch reale Unglücksfälle; es kommt nämlich nur darauf an, daß man elend sei, gleichgiltig in welcher Weise. Die klaglose Ergebenheit, mit der solche Personen oft ihr schweres Schicksal ertragen, ist sehr merkwürdig, aber auch verräterisch. In der Abwehr dieses Widerstandes müssen wir uns auf das Bewußtmachen desselben und auf den Versuch zum langsamen Abbau des feindseligen Über-Ichs beschränken.
Weniger leicht ist es, die Existenz eines anderen Widerstandes zu erweisen, in dessen Bekämpfung wir uns besonders unzulänglich finden. Es gibt unter den Neurotikern Personen, bei denen, nach all ihren Reaktionen zu urteilen, der Trieb zur Selbsterhaltung geradezu eine Verkehrung erfahren hat. Sie scheinen auf nichts anderes als auf Selbstschädigung und Selbstzerstörung auszugehen. Vielleicht gehören auch die Personen, welche am Ende wirklich Selbstmord begehen, zu dieser Gruppe. Wir nehmen an, daß bei ihnen weitgehende Triebentmischungen stattgefunden haben, in deren Folge übergroße Quantitäten des nach innen gewendeten Destruktionstriebs freigeworden sind. Solche Patienten können die Herstellung durch unsere Behandlung nicht erträglich finden, sie widerstreben ihr mit allen Mitteln. Aber wir gestehen es zu, dies ist ein Fall, dessen Aufklärung uns noch nicht ganz geglückt ist.
Überblicken wir jetzt nochmals die Situation, in die wir uns mit unserem Versuch, dem neurotischen Ich Hilfe zu bringen, begeben haben. Dieses Ich kann die Aufgabe, welche ihm die Außenwelt einschließlich der menschlichen Gesellschaft stellt, nicht mehr erfüllen. Es verfügt nicht über all seine Erfahrungen, ein großer Teil seines Erinnerungsschatzes ist ihm abhanden gekommen. Seine Aktivität wird durch strenge Verbote des Über-Ichs gehemmt, seine Energie verzehrt sich in vergeblichen Versuchen zur Abwehr der Ansprüche des Es. Überdies ist es infolge der fortgesetzten Einbrüche des Es in seiner Organisation geschädigt, in sich gespalten, bringt keine ordentliche Synthese mehr zustande, wird von einander widerstrebenden Strebungen, unerledigten Konflikten, ungelösten Zweifeln zerrissen. Wir lassen dies geschwächte Ich des Patienten zunächst an der rein intellektuellen Deutungsarbeit teilnehmen, die eine provisorische Ausfüllung der Lücken in seinem seelischen Besitz anstrebt, lassen uns die Autorität seines Über-Ichs übertragen, feuern es an, den Kampf um jeden einzelnen Anspruch des Es aufzunehmen und die Widerstände zu besiegen, die sich dabei ergeben. Gleichzeitig stellen wir die Ordnung in seinem Ich wieder her, indem wir die aus dem Unbewußten eingedrungenen Inhalte und Strebungen aufspüren und durch Rückführung auf ihren Ursprung der Kritik bloßstellen. Wir dienen dem Patienten in verschiedenen Funktionen als Autorität und Elternersatz, als Lehrer und Erzieher, das Beste haben wir für ihn getan, wenn wir als Analytiker die psychischen Vorgänge in seinem Ich aufs normale Niveau heben, unbewußt Gewordenes und Verdrängtes in Vorbewußtes verwandeln und damit dem Ich wieder zu eigen geben. Auf der Seite des Patienten wirken für uns einige rationelle Momente wie das durch sein Leiden motivierte Bedürfnis nach Genesung und das intellektuelle Interesse, das wir bei ihm für die Lehren und Enthüllungen der Psychoanalyse wecken konnten, mit weit stärkeren Kräften aber die positive Übertragung, mit der er uns entgegenkommt. Auf der anderen Seite streiten gegen uns die negative Übertragung, der Verdrängungswiderstand des Ichs, d. h. seine Unlust, sich der ihm aufgetragenen schweren Arbeit auszusetzen, das Schuldgefühl aus dem Verhältnis zum Über-Ich und das Krankheitsbedürfnis aus tiefgreifenden Veränderungen seiner Triebökonomie. Von dem Anteil der beiden letzteren Faktoren hängt es ab, ob wir seinen Fall einen leichten oder schweren nennen werden. Unabhängig von diesen lassen sich einige andere Momente erkennen, die als günstig oder ungünstig in Betracht kommen. Eine gewisse psychische Trägheit, eine Schwerbeweglichkeit der Libido, die ihre Fixierungen nicht verlassen will, kann uns nicht willkommen sein; die Fähigkeit der Person zur Triebsublimierung spielt eine große Rolle und ebenso ihre Fähigkeit zur Erhebung über das grobe Triebleben sowie die relative Macht ihrer intellektuellen Funktionen.
Wir sind nicht enttäuscht, sondern finden es durchaus begreiflich, wenn wir zum Schluß kommen, daß der Endausgang des Kampfes, den wir aufgenommen haben, von quantitativen Relationen abhängt, von dem Energiebetrag, den wir zu unseren Gunsten beim Patienten mobilisieren können, im Vergleich zur Summe der Energien der Mächte, die gegen uns wirken. Gott ist hier wieder einmal mit den stärkeren Bataillonen –; gewiß erreichen wir nicht immer zu siegen, aber wenigstens können wir meistens erkennen, warum wir nicht gesiegt haben. Wer unseren Ausführungen nur aus therapeutischem Interesse gefolgt ist, wird sich vielleicht nach diesem Eingeständnis geringschätzig abwenden. Aber uns beschäftigt die Therapie hier nur insoweit sie mit psychologischen Mitteln arbeitet, derzeit haben wir keine anderen. Die Zukunft mag uns lehren, mit besonderen chemischen Stoffen die Energiemengen und deren Verteilungen im seelischen Apparat direkt zu beeinflussen. Vielleicht ergeben sich noch ungeahnte andere Möglichkeiten der Therapie; vorläufig steht uns nichts Besseres zu Gebote als die psychoanalytische Technik, und darum sollte man sie trotz ihrer Beschränkungen nicht verachten.
Die psychogene Sehstörung in psychoanalytischer Auffassung (1910)
Meine Herren Kollegen! Ich möchte Ihnen an dem Beispiel der psychogenen Sehstörung zeigen, welche Veränderungen unsere Auffassung von der Genese solcher Leiden unter dem Einflusse der psychoanalytischen Untersuchungsmethode erfahren hat. Sie wissen, man nimmt die hysterische Blindheit als den Typus einer psychogenen Sehstörung an. Die Genese einer solchen glaubt man nach den Untersuchungen der französischen Schule eines Charcot, Janet, Binet zu kennen. Man ist ja imstande, eine solche Blindheit experimentell zu erzeugen, wenn man eine des Somnambulismus fähige Person zur Verfügung hat. Versetzt man diese in tiefe Hypnose und suggeriert ihr die Vorstellung, sie sehe mit dem einen Auge nichts, so benimmt sie sich tatsächlich wie eine auf diesem Auge Erblindete, wie eine Hysterika mit spontan entwickelter Sehstörung. Man darf also den Mechanismus der spontanen hysterischen Sehstörung nach dem Vorbild der suggerierten hypnotischen konstruieren. Bei der Hysterika entsteht die Vorstellung, blind zu sein, nicht aus der Eingebung des Hypnotiseurs, sondern spontan, wie man sagt, durch Autosuggestion, und diese Vorstellung ist in beiden Fällen so stark, daß sie sich in Wirklichkeit umsetzt, ganz ähnlich wie eine suggerierte Halluzination, Lähmung und dergleichen.
Das klingt ja vollkommen verläßlich und muß jeden befriedigen, der sich über die vielen, hinter den Begriffen Hypnose, Suggestion und Autosuggestion versteckten Rätselhaftigkeiten hinwegsetzen kann. Insbesondere die Autosuggestion gibt Anlaß zu weiteren Fragen. Wann, unter welchen Bedingungen wird eine Vorstellung so stark, daß sie sich wie eine Suggestion benehmen und ohne weiteres in Wirklichkeit umsetzen kann? Eingehendere Untersuchungen haben da gelehrt, daß man diese Frage nicht beantworten kann, ohne den Begriff des »Unbewußten« zu Hilfe zu nehmen. Viele Philosophen sträuben sich gegen die Annahme eines solchen seelischen Unbewußten, weil sie sich um die Phänomene nicht gekümmert haben, die zu seiner Aufstellung nötigen. Den Psychopathologen ist es unvermeidlich geworden, mit unbewußten seelischen Vorgängen, unbewußten Vorstellungen und dergleichen zu arbeiten.
Sinnreiche Versuche haben gezeigt, daß die hysterisch Blinden doch in gewissem Sinne sehen, wenn auch nicht im vollen Sinne. Die Erregungen des blinden Auges können doch gewisse psychische Folgen haben, z. B. Affekte hervorrufen, obgleich sie nicht bewußt werden. Die hysterisch Blinden sind also nur fürs Bewußtsein blind, im Unbewußten sind sie sehend. Es sind gerade Erfahrungen dieser Art, die uns zur Sonderung von bewußten und unbewußten seelischen Vorgängen nötigen. Wie kommt es, daß sie die unbewußte »Autosuggestion«, blind zu sein, entwickeln, während sie doch im Unbewußten sehen?
Auf diese weitere Frage antwortet die Forschung der Franzosen mit der Erklärung, daß bei den zur Hysterie disponierten Kranken von vornherein eine Neigung zur Dissoziation –; zur Auflösung des Zusammenhanges im seelischen Geschehen –; bestehe, in deren Folge manche unbewußte Vorgänge sich nicht zum Bewußten fortsetzen. Lassen wir nun den Wert dieses Erklärungsversuches für das Verständnis der behandelten Erscheinungen ganz außer Betracht und wenden wir uns einem anderen Gesichtspunkte zu. Sie sehen doch ein, meine Herren, daß die anfänglich betonte Identität der hysterischen Blindheit mit der durch Suggestion hervorgerufenen wieder aufgegeben ist. Die Hysterischen sind nicht infolge der autosuggestiven Vorstellung, daß sie nicht sehen, blind, sondern infolge der Dissoziation zwischen unbewußten und bewußten Prozessen im Sehakt; ihre Vorstellung, nicht zu sehen, ist der berechtigte Ausdruck des psychischen Sachverhalts und nicht die Ursache desselben.
Meine Herren! Wenn Sie der vorstehenden Darstellung Unklarheit zum Vorwurf machen, so wird es mir nicht leicht werden, sie zu verteidigen. Ich habe versucht, Ihnen eine Synthese aus den Ansichten verschiedener Forscher zu geben, und dabei wahrscheinlich die Zusammenhänge zu straff angezogen. Ich wollte die Begriffe, denen man das Verständnis der psychogenen Störungen unterworfen hat: die Entstehung aus übermächtigen Ideen, die Unterscheidung bewußter von unbewußten seelischen Vorgängen und die Annahme der seelischen Dissoziation, zu einer einheitlichen Komposition verdichten, und dies konnte mir ebensowenig gelingen, wie es den französischen Autoren, an ihrer Spitze P. Janet, gelungen ist. Verzeihen Sie mir also nebst der Unklarheit auch die Untreue meiner Darstellung und lassen Sie sich erzählen, wie uns die Psychoanalyse zu einer in sich besser gefestigten und wahrscheinlich lebenswahreren Auffassung der psychogenen Sehstörungen geführt hat.
Die Psychoanalyse akzeptiert ebenfalls die Annahmen der Dissoziation und des Unbewußten, setzt sie aber in eine andere Beziehung zueinander. Sie ist eine dynamische Auffassung, die das seelische Leben auf ein Spiel von einander fördernden und hemmenden Kräften zurückführt. Wenn in einem Falle eine Gruppe von Vorstellungen im Unbewußten verbleibt, so schließt sie nicht auf eine konstitutionelle Unfähigkeit zur Synthese, die sich gerade in dieser Dissoziation kundgibt, sondern behauptet, daß ein aktives Sträuben anderer Vorstellungsgruppen die Isolierung und Unbewußtheit der einen Gruppe verursacht hat. Den Prozeß, der ein solches Schicksal für die eine Gruppe herbeiführt, heißt sie »Verdrängung« und erkennt in ihm etwas Analoges, wie es auf logischem Gebiete die Urteilsverwerfung ist. Sie weist nach, daß solche Verdrängungen eine außerordentlich wichtige Rolle in unserem Seelenleben spielen, daß sie dem Individuum auch häufig mißlingen können und daß das Mißlingen der Verdrängung die Vorbedingung der Symptombildung ist.
Wenn also die psychogene Sehstörung, wie wir gelernt haben, darauf beruht, daß gewisse, an das Sehen geknüpfte Vorstellungen vom Bewußtsein abgetrennt bleiben, so muß die psychoanalytische Denkweise annehmen, diese Vorstellungen seien in einem Gegensatz zu anderen, stärkeren getreten, für die wir den jeweilig anders zusammengesetzten Sammelbegriff des »Ichs« verwenden, und seien darum in die Verdrängung geraten. Woher soll aber ein solcher, zur Verdrängung auffordernder Gegensatz zwischen dem Ich und einzelnen Vorstellungsgruppen rühren? Sie merken wohl, daß diese Fragestellung vor der Psychoanalyse nicht möglich war, denn vorher wußte man nichts vom psychischen Konflikt und von der Verdrängung. Unsere Untersuchungen haben uns nun in den Stand gesetzt, die verlangte Antwort zu geben. Wir sind auf die Bedeutung der Triebe für das Vorstellungsleben aufmerksam geworden; wir haben erfahren, daß sich jeder Trieb durch die Belebung der zu seinen Zielen passenden Vorstellungen zur Geltung zu bringen sucht. Diese Triebe vertragen sich nicht immer miteinander; sie geraten häufig in einen Konflikt der Interessen; die Gegensätze der Vorstellungen sind nur der Ausdruck der Kämpfe zwischen den einzelnen Trieben. Von ganz besonderer Bedeutung für unseren Erklärungsversuch ist der unleugbare Gegensatz zwischen den Trieben, welche der Sexualität, der Gewinnung sexueller Lust, dienen, und den anderen, welche die Selbsterhaltung des Individuums zum Ziele haben, den Ichtrieben. Als »Hunger« oder als »Liebe« können wir nach den Worten des Dichters alle in unserer Seele wirkenden organischen Triebe klassifizieren. Wir haben den »Sexualtrieb« von seinen ersten Äußerungen beim Kinde bis zur Erreichung der als »normal« bezeichneten Endgestaltung verfolgt und gefunden, daß er aus zahlreichen »Partialtrieben« zusammengesetzt ist, die an den Erregungen von Körperregionen haften; wir haben eingesehen, daß diese Einzeltriebe eine komplizierte Entwicklung durchmachen müssen, ehe sie sich in zweckmäßiger Weise den Zielen der Fortpflanzung einordnen können. Die psychologische Beleuchtung unserer Kulturentwicklung hat uns gelehrt, daß die Kultur wesentlich auf Kosten der sexuellen Partialtriebe entsteht, daß diese unterdrückt, eingeschränkt, umgebildet, auf höhere Ziele gelenkt werden müssen, um die kulturellen seelischen Konstruktionen herzustellen. Als wertvolles Ergebnis dieser Untersuchungen konnten wir erkennen, was uns die Kollegen noch nicht glauben wollen, daß die als »Neurosen« bezeichneten Leiden der Menschen auf die mannigfachen Weisen des Mißglückens dieser Umbildungsvorgänge an den sexuellen Partialtrieben zurückzuführen sind. Das »Ich« fühlt sich durch die Ansprüche der sexuellen Triebe bedroht und erwehrt sich ihrer durch Verdrängungen, die aber nicht immer den erwünschten Erfolg haben, sondern bedrohliche Ersatzbildungen des Verdrängten und lästige Reaktionsbildungen des Ichs zur Folge haben. Aus diesen beiden Klassen von Phänomenen setzt sich zusammen, was wir die Symptome der Neurosen heißen.
Wir sind von unserer Aufgabe anscheinend weit abgeschweift, haben aber dabei die Verknüpfung der neurotischen Krankheitszustände mit unserem gesamten Geistesleben gestreift. Gehen wir jetzt zu unserem engeren Problem zurück. Den sexuellen wie den Ichtrieben stehen im allgemeinen die nämlichen Organe und Organsysteme zur Verfügung. Die sexuelle Lust ist nicht bloß an die Funktion der Genitalien geknüpft; der Mund dient dem Küssen ebensowohl wie dem Essen und der sprachlichen Mitteilung, die Augen nehmen nicht nur die für die Lebenserhaltung wichtigen Veränderungen der Außenwelt wahr, sondern auch die Eigenschaften der Objekte, durch welche diese zu Objekten der Liebeswahl erhoben werden, ihre »Reize«. Es bewahrheitet sich nun, daß es für niemand leicht wird, zweien Herren zugleich zu dienen. In je innigere Beziehung ein Organ mit solch doppelseitiger Funktion zu dem einen der großen Triebe tritt, desto mehr verweigert es sich dem anderen. Dies Prinzip muß zu pathologischen Konsequenzen führen, wenn sich die beiden Grundtriebe entzweit haben, wenn von Seiten des Ichs eine Verdrängung gegen den betreffenden sexuellen Partialtrieb unterhalten wird. Die Anwendung auf das Auge und das Sehen ergibt sich leicht. Wenn der sexuelle Partialtrieb, der sich des Schauens bedient, die sexuelle Schaulust, wegen seiner übergroßen Ansprüche die Gegenwehr der Ichtriebe auf sich gezogen hat, so daß die Vorstellungen, in denen sich sein Streben ausdrückt, der Verdrängung verfallen und vom Bewußtwerden abgehalten werden, so ist damit die Beziehung des Auges und des Sehens zum Ich und zum Bewußtsein überhaupt gestört. Das Ich hat seine Herrschaft über das Organ verloren, welches sich nun ganz dem verdrängten sexuellen Trieb zur Verfügung stellt. Es macht den Eindruck, als ginge die Verdrängung von seiten des Ichs zu weit, als schüttete sie das Kind mit dem Bade aus, indem das Ich jetzt überhaupt nichts mehr sehen will, seitdem sich die sexuellen Interessen im Sehen so sehr vorgedrängt haben. Zutreffender ist aber wohl die andere Darstellung, welche die Aktivität nach der Seite der verdrängten Schaulust verlegt. Es ist die Rache, die Entschädigung des verdrängten Triebes, daß er, von weiterer psychischer Entfaltung abgehalten, seine Herrschaft über das ihm dienende Organ nun zu steigern vermag. Der Verlust der bewußten Herrschaft über das Organ ist die schädliche Ersatzbildung für die mißglückte Verdrängung, die nur um diesen Preis ermöglicht war.
Deutlicher noch als am Auge ist diese Beziehung des zweifach in Anspruch genommenen Organs zum bewußten Ich und zur verdrängten Sexualität an den motorischen Organen ersichtlich, wenn z. B. die Hand hysterisch gelähmt wird, die eine sexuelle Aggression ausführen wollte und nach deren Hemmung nichts anders mehr tun kann, gleichsam als bestünde sie eigensinnig auf der Ausführung der einen verdrängten Innervation, oder wenn die Finger von Personen, welche der Masturbation entsagt haben, sich weigern, das feine Bewegungsspiel, welches am Klavier oder an der Violine erfordert wird, zu erlernen. Für das Auge pflegen wir die dunkeln psychischen Vorgänge bei der Verdrängung der sexuellen Schaulust und bei der Entstehung der psychogenen Sehstörung so zu übersetzen, als erhöbe sich in dem Individuum eine strafende Stimme, welche sagte: »Weil du dein Sehorgan zu böser Sinneslust mißbrauchen wolltest, geschieht es dir ganz recht, wenn du überhaupt nichts mehr siehst«, und die so den Ausgang des Prozesses billigte. Es liegt dann die Idee der Talion darin, und unsere Erklärung der psychogenen Sehstörung ist eigentlich mit jener zusammengefallen, die von der Sage, dem Mythus, der Legende dargeboten wird. In der schönen Sage von der Lady Godiva verbergen sich alle Einwohner des Städtchens hinter ihren verschlossenen Fenstern, um der Dame die Aufgabe, bei hellem Tageslichte nackt durch die Straßen zu reiten, zu erleichtern. Der einzige, der durch die Fensterläden nach der entblößten Schönheit späht, wird gestraft, indem er erblindet. Es ist dies übrigens nicht das einzige Beispiel, welches uns ahnen läßt, daß die Neurotik auch den Schlüssel zur Mythologie in sich birgt.
Meine Herren, man macht der Psychoanalyse mit Unrecht den Vorwurf, daß sie zu rein psychologischen Theorien der krankhaften Vorgänge führe. Schon die Betonung der pathogenen Rolle der Sexualität, die doch gewiß kein ausschließlich psychischer Faktor ist, sollte sie gegen diesen Vorwurf schützen. Die Psychoanalyse vergißt niemals, daß das Seelische auf dem Organischen ruht, wenngleich ihre Arbeit es nur bis zu dieser Grundlage und nicht darüber hinaus verfolgen kann. So ist die Psychoanalyse auch bereit zuzugeben, ja zu postulieren, daß nicht alle funktionellen Sehstörungen psychogen sein können wie die durch Verdrängung der erotischen Schaulust hervorgerufenen. Wenn ein Organ, welches beiderlei Trieben dient, seine erogene Rolle steigert, so ist ganz allgemein zu erwarten, daß dies nicht ohne Veränderungen der Erregbarkeit und der Innervation abgehen wird, die sich bei der Funktion des Organs im Dienste des Ichs als Störungen kundgeben werden. Ja, wenn wir sehen, daß ein Organ, welches sonst der Sinneswahrnehmung dient, sich bei Erhöhung seiner erogenen Rolle geradezu wie ein Genitale gebärdet, werden wir auch toxische Veränderungen in demselben nicht für unwahrscheinlich halten. Für beide Arten von Funktionsstörungen infolge der gesteigerten erogenen Bedeutung, die physiologischen wie die toxischen Ursprunges, wird man, in Ermangelung eines besseren, den alten, unpassenden Namen »neurotische« Störungen beibehalten müssen. Die neurotischen Störungen des Sehens verhalten sich zu den psychogenen wie ganz allgemein die Aktualneurosen zu den Psychoneurosen; psychogene Sehstörungen werden wohl kaum jemals ohne neurotische vorkommen können, wohl aber letztere ohne jene. Leider sind diese »neurotischen« Symptome heute noch sehr wenig gewürdigt und verstanden, denn der Psychoanalyse sind sie nicht unmittelbar zugänglich, und die anderen Untersuchungsweisen haben den Gesichtspunkt der Sexualität außer acht gelassen.
Von der Psychoanalyse zweigt noch ein anderer, in die organische Forschung reichender Gedankengang ab. Man kann sich die Frage vorlegen, ob die durch die Lebenseinflüsse erzeugte Unterdrückung sexueller Partialtriebe für sich allein hinreicht, die Funktionsstörungen der Organe hervorzurufen, oder ob nicht besondere konstitutionelle Verhältnisse vorliegen müssen, welche erst die Organe zur Übertreibung ihrer erogenen Rolle veranlassen und dadurch die Verdrängung der Triebe provozieren. In diesen Verhältnissen müßte man den konstitutionellen Anteil der Disposition zur Erkrankung an psychogenen und neurotischen Störungen erblicken. Es ist dies jenes Moment, welches ich bei der Hysterie vorläufig als »somatisches Entgegenkommen« der Organe bezeichnet habe.
Die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen (1898)
Durch eingehende Untersuchungen bin ich in den letzten Jahren zur Erkenntnis gelangt, daß Momente aus dem Sexualleben die nächsten und praktisch bedeutsamsten Ursachen eines jeden Falles von neurotischer Erkrankung darstellen. Diese Lehre ist nicht völlig neu; eine gewisse Bedeutung ist den sexuellen Momenten in der Ätiologie der Neurosen von jeher und von allen Autoren eingeräumt worden; für manche Unterströmungen in der Medizin ist die Heilung von »Sexualbeschwerden« und von »Nervenschwäche« immer in einem einzigen Versprechen vereint gewesen. Es wird also nicht schwerhalten, dieser Lehre die Originalität zu bestreiten, wenn man einmal darauf verzichtet haben wird, ihre Triftigkeit zu leugnen.
In einigen kürzeren Aufsätzen, die in den letzten Jahren im Neurologischen Zentralblatt, in der Revue neurologique und in der Wiener Klinischen Rundschau erschienen sind, habe ich versucht, das Material und die Gesichtspunkte anzudeuten, welche der Lehre von der »sexuellen Ätiologie der Neurosen« eine wissenschaftliche Stütze bieten. Eine ausführliche Darstellung steht noch aus, und zwar wesentlich darum, weil man bei der Bemühung, den als tatsächlich erkannten Zusammenhang aufzuklären, zu immer neuen Problemen gelangt, für deren Lösung es an Vorarbeiten fehlt. Keineswegs verfrüht erscheint mir aber der Versuch, das Interesse des praktischen Arztes auf die von mir behaupteten Verhältnisse zu lenken, damit er sich in einem von der Richtigkeit dieser Behauptungen und von den Vorteilen überzeuge, welche er für sein ärztliches Handeln aus ihrer Erkenntnis ableiten kann.
Ich weiß, daß es an Bemühungen nicht fehlen wird, den Arzt durch ethisch gefärbte Argumente von der Verfolgung dieses Gegenstandes abzuhalten. Wer sich bei seinen Kranken überzeugen will, ob ihre Neurosen wirklich mit ihrem Sexualleben zusammenhängen, der kann es nicht vermeiden, sich bei ihnen nach ihrem Sexualleben zu erkundigen und auf wahrheitsgetreue Aufklärung über dasselbe zu dringen. Darin soll aber die Gefahr für den einzelnen wie für die Gesellschaft liegen. Der Arzt, höre ich sagen, hat kein Recht, sich in die sexuellen Geheimnisse seiner Patienten einzudrängen, ihre Schamhaftigkeit –; besonders der weiblichen Personen –; durch solches Examen gröblich zu verletzen. Seine ungeschickte Hand kann nur Familienglück zerstören, bei jugendlichen Personen die Unschuld beleidigen und der Autorität der Eltern vorgreifen; bei Erwachsenen wird er unbequeme Mitwisserschaft erwerben und sein eigenes Verhältnis zu seinen Kranken zerstören. Es sei also seine ethische Pflicht, der ganzen sexuellen Angelegenheit fernezubleiben.
Man darf wohl antworten: Das ist die Äußerung einer des Arztes unwürdigen Prüderie, die mit schlechten Argumenten ihre Blöße mangelhaft verdeckt. Wenn Momente aus dem Sexualleben wirklich als Krankheitsursachen zu erkennen sind, so fällt die Ermittlung und Besprechung dieser Momente eben hiedurch ohne weiteres Bedenken in den Pflichtenkreis des Arztes. Die Verletzung der Schamhaftigkeit, die er sich dabei zuschulden kommen läßt, ist keine andere und keine ärgere, sollte man meinen, als wenn er, um eine örtliche Affektion zu heilen, auf der Inspektion der weiblichen Genitalien besteht, zu welcher Forderung ihn die Schule selbst verpflichtet. Von älteren Frauen, die ihre Jugendjahre in der Provinz zugebracht haben, hört man oft noch erzählen, daß sie einst durch übermäßige Genitalblutungen bis zur Erschöpfung heruntergekommen waren, weil sie sich nicht entschließen konnten, einem Arzt den Anblick ihrer Nacktheit zu gestatten. Der erziehliche Einfluß, der von den Ärzten auf das Publikum geübt wird, hat es im Lauf einer Generation dahin gebracht, daß bei unseren jungen Frauen solches Sträuben nur höchst selten vorkommt. Wo es sich träfe, würde es als unverständige Prüderie, als Scham am unrechten Orte verdammt werden. Leben wir denn in der Türkei, würde der Ehemann fragen, wo die kranke Frau dem Arzte nur den Arm durch ein Loch in der Mauer zeigen darf?
Es ist nicht richtig, daß das Examen und die Mitwisserschaft in sexuellen Dingen dem Arzt eine gefährliche Machtfülle gegen seine Patienten verschafft. Derselbe Einwand konnte sich mit mehr Berechtigung seinerzeit gegen die Anwendung der Narkose richten, durch welche der Kranke seines Bewußtseins und seiner Willensbestimmung beraubt und es in die Hand des Arztes gelegt wird, ob und wann er sie wiedererlangen soll. Doch ist uns heute die Narkose unentbehrlich geworden, weil sie dem ärztlichen Bestreben zu helfen dienlich ist wie nichts anderes, und der Arzt hat die Verantwortlichkeit für die Narkose unter seine anderen ernsten Verpflichtungen aufgenommen.
Der Arzt kann in allen Fällen Schaden stiften, wenn er ungeschickt oder gewissenlos ist, in anderen Fällen nicht mehr und nicht minder als bei der Forschung nach dem Sexualleben seiner Patienten. Freilich, wer in einem schätzenswerten Ansatze zur Selbsterkenntnis sich nicht das Taktgefühl, den Ernst und die Verschwiegenheit zutraut, deren er für das Examen der Neurotiker bedarf, wer von sich weiß, daß Enthüllungen aus dem Sexualleben lüsternen Kitzel anstatt wissenschaftlichen Interesses bei ihm hervorrufen werden, der tut recht daran, dem Thema der Ätiologie der Neurosen fernzubleiben. Wir verlangen nur noch, daß er sich auch von der Behandlung der Nervösen fernhalte.
Es ist auch nicht richtig, daß die Kranken einer Erforschung ihres Sexuallebens unüberwindliche Hindernisse entgegensetzen. Erwachsene pflegen sich nach kurzem Zögern mit den Worten zurechtzurücken: Ich bin doch beim Arzte, dem darf man alles sagen. Zahlreiche Frauen, die an der Aufgabe, ihre sexuellen Gefühle zu verbergen, schwer genug durchs Leben zu tragen haben, finden sich erleichtert, wenn sie beim Arzte merken, daß hier keine andere Rücksicht über die ihrer Heilung gesetzt ist, und danken es ihm, daß sie sich auch einmal in sexuellen Dingen rein menschlich gebärden dürfen. Eine dunkle Kenntnis der vorwaltenden Bedeutung sexueller Momente für die Entstehung der Nervosität, wie ich sie für die Wissenschaft neu zu gewinnen suche, scheint im Bewußtsein der Laien überhaupt nie untergegangen zu sein. Wie oft erlebt man Szenen wie die folgende: Man hat ein Ehepaar vor sich, von dem ein Teil an Neurose leidet. Nach vielen Einleitungen und Entschuldigungen, daß es für den Arzt, der in solchen Fällen helfen will, konventionelle Schranken nicht geben darf u. dgl., teilt man den beiden mit, man vermute, der Grund der Krankheit liege in der unnatürlichen und schädlichen Art des sexuellen Verkehrs, die sie seit der letzten Entbindung der Frau gewählt haben dürften. Die Ärzte pflegen sich um diese Verhältnisse in der Regel nicht zu kümmern, allein das sei nur verwerflich, wenn auch die Kranken nicht gerne davon hören usw. Dann stößt der eine Teil den andern an und sagt: Siehst du, ich habe es dir gleich gesagt, das wird mich krank machen. Und der andere antwortet: Ich hab' mir's ja auch gedacht, aber was soll man tun?
Unter gewissen anderen Umständen, etwa bei jungen Mädchen, die ja systematisch zur Verhehlung ihres Sexuallebens erzogen werden, wird man sich mit einem recht bescheidenen Maße von aufrichtigem Entgegenkommen begnügen müssen. Es fällt aber hier ins Gewicht, daß der kundige Arzt seinen Kranken nicht unvorbereitet entgegentritt und in der Regel nicht Aufklärung, sondern bloß Bestätigung seiner Vermutungen von ihnen zu fordern hat. Wer meinen Anweisungen folgen will, wie man sich die Morphologie der Neurosen zurechtzulegen und ins Ätiologische zu übersetzen hat, dem brauchen die Kranken nur wenig Geständnisse mehr zu machen. In der nur allzu bereitwillig gegebenen Schilderung ihrer Krankheitssymptome haben sie ihm meist die Kenntnis der dahinter verborgenen sexuellen Faktoren mitverraten.
Es wäre von großem Vorteile, wenn die Kranken besser wüßten, mit welcher Sicherheit dem Arzte die Deutung ihrer neurotischen Beschwerden und der Rückschluß von ihnen auf die wirksame sexuelle Ätiologie nunmehr möglich ist. Es wäre sicherlich ein Antrieb für sie, auf die Heimlichkeit von dem Augenblicke an zu verzichten, da sie sich entschlossen haben, für ihr Leiden um Hilfe zu bitten. Wir haben aber alle ein Interesse daran, daß auch in sexuellen Dingen ein höherer Grad von Aufrichtigkeit unter den Menschen Pflicht werde, als er bis jetzt verlangt wird. Die sexuelle Sittlichkeit kann dabei nur gewinnen. Gegenwärtig sind wir in Sachen der Sexualität samt und sonders Heuchler, Kranke wie Gesunde. Es wird uns nur zugute kommen, wenn im Gefolge der allgemeinen Aufrichtigkeit ein gewisses Maß von Duldung in sexuellen Dingen zur Geltung gelangt.
Der Arzt hat gewöhnlich ein sehr geringes Interesse an manchen der Fragen, welche unter den Neuropathologen in betreff der Neurosen diskutiert werden, etwa ob man Hysterie und Neurasthenie strenge zu sondern berechtigt ist, ob man eine Hystero-Neurasthenie daneben unterscheiden darf, ob man das Zwangsvorstellen zur Neurasthenie rechnen oder als besondere Neurose anerkennen soll u. dgl. m. Wirklich dürfen auch solche Distinktionen dem Arzte gleichgültig sein, solange sich an die getroffene Entscheidung weiter nichts knüpft, keine tiefere Einsicht und kein Fingerzeig für die Therapie, solange der Kranke in allen Fällen in die Wasserheilanstalt geschickt wird oder zu hören bekommt –; daß ihm nichts fehlt. Anders aber, wenn man unsere Gesichtspunkte über die ursächlichen Beziehungen zwischen der Sexualität und den Neurosen annimmt. Dann erwacht ein neues Interesse für die Symptomatologie der einzelnen neurotischen Fälle, und es gelangt zur praktischen Wichtigkeit, daß man das komplizierte Bild richtig in seine Komponenten zu zerlegen und diese richtig zu benennen verstehe. Die Morphologie der Neurosen ist nämlich mit geringer Mühe in Ätiologie zu übersetzen, und aus der Erkenntnis dieser leiten sich, wie selbstverständlich, neue therapeutische Anweisungen ab.
Die bedeutsame Entscheidung nun, die jedesmal durch sorgfältige Würdigung der Symptome sicher getroffen werden kann, geht dahin, ob der Fall die Charaktere einer Neurasthenie oder einer Psychoneurose (Hysterie, Zwangsvorstellen) an sich trägt. (Es kommen ungemein häufig Mischfälle vor, in denen Zeichen der Neurasthenie mit denen einer Psychoneurose vereinigt sind; wir wollen aber deren Würdigung für später aufsparen.) Nur bei den Neurasthenien hat das Examen der Kranken den Erfolg, die ätiologischen Momente aus dem Sexualleben aufzudecken; dieselben sind dem Kranken, wie natürlich, bekannt und gehören der Gegenwart, richtiger der Lebenszeit seit der Geschlechtsreife an (wenngleich auch diese Abgrenzung nicht alle Fälle einzuschließen gestattet). Bei den Psychoneurosen leistet ein solches Examen wenig; es verschafft uns etwa die Kenntnis von Momenten, die man als Veranlassungen anerkennen muß und die mit dem Sexualleben zusammenhängen oder auch nicht; im ersteren Falle zeigen sie sich dann nicht von anderer Art als die ätiologischen Momente der Neurasthenie, lassen also eine spezifische Beziehung zur Verursachung der Psychoneurose durchaus vermissen. Und doch liegt auch die Ätiologie der Psychoneurosen in jedem Falle wiederum im Sexuellen. Auf einem merkwürdigen Umwege, von dem später die Rede sein wird, kann man zur Kenntnis dieser Ätiologie gelangen und begreiflich finden, daß der Kranke uns von ihr nichts zu sagen wußte. Die Ereignisse und Einwirkungen nämlich, welche jeder Psychoneurose zugrunde liegen, gehören nicht der Aktualität an, sondern einer längst vergangenen, sozusagen prähistorischen Lebensepoche, der frühen Kindheit, und darum sind sie auch dem Kranken nicht bekannt. Er hat sie –; in einem bestimmten Sinne nur –; vergessen.
Sexuelle Ätiologie also in allen Fällen von Neurose; aber bei den Neurasthenien solche von aktueller Art, bei den Psychoneurosen Momente infantiler Natur; dies ist der erste große Gegensatz in der Ätiologie der Neurosen. Ein zweiter ergibt sich, wenn man einem Unterschiede in der Symptomatik der Neurasthenie selbst Rechnung trägt. Hier finden sich einerseits Fälle, in denen sich gewisse für die Neurasthenie charakteristische Beschwerden in den Vordergrund drängen: der Kopfdruck, die Ermüdbarkeit, die Dyspepsie, die Stuhlverstopfung, die Spinalirritation usf. In anderen Fällen treten diese Zeichen zurück, und das Krankheitsbild setzt sich aus anderen Symptomen zusammen, die sämtlich eine Beziehung zum Kernsymptom, der »Angst«, erkennen lassen (freie Ängstlichkeit, Unruhe, Erwartungsangst, komplette, rudimentäre und supplementäre Angstanfälle, lokomotorischer Schwindel, Agoraphobie, Schlaflosigkeit, Schmerzsteigerung usw.). Ich habe dem ersten Typus von Neurasthenie seinen Namen belassen, den zweiten aber als »Angstneurose« ausgezeichnet und diese Scheidung an anderem Orte begründet, woselbst auch der Tatsache des in der Regel gemeinsamen Vorkommens beider Neurosen Rechnung getragen wird. Für unsere Zwecke genügt die Hervorhebung, daß der symptomatischen Verschiedenheit beider Formen ein Unterschied der Ätiologie parallelgeht. Die Neurasthenie läßt sich jedesmal auf einen Zustand des Nervensystems zurückführen, wie er durch exzessive Masturbation erworben wird oder durch gehäufte Pollutionen spontan entsteht; bei der Angstneurose findet man regelmäßig sexuelle Einflüsse, denen das Moment der Zurückhaltung oder der unvollkommenen Befriedigung gemeinsam ist, wie: coitus interruptus, Abstinenz bei lebhafter Libido, sogenannte frustrane Erregung u. dgl. In dem kleinen Aufsatze, welcher die Angstneurose einzuführen bemüht war, habe ich die Formel ausgesprochen, die Angst sei überhaupt eine von ihrer Verwendung abgelenkte Libido.
Wo in einem Falle Symptome der Neurasthenie und der Angstneurose vereinigt sind, also ein Mischfall vorliegt, da hält man sich an den empirisch gefundenen Satz, daß einer Vermengung von Neurosen ein Zusammenwirken von mehreren ätiologischen Momenten entspricht, und wird seine Erwartung jedesmal bestätigt finden. Wie oft diese ätiologischen Momente durch den Zusammenhang der sexuellen Vorgänge organisch miteinander verknüpft sind, z. B. coitus interruptus oder ungenügende Potenz des Mannes mit der Masturbation, dies wäre einer Ausführung im einzelnen wohl würdig.
Wenn man den vorliegenden Fall von neurasthenischer Neurose sicher diagnostiziert und dessen Symptome richtig gruppiert hat, so darf man sich die Symptomatik in Ätiologie übersetzen und dann von den Kranken dreist die Bekräftigung seiner Vermutungen verlangen. Anfänglicher Widerspruch darf einen nicht irremachen; man besteht fest auf dem, was man erschlossen hat, und besiegt endlich jeden Widerstand dadurch, daß man die Unerschütterlichkeit seiner Überzeugung betont. Man erfährt dabei allerlei aus dem Sexualleben der Menschen, womit sich ein nützliches und lehrreiches Buch füllen ließe, lernt es auch nach jeder Richtung hin bedauern, daß die Sexualwissenschaft heutzutage noch als unehrlich gilt. Da kleinere Abweichungen von einer normalen vita sexualis viel zu häufig sind, als daß man ihrer Auffindung Wert beilegen dürfte, wird man bei seinen neurotisch Kranken nur schwere und lange Zeit fortgesetzte Abnormität des Sexuallebens als Aufklärung gelten lassen; daß man aber durch sein Drängen einen Kranken, der psychisch normal ist, veranlassen könnte, sich selbst fälschlich sexueller Vergehen zu bezichtigen, das darf man getrost als eine imaginäre Gefahr vernachlässigen.
Verfährt man in dieser Weise mit seinen Kranken, so erwirbt man sich auch die Überzeugung, daß es für die Lehre von der sexuellen Ätiologie der Neurasthenie negative Fälle nicht gibt. Bei mir wenigstens ist diese Überzeugung so sicher geworden, daß ich auch den negativen Ausfall des Examens diagnostisch verwertet habe, nämlich um mir zu sagen, daß solche Fälle keine Neurasthenie sein können. So kam ich mehrmals dazu, eine progressive Paralyse anstatt einer Neurasthenie anzunehmen, weil es mir nicht gelungen war, die nach meiner Lehre erforderliche ausgiebige Masturbation nachzuweisen, und der Verlauf dieser Fälle gab mir nachträglich recht. Ein andermal, wo der Kranke, bei Abwesenheit deutlicher organischer Veränderungen, über Kopfdruck, Kopfschmerzen, Dyspepsie klagte und meinen sexuellen Verdächtigungen mit Aufrichtigkeit und überlegener Sicherheit begegnete, fiel es mir ein, eine latente Eiterung in einer der Nebenhöhlen der Nase zu vermuten, und ein spezialistisch geschulter Kollege bestätigte diesen aus dem sexuell negativen Examen gezogenen Schluß, indem er den Kranken durch Entleerung von fötidem Eiter aus einer Highmorshöhle von seinen Beschwerden befreite.
Der Anschein, als ob es dennoch »negative Fälle« gäbe, kann auch auf andere Weise entstehen. Das Examen weist mitunter ein normales Sexualleben bei Personen nach, deren Neurose einer Neurasthenie oder einer Angstneurose für oberflächliche Beobachtung wirklich genug ähnlich sieht. Tiefer eindringende Untersuchung deckt aber dann regelmäßig den wahren Sachverhalt auf. Hinter solchen Fällen, die man für Neurasthenie gehalten hat, steckt eine Psychoneurose, eine Hysterie oder Zwangsneurose. Die Hysterie insbesondere, die so viele organische Affektionen nachahmt, kann mit Leichtigkeit eine der aktuellen Neurosen vortäuschen, indem sie deren Symptome zu hysterischen erhebt. Solche Hysterien in der Form der Neurasthenie sind nicht einmal sehr selten. Es ist aber keine wohlfeile Auskunft, wenn man für die Neurasthenien mit sexuell negativer Auskunft auf die Psychoneurosen rekurriert; man kann den Nachweis hiefür führen auf jenem Wege, der allein eine Hysterie untrüglich entlarvt, auf dem Wege der später zu erwähnenden Psychoanalyse.
Vielleicht wird nun mancher, der gerne bereit ist, der sexuellen Ätiologie bei seinen neurasthenisch Kranken Rechnung zu tragen, es doch als eine Einseitigkeit rügen, wenn er nicht aufgefordert wird, auch den anderen Momenten, die als Ursachen der Neurasthenie bei den Autoren allgemein erwähnt sind, seine Aufmerksamkeit zu schenken. Es fällt mir nun nicht ein, die sexuelle Ätiologie bei den Neurosen jeder anderen zu substituieren, so daß ich deren Wirksamkeit für aufgehoben erklären würde. Das wäre ein Mißverständnis. Ich meine vielmehr, zu all den bekannten und wahrscheinlich mit Recht anerkannten ätiologischen Momenten der Autoren für die Entstehung der Neurasthenie kommen die sexuellen, die bisher nicht hinreichend gewürdigt worden sind, noch hinzu. Diese verdienen aber, nach meiner Schätzung, daß man ihnen in der ätiologischen Reihe eine besondere Stellung anweise. Denn sie allein werden in keinem Falle von Neurasthenie vermißt, sie allein vermögen es, die Neurose ohne weitere Beihilfe zu erzeugen, so daß diese anderen Momente zur Rolle einer Hilfs- und Supplementärätiologie herabgedrückt scheinen; sie allein gestatten dem Arzte, sichere Beziehungen zwischen ihrer Mannigfaltigkeit und der Vielheit der Krankheitsbilder zu erkennen. Wenn ich dagegen die Fälle zusammenstelle, die angeblich durch Überarbeitung, Gemütsaufregung, nach einem Typhus u. dgl. neurasthenisch geworden sind, so zeigen sie mir in den Symptomen nichts Gemeinsames, ich wüßte aus der Art der Ätiologie keine Erwartung in betreff der Symptome zu bilden wie umgekehrt aus dem Krankheitsbilde nicht auf die einwirkende Ätiologie zu schließen.
Die sexuellen Ursachen sind auch jene, welche dem Arzte am ehesten einen Anhalt für sein therapeutisches Wirken bieten. Die Heredität ist unzweifelhaft ein bedeutsamer Faktor, wo sie sich findet; sie gestattet, daß ein großer Krankheitseffekt zustande kommt, wo sich sonst nur ein sehr geringer ergeben hätte. Allein die Heredität ist der Beeinflussung des Arztes unzugänglich; ein jeder bringt seine hereditären Krankheitsneigungen mit sich; wir können nichts mehr daran ändern. Auch dürfen wir nicht vergessen, daß wir gerade in der Ätiologie der Neurasthenien der Heredität den ersten Rang notwendig versagen müssen. Die Neurasthenie (in beiden Formen) gehört zu den Affektionen, die jeder erblich Unbelastete bequem erwerben kann. Wäre es anders, so wäre ja die riesige Zunahme der Neurasthenie undenkbar, über welche alle Autoren klagen. Was die Zivilisation betrifft, zu deren Sündenregister man oft die Verursachung der Neurasthenie zu schreiben pflegt, so mögen auch hierin die Autoren recht haben (wiewohl wahrscheinlich auf ganz anderen Wegen, als sie vermeinen); aber der Zustand unserer Zivilisation ist gleichfalls für den einzelnen etwas Unabänderliches; übrigens erklärt dieses Moment bei seiner Allgemeingültigkeit für die Mitglieder derselben Gesellschaft niemals die Tatsache der Auswahl bei der Erkrankung. Der nicht neurasthenische Arzt steht ja unter demselben Einflüsse der angeblich unheilvollen Zivilisation wie der neurasthenische Kranke, den er behandeln soll. –; Die Bedeutung erschöpfender Einflüsse bleibt mit der oben gegebenen Einschränkung bestehen. Aber mit dem Momente der »Überarbeitung«, das die Ärzte so gerne ihren Patienten als Ursache ihrer Neurose gelten lassen, wird übermäßig viel Mißbrauch getrieben. Es ist ganz richtig, daß jeder, der sich durch sexuelle Schädlichkeiten zur Neurasthenie disponiert hat, die intellektuelle Arbeit und die psychischen Mühen des Lebens schlecht verträgt, aber niemals wird jemand durch Arbeit oder durch Aufregung allein neurotisch. Geistige Arbeit ist eher ein Schutzmittel gegen neurasthenische Erkrankung; gerade die ausdauerndsten intellektuellen Arbeiter bleiben von der Neurasthenie verschont, und was die Neurastheniker als »krank machende Überarbeitung« anklagen, das verdient in der Regel weder der Qualität noch dem Ausmaße nach als »geistige Arbeit« anerkannt zu werden. Die Ärzte werden sich wohl gewöhnen müssen, dem Beamten, der sich in seinem Bureau »überangestrengt«, oder der Hausfrau, der ihr Hauswesen zu schwer geworden ist, die Aufklärung zu geben, daß sie nicht erkrankt sind, weil sie versucht haben, ihre für ein zivilisiertes Gehirn eigentlich leichten Pflichten zu erfüllen, sondern weil sie währenddessen ihr Sexualleben gröblich vernachlässigt und verdorben haben.
Nur die sexuelle Ätiologie ermöglicht uns ferner das Verständnis aller Einzelheiten der Krankengeschichten bei Neurasthenikern, der rätselhaften Besserungen mitten im Krankheitsverlaufe und der ebenso unbegreiflichen Verschlimmerungen, die von Ärzten und Kranken dann gewöhnlich mit der eingeschlagenen Therapie in Beziehung gebracht werden. In meiner mehr als zweihundert Fälle umfassenden Sammlung ist z. B. die Geschichte eines Mannes verzeichnet, der, nachdem ihm die hausärztliche Behandlung nichts genützt hatte, zu Pfarrer Kneipp ging und von dieser Kur an ein Jahr von außerordentlicher Besserung mitten in seinen Leiden zu verzeichnen hatte. Als aber ein Jahr später die Beschwerden sich wieder verstärkten und er neuerdings Hilfe in Wörishofen suchte, blieb der Erfolg dieser zweiten Kur aus. Ein Blick in die Familienchronik dieses Patienten löst das zweifache Rätsel auf: sechseinhalb Monate nach der ersten Rückkehr aus Wörishofen wurde dem Kranken von seiner Frau ein Kind geboren; er hatte sie also zu Beginn einer noch unerkannten Gravidität verlassen und durfte nach seiner Wiederkunft natürlichen Verkehr mit ihr pflegen. Als nach Ablauf dieser für ihn heilsamen Zeit seine Neurose durch neuerlichen coitus interruptus wieder angefacht war, mußte sich die zweite Kur erfolglos erweisen, da jene oben erwähnte Gravidität die letzte blieb.
Ein ähnlicher Fall, in dem gleichfalls eine unerwartete Einwirkung der Therapie zu erklären war, gestaltete sich noch lehrreicher, indem er eine rätselhafte Abwechslung in den Symptomen der Neurose enthielt. Ein jugendlicher Nervöser war von seinem Arzte in eine wohlgeleitete Wasserheilanstalt wegen typischer Neurasthenie geschickt worden. Dort besserte sich sein Zustand anfänglich immer mehr, so daß alle Aussicht vorhanden war, den Patienten als dankbaren Anhänger der Hydrotherapie zu entlassen. Da trat in der sechsten Woche ein Umschlag ein; der Kranke »vertrug das Wasser nicht mehr«, wurde immer nervöser und verließ endlich nach zwei weiteren Wochen ungeheilt und unzufrieden die Anstalt. Als er sich bei mir über diesen Trug der Therapie beklagte, erkundigte ich mich ein wenig nach den Symptomen, die ihn mitten in der Kur befallen hatten. Merkwürdigerweise hatte sich darin ein Wandel vollzogen. Er war mit Kopfdruck, Müdigkeit und Dyspepsie in die Anstalt gegangen; was ihn in der Behandlung gestört hatte, waren: Aufgeregtheit, Anfälle von Beklemmung, Schwindel im Gehen und Schlafstörung gewesen. Nun konnte ich dem Kranken sagen: »Sie tun der Hydrotherapie unrecht. Sie sind, wie Sie selbst sehr wohl gewußt haben, infolge von lange fortgesetzter Masturbation erkrankt. In der Anstalt haben Sie diese Art der Befriedigung aufgegeben und sich darum rasch erholt. Als Sie sich aber wohl fühlten, haben Sie unklugerweise Beziehungen zu einer Dame, nehmen wir an, einer Mitpatientin, gesucht, die nur zur Aufregung ohne normale Befriedigung führen konnten. Die schönen Spaziergänge in der Nähe der Anstalt gaben Ihnen gute Gelegenheit dazu. An diesem Verhältnisse sind Sie von neuem erkrankt, nicht an einer plötzlich aufgetretenen Intoleranz gegen die Hydrotherapie. Aus Ihrem gegenwärtigen Befinden schließe ich übrigens, daß Sie dasselbe Verhältnis auch in der Stadt fortsetzen.« Ich kann versichern, daß der Kranke mich dann Punkt für Punkt bestätigt hat.
Die gegenwärtige Therapie der Neurasthenie, wie sie wohl am günstigsten in den Wasserheilanstalten geübt wird, setzt sich das Ziel, die Besserung des nervösen Zustandes durch zwei Momente: Schonung und Stärkung des Patienten zu erreichen. Ich wüßte nichts anderes gegen diese Therapie vorzubringen, als daß sie den sexuellen Bedingungen des Falles keine Rechnung trägt. Nach meiner Erfahrung ist es höchst wünschenswert, daß die ärztlichen Leiter solcher Anstalten sich genügend klarmachen, daß sie es nicht mit Opfern der Zivilisation oder der Heredität, sondern –; sit venia verbo –; mit Sexualitätskrüppeln zu tun haben. Sie würden sich dann einerseits ihre Erfolge wie ihre Mißerfolge leichter erklären, anderseits aber neue Erfolge erzielen, die bis jetzt dem Zufalle oder dem unbeeinflußten Verhalten des Kranken anheimgegeben sind. Wenn man eine ängstlich-neurasthenische Frau von ihrem Hause weg in die Wasserheilanstalt schickt, sie dort, aller Pflichten ledig, baden, turnen und sich reichlich ernähren läßt, so wird man gewiß geneigt sein, die oft glänzende Besserung, die so in einigen Wochen oder Monaten erreicht wird, auf Rechnung der Ruhe, welche die Kranke genossen hat, und der Stärkung, die ihr die Hydrotherapie gebracht hat, zu setzen. Das mag so sein; man übersieht aber dabei, daß mit der Entfernung vom Hause für die Patientin auch eine Unterbrechung des ehelichen Verkehrs gegeben ist und daß erst diese zeitweilige Ausschaltung der krank machenden Ursache ihr die Möglichkeit gibt, sich bei zweckmäßiger Therapie zu erholen. Die Vernachlässigung dieses ätiologischen Gesichtspunktes rächt sich nachträglich, indem der scheinbar so befriedigende Heilerfolg sich als sehr flüchtig erweist. Kurze Zeit nachdem der Patient in seine Lebensverhältnisse zurückgekehrt ist, stellen sich die Symptome des Leidens wieder ein und nötigen ihn, entweder immer von Zeit zu Zeit einen Teil seiner Existenz unproduktiv in solchen Anstalten zu verbringen, oder veranlassen ihn, seine Hoffnungen auf Heilung anderswohin zu richten. Es ist also klar, daß die therapeutischen Aufgaben bei der Neurasthenie nicht in den Wasserheilanstalten, sondern innerhalb der Lebensverhältnisse der Kranken in Angriff zu nehmen sind.
Bei anderen Fällen kann unsere ätiologische Lehre dem Anstaltsarzte Aufklärung über die Quelle von Mißerfolgen geben, die sich noch in der Anstalt selbst ereignen, und ihm nahelegen, wie solche zu vermeiden sind. Die Masturbation ist bei erwachsenen Mädchen und reifen Männern weit häufiger, als man anzunehmen pflegt, und wirkt als Schädlichkeit nicht nur durch die Erzeugung der neurasthenischen Symptome, sondern auch, indem sie die Kranken unter dem Drucke eines als schändlich empfundenen Geheimnisses erhält. Der Arzt, der nicht gewohnt ist, Neurasthenie in Masturbation zu übersetzen, gibt sich für den Krankheitszustand Rechenschaft, indem er sich auf ein Schlagwort wie Anämie, Unterernährung, Überarbeitung usw. bezieht, und erwartet nun bei Anwendung der dagegen ausgearbeiteten Therapie die Heilung seines Kranken. Zu seinem Erstaunen wechseln aber beim Kranken Zeiten von Besserung mit anderen ab, in denen unter schwerer Verstimmung alle Symptome sich verschlimmern. Der Ausgang einer solchen Behandlung ist im allgemeinen zweifelhaft. Wüßte der Arzt, daß der Kranke die ganze Zeit über mit seiner sexuellen Angewöhnung kämpft, daß er in Verzweiflung verfallen ist, weil er ihr wieder einmal unterliegen mußte, verstünde er, dem Kranken sein Geheimnis abzunehmen, dessen Schwere in seinen Augen zu entwerten und ihn bei seinem Abgewöhnungskampfe zu unterstützen, so würde der Erfolg der therapeutischen Bemühung hiedurch wohl gesichert.
Die Abgewöhnung der Masturbation ist nur eine der neuen therapeutischen Aufgaben, welche dem Arzte aus der Berücksichtigung der sexuellen Ätiologie erwachsen, und diese Aufgabe gerade scheint wie jede andere Abgewöhnung nur in einer Krankenanstalt und unter beständiger Aufsicht des Arztes lösbar. Sich selbst überlassen, pflegt der Masturbant bei jeder verstimmenden Einwirkung auf die ihm bequeme Befriedigung zurückzugreifen. Die ärztliche Behandlung kann sich hier kein anderes Ziel stecken, als den wieder gekräftigten Neurastheniker dem normalen Geschlechtsverkehre zuzuführen, denn das einmal geweckte und durch eine geraume Zeit befriedigte Sexualbedürfnis läßt sich nicht mehr zum Schweigen bringen, sondern bloß auf einen anderen Weg verschieben. Eine ganz analoge Bemerkung gilt übrigens auch für alle anderen Abstinenzkuren, die so lange nur scheinbar gelingen werden, solange sich der Arzt damit begnügt, dem Kranken das narkotische Mittel zu entziehen, ohne sich um die Quelle zu kümmern, aus welcher das imperative Bedürfnis nach einem solchen entspringt. »Gewöhnung« ist eine bloße Redensart ohne aufklärenden Wert; nicht jedermann, der eine Zeitlang Morphium, Kokain, Chloralhydrat u. dgl. zu nehmen Gelegenheit hat, erwirbt hiedurch die »Sucht« nach diesen Dingen. Genauere Untersuchung weist in der Regel nach, daß diese Narkotika zum Ersatze –; direkt oder auf Umwegen –; des mangelnden Sexualgenusses bestimmt sind, und wo sich normales Sexualleben nicht mehr herstellen läßt, da darf man den Rückfall des Entwöhnten mit Sicherheit erwarten.
Die andere Aufgabe wird dem Arzte durch die Ätiologie der Angstneurose gestellt und besteht darin, den Kranken zum Verlassen aller schädlichen Arten des Sexualverkehrs und zur Aufnahme normaler sexueller Beziehungen zu veranlassen. Wie begreiflich, fällt diese Pflicht vor allem dem ärztlichen Vertrauensmanne des Kranken, dem Hausarzte, zu, der seine Klienten schwer schädigt, wenn er sich zu vornehm hält, um in diese Sphäre einzugreifen.
Da es sich hiebei zumeist um Ehepaare handelt, stößt das Bemühen des Arztes alsbald mit den malthusianischen Tendenzen, die Anzahl der Konzeptionen in der Ehe einzuschränken, zusammen. Es scheint mir unzweifelhaft, daß diese Vorsätze in unserem Mittelstande immer mehr an Ausbreitung gewinnen; ich bin Ehepaaren begegnet, die schon nach dem ersten Kinde die Verhütung der Konzeption durchzuführen begannen, und anderen, deren sexueller Verkehr von der Hochzeitsnacht an diesem Vorsatze Rechnung tragen wollte. Das Problem des Malthusianismus ist weitläufig und kompliziert; ich habe nicht die Absicht, es hier erschöpfend zu behandeln, wie es für die Therapie der Neurosen eigentlich erforderlich wäre. Ich gedenke nur zu erörtern, welche Stellung der Arzt, der die sexuelle Ätiologie der Neurosen anerkennt, zu diesem Problem am besten einnehmen kann.
Das Verkehrteste ist es offenbar, wenn er dasselbe –; unter welchen Vorwänden immer –; ignorieren will. Was notwendig ist, kann nicht unter meiner ärztlichen Würde sein, und es ist notwendig, einem Ehepaare, das an die Einschränkung der Kinderzeugung denkt, mit ärztlichem Rate beizustehen, wenn man nicht einen Teil oder beide der Neurose aussetzen will. Es läßt sich nicht bestreiten, daß malthusianische Vorkehrungen irgend einmal in einer Ehe zur Notwendigkeit werden, und theoretisch wäre es einer der größten Triumphe der Menschheit, eine der fühlbarsten Befreiungen vom Naturzwange, dem unser Geschlecht unterworfen ist, wenn es gelänge, den verantwortlichen Akt der Kinderzeugung zu einer willkürlichen und beabsichtigten Handlung zu erheben und ihn von der Verquickung mit der notwendigen Befriedigung eines natürlichen Bedürfnisses loszulösen.
Der einsichtsvolle Arzt wird es also auf sich nehmen zu entscheiden, unter welchen Verhältnissen die Anwendung von Maßregeln zur Verhütung der Konzeption gerechtfertigt ist, und wird die schädlichen unter diesen Hilfsmitteln von den harmlosen zu sondern haben. Schädlich ist alles, was das Zustandekommen der Befriedigung hindert; bekanntlich besitzen wir aber derzeit kein Schutzmittel gegen die Konzeption, welches allen berechtigten Anforderungen genügen würde, d. h. sicher, bequem ist, der Lustempfindung beim Koitus nicht Eintrag tut und das Feingefühl der Frau nicht verletzt. Hier ist den Ärzten eine praktische Aufgabe gestellt, an deren Lösung sie ihre Kräfte dankbringend setzen können. Wer jene Lücke in unserer ärztlichen Technik ausfüllt, der hat Unzähligen den Lebensgenuß erhalten und die Gesundheit bewahrt, freilich dabei auch eine tief einschneidende Veränderung in unseren gesellschaftlichen Zuständen angebahnt.
Hiemit sind die Anregungen nicht erschöpft, die aus der Erkenntnis einer sexuellen Ätiologie der Neurosen fließen. Die Hauptleistung, die uns zugunsten der Neurastheniker möglich ist, fällt in die Prophylaxis. Wenn die Masturbation die Ursache der Neurasthenie in der Jugend ist und späterhin durch die von ihr geschaffene Verminderung der Potenz auch zu ätiologischer Bedeutung für die Angstneurose gelangt, so ist die Verhütung der Masturbation bei beiden Geschlechtern eine Aufgabe, die mehr Beachtung verdient, als sie bis jetzt gefunden hat. Überdenkt man alle die feineren und gröberen Schädigungen, die von der angeblich immer mehr um sich greifenden Neurasthenie ausgehen, so erkennt man geradezu ein Volksinteresse darin, daß die Männer mit voller Potenz in den Sexualverkehr eintreten. In Sachen der Prophylaxis aber ist der einzelne ziemlich ohnmächtig. Die Gesamtheit muß ein Interesse an dem Gegenstande gewinnen und ihre Zustimmung zur Schöpfung von gemeingültigen Einrichtungen geben. Vorläufig sind wir von einem solchen Zustande, der Abhilfe versprechen würde, noch weit entfernt, und darum kann man mit Recht auch unsere Zivilisation für die Verbreitung der Neurasthenie verantwortlich machen. Es müßte sich vieles ändern. Der Widerstand einer Generation von Ärzten muß gebrochen werden, die sich nicht mehr an ihre eigene Jugend erinnern können; der Hochmut der Väter ist zu überwinden, die vor ihren Kindern nicht gerne auf das Niveau der Menschlichkeit herabsteigen wollen, die unverständige Verschämtheit der Mütter ist zu bekämpfen, denen es jetzt regelmäßig als unerforschliche, aber unverdiente Schicksalsfügung erscheint, daß »gerade ihre Kinder nervös geworden sind«. Vor allem aber muß in der öffentlichen Meinung Raum geschaffen werden für die Diskussion der Probleme des Sexuallebens; man muß von diesen reden können, ohne für einen Ruhestörer oder für einen Spekulanten auf niedrige Instinkte erklärt zu werden. Und somit verbliebe auch hier genügend Arbeit für ein nächstes Jahrhundert, in dem unsere Zivilisation es verstehen soll, sich mit den Ansprüchen unserer Sexualität zu vertragen!
Der Wert einer richtigen diagnostischen Scheidung der Psychoneurosen von der Neurasthenie bezeigt sich auch darin, daß die ersteren eine andere praktische Würdigung und besondere therapeutische Maßnahmen erfordern. Die Psychoneurosen treten unter zweierlei Bedingungen auf, entweder selbständig oder im Gefolge der Aktualneurosen (Neurasthenie und Angstneurose). Im letzteren Falle hat man es mit einem neuen, übrigens sehr häufigen Typus von gemischten Neurosen zu tun. Die Ätiologie der Aktualneurose ist zur Hilfsätiologie der Psychoneurose geworden; es ergibt sich ein Krankheitsbild, in dem etwa die Angstneurose vorherrscht, das aber sonst Züge der echten Neurasthenie, der Hysterie und der Zwangsneurose enthält. Man tut nicht gut, angesichts einer solchen Vermengung etwa auf eine Sonderung der einzelnen neurotischen Krankheitsbilder zu verzichten, da es doch nicht schwer ist, sich den Fall in folgender Weise zurechtzulegen: Wie die vorwiegende Ausbildung der Angstneurose beweist, ist hier die Erkrankung unter dem ätiologischen Einfluß einer aktuellen sexuellen Schädlichkeit entstanden. Das betreffende Individuum war aber außerdem zu einer oder mehreren Psychoneurosen durch eine besondere Ätiologie disponiert und wäre irgend einmal spontan oder bei Hinzutritt eines andern schwächenden Moments an Psychoneurose erkrankt. Nun ist die noch fehlende Hilfsätiologie für die Psychoneurose durch die aktuelle Ätiologie der Angstneurose hinzugefügt worden.
Für solche Fälle hat sich mit Recht die therapeutische Übung eingebürgert, von der psychoneurotischen Komponente im Krankheitsbilde abzusehen und ausschließlich die Aktualneurose zu behandeln. Es gelingt in sehr vielen Fällen, auch der mitgerissenen Neurose Herr zu werden, wenn man der Neurasthenie zweckmäßig entgegentritt. Eine andere Beurteilung erfordern aber jene Fälle von Psychoneurose, die, sei es spontan auftreten oder nach dem Ablaufe einer aus Neurasthenie und Psychoneurose gemengten Erkrankung als selbständig übrigbleiben. Wenn ich von »spontanem« Auftreten einer Psychoneurose gesprochen habe, so meine ich damit nicht etwa, daß man bei anamnestischer Nachforschung jedes ätiologische Moment vermißt. Dies kann wohl der Fall sein, man kann aber auch auf ein indifferentes Moment, eine Gemütsbewegung, Schwächung durch somatische Erkrankung u. dgl., hingewiesen werden. Doch muß man für alle diese Fälle festhalten, daß die eigentliche Ätiologie der Psychoneurosen nicht in diesen Veranlassungen liegt, sondern der gewöhnlichen Weise anamnestischer Erhebung unfaßbar bleibt.
Wie bekannt, ist es diese Lücke, welche man versucht hat, durch die Annahme einer besonderen neuropathischen Disposition auszufüllen, deren Existenz einer Therapie solcher Krankheitszustände freilich nicht viel Aussicht auf Erfolg übrigließe. Die neuropathische Disposition selbst wird als Zeichen einer allgemeinen Degeneration aufgefaßt, und somit gelangt dieses bequeme Kunstwort zu einer überreichlichen Verwendung gegen die armen Kranken, denen zu helfen die Ärzte recht ohnmächtig sind. Zum Glück steht es anders. Die neuropathische Disposition existiert wohl, aber ich muß bestreiten, daß sie zur Erzeugung der Psychoneurose hinreicht. Ich muß ferner bestreiten, daß das Zusammentreffen von neuropathischer Disposition und veranlassenden Ursachen des späteren Lebens eine ausreichende Ätiologie der Psychoneurosen darstellt. Man ist in der Zurückführung der Krankheitsschicksale des einzelnen auf die Erlebnisse seiner Ahnen zu weit gegangen und hat daran vergessen, daß zwischen der Empfängnis und der Reife des Individuums ein langer und bedeutsamer Lebensabschnitt liegt, die Kindheit, in welcher die Keime zu späterer Erkrankung erworben werden können. So ist es tatsächlich bei der Psychoneurose. Ihre wirkliche Ätiologie ist zu finden in Erlebnissen der Kindheit, und zwar wiederum –; und ausschließlich –; in Eindrücken, die das sexuelle Leben betreffen. Man tut unrecht daran, das Sexualleben der Kinder völlig zu vernachlässigen; sie sind, soviel ich erfahren habe, aller psychischen und vieler somatischen Sexualleistungen fähig. Sowenig die äußeren Genitalien und die beiden Keimdrüsen den ganzen Geschlechtsapparat des Menschen darstellen, ebensowenig beginnt sein Geschlechtsleben erst mit der Pubertät, wie es der groben Beobachtung erscheinen mag. Es ist aber richtig, daß die Organisation und Entwicklung der Spezies Mensch eine ausgiebigere sexuelle Betätigung im Kindesalter zu vermeiden strebt; es scheint, daß die sexuellen Triebkräfte beim Menschen aufgespeichert werden sollen, um dann bei ihrer Entfesselung zur Zeit der Pubertät großen kulturellen Zwecken zu dienen. (Wilh. Fließ.) Aus einem derartigen Zusammenhange läßt sich etwa verstehen, warum sexuelle Erlebnisse des Kindesalters pathogen wirken müssen. Sie entfalten ihre Wirkung aber nur zum geringsten Maße zur Zeit, da sie vorfallen; weit bedeutsamer ist ihre nachträgliche Wirkung, die erst in späteren Perioden der Reifung eintreten kann. Diese nachträgliche Wirkung geht, wie nicht anders möglich, von den psychischen Spuren aus, welche die infantilen Sexualerlebnisse zurückgelassen haben. In dem Intervall zwischen dem Erleben dieser Eindrücke und deren Reproduktion (vielmehr dem Erstarken der von ihnen ausgehenden libidinösen Impulse) hat nicht nur der somatische Sexualapparat, sondern auch der psychische Apparat eine bedeutsame Ausgestaltung erfahren, und darum erfolgt auf die Einwirkung jener früheren sexuellen Erlebnisse nun eine abnorme psychische Reaktion, es entstehen psychopathologische Bildungen.
In diesen Andeutungen konnte ich nur die Hauptmomente anführen, auf welche sich die Theorie der Psychoneurosen stützt: die Nachträglichkeit, den infantilen Zustand des Geschlechtsapparates und des Seeleninstrumentes. Um ein wirkliches Verständnis des Entstehungsmechanismus der Psychoneurosen zu erzielen, brauchte es breiterer Ausführungen; vor allem wäre es unvermeidlich, gewisse Annahmen über die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des psychischen Apparates, die mir neu scheinen, als glaubwürdig hinzustellen. In einem Buche über »Traumdeutung«, das ich gegenwärtig vorbereite, werde ich die Gelegenheit finden, jene Fundamente einer Neurosenpsychologie zu berühren. Der Traum gehört nämlich in dieselbe Reihe psychopathologischer Bildungen wie die hysterische fixe Idee, die Zwangsvorstellung und die Wahnidee.
Da die Erscheinungen der Psychoneurosen vermittels der Nachträglichkeit von unbewußten psychischen Spuren aus entstehen, werden sie der Psychotherapie zugänglich, die allerdings hier andere Wege einschlagen muß als den bis jetzt einzig begangenen der Suggestion mit oder ohne Hypnose. Auf der von J. Breuer angegebenen »kathartischen« Methode fußend, habe ich in den letzten Jahren ein therapeutisches Verfahren nahezu ausgearbeitet, welches ich das » psychoanalytische« heißen will und dem ich zahlreiche Erfolge verdanke, während ich hoffen darf, seine Wirksamkeit noch erheblich zu steigern. In den 1895 veröffentlichten Studien über Hysterie (mit J. Breuer) sind die ersten Mitteilungen über Technik und Tragweite der Methode gegeben worden. Seither hat sich manches, wie ich behaupten darf, zum Besseren daran geändert. Während wir damals bescheiden aussagten, daß wir nur die Beseitigung von hysterischen Symptomen, nicht die Heilung der Hysterie selbst in Angriff nehmen könnten, hat sich mir seither diese Unterscheidung als inhaltslos herausgestellt, also die Aussicht auf wirkliche Heilung der Hysterie und Zwangsvorstellungen ergeben. Es hat mich darum recht lebhaft interessiert, in den Publikationen von Fachgenossen zu lesen: In diesem Falle habe das sinnreiche, von Breuer und Freud ersonnene Verfahren versagt, oder: Die Methode habe nicht gehalten, was sie zu versprechen schien. Ich hatte dabei etwa die Empfindungen eines Menschen, der in der Zeitung seine Todesanzeige findet, sich aber dabei in seinem Besserwissen beruhigt fühlen darf. Das Verfahren ist nämlich so schwierig, daß es durchaus erlernt werden muß; und ich kann mich nicht besinnen, daß es einer meiner Kritiker von mir hätte erlernen wollen, glaube auch nicht, daß sie sich, ähnlich wie ich, genug intensiv damit beschäftigt haben, um es selbständig auffinden zu können. Die Bemerkungen in den Studien über Hysterie sind vollkommen unzureichend, um einem Leser die Beherrschung dieser Technik zu ermöglichen, streben solche vollständige Unterweisung auch keineswegs an.
Die psychoanalytische Therapie ist derzeit nicht allgemein anwendbar; ich kenne für sie folgende Einschränkungen: Sie erfordert ein gewisses Maß von Reife und Einsicht beim Kranken, taugt daher nicht für kindliche Personen oder für erwachsene Schwachsinnige und Ungebildete. Sie scheitert bei allzu betagten Personen daran, daß sie bei ihnen, dem angehäuften Material entsprechend, allzuviel Zeit in Anspruch nehmen würde, so daß man bis zur Beendigung der Kur in einen Lebensabschnitt geraten würde, für welchen auf nervöse Gesundheit nicht mehr Wert gelegt wird. Endlich ist sie nur dann möglich, wenn der Kranke einen psychischen Normalzustand hat, von dem aus sich das pathologische Material bewältigen läßt. Während einer hysterischen Verworrenheit, einer eingeschalteten Manie oder Melancholie ist mit den Mitteln der Psychoanalyse nichts zu leisten. Man kann solche Fälle dem Verfahren noch unterziehen, nachdem man mit den gewöhnlichen Maßregeln die Beruhigung der stürmischen Erscheinungen herbeigeführt hat. In der Praxis werden überhaupt die chronischen Fälle von Psychoneurosen besser der Methode standhalten als die Fälle von akuten Krisen, bei denen das Hauptgewicht naturgemäß auf die Raschheit der Erledigung fällt. Daher geben auch die hysterischen Phobien und die verschiedenen Formen der Zwangsneurose das günstigste Arbeitsgebiet für diese neue Therapie.
Daß die Methode in diese Schranken gebannt ist, erklärt sich zum guten Teil aus den Verhältnissen, unter denen ich sie ausarbeiten mußte. Mein Material sind eben chronisch Nervöse der gebildeteren Stände. Ich halte es für sehr wohl möglich, daß sich ergänzende Verfahren für kindliche Personen und für das Publikum, welches in den Spitälern Hilfe sucht, ausbilden lassen. Ich muß auch anführen, daß ich meine Therapie bisher ausschließlich an schweren Fällen von Hysterie und Zwangsneurose erprobt habe; wie es sich bei jenen leichten Erkrankungsfällen gestalten würde, die man bei einer indifferenten Behandlung von wenigen Monaten in wenigstens scheinbare Genesung ausgehen sieht, weiß ich nicht anzugeben. Wie begreiflich, durfte eine neue Therapie, die vielfache Opfer erfordert, nur auf solche Kranke rechnen, die bereits die anerkannten Heilmethoden ohne Erfolg versucht hatten oder deren Zustände den Schluß berechtigten, sie hätten von diesen angeblich bequemeren und kürzeren Heilverfahren nichts zu erwarten. So mußte ich mit einem unvollkommenen Instrumente sogleich die schwersten Aufgaben in Angriff nehmen; die Probe ist um so beweiskräftiger ausgefallen.
Die wesentlichen Schwierigkeiten, die sich jetzt noch der psychoanalytischen Heilmethode entgegensetzen, liegen nicht an ihr selbst, sondern in dem Mangel an Verständnis für das Wesen der Psychoneurosen bei Ärzten und Laien. Es ist nur das notwendige Korrelat zu dieser vollen Unwissenheit, wenn sich die Ärzte für berechtigt halten, den Kranken durch die unzutreffendsten Versicherungen zu trösten oder zu therapeutischen Maßnahmen zu veranlassen. »Kommen Sie für sechs Wochen in meine Anstalt, und Sie werden Ihre Symptome (Reiseangst, Zwangsvorstellungen usw.) verloren haben.« Tatsächlich ist die Anstalt unentbehrlich für die Beruhigung akuter Zufälle im Verlaufe einer Psychoneurose durch Ablenkung, Pflege und Schonung; zur Beseitigung chronischer Zustände leistet sie –; nichts, und zwar die vornehmen, angeblich wissenschaftlich geleiteten Sanatorien ebensowenig wie die gemeinen Wasserheilanstalten.
Es wäre würdiger und dem Kranken, der sich doch schließlich mit seinen Beschwerden abfinden muß, zuträglicher, wenn der Arzt die Wahrheit sprechen würde, wie er sie alle Tage kennenlernt: Die Psychoneurosen sind als Genus keineswegs leichte Erkrankungen. Wenn eine Hysterie anfängt, kann niemand vorher wissen, wann sie ein Ende nehmen wird. Man tröstet sich meist vergeblich mit der Prophezeiung: Eines Tages wird sie plötzlich vorüber sein. Die Heilung erweist sich häufig genug als ein bloßes Übereinkommen zur gegenseitigen Duldung zwischen dem Gesunden und dem Kranken im Patienten oder erfolgt auf dem Wege der Umwandlung eines Symptoms in eine Phobie. Die mühsam beschwichtigte Hysterie des Mädchens lebt nach kurzer Unterbrechung durch das junge Eheglück in der Hysterie der Ehefrau wieder auf, nur daß jetzt eine andere Person als früher, der Ehemann, durch sein Interesse veranlaßt wird, über den Erkrankungsfall zu schweigen. Wo es nicht zu manifester Existenzunfähigkeit infolge von Krankheit kommt, da fehlt doch fast nie die Einbuße an aller freien Entfaltung der Seelenkräfte. Zwangsvorstellungen kehren das ganze Leben hindurch wieder; Phobien und andere Willenseinschränkungen sind für jede Therapie bisher unbeeinflußbar gewesen. Das alles wird dem Laien vorenthalten, und darum ist der Vater einer hysterischen Tochter entsetzt, wenn er z. B. einer einjährigen Behandlung seines Kindes zustimmen soll, wo doch die Krankheit etwa erst einige Monate gedauert hat. Der Laie ist sozusagen von der Überflüssigkeit all dieser Psychoneurosen tief innerlich überzeugt, er bringt darum dem Krankheitsverlaufe keine Geduld und der Therapie keine Opferbereitschaft entgegen. Wenn er sich angesichts eines Typhus, der drei Wochen anhält, eines Beinbruches, der zur Heilung sechs Monate beansprucht, verständiger benimmt, wenn ihm die Fortsetzung orthopädischer Maßnahmen durch mehrere Jahre einsichtlich erscheint, sobald sich die ersten Spuren einer Rückgratsverkrümmung bei seinem Kinde zeigen, so rührt dieser Unterschied von dem besseren Verständnis der Ärzte her, die ihr Wissen in ehrlicher Mitteilung dem Laien übertragen. Die Aufrichtigkeit der Ärzte und die Gefügigkeit der Laien wird sich auch für die Psychoneurosen herstellen, wenn erst die Einsicht in das Wesen dieser Affektionen ärztliches Gemeingut geworden ist. Die psychotherapeutische Radikalbehandlung derselben wird wohl immer eine besondere Schulung erfordern und mit der Ausübung anderer ärztlicher Tätigkeit unverträglich sein. Dafür winkt dieser, in der Zukunft wohl zahlreichen Klasse von Ärzten Gelegenheit zu rühmlichen Leistungen und einer befriedigenden Einsicht in das Seelenleben der Menschen.
Die Verdrängung (1915)
Es kann das Schicksal einer Triebregung werden, daß sie auf Widerstände stößt, welche sie unwirksam machen wollen. Unter Bedingungen, deren nähere Untersuchung uns bevorsteht, gelangt sie dann in den Zustand der Verdrängung. Handelte es sich um die Wirkung eines äußeren Reizes, so wäre offenbar die Flucht das geeignete Mittel. Im Falle des Triebes kann die Flucht nichts nützen, denn das Ich kann sich nicht selbst entfliehen. Später einmal wird in der Urteilsverwerfung ( Verurteilung) ein gutes Mittel gegen die Triebregung gefunden werden. Eine Vorstufe der Verurteilung, ein Mittelding zwischen Flucht und Verurteilung ist die Verdrängung, deren Begriff in der Zeit vor den psychoanalytischen Studien nicht aufgestellt werden konnte.
Die Möglichkeit einer Verdrängung ist theoretisch nicht leicht abzuleiten. Warum sollte eine Triebregung einem solchen Schicksal verfallen? Offenbar muß hier die Bedingung erfüllt sein, daß die Erreichung des Triebzieles Unlust an Stelle von Lust bereitet. Aber dieser Fall ist nicht gut denkbar. Solche Triebe gibt es nicht, eine Triebbefriedigung ist immer lustvoll. Es müßten besondere Verhältnisse anzunehmen sein, irgendein Vorgang, durch den die Befriedigungslust in Unlust verwandelt wird.
Wir können zur besseren Abgrenzung der Verdrängung einige andere Triebsituationen in Erörterung ziehen. Es kann vorkommen, daß sich ein äußerer Reiz, z. B. dadurch, daß er ein Organ anätzt und zerstört, verinnerlicht und so eine neue Quelle beständiger Erregung und Spannungsvermehrung ergibt. Er erwirbt damit eine weitgehende Ähnlichkeit mit einem Trieb. Wir wissen, daß wir diesen Fall als Schmerz empfinden. Das Ziel dieses Pseudotriebes ist aber nur das Aufhören der Organveränderung und der mit ihr verbundenen Unlust. Andere, direkte Lust kann aus dem Aufhören des Schmerzes nicht gewonnen werden. Der Schmerz ist auch imperativ; er unterliegt nur noch der Einwirkung einer toxischen Aufhebung und der Beeinflussung durch psychische Ablenkung.
Der Fall des Schmerzes ist zu wenig durchsichtig, um etwas für unsere Absicht zu leisten. Nehmen wir den Fall, daß ein Triebreiz wie der Hunger unbefriedigt bleibt. Er wird dann imperativ, ist durch nichts anderes als durch die Befriedigungsaktion zu beschwichtigen, unterhält eine beständige Bedürfnisspannung. Etwas wie eine Verdrängung scheint hier auf lange hinaus nicht in Betracht zu kommen.
Der Fall der Verdrängung ist also gewiß nicht gegeben, wenn die Spannung infolge von Unbefriedigung einer Triebregung unerträglich groß wird. Was dem Organismus an Abwehrmitteln gegen diese Situation gegeben ist, muß in anderem Zusammenhang erörtert werden.
Halten wir uns lieber an die klinische Erfahrung, wie sie uns in der psychoanalytischen Praxis entgegentritt. Dann werden wir belehrt, daß die Befriedigung des der Verdrängung unterliegenden Triebes wohl möglich und daß sie auch jedesmal an sich lustvoll wäre, aber sie wäre mit anderen Ansprüchen und Vorsätzen unvereinbar; sie würde also Lust an der einen, Unlust an anderer Stelle erzeugen. Zur Bedingung der Verdrängung ist dann geworden, daß das Unlustmotiv eine stärkere Macht gewinnt als die Befriedigungslust. Wir werden ferner durch die psychoanalytische Erfahrung an den Übertragungsneurosen zu dem Schluß genötigt, daß die Verdrängung kein ursprünglich vorhandener Abwehrmechanismus ist, daß sie nicht eher entstehen kann, als bis sich eine scharfe Sonderung von bewußter und unbewußter Seelentätigkeit hergestellt hat, und daß ihr Wesen nur in der Abweisung und Fernhaltung vom Bewußten besteht. Diese Auffassung der Verdrängung würde durch die Annahme ergänzt werden, daß vor solcher Stufe der seelischen Organisation die anderen Triebschicksale, wie die Verwandlung ins Gegenteil, die Wendung gegen die eigene Person, die Aufgabe der Abwehr von Triebregungen bewältigen.
Wir meinen jetzt auch, Verdrängung und Unbewußtes seien in so großem Ausmaße korrelativ, daß wir die Vertiefung in das Wesen der Verdrängung aufschieben müssen, bis wir mehr von dem Aufbau des psychischen Instanzenzuges und der Differenzierung von Unbewußt und Bewußt erfahren haben. Vorher können wir nur noch einige klinisch erkannte Charaktere der Verdrängung in rein deskriptiver Weise zusammenstellen, auf die Gefahr hin, vieles anderwärts Gesagte ungeändert zu wiederholen.
Wir haben also Grund, eine Urverdrängung anzunehmen, eine erste Phase der Verdrängung, die darin besteht, daß der psychischen (Vorstellungs-)Repräsentanz des Triebes die Übernahme ins Bewußte versagt wird. Mit dieser ist eine Fixierung gegeben; die betreffende Repräsentanz bleibt von da an unveränderlich bestehen und der Trieb an sie gebunden. Dies geschieht infolge der später zu besprechenden Eigenschaften unbewußter Vorgänge.
Die zweite Stufe der Verdrängung, die eigentliche Verdrängung, betrifft psychische Abkömmlinge der verdrängten Repräsentanz oder solche Gedankenzüge, die, anderswoher stammend, in assoziative Beziehung zu ihr geraten sind. Wegen dieser Beziehung erfahren diese Vorstellungen dasselbe Schicksal wie das Urverdrängte. Die eigentliche Verdrängung ist also ein Nachdrängen. Man tut übrigens unrecht, wenn man nur die Abstoßung hervorhebt, die vom Bewußten her auf das zu Verdrängende wirkt. Es kommt ebensosehr die Anziehung in Betracht, welche das Urverdrängte auf alles ausübt, womit es sich in Verbindung setzen kann. Wahrscheinlich würde die Verdrängungstendenz ihre Absicht nicht erreichen, wenn diese Kräfte nicht zusammenwirkten, wenn es nicht ein vorher Verdrängtes gäbe, welches das vom Bewußten Abgestoßene aufzunehmen bereit wäre.
Unter dem Einfluß des Studiums der Psychoneurosen, welches uns die bedeutsamen Wirkungen der Verdrängung vorführt, werden wir geneigt, deren psychologischen Inhalt zu überschätzen, und vergessen zu leicht, daß die Verdrängung die Triebrepräsentanz nicht daran hindert, im Unbewußten fortzubestehen, sich weiter zu organisieren, Abkömmlinge zu bilden und Verbindungen anzuknüpfen. Die Verdrängung stört wirklich nur die Beziehung zu einem psychischen System, dem des Bewußten.
Die Psychoanalyse kann uns noch anderes zeigen, was für das Verständnis der Wirkungen der Verdrängung bei den Psychoneurosen bedeutsam ist. Z. B., daß die Triebrepräsentanz sich ungestörter und reichhaltiger entwickelt, wenn sie durch die Verdrängung dem bewußten Einfluß entzogen ist. Sie wuchert dann sozusagen im Dunkeln und findet extreme Ausdrucksformen, welche, wenn sie dem Neurotiker übersetzt und vorgehalten werden, ihm nicht nur fremd erscheinen müssen, sondern ihn auch durch die Vorspiegelung einer außerordentlichen und gefährlichen Triebstärke schrecken. Diese täuschende Triebstärke ist das Ergebnis einer ungehemmten Entfaltung in der Phantasie und der Aufstauung infolge versagter Befriedigung. Daß dieser letztere Erfolg an die Verdrängung geknüpft ist, weist darauf hin, worin wir ihre eigentliche Bedeutung zu suchen haben.
Indem wir aber noch zur Gegenansicht zurückkehren, stellen wir fest, es sei nicht einmal richtig, daß die Verdrängung alle Abkömmlinge des Urverdrängten vom Bewußten abhalte. Wenn sich diese weit genug von der verdrängten Repräsentanz entfernt haben, sei es durch Annahme von Entstellungen oder durch die Anzahl der eingeschobenen Mittelglieder, so steht ihnen der Zugang zum Bewußten ohne weiteres frei. Es ist, als ob der Widerstand des Bewußten gegen sie eine Funktion ihrer Entfernung vom ursprünglich Verdrängten wäre. Während der Ausübung der psychoanalytischen Technik fordern wir den Patienten unausgesetzt dazu auf, solche Abkömmlinge des Verdrängten zu produzieren, die infolge ihrer Entfernung oder Entstellung die Zensur des Bewußten passieren können. Nichts anderes sind ja die Einfälle, die wir unter Verzicht auf alle bewußten Zielvorstellungen und alle Kritik von ihm verlangen und aus denen wir eine bewußte Übersetzung der verdrängten Repräsentanz wiederherstellen. Wir beobachten dabei, daß der Patient eine solche Einfallsreihe fortspinnen kann, bis er in ihrem Ablauf auf eine Gedankenbildung stößt, bei welcher die Beziehung zum Verdrängten so intensiv durchwirkt, daß er seinen Verdrängungsversuch wiederholen muß. Auch die neurotischen Symptome müssen der obigen Bedingung genügt haben, denn sie sind Abkömmlinge des Verdrängten, welches sich mittels dieser Bildungen den ihm versagten Zugang zum Bewußtsein endlich erkämpft hat.
Wie weit die Entstellung und Entfernung vom Verdrängten gehen muß, bis der Widerstand des Bewußten aufgehoben ist, läßt sich allgemein nicht angeben. Es findet dabei eine feine Abwägung statt, deren Spiel uns verdeckt ist, deren Wirkungsweise uns aber erraten läßt, es handle sich darum, vor einer bestimmten Intensität der Besetzung des Unbewußten haltzumachen, mit deren Überschreitung es zur Befriedigung durchdringen würde. Die Verdrängung arbeitet also höchst individuell; jeder einzelne Abkömmling des Verdrängten kann sein besonderes Schicksal haben; ein wenig mehr oder weniger von Entstellung macht, daß der ganze Erfolg umschlägt. In demselben Zusammenhang ist auch zu begreifen, daß die bevorzugten Objekte der Menschen, ihre Ideale, aus denselben Wahrnehmungen und Erlebnissen stammen wie die von ihnen am meisten verabscheuten, und sich ursprünglich nur durch geringe Modifikationen voneinander unterscheiden. Ja, es kann, wie wir's bei der Entstehung des Fetisch gefunden haben, die ursprüngliche Triebrepräsentanz in zwei Stücke zerlegt worden sein, von denen das eine der Verdrängung verfiel, während der Rest, gerade wegen dieser innigen Verknüpftheit, das Schicksal der Idealisierung erfuhr.
Dasselbe, was ein Mehr oder Weniger an Entstellung leistet, kann auch sozusagen am anderen Ende des Apparates durch eine Modifikation in den Bedingungen der Lust-Unlustproduktion erzielt werden. Es sind besondere Techniken ausgebildet worden, deren Absicht dahin geht, solche Veränderungen des psychischen Kräftespieles herbeizuführen, daß dasselbe, was sonst Unlust erzeugt, auch einmal lustbringend wird, und sooft solch ein technisches Mittel in Aktion tritt, wird die Verdrängung für eine sonst abgewiesene Triebrepräsentanz aufgehoben. Diese Techniken sind bisher nur für den Witz genauer verfolgt worden. In der Regel ist die Aufhebung der Verdrängung nur eine vorübergehende; sie wird alsbald wiederhergestellt.
Erfahrungen dieser Art reichen aber hin, uns auf weitere Charaktere der Verdrängung aufmerksam zu machen. Sie ist nicht nur, wie eben ausgeführt, individuell, sondern auch im hohen Grade mobil. Man darf sich den Verdrängungsvorgang nicht wie ein einmaliges Geschehen mit Dauererfolg vorstellen, etwa wie wenn man etwas Lebendes erschlagen hat, was von da an tot ist; sondern die Verdrängung erfordert einen anhaltenden Kraftaufwand, mit dessen Unterlassung ihr Erfolg in Frage gestellt wäre, so daß ein neuerlicher Verdrängungsakt notwendig würde. Wir dürfen uns vorstellen, daß das Verdrängte einen kontinuierlichen Druck in der Richtung zum Bewußten hin ausübt, dem durch unausgesetzten Gegendruck das Gleichgewicht gehalten werden muß. Die Erhaltung einer Verdrängung setzt also eine beständige Kraftausgabe voraus, und ihre Aufhebung bedeutet ökonomisch eine Ersparung. Die Mobilität der Verdrängung findet übrigens auch einen Ausdruck in den psychischen Charakteren des Schlafzustandes, welcher allein die Traumbildung ermöglicht. Mit dem Erwachen werden die eingezogenen Verdrängungsbesetzungen wieder ausgeschickt.
Wir dürfen endlich nicht vergessen, daß wir von einer Triebregung erst sehr wenig ausgesagt haben, wenn wir feststellen, sie sei eine verdrängte. Sie kann sich unbeschadet der Verdrängung in sehr verschiedenen Zuständen befinden, inaktiv sein, d. h. sehr wenig mit psychischer Energie besetzt, oder in wechselndem Grade besetzt und damit zur Aktivität befähigt. Ihre Aktivierung wird zwar nicht die Folge haben, daß sie die Verdrängung direkt aufhebt, wohl aber alle die Vorgänge anregen, welche mit dem Durchdringen zum Bewußtsein auf Umwegen einen Abschluß finden. Bei unverdrängten Abkömmlingen des Unbewußten entscheidet oft das Ausmaß der Aktivierung oder Besetzung über das Schicksal der einzelnen Vorstellung. Es ist ein alltägliches Vorkommnis, daß ein solcher Abkömmling unverdrängt bleibt, solange er eine geringe Energie repräsentiert, obwohl sein Inhalt geeignet wäre, einen Konflikt mit dem bewußt Herrschenden zu ergeben. Das quantitative Moment zeigt sich aber als entscheidend für den Konflikt; sobald die im Grunde anstößige Vorstellung sich über ein gewisses Maß verstärkt, wird der Konflikt aktuell, und gerade die Aktivierung zieht die Verdrängung nach sich. Zunahme der Energiebesetzung wirkt also in Sachen der Verdrängung gleichsinnig wie Annäherung an das Unbewußte, Abnahme derselben wie Entfernung davon oder Entstellung. Wir verstehen, daß die verdrängenden Tendenzen in der Abschwächung des Unliebsamen einen Ersatz für dessen Verdrängung finden können.
In den bisherigen Erörterungen behandelten wir die Verdrängung einer Triebrepräsentanz und verstanden unter einer solchen eine Vorstellung oder Vorstellungsgruppe, welche vom Trieb her mit einem bestimmten Betrag von psychischer Energie (Libido, Interesse) besetzt ist. Die klinische Beobachtung nötigt uns nun zu zerlegen, was wir bisher einheitlich aufgefaßt hatten, denn sie zeigt uns, daß etwas anderes, was den Trieb repräsentiert, neben der Vorstellung in Betracht kommt und daß dieses andere ein Verdrängungsschicksal erfährt, welches von dem der Vorstellung ganz verschieden sein kann. Für dieses andere Element der psychischen Repräsentanz hat sich der Name Affektbetrag eingebürgert; es entspricht dem Triebe, insofern er sich von der Vorstellung abgelöst hat und einen seiner Quantität gemäßen Ausdruck in Vorgängen findet, welche als Affekte der Empfindung bemerkbar werden. Wir werden von nun an, wenn wir einen Fall von Verdrängung beschreiben, gesondert verfolgen müssen, was durch die Verdrängung aus der Vorstellung und was aus der an ihr haftenden Triebenergie geworden ist.
Gern würden wir über beiderlei Schicksale etwas Allgemeines aussagen wollen. Dies wird uns auch nach einiger Orientierung möglich. Das allgemeine Schicksal der den Trieb repräsentierenden Vorstellung kann nicht leicht etwas anderes sein, als daß sie aus dem Bewußten verschwindet, wenn sie früher bewußt war, oder vom Bewußtsein abgehalten wird, wenn sie im Begriffe war, bewußt zu werden. Der Unterschied ist nicht mehr bedeutsam; er kommt etwa darauf hinaus, ob ich einen unliebsamen Gast aus meinem Salon hinausbefördere oder aus meinem Vorzimmer oder ihn, nachdem ich ihn erkannt habe, überhaupt nicht über die Schwelle der Wohnungstür treten lasse [Fußnote]Dieses für den Verdrängungsvorgang brauchbare Gleichnis kann auch über einen früher erwähnten Charakter der Verdrängung ausgedehnt werden. Ich brauche nur hinzuzufügen, daß ich die dem Gast verbotene Tür durch einen ständigen Wächter bewachen lassen muß, weil der Abgewiesene sie sonst aufsprengen würde. (S. oben.). Das Schicksal des quantitativen Faktors der Triebrepräsentanz kann ein dreifaches sein, wie uns eine flüchtige Übersicht über die in der Psychoanalyse gemachten Erfahrungen lehrt: Der Trieb wird entweder ganz unterdrückt, so daß man nichts von ihm auffindet, oder er kommt als irgendwie qualitativ gefärbter Affekt zum Vorschein, oder er wird in Angst verwandelt. Die beiden letzteren Möglichkeiten stellen uns die Aufgabe, die Umsetzung der psychischen Energien der Triebe in Affekte und ganz besonders in Angst als neues Triebschicksal ins Auge zu fassen.
Wir erinnern uns, daß Motiv und Absicht der Verdrängung nichts anderes als die Vermeidung von Unlust war. Daraus folgt, daß das Schicksal des Affektbetrags der Repräsentanz bei weitem wichtiger ist als das der Vorstellung und daß dies über die Beurteilung des Verdrängungsvorganges entscheidet. Gelingt es einer Verdrängung nicht, die Entstehung von Unlustempfindungen oder Angst zu verhüten, so dürfen wir sagen, sie sei mißglückt, wenngleich sie ihr Ziel an dem Vorstellungsanteil erreicht haben mag. Natürlich wird die mißglückte Verdrängung mehr Anspruch auf unser Interesse erheben als die etwa geglückte, die sich zumeist unserem Studium entziehen wird.
Wir wollen nun Einblick in den Mechanismus des Verdrängungsvorganges gewinnen und vor allem wissen, ob es nur einen einzigen Mechanismus der Verdrängung gibt oder mehrere und ob vielleicht jede der Psychoneurosen durch einen ihr eigentümlichen Mechanismus der Verdrängung ausgezeichnet ist. Zu Beginn dieser Untersuchung stoßen wir aber auf Komplikationen. Der Mechanismus einer Verdrängung wird uns nur zugänglich, wenn wir aus den Erfolgen der Verdrängung auf ihn zurückschließen. Beschränken wir die Beobachtung auf die Erfolge an dem Vorstellungsanteil der Repräsentanz, so erfahren wir, daß die Verdrängung in der Regel eine Ersatzbildung schafft. Welches ist nun der Mechanismus einer solchen Ersatzbildung, oder gibt es hier auch mehrere Mechanismen zu unterscheiden? Wir wissen auch, daß die Verdrängung Symptome hinterläßt. Dürfen wir nun Ersatzbildung und Symptombildung zusammenfallen lassen, und wenn dies im ganzen angeht, deckt sich der Mechanismus der Symptombildung mit dem der Verdrängung? Die vorläufige Wahrscheinlichkeit scheint dafür zu sprechen, daß beide weit auseinandergehen, daß es nicht die Verdrängung selbst ist, welche Ersatzbildungen und Symptome schafft, sondern daß diese letzteren als Anzeichen einer Wiederkehr des Verdrängten ganz anderen Vorgängen ihr Entstehen verdanken. Es scheint sich auch zu empfehlen, daß man die Mechanismen der Ersatz- und Symptombildung vor denen der Verdrängung in Untersuchung ziehe.
Es ist klar, daß die Spekulation hier weiter nichts zu suchen hat, sondern durch die sorgfältige Analyse der bei den einzelnen Neurosen zu beobachtenden Erfolge der Verdrängung abgelöst werden muß. Ich muß aber den Vorschlag machen, auch diese Arbeit aufzuschieben, bis wir uns verläßliche Vorstellungen über das Verhältnis des Bewußten zum Unbewußten gebildet haben. Nur um die vorliegende Erörterung nicht ganz unfruchtbar ausgehen zu lassen, will ich vorwegnehmen, daß 1. der Mechanismus der Verdrängung tatsächlich nicht mit dem oder den Mechanismen der Ersatzbildung zusammenfällt, 2. daß es sehr verschiedene Mechanismen der Ersatzbildung gibt, und 3. daß den Mechanismen der Verdrängung wenigstens eines gemeinsam ist, die Entziehung der Energiebesetzung (oder Libido, wenn wir von Sexualtrieben handeln).
Ich will auch unter Einschränkung auf die drei bekanntesten Psychoneurosen an einigen Beispielen zeigen, wie die hier eingeführten Begriffe auf das Studium der Verdrängung Anwendung finden. Von der Angsthysterie werde ich das gut analysierte Beispiel einer Tierphobie wählen. Die der Verdrängung unterliegende Triebregung ist eine libidinöse Einstellung zum Vater, gepaart mit der Angst vor demselben. Nach der Verdrängung ist diese Regung aus dem Bewußtsein geschwunden, der Vater kommt als Objekt der Libido nicht darin vor. Als Ersatz findet sich an analoger Stelle ein Tier, das sich mehr oder weniger gut zum Angstobjekt eignet. Die Ersatzbildung des Vorstellungsanteiles hat sich auf dem Wege der Verschiebung längs eines in bestimmter Weise determinierten Zusammenhanges hergestellt. Der quantitative Anteil ist nicht verschwunden, sondern hat sich in Angst umgesetzt. Das Ergebnis ist eine Angst vor dem Wolf an Stelle eines Liebesanspruches an den Vater. Natürlich reichen die hier verwendeten Kategorien nicht aus, um den Erklärungsansprüchen auch nur des einfachsten Falles von Psychoneurose zu genügen. Es kommen immer noch andere Gesichtspunkte in Betracht.
Eine solche Verdrängung wie im Falle der Tierphobie darf als eine gründlich mißglückte bezeichnet werden. Das Werk der Verdrängung besteht nur in der Beseitigung und Ersetzung der Vorstellung, die Unlustersparnis ist überhaupt nicht gelungen. Deshalb ruht die Arbeit der Neurose auch nicht, sondern setzt sich in einem zweiten Tempo fort, um ihr nächstes, wichtigeres Ziel zu erreichen. Es kommt zur Bildung eines Fluchtversuches, der eigentlichen Phobie, einer Anzahl von Vermeidungen, welche die Angstentbindung ausschließen sollen. Durch welchen Mechanismus die Phobie ans Ziel gelangt, können wir in einer spezielleren Untersuchung verstehen lernen.
Zu einer ganz anderen Würdigung des Verdrängungsvorganges nötigt uns das Bild der echten Konversionshysterie. Hier ist das Hervorstechende, daß es gelingen kann, den Affektbetrag zum völligen Verschwinden zu bringen. Der Kranke zeigt dann gegen seine Symptome das Verhalten, welches Charcot » la belle indifférence des hystériques« genannt hat. Andere Male gelingt diese Unterdrückung nicht so vollständig, ein Anteil peinlicher Sensationen knüpft sich an die Symptome selbst, oder ein Stück Angstentbindung hat sich nicht vermeiden lassen, das seinerseits den Mechanismus der Phobiebildung ins Werk setzt. Der Vorstellungsinhalt der Triebrepräsentanz ist dem Bewußtsein gründlich entzogen; als Ersatzbildung –; und gleichzeitig als Symptom –; findet sich eine überstarke –; in den vorbildlichen Fällen somatische –; Innervation, bald sensorischer, bald motorischer Natur, entweder als Erregung oder als Hemmung. Die überinnervierte Stelle erweist sich bei näherer Betrachtung als ein Stück der verdrängten Triebrepräsentanz selbst, welches wie durch Verdichtung die gesamte Besetzung auf sich gezogen hat. Natürlich decken auch diese Bemerkungen den Mechanismus einer Konversionshysterie nicht restlos auf; vor allem ist noch das Moment der Regression hinzuzufügen, das in anderem Zusammenhang gewürdigt werden soll.
Die Verdrängung der Hysterie kann als völlig mißglückt beurteilt werden, insofern sie nur durch ausgiebige Ersatzbildungen ermöglicht worden ist; mit Bezug auf die Erledigung des Affektbetrages, die eigentliche Aufgabe der Verdrängung, bedeutet sie aber in der Regel einen vollen Erfolg. Der Verdrängungsvorgang der Konversionshysterie ist dann auch mit der Symptombildung abgeschlossen und braucht sich nicht wie bei Angsthysterie zweizeitig –; oder eigentlich unbegrenzt –; fortzusetzen.
Ein ganz anderes Ansehen zeigt die Verdrängung wieder bei der dritten Affektion, die wir zu dieser Vergleichung heranziehen, bei der Zwangsneurose. Hier gerät man zuerst in Zweifel, was man als die der Verdrängung unterliegende Repräsentanz anzusehen hat, eine libidinöse oder eine feindselige Strebung. Die Unsicherheit rührt daher, daß die Zwangsneurose auf der Voraussetzung einer Regression ruht, durch welche eine sadistische Strebung an die Stelle der zärtlichen getreten ist. Dieser feindselige Impuls gegen eine geliebte Person ist es, welcher der Verdrängung unterliegt. Der Effekt ist in einer ersten Phase der Verdrängungsarbeit ein ganz anderer als später. Zunächst hat diese vollen Erfolg, der Vorstellungsinhalt wird abgewiesen und der Affekt zum Verschwinden gebracht. Als Ersatzbildung findet sich eine Ichveränderung, die Steigerung der Gewissenhaftigkeit, die man nicht gut ein Symptom heißen kann. Ersatz- und Symptombildung fallen hier auseinander. Hier erfährt man auch etwas über den Mechanismus der Verdrängung. Diese hat wie überall eine Libidoentziehung zustande gebracht, aber sich zu diesem Zwecke der Reaktionsbildung durch Verstärkung eines Gegensatzes bedient. Die Ersatzbildung hat also hier denselben Mechanismus wie die Verdrängung und fällt im Grunde mit ihr zusammen, sie trennt sich aber zeitlich, wie begrifflich, von der Symptombildung. Es ist sehr wahrscheinlich, daß das Ambivalenzverhältnis, in welches der zu verdrängende sadistische Impuls eingetragen ist, den ganzen Vorgang ermöglicht.
Die anfänglich gute Verdrängung hält aber nicht stand, im weiteren Verlaufe drängt sich das Mißglücken der Verdrängung immer mehr vor. Die Ambivalenz, welche die Verdrängung durch Reaktionsbildung gestattet hat, ist auch die Stelle, an welcher dem Verdrängten die Wiederkehr gelingt. Der verschwundene Affekt kommt in der Verwandlung zur sozialen Angst, Gewissensangst, Vorwurf ohne Ersparnis wieder, die abgewiesene Vorstellung ersetzt sich durch Verschiebungsersatz, oft durch Verschiebung auf Kleinstes, Indifferentes, Eine Tendenz zur intakten Herstellung der verdrängten Vorstellung ist meist unverkennbar. Das Mißglücken in der Verdrängung des quantitativen, affektiven Faktors bringt denselben Mechanismus der Flucht durch Vermeidungen und Verbote ins Spiel, den wir bei der Bildung der hysterischen Phobie kennengelernt haben. Die Abweisung der Vorstellung vom Bewußten wird aber hartnäckig festgehalten, weil mit ihr die Abhaltung von der Aktion, die motorische Fesselung des Impulses, gegeben ist. So läuft die Verdrängungsarbeit der Zwangsneurose in ein erfolgloses und unabschließbares Ringen aus.
Aus der kleinen, hier vorgebrachten Vergleichsreihe kann man sich die Überzeugung holen, daß es noch umfassender Untersuchungen bedarf, ehe man hoffen kann, die mit der Verdrängung und neurotischen Symptombildung zusammenhängenden Vorgänge zu durchschauen. Die außerordentliche Verschlungenheit aller in Betracht kommenden Momente läßt uns nur einen Weg zur Darstellung frei. Wir müssen bald den einen, bald den anderen Gesichtspunkt herausgreifen und ihn durch das Material hindurchverfolgen, solange seine Anwendung etwas zu leisten scheint. Jede einzelne dieser Bearbeitungen wird an sich unvollständig sein und dort Unklarheiten nicht vermeiden können, wo sie an das noch nicht Bearbeitete anrührt; wir dürfen aber hoffen, daß sich aus der endlichen Zusammensetzung ein gutes Verständnis ergeben wird.
Die Verneinung (1925)
Die Art, wie unsere Patienten ihre Einfälle während der analytischen Arbeit vorbringen, gibt uns Anlaß zu einigen interessanten Beobachtungen. »Sie werden jetzt denken, ich will etwas Beleidigendes sagen, aber ich habe wirklich nicht diese Absicht.« Wir verstehen, das ist die Abweisung eines eben auftauchenden Einfalles durch Projektion. Oder: »Sie fragen, wer diese Person im Traum sein kann. Die Mutter ist es nicht.« Wir berichtigen: »Also ist es die Mutter.« Wir nehmen uns die Freiheit, bei der Deutung von der Verneinung abzusehen und den reinen Inhalt des Einfalls herauszugreifen. Es ist so, als ob der Patient gesagt hätte: »Mir ist zwar die Mutter zu dieser Person eingefallen, aber ich habe keine Lust, diesen Einfall gelten zu lassen.«
Gelegentlich kann man sich eine gesuchte Aufklärung über das unbewußte Verdrängte auf eine sehr bequeme Weise verschaffen. Man fragt: »Was halten Sie wohl für das Allerunwahrscheinlichste in jener Situation? Was, meinen Sie, ist Ihnen damals am fernsten gelegen?« Geht der Patient in die Falle und nennt das, woran er am wenigsten glauben kann, so hat er damit fast immer das Richtige zugestanden. Ein hübsches Gegenstück zu diesem Versuch stellt sich oft beim Zwangsneurotiker her, der bereits in das Verständnis seiner Symptome eingeführt worden ist. »Ich habe eine neue Zwangsvorstellung bekommen. Mir ist sofort dazu eingefallen, sie könnte dies Bestimmte bedeuten. Aber nein, das kann ja nicht wahr sein, sonst hätte es mir nicht einfallen können.« Was er mit dieser der Kur abgelauschten Begründung verwirft, ist natürlich der richtige Sinn der neuen Zwangsvorstellung.
Ein verdrängter Vorstellungs- oder Gedankeninhalt kann also zum Bewußtsein durchdringen, unter der Bedingung, daß er sich verneinen läßt. Die Verneinung ist eine Art, das Verdrängte zur Kenntnis zu nehmen, eigentlich schon eine Aufhebung der Verdrängung, aber freilich keine Annahme des Verdrängten. Man sieht, wie sich hier die intellektuelle Funktion vom affektiven Vorgang scheidet. Mit Hilfe der Verneinung wird nur die eine Folge des Verdrängungsvorganges rückgängig gemacht, daß dessen Vorstellungsinhalt nicht zum Bewußtsein gelangt. Es resultiert daraus eine Art von intellektueller Annahme des Verdrängten bei Fortbestand des Wesentlichen an der Verdrängung [Fußnote]Derselbe Vorgang liegt dem bekannten Vorgang des »Berufens« zugrunde. »Wie schön, daß ich meine Migräne so lange nicht gehabt habe!« Das ist aber die erste Ankündigung des Anfalls, dessen Herannahen man bereits verspürt, aber noch nicht glauben will.. Im Verlauf der analytischen Arbeit schaffen wir oft eine andere, sehr wichtige und ziemlich befremdende Abänderung derselben Situation. Es gelingt uns, auch die Verneinung zu besiegen und die volle intellektuelle Annahme des Verdrängten durchzusetzen –; der Verdrängungsvorgang selbst ist damit noch nicht aufgehoben.
Da es die Aufgabe der intellektuellen Urteilsfunktion ist, Gedankeninhalte zu bejahen oder zu verneinen, haben uns die vorstehenden Bemerkungen zum psychologischen Ursprung dieser Funktion geführt. Etwas im Urteil verneinen, heißt im Grunde: »Das ist etwas, was ich am liebsten verdrängen möchte.« Die Verurteilung ist der intellektuelle Ersatz der Verdrängung, ihr »Nein« ein Merkzeichen derselben, ein Ursprungszertifikat etwa wie das » made in Germany«. Vermittels des Verneinungssymbols macht sich das Denken von den Einschränkungen der Verdrängung frei und bereichert sich um Inhalte, deren es für seine Leistung nicht entbehren kann.
Die Urteilsfunktion hat im wesentlichen zwei Entscheidungen zu treffen. Sie soll einem Ding eine Eigenschaft zu- oder absprechen, und sie soll einer Vorstellung die Existenz in der Realität zugestehen oder bestreiten. Die Eigenschaft, über die entschieden werden soll, könnte ursprünglich gut oder schlecht, nützlich oder schädlich gewesen sein. In der Sprache der ältesten, oralen Triebregungen ausgedrückt: »Das will ich essen oder will es ausspucken«, und in weitergehender Übertragung: »Das will ich in mich einführen und das aus mir ausschließen.« Also: »Es soll in mir oder außer mir sein.« Das ursprüngliche Lust-Ich will, wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe, alles Gute sich introjizieren, alles Schlechte von sich werfen. Das Schlechte, das dem Ich Fremde, das Außenbefindliche, ist ihm zunächst identisch [Fußnote]Vgl. hiezu die Ausführungen in ›Triebe und Triebschicksale‹..
Die andere der Entscheidungen der Urteilsfunktion, die über die reale Existenz eines vorgestellten Dinges, ist ein Interesse des endgültigen Real-Ichs, das sich aus dem anfänglichen Lust-Ich entwickelt. (Realitätsprüfung.) Nun handelt es sich nicht mehr darum, ob etwas Wahrgenommenes (ein Ding) ins Ich aufgenommen werden soll oder nicht, sondern ob etwas im Ich als Vorstellung Vorhandenes auch in der Wahrnehmung (Realität) wiedergefunden werden kann. Es ist, wie man sieht, wieder eine Frage des Außen und Innen. Das Nichtreale, bloß Vorgestellte, Subjektive, ist nur innen; das andere, Reale, auch im Draußen vorhanden. In dieser Entwicklung ist die Rücksicht auf das Lustprinzip beiseite gesetzt worden. Die Erfahrung hat gelehrt, es ist nicht nur wichtig, ob ein Ding (Befriedigungsobjekt) die »gute« Eigenschaft besitzt, also die Aufnahme ins Ich verdient, sondern auch, ob es in der Außenwelt da ist, so daß man sich seiner nach Bedürfnis bemächtigen kann. Um diesen Fortschritt zu verstehen, muß man sich daran erinnern, daß alle Vorstellungen von Wahrnehmungen stammen, Wiederholungen derselben sind. Ursprünglich ist also schon die Existenz der Vorstellung eine Bürgschaft für die Realität des Vorgestellten. Der Gegensatz zwischen Subjektivem und Objektivem besteht nicht von Anfang an. Er stellt sich erst dadurch her, daß das Denken die Fähigkeit besitzt, etwas einmal Wahrgenommenes durch Reproduktion in der Vorstellung wieder gegenwärtig zu machen, während das Objekt draußen nicht mehr vorhanden zu sein braucht. Der erste und nächste Zweck der Realitätsprüfung ist also nicht, ein dem Vorgestellten entsprechendes Objekt in der realen Wahrnehmung zu finden, sondern es wiederzufinden, sich zu überzeugen, daß es noch vorhanden ist. Ein weiterer Beitrag zur Entfremdung zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven rührt von einer anderen Fähigkeit des Denkvermögens her. Die Reproduktion der Wahrnehmung in der Vorstellung ist nicht immer deren getreue Wiederholung; sie kann durch Weglassungen modifiziert, durch Verschmelzungen verschiedener Elemente verändert sein. Die Realitätsprüfung hat dann zu kontrollieren, wie weit diese Entstellungen reichen. Man erkennt aber als Bedingung für die Einsetzung der Realitätsprüfung, daß Objekte verlorengegangen sind, die einst reale Befriedigung gebracht hatten.
Das Urteilen ist die intellektuelle Aktion, die über die Wahl der motorischen Aktion entscheidet, dem Denkaufschub ein Ende setzt und vom Denken zum Handeln überleitet. Auch über den Denkaufschub habe ich bereits an anderer Stelle gehandelt. Er ist als eine Probeaktion zu betrachten, ein motorisches Tasten mit geringen Abfuhraufwänden. Besinnen wir uns: Wo hatte das Ich ein solches Tasten vorher geübt, an welcher Stelle die Technik erlernt, die es jetzt bei den Denkvorgängen anwendet? Dies geschah am sensorischen Ende des seelischen Apparats, bei den Sinneswahrnehmungen. Nach unserer Annahme ist ja die Wahrnehmung kein rein passiver Vorgang, sondern das Ich schickt periodisch kleine Besetzungsmengen in das Wahrnehmungssystem, mittels deren es die äußeren Reize verkostet, um sich nach jedem solchen tastenden Vorstoß wieder zurückzuziehen.
Das Studium des Urteils eröffnet uns vielleicht zum erstenmal die Einsicht in die Entstehung einer intellektuellen Funktion aus dem Spiel der primären Triebregungen. Das Urteilen ist die zweckmäßige Fortentwicklung der ursprünglich nach dem Lustprinzip erfolgten Einbeziehung ins Ich oder Ausstoßung aus dem Ich. Seine Polarität scheint der Gegensätzlichkeit der beiden von uns angenommenen Triebgruppen zu entsprechen. Die Bejahung –; als Ersatz der Vereinigung –; gehört dem Eros an, die Verneinung –; Nachfolge der Ausstoßung –; dem Destruktionstrieb. Die allgemeine Verneinungslust, der Negativismus mancher Psychotiker ist wahrscheinlich als Anzeichen der Triebentmischung durch Abzug der libidinösen Komponenten zu verstehen. Die Leistung der Urteilsfunktion wird aber erst dadurch ermöglicht, daß die Schöpfung des Verneinungssymbols dem Denken einen ersten Grad von Unabhängigkeit von den Erfolgen der Verdrängung und somit auch vom Zwang des Lustprinzips gestattet hat.
Zu dieser Auffassung der Verneinung stimmt es sehr gut, daß man in der Analyse kein »Nein« aus dem Unbewußten auffindet und daß die Anerkennung des Unbewußten von Seiten des Ichs sich in einer negativen Formel ausdrückt. Kein stärkerer Beweis für die gelungene Aufdeckung des Unbewußten, als wenn der Analysierte mit dem Satze: » Das habe ich nicht gedacht«, oder: » Daran habe ich nicht (nie) gedacht«, darauf reagiert.
Die zukünftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie (1910)
Meine Herren! Da uns heute vorwiegend praktische Ziele zusammengeführt haben, werde auch ich ein praktisches Thema zum Gegenstand meines einführenden Vortrages wählen, nicht Ihr wissenschaftliches, sondern Ihr ärztliches Interesse anrufen. Ich halte mir vor, wie Sie wohl die Erfolge unserer Therapie beurteilen, und nehme an, daß die meisten von Ihnen die beiden Phasen der Anfängerschaft bereits durchgemacht haben, die des Entzückens über die ungeahnte Steigerung unserer therapeutischen Leistung und die der Depression über die Größe der Schwierigkeiten, die unseren Bemühungen im Wege stehen. Aber an welcher Stelle dieses Entwicklungsganges sich die einzelnen von Ihnen auch befinden mögen, ich habe heute vor, Ihnen zu zeigen, daß wir mit unseren Hilfsmitteln zur Bekämpfung der Neurosen keineswegs zu Ende sind und daß wir von der näheren Zukunft noch eine erhebliche Besserung unserer therapeutischen Chancen erwarten dürfen.
Von drei Seiten her, meine ich, wird uns die Verstärkung kommen:
(1) durch inneren Fortschritt,
(2) durch Zuwachs an Autorität,
(3) durch die Allgemeinwirkung unserer Arbeit.
Ad (1) Unter » innerem Fortschritt« verstehe ich den Fortschritt (a) in unserem analytischen Wissen, (b) in unserer Technik.
(a) Zum Fortschritt unseres Wissens: Wir wissen natürlich lange noch nicht alles, was wir zum Verständnis des Unbewußten bei unseren Kranken brauchen. Nun ist es klar, daß jeder Fortschritt unseres Wissens einen Machtzuwachs für unsere Therapie bedeutet. Solange wir nichts verstanden haben, haben wir auch nichts ausgerichtet; je mehr wir verstehen lernen, desto mehr werden wir leisten. In ihren Anfängen war die psychoanalytische Kur unerbittlich und erschöpfend. Der Patient mußte alles selbst sagen, und die Tätigkeit des Arztes bestand darin, ihn unausgesetzt zu drängen. Heute sieht es freundlicher aus. Die Kur besteht aus zwei Stücken, aus dem, was der Arzt errät und dem Kranken sagt, und aus der Verarbeitung dessen, was er gehört hat, von Seiten des Kranken. Der Mechanismus unserer Hilfeleistung ist ja leicht zu verstehen; wir geben dem Kranken die bewußte Erwartungsvorstellung, nach deren Ähnlichkeit er die verdrängte, unbewußte bei sich auffindet. Das ist die intellektuelle Hilfe, die ihm die Überwindung der Widerstände zwischen Bewußtem und Unbewußtem erleichtert. Ich bemerke Ihnen nebenbei, es ist nicht der einzige Mechanismus, der in der analytischen Kur verwendet wird; Sie kennen ja alle den weit kräftigeren, der in der Verwendung der »Übertragung« liegt. Ich werde mich bemühen, alle diese für das Verständnis der Kur wichtigen Verhältnisse demnächst in einer Allgemeinen Methodik der Psychoanalyse zu behandeln. Auch brauche ich bei Ihnen den Einwand nicht zurückzuweisen, daß in der heutigen Praxis der Kur die Beweiskraft für die Richtigkeit unserer Voraussetzungen verdunkelt wird; Sie vergessen nicht, daß diese Beweise anderswo zu finden sind und daß ein therapeutischer Eingriff nicht so geführt werden kann wie eine theoretische Untersuchung.
Lassen Sie mich nun einige Gebiete streifen, auf denen wir Neues zu lernen haben und wirklich täglich Neues erfahren. Da ist vor allem das der Symbolik im Traum und im Unbewußten. Ein hart bestrittenes Thema, wie Sie wissen! Es ist kein geringes Verdienst unseres Kollegen W. Stekel, daß er unbekümmert um den Einspruch all der Gegner sich in das Studium der Traumsymbole begeben hat. Da ist wirklich noch viel zu lernen; meine 1899 niedergeschriebene Traumdeutung erwartet vom Studium der Symbolik wichtige Ergänzungen.
Über eines dieser neuerkannten Symbole möchte ich Ihnen einige Worte sagen: Vor einiger Zeit wurde es mir bekannt, daß ein uns fernerstehender Psychologe sich an einen von uns mit der Bemerkung gewendet, wir überschätzten doch gewiß die geheime sexuelle Bedeutung der Träume. Sein häufigster Traum sei, eine Stiege hinaufzusteigen, und da sei doch gewiß nichts Sexuelles dahinter. Durch diesen Einwand aufmerksam gemacht, haben wir dem Vorkommen von Stiegen, Treppen, Leitern im Traume Aufmerksamkeit geschenkt und konnten bald feststellen, daß die Stiege (und was ihr analog ist) ein sicheres Koitussymbol darstellt. Die Grundlage der Vergleichung ist nicht schwer aufzufinden; in rhythmischen Absätzen, unter zunehmender Atemnot kommt man auf eine Höhe und kann dann in ein paar raschen Sprüngen wieder unten sein. So findet sich der Rhythmus des Koitus im Stiegensteigen wieder. Vergessen wir nicht den Sprachgebrauch heranzuziehen. Er zeigt uns, daß das »Steigen« ohne weiteres als Ersatzbezeichnung der sexuellen Aktion gebraucht wird. Man pflegt zu sagen, der Mann ist ein »Steiger«, »nachsteigen«. Im Französischen heißt die Stufe der Treppe: la marche; » un vieux marcheur« deckt sich ganz mit unserem »ein alter Steiger«. Das Traummaterial, aus dem diese neu erkannten Symbole stammen, wird Ihnen seinerzeit von dem Komitee zur Sammelforschung über Symbolik, welches wir einsetzen sollen, vorgelegt werden. Über ein anderes interessantes Symbol, das des »Rettens« und dessen Bedeutungswandel, werden Sie im zweiten Band unseres Jahrbuches Angaben finden. Aber ich muß hier abbrechen, sonst komme ich nicht zu den anderen Punkten.
Jeder einzelne von Ihnen wird sich aus seiner Erfahrung überzeugen, wie ganz anders er einem neuen Falle gegenübersteht, wenn er erst das Gefüge einiger typischer Krankheitsfälle durchschaut hat. Nehmen Sie nun an, daß wir das Gesetzmäßige im Aufbau der verschiedenen Formen von Neurosen in ähnlicher Weise in knappe Formeln gebannt hätten, wie es uns bis jetzt für die hysterische Symptombildung gelungen ist, wie gesichert würde dadurch unser prognostisches Urteil. Ja, wie der Geburtshelfer durch die Inspektion der Placenta erfährt, ob sie vollständig ausgestoßen wurde oder ob noch schädliche Reste zurückgeblieben sind, so würden wir unabhängig vom Erfolg und jeweiligen Befinden des Kranken sagen können, ob uns die Arbeit endgültig gelungen ist oder ob wir auf Rückfälle und neuerliche Erkrankung gefaßt sein müssen.
(b) Ich eile zu den Neuerungen auf dem Gebiete der Technik, wo wirklich das meiste noch seiner definitiven Feststellung harrt und vieles eben jetzt klar zu werden beginnt. Die psychoanalytische Technik setzt sich jetzt zweierlei Ziele, dem Arzt Mühe zu ersparen und dem Kranken den uneingeschränktesten Zugang zu seinem Unbewußten zu eröffnen. Sie wissen, in unserer Technik hat eine prinzipielle Wandlung stattgefunden. Zur Zeit der kathartischen Kur setzten wir uns die Aufklärung der Symptome zum Ziel, dann wandten wir uns von den Symptomen ab und setzten die Aufdeckung der »Komplexe« –; nach dem unentbehrlich gewordenen Wort von Jung –; als Ziel an die Stelle; jetzt richten wir aber die Arbeit direkt auf die Auffindung und Überwindung der »Widerstände« und vertrauen mit Recht darauf, daß die Komplexe sich mühelos ergeben werden, sowie die Widerstände erkannt und beseitigt sind. Bei manchem von Ihnen hat sich seither das Bedürfnis gezeigt, diese Widerstände übersehen und klassifizieren zu können. Ich bitte Sie nun, an Ihrem Material nachzuprüfen, ob Sie folgende Zusammenfassung bestätigen können: Bei männlichen Patienten scheinen die bedeutsamsten Kurwiderstände vom Vaterkomplex auszugehen und sich in Furcht vor dem Vater, Trotz gegen den Vater und Unglauben gegen den Vater aufzulösen.
Andere Neuerungen der Technik betreffen die Person des Arztes selbst. Wir sind auf die »Gegenübertragung« aufmerksam geworden, die sich beim Arzt durch den Einfluß des Patienten auf das unbewußte Fühlen des Arztes einstellt, und sind nicht weit davon, die Forderung zu erheben, daß der Arzt diese Gegenübertragung in sich erkennen und bewältigen müsse. Wir haben, seitdem eine größere Anzahl von Personen die Psychoanalyse üben und ihre Erfahrungen untereinander austauschen, bemerkt, daß jeder Psychoanalytiker nur so weit kommt, als seine eigenen Komplexe und inneren Widerstände es gestatten, und verlangen daher, daß er seine Tätigkeit mit einer Selbstanalyse beginne und diese, während er seine Erfahrungen an Kranken macht, fortlaufend vertiefe. Wer in einer solchen Selbstanalyse nichts zustande bringt, mag sich die Fähigkeit, Kranke analytisch zu behandeln, ohne weiteres absprechen.
Wir nähern uns jetzt auch der Einsicht, daß die analytische Technik je nach der Krankheitsform und je nach den beim Patienten vorherrschenden Trieben gewisse Modifikationen erfahren muß. Von der Therapie der Konversionshysterie sind wir ja ausgegangen; bei der Angsthysterie (den Phobien) müssen wir unser Vorgehen etwas ändern. Diese Kranken können nämlich das für die Auflösung der Phobie entscheidende Material nicht bringen, solange sie sich durch die Einhaltung der phobischen Bedingung geschützt fühlen. Daß sie von Anfang der Kur an auf die Schutzvorrichtung verzichten und unter den Bedingungen der Angst arbeiten, erreicht man natürlich nicht. Man muß ihnen also so lange Hilfe durch Übersetzung ihres Unbewußten zuführen, bis sie sich entschließen können, auf den Schutz der Phobie zu verzichten, und sich einer nun sehr gemäßigten Angst aussetzen. Haben sie das getan, so wird jetzt erst das Material zugänglich, dessen Beherrschung zur Lösung der Phobie führt. Andere Modifikationen der Technik, die mir noch nicht spruchreif scheinen, werden in der Behandlung der Zwangsneurosen erforderlich sein. Ganz bedeutsame, noch nicht geklärte Fragen tauchen in diesem Zusammenhange auf, inwieweit den bekämpften Trieben des Kranken ein Stück Befriedigung während der Kur zu gestatten ist und welchen Unterschied es dabei macht, ob diese Triebe aktiver (sadistischer) oder passiver (masochistischer) Natur sind.
Ich hoffe, Sie werden den Eindruck erhalten haben, daß, wenn wir all das wüßten, was uns jetzt erst ahnt, und alle Verbesserungen der Technik durchgeführt haben werden, zu denen uns die vertiefte Erfahrung an unseren Kranken führen muß, daß unser ärztliches Handeln dann eine Präzision und Erfolgssicherheit erreichen wird, die nicht auf allen ärztlichen Spezialgebieten vorhanden sind.
Ad (2) Ich sagte, wir hätten viel zu erwarten durch den Zuwachs an Autorität, der uns im Laufe der Zeit zufallen muß. Über die Bedeutung der Autorität brauche ich Ihnen nicht viel zu sagen. Die wenigsten Kulturmenschen sind fähig, ohne Anlehnung an andere zu existieren oder auch nur ein selbständiges Urteil zu fällen. Die Autoritätssucht und innere Haltlosigkeit der Menschen können Sie sich nicht arg genug vorstellen. Die außerordentliche Vermehrung der Neurosen seit der Entkräftung der Religionen mag Ihnen einen Maßstab dafür geben. Die Verarmung des Ichs durch den großen Verdrängungsaufwand, den die Kultur von jedem Individuum fordert, mag eine der hauptsächlichsten Ursachen dieses Zustandes sein.
Diese Autorität und die enorme von ihr ausgehende Suggestion war bisher gegen uns. Alle unsere therapeutischen Erfolge sind gegen diese Suggestion erzielt worden; es ist zu verwundern, daß unter solchen Verhältnissen überhaupt Erfolge zu gewinnen waren. Ich will mich nicht so weit gehen lassen, Ihnen die Annehmlichkeiten jener Zeiten, da ich allein die Psychoanalyse vertrat, zu schildern. Ich weiß, die Kranken, denen ich die Versicherung gab, ich wüßte ihnen dauernde Abhilfe ihrer Leiden zu bringen, sahen sich in meiner bescheidenen Umgebung um, dachten an meinen geringen Ruf und Titel und betrachteten mich wie etwa einen Besitzer eines unfehlbaren Gewinnsystems an dem Orte einer Spielbank, gegen den man einwendet, wenn der Mensch das kann, so muß er selbst anders aussehen. Es war auch wirklich nicht bequem, psychische Operationen auszuführen, während der Kollege, der die Pflicht der Assistenz gehabt hätte, sich ein besonderes Vergnügen daraus machte, ins Operationsfeld zu spucken, und die Angehörigen den Operateur bedrohten, sobald es Blut oder unruhige Bewegungen bei dem Kranken gab. Eine Operation darf doch Reaktionserscheinungen machen; in der Chirurgie sind wir längst daran gewöhnt. Man glaubte mir einfach nicht, wie man heute noch uns allen wenig glaubt; unter solchen Bedingungen mußte mancher Eingriff mißlingen. Um die Vermehrung unserer therapeutischen Chancen zu ermessen, wenn sich das allgemeine Vertrauen uns zuwendet, denken Sie an die Stellung des Frauenarztes in der Türkei und im Abendlande. Alles, was dort der Frauenarzt tun darf, ist, an dem Arm, der ihm durch ein Loch in der Wand entgegengestreckt wird, den Puls zu fühlen. Einer solchen Unzugänglichkeit des Objektes entspricht auch die ärztliche Leistung; unsere Gegner im Abendlande wollen uns eine ungefähr ähnliche Verfügung über das Seelische unserer Kranken gestatten. Seitdem aber die Suggestion der Gesellschaft die kranke Frau zum Gynäkologen drängt, ist dieser der Helfer und Retter der Frau geworden. Sagen Sie nun nicht, wenn uns die Autorität der Gesellschaft zu Hilfe kommt und unsere Erfolge so sehr steigert, so wird dies nichts für die Richtigkeit unserer Voraussetzungen beweisen. Die Suggestion kann angeblich alles, und unsere Erfolge werden dann Erfolge der Suggestion sein und nicht der Psychoanalyse. Die Suggestion der Gesellschaft kommt doch jetzt den Wasser-, Diät- und elektrischen Kuren bei Nervösen entgegen, ohne daß es diesen Maßnahmen gelingt, die Neurosen zu bezwingen. Es wird sich zeigen, ob die psychoanalytischen Behandlungen mehr zu leisten vermögen.
Nun muß ich aber Ihre Erwartungen allerdings wieder dämpfen. Die Gesellschaft wird sich nicht beeilen, uns Autorität einzuräumen. Sie muß sich im Widerstande gegen uns befinden, denn wir verhalten uns kritisch gegen sie; wir weisen ihr nach, daß sie an der Verursachung der Neurosen selbst einen großen Anteil hat. Wie wir den einzelnen durch die Aufdeckung des in ihm Verdrängten zu unserem Feinde machen, so kann auch die Gesellschaft die rücksichtslose Bloßlegung ihrer Schäden und Unzulänglichkeiten nicht mit sympathischem Entgegenkommen beantworten; weil wir Illusionen zerstören, wirft man uns vor, daß wir die Ideale in Gefahr bringen. So scheint es also, daß die Bedingung, von der ich eine so große Förderung unserer therapeutischen Chancen erwarte, niemals eintreten wird. Und doch ist die Situation nicht so trostlos, wie man jetzt meinen sollte. So mächtig auch die Affekte und die Interessen der Menschen sein mögen, das Intellektuelle ist doch auch eine Macht. Nicht gerade diejenige, welche sich zuerst Geltung verschafft, aber um so sicherer am Ende. Die einschneidendsten Wahrheiten werden endlich gehört und anerkannt, nachdem die durch sie verletzten Interessen und die durch sie geweckten Affekte sich ausgetobt haben. Es ist bisher noch immer so gegangen, und die unerwünschten Wahrheiten, die wir Psychoanalytiker der Welt zu sagen haben, werden dasselbe Schicksal finden. Nur wird es nicht sehr rasch geschehen; wir müssen warten können.
Ad (3) Endlich muß ich Ihnen erklären, was ich unter der »Allgemeinwirkung« unserer Arbeit verstehe und wie ich dazu komme, Hoffnungen auf diese zu setzen. Es liegt da eine sehr merkwürdige therapeutische Konstellation vor, die sich in gleicher Weise vielleicht nirgendwo wiederfindet, die Ihnen auch zunächst befremdlich erscheinen wird, bis Sie etwas längst Vertrautes in ihr erkennen werden. Sie wissen doch, die Psychoneurosen sind entstellte Ersatzbefriedigungen von Trieben, deren Existenz man vor sich selbst und vor den anderen verleugnen muß. Ihre Existenzfähigkeit ruht auf dieser Entstellung und Verkennung. Mit der Lösung des Rätsels, das sie bieten, und der Annahme dieser Lösung durch die Kranken werden diese Krankheitszustände existenzunfähig. Es gibt kaum etwas Ähnliches in der Medizin; in den Märchen hören Sie von bösen Geistern, deren Macht gebrochen ist, sobald man ihnen ihren geheimgehaltenen Namen sagen kann.
Nun setzen Sie an die Stelle des einzelnen Kranken die ganze an den Neurosen krankende, aus kranken und gesunden Personen bestehende Gesellschaft, an Stelle der Annahme der Lösung dort die allgemeine Anerkennung hier, so wird Ihnen eine kurze Überlegung zeigen, daß diese Ersetzung am Ergebnis nichts zu ändern vermag. Der Erfolg, den die Therapie beim einzelnen haben kann, muß auch bei der Masse eintreten. Die Kranken können ihre verschiedenen Neurosen, ihre ängstliche Überzärtlichkeit, die den Haß verbergen soll, ihre Agoraphobie, die von ihrem enttäuschten Ehrgeiz erzählt, ihre Zwangshandlungen, die Vorwürfe wegen und Sicherungen gegen böse Vorsätze darstellen, nicht bekanntwerden lassen, wenn allen Angehörigen und Fremden, vor denen sie ihre Seelenvorgänge verbergen wollen, der allgemeine Sinn der Symptome bekannt ist und wenn sie selbst wissen, daß sie in den Krankheitserscheinungen nichts produzieren, was die anderen nicht sofort zu deuten verstehen. Die Wirkung wird sich aber nicht auf das –; übrigens häufig undurchführbare –; Verbergen der Symptome beschränken; denn durch dieses Verbergenmüssen wird das Kranksein unverwendbar. Die Mitteilung des Geheimnisses hat die »ätiologische Gleichung«, aus welcher die Neurosen hervorgehen, an ihrem heikelsten Punkte angegriffen, sie hat den Krankheitsgewinn illusorisch gemacht, und darum kann nichts anderes als die Einstellung der Krankheitsproduktion die endliche Folge der durch die Indiskretion des Arztes veränderten Sachlage sein.
Erscheint Ihnen diese Hoffnung utopisch, so lassen Sie sich daran erinnern, daß Beseitigung neurotischer Phänomene auf diesem Wege wirklich bereits vorgekommen ist, wenngleich in ganz vereinzelten Fällen. Denken Sie daran, wie häufig in früheren Zeiten die Halluzination der heiligen Jungfrau bei Bauernmädchen war. Solange eine solche Erscheinung einen großen Zulauf von Gläubigen, etwa noch die Erbauung einer Kapelle am Gnadenorte zur Folge hatte, war der visionäre Zustand dieser Mädchen einer Beeinflussung unzugänglich. Heute hat selbst die Geistlichkeit ihre Stellung zu diesen Erscheinungen verändert; sie gestattet, daß der Gendarm und der Arzt die Visionärin besuchen, und seitdem erscheint die Jungfrau nur sehr selten. Oder gestatten Sie, daß ich dieselben Vorgänge, die ich vorhin in die Zukunft verlegt habe, an einer analogen, aber erniedrigten und darum leichter übersehbaren Situation mit Ihnen studiere. Nehmen Sie an, ein aus Herren und Damen der guten Gesellschaft bestehender Kreis habe einen Tagesausflug nach einem im Grünen gelegenen Wirtshause verabredet. Die Damen haben miteinander ausgemacht, wenn eine von ihnen ein natürliches Bedürfnis befriedigen wolle, so werde sie laut sagen: sie gehe jetzt Blumen pflücken; ein Boshafter sei aber hinter dieses Geheimnis gekommen und habe auf das gedruckte und an die Teilnehmer verschickte Programm setzen lassen: Wenn die Damen auf die Seite gehen wollen, mögen sie sagen, sie gehen Blumen pflücken. Natürlich wird keine der Damen mehr sich dieser Verblümung bedienen wollen, und ebenso erschwert werden ähnliche, neu verabredete Formeln sein. Was wird die Folge sein? Die Damen werden sich ohne Scheu zu ihren natürlichen Bedürfnissen bekennen, und keiner der Herren wird daran Anstoß nehmen. Kehren wir zu unserem ernsthafteren Falle zurück. Soundso viele Menschen haben sich in Lebenskonflikten, deren Lösung ihnen allzu schwierig wurde, in die Neurose geflüchtet und dabei einen unverkennbaren, wenn auch auf die Dauer allzu kostspieligen Krankheitsgewinn erzielt. Was werden diese Menschen tun müssen, wenn ihnen die Flucht in die Krankheit durch die indiskreten Aufklärungen der Psychoanalyse versperrt wird? Sie werden ehrlich sein müssen, sich zu den in ihnen rege gewordenen Trieben bekennen, im Konflikt standhalten, werden kämpfen oder verzichten, und die Toleranz der Gesellschaft, die sich im Gefolge der psychoanalytischen Aufklärung unabwendbar einstellt, wird ihnen zu Hilfe kommen.
Erinnern wir uns aber, daß man dem Leben nicht als fanatischer Hygieniker oder Therapeut entgegentreten darf. Gestehen wir uns ein, daß diese ideale Verhütung der neurotischen Erkrankungen nicht allen einzelnen zum Vorteil gereichen wird. Eine gute Anzahl derer, die sich heute in die Krankheit flüchten, würde unter den von uns angenommenen Bedingungen den Konflikt nicht bestehen, sondern rasch zugrunde gehen oder ein Unheil anstiften, welches größer ist als ihre eigene neurotische Erkrankung. Die Neurosen haben eben ihre biologische Funktion als Schutzvorrichtung und ihre soziale Berechtigung; ihr »Krankheitsgewinn« ist nicht immer ein rein subjektiver. Wer von Ihnen hat nicht schon einmal hinter die Verursachung einer Neurose geblickt, die er als den mildesten Ausgang unter allen Möglichkeiten der Situation gelten lassen mußte? Und soll man wirklich gerade der Ausrottung der Neurosen so schwere Opfer bringen, wenn doch die Welt voll ist von anderem unabwendbaren Elend?
Sollen wir also unsere Bemühungen zur Aufklärung über den geheimen Sinn der Neurotik als im letzten Grunde gefährlich für den einzelnen und schädlich für den Betrieb der Gesellschaft aufgeben, darauf verzichten, aus einem Stück wissenschaftlicher Erkenntnis die praktische Folgerung zu ziehen? Nein, ich meine, unsere Pflicht geht doch nach der anderen Richtung. Der Krankheitsgewinn der Neurosen ist doch im ganzen und am Ende eine Schädigung für die einzelnen wie für die Gesellschaft. Das Unglück, das sich infolge unserer Aufklärungsarbeit ergeben kann, wird doch nur einzelne betreffen. Die Umkehr zu einem wahrheitsgemäßeren und würdigeren Zustand der Gesellschaft wird mit diesen Opfern nicht zu teuer erkauft sein. Vor allem aber: alle die Energien, die sich heute in der Produktion neurotischer Symptome im Dienste einer von der Wirklichkeit isolierten Phantasiewelt verzehren, werden, wenn sie schon nicht dem Leben zugute kommen können, doch den Schrei nach jenen Veränderungen in unserer Kultur verstärken helfen, in denen wir allein das Heil für die Nachkommenden erblicken können.
So möchte ich Sie denn mit der Versicherung entlassen, daß Sie in mehr als einem Sinne Ihre Pflicht tun, wenn Sie Ihre Kranken psychoanalytisch behandeln. Sie arbeiten nicht nur im Dienste der Wissenschaft, indem Sie die einzige und nie wiederkehrende Gelegenheit ausnützen, die Geheimnisse der Neurosen zu durchschauen; Sie geben nicht nur Ihrem Kranken die wirksamste Behandlung gegen seine Leiden, die uns heute zu Gebote steht; Sie leisten auch Ihren Beitrag zu jener Aufklärung der Masse, von der wir die gründlichste Prophylaxe der neurotischen Erkrankungen auf dem Umwege über die gesellschaftliche Autorität erwarten.
Dostojewski und die Vatertötung (1928)
An der reichen Persönlichkeit Dostojewskis möchte man vier Fassaden unterscheiden: Den Dichter, den Neurotiker, den Ethiker und den Sünder. Wie soll man sich in der verwirrenden Komplikation zurechtfinden?
Am Dichter ist am wenigsten Zweifel, er hat seinen Platz nicht weit hinter Shakespeare. Die Brüder Karamasoff sind der großartigste Roman, der je geschrieben wurde, die Episode des Großinquisitors eine der Höchstleistungen der Weltliteratur, kaum zu überschätzen. Leider muß die Analyse vor dem Problem des Dichters die Waffen strecken.
Am ehesten angreifbar ist der Ethiker in Dostojewski. Wenn man ihn als sittlichen Menschen hochstellen will, mit der Begründung, daß nur der die höchste Stufe der Sittlichkeit erreicht, der durch die tiefste Sündhaftigkeit gegangen ist, so setzt man sich über ein Bedenken hinweg. Sittlich ist jener, der schon auf die innerlich verspürte Versuchung reagiert, ohne ihr nachzugeben. Wer abwechselnd sündigt und dann in seiner Reue hohe sittliche Forderungen aufstellt, der setzt sich dem Vorwurf aus, daß er sich's zu bequem gemacht hat. Er hat das Wesentliche an der Sittlichkeit, den Verzicht, nicht geleistet, denn die sittliche Lebensführung ist ein praktisches Menschheitsinteresse. Er erinnert an die Barbaren der Völkerwanderung, die morden und dafür Buße tun, wo die Buße direkt eine Technik wird, um den Mord zu ermöglichen. Iwan der Schreckliche benimmt sich auch nicht anders; ja dieser Ausgleich mit der Sittlichkeit ist ein charakteristisch russischer Zug. Auch ist das Endergebnis von Dostojewskis sittlichem Ringen kein rühmliches. Nach den heftigsten Kämpfen, die Triebansprüche des Individuums mit den Forderungen der menschlichen Gemeinschaft zu versöhnen, landet er rückläufig bei der Unterwerfung unter die weltliche wie unter die geistliche Autorität, bei der Ehrfurcht vor dem Zaren und dem Christengott und bei einem engherzigen russischen Nationalismus, eine Station, zu der geringere Geister mit weniger Mühe gelangt sind. Hier ist der schwache Punkt der großen Persönlichkeit. Dostojewski hat es versäumt, ein Lehrer und Befreier der Menschen zu werden, er hat sich zu ihren Kerkermeistern gesellt; die kulturelle Zukunft der Menschen wird ihm wenig zu danken haben. Es läßt sich wahrscheinlich zeigen, daß er durch seine Neurose zu solchem Scheitern verdammt wurde. Nach der Höhe seiner Intelligenz und der Stärke seiner Menschenliebe wäre ihm ein anderer, ein apostolischer Lebensweg eröffnet gewesen.
Dostojewski als Sünder oder Verbrecher zu betrachten ruft ein heftiges Sträuben hervor, das nicht in der philiströsen Einschätzung des Verbrechers begründet zu sein braucht. Man wird bald des wirklichen Motivs gewahr; für den Verbrecher sind zwei Züge wesentlich, die grenzenlose Eigensucht und die starke destruktive Tendenz; beiden gemeinsam und Voraussetzung für deren Äußerungen ist die Lieblosigkeit, der Mangel an affektiver Wertung der (menschlichen) Objekte. Man erinnert sich sofort an den Gegensatz hiezu bei Dostojewski, an seine große Liebesbedürftigkeit und seine enorme Liebesfähigkeit, die sich selbst in Erscheinungen der Übergüte äußert und ihn lieben und helfen läßt, wo er selbst das Recht zum Haß und zur Rache hatte, z. B. im Verhältnis zu seiner ersten Frau und ihrem Geliebten. Dann muß man fragen, woher überhaupt die Versuchung rührt, Dostojewski den Verbrechern zuzurechnen. Antwort: Es ist die Stoffwahl des Dichters, die gewalttätige, mörderische, eigensüchtige Charaktere vor allen anderen auszeichnet, was auf die Existenz solcher Neigungen in seinem Inneren hindeutet, ferner einiges Tatsächliche aus seinem Leben, wie seine Spielsucht, vielleicht der sexuelle Mißbrauch eines unreifen Mädchens (Geständnis) [Fußnote]Siehe die Diskussion hierüber in Fülöp-Miller und Eckstein (1926). –; Stefan Zweig (1920): »Er macht nicht halt vor den Zäunen der bürgerlichen Moral, und niemand weiß genau zu sagen, wie weit er in seinem Leben die juristische Grenze überschritten, wieviel von den verbrecherischen Instinkten seiner Helden in ihm selbst zur Tat geworden ist.« Über die intimen Beziehungen zwischen Dostojewskis Gestalten und seinen eigenen Erlebnissen siehe die Ausführungen René Fülöp-Millers im einleitenden Abschnitt zu Fülöp-Miller und Eckstein (1925), die an Nikolai Strachoff anknüpfen.. Der Widerspruch löst sich durch die Einsicht, daß der sehr starke Destruktionstrieb Dostojewskis, der ihn leicht zum Verbrecher gemacht hätte, im Leben hauptsächlich gegen die eigene Person (nach innen anstatt nach außen) gerichtet ist und so als Masochismus und Schuldgefühl zum Ausdruck kommt. Seine Person behält immerhin genug sadistische Züge übrig, die sich in seiner Reizbarkeit, Quälsucht, Intoleranz, auch gegen geliebte Personen, äußern und noch in der Art, wie er als Autor seine Leser behandelt, zum Vorschein kommen, also in kleinen Dingen Sadist nach außen, in größeren Sadist nach innen, also Masochist, das heißt der weichste, gutmütigste, hilfsbereiteste Mensch.
Aus der Komplikation der Person Dostojewskis haben wir drei Faktoren herausgeholt, einen quantitativen und zwei qualitative: Die außerordentliche Höhe seiner Affektivität, die perverse Triebanlage, die ihn zum Sado-Masochisten oder zum Verbrecher veranlagen mußte, und die unanalysierbare, künstlerische Begabung. Dies Ensemble wäre sehr wohl ohne Neurose existenzfähig; es gibt ja nicht-neurotische Vollmasochisten. Nach dem Kräfteverhältnis zwischen den Triebansprüchen und den ihnen entgegenstehenden Hemmungen (plus der verfügbaren Sublimierungswege) wäre Dostojewski immer noch als ein sogenannter »triebhafter Charakter« zu klassifizieren. Aber die Situation wird getrübt durch die Mitanwesenheit der Neurose, die, wie gesagt, nicht unter diesen Bedingungen unerläßlich wäre, aber doch um so eher zustande kommt, je reichhaltiger die vom Ich zu bewältigende Komplikation ist. Die Neurose ist doch nur ein Zeichen dafür, daß dem Ich eine solche Synthese nicht gelungen ist, daß es bei solchem Versuch seine Einheitlichkeit eingebüßt hat.
Wodurch wird nun im strengen Sinne die Neurose erwiesen? Dostojewski nannte sich selbst und galt bei den anderen als Epileptiker auf Grund seiner schweren, mit Bewußtseinsverlust, Muskelkrämpfen und nachfolgender Verstimmung einhergehenden Anfälle. Es ist nun überaus wahrscheinlich, daß diese sogenannte Epilepsie nur ein Symptom seiner Neurose war, die demnach als Hysteroepilepsie, das heißt als schwere Hysterie, klassifiziert werden müßte. Volle Sicherheit ist aus zwei Gründen nicht zu erreichen, erstens, weil die anamnestischen Daten über Dostojewskis sogenannte Epilepsie mangelhaft und unzuverlässig sind, zweitens, weil die Auffassung der mit epileptoiden Anfällen verbundenen Krankheitszustände nicht geklärt ist.
Zunächst zum zweiten Punkt. Es ist überflüssig, die ganze Pathologie der Epilepsie hier zu wiederholen, die doch nichts Entscheidendes bringt, doch kann man sagen: Immer hebt sich noch als scheinbare klinische Einheit der alte Morbus sacer hervor, die unheimliche Krankheit mit ihren unberechenbaren, anscheinend nicht provozierten Krampfanfällen, der Charakterveränderung ins Reizbare und Aggressive und der progressiven Herabsetzung aller geistigen Leistungen. Aber an allen Enden zerflattert dies Bild ins Unbestimmte. Die Anfälle, die brutal auftreten, mit Zungenbiß und Harnentleerung, gehäuft zum lebensbedrohlichen Status epilepticus, der schwere Selbstbeschädigung herbeiführt, können sich doch ermäßigen zu kurzen Absenzen, zu bloßen rasch vorübergehenden Schwindelzuständen, können sich ersetzen durch kurze Zeiten, in denen der Kranke, wie unter der Herrschaft des Unbewußten, etwas ihm Fremdartiges tut. Sonst in unfaßbarer Weise rein körperlich bedingt, können sie doch ihre erste Entstehung einem rein seelischen Einfluß (Schreck) verdankt haben oder weiterhin auf seelische Erregungen reagieren. So charakteristisch die intellektuelle Herabsetzung für die übergroße Mehrzahl der Fälle sein mag, so ist doch wenigstens ein Fall bekannt, in dem das Leiden intellektuelle Höchstleistung nicht zu stören vermochte (Helmholtz). (Andere Fälle, von denen das gleiche behauptet wurde, sind unsicher oder unterliegen denselben Bedenken wie Dostojewski selbst.) Die Personen, die von der Epilepsie befallen sind, können den Eindruck von Stumpfheit, behinderter Entwicklung machen, wie doch das Leiden oft greifbarste Idiotie und größte Hirndefekte begleitet, wenn auch nicht als notwendiger Bestandteil des Krankheitsbildes; aber diese Anfälle finden sich mit allen ihren Variationen auch bei anderen Personen vor, die eine volle seelische Entwicklung und eher übergroße, meist ungenügend beherrschte Affektivität bekunden. Kein Wunder, daß man es unter diesen Umständen für unmöglich findet, die Einheit einer klinischen Affektion »Epilepsie« festzuhalten. Was in der Gleichartigkeit der geäußerten Symptome zum Vorschein kommt, scheint eine funktionelle Auffassung zu fordern, als ob ein Mechanismus der abnormen Triebabfuhr organisch vorgebildet wäre, der unter ganz verschiedenen Verhältnissen in Anspruch genommen wird, sowohl bei Störungen der Gehirntätigkeit durch schwere gewebliche und toxische Erkrankung als auch bei unzulänglicher Beherrschung der seelischen Ökonomie, krisenhaftem Betrieb der in der Seele wirkenden Energie. Hinter dieser Zweiteilung ahnt man die Identität des zugrunde liegenden Mechanismus der Triebabfuhr. Derselbe kann auch den Sexualvorgängen, die im Grunde toxisch verursacht sind, nicht fernestehen; schon die ältesten Ärzte nannten den Koitus eine kleine Epilepsie, erkannten also im sexuellen Akt die Milderung und Adaptierung der epileptischen Reizabfuhr.
Die »epileptische Reaktion«, wie man dies Gemeinsame nennen kann, stellt sich ohne Zweifel auch der Neurose zur Verfügung, deren Wesen darin besteht, Erregungsmassen, mit denen sie psychisch nicht fertig wird, auf somatischem Wege zu erledigen. Der epileptische Anfall wird so ein Symptom der Hysterie und von ihr adaptiert und modifiziert, ähnlich wie vom normalen Sexualablauf. Man hat also ganz recht, eine organische von einer »affektiven« Epilepsie zu unterscheiden. Die praktische Bedeutung ist die: wer die eine hat, ist ein Gehirnkranker, wer die andere hat, ein Neurotiker. Im ersteren Fall unterliegt das Seelenleben einer ihm fremden Störung von außen, im anderen ist die Störung ein Ausdruck des Seelenlebens selbst.
Es ist überaus wahrscheinlich, daß Dostojewskis Epilepsie von der zweiten Art ist. Strenge erweisen kann man es nicht, man müßte denn imstande sein, das erste Auftreten und die späteren Schwankungen der Anfälle in den Zusammenhang seines seelischen Lebens einzureihen, und dafür weiß man zu wenig. Die Beschreibungen der Anfälle selbst lehren nichts, die Auskünfte über Beziehungen zwischen Anfällen und Erlebnissen sind mangelhaft und oft widersprechend. Am wahrscheinlichsten ist die Annahme, daß die Anfälle weit in Dostojewskis Kindheit zurückgehen, daß sie zuerst durch mildere Symptome vertreten waren und erst nach dem erschütternden Erlebnis im achtzehnten Jahr, nach der Ermordung des Vaters, die epileptische Form annahmen [Fußnote]Vgl. hiezu Rene Fülöp-Miller (1924). Besonderes Interesse erweckt die Mitteilung, daß sich in des Dichters Kindheit »etwas Furchtbares, Unvergeßliches und Qualvolles« ereignet habe, auf das die ersten Anzeichen seines Leidens zurückzuführen seien (Suworin in einem Artikel der Nowoje Wremja, 1881, nach dem Zitat in der Einleitung zu Fülöp-Miller und Eckstein, 1925, XLV). Ferner Orest Miller (1921, 140): »Es gibt über die Krankheit Fjodor Michailowitschs allerdings noch eine besondere Aussage, die sich auf seine früheste Jugend bezieht und die Krankheit mit einem tragischen Fall in dem Familienleben der Eltern Dostojewskis in Verbindung bringt. Doch obgleich mir diese Aussage von einem Menschen, der Fjodor Michailowitsch sehr nahestand, mündlich mitgeteilt worden ist, kann ich mich nicht entschließen, da ich von keiner Seite eine Bestätigung dieses Gerüchts erhalten habe, die erwähnte Angabe hier ausführlich und genau wiederzugeben.« Biographik und Neurosenforschung können dieser Diskretion nicht zu Dank verpflichtet sein.. Es wäre sehr passend, wenn sich bewahrheitete, daß sie während der Strafzeit in Sibirien völlig sistiert hätten, aber andere Angaben widersprechen dem [Fußnote]Die meisten Angaben, darunter Dostojewskis eigene Auskunft, behaupten vielmehr, daß die Krankheit erst während der sibirischen Strafzeit ihren definitiven, epileptischen Charakter angenommen habe. Leider hat man Grund, den autobiographischen Mitteilungen der Neurotiker zu mißtrauen. Die Erfahrung zeigt, daß ihre Erinnerung Verfälschungen unternimmt, die dazu bestimmt sind, einen unliebsamen Kausalzusammenhang zu zerreißen. Doch scheint es gesichert, daß der Aufenthalt im sibirischen Kerker auch den Krankheitszustand Dostojewskis eingreifend verändert hat. Vgl. hiezu: Fülöp-Miller (1924, 1186).. Die unverkennbare Beziehung zwischen der Vatertötung in den Brüdern Karamasoff und dem Schicksal von Dostojewskis Vater ist mehr als einem Biographen aufgefallen und hat sie zu einem Hinweis auf eine »gewisse moderne psychologische Richtung« veranlaßt. Die psychoanalytische Betrachtung, denn diese ist gemeint, ist versucht, in diesem Ereignis das schwerste Trauma und in Dostojewskis Reaktion darauf den Angelpunkt seiner Neurose zu erkennen.
Wenn ich es aber unternehme, diese Aufstellung psychoanalytisch zu begründen, muß ich befürchten, allen denen unverständlich zu bleiben, die mit den Ausdrucksweisen und Lehren der Psychoanalyse nicht vertraut sind.
Wir haben einen gesicherten Ausgangspunkt. Wir kennen den Sinn der ersten Anfälle Dostojewskis in seinen jungen Jahren lange vor dem Auftreten der »Epilepsie«. Diese Anfälle hatten Todesbedeutung, sie wurden von Todesangst eingeleitet und bestanden in lethargischen Schlafzuständen. Als plötzliche, grundlose Schwermut kam sie (die Krankheit) zuerst über ihn, da er noch ein Knabe war; ein Gefühl, so erzählte er später seinem Freunde Solowjoff, als ob er sogleich sterben müßte; und tatsächlich folgte dann auch ein dem wirklichen Tode vollkommen ähnlicher Zustand ... Sein Bruder Andree hat berichtet, daß Fedor schon in jungen Jahren vor dem Einschlafen Zettelchen hinzulegen pflegte, er fürchte in der Nacht in den scheintodähnlichen Schlaf zu verfallen und bitte darum, man möge ihn erst nach fünf Tagen beerdigen lassen. (Fülöp-Miller und Eckstein, 1925, LX.)
Wir kennen den Sinn und die Absicht solcher Todesanfälle. Sie bedeuten eine Identifizierung mit einem Toten, einer Person, die wirklich gestorben ist oder die noch lebt und der man den Tod wünscht. Der letztere Fall ist der bedeutsamere. Der Anfall hat dann den Wert einer Bestrafung. Man hat einen anderen tot gewünscht, nun ist man dieser andere und ist selbst tot. Hier setzt die psychoanalytische Lehre die Behauptung ein, daß dieser andere für den Knaben in der Regel der Vater ist, der –; hysterisch genannte –; Anfall also eine Selbstbestrafung für den Todeswunsch gegen den gehaßten Vater.
Der Vatermord ist nach bekannter Auffassung das Haupt- und Urverbrechen der Menschheit wie des einzelnen [Fußnote]Siehe des Verfassers Totem und Tabu (1912–;13).. Er ist jedenfalls die Hauptquelle des Schuldgefühls, wir wissen nicht, ob die einzige; die Untersuchungen konnten den seelischen Ursprung von Schuld und Sühnebedürfnis noch nicht sicherstellen. Er braucht aber nicht die einzige zu sein. Die psychologische Situation ist kompliziert und bedarf einer Erläuterung. Das Verhältnis des Knaben zum Vater ist ein, wie wir sagen, ambivalentes. Außer dem Haß, der den Vater als Rivalen beseitigen möchte, ist regelmäßig ein Maß von Zärtlichkeit für ihn vorhanden. Beide Einstellungen treten zur Vateridentifizierung zusammen, man möchte an Stelle des Vaters sein, weil man ihn bewundert, so sein möchte wie er und weil man ihn wegschaffen will. Diese ganze Entwicklung stößt nun auf ein mächtiges Hindernis. In einem gewissen Moment lernt das Kind verstehen, daß der Versuch, den Vater als Rivalen zu beseitigen, von ihm durch die Kastration gestraft werden würde. Aus Kastrationsangst, also im Interesse der Bewahrung seiner Männlichkeit, gibt es also den Wunsch nach dem Besitz der Mutter und der Beseitigung des Vaters auf. Soweit er im Unbewußten erhalten bleibt, bildet er die Grundlage des Schuldgefühls. Wir glauben hierin normale Vorgänge beschrieben zu haben, das normale Schicksal des sogenannten Ödipuskomplexes; eine wichtige Ergänzung haben wir allerdings noch nachzutragen.
Eine weitere Komplikation stellt sich her, wenn beim Kinde jener konstitutionelle Faktor, den wir die Bisexualität heißen, stärker ausgebildet ist. Dann wird unter der Bedrohung der Männlichkeit durch die Kastration die Neigung gekräftigt, nach der Richtung der Weiblichkeit auszuweichen, sich vielmehr an die Stelle der Mutter zu setzen und ihre Rolle als Liebesobjekt beim Vater zu übernehmen. Allein die Kastrationsangst macht auch diese Lösung unmöglich. Man versteht, daß man auch die Kastration auf sich nehmen muß, wenn man vom Vater wie ein Weib geliebt werden will. So verfallen beide Regungen, Vaterhaß wie Vaterverliebtheit, der Verdrängung. Ein gewisser psychologischer Unterschied besteht darin, daß der Vaterhaß aufgegeben wird infolge der Angst vor einer äußeren Gefahr (der Kastration); die Vaterverliebtheit aber wird als innere Triebgefahr behandelt, die doch im Grunde wieder auf die nämliche äußere Gefahr zurückgeht.
Was den Vaterhaß unannehmbar macht, ist die Angst vor dem Vater; die Kastration ist schrecklich, sowohl als Strafe wie auch als Preis der Liebe. Von den beiden Faktoren, die den Vaterhaß verdrängen, ist der erste, die direkte Straf- und Kastrationsangst, der normale zu nennen, die pathogene Verstärkung scheint erst durch den anderen Faktor, die Angst vor der femininen Einstellung, hinzuzukommen. Eine stark bisexuelle Anlage wird so zu einer der Bedingungen oder Bekräftigungen der Neurose. Eine solche ist für Dostojewski sicherlich anzunehmen und zeigt sich in existenzmöglicher Form (latente Homosexualität) in der Bedeutung von Männerfreundschaften für sein Leben, in seinem sonderbar zärtlichen Verhalten gegen Liebesrivalen und in seinem ausgezeichneten Verständnis für Situationen, die sich nur durch verdrängte Homosexualität erklären, wie viele Beispiele aus seinen Novellen zeigen.
Ich bedaure es, kann es aber nicht ändern, wenn diese Ausführungen über die Haß- und Liebeseinstellungen zum Vater und deren Wandlungen unter dem Einfluß der Kastrationsdrohung dem der Psychoanalyse unkundigen Leser unschmackhaft und unglaubwürdig erscheinen. Ich würde selbst erwarten, daß gerade der Kastrationskomplex der allgemeinsten Ablehnung sicher ist. Aber ich kann nur beteuern, daß die psychoanalytische Erfahrung gerade diese Verhältnisse über jeden Zweifel hinaushebt und uns in ihnen den Schlüssel zu jeder Neurose erkennen heißt. Den müssen wir also auch an der sogenannten Epilepsie unseres Dichters versuchen. So fremd sind aber unserem Bewußtsein die Dinge, von denen unser unbewußtes Seelenleben beherrscht wird. Mit dem bisher Mitgeteilten sind die Folgen der Verdrängung des Vaterhasses im Ödipuskomplex nicht erschöpft. Es kommt als neu hinzu, daß die Vateridentifizierung sich am Ende doch einen dauernden Platz im Ich erzwingt. Sie wird ins Ich aufgenommen, stellt sich aber darin als eine besondere Instanz dem anderen Inhalt des Ichs entgegen. Wir heißen sie dann das Über-Ich und schreiben ihr, der Erbin des Elterneinflusses, die wichtigsten Funktionen zu.
War der Vater hart, gewalttätig, grausam, so nimmt das Über-Ich diese Eigenschaften von ihm an, und in seiner Relation zum Ich stellt sich die Passivität wieder her, die gerade verdrängt werden sollte. Das Über-Ich ist sadistisch geworden, das Ich wird masochistisch, d. h. im Grunde weiblich passiv. Es entsteht ein großes Strafbedürfnis im Ich, das teils als solches dem Schicksal bereitliegt, teils in der Mißhandlung durch das Über-Ich (Schuldbewußtsein) Befriedigung findet. Jede Strafe ist ja im Grunde die Kastration und als solche Erfüllung der alten passiven Einstellung zum Vater. Auch das Schicksal ist endlich nur eine spätere Vaterprojektion.
Die normalen Vorgänge bei der Gewissensbildung müssen so ähnlich sein wie die hier dargestellten abnormen. Es ist uns noch nicht gelungen, die Abgrenzung beider herzustellen. Man bemerkt, daß hier der größte Anteil am Ausgang der passiven Komponente der verdrängten Weiblichkeit zugeschrieben wird. Außerdem muß als akzidenteller Faktor bedeutsam werden, ob der in jedem Fall gefürchtete Vater auch in der Realität besonders gewalttätig ist. Dies trifft für Dostojewski zu, und die Tatsache seines außerordentlichen Schuldgefühls wie seiner masochistischen Lebensführung werden wir auf eine besonders starke feminine Komponente zurückführen. So ist die Formel für Dostojewski: ein besonders stark bisexuell Veranlagter, der sich mit besonderer Intensität gegen die Abhängigkeit von einem besonders harten Vater wehren kann. Diesen Charakter der Bisexualität fügen wir zu den früher erkannten Komponenten seines Wesens hinzu. Das frühzeitige Symptom der »Todesanfälle« läßt sich also verstehen als eine vom Über-Ich strafweise zugelassene Vateridentifizierung des Ichs. Du hast den Vater töten wollen, um selbst der Vater zu sein. Nun bist du der Vater, aber der tote Vater; der gewöhnliche Mechanismus hysterischer Symptome. Und dabei: jetzt tötet dich der Vater. Für das Ich ist das Todessymptom Phantasiebefriedigung des männlichen Wunsches und gleichzeitig masochistische Befriedigung; für das Über-Ich Strafbefriedigung, also sadistische Befriedigung. Beide, Ich und Über-Ich, spielen die Vaterrolle weiter. –; Im ganzen hat sich die Relation zwischen Person und Vaterobjekt bei Erhaltung ihres Inhalts in eine Relation zwischen Ich und Über-Ich gewandelt, eine Neuinszenierung auf einer zweiten Bühne. Solche infantile Reaktionen aus dem Ödipuskomplex mögen erlöschen, wenn die Realität ihnen keine weitere Nahrung zuführt. Aber der Charakter des Vaters bleibt derselbe, nein, er verschlechtert sich mit den Jahren, und so bleibt auch der Vaterhaß Dostojewskis erhalten, sein Todeswunsch gegen diesen bösen Vater. Nun ist es gefährlich, wenn die Realität solche verdrängte Wünsche erfüllt. Die Phantasie ist Realität geworden, alle Abwehrmaßregeln werden nun verstärkt. Nun nehmen Dostojewskis Anfälle epileptischen Charakter an, sie bedeuten gewiß noch immer die strafweise Vateridentifizierung, sind aber fürchterlich geworden wie der schreckliche Tod des Vaters selbst. Welchen, insbesondere sexuellen, Inhalt sie dazu noch aufgenommen haben, entzieht sich dem Erraten.
Eines ist merkwürdig: in der Aura des Anfalles wird ein Moment der höchsten Seligkeit erlebt, der sehr wohl den Triumph und die Befreiung bei der Todesnachricht fixiert haben kann, auf den dann sofort die um so grausamere Strafe folgte. So eine Folge von Triumph und Trauer, Festfreude und Trauer, haben wir auch bei den Brüdern der Urhorde, die den Vater erschlugen, erraten und finden ihn in der Zeremonie der Totemmahlzeit wiederholt. Wenn es zutrifft, daß Dostojewski in Sibirien frei von Anfällen war, so bestätigte dies nur, daß seine Anfälle seine Strafe waren. Er brauchte sie nicht mehr, wenn er anders gestraft war. Allein dies ist unerweisbar. Eher erklärt diese Notwendigkeit der Strafe für Dostojewskis seelische Ökonomie, daß er ungebrochen durch diese Jahre des Elends und der Demütigungen hindurchging. Dostojewskis Verurteilung als politischer Verbrecher war ungerecht, er mußte das wissen, aber er akzeptierte die unverdiente Strafe von Väterchen Zar als Ersatz für die Strafe, die seine Sünde gegen den wirklichen Vater verdient hatte. Anstelle der Selbstbestrafung ließ er sich vom Stellvertreter des Vaters bestrafen. Man blickt hier ein Stück in die psychologische Rechtfertigung der von der Gesellschaft verhängten Strafen hinein. Es ist wahr, daß große Gruppen von Verbrechern nach der Strafe verlangen. Ihr Über-Ich fordert sie, erspart sich damit, sie selbst zu verhängen.
Wer den komplizierten Bedeutungswandel hysterischer Symptome kennt, wird verstehen, daß hier kein Versuch unternommen wird, den Sinn der Anfälle Dostojewskis über diesen Anfang hinaus zu ergründen [Fußnote]Siehe Totem und Tabu. Die beste Auskunft über den Sinn und Inhalt seiner Anfälle gibt Dostojewski selbst, wenn er seinem Freunde Strachoff mitteilt, daß seine Reizbarkeit und Depression nach einem epileptischen Anfall darin begründet sei, daß er sich als Verbrecher erscheine und das Gefühl nicht loswerden könne, eine ihm unbekannte Schuld auf sich geladen, eine große Missetat verübt zu haben, die ihn bedrücke (Fülöp-Miller, 1924, 1188). In solchen Anklagen erblickt die Psychoanalyse ein Stück Erkenntnis der »psychischen Realität« und bemüht sich, die unbekannte Schuld dem Bewußtsein bekannt zu machen.. Genug, daß man annehmen darf, ihr ursprünglicher Sinn sei hinter allen späteren Überlagerungen unverändert geblieben. Man darf sagen, Dostojewski ist niemals von der Gewissensbelastung durch die Absicht des Vatermordes frei geworden. Sie hat auch sein Verhalten zu den zwei anderen Gebieten bestimmt, auf denen die Vaterrelation maßgebend ist, zur staatlichen Autorität und zum Gottesglauben. Auf ersterem landete er bei der vollen Unterwerfung unter Väterchen Zar, der in der Wirklichkeit die Komödie der Tötung mit ihm einmal aufgeführt hatte, welche ihm sein Anfall so oft vorzuspielen pflegte. Die Buße gewann hier die Oberhand. Auf religiösem Gebiet blieb ihm mehr Freiheit, nach anscheinend guten Berichten soll er bis zum letzten Augenblick seines Lebens zwischen Gläubigkeit und Atheismus geschwankt haben. Sein großer Intellekt machte es ihm unmöglich, irgendeine der Denkschwierigkeiten, zu denen die Gläubigkeit führt, zu übersehen. In individueller Wiederholung einer welthistorischen Entwicklung hoffte er im Christusideal einen Ausweg und eine Schuldbefreiung zu finden, seine Leiden selbst als Anspruch auf eine Christusrolle zu verwenden. Wenn er es im ganzen nicht zur Freiheit brachte und Reaktionär wurde, so kam es daher, daß die allgemein menschliche Sohnesschuld, auf der sich das religiöse Gefühl aufbaut, bei ihm eine überindividuelle Stärke erreicht hatte und selbst seiner großen Intelligenz unüberwindlich blieb. Wir setzen uns hier dem Vorwurf aus, daß wir die Unparteilichkeit der Analyse aufgeben und Dostojewski Wertungen unterziehen, die nur vom Parteistandpunkt einer gewissen Weltanschauung berechtigt sind. Ein Konservativer würde die Partei des Großinquisitors nehmen und anders über Dostojewski urteilen. Der Vorwurf ist berechtigt, zu seiner Milderung kann man nur sagen, daß die Entscheidung Dostojewskis durch seine Denkhemmung infolge seiner Neurose bestimmt erscheint.
Es ist kaum ein Zufall, daß drei Meisterwerke der Literatur aller Zeiten das gleiche Thema, das der Vatertötung, behandeln: Der König Ödipus des Sophokles, der Hamlet Shakespeares und Dostojewskis Brüder Karamasoff. In allen dreien ist auch das Motiv der Tat, die sexuale Rivalität um das Weib, bloßgelegt. Am aufrichtigsten ist gewiß die Darstellung im Drama, das sich der griechischen Sage anschließt. Hier hat der Held noch selbst die Tat vollbracht. Aber ohne Milderung und Verhüllung ist die poetische Bearbeitung nicht möglich. Das nackte Geständnis der Absicht zur Vatertötung, wie wir es in der Analyse erzielen, scheint ohne analytische Vorbereitung unerträglich. Im griechischen Drama wird die unerläßliche Abschwächung in meisterhafter Weise bei Erhaltung des Tatbestandes dadurch herbeigeführt, daß das unbewußte Motiv des Helden als ein ihm fremder Schicksalszwang ins Reale projiziert wird. Der Held begeht die Tat unabsichtlich und scheinbar ohne Einfluß des Weibes, doch wird diesem Zusammenhang Rechnung getragen, indem er die Mutter Königin erst nach einer Wiederholung der Tat an dem Ungeheuer, das den Vater symbolisiert, erringen kann. Nachdem seine Schuld aufgedeckt, bewußtgemacht ist, erfolgt kein Versuch, sie mit Berufung auf die Hilfskonstruktion des Schicksalszwanges von sich abzuwälzen, sondern sie wird anerkannt und wie eine bewußte Vollschuld bestraft, was der Überlegung ungerecht erscheinen muß, aber psychologisch vollkommen korrekt ist. Die Darstellung des englischen Dramas ist indirekter, der Held hat die Handlung nicht selbst vollbracht, sondern ein anderer, für den sie keinen Vatermord bedeutet. Das anstößige Motiv der sexualen Rivalität beim Weibe braucht darum nicht verschleiert zu werden. Auch den Ödipuskomplex des Helden erblicken wir gleichsam im reflektierten Licht, indem wir die Wirkung der Tat des anderen auf ihn erfahren. Er sollte die Tat rächen, findet sich in merkwürdiger Weise unfähig dazu. Wir wissen, es ist sein Schuldgefühl, das ihn lähmt; in einer den neurotischen Vorgängen durchaus gemäßen Weise wird das Schuldgefühl auf die Wahrnehmung seiner Unzulänglichkeit zur Erfüllung dieser Aufgabe verschoben. Es ergeben sich Anzeichen, daß der Held diese Schuld als eine überindividuelle empfindet. Er verachtet die anderen nicht minder als sich. »Behandelt jeden Menschen nach seinem Verdienst, und wer ist vor Schlägen sicher?« In dieser Richtung geht der Roman des Russen einen Schritt weiter. Auch hier hat ein anderer den Mord vollbracht, aber einer, der zu dem Ermordeten in derselben Sohnesbeziehung stand wie der Held Dmitri, bei dem das Motiv der sexuellen Rivalität offen zugestanden wird, ein anderer Bruder, dem bemerkenswerterweise Dostojewski seine eigene Krankheit, die vermeintliche Epilepsie, angehängt hat, als ob er gestehen wollte, der Epileptiker, Neurotiker in mir ist ein Vatermörder. Und nun folgt in dem Plädoyer vor dem Gerichtshof der berühmte Spott auf die Psychologie, sie sei ein Stock mit zwei Enden. Eine großartige Verhüllung, denn man braucht sie nur umzukehren, um den tiefsten Sinn der Dostojewskischen Auffassung zu finden. Nicht die Psychologie verdient den Spott, sondern das gerichtliche Ermittlungsverfahren. Es ist ja gleichgültig, wer die Tat wirklich ausgeführt hat, für die Psychologie kommt es nur darauf an, wer sie in seinem Gefühl gewollt und, als sie geschehen, willkommen geheißen hat, und darum sind bis auf die Kontrastfigur des Aljoscha alle Brüder gleich schuldig, der triebhafte Genußmensch, der skeptische Zyniker und der epileptische Verbrecher. In den Brüdern Karamasoff findet sich eine für Dostojewski höchst bezeichnende Szene. Der Staretz hat im Gespräch mit Dmitri erkannt, daß er die Bereitschaft zum Vatermord in sich trägt, und wirft sich vor ihm nieder. Das kann nicht Ausdruck der Bewunderung sein, es muß heißen, daß der Heilige die Versuchung, den Mörder zu verachten oder zu verabscheuen, von sich weist und sich darum vor ihm demütigt. Dostojewskis Sympathie für den Verbrecher ist in der Tat schrankenlos, sie geht weit über das Mitleid hinaus, auf das der Unglückliche Anspruch hat, erinnert an die heilige Scheu, mit der das Altertum den Epileptiker und den Geistesgestörten betrachtet hat. Der Verbrecher ist ihm fast wie ein Erlöser, der die Schuld auf sich genommen hat, die sonst die anderen hätten tragen müssen. Man braucht nicht mehr zu morden, nachdem er bereits gemordet hat, aber man muß ihm dafür dankbar sein, sonst hätte man selbst morden müssen. Das ist nicht gütiges Mitleid allein, es ist Identifizierung auf Grund der gleichen mörderischen Impulse, eigentlich ein um ein Geringes verschobener Narzißmus. Der ethische Wert dieser Güte soll damit nicht bestritten werden. Vielleicht ist dies überhaupt der Mechanismus der gütigen Teilnahme am anderen Menschen, den man in dem extremen Falle des vom Schuldbewußtsein beherrschten Dichters besonders leicht durchschaut. Kein Zweifel, daß diese Identifizierungssympathie die Stoffwahl Dostojewskis entscheidend bestimmt hat. Er hat aber zuerst den gemeinen Verbrecher –; aus Eigensucht –;, den politischen und religiösen Verbrecher behandelt, ehe er am Ende seines Lebens zum Urverbrecher, zum Vatermörder, zurückkehrte und an ihm sein poetisches Geständnis ablegte.
Die Veröffentlichung seines Nachlasses und der Tagebücher seiner Frau hat eine Episode seines Lebens grell beleuchtet, die Zeit, da Dostojewski in Deutschland von der Spielsucht besessen war. (Fülöp-Miller und Eckstein, 1925.) Ein unverkennbarer Anfall von pathologischer Leidenschaft, der auch von keiner Seite anders gewertet werden konnte. Es fehlte nicht an Rationalisierungen für dies merkwürdige und unwürdige Tun. Das Schuldgefühl hatte sich, wie nicht selten bei Neurotikern, eine greifbare Vertretung durch eine Schuldenlast geschaffen und Dostojewski konnte vorschützen, daß er sich durch den Spielgewinn die Möglichkeit erwerben wolle, nach Rußland zurückzukommen, ohne von seinen Gläubigern eingesperrt zu werden. Aber das war nur Vorwand, Dostojewski war scharfsinnig genug, es zu erkennen, und ehrlich genug, es zu gestehen. Er wußte, die Hauptsache war das Spiel an und für sich, le jeu pour le jeu[Fußnote]»Die Hauptsache ist das Spiel selbst«, schrieb er in einem seiner Briefe. »Ich schwöre Ihnen, es handelt sich dabei nicht um Habgier, obwohl ich ja freilich vor allem Geld nötig hatte.«. Alle Einzelheiten seines triebhaft unsinnigen Benehmens beweisen dies und noch etwas anderes. Er ruhte nie, ehe er nicht alles verloren hatte. Das Spiel war ihm auch ein Weg zur Selbstbestrafung. Er hatte ungezählte Male der jungen Frau sein Wort oder sein Ehrenwort gegeben, nicht mehr zu spielen oder an diesem Tag nicht mehr zu spielen, und er brach es, wie sie sagt, fast immer. Hatte er durch Verluste sich und sie ins äußerste Elend gebracht, so zog er daraus eine zweite pathologische Befriedigung. Er konnte sich vor ihr beschimpfen, demütigen, sie auffordern, ihn zu verachten, zu bedauern, daß sie ihn alten Sünder geheiratet, und nach dieser Entlastung des Gewissens ging dies Spiel am nächsten Tag weiter. Und die junge Frau gewöhnte sich an diesen Zyklus, weil sie bemerkt hatte, daß dasjenige, von dem in Wirklichkeit allein die Rettung zu erwarten war, die literarische Produktion, nie besser vor sich ging, als nachdem sie alles verloren und ihre letzte Habe verpfändet hatten. Sie verstand den Zusammenhang natürlich nicht. Wenn sein Schuldgefühl durch die Bestrafungen befriedigt war, die er selbst über sich verhängt hatte, dann ließ seine Arbeitshemmung nach, dann gestattete er sich, einige Schritte auf dem Wege zum Erfolg zu tun [Fußnote]Immer blieb er so lange am Spieltisch, bis er alles verloren hatte, bis er vollständig vernichtet dastand. Nur wenn sich das Unheil ganz erfüllt hatte, wich endlich der Dämon von seiner Seele und überließ dem schöpferischen Genius den Platz. (Fülöp-Miller und Eckstein, 1925, LXXXVI.).
Welches Stück längst verschütteten Kinderlebens sich im Spielzwang Wiederholung erzwingt, läßt sich unschwer in Anlehnung an eine Novelle eines jüngeren Dichters erraten. Stefan Zweig, der übrigens Dostojewski selbst eine Studie gewidmet hat ( Drei Meister), erzählt in seiner Sammlung von drei Novellen Die Verwirrung der Gefühle eine Geschichte, die er ›Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau‹ betitelt. Das kleine Meisterwerk will angeblich nur dartun, ein wie unverantwortliches Wesen das Weib ist, zu welchen es selbst überraschenden Überschreitungen es durch einen unerwarteten Lebenseindruck gedrängt werden kann. Allein die Novelle sagt weit mehr, stellt ohne solche entschuldigende Tendenz etwas ganz anderes, allgemein Menschliches oder vielmehr Männliches dar, wenn man sie einer analytischen Deutung unterzieht, und eine solche Deutung ist so aufdringlich nahegelegt, daß man sie nicht abweisen kann. Es ist bezeichnend für die Natur des künstlerischen Schaffens, daß der mir befreundete Dichter auf Befragen versichern konnte, daß die ihm mitgeteilte Deutung seinem Wissen und seiner Absicht völlig fremd gewesen sei, obwohl in die Erzählung manche Details eingeflochten sind, die geradezu berechnet scheinen, auf die geheime Spur hinzuweisen. In der Novelle Zweigs erzählt eine vornehme ältere Dame dem Dichter ein Erlebnis, das sie vor mehr als zwanzig Jahren betroffen hat. Früh verwitwet, Mutter zweier Söhne, die sie nicht mehr brauchten, von allen Lebenserwartungen abgewendet, geriet sie in ihrem zweiundvierzigsten Jahr auf einer ihrer zwecklosen Reisen in den Spielsaal des Kasinos von Monaco und wurde unter all den merkwürdigen Eindrücken des Orts bald von dem Anblick zweier Hände fasziniert, die alle Empfindungen des unglücklichen Spielers mit erschütternder Aufrichtigkeit und Intensität zu verraten schienen. Diese Hände gehörten einem schönen Jüngling –; der Dichter gibt ihm wie absichtslos das Alter des ersten Sohnes der Zuschauerin –;, der, nachdem er alles verloren, in tiefster Verzweiflung den Saal verläßt, voraussichtlich um im Park sein hoffnungsloses Leben zu beenden. Eine unerklärliche Sympathie zwingt sie, ihm zu folgen und alle Versuche zu seiner Rettung zu unternehmen. Er hält sie für eine der am Orte so zahlreichen zudringlichen Frauen und will sie abschütteln, aber sie bleibt bei ihm und sieht sich auf die natürlichste Weise genötigt, seine Unterkunft im Hotel und endlich sein Bett zu teilen. Nach dieser improvisierten Liebesnacht läßt sie sich von dem anscheinend beruhigten Jüngling unter den feierlichsten Umständen die Versicherung geben, daß er nie wieder spielen wird, stattet ihn mit Geld für die Heimreise aus und verspricht, ihn vor Abgang des Zuges auf dem Bahnhof zu treffen. Dann aber erwacht in ihr eine große Zärtlichkeit für ihn, sie will alles opfern, um ihn zu behalten, beschließt, mit ihm zu reisen, anstatt von ihm Abschied zu nehmen. Widrige Zufälligkeiten halten sie auf, so daß sie den Zug versäumt; in der Sehnsucht nach dem Verschwundenen sucht sie den Spielsaal wieder auf und findet dort entsetzt die Hände wieder, die zuerst ihre Sympathie entzündeten; der Pflichtvergessene ist zum Spiel zurückgekehrt. Sie mahnt ihn an sein Versprechen, aber von der Leidenschaft besessen, schilt er sie Spielverderberin, heißt sie gehen und wirft ihr das Geld hin, mit dem sie ihn loskaufen wollte. In tiefster Beschämung muß sie fliehen und kann später in Erfahrung bringen, daß es ihr nicht gelungen war, ihn vor dem Selbstmord zu bewahren.
Diese glänzend erzählte, lückenlos motivierte Geschichte ist gewiß für sich allein existenzfähig und einer großen Wirkung auf den Leser sicher. Die Analyse lehrt aber, daß ihre Erfindung auf dem Urgrund einer Wunschphantasie der Pubertätszeit ruht, die bei manchen Personen selbst als bewußt erinnert wird. Die Phantasie lautet, die Mutter möge selbst den Jüngling ins sexuelle Leben einführen, um ihn vor den gefürchteten Schädlichkeiten der Onanie zu retten. Die so häufigen Erlösungsdichtungen haben denselben Ursprung. Das »Laster« der Onanie ist durch das der Spielsucht ersetzt, die Betonung der leidenschaftlichen Tätigkeit der Hände ist für diese Ableitung verräterisch. Wirklich ist die Spielwut ein Äquivalent des alten Onaniezwanges, mit keinem anderen Wort als »Spielen« ist in der Kinderstube die Betätigung der Hände am Genitale benannt worden. Die Unwiderstehlichkeit der Versuchung, die heiligen und doch nie gehaltenen Vorsätze, es nie wieder zu tun, die betäubende Lust und das böse Gewissen, man richte sich zugrunde (Selbstmord), sind bei der Ersetzung unverändert erhalten geblieben. Die Zweigsche Novelle wird zwar von der Mutter, nicht vom Sohne, erzählt. Es muß dem Sohne schmeicheln zu denken: wenn die Mutter wüßte, in welche Gefahren mich die Onanie bringt, würde sie mich gewiß durch die Gestattung aller Zärtlichkeiten an ihrem eigenen Leib vor ihnen retten. Die Gleichstellung der Mutter mit der Dirne, die der Jüngling in der Zweigschen Novelle vollzieht, gehört in den Zusammenhang derselben Phantasie. Sie macht die Unzugängliche leicht erreichbar; das böse Gewissen, das diese Phantasie begleitet, setzt den schlechten Ausgang der Dichtung durch. Es ist auch interessant zu bemerken, wie die der Novelle vom Dichter gegebene Fassade deren analytischen Sinn zu verhüllen sucht. Denn es ist sehr bestreitbar, daß das Liebesleben der Frau von plötzlichen und rätselhaften Impulsen beherrscht wird. Die Analyse deckt vielmehr eine zureichende Motivierung für das überraschende Benehmen der bis dahin von der Liebe abgewandten Frau auf. Dem Andenken ihres verlorenen Ehemannes getreu, hat sie sich gegen alle ihm ähnlichen Ansprüche gewappnet, aber –; darin behält die Phantasie des Sohnes recht –; einer ihr ganz unbewußten Liebesübertragung auf den Sohn war sie als Mutter nicht entgangen, und an dieser unbewachten Stelle kann das Schicksal sie packen. Wenn die Spielsucht mit ihren erfolglosen Abgewöhnungskämpfen und ihren Gelegenheiten zur Selbstbestrafung eine Wiederholung des Onaniezwanges ist, so werden wir nicht verwundert sein, daß sie sich im Leben Dostojewskis einen so großen Raum erobert hat. Wir finden doch keinen Fall von schwerer Neurose, in dem die autoerotische Befriedigung der Frühzeit und der Pubertätszeit nicht ihre Rolle gespielt hätte, und die Beziehungen zwischen den Bemühungen, sie zu unterdrücken, und der Angst vor dem Vater sind zu sehr bekannt, um mehr als einer Erwähnung zu bedürfen [Fußnote]Die meisten der hier vorgetragenen Ansichten sind auch in der 1923 erschienenen trefflichen Schrift von Jolan Neufeld, Dostojewski, Skizze zu seiner Psychoanalyse (Imago-Bücher, Nr. IV), enthalten..
“Ein Kind wird geschlagen” (1919)
(Beitrag zur Kenntnis der Entstehung sexueller Perversionen)
I
Die Phantasievorstellung: »ein Kind wird geschlagen« wird mit überraschender Häufigkeit von Personen eingestanden, die wegen einer Hysterie oder einer Zwangsneurose die analytische Behandlung aufgesucht haben. Es ist recht wahrscheinlich, daß sie noch öfter bei anderen vorkommt, die nicht durch manifeste Erkrankung zu diesem Entschluß genötigt worden sind.
An diese Phantasie sind Lustgefühle geknüpft, wegen welcher sie ungezählte Male reproduziert worden ist oder noch immer reproduziert wird. Auf der Höhe der vorgestellten Situation setzt sich fast regelmäßig eine onanistische Befriedigung (an den Genitalien also) durch, anfangs mit Willen der Person, aber ebenso späterhin mit Zwangscharakter gegen ihr Widerstreben.
Das Eingeständnis dieser Phantasie erfolgt nur zögernd, die Erinnerung an ihr erstes Auftreten ist unsicher, der analytischen Behandlung des Gegenstandes tritt ein unzweideutiger Widerstand entgegen, Schämen und Schuldbewußtsein regen sich hiebei vielleicht kräftiger als bei ähnlichen Mitteilungen über die erinnerten Anfänge des Sexuallebens.
Es läßt sich endlich feststellen, daß die ersten Phantasien dieser Art sehr frühzeitig gepflegt worden sind, gewiß vor dem Schulbesuch, schon im fünften und sechsten Jahr. Wenn das Kind in der Schule mitangesehen hat, wie andere Kinder vom Lehrer geschlagen wurden, so hat dies Erleben die Phantasien wieder hervorgerufen, wenn sie eingeschlafen waren, hat sie verstärkt, wenn sie noch bestanden, und ihren Inhalt in merklicher Weise modifiziert. Es wurden von da an »unbestimmt viele« Kinder geschlagen. Der Einfluß der Schule war so deutlich, daß die betreffenden Patienten zunächst versucht waren, ihre Schlagephantasien ausschließlich auf diese Eindrücke der Schulzeit, nach dem sechsten Jahr, zurückzuführen. Allein dies ließ sich niemals halten; sie waren schon vorher vorhanden gewesen.
Hörte das Schlagen der Kinder in höheren Schulklassen auf, so wurde dessen Einfluß durch die Einwirkung der bald zu Bedeutung kommenden Lektüre mehr als nur ersetzt. In dem Milieu meiner Patienten waren es fast immer die nämlichen, der Jugend zugänglichen Bücher, aus deren Inhalt sich die Schlagephantasien neue Anregungen holten: die sogenannte Bibliothèque rose, Onkel Toms Hütte und dergleichen. Im Wetteifer mit diesen Dichtungen begann die eigene Phantasietätigkeit des Kindes, einen Reichtum von Situationen und Institutionen zu erfinden, in denen Kinder wegen ihrer Schlimmheit und ihrer Unarten geschlagen oder in anderer Weise bestraft und gezüchtigt werden.
Da die Phantasievorstellung, ein Kind wird geschlagen, regelmäßig mit hoher Lust besetzt war und in einen Akt lustvoller autoerotischer Befriedigung auslief, könnte man erwarten, daß auch das Zuschauen, wie ein anderes Kind in der Schule geschlagen wurde, eine Quelle ähnlichen Genusses gewesen sei. Allein dies war nie der Fall. Das Miterleben realer Schlageszenen in der Schule rief beim zuschauenden Kinde ein eigentümlich aufgeregtes, wahrscheinlich gemischtes Gefühl hervor, an dem die Ablehnung einen großen Anteil hatte. In einigen Fällen wurde das reale Erleben der Schlageszenen als unerträglich empfunden. Übrigens wurde auch in den raffinierten Phantasien späterer Jahre an der Bedingung festgehalten, daß den gezüchtigten Kindern kein ernsthafter Schaden zugefügt werde.
Man mußte die Frage aufwerfen, welche Beziehung zwischen der Bedeutung der Schlagephantasien und der Rolle bestehen möge, die reale körperliche Züchtigungen in der häuslichen Erziehung des Kindes gespielt hätten. Die nächstliegende Vermutung, es werde sich hiebei eine umgekehrte Relation ergeben, ließ sich infolge der Einseitigkeit des Materials nicht erweisen. Die Personen, die den Stoff für diese Analysen hergaben, waren in ihrer Kindheit sehr selten geschlagen, waren jedenfalls nicht mit Hilfe von Prügeln erzogen worden. Jedes dieser Kinder hatte natürlich doch irgendeinmal die überlegene Körperkraft seiner Eltern oder Erzieher zu spüren bekommen; daß es an Schlägereien zwischen den Kindern selbst in keiner Kinderstube gefehlt, bedarf keiner ausdrücklichen Hervorhebung.
Bei jenen frühzeitigen und simplen Phantasien, die nicht offenkundig auf den Einfluß von Schuleindrücken oder Szenen aus der Lektüre hinwiesen, wollte die Forschung gern mehr erfahren. Wer war das geschlagene Kind? Das phantasierende selbst oder ein fremdes? War es immer dasselbe Kind oder beliebig oft ein anderes? Wer war es, der das Kind schlug? Ein Erwachsener? Und wer dann? Oder phantasierte das Kind, daß es selbst ein anderes schlüge? Auf alle diese Fragen kam keine aufklärende Auskunft, immer nur die eine scheue Antwort: »Ich weiß nichts mehr darüber; ein Kind wird geschlagen.«
Erkundigungen nach dem Geschlecht des geschlagenen Kindes hatten mehr Erfolg, brachten aber auch kein Verständnis. Manchmal wurde geantwortet: »Immer nur Buben«, oder: »Nur Mädel«; öfter hieß es: »Das weiß ich nicht«, oder: »Das ist gleichgültig.« Das, worauf es dem Fragenden ankam, eine konstante Beziehung zwischen dem Geschlecht des phantasierenden und dem des geschlagenen Kindes, stellte sich niemals heraus. Gelegentlich einmal kam noch ein charakteristisches Detail aus dem Inhalt der Phantasie zum Vorschein: »Das kleine Kind wird auf den nackten Popo geschlagen.«
Unter diesen Umständen konnte man vorerst nicht einmal entscheiden, ob die an der Schlagephantasie haftende Lust als eine sadistische oder als eine masochistische zu bezeichnen sei.
II
Die Auffassung einer solchen, im frühen Kindesalter vielleicht bei zufälligen Anlässen auftauchenden und zur autoerotischen Befriedigung festgehaltenen Phantasie kann nach unseren bisherigen Einsichten nur lauten, daß es sich hiebei um einen primären Zug von Perversion handle. Eine der Komponenten der Sexualfunktion sei den anderen in der Entwicklung vorangeeilt, habe sich vorzeitig selbständig gemacht, sich fixiert und dadurch den späteren Entwicklungsvorgängen entzogen, damit aber ein Zeugnis für eine besondere, anormale Konstitution der Person gegeben. Wir wissen, daß eine solche infantile Perversion nicht fürs Leben zu verbleiben braucht, sie kann noch später der Verdrängung verfallen, durch eine Reaktionsbildung ersetzt oder durch eine Sublimierung umgewandelt werden. (Vielleicht ist es aber so, daß die Sublimierung aus einem besonderen Prozeß hervorgeht, welcher durch die Verdrängung hintangehalten würde.) Wenn aber diese Vorgänge ausbleiben, dann erhält sich die Perversion im reifen Leben, und wo wir beim Erwachsenen eine sexuelle Abirrung –; Perversion, Fetischismus, Inversion –; vorfinden, da erwarten wir mit Recht, ein solches fixierendes Ereignis der Kinderzeit durch anamnestische Erforschung aufzudecken. Ja lange vor der Zeit der Psychoanalyse haben Beobachter wie Binet die sonderbaren sexuellen Abirrungen der Reifezeit auf solche Eindrücke, gerade der nämlichen Kinderjahre von fünf oder sechs an, zurückführen können. Man war hiebei allerdings auf eine Schranke unseres Verständnisses gestoßen, denn den fixierenden Eindrücken fehlte jede traumatische Kraft, sie waren zumeist banal und für andere Individuen nicht aufregend; man konnte nicht sagen, warum sich das Sexualstreben gerade an sie fixiert hatte. Aber man konnte ihre Bedeutung darin suchen, daß sie eben der voreiligen und sprungbereiten Sexualkomponente den, wenn auch zufälligen Anlaß zur Anheftung geboten hatten, und man mußte ja darauf vorbereitet sein, daß die Kette der Kausalverknüpfung irgendwo ein vorläufiges Ende finden werde. Gerade die mitgebrachte Konstitution schien allen Anforderungen an einen solchen Haltepunkt zu entsprechen.
Wenn die frühzeitig losgerissene Sexualkomponente die sadistische ist, so bilden wir auf Grund anderswo gewonnener Einsicht die Erwartung, daß durch spätere Verdrängung derselben eine Disposition zur Zwangsneurose geschaffen werde. Man kann nicht sagen, daß dieser Erwartung durch das Ergebnis der Untersuchung widersprochen wird. Unter den sechs Fällen, auf deren eingehendem Studium diese kleine Mitteilung aufgebaut ist (vier Frauen, zwei Männer), befanden sich Fälle von Zwangsneurose, ein allerschwerster, lebenszerstörender, und ein mittelschwerer, der Beeinflussung gut zugänglicher, ferner ein dritter, der wenigstens einzelne deutliche Züge der Zwangsneurose aufwies. Ein vierter Fall war freilich eine glatte Hysterie mit Schmerzen und Hemmungen, und ein fünfter, der die Analyse bloß wegen Unschlüssigkeiten im Leben aufsuchte, wäre von grober klinischer Diagnostik überhaupt nicht klassifiziert oder als »Psychasthenie« abgetan worden. Man darf in dieser Statistik keine Enttäuschung erblicken, denn erstens wissen wir, daß nicht jegliche Disposition sich zur Affektion weiterentwickeln muß, und zweitens darf es uns genügen zu erklären, was vorhanden ist, und dürfen wir uns der Aufgabe, auch verstehen zu lassen, warum etwas nicht zustande gekommen ist, im allgemeinen entziehen.
So weit und nicht weiter würden uns unsere gegenwärtigen Einsichten ins Verständnis der Schlagephantasien eindringen lassen. Eine Ahnung, daß das Problem hiemit nicht erledigt ist, regt sich allerdings beim analysierenden Arzte, wenn er sich eingestehen muß, daß diese Phantasien meist abseits vom übrigen Inhalt der Neurose bleiben und keinen rechten Platz in deren Gefüge einnehmen; aber man pflegt, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, über solche Eindrücke gern hinwegzugehen.
III
Strenggenommen –; und warum sollte man dies nicht so streng als möglich nehmen? –; verdient die Anerkennung als korrekte Psychoanalyse nur die analytische Bemühung, der es gelungen ist, die Amnesie zu beheben, welche dem Erwachsenen die Kenntnis seines Kinderlebens vom Anfang an (das heißt etwa vom zweiten bis zum fünften Jahr) verhüllt. Man kann das unter Analytikern nicht laut genug sagen und nicht oft genug wiederholen. Die Motive, sich über diese Mahnung hinwegzusetzen, sind ja begreiflich. Man möchte brauchbare Erfolge in kürzerer Zeit und mit geringerer Mühe erzielen. Aber gegenwärtig ist die theoretische Erkenntnis noch ungleich wichtiger für jeden von uns als der therapeutische Erfolg, und wer die Kindheitsanalyse vernachlässigt, muß notwendig den folgenschwersten Irrtümern verfallen. Eine Unterschätzung des Einflusses späterer Erlebnisse wird durch diese Betonung der Wichtigkeit der frühesten nicht bedingt; aber die späteren Lebenseindrücke sprechen in der Analyse laut genug durch den Mund des Kranken, für das Anrecht der Kindheit muß erst der Arzt die Stimme erheben.
Die Kinderzeit zwischen zwei und vier oder fünf Jahren ist diejenige, in welcher die mitgebrachten libidinösen Faktoren von den Erlebnissen zuerst geweckt und an gewisse Komplexe gebunden werden. Die hier behandelten Schlagephantasien zeigen sich erst zu Ende oder nach Ablauf dieser Zeit. Es könnte also wohl sein, daß sie eine Vorgeschichte haben, eine Entwicklung durchmachen, einem Endausgang, nicht einer Anfangsäußerung entsprechen.
Diese Vermutung wird durch die Analyse bestätigt. Die konsequente Anwendung derselben lehrt, daß die Schlagephantasien eine gar nicht einfache Entwicklungsgeschichte haben, in deren Verlauf sich das meiste an ihnen mehr als einmal ändert: ihre Beziehung zur phantasierenden Person, ihr Objekt, Inhalt und ihre Bedeutung.
Zur leichteren Verfolgung dieser Wandlungen in den Schlagephantasien werde ich mir nun gestatten, meine Beschreibungen auf die weiblichen Personen einzuschränken, die ohnedies (vier gegen zwei) die Mehrheit meines Materials ausmachen. An die Schlagephantasien der Männer knüpft außerdem ein anderes Thema an, das ich in dieser Mitteilung beiseite lassen will. Ich werde mich dabei bemühen, nicht mehr zu schematisieren, als zur Darstellung eines durchschnittlichen Sachverhaltes unvermeidlich ist. Mag dann weitere Beobachtung auch eine größere Mannigfaltigkeit der Verhältnisse ergeben, so bin ich doch sicher, ein typisches Vorkommnis, und zwar nicht von seltener Art, erfaßt zu haben.
Die erste Phase der Schlagephantasien bei Mädchen also muß einer sehr frühen Kinderzeit angehören. Einiges an ihnen bleibt in merkwürdiger Weise unbestimmbar, als ob es gleichgültig wäre. Die kärgliche Auskunft, die man von den Patienten bei der ersten Mitteilung erhalten hat: »Ein Kind wird geschlagen«, erscheint für diese Phantasie gerechtfertigt. Allein anderes ist mit Sicherheit bestimmbar und dann allemal im gleichen Sinne. Das geschlagene Kind ist nämlich nie das phantasierende, regelmäßig ein anderes Kind, zumeist ein Geschwisterchen, wo ein solches vorhanden ist. Da dies Bruder oder Schwester sein kann, kann sich hier auch keine konstante Beziehung zwischen dem Geschlecht des phantasierenden und dem des geschlagenen Kindes ergeben. Die Phantasie ist also sicherlich keine masochistische; man möchte sie sadistisch nennen, allein man darf nicht außer acht lassen, daß das phantasierende Kind auch niemals selbst das schlagende ist. Wer in Wirklichkeit die schlagende Person ist, bleibt zunächst unklar. Es läßt sich nur feststellen: kein anderes Kind, sondern ein Erwachsener. Diese unbestimmte erwachsene Person wird dann späterhin klar und eindeutig als der Vater (des Mädchens) kenntlich.
Diese erste Phase der Schlagephantasie wird also voll wiedergegeben durch den Satz: » Der Vater schlägt das Kind.« Ich verrate viel von dem später aufzuzeigenden Inhalt, wenn ich anstatt dessen sage: »Der Vater schlägt das mir verhaßte Kind.« Man kann übrigens schwankend werden, ob man dieser Vorstufe der späteren Schlagephantasie auch schon den Charakter einer »Phantasie« zuerkennen soll. Es handelt sich vielleicht eher um Erinnerungen an solche Vorgänge, die man mitangesehen hat, an Wünsche, die bei verschiedenen Anlässen aufgetreten sind, aber diese Zweifel haben keine Wichtigkeit.
Zwischen dieser ersten und der nächsten Phase haben sich große Umwandlungen vollzogen. Die schlagende Person ist zwar die nämliche, die des Vaters, geblieben, aber das geschlagene Kind ist ein anderes geworden, es ist regelmäßig die des phantasierenden Kindes selbst, die Phantasie ist in hohem Grade lustbetont und hat sich mit einem bedeutsamen Inhalt erfüllt, dessen Ableitung uns später beschäftigen wird. Ihr Wortlaut ist jetzt also: » Ich werde vom Vater geschlagen.« Sie hat unzweifelhaft masochistischen Charakter.
Diese zweite Phase ist die wichtigste und folgenschwerste von allen. Aber man kann in gewissem Sinne von ihr sagen, sie habe niemals eine reale Existenz gehabt. Sie wird in keinem Falle erinnert, sie hat es nie zum Bewußtwerden gebracht. Sie ist eine Konstruktion der Analyse, aber darum nicht minder eine Notwendigkeit.
Die dritte Phase ähnelt wiederum der ersten. Sie hat den aus der Mitteilung der Patientin bekannten Wortlaut. Die schlagende Person ist niemals die des Vaters, sie wird entweder wie in der ersten Phase unbestimmt gelassen oder in typischer Weise durch einen Vatervertreter (Lehrer) besetzt. Die eigene Person des phantasierenden Kindes kommt in der Schlagephantasie nicht mehr zum Vorschein. Auf eindringliches Befragen äußern die Patienten nur: »Ich schaue wahrscheinlich zu.« Anstatt des einen geschlagenen Kindes sind jetzt meistens viele Kinder vorhanden. Überwiegend häufig sind es (in den Phantasien der Mädchen) Buben, die geschlagen werden, aber auch nicht individuell bekannte. Die ursprüngliche einfache und monotone Situation des Geschlagenwerdens kann die mannigfaltigsten Abänderungen und Ausschmückungen erfahren, das Schlagen selbst durch Strafen und Demütigungen anderer Art ersetzt werden. Der wesentliche Charakter aber, der auch die einfachsten Phantasien dieser Phase von denen der ersten unterscheidet und der die Beziehung zur mittleren Phase herstellt, ist der folgende: die Phantasie ist jetzt der Träger einer starken, unzweideutig sexuellen Erregung und vermittelt als solcher die onanistische Befriedigung. Gerade das ist aber das Rätselhafte; auf welchem Wege ist die nunmehr sadistische Phantasie, daß fremde und unbekannte Buben geschlagen werden, zu dem von da an dauernden Besitz der libidinösen Strebung des kleinen Mädchens gekommen?
Wir verhehlen uns auch nicht, daß Zusammenhang und Aufeinanderfolge der drei Phasen der Schlagephantasie wie alle ihre anderen Eigentümlichkeiten bisher ganz unverständlich geblieben sind.
IV
Führt man die Analyse durch jene frühen Zeiten, in die die Schlagephantasie verlegt und aus denen sie erinnert wird, so zeigt sie das Kind in die Erregungen seines Elternkomplexes verstrickt.
Das kleine Mädchen ist zärtlich an den Vater fixiert, der wahrscheinlich alles getan hat, um seine Liebe zu gewinnen, und legt dabei den Keim zu einer Haß- und Konkurrenzeinstellung gegen die Mutter, die neben einer Strömung von zärtlicher Anhänglichkeit bestehen bleibt und der vorbehalten sein kann, mit den Jahren immer stärker und deutlicher bewußt zu werden oder den Anstoß zu einer übergroßen reaktiven Liebesbindung an sie zu geben. Aber nicht an das Verhältnis zur Mutter knüpft die Schlagephantasie an. Es gibt in der Kinderstube noch andere Kinder, um ganz wenige Jahre älter oder jünger, die man aus allen anderen Gründen, hauptsächlich aber darum nicht mag, weil man die Liebe der Eltern mit ihnen teilen soll, und die man darum mit der ganzen wilden Energie, die dem Gefühlsleben dieser Jahre eigen ist, von sich stößt. Ist es ein jüngeres Geschwisterchen (wie in drei von meinen vier Fällen), so verachtet man es, außerdem daß man es haßt, und muß doch zusehen, wie es jenen Anteil von Zärtlichkeit an sich zieht, den die verblendeten Eltern jedesmal für das Jüngste bereit haben. Man versteht bald, daß Geschlagenwerden, auch wenn es nicht sehr wehe tut, eine Absage der Liebe und eine Demütigung bedeutet. So manches Kind, das sich für sicher thronend in der unerschütterlichen Liebe seiner Eltern hielt, ist durch einen einzigen Schlag aus allen Himmeln seiner eingebildeten Allmacht gestürzt worden. Also ist es eine behagliche Vorstellung, daß der Vater dieses verhaßte Kind schlägt, ganz unabhängig davon, ob man gerade ihn schlagen gesehen hat. Es heißt: »Der Vater liebt dieses andere Kind nicht, er liebt nur mich.«
Dies ist also Inhalt und Bedeutung der Schlagephantasie in ihrer ersten Phase. Die Phantasie befriedigt offenbar die Eifersucht des Kindes und hängt von seinem Liebesleben ab, aber sie wird auch von dessen egoistischen Interessen kräftig gestützt. Es bleibt also zweifelhaft, ob man sie als eine rein »sexuelle« bezeichnen darf; auch eine »sadistische« getraut man sich nicht, sie zu nennen. Man weiß ja, daß gegen den Ursprung hin alle die Kennzeichen zu verschwimmen pflegen, auf welche wir unsere Unterscheidungen aufzubauen gewohnt sind. Also vielleicht ähnlich wie die Verheißung der drei Schicksalsschwestern an Banquo lautete: nicht sicher sexuell, nicht selbst sadistisch, aber doch der Stoff, aus dem später beides werden soll. Keinesfalls aber liegt ein Grund zur Vermutung vor, daß schon diese erste Phase der Phantasie einer Erregung dient, welche sich unter Inanspruchnahme der Genitalien Abfuhr in einem onanistischen Akt zu verschaffen lernt.
In dieser vorzeitigen Objektwahl der inzestuösen Liebe erreicht das Sexualleben des Kindes offenbar die Stufe der genitalen Organisation. Es ist dies für den Knaben leichter nachzuweisen, aber auch fürs kleine Mädchen nicht zu bezweifeln. Etwas wie eine Ahnung der späteren definitiven und normalen Sexualziele beherrscht das libidinöse Streben des Kindes; man mag sich füglich verwundern, woher es kommt, darf es aber als Beweis dafür nehmen, daß die Genitalien ihre Rolle beim Erregungsvorgang bereits angetreten haben. Der Wunsch, mit der Mutter ein Kind zu haben, fehlt nie beim Knaben, der Wunsch, vom Vater ein Kind zu bekommen, ist beim Mädchen konstant, und dies bei völliger Unfähigkeit, sich Klarheit über den Weg zu schaffen, der zur Erfüllung dieser Wünsche führen kann. Daß die Genitalien etwas damit zu tun haben, scheint beim Kinde festzustehen, wenngleich seine grübelnde Tätigkeit das Wesen der zwischen den Eltern vorausgesetzten Intimität in andersartigen Beziehungen suchen mag, zum Beispiel im Beisammenschlafen, in gemeinsamer Harnentleerung und dergleichen, und solcher Inhalt eher in Wortvorstellungen erfaßt werden kann als das Dunkle, das mit dem Genitalen zusammenhängt.
Allein es kömmt die Zeit, zu der diese frühe Blüte vom Frost geschädigt wird; keine dieser inzestuösen Verliebtheiten kann dem Verhängnis der Verdrängung entgehen. Sie verfallen ihr entweder bei nachweisbaren äußeren Anlässen, die eine Enttäuschung hervorrufen, bei unerwarteten Kränkungen, bei der unerwünschten Geburt eines neuen Geschwisterchens, die als Treulosigkeit empfunden wird usw., oder ohne solche Veranlassungen, von innen heraus, vielleicht nur infolge des Ausbleibens der zu lange ersehnten Erfüllung. Es ist unverkennbar, daß die Veranlassungen nicht die wirkenden Ursachen sind, sondern daß es diesen Liebesbeziehungen bestimmt ist, irgend einmal unterzugehen, wir können nicht sagen, woran. Am wahrscheinlichsten ist es, daß sie vergehen, weil ihre Zeit um ist, weil die Kinder in eine neue Entwicklungsphase eintreten, in welcher sie genötigt sind, die Verdrängung der inzestuösen Objektwahl aus der Menschheitsgeschichte zu wiederholen, wie sie vorher gedrängt waren, solche Objektwahl vorzunehmen. (Siehe das Schicksal in der Ödipusmythe.) Was als psychisches Ergebnis der inzestuösen Liebesregungen unbewußt vorhanden ist, wird vom Bewußtsein der neuen Phase nicht mehr übernommen, was davon bereits bewußt geworden war, wieder herausgedrängt. Gleichzeitig mit diesem Verdrängungsvorgang erscheint ein Schuldbewußtsein, auch dieses unbekannter Herkunft, aber ganz unzweifelhaft an jene Inzestwünsche geknüpft und durch deren Fortdauer im Unbewußten gerechtfertigt [Fußnote]Siehe die Fortführung in ›Der Untergang des Ödipuskomplexes‹ (1924 d)..
Die Phantasie der inzestuösen Liebeszeit hatte gesagt: »Er (der Vater) liebt nur mich, nicht das andere Kind, denn dieses schlägt er ja.« Das Schuldbewußtsein weiß keine härtere Strafe zu finden als die Umkehrung dieses Triumphes: »Nein, er liebt dich nicht, denn er schlägt dich.« So würde die Phantasie der zweiten Phase, selbst vom Vater geschlagen zu werden, zum direkten Ausdruck des Schuldbewußtseins, dem nun die Liebe zum Vater unterliegt. Sie ist also masochistisch geworden; meines Wissens ist es immer so, jedesmal ist das Schuldbewußtsein das Moment, welches den Sadismus zum Masochismus umwandelt. Dies ist aber gewiß nicht der ganze Inhalt des Masochismus. Das Schuldbewußtsein kann nicht allein das Feld behauptet haben; der Liebesregung muß auch ihr Anteil werden. Erinnern wir uns daran, daß es sich um Kinder handelt, bei denen die sadistische Komponente aus konstitutionellen Gründen vorzeitig und isoliert hervortreten konnte. Wir brauchen diesen Gesichtspunkt nicht aufzugeben. Bei eben diesen Kindern ist ein Rückgreifen auf die prägenitale, sadistisch-anale Organisation des Sexuallebens besonders erleichtert. Wenn die kaum erreichte genitale Organisation von der Verdrängung betroffen wird, so tritt nicht nur die eine Folge auf, daß jegliche psychische Vertretung der inzestuösen Liebe unbewußt wird oder bleibt, sondern es kommt noch als andere Folge hinzu, daß die Genitalorganisation selbst eine regressive Erniedrigung erfährt. Das: »Der Vater liebt mich«, war im genitalen Sinne gemeint; durch die Regression verwandelt es sich in: »Der Vater schlägt mich (ich werde vom Vater geschlagen).« Dies Geschlagenwerden ist nun ein Zusammentreffen von Schuldbewußtsein und Erotik; es ist nicht nur die Strafe für die verpönte genitale Beziehung, sondern auch der regressive Ersatz für sie, und aus dieser letzteren Quelle bezieht es die libidinöse Erregung, die ihm von nun anhaften und in onanistischen Akten Abfuhr finden wird. Dies ist aber erst das Wesen des Masochismus.
Die Phantasie der zweiten Phase, selbst vom Vater geschlagen zu werden, bleibt in der Regel unbewußt, wahrscheinlich infolge der Intensität der Verdrängung. Ich kann nicht angeben, warum sie doch in einem meiner sechs Fälle (einem männlichen) bewußt erinnert wurde. Dieser jetzt erwachsene Mann hatte es klar im Gedächtnis bewahrt, daß er die Vorstellung, von der Mutter geschlagen zu werden, zu onanistischen Zwecken zu gebrauchen pflegte; allerdings ersetzte er die eigene Mutter bald durch die Mütter von Schulkollegen oder andere, ihr irgendwie ähnliche Frauen. Es ist nicht zu vergessen, daß bei der Verwandlung der inzestuösen Phantasie des Knaben in die entsprechende masochistische eine Umkehrung mehr vor sich geht als im Falle des Mädchens, nämlich die Ersetzung von Aktivität durch Passivität, und dies Mehr von Entstellung mag die Phantasie vor dem Unbewußtbleiben als Erfolg der Verdrängung schützen. Dem Schuldbewußtsein hätte so die Regression an Stelle der Verdrängung genügt; in den weiblichen Fällen wäre das, vielleicht an sich anspruchsvollere, Schuldbewußtsein erst durch das Zusammenwirken beider begütigt worden.
In zweien meiner vier weiblichen Fälle hatte sich über der masochistischen Schlagephantasie ein kunstvoller, für das Leben der Betreffenden sehr bedeutsamer Überbau von Tagträumen entwickelt, dem die Funktion zufiel, das Gefühl der befriedigten Erregung auch bei Verzicht auf den onanistischen Akt möglich zu machen. In einem dieser Fälle durfte der Inhalt, vom Vater geschlagen zu werden, sich wieder ins Bewußtsein wagen, wenn das eigene Ich durch leichte Verkleidung unkenntlich gemacht war. Der Held dieser Geschichten wurde regelmäßig vom Vater geschlagen, später nur gestraft, gedemütigt usw.
Ich wiederhole aber, in der Regel bleibt die Phantasie unbewußt und muß erst in der Analyse rekonstruiert werden. Dies läßt vielleicht den Patienten recht geben, die sich erinnern wollen, die Onanie sei bei ihnen früher aufgetreten als die –; gleich zu besprechende –; Schlagephantasie der dritten Phase; letztere habe sich erst später hinzugesellt, etwa unter dem Eindruck von Schulszenen. Sooft wir diesen Angaben Glauben schenkten, waren wir immer geneigt anzunehmen, die Onanie sei zunächst unter der Herrschaft unbewußter Phantasien gestanden, die später durch bewußte ersetzt wurden.
Als solchen Ersatz fassen wir dann die bekannte Schlagephantasie der dritten Phase auf, die endgültige Gestaltung derselben, in der das phantasierende Kind höchstens noch als Zuschauer vorkommt, der Vater in der Person eines Lehrers oder sonstigen Vorgesetzten erhalten ist. Die Phantasie, die nun jener der ersten Phase ähnlich ist, scheint sich wieder ins Sadistische gewendet zu haben. Es macht den Eindruck, als wäre in dem Satze: »Der Vater schlägt das andere Kind, er liebt nur mich«, der Akzent auf den ersten Teil zurückgewichen, nachdem der zweite der Verdrängung erlegen ist. Allein nur die Form dieser Phantasie ist sadistisch, die Befriedigung, die aus ihr gewonnen wird, ist eine masochistische, ihre Bedeutung liegt darin, daß sie die libidinöse Besetzung des verdrängten Anteils übernommen hat und mit dieser auch das am Inhalt haftende Schuldbewußtsein. Alle die vielen unbestimmten Kinder, die vom Lehrer geschlagen werden, sind doch nur Ersetzungen der eigenen Person.
Hier zeigt sich auch zum erstenmal etwas wie eine Konstanz des Geschlechtes bei den der Phantasie dienenden Personen. Die geschlagenen Kinder sind fast durchwegs Knaben, in den Phantasien der Knaben ebensowohl wie in denen der Mädchen. Dieser Zug erklärt sich greifbarerweise nicht aus einer etwaigen Konkurrenz der Geschlechter, denn sonst müßten ja in den Phantasien der Knaben vielmehr Mädchen geschlagen werden; er hat auch nichts mit dem Geschlecht des gehaßten Kindes der ersten Phase zu tun, sondern er weist auf einen komplizierenden Vorgang bei den Mädchen hin. Wenn sie sich von der genital gemeinten inzestuösen Liebe zum Vater abwenden, brechen sie überhaupt leicht mit ihrer weiblichen Rolle, beleben ihren »Männlichkeitskomplex« (van Ophuijsen) und wollen von da an nur Buben sein. Daher sind auch ihre Prügelknaben, die sie vertreten, Buben. In beiden Fällen von Tagträumen –; der eine erhob sich beinahe zum Niveau einer Dichtung –; waren die Helden immer nur junge Männer, ja Frauen kamen in diesen Schöpfungen überhaupt nicht vor und fanden erst nach vielen Jahren in Nebenrollen Aufnahme.
V
Ich hoffe, ich habe meine analytischen Erfahrungen detailliert genug vorgetragen, und bitte nur noch in Betracht zu ziehen, daß die oft erwähnten sechs Fälle nicht mein Material erschöpfen, sondern daß ich auch wie andere Analytiker über eine weit größere Anzahl von minder gut untersuchten Fällen verfüge. Diese Beobachtungen können nach mehreren Richtungen verwertet werden, zur Aufklärung über die Genese der Perversionen überhaupt, im besonderen des Masochismus, und zur Würdigung der Rolle, welche der Geschlechtsunterschied in der Dynamik der Neurose spielt.
Das augenfälligste Ergebnis einer solchen Diskussion betrifft die Entstehung der Perversionen. An der Auffassung, die bei ihnen die konstitutionelle Verstärkung oder Voreiligkeit einer Sexualkomponente in den Vordergrund rückt, wird zwar nicht gerüttelt, aber damit ist nicht alles gesagt. Die Perversion steht nicht mehr isoliert im Sexualleben des Kindes, sondern sie wird in den Zusammenhang der uns bekannten typischen –; um nicht zu sagen: normalen –; Entwicklungsvorgänge aufgenommen. Sie wird in Beziehung zur inzestuösen Objektliebe des Kindes, zum Ödipuskomplex desselben, gebracht, tritt auf dem Boden dieses Komplexes zuerst hervor, und nachdem er zusammengebrochen ist, bleibt sie, oft allein, von ihm übrig, als Erbe seiner libidinösen Ladung und belastet mit dem an ihm haftenden Schuldbewußtsein. Die abnorme Sexualkonstitution hat schließlich ihre Stärke darin gezeigt, daß sie den Ödipuskomplex in eine besondere Richtung gedrängt und ihn zu einer ungewöhnlichen Resterscheinung gezwungen hat.
Die kindliche Perversion kann, wie bekannt, das Fundament für die Ausbildung einer gleichsinnigen, durchs Leben bestehenden Perversion werden, die das ganze Sexualleben des Menschen aufzehrt, oder sie kann abgebrochen werden und im Hintergrunde einer normalen Sexualentwicklung erhalten bleiben, der sie dann doch immer einen gewissen Energiebetrag entzieht. Der erstere Fall ist der bereits in voranalytischen Zeiten erkannte, aber die Kluft zwischen beiden wird durch die analytische Untersuchung solcher ausgewachsener Perversionen nahezu ausgefüllt. Man findet nämlich häufig genug bei diesen Perversen, daß auch sie, gewöhnlich in der Pubertätszeit, einen Ansatz zur normalen Sexualtätigkeit gebildet haben. Aber der war nicht kräftig genug, wurde vor den ersten, nie ausbleibenden Hindernissen aufgegeben, und dann griff die Person endgültig auf die infantile Fixierung zurück.
Es wäre natürlich wichtig zu wissen, ob man die Entstehung der infantilen Perversionen aus dem Ödipuskomplex ganz allgemein behaupten darf. Das kann ja ohne weitere Untersuchungen nicht entschieden werden, aber unmöglich erschiene es nicht. Wenn wir der Anamnesen gedenken, die von den Perversionen Erwachsener gewonnen wurden, so merken wir doch, daß der maßgebende Eindruck, das »erste Erlebnis«, all dieser Perversen, Fetischisten und dergleichen fast niemals in Zeiten früher als das sechste Jahr verlegt wird. Um diese Zeit ist die Herrschaft des Ödipuskomplexes aber bereits abgelaufen; das erinnerte, in so rätselhafter Weise wirksame Erlebnis könnte sehr wohl die Erbschaft desselben vertreten haben. Die Beziehungen zwischen ihm und dem nun verdrängten Komplex müssen dunkle bleiben, solange nicht die Analyse in die Zeit hinter dem ersten »pathogenen« Eindruck Licht getragen hat. Man erwäge nun, wie wenig Wert zum Beispiel die Behauptung einer angeborenen Homosexualität hat, die sich auf die Mitteilung stützt, die betreffende Person habe schon vom achten oder vom sechsten Jahre an nur Zuneigung zum gleichen Geschlecht verspürt.
Wenn aber die Ableitung der Perversionen aus dem Ödipuskomplex allgemein durchführbar ist, dann hat unsere Würdigung desselben eine neue Bekräftigung erfahren. Wir meinen ja, der Ödipuskomplex sei der eigentliche Kern der Neurose, die infantile Sexualität, die in ihm gipfelt, die wirkliche Bedingung der Neurose, und was von ihm im Unbewußten erübrigt, stelle die Disposition zur späteren neurotischen Erkrankung des Erwachsenen dar. Die Schlagephantasie und andere analoge perverse Fixierungen wären dann auch nur Niederschläge des Ödipuskomplexes, gleichsam Narben nach dem abgelaufenen Prozeß, geradeso wie die berüchtigte »Minderwertigkeit« einer solchen narzißtischen Narbe entspricht. Ich muß in dieser Auffassung Marcinowski, der sie kürzlich in glücklicher Weise vertreten hat (›Erotische Quellen der Minderwertigkeitsgefühle‹, 1918), uneingeschränkt beistimmen. Dieser Kleinheitswahn der Neurotiker ist bekanntlich auch nur ein partieller und mit der Existenz von Selbstüberschätzung aus anderen Quellen vollkommen verträglich. Über die Herkunft des Ödipuskomplexes selbst und über das den Menschen wahrscheinlich allein unter allen Tieren zugemessene Schicksal, das Sexualleben zweimal beginnen zu müssen, zuerst wie alle anderen Geschöpfe von früher Kindheit an und dann nach langer Unterbrechung in der Pubertätszeit von neuem, über all das, was mit seinem »archaischen Erbe« zusammenhängt, habe ich mich an anderer Stelle geäußert, und darauf gedenke ich hier nicht einzugehen.
Zur Genese des Masochismus liefert die Diskussion unserer Schlagephantasien nur spärliche Beiträge. Es scheint sich zunächst zu bestätigen, daß der Masochismus keine primäre Triebäußerung ist, sondern aus einer Rückwendung des Sadismus gegen die eigene Person, also durch Regression vom Objekt aufs Ich entsteht. (Vgl. ›Triebe und Triebschicksale‹.) Triebe mit passivem Ziele sind, zumal beim Weibe, von Anfang zuzugeben, aber die Passivität ist noch nicht das Ganze des Masochismus; es gehört noch der Unlustcharakter dazu, der bei einer Trieberfüllung so befremdlich ist. Die Umwandlung des Sadismus in Masochismus scheint durch den Einfluß des am Verdrängungsakt beteiligten Schuldbewußtseins zu geschehen. Die Verdrängung äußert sich also hier in dreierlei Wirkungen; sie macht die Erfolge der Genitalorganisation unbewußt, nötigt diese selbst zur Regression auf die frühere sadistisch-anale Stufe und verwandelt deren Sadismus in den passiven, in gewissem Sinne wiederum narzißtischen Masochismus. Der mittlere dieser drei Erfolge wird durch die in diesen Fällen anzunehmende Schwäche der Genitalorganisation ermöglicht; der dritte wird notwendig, weil das Schuldbewußtsein am Sadismus ähnlichen Anstoß nimmt wie an der genital gefaßten inzestuösen Objektwahl. Woher das Schuldbewußtsein selbst stammt, sagen wiederum die Analysen nicht. Es scheint von der neuen Phase, in die das Kind eintritt, mitgebracht zu werden, und wenn es von da an verbleibt, einer ähnlichen Narbenbildung, wie es das Minderwertigkeitsgefühl ist, zu entsprechen. Nach unserer bisher noch unsicheren Orientierung in der Struktur des Ichs würden wir es jener Instanz zuteilen, die sich als kritisches Gewissen dem übrigen Ich entgegenstellt, im Traum das Silberersche funktionale Phänomen erzeugt und sich im Beachtungswahn vom Ich ablöst.
Im Vorbeigehen wollen wir auch zur Kenntnis nehmen, daß die Analyse der hier behandelten kindlichen Perversion auch ein altes Rätsel lösen hilft, welches allerdings die außerhalb der Analyse Stehenden immer mehr gequält hat als die Analytiker selbst. Aber noch kürzlich hat selbst E. Bleuler als merkwürdig und unerklärlich anerkannt, daß von den Neurotikern die Onanie zum Mittelpunkt ihres Schuldbewußtseins gemacht werde. Wir haben von jeher angenommen, daß dies Schuldbewußtsein die frühkindliche und nicht die Pubertätsonanie meine und daß es zum größten Teil nicht auf den onanistischen Akt, sondern auf die ihm zugrunde liegende, wenn auch unbewußte Phantasie –; aus dem Ödipuskomplex also –; zu beziehen sei.
Ich habe bereits ausgeführt, welche Bedeutung die dritte, scheinbar sadistische Phase der Schlagephantasie als Träger der zur Onanie drängenden Erregung [zu] gewinnen und zu welcher teils gleichsinnig fortsetzenden, teils kompensatorisch aufhebenden Phantasietätigkeit sie anzuregen pflegt. Doch ist die zweite, unbewußte und masochistische Phase, die Phantasie, selbst vom Vater geschlagen zu werden, die ungleich wichtigere. Nicht nur, daß sie ja durch Vermittlung der sie ersetzenden fortwirkt; es sind auch Wirkungen auf den Charakter nachzuweisen, welche sich unmittelbar von ihrer unbewußten Fassung ableiten. Menschen, die eine solche Phantasie bei sich tragen, entwickeln eine besondere Empfindlichkeit und Reizbarkeit gegen Personen, die sie in die Vaterreihe einfügen können; sie lassen sich leicht von ihnen kränken und bringen so die Verwirklichung der phantasierten Situation, daß sie vom Vater geschlagen werden, zu ihrem Leid und Schaden zustande. Ich würde nicht verwundert sein, wenn es einmal gelänge, dieselbe Phantasie als Grundlage des paranoischen Querulantenwahns nachzuweisen.
VI
Die Beschreibung der infantilen Schlagephantasien wäre völlig unübersichtlich geraten, wenn ich sie nicht, von wenigen Beziehungen abgesehen, auf die Verhältnisse bei weiblichen Personen eingeschränkt hätte. Ich wiederhole kurz die Ergebnisse: Die Schlagephantasie der kleinen Mädchen macht drei Phasen durch, von denen die erste und letzte als bewußt erinnert werden, die mittlere unbewußt bleibt. Die beiden bewußten scheinen sadistisch, die mittlere, unbewußte, ist unzweifelhaft masochistischer Natur; ihr Inhalt ist, vom Vater geschlagen zu werden, an ihr hängt die libidinöse Ladung und das Schuldbewußtsein. Das geschlagene Kind ist in den beiden ersteren Phantasien stets ein anderes, in der mittleren Phase nur die eigene Person, in der dritten, bewußten Phase sind es weit überwiegend nur Knaben, die geschlagen werden. Die schlagende Person ist von Anfang an der Vater, später ein Stellvertreter aus der Vaterreihe. Die unbewußte Phantasie der mittleren Phase hatte ursprünglich genitale Bedeutung, ist durch Verdrängung und Regression aus dem inzestuösen Wunsch, vom Vater geliebt zu werden, hervorgegangen. In anscheinend lockerem Zusammenhange schließt sich an, daß die Mädchen zwischen der zweiten und dritten Phase ihr Geschlecht wechseln, indem sie sich zu Knaben phantasieren.
In der Kenntnis der Schlagephantasien der Knaben bin ich, vielleicht nur durch die Ungunst des Materials, weniger weit gekommen. Ich habe begreiflicherweise volle Analogie der Verhältnisse bei Knaben und Mädchen erwartet, wobei an die Stelle des Vaters in der Phantasie die Mutter hätte treten müssen. Die Erwartung schien sich auch zu bestätigen, denn die für entsprechend gehaltene Phantasie des Knaben hatte zum Inhalt, von der Mutter (später von einer Ersatzperson) geschlagen zu werden. Allein diese Phantasie, in welcher die eigene Person als Objekt festgehalten war, unterschied sich von der zweiten Phase bei Mädchen dadurch, daß sie bewußt werden konnte. Wollte man sie aber darum eher der dritten Phase beim Mädchen gleichstellen, so blieb als neuer Unterschied, daß die eigene Person des Knaben nicht durch viele, unbestimmte, fremde, am wenigsten durch viele Mädchen ersetzt war. Die Erwartung eines vollen Parallelismus hatte sich also getäuscht.
Mein männliches Material umfaßte nur wenige Fälle mit infantiler Schlagephantasie ohne sonstige grobe Schädigung der Sexualtätigkeit, dagegen eine größere Anzahl von Personen, die als richtige Masochisten im Sinne der sexuellen Perversion bezeichnet werden mußten. Es waren entweder solche, die ihre Sexualbefriedigung ausschließlich in Onanie bei masochistischen Phantasien fanden, oder denen es gelungen war, Masochismus und Genitalbetätigung so zu verkoppeln, daß sie bei masochistischen Veranstaltungen und unter ebensolchen Bedingungen Erektion und Ejakulation erzielten oder zur Ausführung eines normalen Koitus befähigt wurden. Dazu kam der seltenere Fall, daß ein Masochist in seinem perversen Tun durch unerträglich stark auftretende Zwangsvorstellungen gestört wurde. Befriedigte Perverse haben nun selten Grund, die Analyse aufzusuchen; für die drei angeführten Gruppen von Masochisten können sich aber starke Motive ergeben, die sie zum Analytiker führen. Der masochistische Onanist findet sich absolut impotent, wenn er endlich doch den Koitus mit dem Weibe versucht, und wer bisher mit Hilfe einer masochistischen Vorstellung oder Veranstaltung den Koitus zustande gebracht hat, kann plötzlich die Entdeckung machen, daß dies ihm bequeme Bündnis versagt hat, indem das Genitale auf den masochistischen Anreiz nicht mehr reagiert. Wir sind gewohnt, den psychisch Impotenten, die sich in unsere Behandlung begeben, zuversichtlich Herstellung zu versprechen, aber wir sollten auch in dieser Prognose zurückhaltender sein, solange uns die Dynamik der Störung unbekannt ist. Es ist eine böse Überraschung, wenn uns die Analyse als Ursache der »bloß psychischen« Impotenz eine exquisite, vielleicht längst eingewurzelte, masochistische Einstellung enthüllt.
Bei diesen masochistischen Männern macht man nun eine Entdeckung, welche uns mahnt, die Analogie mit den Verhältnissen beim Weibe vorerst nicht weiter zu verfolgen, sondern den Sachverhalt selbständig zu beurteilen. Es stellt sich nämlich heraus, daß sie in den masochistischen Phantasien wie bei den Veranstaltungen zur Realisierung derselben sich regelmäßig in die Rolle von Weibern versetzen, daß also ihr Masochismus mit einer femininen Einstellung zusammenfällt. Dies ist aus den Einzelheiten der Phantasien leicht nachzuweisen; viele Patienten wissen es aber auch und äußern es als eine subjektive Gewißheit. Daran wird nichts geändert, wenn der spielerische Aufputz der masochistischen Szene an der Fiktion eines unartigen Knaben, Pagen oder Lehrlings, der gestraft werden soll, festhält. Die züchtigenden Personen sind aber in den Phantasien wie in den Veranstaltungen jedesmal Frauen. Das ist verwirrend genug; man möchte auch wissen, ob schon der Masochismus der infantilen Schlagephantasie auf solcher femininen Einstellung beruht [Fußnote]Weiteres darüber in ›Das ökonomische Problem des Masochismus‹ (1924 c)..
Lassen wir darum die schwer aufzuklärenden Verhältnisse des Masochismus der Erwachsenen beiseite und wenden uns zu den infantilen Schlagephantasien beim männlichen Geschlecht. Hier gestattet uns die Analyse der frühesten Kinderzeit wiederum, einen überraschenden Fund zu machen: Die bewußte oder bewußtseinsfähige Phantasie des Inhalts, von der Mutter geschlagen zu werden, ist nicht primär. Sie hat ein Vorstadium, das regelmäßig unbewußt ist und das den Inhalt hat: » Ich werde vom Vater geschlagen.« Dieses Vorstadium entspricht also wirklich der zweiten Phase der Phantasie beim Mädchen. Die bekannte und bewußte Phantasie: Ich werde von der Mutter geschlagen, steht an der Stelle der dritten Phase beim Mädchen, in der, wie erwähnt, unbekannte Knaben die geschlagenen Objekte sind. Ein der ersten Phase beim Mädchen vergleichbares Vorstadium sadistischer Natur konnte ich beim Knaben nicht nachweisen, aber ich will hier keine endgültige Ablehnung aussprechen, denn ich sehe die Möglichkeit komplizierterer Typen wohl ein.
Das Geschlagenwerden der männlichen Phantasie, wie ich sie kurz und hoffentlich nicht mißverständlich nennen werde, ist gleichfalls ein durch Regression erniedrigtes Geliebtwerden im genitalen Sinne. Die unbewußte männliche Phantasie hat also ursprünglich nicht gelautet: »Ich werde vom Vater geschlagen«, wie wir es vorhin vorläufig hinstellten, sondern vielmehr: » Ich werde vom Vater geliebt.« Sie ist durch die bekannten Prozesse umgewandelt worden in die bewußte Phantasie: » Ich werde von der Mutter geschlagen.« Die Schlagephantasie des Knaben ist also von Anfang an eine passive, wirklich aus der femininen Einstellung zum Vater hervorgegangen. Sie entspricht auch ebenso wie die weibliche (die des Mädchens) dem Ödipuskomplex, nur ist der von uns erwartete Parallelismus zwischen beiden gegen eine Gemeinsamkeit anderer Art aufzugeben: In beiden Fällen leitet sich die Schlagephantasie von der inzestuösen Bindung an den Vater ab.
Es wird der Übersichtlichkeit dienen, wenn ich hier die anderen Übereinstimmungen und Verschiedenheiten zwischen den Schlagephantasien der beiden Geschlechter anfüge. Beim Mädchen geht die unbewußte masochistische Phantasie von der normalen Ödipuseinstellung aus; beim Knaben von der verkehrten, die den Vater zum Liebesobjekt nimmt. Beim Mädchen hat die Phantasie eine Vorstufe (die erste Phase), in welcher das Schlagen in seiner indifferenten Bedeutung auftritt und eine eifersüchtig gehaßte Person betrifft; beides entfällt beim Knaben, doch könnte gerade diese Differenz durch glücklichere Beobachtung beseitigt werden. Beim Übergang zur ersetzenden bewußten Phantasie hält das Mädchen die Person des Vaters und somit das Geschlecht der schlagenden Person fest; es ändert aber die geschlagene Person und ihr Geschlecht, so daß am Ende ein Mann männliche Kinder schlägt; der Knabe ändert im Gegenteil Person und Geschlecht des Schlagenden, indem er Vater durch Mutter ersetzt, und behält seine Person bei, so daß am Ende der Schlagende und die geschlagene Person verschiedenen Geschlechts sind. Beim Mädchen wird die ursprünglich masochistische (passive) Situation durch die Verdrängung in eine sadistische umgewandelt, deren sexueller Charakter sehr verwischt ist, beim Knaben bleibt sie masochistisch und bewahrt infolge der Geschlechtsdifferenz zwischen schlagender und geschlagener Person mehr Ähnlichkeit mit der ursprünglichen, genital gemeinten Phantasie. Der Knabe entzieht sich durch die Verdrängung und Umarbeitung der unbewußten Phantasie seiner Homosexualität; das Merkwürdige an seiner späteren bewußten Phantasie ist, daß sie feminine Einstellung ohne homosexuelle Objektwahl zum Inhalt hat. Das Mädchen dagegen entläuft bei dem gleichen Vorgang dem Anspruch des Liebeslebens überhaupt, phantasiert sich zum Manne, ohne selbst männlich aktiv zu werden, und wohnt dem Akt, welcher einen sexuellen ersetzt, nur mehr als Zuschauer bei.
Wir sind berechtigt anzunehmen, daß durch die Verdrängung der ursprünglichen unbewußten Phantasie nicht allzuviel geändert wird. Alles fürs Bewußtsein Verdrängte und Ersetzte bleibt im Unbewußten erhalten und wirkungsfähig. Anders ist es mit dem Effekt der Regression auf eine frühere Stufe der Sexualorganisation. Von dieser dürfen wir glauben, daß sie auch die Verhältnisse im Unbewußten ändert, so daß nach der Verdrängung im Unbewußten bei beiden Geschlechtern zwar nicht die (passive) Phantasie, vom Vater geliebt zu werden, aber doch die masochistische, von ihm geschlagen zu werden, bestehen bleibt. Es fehlt auch nicht an Anzeichen dafür, daß die Verdrängung ihre Absicht nur sehr unvollkommen erreicht hat. Der Knabe, der ja der homosexuellen Objektwahl entfliehen wollte und sein Geschlecht nicht gewandelt hat, fühlt sich doch in seinen bewußten Phantasien als Weib und stattet die schlagenden Frauen mit männlichen Attributen und Eigenschaften aus. Das Mädchen, das selbst sein Geschlecht aufgegeben und im ganzen gründlichere Verdrängungsarbeit geleistet hat, wird doch den Vater nicht los, getraut sich nicht selbst zu schlagen, und weil es selbst zum Buben geworden ist, läßt es hauptsächlich Buben geschlagen werden.
Ich weiß, daß die hier beschriebenen Unterschiede im Verhalten der Schlagephantasie bei beiden Geschlechtern nicht genügend aufgeklärt sind, unterlasse aber den Versuch, diese Komplikationen durch Verfolgung ihrer Abhängigkeit von anderen Momenten zu entwirren, weil ich selbst das Material der Beobachtung nicht für erschöpfend halte. Soweit es aber vorliegt, möchte ich es zur Prüfung zweier Theorien benützen, die, einander entgegengesetzt, beide die Beziehung der Verdrängung zum Geschlechtscharakter behandeln und dieselbe, jede in ihrem Sinne, als eine sehr innige darstellen. Ich schicke voraus, daß ich beide immer für unzutreffend und irreführend gehalten habe.
Die erste dieser Theorien ist anonym; sie wurde mir vor vielen Jahren von einem damals befreundeten Kollegen vorgetragen. Ihre großzügige Einfachheit wirkt so bestechend, daß man sich nur verwundert fragen muß, warum sie sich seither in der Literatur nur durch vereinzelte Andeutungen vertreten findet. Sie lehnt sich an die bisexuelle Konstitution der menschlichen Individuen und behauptet, bei jedem einzelnen sei der Kampf der Geschlechtscharaktere das Motiv der Verdrängung. Das stärker ausgebildete, in der Person vorherrschende Geschlecht habe die seelische Vertretung des unterlegenen Geschlechtes ins Unbewußte verdrängt. Der Kern des Unbewußten, das Verdrängte, sei also bei jedem Menschen das in ihm vorhandene Gegengeschlechtliche. Das kann einen greifbaren Sinn wohl nur dann geben, wenn wir das Geschlecht eines Menschen durch die Ausbildung seiner Genitalien bestimmt sein lassen, sonst wird ja das stärkere Geschlecht eines Menschen unsicher, und wir laufen Gefahr, das, was uns als Anhaltspunkt bei der Untersuchung dienen soll, selbst wieder aus deren Ergebnis abzuleiten. Kurz zusammengefaßt: Beim Manne ist das unbewußte Verdrängte auf weibliche Triebregungen zurückzuführen; umgekehrt so beim Weibe.
Die zweite Theorie ist neuerer Herkunft; sie stimmt mit der ersten darin überein, daß sie wiederum den Kampf der beiden Geschlechter als entscheidend für die Verdrängung hinstellt. Im übrigen muß sie mit der ersteren in Gegensatz geraten; sie beruft sich auch nicht auf biologische, sondern auf soziologische Stützen. Diese von Alf. Adler ausgesprochene Theorie des »männlichen Protestes« hat zum Inhalt, daß jedes Individuum sich sträubt, auf der minderwertigen »weiblichen Linie« zu verbleiben, und zur allein befriedigenden männlichen Linie hindrängt. Aus diesem männlichen Protest erklärt Adler ganz allgemein die Charakter- wie die Neurosenbildung. Leider sind die beiden doch gewiß auseinanderzuhaltenden Vorgänge bei Adler so wenig scharf geschieden und wird die Tatsache der Verdrängung überhaupt so wenig gewürdigt, daß man sich der Gefahr eines Mißverständnisses aussetzt, wenn man die Lehre vom männlichen Protest auf die Verdrängung anzuwenden versucht. Ich meine, dieser Versuch müßte ergeben, daß der männliche Protest, das Abrückenwollen von der weiblichen Linie, in allen Fällen das Motiv der Verdrängung ist. Das Verdrängende wäre also stets eine männliche, das Verdrängte eine weibliche Triebregung. Aber auch das Symptom wäre Ergebnis einer weiblichen Regung, denn wir können den Charakter des Symptoms, daß es ein Ersatz des Verdrängten sei, der sich der Verdrängung zum Trotze durchgesetzt hat, nicht aufgeben.
Erproben wir nun die beiden Theorien, denen sozusagen die Sexualisierung des Verdrängungsvorganges gemeinsam ist, an dem Beispiel der hier studierten Schlagephantasie. Die ursprüngliche Phantasie: »Ich werde vom Vater geschlagen«, entspricht beim Knaben einer femininen Einstellung, ist also eine Äußerung seiner gegengeschlechtlichen Anlage. Wenn sie der Verdrängung unterliegt, so scheint die erstere Theorie recht behalten zu sollen, die ja die Regel aufgestellt hat, das Gegengeschlechtliche deckt sich mit dem Verdrängten. Es entspricht freilich unseren Erwartungen wenig, wenn das, was sich nach erfolgter Verdrängung herausstellt, die bewußte Phantasie, doch wiederum die feminine Einstellung, nur diesmal zur Mutter, aufweist. Aber wir wollen nicht auf Zweifel eingehen, wo die Entscheidung so nahe bevorsteht. Die ursprüngliche Phantasie der Mädchen: »Ich werde vom Vater geschlagen (das heißt: geliebt)«, entspricht doch gewiß als feminine Einstellung dem bei ihnen vorherrschenden, manifesten Geschlecht, sie sollte also der Theorie zufolge der Verdrängung entgehen, brauchte nicht unbewußt zu werden. In Wirklichkeit wird sie es doch und erfährt eine Ersetzung durch eine bewußte Phantasie, welche den manifesten Geschlechtscharakter verleugnet. Diese Theorie ist also für das Verständnis der Schlagephantasien unbrauchbar und durch sie widerlegt. Man könnte einwenden, es seien eben weibische Knaben und männische Mädchen, bei denen diese Schlagephantasien vorkommen und die diese Schicksale erfahren, oder es sei ein Zug von Weiblichkeit beim Knaben und von Männlichkeit beim Mädchen dafür verantwortlich zu machen, beim Knaben für die Entstehung der passiven Phantasie, beim Mädchen für deren Verdrängung. Wir würden dieser Auffassung wahrscheinlich zustimmen, aber die behauptete Beziehung zwischen manifestem Geschlechtscharakter und Auswahl des zur Verdrängung Bestimmten wären darum nicht minder unhaltbar. Wir sehen im Grunde nur, daß bei männlichen und weiblichen Individuen sowohl männliche wie weibliche Triebregungen vorkommen und ebenso durch Verdrängung unbewußt werden können.
Sehr viel besser scheint sich die Theorie des männlichen Protestes gegen die Probe an den Schlagephantasien zu behaupten. Beim Knaben wie beim Mädchen entspricht die Schlagephantasie einer femininen Einstellung, also einem Verweilen auf der weiblichen Linie, und beide Geschlechter beeilen sich, durch Verdrängung der Phantasie von dieser Einstellung loszukommen. Allerdings scheint der männliche Protest nur beim Mädchen vollen Erfolg zu erzielen, hier stellt sich ein geradezu ideales Beispiel für das Wirken des männlichen Protestes her. Beim Knaben ist der Erfolg nicht voll befriedigend, die weibliche Linie wird nicht aufgegeben, der Knabe ist in seiner bewußten masochistischen Phantasie gewiß nicht »oben«. Es entspricht also der aus der Theorie abgeleiteten Erwartung, wenn wir in dieser Phantasie ein Symptom erkennen, das durch Mißglücken des männlichen Protestes entstanden ist. Es stört uns freilich, daß die aus der Verdrängung hervorgegangene Phantasie des Mädchens ebenfalls Wert und Bedeutung eines Symptoms hat. Hier, wo der männliche Protest seine Absicht voll durchgesetzt hat, müßte doch die Bedingung für die Symptombildung entfallen sein.
Ehe wir noch aus dieser Schwierigkeit die Vermutung schöpfen, daß die ganze Betrachtungsweise des männlichen Protestes den Problemen der Neurosen und Perversionen unangemessen und in ihrer Anwendung auf sie unfruchtbar sei, werden wir unseren Blick von den passiven Schlagephantasien weg zu anderen Triebäußerungen des kindlichen Sexuallebens richten, die gleichfalls der Verdrängung unterliegen. Es kann doch niemand daran zweifeln, daß es auch Wünsche und Phantasien gibt, die von vornherein die männliche Linie einhalten und Ausdruck männlicher Triebregungen sind, z. B. sadistische Impulse oder die aus dem normalen Ödipuskomplex hervorgehenden Gelüste des Knaben gegen seine Mutter. Es ist ebensowenig zweifelhaft, daß auch diese von der Verdrängung befallen werden; wenn der männliche Protest die Verdrängung der passiven, später masochistischen Phantasien gut erklärt haben sollte, so wird er eben dadurch für den entgegengesetzten Fall der aktiven Phantasien völlig unbrauchbar. Das heißt: die Lehre vom männlichen Protest ist mit der Tatsache der Verdrängung überhaupt unvereinbar. Nur wer bereit ist, alle psychologischen Erwerbungen von sich zu werfen, die seit der ersten kathartischen Kur Breuers und durch sie gemacht worden sind, kann erwarten, daß dem Prinzip des männlichen Protestes in der Aufklärung der Neurosen und Perversionen eine Bedeutung zukommen wird.
Die auf Beobachtung gestützte psychoanalytische Theorie hält fest daran, daß die Motive der Verdrängung nicht sexualisiert werden dürfen. Den Kern des seelisch Unbewußten bildet die archaische Erbschaft des Menschen, und dem Verdrängungsprozeß verfällt, was immer davon beim Fortschritt zu späteren Entwicklungsphasen als unbrauchbar, als mit dem Neuen unvereinbar und ihm schädlich zurückgelassen werden soll. Diese Auswahl gelingt bei einer Gruppe von Trieben besser als bei der anderen. Letztere, die Sexualtriebe, vermögen es, kraft besonderer Verhältnisse, die schon oftmals aufgezeigt worden sind, die Absicht der Verdrängung zu vereiteln und sich die Vertretung durch störende Ersatzbildungen zu erzwingen. Daher ist die der Verdrängung unterliegende infantile Sexualität die Haupttriebkraft der Symptombildung, und das wesentliche Stück ihres Inhalts, der Ödipuskomplex, der Kernkomplex der Neurose. Ich hoffe, in dieser Mitteilung die Erwartung regegemacht zu haben, daß auch die sexuellen Abirrungen des kindlichen wie des reifen Alters von dem nämlichen Komplex abzweigen.
Eine Kindheitserinnerung aus Dichtung und Wahrheit (1917)
»Wenn man sich erinnern will, was uns in der frühsten Zeit der Kindheit begegnet ist, so kommt man oft in den Fall, dasjenige, was wir von andern gehört, mit dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigner anschauender Erfahrung besitzen.« Diese Bemerkung macht Goethe auf einem der ersten Blätter der Lebensbeschreibung, die er im Alter von sechzig Jahren aufzuzeichnen begann. Vor ihr stehen nur einige Mitteilungen über seine »am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlag zwölf« erfolgte Geburt. Die Konstellation der Gestirne war ihm günstig und mag wohl Ursache seiner Erhaltung gewesen sein, denn er kam »für tot« auf die Welt, und nur durch vielfache Bemühungen brachte man es dahin, daß er das Licht erblickte. Nach dieser Bemerkung folgt eine kurze Schilderung des Hauses und der Räumlichkeit, in welcher sich die Kinder –; er und seine jüngere Schwester –; am liebsten aufhielten. Dann aber erzählt Goethe eigentlich nur eine einzige Begebenheit, die man in die »früheste Zeit der Kindheit« (in die Jahre bis vier?) versetzen kann und an welche er eine eigene Erinnerung bewahrt zu haben scheint.
Der Bericht hierüber lautet: »und mich gewannen drei gegenüber wohnende Brüder von Ochsenstein, hinterlassene Söhne des verstorbenen Schultheißen, gar lieb, und beschäftigten und neckten sich mit mir auf mancherlei Weise.«
»Die Meinigen erzählten gern allerlei Eulenspiegeleien, zu denen mich jene sonst ernsten und einsamen Männer angereizt. Ich führe nur einen von diesen Streichen an. Es war eben Topfmarkt gewesen, und man hatte nicht allein die Küche für die nächste Zeit mit solchen Waren versorgt, sondern auch uns Kindern dergleichen Geschirr im kleinen zu spielender Beschäftigung eingekauft. An einem schönen Nachmittag, da alles ruhig im Hause war, trieb ich im Geräms« (der erwähnten gegen die Straße gerichteten Örtlichkeit) »mit meinen Schüsseln und Töpfen mein Wesen, und da weiter nichts dabei herauskommen wollte, warf ich ein Geschirr auf die Straße und freute mich, daß es so lustig zerbrach. Die von Ochsenstein, welche sahen, wie ich mich daran ergötzte, daß ich sogar fröhlich in die Händchen patschte, riefen: Noch mehr! Ich säumte nicht, sogleich einen Topf und, auf immer fortwährendes Rufen: Noch mehr! nach und nach sämtliche Schüsselchen, Tiegelchen, Kännchen gegen das Pflaster zu schleudern. Meine Nachbarn fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen, und ich war höchlich froh, ihnen Vergnügen zu machen. Mein Vorrat aber war aufgezehrt, und sie riefen immer: Noch mehr! Ich eilte daher stracks in die Küche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Zerbrechen ein noch lustigeres Schauspiel gaben; und so lief ich hin und wider, brachte einen Teller nach dem anderen, wie ich sie auf dem Topfbrett der Reihe nach erreichen konnte, und weil sich jene gar nicht zufrieden gaben, so stürzte ich alles, was ich von Geschirr erschleppen konnte, in gleiches Verderben. Nur später erschien jemand, zu hindern und zu wehren. Das Unglück war geschehen, und man hatte für so viel zerbrochene Töpferware wenigstens eine lustige Geschichte, an der sich besonders die schalkischen Urheber bis an ihr Lebensende ergötzten.«
Dies konnte man in voranalytischen Zeiten ohne Anlaß zum Verweilen und ohne Anstoß lesen; aber später wurde das analytische Gewissen rege. Man hatte sich ja über Erinnerungen aus der frühesten Kindheit bestimmte Meinungen und Erwartungen gebildet, für die man gerne allgemeine Gültigkeit in Anspruch nahm. Es sollte nicht gleichgültig oder bedeutungslos sein, welche Einzelheit des Kindheitslebens sich dem allgemeinen Vergessen der Kindheit entzogen hatte. Vielmehr durfte man vermuten, daß dies im Gedächtnis Erhaltene auch das Bedeutsamste des ganzen Lebensabschnittes sei, und zwar entweder so, daß es solche Wichtigkeit schon zu seiner Zeit besessen, oder anders, daß es sie durch den Einfluß späterer Erlebnisse nachträglich erworben habe.
Allerdings war die hohe Wertigkeit solcher Kindheitserinnerungen nur in seltenen Fällen offensichtlich. Meist erschienen sie gleichgültig, ja nichtig, und es blieb zunächst unverstanden, daß es gerade ihnen gelungen war, der Amnesie zu trotzen; auch wußte derjenige, der sie als sein eigenes Erinnerungsgut seit langen Jahren bewahrt hatte, sie sowenig zu würdigen wie der Fremde, dem er sie erzählte. Um sie in ihrer Bedeutsamkeit zu erkennen, bedurfte es einer gewissen Deutungsarbeit, die entweder nachwies, wie ihr Inhalt durch einen anderen zu ersetzen sei, oder ihre Beziehung zu anderen, unverkennbar wichtigen Erlebnissen aufzeigte, für welche sie als sogenannte Deckerinnerungen eingetreten waren.
In jeder psychoanalytischen Bearbeitung einer Lebensgeschichte gelingt es, die Bedeutung der frühesten Kindheitserinnerungen in solcher Weise aufzuklären. Ja, es ergibt sich in der Regel, daß gerade diejenige Erinnerung, die der Analysierte voranstellt, die er zuerst erzählt, mit der er seine Lebensbeichte einleitet, sich als die wichtigste erweist, als diejenige, welche die Schlüssel zu den Geheimfächern seines Seelenlebens in sich birgt. Aber im Falle jener kleinen Kinderbegebenheit, die in Dichtung und Wahrheit erzählt wird, kommt unseren Erwartungen zu wenig entgegen. Die Mittel und Wege, die bei unseren Patienten zur Deutung führen, sind uns hier natürlich unzugänglich; der Vorfall an sich scheint einer aufspürbaren Beziehung zu wichtigen Lebenseindrücken späterer Zeit nicht fähig zu sein. Ein Schabernack zum Schaden der häuslichen Wirtschaft, unter fremdem Einfluß verübt, ist sicherlich keine passende Vignette für all das, was Goethe aus seinem reichen Leben mitzuteilen hat. Der Eindruck der vollen Harmlosigkeit und Beziehungslosigkeit will sich für diese Kindererinnerung behaupten, und wir mögen die Mahnung mitnehmen, die Anforderungen der Psychoanalyse nicht zu überspannen oder am ungeeigneten Orte vorzubringen.
So hatte ich denn das kleine Problem längst aus meinen Gedanken fallenlassen, als mir der Zufall einen Patienten zuführte, bei dem sich eine ähnliche Kindheitserinnerung in durchsichtigerem Zusammenhange ergab. Es war ein siebenundzwanzigjähriger, hochgebildeter und begabter Mann, dessen Gegenwart durch einen Konflikt mit seiner Mutter ausgefüllt war, der sich so ziemlich auf alle Interessen des Lebens erstreckte, unter dessen Wirkung die Entwicklung seiner Liebesfähigkeit und seiner selbständigen Lebensführung schwer gelitten hatte. Dieser Konflikt ging weit in die Kindheit zurück; man kann wohl sagen, bis in sein viertes Lebensjahr. Vorher war er ein sehr schwächliches, immer kränkelndes Kind gewesen, und doch hatten seine Erinnerungen diese üble Zeit zum Paradies verklärt, denn damals besaß er die uneingeschränkte, mit niemandem geteilte Zärtlichkeit der Mutter. Als er noch nicht vier Jahre war, wurde ein –; heute noch lebender –; Bruder geboren, und in der Reaktion auf diese Störung wandelte er sich zu einem eigensinnigen, unbotmäßigen Jungen, der unausgesetzt die Strenge der Mutter herausforderte. Er kam auch nie mehr in das richtige Geleise.
Als er in meine Behandlung trat –; nicht zum mindesten darum, weil die bigotte Mutter die Psychoanalyse verabscheute –; war die Eifersucht auf den nachgeborenen Bruder, die sich seinerzeit selbst in einem Attentat auf den Säugling in der Wiege geäußert hatte, längst vergessen. Er behandelte jetzt seinen jüngeren Bruder sehr rücksichtsvoll, aber sonderbare Zufallshandlungen, durch die er sonst geliebte Tiere wie seinen Jagdhund oder sorgsam von ihm gepflegte Vögel plötzlich zu schwerem Schaden brachte, waren wohl als Nachklänge jener feindseligen Impulse gegen den kleinen Bruder zu verstehen.
Dieser Patient berichtete nun, daß er um die Zeit des Attentats gegen das ihm verhaßte Kind einmal alles ihm erreichbare Geschirr aus dem Fenster des Landhauses auf die Straße geworfen. Also dasselbe, was Goethe in Dichtung und Wahrheit aus seiner Kindheit erzählt! Ich bemerke, daß mein Patient von fremder Nationalität und nicht in deutscher Bildung erzogen war; er hatte Goethes Lebensbeschreibung niemals gelesen.
Diese Mitteilung mußte mir den Versuch nahelegen, die Kindheitserinnerung Goethes in dem Sinne zu deuten, der durch die Geschichte meines Patienten unabweisbar geworden war. Aber waren in der Kindheit des Dichters die für solche Auffassung erforderlichen Bedingungen nachzuweisen? Goethe selbst macht zwar die Aneiferung der Herren von Ochsenstein für seinen Kinderstreich verantwortlich. Aber seine Erzählung selbst läßt erkennen, daß die erwachsenen Nachbarn ihn nur zur Fortsetzung seines Treibens aufgemuntert hatten. Den Anfang dazu hatte er spontan gemacht, und die Motivierung, die er für dies Beginnen gibt: »Da weiter nichts dabei (beim Spiele) herauskommen wollte«, läßt sich wohl ohne Zwang als Geständnis deuten, daß ihm ein wirksames Motiv seines Handelns zur Zeit der Niederschrift und wahrscheinlich auch lange Jahre vorher nicht bekannt war.
Es ist bekannt, daß Joh. Wolfgang und seine Schwester Cornelia die ältesten Überlebenden einer größeren, recht hinfälligen Kinderreihe waren. Dr. Hanns Sachs war so freundlich, mir die Daten zu verschaffen, die sich auf diese früh verstorbenen Geschwister Goethes beziehen.
Geschwister Goethes:
Hermann Jakob, getauft Montag, den 27. November 1752, erreichte ein Alter von sechs Jahren und sechs Wochen, beerdigt 13. Jänner 1759.
Katharina Elisabetha, getauft Montag, den 9. September 1754, beerdigt Donnerstag, den 22. Dezember 1755 (ein Jahr, vier Monate alt).
Johanna Maria, getauft Dienstag, den 29. März 1757, und beerdigt Samstag, den 11. August 1759 (zwei Jahre, vier Monate alt). (Dies war jedenfalls das von ihrem Bruder gerühmte sehr schöne und angenehme Mädchen.)
Georg Adolph, getauft Sonntag, den 15. Juni 1760; beerdigt, acht Monate alt, Mittwoch, den 18. Februar 1761.
Goethes nächste Schwester, Cornelia Friederica Christiana, war am 7. Dezember 1750 geboren, als er fünfviertel Jahre alt war. Durch diese geringe Altersdifferenz ist sie als Objekt der Eifersucht so gut wie ausgeschlossen. Man weiß, daß Kinder, wenn ihre Leidenschaften erwachen, niemals so heftige Reaktionen gegen die Geschwister entwickeln, welche sie vorfinden, sondern ihre Abneigung gegen die neu Ankommenden richten. Auch ist die Szene, um deren Deutung wir uns bemühen, mit dem zarten Alter Goethes bei oder bald nach der Geburt Cornelias unvereinbar.
Bei der Geburt des ersten Brüderchens Hermann Jakob war Joh. Wolfgang dreieinviertel Jahre alt. Ungefähr zwei Jahre später, als er etwa fünf Jahre alt war, wurde die zweite Schwester geboren. Beide Altersstufen kommen für die Datierung des Geschirrhinauswerfens in Betracht; die erstere verdient vielleicht den Vorzug, sie würde auch die bessere Übereinstimmung mit dem Falle meines Patienten ergeben, der bei der Geburt seines Bruders etwa dreidreiviertel Jahre zählte.
Der Bruder Hermann Jakob, auf den unser Deutungsversuch in solcher Art hingelenkt wird, war übrigens kein so flüchtiger Gast in der Goetheschen Kinderstube wie die späteren Geschwister. Man könnte sich verwundern, daß die Lebensgeschichte seines großen Bruders nicht ein Wörtchen des Gedenkens an ihn bringt [Fußnote]Ich bediene mich dieser Gelegenheit, um eine unrichtige Behauptung, die nicht hätte vorfallen sollen, zurückzunehmen. An einer späteren Stelle dieses ersten Buches wird der jüngere Bruder doch erwähnt und geschildert. Es geschieht bei der Erinnerung an die lästigen Kinderkrankheiten, unter denen auch dieser Bruder »nicht wenig litt«. »Er war von zarter Natur, still und eigensinnig, und wir hatten niemals ein eigentliches Verhältnis zusammen. Auch überlebte er kaum die Kinderjahre.«. Er wurde über sechs Jahre alt, und Joh. Wolfgang war nahe an zehn Jahre, als er starb. Dr. Ed. Hitschmann, der so freundlich war, mir seine Notizen über diesen Stoff zur Verfügung zu stellen, meint:
» Auch der kleine Goethe hat ein Brüderchen nicht ungern sterben gesehen. Wenigstens berichtete seine Mutter nach Bettina Brentanos Wiedererzählung folgendes: ›Sonderbar fiel es der Mutter auf, daß er bei dem Tod seines jüngeren Bruders Jakob, der sein Spielkamerad war, keine Träne vergoß, er schien vielmehr eine Art Ärger über die Klagen der Eltern und Geschwister zu haben; da die Mutter nun später den Trotzigen fragte, ob er den Bruder nicht lieb gehabt habe, lief er in seine Kammer, brachte unter dem Bett hervor eine Menge Papiere, die mit Lektionen und Geschichtchen beschrieben waren, er sagte ihr, daß er dies alles gemacht habe, um es dem Bruder zu lehren.‹ Der ältere Bruder hätte also immerhin gern Vater mit dem Jüngeren gespielt und ihm seine Überlegenheit gezeigt.«
Wir könnten uns also die Meinung bilden, das Geschirrhinauswerfen sei eine symbolische, oder sagen wir es richtiger: eine magische Handlung, durch welche das Kind (Goethe sowie mein Patient) seinen Wunsch nach Beseitigung des störenden Eindringlings zu kräftigem Ausdruck bringt. Wir brauchen das Vergnügen des Kindes beim Zerschellen der Gegenstände nicht zu bestreiten; wenn eine Handlung bereits an sich lustbringend ist, so ist dies keine Abhaltung, sondern eher eine Verlockung, sie auch im Dienste anderer Absichten zu wiederholen. Aber wir glauben nicht, daß es die Lust am Klirren und Brechen war, welche solchen Kinderstreichen einen dauernden Platz in der Erinnerung des Erwachsenen sichern konnte. Wir sträuben uns auch nicht, die Motivirung der Handlung um einen weiteren Beitrag zu komplizieren. Das Kind, welches das Geschirr zerschlägt, weiß wohl, daß es etwas Schlechtes tut, worüber die Erwachsenen schelten werden, und wenn es sich durch dieses Wissen nicht zurückhalten läßt, so hat es wahrscheinlich einen Groll gegen die Eltern zu befriedigen; es will sich schlimm zeigen.
Der Lust am Zerbrechen und am Zerbrochenen wäre auch Genüge getan, wenn das Kind die gebrechlichen Gegenstände einfach auf den Boden würfe. Die Hinausbeförderung durch das Fenster auf die Straße bliebe dabei ohne Erklärung. Dies » Hinaus« scheint aber ein wesentliches Stück der magischen Handlung zu sein und dem verborgenen Sinn derselben zu entstammen. Das neue Kind soll fortgeschafft werden, durchs Fenster möglicherweise darum, weil es durchs Fenster gekommen ist. Die ganze Handlung wäre dann gleichwertig jener uns bekanntgewordenen wörtlichen Reaktion eines Kindes, als man ihm mitteilte, daß der Storch ein Geschwisterchen gebracht. »Er soll es wieder mitnehmen«, lautete sein Bescheid.
Indes, wir verhehlen uns nicht, wie mißlich es –; von allen inneren Unsicherheiten abgesehen –; bleibt, die Deutung einer Kinderhandlung auf eine einzige Analogie zu begründen. Ich hatte darum auch meine Auffassung der kleinen Szene aus Dichtung und Wahrheit durch Jahre zurückgehalten. Da bekam ich eines Tages einen Patienten, der seine Analyse mit folgenden, wortgetreu fixierten Sätzen einleitete:
»Ich bin das älteste von acht oder neun Geschwistern [Fußnote]Ein flüchtiger Irrtum auffälliger Natur. Es ist nicht abzuweisen, daß er bereits durch die Beseitigungstendenz gegen den Bruder induziert ist. (Vgl. Ferenczi, ›Über passagere Symptombildung während der Analyse‹, 1912.). Eine meiner ersten Erinnerungen ist, daß der Vater, in Nachtkleidung auf seinem Bette sitzend, mir lachend erzählt, daß ich einen Bruder bekommen habe. Ich war damals dreidreiviertel Jahre alt; so groß ist der Altersunterschied zwischen mir und meinem nächsten Bruder. Dann weiß ich, daß ich kurze Zeit nachher (oder war es ein Jahr vorher?) [Fußnote]Dieser den wesentlichen Punkt der Mitteilung als Widerstand annagende Zweifel wurde vom Patienten bald nachher selbständig zurückgezogen. einmal verschiedene Gegenstände, Bürsten –; oder war es nur eine Bürste? –; Schuhe und anderes aus dem Fenster auf die Straße geworfen habe. Ich habe auch noch eine frühere Erinnerung. Als ich zwei Jahre alt war, übernachtete ich mit den Eltern in einem Hotelzimmer in Linz auf der Reise ins Salzkammergut. Ich war damals so unruhig in der Nacht und machte ein solches Geschrei, daß mich der Vater schlagen mußte.«
Vor dieser Aussage ließ ich jeden Zweifel fallen. Wenn bei analytischer Einstellung zwei Dinge unmittelbar nacheinander, wie in einem Atem vorgebracht werden, so sollen wir diese Annäherung auf Zusammenhang umdeuten. Es war also so, als ob der Patient gesagt hätte: Weil ich erfahren, daß ich einen Bruder bekommen habe, habe ich einige Zeit nachher jene Gegenstände auf die Straße geworfen. Das Hinauswerfen der Bürsten, Schuhe usw. gibt sich als Reaktion auf die Geburt des Bruders zu erkennen. Es ist auch nicht unerwünscht, daß die fortgeschafften Gegenstände in diesem Falle nicht Geschirr, sondern andere Dinge waren, wahrscheinlich solche, wie sie das Kind eben erreichen konnte ... Das Hinausbefördern (durchs Fenster auf die Straße) erweist sich so als das Wesentliche der Handlung, die Lust am Zerbrechen, am Klirren und die Art der Dinge, an denen »die Exekution vollzogen wird«, als inkonstant und unwesentlich.
Natürlich gilt die Forderung des Zusammenhanges auch für die dritte Kindheitserinnerung des Patienten, die, obwohl die früheste, an das Ende der kleinen Reihe gerückt ist. Es ist leicht, sie zu erfüllen. Wir verstehen, daß das zweijährige Kind darum so unruhig war, weil es das Beisammensein von Vater und Mutter im Bette nicht leiden wollte. Auf der Reise war es wohl nicht anders möglich, als das Kind zum Zeugen dieser Gemeinschaft werden zu lassen. Von den Gefühlen, die sich damals in dem kleinen Eifersüchtigen regten, ist ihm die Erbitterung gegen das Weib verblieben, und diese hat eine dauernde Störung seiner Liebesentwicklung zur Folge gehabt.
Als ich nach diesen beiden Erfahrungen im Kreise der psychoanalytischen Gesellschaft die Erwartung äußerte, Vorkommnisse solcher Art dürften bei kleinen Kindern nicht zu den Seltenheiten gehören, stellte mir Frau Dr. v. Hug-Hellmuth zwei weitere Beobachtungen zur Verfügung, die ich hier folgen lasse:
I
»Mit zirka dreieinhalb Jahren hatte der kleine Erich ›urplötzlich‹ die Gewohnheit angenommen, alles, was ihm nicht paßte, zum Fenster hinauszuwerfen. Aber er tat es auch mit Gegenständen, die ihm nicht im Wege waren und ihn nichts angingen. Gerade am Geburtstag des Vaters –; da zählte er drei Jahre viereinhalb Monate –; warf er eine schwere Teigwalze, die er flugs aus der Küche ins Zimmer geschleppt hatte, aus einem Fenster der im dritten Stockwerk gelegenen Wohnung auf die Straße. Einige Tage später ließ er den Mörserstößel, dann ein Paar schwerer Bergschuhe des Vaters, die er erst aus dem Kasten nehmen mußte, folgen [Fußnote]»Immer wählte er schwere Gegenstände.«.
Damals machte die Mutter im siebenten oder achten Monate ihrer Schwangerschaft eine fausse couche[Fußnote]Fehlgeburt, nach der das Kind ›wie ausgewechselt brav und zärtlich still‹ war. Im fünften oder sechsten Monate sagte er wiederholt zur Mutter: ›Mutti, ich spring' dir auf den Bauch‹ oder ›Mutti, ich drück' dir den Bauch ein‹. Und kurz vor der fausse couche, im Oktober: ›Wenn ich schon einen Bruder bekommen soll, so wenigstens nach dem Christkindl.‹«
II
»Eine junge Dame von neunzehn Jahren gibt spontan als früheste Kindheitserinnerung folgende:
›Ich sehe mich furchtbar ungezogen, zum Hervorkriechen bereit, unter dem Tische im Speisezimmer sitzen. Auf dem Tische steht meine Kaffeeschale –; ich sehe noch jetzt deutlich das Muster des Porzellans vor mir –;, die ich in dem Augenblick, als Großmama ins Zimmer trat, zum Fenster hinauswerfen wollte.
Es hatte sich nämlich niemand um mich gekümmert, und indessen hatte sich auf dem Kaffee eine ›Haut‹ gebildet, was mir immer fürchterlich war und heute noch ist.
An diesem Tage wurde mein um zweieinhalb Jahre jüngerer Bruder geboren, deshalb hatte niemand Zeit für mich.
Man erzählt mir noch immer, daß ich an diesem Tage unausstehlich war; zu Mittag hatte ich das Lieblingsglas des Papas vom Tische geworfen, tagsüber mehrmals mein Kleidchen beschmutzt und war von früh bis abends übelster Laune. Auch ein Badepüppchen hatte ich in meinem Zorne zertrümmert.‹«
Diese beiden Fälle bedürfen kaum eines Kommentars. Sie bestätigen ohne weitere analytische Bemühung, daß die Erbitterung des Kindes über das erwartete oder erfolgte Auftreten eines Konkurrenten sich in dem Hinausbefördern von Gegenständen durch das Fenster wie auch durch andere Akte von Schlimmheit und Zerstörungssucht zum Ausdruck bringt. In der ersten Beobachtung symbolisieren wohl die »schweren Gegenstände« die Mutter selbst, gegen welche sich der Zorn des Kindes richtet, solange das neue Kind noch nicht da ist. Der dreieinhalbjährige Knabe weiß um die Schwangerschaft der Mutter und ist nicht im Zweifel darüber, daß sie das Kind in ihrem Leibe beherbergt. Man muß sich hiebei an den »kleinen Hans« [Fußnote]›Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben‹. erinnern und an seine besondere Angst vor schwer beladenen Wagen [Fußnote]Für diese Symbolik der Schwangerschaft hat mir vor einiger Zeit eine mehr als fünfzigjährige Dame eine weitere Bestätigung erbracht. Es war ihr wiederholt erzählt worden, daß sie als kleines Kind, das kaum sprechen konnte, den Vater aufgeregt zum Fenster zu ziehen pflegte, wenn ein schwerer Möbelwagen auf der Straße vorbeifuhr. Mit Rücksicht auf ihre Wohnungserinnerungen läßt sich feststellen, daß sie damals jünger war als zweidreiviertel Jahre. Um diese Zeit wurde ihr nächster Bruder geboren und infolge dieses Zuwachses die Wohnung gewechselt. Ungefähr gleichzeitig hatte sie oft vor dem Einschlafen die ängstliche Empfindung von etwas unheimlich Großem, das auf sie zukam, und dabei »wurden ihr die Hände so dick«.. An der zweiten Beobachtung ist das frühe Alter des Kindes, zweieinhalb Jahre, bemerkenswert.
Wenn wir nun zur Kindheitserinnerung Goethes zurückkehren und an ihrer Stelle in Dichtung und Wahrheit einsetzen, was wir aus der Beobachtung anderer Kinder erraten zu haben glauben, so stellt sich ein tadelloser Zusammenhang her, den wir sonst nicht entdeckt hätten. Es heißt dann: Ich bin ein Glückskind gewesen; das Schicksal hat mich am Leben erhalten, obwohl ich für tot zur Welt gekommen bin. Meinen Bruder aber hat es beseitigt, so daß ich die Liebe der Mutter nicht mit ihm zu teilen brauchte. Und dann geht der Gedankenweg weiter, zu einer anderen in jener Frühzeit Verstorbenen, der Großmutter, die wie ein freundlicher, stiller Geist in einem anderen Wohnraum hauste.
Ich habe es aber schon an anderer Stelle ausgesprochen: Wenn man der unbestrittene Liebling der Mutter gewesen ist, so behält man fürs Leben jenes Eroberergefühl, jene Zuversicht des Erfolges, welche nicht selten wirklich den Erfolg nach sich zieht. Und eine Bemerkung solcher Art wie: Meine Stärke wurzelt in meinem Verhältnis zur Mutter, hätte Goethe seiner Lebensgeschichte mit Recht voranstellen dürfen.
Eine Teufelsneurose im siebzehnten Jahrhundert (1923)
An den Neurosen der Kinderzeit haben wir gelernt, daß manches hier mühelos mit freiem Auge zu sehen ist, was sich späterhin nur gründlicher Forschung zu erkennen gibt. Eine ähnliche Erwartung wird sich für die neurotischen Erkrankungen früherer Jahrhunderte ergeben, wenn wir nur darauf gefaßt sind, dieselben unter anderen Überschriften als unsere heutigen Neurosen zu finden. Wir dürfen nicht erstaunt sein, wenn die Neurosen dieser frühen Zeiten im dämonologischen Gewande auftreten, während die der unpsychologischen Jetztzeit im hypochondrischen, als organische Krankheiten verkleidet, erscheinen. Mehrere Autoren, voran Charcot, haben bekanntlich in den Darstellungen der Besessenheit und Verzückung, wie sie uns die Kunst hinterlassen hat, die Äußerungsformen der Hysterie agnosziert; es wäre nicht schwer gewesen, in den Geschichten dieser Kranken die Inhalte der Neurose wiederzufinden, wenn man ihnen damals mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte.
Die dämonologische Theorie jener dunkeln Zeiten hat gegen alle somatischen Auffassungen der »exakten« Wissenschaftsperiode recht behalten. Die Besessenheiten entsprechen unseren Neurosen, zu deren Erklärung wir wieder psychische Mächte heranziehen. Die Dämonen sind uns böse, verworfene Wünsche, Abkömmlinge abgewiesener, verdrängter Triebregungen. Wir lehnen bloß die Projektion in die äußere Welt ab, welche das Mittelalter mit diesen seelischen Wesen vornahm; wir lassen sie im Innenleben der Kranken, wo sie hausen, entstanden sein.
I. Die Geschichte des Malers Christoph Haitzmann
Einen Einblick in eine solche dämonologische Neurose des siebzehnten Jahrhunderts verdanke ich dem freundlichen Interesse des Herrn Hofrats Dr. R. Payer-Thurn, Direktor der ehemals k. k. Fideikommißbibliothek in Wien. Payer-Thurn hatte in der Bibliothek ein aus dem Gnadenort Mariazell stammendes Manuskript aufgefunden, in dem über eine wunderbare Erlösung von einem Teufelspakt durch die Gnade der heiligen Maria ausführlich berichtet wird. Sein Interesse wurde durch die Beziehung dieses Inhalts zur Faustsage geweckt und wird ihn zu einer eingehenden Darstellung und Bearbeitung des Stoffes veranlassen. Da er aber fand, daß die Person, deren Erlösung beschrieben wird, an Krampfanfällen und Visionen litt, wandte er sich an mich um eine ärztliche Begutachtung des Falles. Wir sind übereingekommen, unsere Arbeiten unabhängig voneinander und gesondert zu veröffentlichen. Ich statte ihm für seine Anregung wie für mancherlei Hilfeleistung beim Studium des Manuskripts meinen Dank ab.
Diese dämonologische Krankengeschichte bringt wirklich einen wertvollen Fund, der ohne viel Deutung klar zutage liegt, wie manche Fundstelle als gediegenes Metall liefert, was anderwärts mühsam aus dem Erz geschmolzen werden muß.
Das Manuskript, von dem mir eine genaue Abschrift vorliegt, zerlegt sich uns in zwei Stücke von ganz verschiedener Natur: in den lateinisch abgefaßten Bericht des mönchischen Schreibers oder Kompilators und in ein deutsch geschriebenes Tagebuchbruchstück des Patienten. Der erste Teil enthält den Vorbericht und die eigentliche Wunderheilung; der zweite Teil kann für die geistlichen Herren nicht von Bedeutung gewesen sein, um so wertvoller ist er für uns. Er trägt viel dazu bei, unser sonst schwankendes Urteil über den Krankheitsfall zu festigen, und wir haben guten Grund, den Geistlichen zu danken, daß sie dies Dokument erhalten haben, obgleich es ihrer Tendenz nichts mehr leistet, ja diese eher gestört haben mag.
Ehe ich aber in die Zusammensetzung der kleinen handschriftlichen Broschüre, die den Titel
» Trophaeum Mariano-Cellense«
führt, weiter eingehe, muß ich ein Stück ihres Inhalts erzählen, das ich dem Vorbericht entnehme.
Am 5. September 1677 wurde der Maler Christoph Haitzmann, ein Bayer, mit einem Geleitbrief des Pfarrers von Pottenbrunn (in Niederösterreich) nach dem nahen Mariazell gebracht [Fußnote]Das Alter des Malers ist nirgends angegeben. Der Zusammenhang läßt einen Mann zwischen 30 und 40, wahrscheinlich der unteren Grenze näher, erraten. Er verstarb, wie wir hören werden, im Jahre 1700.. Er habe sich in Ausübung seiner Kunst mehrere Monate in Pottenbrunn aufgehalten, sei dort am 29. August in der Kirche von schrecklichen Krämpfen befallen worden, und als sich diese in den nächsten Tagen wiederholten, habe ihn der Praefectus Dominii Pottenbrunnensis examiniert, was ihn wohl bedrücke, ob er sich wohl in unerlaubten Verkehr mit dem bösen Geist eingelassen habe [Fußnote]Die Möglichkeit, daß diese Fragestellung dem Leidenden die Phantasie seines Teufelspaktes eingegeben, »suggeriert« hat, sei hier nur gestreift.. Worauf er gestanden, daß er wirklich vor neun Jahren zu einer Zeit der Verzagtheit an seiner Kunst und des Zweifels an seiner Selbsterhaltung dem Teufel, der ihn neunmal versucht, nachgegeben und sich schriftlich verpflichtet, ihm nach Ablauf dieser Zeit mit Leib und Seele anzugehören. Das Ende des Termins nahe mit dem 24. des laufenden Monats [Fußnote]quorum et finis 24 mensis hujus futurus appropinquat.. Der Unglückliche bereue und sei überzeugt, daß nur die Gnade der Mutter Gottes von Mariazell ihn retten könne, indem sie den Bösen zwinge, ihm die mit Blut geschriebene Verschreibung herauszugeben. Aus diesem Grund erlaube man sich miserum hunc hominem omni auxilio destitutum dem Wohlwollen der Herren von Mariazell zu empfehlen.
Soweit der Pfarrer von Pottenbrunn, Leopoldus Braun, am 1. September 1677.
Ich kann nun in der Analyse des Manuskripts fortfahren. Es besteht also aus drei Teilen:
1. einem farbigen Titelblatt, welches die Szene der Verschreibung und die der Erlösung in der Kapelle von Mariazell darstellt; auf dem nächsten Blatt sind acht ebenfalls farbige Zeichnungen der späteren Erscheinungen des Teufels mit kurzen Beischriften in deutscher Sprache. Diese Bilder sind nicht Originale, sondern Kopien –; wie uns feierlich versichert wird: getreue Kopien –; nach den ursprünglichen Malereien des Chr. Haitzmann;
2. aus dem eigentlichen Trophaeum Mariano-Cellense (lateinisch), dem Werk eines geistlichen Kompilators, der sich am Ende »P. A. E.« unterzeichnet und diesen Buchstaben vier Verszeilen, welche seine Biographie enthalten, beifügt. Den Abschluß bildet ein Zeugnis des Abtes Kilian von St. Lambert vom 9. September 1729, welches in anderer Schrift als der des Kompilators die genaue Übereinstimmung des Manuskripts und der Bilder mit den im Archiv aufbewahrten Originalen bestätigt. Es ist nicht angegeben, in welchem Jahr das Trophaeum angefertigt wurde. Es steht uns frei anzunehmen, daß es im gleichen Jahr geschah, in dem der Abt Kilian das Zeugnis ausstellte, also 1729 oder, da 1714 die letzte im Text genannte Jahreszahl ist, das Werk des Kompilators in irgendeine Zeit zwischen 1714 und 1729 zu verlegen. Das Wunder, welches durch diese Schrift vor Vergessenheit bewahrt werden sollte, hat sich im Jahr 1677 zugetragen, also 37 bis 52 Jahre vorher;
3. aus dem deutsch abgefaßten Tagebuch des Malers, welches von der Zeit seiner Erlösung in der Kapelle bis zum 13. Januar des nächsten Jahres 1678 reicht. Es ist in den Text des Trophaeum kurz vor dessen Ende eingeschaltet.
Den Kern des eigentlichen Trophaeum bilden zwei Schriftstücke, der bereits erwähnte Geleitbrief des Pfarrers Leopold Braun von Pottenbrunn vom 1. September 1677, und der Bericht des Abtes Franciscus von Mariazell und St. Lambert, der die Wunderheilung schildert, vom 12. September 1677, also nur wenige Tage später datiert. Die Tätigkeit des Redakteurs oder Kompilators P. A. E. hat eine Einleitung geliefert, welche die beiden Aktenstücke gleichsam verschmilzt, ferner einige wenig bedeutsame Verbindungsstücke und am Schluß einen Bericht über die weiteren Schicksale des Malers nach einer im Jahre 1714 eingeholten Erkundigung beigefügt [Fußnote]Dies würde dafür sprechen, daß 1714 auch das Datum der Abfassung des Trophaeum ist..
Die Vorgeschichte des Malers wird also im Trophaeum dreimal erzählt,
1. im Geleitbrief des Pfarrers von Pottenbrunn,
2. im feierlichen Bericht des Abtes Franciscus und
3. in der Einleitung des Redakteurs. Beim Vergleich dieser drei Quellen stellen sich gewisse Unstimmigkeiten heraus, die zu verfolgen nicht unwichtig sein wird.
Ich kann jetzt die Geschichte des Malers fortsetzen. Nachdem er in Mariazell lange gebüßt und gebetet, erhält er am 8. September, dem Tag Maria Geburt, um die zwölfte Nachtstunde vom Teufel, der in der heiligen Kapelle als geflügelter Drache erscheint, den mit Blut geschriebenen Pakt zurück. Wir werden später zu unserem Befremden erfahren, daß in der Geschichte des Malers Chr. Haitzmann zwei Verschreibungen an den Teufel vorkommen, eine frühere, mit schwarzer Tinte und eine spätere, mit Blut geschriebene. In der mitgeteilten Beschwörungsszene handelt es sich, wie auch noch das Bild auf dem Titelblatt erkennen läßt, um die blutige, also um die spätere.
An dieser Stelle könnte sich bei uns ein Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit der geistlichen Berichterstatter erheben, das uns mahnen würde, doch nicht unsere Arbeit an ein Produkt mönchischen Aberglaubens zu verschwenden. Es wird erzählt, daß mehrere, mit Namen benannte Geistliche dem Exorzierten während der ganzen Zeit Beistand leisteten und auch während der Teufelserscheinung in der Kapelle anwesend waren. Wenn behauptet würde, daß auch sie den teuflischen Drachen gesehen haben, wie er dem Maler den rot beschriebenen Zettel hinhält ( Schedam sibi porrigentem conspexisset), so stünden wir vor mehreren unangenehmen Möglichkeiten, unter denen die einer kollektiven Halluzination noch die mildeste wäre. Allein der Wortlaut des vom Abt Franciscus ausgestellten Zeugnisses schlägt dieses Bedenken nieder. Es wird darin keineswegs behauptet, daß auch die geistlichen Beistände den Teufel erschaut haben, sondern es heißt ehrlich und nüchtern, daß der Maler sich plötzlich von den Geistlichen, die ihn hielten, losgerissen, in die Ecke der Kapelle, wo er die Erscheinung sah, gestürmt und dann mit dem Zettel in der Hand zurückgekommen sei [Fußnote]»... [poenitens] ipsumque Daemonem ad Aram Sac. Cellae per fenestrellam in cornu Epistolae, Schedam sibi porrigentem conspexisset, eo advolans e Religiosorum manibus, qui eum tenebant, ipsam Schedam ad manum obtinuit, ...«.
Das Wunder war groß, der Sieg der heiligen Mutter über Satan unzweifelhaft, die Heilung aber leider nicht beständig. Es sei nochmals zur Ehre der geistlichen Herren hervorgehoben, daß sie diese Tatsache nicht verschweigen. Der Maler verließ Mariazell nach kurzer Zeit im besten Wohlbefinden und begab sich dann nach Wien, wo er bei einer verheirateten Schwester wohnte. Dort fingen am 11. Oktober neuerliche, zum Teil sehr schwere Anfälle an, über die das Tagebuch bis zum 13. Januar berichtet. Es waren Visionen, Abwesenheiten, in denen er die mannigfaltigsten Dinge sah und erlebte, Krampfzustände, begleitet von den schmerzhaftesten Sensationen, einmal ein Zustand von Lähmung der Beine u. dgl. Diesmal plagte ihn aber nicht der Teufel, sondern es waren heilige Gestalten, die ihn heimsuchten, Christus, die heilige Jungfrau selbst. Merkwürdig, daß er unter diesen himmlischen Erscheinungen und den Strafen, die sie über ihn verhängten, nicht minder litt als früher unter dem Verkehr mit dem Teufel. Er faßte auch diese neuen Erlebnisse im Tagebuch als Erscheinungen des Teufels zusammen und beklagte sich über maligni Spiritus manifestationes, als er im Mai 1678 nach Mariazell zurückkehrte.
Den geistlichen Herren gab er als Motiv seiner Rückkehr an, daß er auch eine andere, frühere, mit Tinte geschriebene Verschreibung vom Teufel zu fordern habe [Fußnote]Diese wäre, im September 1668 ausgestellt, 9½ Jahre später, im Mai 1678, längst verfallen gewesen.. Auch diesmal verhalfen ihm die heilige Maria und die frommen Patres zur Erfüllung seiner Bitte. Aber der Bericht, wie das geschah, ist schweigsam. Es heißt nur mit kurzen Worten: qua iuxta votum redditâ. Er betete wieder, und er erhielt den Vertrag zurück. Dann fühlte er sich ganz frei und trat in den Orden der Barmherzigen Brüder ein.
Man hat wiederum Anlaß anzuerkennen, daß die offenkundige Tendenz seiner Bemühung den Kompilator nicht dazu verführt hat, die von einer Krankengeschichte zu fordernde Wahrhaftigkeit zu verleugnen. Denn er verschweigt nicht, was die Erkundigung nach dem Ausgang des Malers beim Vorstand des Klosters der Barmherzigen Brüder im Jahre 1714 ergeben. Der R. P r Provincialis berichtet, daß Bruder Chrysostomus noch wiederholt Anfechtungen des bösen Geistes erfahren hat, der ihn zu einem neuen Pakt verleiten wollte, und zwar nur dann, » wenn er etwas mehrers von Wein getrunken«, durch die Gnade Gottes sei es aber immer möglich gewesen, ihn abzuweisen. Bruder Chrysostomus sei dann im Kloster des Ordens Neustatt an der Moldau im Jahre 1700 » sanft und trostreich« an der Hektica verstorben.
II. Das Motiv des Teufelspakts
Wenn wir diese Teufelsverschreibung wie eine neurotische Krankengeschichte betrachten, wendet sich unser Interesse zunächst der Frage nach ihrer Motivierung zu, die ja mit der Veranlassung innig zusammenhängt. Warum verschreibt man sich dem Teufel? Dr. Faust fragt zwar verächtlich: »Was willst du armer Teufel geben?« Aber er hat nicht recht, der Teufel hat als Entgelt für die unsterbliche Seele allerlei zu bieten, was die Menschen hoch einschätzen: Reichtum, Sicherheit vor Gefahren, Macht über die Menschen und über die Kräfte der Natur, selbst Zauberkünste und vor allem anderen: Genuß, Genuß bei schönen Frauen. Diese Leistungen oder Verpflichtungen des Teufels pflegen auch im Vertrag mit ihm ausdrücklich erwähnt zu werden [Fußnote]Siehe in Faust, I. Teil, Studierzimmer: »Ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden, Auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhn; Wenn wir uns drüben wiederfinden, So sollst du mir das Gleiche thun.«. Was ist nun für Christoph Haitzmann das Motiv seines Pakts gewesen?
Merkwürdigerweise keiner von all diesen so natürlichen Wünschen. Um jeden Zweifel daran zu bannen, braucht man nur die kurzen Bemerkungen einzusehen, die der Maler zu den von ihm abgebildeten Teufelserscheinungen hinzusetzt. Zum Beispiel lautet die Note zur dritten Vision:
» Zum driten ist er mir in anderthalb Jahren in dißer abscheühlichen Gestalt erschinen, mit einen Buuch in der Handt, darin lauter Zauberey und schwarze Kunst war begrüffen . . .«
Aber aus der Beischrift zu einer späteren Erscheinung erfahren wir, daß der Teufel ihm heftige Vorwürfe macht, warum er » sein vorgemeldtes Buuch verbrennt«, und ihn zu zerreißen droht, wenn er es ihm nicht wieder beschafft.
Bei der vierten Erscheinung zeigt er ihm einen großen gelben Beutel und einen großen Dukaten und verspricht ihm jederzeit soviel davon, als er nur haben will, » aber ich solliches gar nit angenomben«, kann sich der Maler rühmen.
Ein anderes Mal verlangt er von ihm, er solle sich amüsieren, unterhalten lassen. Wozu der Maler bemerkt, » welliches zwar auch auf sein begehren geschehen aber ich yber drey Tag nit continuirt, und gleich widerumb außgelöst worden«.
Da er nun Zauberkünste, Geld und Genuß zurückweist, wenn der Teufel sie ihm bietet, geschweige denn, daß er sie zu Bedingungen des Pakts gemacht hätte, wird es wirklich dringlich zu wissen, was dieser Maler eigentlich vom Teufel wollte, als er sich ihm verschrieb. Irgendein Motiv, sich mit dem Teufel einzulassen, muß er doch gehabt haben.
Das Trophaeum gibt auch sichere Auskunft über diesen Punkt. Er war schwermütig geworden, konnte nicht, oder wollte nicht recht arbeiten und hatte Sorge um die Erhaltung seiner Existenz, also melancholische Depression mit Arbeitshemmung und (berechtigter) Lebenssorge. Wir sehen, daß wir es wirklich mit einer Krankengeschichte zu tun haben, erfahren auch, welches die Veranlassung dieser Erkrankung war, die der Maler selbst in den Bemerkungen zu den Teufelsbildern geradezu eine Melancholie nennt (» solte mich darmit belustigen und meläncoley vertreiben«). Von unseren drei Quellen erwähnt zwar die erste, der Geleitbrief des Pfarrers, nur den Depressionszustand (» dum artis suae progressum emolumentumque secuturum pusillanimis perpenderet«), aber die zweite, der Bericht des Abtes Franciscus, weiß auch die Quelle dieser Verzagtheit oder Verstimmung zu nennen, denn hier heißt es » acceptâ aliquâ pusillanimitate ex morte parentis« und dementsprechend auch in der Einleitung des Kompilators mit den nämlichen, nur umgestellten Worten: » ex morte parentis acceptâ aliquâ pusillanimitate.« Es war also sein Vater gestorben, er darüber in eine Melancholie verfallen, da näherte sich ihm der Teufel, fragte ihn, warum er so bestürzt und traurig sei, und versprach ihm » auf alle Weiß zu helfen und an die Handt zu gehen« [Fußnote]Bild 1 und Legende dazu auf dem Titelblatt, der Teufel in Gestalt eines » Ersamen Bürgers«..
Da verschreibt sich also einer dem Teufel, um von einer Gemütsdepression befreit zu werden. Gewiß ein ausgezeichnetes Motiv nach dem Urteil eines jeden, der sich in die Qualen eines solchen Zustandes einfühlen kann und der überdies weiß, wie wenig ärztliche Kunst von diesem Leiden zu lindern versteht. Doch würde keiner, der dieser Erzählung so weit gefolgt ist, erraten können, wie der Wortlaut der Verschreibung an den Teufel (oder vielmehr der beiden Verschreibungen, einer ersten, mit Tinte und einer zweiten, etwa ein Jahr später, mit Blut geschriebenen, beide angeblich noch in der Schatzkammer von Mariazell vorhanden und im Trophaeum mitgeteilt), wie also der Wortlaut dieser Verschreibungen gelautet hat.
Diese Verschreibungen bringen uns zwei starke Überraschungen. Erstens nennen sie nicht eine Verpflichtung des Teufels, für deren Einhaltung die ewige Seligkeit verpfändet wird, sondern nur eine Forderung des Teufels, die der Maler einhalten soll. Es berührt uns als ganz unlogisch, absurd, daß dieser Mensch seine Seele einsetzt nicht für etwas, was er vom Teufel bekommen, sondern was er dem Teufel leisten soll. Noch sonderbarer klingt die Verpflichtung des Malers. Erste, mit schwarzer Tinte geschriebene »Syngrapha«:
Ich Christoph Haizmann undterschreibe mich disen Herrn: sein leibeigent Sohn auff 9. Jahr. 1669 Jahr.
Zweite, mit Blut geschrieben:
Anno 1669
Christoph Haizmann. Ich verschreibe mich disen Satan, ich sein leibeigner Sohn zu sein, vnd in 9. Jahr ihm mein Leib vndt Seel zu zugeheren.
Alles Befremden entfällt aber, wenn wir den Text der Verschreibungen so zurechtrücken, daß in ihr als Forderung des Teufels dargestellt wird, was vielmehr seine Leistung, also Forderung des Malers ist. Dann bekäme der unverständliche Pakt einen geraden Sinn und könnte solcherart ausgelegt werden: Der Teufel verpflichtet sich, dem Maler durch neun Jahre den verlorenen Vater zu ersetzen. Nach Ablauf dieser Zeit verfällt der Maler mit Leib und Seele dem Teufel, wie es bei diesen Händeln allgemein üblich war. Der Gedankengang des Malers, der seinen Pakt motiviert, scheint ja der folgende zu sein: Durch den Tod des Vaters hat er Stimmung und Arbeitsfähigkeit eingebüßt; wenn er nun einen Vaterersatz bekommt, hofft er das Verlorene wiederzugewinnen.
Jemand, der durch den Tod seines Vaters melancholisch geworden ist, muß doch diesen Vater liebgehabt haben. Dann ist es aber sehr sonderbar, daß ein solcher Mensch auf die Idee kommen kann, den Teufel zum Ersatz für den geliebten Vater zu nehmen.
III. Der Teufel als Vaterersatz
Ich besorge, eine nüchterne Kritik wird uns nicht zugeben, daß wir mit jener Umdeutung den Sinn des Teufelspakts bloßgelegt haben. Sie wird zweierlei Einwendungen dagegen erheben. Erstens: es sei nicht notwendig, die Verschreibung als einen Vertrag anzusehen, in dem die Verpflichtungen beider Teile Platz gefunden haben. Sie enthalte vielmehr nur die Verpflichtung des Malers, die des Teufels sei außerhalb ihres Textes geblieben, gleichsam » sousentendue«. Der Maler verpflichtet sich aber zu zweierlei, erstens zur Teufelssohnschaft durch neun Jahre und zweitens dazu, ihm nach dem Tode ganz anheimzufallen. Damit ist eine der Begründungen unseres Schlusses weggeräumt.
Die zweite Einwendung wird sagen, es sei nicht berechtigt, auf den Ausdruck, des Teufels leibeigener Sohn zu sein, besonderes Gewicht zu legen. Das sei eine geläufige Redensart, die jeder so auffassen könne, wie die geistlichen Herren sie verstanden haben mögen. Diese übersetzen die in den Verschreibungen versprochene Sohnschaft nicht in ihr Latein, sondern sagen nur, daß der Maler sich dem Bösen » mancipavit«, zu eigen gegeben, es auf sich genommen habe, ein sündhaftes Leben zu führen und Gott und die heilige Dreieinigkeit zu verleugnen. Warum sollten wir uns von dieser naheliegenden und ungezwungenen Auffassung entfernen? [Fußnote]In der Tat werden wir später, wenn wir erwägen, wann und für wen diese Verschreibungen abgefaßt wurden, selbst einsehen, daß ihr Text unauffällig und allgemeinverständlich lauten mußte. Es reicht uns aber hin, wenn er eine Zweideutigkeit bewahrt, an welche auch unsere Auslegung anknüpfen kann. Der Sachverhalt wäre dann einfach der, daß sich jemand in der Qual und Ratlosigkeit einer melancholischen Depression dem Teufel verschreibt, dem er auch das stärkste therapeutische Können zutraut. Daß diese Verstimmung aus dem Tod des Vaters hervorging, komme nicht weiter in Betracht, es hätte auch ein anderer Anlaß sein können. Das klingt stark und vernünftig. Gegen die Psychoanalyse erhebt sich wieder der Vorwurf, daß sie einfache Verhältnisse in spitzfindiger Weise kompliziert, Geheimnisse und Probleme dort sieht, wo sie nicht existieren, und daß sie dies bewerkstelligt, indem sie kleine und nebensächliche Züge, wie man sie überall finden kann, übermäßig betont und zu Trägern der weitgehendsten und fremdartigsten Schlüsse erhebt. Vergeblich würden wir dagegen geltend machen, daß durch diese Abweisung so viele schlagende Analogien aufgehoben und feine Zusammenhänge zerrissen werden, die wir in diesem Falle aufzeigen können. Die Gegner werden sagen, diese Analogien und Zusammenhänge bestehen eben nicht, sondern werden von uns mit überflüssigem Scharfsinn in den Fall hineingetragen.
Nun, ich werde meine Entgegnung nicht mit den Worten einleiten: seien wir ehrlich oder seien wir aufrichtig, denn das muß man immer sein können, ohne einen besonderen Anlauf dazu zu nehmen, sondern ich werde mit schlichten Worten versichern, daß ich wohl weiß, wenn jemand nicht bereits an die Berechtigung der psychoanalytischen Denkweise glaubt, werde er diese Überzeugung auch nicht aus dem Fall des Malers Chr. Haitzmann im siebzehnten Jahrhundert gewinnen. Es ist auch gar nicht meine Absicht, diesen Fall als Beweismittel für die Gültigkeit der Psychoanalyse zu verwerten; ich setze vielmehr die Psychoanalyse als gültig voraus und verwende sie dazu, um die dämonologische Erkrankung des Malers aufzuklären. Die Berechtigung hiezu nehme ich aus dem Erfolg unserer Forschungen über das Wesen der Neurosen überhaupt. In aller Bescheidenheit darf man es aussprechen, daß heute selbst die Stumpferen unter unseren Zeit- und Fachgenossen einzusehen beginnen, daß ein Verständnis der neurotischen Zustände ohne Hilfe der Psychoanalyse nicht zu erreichen ist.
»Die Pfeile nur erobern Troja, sie allein«
bekennt der Odysseus in Sophokles' Philoktet.
Wenn es richtig ist, die Teufelsverschreibung unseres Malers als neurotische Phantasie anzusehen, so bedarf eine psychoanalytische Würdigung derselben keiner weiteren Entschuldigung. Auch kleine Anzeichen haben ihren Sinn und Wert, ganz besonders unter den Entstehungsbedingungen der Neurose. Man kann sie freilich ebensowohl überschätzen wie unterschätzen, und es bleibt eine Sache des Takts, wie weit man in ihrer Verwertung gehen will. Wenn aber jemand nicht an die Psychoanalyse und nicht einmal an den Teufel glaubt, muß es ihm überlassen bleiben, was er mit dem Fall des Malers anfangen will, sei es, daß er dessen Erklärung aus eigenen Mitteln bestreiten kann, sei es, daß er nichts der Erklärung Bedürftiges an ihm findet.
Wir kehren also zu unserer Annahme zurück, daß der Teufel, dem unser Maler sich verschreibt, ihm ein direkter Vaterersatz ist. Dazu stimmt auch die Gestalt, in der er ihm zuerst erscheint, als ehrsamer älterer Bürgersmann mit braunem Vollbart, in rotem Mantel, schwarzem Hut, die Rechte auf den Stock gestützt, einen schwarzen Hund neben sich (Bild 1). Später wird seine Erscheinung immer schreckhafter, man möchte sagen mythologischer: Hörner, Adlerklauen, Fledermausflügel werden zu ihrer Ausstattung verwendet. Zum Schluß erscheint er in der Kapelle als fliegender Drache. Auf ein bestimmtes Detail seiner körperlichen Gestaltung werden wir später zurückkommen müssen.
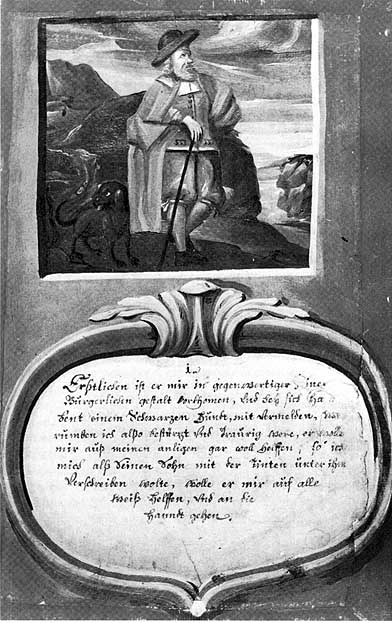
Bild 1: Erste Erscheinung des Teufels
Daß der Teufel zum Ersatz eines geliebten Vaters gewählt wird, klingt wirklich befremdend, aber doch nur, wenn wir zum erstenmal davon hören, denn wir wissen mancherlei, was die Überraschung mindern kann. Zunächst, daß Gott ein Vaterersatz ist oder richtiger: ein erhöhter Vater oder noch anders: ein Nachbild des Vaters, wie man ihn in der Kindheit sah und erlebte, der Einzelne in seiner eigenen Kindheit und das Menschengeschlecht in seiner Vorzeit als Vater der primitiven Urhorde. Später sah der Einzelne seinen Vater anders und geringer, aber das kindliche Vorstellungsbild blieb erhalten und verschmolz mit der überlieferten Erinnerungsspur des Urvaters zur Gottesvorstellung des Einzelnen. Wir wissen auch aus der Geheimgeschichte des Individuums, welche die Analyse aufdeckt, daß das Verhältnis zu diesem Vater vielleicht vom Anfang an ein ambivalentes war, jedenfalls bald so wurde, d. h. es umfaßte zwei einander entgegengesetzte Gefühlsregungen, nicht nur eine zärtlich unterwürfige, sondern auch eine feindselig trotzige. Dieselbe Ambivalenz beherrscht nach unserer Auffassung das Verhältnis der Menschenart zu ihrer Gottheit. Aus dem nicht zu Ende gekommenen Widerstreit von Vatersehnsucht einerseits, Angst und Sohnestrotz anderseits haben wir uns wichtige Charaktere und entscheidende Schicksale der Religionen erklärt [Fußnote]Siehe Totem und Tabu (1912–;13) und im einzelnen Th. Reik (1919)..
Vom bösen Dämon wissen wir, daß er als Widerpart Gottes gedacht ist und doch seiner Natur sehr nahe steht. Seine Geschichte ist allerdings nicht so gut erforscht wie die Gottes, nicht alle Religionen haben den bösen Geist, den Gegner Gottes, aufgenommen, sein Vorbild im individuellen Leben bleibt zunächst im Dunkeln. Aber eines steht fest, Götter können zu bösen Dämonen werden, wenn neue Götter sie verdrängen. Wenn ein Volk von einem anderen besiegt wird, so wandeln sich die gestürzten Götter der Besiegten nicht selten für das Siegervolk in Dämonen um. Der böse Dämon des christlichen Glaubens, der Teufel des Mittelalters, war nach der christlichen Mythologie selbst ein gefallener Engel und gottgleicher Natur. Es braucht nicht viel analytischen Scharfsinns, um zu erraten, daß Gott und Teufel ursprünglich identisch waren, eine einzige Gestalt, die später in zwei mit entgegengesetzten Eigenschaften zerlegt wurde [Fußnote]Siehe Th. Reik (1923) im Kapitel: ›Gott und Teufel‹.. In den Urzeiten der Religionen trug Gott selbst noch alle die schreckenden Züge, die in der Folge zu einem Gegenstück von ihm vereinigt wurden.
Es ist der uns wohlbekannte Vorgang der Zerlegung einer Vorstellung mit gegensinnigem –; ambivalentem –; Inhalt in zwei scharf kontrastierende Gegensätze. Die Widersprüche in der ursprünglichen Natur Gottes sind aber eine Spiegelung der Ambivalenz, welche das Verhältnis des Einzelnen zu seinem persönlichen Vater beherrscht. Wenn der gütige und gerechte Gott ein Vaterersatz ist, so darf man sich nicht darüber wundern, daß auch die feindliche Einstellung, die ihn haßt und fürchtet und sich über ihn beklagt, in der Schöpfung des Satans zum Ausdruck gekommen ist. Der Vater wäre also das individuelle Urbild sowohl Gottes wie des Teufels. Die Religionen würden aber unter der untilgbaren Nachwirkung der Tatsache stehen, daß der primitive Urvater ein uneingeschränkt böses Wesen war, Gott weniger ähnlich als dem Teufel.
Freilich, so leicht ist es nicht, die Spur der satanischen Auffassung des Vaters im Seelenleben des Einzelnen aufzuzeigen. Wenn der Knabe Fratzen und Karikaturen zeichnet, so gelingt es etwa nachzuweisen, daß er in ihnen den Vater verhöhnt, und wenn beide Geschlechter sich nächtlicherweise vor Räubern und Einbrechern schrecken, so hat die Erkennung derselben als Abspaltung des Vaters keine Schwierigkeit [Fußnote]Als Einbrecher erscheint der Vater Wolf auch in dem bekannten Märchen von den sieben Geißlein.. Auch die in den Tierphobien der Kinder auftretenden Tiere sind am häufigsten Vaterersatz wie in der Urzeit das Totemtier. So deutlich aber wie bei unserem neurotischen Maler des siebzehnten Jahrhunderts hört man sonst nicht, daß der Teufel ein Nachbild des Vaters ist und als Ersatz für ihn eintreten kann. Darum sprach ich eingangs dieser Arbeit die Erwartung aus, eine solche dämonologische Krankengeschichte werde uns als gediegenes Metall zeigen, was in den Neurosen einer späteren, nicht mehr abergläubischen aber dafür hypochondrischen Zeit mühselig durch analytische Arbeit aus dem Erz der Einfälle und Symptome dargestellt werden muß [Fußnote]Wenn es uns so selten gelingt, in unseren Analysen den Teufel als Vaterersatz aufzufinden, so mag dies darauf hinweisen, daß diese Figur der mittelalterlichen Mythologie bei den Personen, die sich unserer Analyse unterziehen, ihre Rolle längst ausgespielt hat. Dem frommen Christen früherer Jahrhunderte war der Glaube an den Teufel nicht weniger Pflicht als der Glaube an Gott. In der Tat brauchte er den Teufel, um an Gott festhalten zu können. Der Rückgang der Gläubigkeit hat dann aus verschiedenen Gründen zuerst und zunächst die Person des Teufels betroffen. Wenn man sich getraut, die Idee des Teufels als Vaterersatz kulturgeschichtlich zu verwerten, so kann man auch die Hexenprozesse des Mittelalters in einem neuen Lichte sehen..
Stärkere Überzeugung werden wir wahrscheinlich gewinnen, wenn wir tiefer in die Analyse der Erkrankung bei unserem Maler eindringen. Daß ein Mann durch den Tod seines Vaters eine melancholische Depression und Arbeitshemmung erwirbt, ist nichts Ungewöhnliches. Wir schließen daraus, daß er an diesem Vater mit besonders starker Liebe gehangen hat, und erinnern uns daran, wie oft auch die schwere Melancholie als neurotische Form der Trauer auftritt.
Darin haben wir gewiß recht, nicht aber, wenn wir weiter schließen, daß dies Verhältnis eitel Liebe gewesen sei. Im Gegenteil, eine Trauer nach dem Verlust des Vaters wird sich um so eher in Melancholie umwandeln, je mehr das Verhältnis zu ihm im Zeichen der Ambivalenz stand. Die Hervorhebung dieser Ambivalenz bereitet uns aber auf die Möglichkeit der Erniedrigung des Vaters vor, wie sie in der Teufelsneurose des Malers zum Ausdruck kommt. Könnten wir nun von Chr. Haitzmann so viel erfahren wie von einem Patienten, der sich unserer Analyse unterzieht, so wäre es ein leichtes, diese Ambivalenz zu entwickeln, ihm zur Erinnerung zu bringen, wann und bei welchen Anlässen er Grund bekam, seinen Vater zu fürchten und zu hassen, vor allem aber die akzidentellen Momente aufzudecken, die zu den typischen Motiven des Vaterhasses hinzugekommen sind, welche in der natürlichen Sohn-Vater-Beziehung unvermeidlich wurzeln. Vielleicht fände dann die Arbeitshemmung eine spezielle Aufklärung. Es ist möglich, daß der Vater sich dem Wunsch des Sohnes, Maler zu werden, widersetzt hatte; dessen Unfähigkeit, seine Kunst nach dem Tode des Vaters auszuüben, wäre dann einerseits ein Ausdruck des bekannten »nachträglichen Gehorsams«, anderseits würde sie, die den Sohn zur Selbsterhaltung unfähig macht, die Sehnsucht nach dem Vater als Beschützer vor der Lebenssorge steigern müssen. Als nachträglicher Gehorsam wäre sie auch eine Äußerung der Reue und eine erfolgreiche Selbstbestrafung.
Da wir eine solche Analyse mit Chr. Haitzmann, † 1700, nicht anstellen können, müssen wir uns darauf beschränken, diejenigen Züge seiner Krankengeschichte hervorzuheben, welche auf die typischen Anlässe zu einer negativen Vatereinstellung hinweisen können. Es sind nur wenige, nicht sehr auffällig, aber recht interessant.
Vorerst die Rolle der Zahl Neun. Der Pakt mit dem Bösen wird auf neun Jahre geschlossen. Der gewiß unverdächtige Bericht des Pfarrers von Pottenbrunn äußert sich klar darüber: pro novem annis Syngraphen scriptam tradidit. Dieser vom 1. September 1677 datierte Geleitbrief weiß auch anzugeben, daß die Frist in wenigen Tagen abgelaufen wäre: quorum et finis 24 mensis hujus futurus appropinquat. Die Verschreibung wäre also am 24. September 1668 erfolgt [Fußnote]Der Widerspruch, daß die wiedergegebenen Verschreibungen beide die Jahreszahl 1669 zeigen, wird uns später beschäftigen.. Ja in diesem Bericht hat die Zahl Neun noch eine andere Verwendung. » Nonies« –; neunmal –; will der Maler den Versuchungen des Bösen widerstanden haben, ehe er sich ihm ergab. Dies Detail wird in den späteren Berichten nicht mehr erwähnt; » Post annos novem« heißt es dann auch im Attest des Abtes und » ad novem annos«, wiederholt der Kompilator in seinem Auszug, ein Beweis, daß diese Zahl nicht als gleichgültig angesehen wurde.
Die Neunzahl ist uns aus neurotischen Phantasien wohlbekannt. Sie ist die Zahl der Schwangerschaftsmonate und lenkt, wo immer sie vorkommt, unsere Aufmerksamkeit auf eine Schwangerschaftsphantasie hin. Bei unserem Maler handelt es sich freilich um neun Jahre, nicht um neun Monate, und die Neun, wird man sagen, ist auch sonst eine bedeutungsvolle Zahl. Aber wer weiß, ob die Neun nicht überhaupt ein gutes Teil ihrer Heiligkeit ihrer Rolle in der Schwangerschaft verdankt; und die Wandlung von neun Monaten zu neun Jahren braucht uns nicht zu beirren. Wir wissen vom Traum her, wie die »unbewußte Geistestätigkeit« mit den Zahlen umspringt. Treffen wir z. B. im Traum auf eine Fünf, so ist diese jedesmal auf eine bedeutsame Fünf des Wachlebens zurückzuführen, aber in der Realität waren es fünf Jahre Altersunterschied oder eine Gesellschaft von fünf Personen, im Traum erscheinen sie als fünf Geldscheine oder fünf Stücke Obst. Das heißt die Zahl wird beibehalten, aber ihr Nenner beliebig, je nach den Anforderungen der Verdichtung und Verschiebung vertauscht. Neun Jahre im Traum können also ganz leicht neun Monaten der Wirklichkeit entsprechen. Auch spielt die Traumarbeit noch in anderer Weise mit den Zahlen des Wachlebens, indem sie mit souveräner Gleichgültigkeit sich um die Nullen nicht bekümmert, sie gar nicht wie Zahlen behandelt. Fünf Dollars im Traum können fünfzig, fünfhundert, fünftausend Dollars der Realität vertreten.
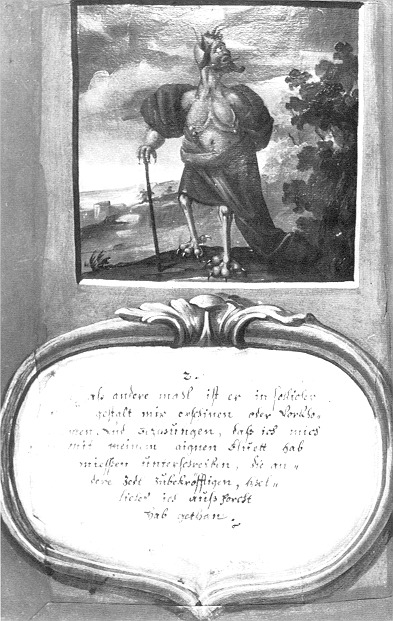
Bild 2: Zweite Erscheinung des Teufels
Ein anderes Detail in den Beziehungen des Malers zum Teufel weist uns gleichfalls auf die Sexualität hin. Das erstemal sieht er, wie schon erwähnt, den Bösen in der Erscheinung eines ehrsamen Bürgers. Aber schon das nächste Mal ist er nackt, mißgestaltet und hat zwei Paar weiblicher Brüste. Die Brüste, bald einfach, bald mehrfach vorhanden, fehlen nun in keiner der folgenden Erscheinungen. Nur in einer derselben zeigt der Teufel außer den Brüsten einen großen, in eine Schlange auslaufenden Penis. Diese Betonung des weiblichen Geschlechtscharakters durch große, hängende Brüste (nie findet sich eine Andeutung des weiblichen Genitales) muß uns als auffälliger Widerspruch gegen unsere Annahme erscheinen, der Teufel bedeute unserem Maler einen Vaterersatz. Eine solche Darstellung des Teufels ist auch an und für sich ungewöhnlich. Wo Teufel ein Gattungsbegriff ist, also Teufel in der Mehrzahl auftreten, hat auch die Darstellung von weiblichen Teufeln nichts Befremdendes, aber daß der eine Teufel, der eine große Individualität ist, der Herr der Hölle und Widersacher Gottes, anders als männlich, ja übermännlich mit Hörnern, Schweif und großer Penisschlange gebildet werde, scheint mir nicht vorzukommen.
Aus diesen beiden kleinen Anzeichen läßt sich doch erraten, welches typische Moment den negativen Anteil seines Vaterverhältnisses bedingt. Das, wogegen er sich sträubt, ist die feminine Einstellung zum Vater, die in der Phantasie, ihm ein Kind zu gebären (neun Jahre) gipfelt. Wir kennen diesen Widerstand genau aus unseren Analysen, wo er in der Übertragung sehr merkwürdige Formen annimmt und uns viel zu schaffen macht. Mit der Trauer um den verlorenen Vater, mit der Steigerung der Sehnsucht nach ihm, wird bei unserem Maler auch die längst verdrängte Schwangerschaftsphantasie reaktiviert, gegen die er sich durch Neurose und Vatererniedrigung wehren muß.
Warum trägt aber der zum Teufel herabgesetzte Vater das körperliche Merkmal des Weibes an sich? Dieser Zug erscheint anfangs schwer deutbar, bald aber ergeben sich zwei Erklärungen für ihn, die miteinander konkurrieren, ohne einander auszuschließen. Die feminine Einstellung zum Vater unterlag der Verdrängung, sobald der Knabe verstand, daß der Wettbewerb mit dem Weib um die Liebe des Vaters das Aufgeben des eigenen männlichen Genitales, also die Kastration, zur Bedingung hat. Die Ablehnung der femininen Einstellung ist also die Folge des Sträubens gegen die Kastration, sie findet regelmäßig ihren stärksten Ausdruck in der gegensätzlichen Phantasie, den Vater selbst zu kastrieren, ihn zum Weib zu machen. Die Brüste des Teufels entsprächen also einer Projektion der eigenen Weiblichkeit auf den Vaterersatz. Die andere Erklärung dieser Ausstattung des Teufelskörpers hat nicht mehr feindseligen, sondern zärtlichen Sinn; sie erblickt in dieser Gestaltung ein Anzeichen dafür, daß die infantile Zärtlichkeit von der Mutter her auf den Vater verschoben worden ist, und deutet so eine starke, vorgängige Mutterfixierung an, die ihrerseits wieder für ein Stück der Feindseligkeit gegen den Vater verantwortlich ist. Die großen Brüste sind das positive Geschlechtskennzeichen der Mutter, auch zu einer Zeit, wo der negative Charakter des Weibes, der Penismangel, dem Kinde noch nicht bekannt ist [Fußnote]Vgl. Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci (1910 c)..
Wenn das Widerstreben gegen die Annahme der Kastration unserem Maler die Erledigung seiner Vatersehnsucht unmöglich macht, so ist es überaus verständlich, daß er sich um Hilfe und Rettung an das Bild der Mutter wendet. Darum erklärt er, daß nur die heilige Mutter Gottes von Mariazell ihn vom Pakt mit dem Teufel lösen kann, und erhält am Geburtstag der Mutter (8. September) seine Freiheit wieder. Ob der Tag, an dem der Pakt geschlossen wurde, der 24. September, nicht auch ein in ähnlicher Weise ausgezeichneter Tag war, werden wir natürlich nie erfahren.
Kaum ein anderes Stück der psychoanalytischen Ermittlungen aus dem Seelenleben des Kindes klingt dem normalen Erwachsenen so abstoßend und unglaubwürdig wie die feminine Einstellung zum Vater und die aus ihr folgende Schwangerschaftsphantasie des Knaben. Wir können erst ohne Besorgnis und ohne Bedürfnis nach Entschuldigung von ihr reden, seitdem der sächsische Senatspräsident Daniel Paul Schreber die Geschichte seiner psychotischen Erkrankung und weitgehenden Herstellung bekanntgemacht hat [Fußnote]D. P. Schreber, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, Leipzig 1903. Vgl. meine Analyse des Falles Schreber [(1911 c)].. Aus dieser unschätzbaren Veröffentlichung erfahren wir, daß der Herr Senatspräsident etwa um das fünfzigste Jahr seines Lebens die sichere Überzeugung bekam, daß Gott –; der übrigens deutliche Züge seines Vaters, des verdienten Arztes Dr. Schreber, an sich trägt –; den Entschluß gefaßt, ihn zu entmannen, als Weib zu gebrauchen und aus ihm neue Menschen von Schreberschem Geist entstehen zu lassen. (Er war selbst in seiner Ehe kinderlos geblieben.) An dem Sträuben gegen diese Absicht Gottes, welche ihm höchst ungerecht und »weltordnungswidrig« vorkam, erkrankte er unter den Erscheinungen einer Paranoia, die sich aber im Laufe der Jahre bis auf einen geringen Rest rückbildete. Der geistvolle Verfasser seiner eigenen Krankengeschichte konnte wohl nicht ahnen, daß er in ihr ein typisches pathogenes Moment aufgedeckt hatte.
Dieses Sträuben gegen die Kastration oder die feminine Einstellung hat Alf. Adler aus seinen organischen Zusammenhängen gerissen, in seichte oder falsche Beziehungen zum Machtstreben gebracht und als »männlichen Protest« selbständig hingestellt. Da eine Neurose immer nur aus dem Konflikt zweier Strebungen hervorgehen kann, ist es ebenso berechtigt, im männlichen Protest die Verursachung »aller« Neurosen zu sehen wie in der femininen Einstellung, gegen welche protestiert wird. Richtig ist, daß dieser männliche Protest einen regelmäßigen Anteil an der Charakterbildung hat, bei manchen Typen einen sehr großen, und daß er uns als scharfer Widerstand bei der Analyse neurotischer Männer entgegentritt. Die Psychoanalyse würdigt den männlichen Protest im Zusammenhang des Kastrationskomplexes, ohne seine Allmacht oder Allgegenwart bei den Neurosen vertreten zu können. Der ausgeprägteste Fall von männlichem Protest in allen manifesten Reaktionen und Charakterzügen, der meine Behandlung aufgesucht hat, bedurfte ihrer wegen einer Zwangsneurose mit Obsessionen, in denen der ungelöste Konflikt zwischen männlicher und weiblicher Einstellung (Kastrationsangst und Kastrationslust) zu deutlichem Ausdruck kam. Überdies hatte der Patient masochistische Phantasien entwickelt, die durchaus auf den Wunsch, die Kastration anzunehmen, zurückgingen, und war selbst von diesen Phantasien zur realen Befriedigung in perversen Situationen vorgeschritten. Das Ganze seines Zustandes beruhte –; wie die Adlersche Theorie überhaupt –; auf der Verdrängung, Verleugnung frühinfantiler Liebesfixierungen.
Der Senatspräsident Schreber fand seine Heilung, als er sich entschloß, den Widerstand gegen die Kastration aufzugeben und sich in die ihm von Gott zugedachte weibliche Rolle zu fügen. Er wurde dann klar und ruhig, konnte seine Entlassung aus der Anstalt selbst durchsetzen und führte ein normales Leben bis auf den einen Punkt, daß er einige Stunden täglich der Pflege seiner Weiblichkeit widmete, von deren langsamem Fortschreiten bis zu dem von Gott bestimmten Ziel er überzeugt blieb.
IV. Die zwei Verschreibungen
Ein merkwürdiges Detail in der Geschichte unseres Malers ist die Angabe, daß er dem Teufel zwei verschiedene Verschreibungen ausgestellt. Die erste, mit schwarzer Tinte geschriebene, hatte den Wortlaut:
» Ich Chr. H. undterschreibe mich disen Herrn: sein leibeigent Sohn auff 9. Jahr.«
Die zweite, mit Blut geschrieben, lautet:
» Ch. H. Ich verschreibe mich disen Satan, ich sein leibeigner Sohn zu sein, vnd in 9. Jahr ihm mein Leib vndt Seel zu zugeheren.«
Beide sollen zur Zeit der Abfassung des Trophaeum im Archiv von Mariazell im Original vorhanden gewesen sein, beide tragen die nämliche Jahreszahl 1669.
Ich habe die beiden Verschreibungen bereits mehrmals erwähnt und unternehme es jetzt, mich eingehender mit ihnen zu beschäftigen, obwohl gerade hier die Gefahr, Kleinigkeiten zu überschätzen, besonders drohend erscheint.
Die Tatsache, daß sich einer dem Teufel zweimal verschreibt, so daß die erste Schrift durch die zweite ersetzt wird, ohne aber ihre eigene Gültigkeit zu verlieren, ist ungewöhnlich. Vielleicht befremdet sie andere weniger, die mit dem Teufelsstoff vertrauter sind. Ich konnte nur eine besondere Eigentümlichkeit unseres Falles darin sehen und wurde mißtrauisch, als ich fand, daß die Berichte gerade in diesem Punkt nicht zusammenstimmen. Die Verfolgung dieser Widersprüche wird uns in unerwarteter Weise zu einem tieferen Verständnis der Krankengeschichte leiten.
Das Geleitschreiben des Pfarrers von Pottenbrunn weist die einfachsten und klarsten Verhältnisse auf. In ihm ist nur von einer Verschreibung die Rede, die der Maler vor neun Jahren mit Blut gefertigt und die nun in den nächsten Tagen, am 24. September, fällig wird, sie wäre also am 24. September 1668 ausgestellt worden; leider ist diese Jahreszahl, die sich mit Sicherheit ableiten läßt, nicht ausdrücklich genannt.
Der Attest des Abtes Franciscus, wie wir wissen, wenige Tage später datiert (12. Sept. 1677), erwähnt bereits einen komplizierteren Sachverhalt. Es liegt nahe anzunehmen, daß der Maler inzwischen genauere Mitteilungen gemacht hatte. In diesem Attest wird erzählt, daß der Maler zwei Verschreibungen von sich gegeben, die eine im Jahre 1668 (wie es auch nach dem Geleitbrief sein müßte) mit schwarzer Tinte geschrieben, die andere aber » sequenti anno1669« mit Blut geschrieben. Die Verschreibung, die er am Tage Maria Geburt zurückbekam, war die mit Blut geschriebene, also die spätere, 1669 ausgestellte. Dies geht nicht aus dem Attest des Abtes hervor, denn dort heißt es im weiteren einfach: » schedam redderet« und » schedam sibi porrigentem conspexisset«, als ob es sich nur um ein einziges Schriftstück handeln könnte. Aber wohl folgt es aus dem weiteren Verlauf der Geschichte sowie aus dem farbigen Titelblatt des Trophaeum, wo auf dem Zettel, den der dämonische Drache hält, deutlich rote Schrift zu sehen ist. Der weitere Verlauf ist, wie bereits erwähnt, der, daß der Maler im Mai 1678 nach Mariazell wiederkehrt, nachdem er in Wien neuerliche Anfechtungen des Bösen erfahren, und das Ansuchen stellt, es möge ihm durch einen neuerlichen Gnadenakt der heiligen Mutter auch dies erste, mit Tinte geschriebene Dokument wiedergegeben werden. Auf welche Weise dies geschieht, wird nicht mehr so ausführlich wie das erstemal beschrieben. Es heißt nur » qua iuxta votum redditâ«, und an anderer Stelle erzählt der Kompilator, daß gerade diese Verschreibung » zwsammengeknäult und in vier Stücke zerrissen« dem Maler am 9. Mai 1678 um die neunte Abendstunde vom Teufel zugeworfen wurde.
Die Verschreibungen tragen aber beide dasselbe Datum: Jahr 1669.
Dieser Widerspruch bedeutet entweder gar nichts, oder er führt auf folgende Spur:
Wenn wir von der Darstellung des Abtes als der ausführlicheren ausgehen, ergeben sich mancherlei Schwierigkeiten. Als Chr. H. dem Pfarrer von Pottenbrunn bekannte, er sei in Teufelsnöten, der Termin laufe bald ab, kann er (im Jahre 1677) nur an die im Jahre 1668 ausgestellte Verschreibung gedacht haben, also an die erste, schwarze (die im Geleitbrief allerdings einzig genannt und als die blutige bezeichnet wird). Wenige Tage später, in Mariazell, bekümmert er sich aber nur darum, die spätere, blutige, zurückzubekommen, die noch gar nicht fällig ist (1669–;1677), und läßt die erste überfällig werden. Diese wird erst 1678, also im zehnten Jahr zurückerbeten. Ferner, warum sind beide Verschreibungen aus dem gleichen Jahr 1669 datiert, wenn die eine ausdrücklich » anno subsequenti« zugeteilt ist?
Der Kompilator muß diese Schwierigkeiten verspürt haben, denn er macht einen Versuch, sie zu beheben. In seiner Einleitung schließt er sich der Darstellung des Abtes an, modifiziert sie aber in einem Punkte. Der Maler, sagt er, habe sich im Jahre 1669 dem Teufel mit Tinte verschrieben, » deinde vero«, später aber mit Blut. Er setzt sich also über die ausdrückliche Angabe der beiden Berichte, daß eine Verschreibung ins Jahr 1668 fällt, hinweg und vernachlässigt die Bemerkung im Attest des Abtes, daß sich zwischen beiden Verschreibungen die Jahreszahl geändert, um im Einklang mit der Datierung der beiden, vom Teufel zurückgegebenen Schriftstücke zu bleiben.
Im Attest des Abtes findet sich nach den Worten » sequenti vero anno 1669« eine in Klammern eingeschlossene Stelle, welche lautet: » sumitur hic alter annus pro nondum completo, uti saepe in loquendo fieri solet, nam eundem annum indicant Syngraphae, quarum atramento scripta ante praesentem attestationem nondum habita fuit.« Diese Stelle ist ein unzweifelhaftes Einschiebsel des Kompilators, denn der Abt, der nur eine Verschreibung gesehen hat, kann doch nicht aussagen, daß beide dasselbe Datum tragen. Sie soll wohl auch durch die Klammern als ein dem Zeugnis fremder Zusatz kenntlich gemacht werden. Was sie enthält, ist ein anderer Versuch des Kompilators, die vorliegenden Widersprüche zu versöhnen. Er meint, es sei zwar richtig, daß die erste Verschreibung im Jahre 1668 gegeben worden ist, aber da das Jahr schon vorgerückt war (September), habe der Maler sie um ein Jahr vordatiert, so daß beide Verschreibungen die gleiche Jahreszahl zeigen konnten. Seine Berufung darauf, man mache es ja im mündlichen Verkehr oft ähnlich, verurteilt wohl diesen ganzen Erklärungsversuch als eine »faule Ausrede«.
Ich weiß nun nicht, ob meine Darstellung dem Leser irgendeinen Eindruck gemacht und ob sie ihn in Stand gesetzt hat, sich für diese Winzigkeiten zu interessieren. Ich fand es unmöglich, den richtigen Sachverhalt in unzweifelhafter Weise festzustellen, bin aber beim Studium dieser verworrenen Angelegenheit auf eine Vermutung gekommen, die den Vorzug hat, den natürlichsten Hergang einzusetzen, wenngleich die schriftlichen Zeugnisse sich auch ihr nicht völlig fügen.
Ich meine, als der Maler zuerst nach Mariazell kam, sprach er nur von einer regelrecht mit Blut geschriebenen Verschreibung, die bald verfallen sollte, also im September 1668 gegeben war, ganz so, wie es im Geleitbrief des Pfarrers mitgeteilt ist. In Mariazell präsentierte er auch diese blutige Verschreibung als diejenige, die ihm der Dämon unter dem Zwang der heiligen Mutter zurückgegeben hatte. Wir wissen, was weiter geschah. Der Maler verließ bald darauf den Gnadenort und ging nach Wien, wo er sich auch bis Mitte Oktober frei fühlte. Aber dann fingen Leiden und Erscheinungen, in denen er das Werk des bösen Geistes sah, wieder an. Er fühlte sich wieder erlösungsbedürftig, fand sich aber vor der Schwierigkeit aufzuklären, warum ihm die Beschwörung in der heiligen Kapelle keine dauernde Erlösung gebracht hatte. Als ungeheilter Rückfälliger wäre er wohl in Mariazell nicht willkommen gewesen. In dieser Not erfand er eine frühere, erste Verschreibung, die aber mit Tinte geschrieben sein sollte, damit ihr Zurückstehen gegen eine spätere, blutige, plausibel erscheinen konnte. Nach Mariazell zurückgekommen, ließ er sich auch diese angeblich erste Verschreibung zurückgeben. Dann hatte er Ruhe vor dem Bösen, allerdings tat er gleichzeitig etwas anderes, was uns auf den Hintergrund dieser Neurose hinweisen wird.
Die Zeichnungen fertigte er gewiß erst bei seinem zweiten Aufenthalt in Mariazell an; das einheitlich komponierte Titelblatt enthält die Darstellung beider Verschreibungsszenen. Bei dem Versuch, seine neueren Angaben mit seinen früheren in Einklang zu bringen, mag er wohl in Verlegenheiten geraten sein. Es war für ihn ungünstig, daß er nur eine frühere, nicht eine spätere Verschreibung hinzudichten konnte. So konnte er das ungeschickte Ergebnis nicht vermeiden, daß er die eine, die blutige Verschreibung zu früh (im achten Jahr), die andere, die schwarze, zu spät (im zehnten Jahr) eingelöst hatte. Als verräterisches Anzeichen seiner zweifachen Redaktion ereignete es sich ihm, daß er sich in der Datierung der Verschreibungen irrte und auch die frühere in das Jahr 1669 setzte. Dieser Irrtum hat die Bedeutung einer ungewollten Aufrichtigkeit; er läßt uns erraten, daß die angeblich frühere Verschreibung zu einem späteren Termin hergestellt wurde. Der Kompilator, der den Stoff gewiß nicht früher als 1714, vielleicht erst 1729 zur Bearbeitung übernahm, mußte sich bemühen, die nicht unwesentlichen Widersprüche, so gut er konnte, wegzuschaffen. Da die beiden Verschreibungen, die ihm vorlagen, auf 1669 lauteten, half er sich durch die Ausrede, die er in das Zeugnis des Abtes einschaltete.
Man erkennt leicht, worin die Schwäche dieser sonst ansprechenden Konstruktion gelegen ist. Die Angabe zweier Verschreibungen, einer schwarzen und einer blutigen, findet sich bereits im Zeugnis des Abtes Franciscus. Ich habe also die Wahl, entweder dem Kompilator unterzuschieben, daß er an diesem Zeugnis im engen Anschluß an seine Einschaltung auch etwas geändert hat, oder ich muß bekennen, daß ich die Verwirrung nicht zu lösen vermag [Fußnote]Der Kompilator, meine ich, fand sich zwischen zwei fixen Punkten eingeengt. Einerseits fand er sowohl im Geleitbrief des Pfarrers wie im Attest des Abtes die Angabe, daß die Verschreibung (zumindest die erste) im Jahre 1668 ausgestellt worden sei, anderseits zeigten beide im Archiv aufbewahrten Verschreibungen die Jahreszahl 1669; da er zwei Verschreibungen vor sich liegen hatte, stand es für ihn fest, daß zwei Verschreibungen erfolgt waren. Wenn im Zeugnis des Abtes nur von einer die Rede war, wie ich glaube, so mußte er in dieses Zeugnis die Erwähnung der anderen einsetzen und dann den Widerspruch durch die Annahme einer Vordatierung aufheben. Die Abänderung des Textes, die er vornahm, stößt an die Einschaltung, die nur von ihm herrühren kann, unmittelbar an. Er war gezwungen, Einschaltung und Abänderung durch die Worte sequenti vero anno 1669 zu verbinden, weil der Maler in der (sehr beschädigten) Legende zum Titelbilde ausdrücklich geschrieben hatte: Nach einem Jahr würdt Er . . . schrökhliche betrohungen in ab- . . . . . . . gestalt Nr. 2 bezwungen sich, . . . . . . . . . . n Bluot zu verschreiben. Das »Verschreiben« des Malers, als er die Syngraphae anfertigte, durch das ich zu meinem Erklärungsversuch genötigt worden bin, erscheint mir nicht weniger interessant als seine Verschreibungen selbst..
Die ganze Diskussion wird den Lesern längst überflüssig und die in ihr behandelten Details zu unwichtig erschienen sein. Aber die Sache gewinnt ein neues Interesse, wenn man sie nach einer bestimmten Richtung hin verfolgt.
Ich habe eben vom Maler ausgesagt, daß er, durch den Verlauf seiner Krankheit unliebsam überrascht, eine frühere Verschreibung (die mit Tinte) erfunden habe, um seine Position gegen die geistlichen Herren in Mariazell behaupten zu können. Nun schreibe ich für Leser, die zwar an die Psychoanalyse glauben, aber nicht an den Teufel, und diese könnten mir vorhalten, es sei unsinnig, dem armen Kerl von Maler –; hunc miserum nennt ihn der Geleitbrief –; einen solchen Vorwurf zu machen. Die blutige Verschreibung war ja genauso phantasiert wie die angeblich frühere mit Tinte. In Wirklichkeit ist ihm ja überhaupt kein Teufel erschienen, der ganze Pakt mit dem Teufel existierte ja nur in seiner Phantasie. Ich sehe das ein; man kann dem Armen das Recht nicht bestreiten, seine ursprüngliche Phantasie durch eine neue zu ergänzen, wenn die geänderten Verhältnisse es zu erfordern schienen.
Aber auch hier gibt es noch eine Fortsetzung. Die beiden Verschreibungen sind ja nicht Phantasien wie die Teufelsvisionen; sie waren Dokumente, nach der Versicherung des Abschreibers wie nach dem Zeugnis des späteren Abtes Kilian im Archiv von Mariazell für alle sichtbar und greifbar aufbewahrt. Also stehen wir hier vor einem Dilemma. Entweder haben wir anzunehmen, daß der Maler die beiden ihm angeblich durch göttliche Huld zurückgestellten Schedae selbst zur Zeit verfertigt, da er sie brauchte, oder wir müssen den geistlichen Herren von Mariazell und Sankt Lambert trotz aller feierlichen Versicherungen, Bestätigungen durch Zeugen mit beigefügten Siegeln usw. die Glaubwürdigkeit verweigern. Ich gestehe, die Verdächtigung der geistlichen Herren fiele mir nicht leicht. Ich neige zwar zur Annahme, daß der Kompilator im Interesse der Konkordanz einiges am Zeugnis des ersten Abtes verfälscht hat, aber diese »sekundäre Bearbeitung« geht nicht weit über ähnliche Leistungen, auch moderner und weltlicher Geschichtsschreiber, hinaus und geschah jedenfalls im guten Glauben. Nach anderer Richtung haben sich die geistlichen Herren gegründeten Anspruch auf unser Vertrauen erworben. Ich sagte es schon, nichts hätte sie hindern können, die Berichte über die Unvollständigkeit der Heilung und die Fortdauer der Versuchungen zu unterdrücken, und auch die Schilderung der Beschwörungsszene in der Kapelle, der man mit einigem Bangen entgegensehen durfte, ist nüchtern und glaubwürdig geraten. Es bleibt also nichts übrig, als den Maler zu beschuldigen. Die rote Verschreibung hatte er wohl bei sich, als er sich zum Bußgebet in die Kapelle begab, und zog sie dann hervor, als er von seiner Begegnung mit dem Dämon zu den geistlichen Beiständen zurückkehrte. Es muß auch gar nicht derselbe Zettel gewesen sein, der später im Archiv aufbewahrt wurde, sondern nach unserer Konstruktion kann er die Jahreszahl 1668 (neun Jahre vor der Beschwörung) getragen haben.
V. Die weitere Neurose
Aber das wäre Betrug und nicht Neurose, der Maler ein Simulant und Fälscher, nicht ein kranker Besessener! Nun, die Übergänge zwischen Neurose und Simulation sind bekanntlich fließende. Ich finde auch keine Schwierigkeit anzunehmen, daß der Maler diesen Zettel ebenso wie die späteren in einem besonderen, seinen Visionen gleichzustellenden Zustand geschrieben und mit sich genommen hat. Wenn er die Phantasie vom Teufelspakt und von der Erlösung durchführen wollte, konnte er ja gar nichts anderes tun.
Den Stempel der Wahrhaftigkeit trägt dagegen das Tagebuch aus Wien an sich, das er bei seinem zweiten Aufenthalt zu Mariazell den Geistlichen übergab. Es läßt uns freilich tief in die Motivierung oder sagen wir lieber Verwertung der Neurose blicken.
Die Aufzeichnungen reichen von seiner erfolgreichen Beschwörung bis zum 13. Januar des nächsten Jahres 1678. Bis zum 11. Oktober erging es ihm in Wien, wo er bei einer verheirateten Schwester wohnte, recht gut, dann aber fingen neue Zustände mit Visionen und Krämpfen, Bewußtlosigkeit und schmerzhaften Sensationen an, die dann auch zu seiner Rückkehr nach Mariazell im Mai 1678 führten.
Die neue Leidensgeschichte gliedert sich in drei Phasen. Zuerst meldet sich die Versuchung in Gestalt eines schön gekleideten Kavaliers, der ihm zureden will, den Zettel wegzuwerfen, der seine Aufnahme in die Bruderschaft vom heiligen Rosenkranz bescheinigt. Da er widerstand, wiederholte sich dieselbe Erscheinung am nächsten Tag, aber diesmal in einem prächtig geschmückten Saal, in dem vornehme Herren mit schönen Damen tanzten. Derselbe Kavalier, der ihn schon einmal versucht, machte ihm einen auf Malerei bezüglichen Antrag [Fußnote]Eine mir unverständliche Stelle. und versprach ihm dafür ein schönes Stück Geld. Nachdem er diese Vision durch Gebete zum Verschwinden gebracht, wiederholte sie sich einige Tage später in noch eindringlicherer Form. Diesmal schickte der Kavalier eine der schönsten Frauen, die an der Festtafel saßen, zu ihm hin, um ihn zur Gesellschaft zu bringen, und er hatte Mühe, sich der Verführerin zu erwehren. Am erschreckendsten war aber die bald darauf folgende Vision eines noch prunkvolleren Saales, in dem ein von » Goldstuckh aufgerichteter Thron« war. Kavaliere standen herum und erwarteten die Ankunft ihres Königs. Dieselbe Person, die sich schon so oft um ihn bekümmert hatte, ging auf ihn zu und forderte ihn auf, den Thron zu besteigen, sie » wollten ihn für ihren König halten und in Ewigkeit verehren«. Mit dieser Ausschweifung seiner Phantasie schließt die erste, recht durchsichtige Phase der Versuchungsgeschichte ab.
Es mußte jetzt zu einer Gegenwirkung kommen. Die asketische Reaktion erhob ihr Haupt. Am 20. Oktober erschien ihm ein großer Glanz, eine Stimme daraus gab sich als Christus zu erkennen und forderte von ihm, daß er dieser bösen Welt entsagen und sechs Jahre lang in einer Wüste Gott dienen solle. Der Maler litt unter diesen heiligen Erscheinungen offenbar mehr als unter den früheren dämonischen. Aus diesem Anfall erwachte er erst nach 2½ Stunden. Im nächsten war die von Glanz umgebene heilige Person weit unfreundlicher, drohte ihm, weil er den göttlichen Vorschlag nicht angenommen hatte, und führte ihn in die Hölle, damit er durch das Los der Verdammten geschreckt werde. Offenbar blieb aber die Wirkung aus, denn die Erscheinungen der Person im Glanze, die Christus sein sollte, wiederholten sich noch mehrmals, jedesmal mit stundenlanger Geistesabwesenheit und Verzücktheit für den Maler. In der großartigsten dieser Verzücktheiten führte ihn die Person im Glanze zuerst in eine Stadt, in deren Straßen die Menschen alle Werke der Finsternis übten, und dann zum Gegensatz auf eine schöne Au, in der Einsiedler ihr gottgefälliges Leben führten und greifbare Beweise von Gottes Gnade und Fürsorge erhielten. Dann erschien an Stelle Christi die heilige Mutter selbst, die ihn unter Berufung auf ihre früher geleistete Hilfe mahnte, dem Befehl ihres lieben Sohnes nachzukommen. » Da er sich hiezu nicht recht resolviret«, kam Christus am nächsten Tage wieder und setzte ihm mit Drohungen und Versprechungen tüchtig zu. Da gab er endlich nach, beschloß aus diesem Leben auszutreten und zu tun, was von ihm verlangt wurde. Mit dieser Entschließung endet die zweite Phase. Der Maler konstatiert, daß er von dieser Zeit an keine Erscheinung oder Anfechtung mehr gehabt hat.
Indes muß dieser Entschluß nicht sehr gefestigt oder seine Ausführung allzulang aufgeschoben worden sein, denn als er am 26. Dezember in St. Stephan seine Andacht verrichtete, konnte er sich beim Anblick einer wackeren Jungfrau, die mit einem wohlaufgeputzten Herrn ging, der Idee nicht erwehren, er könnte selbst an Stelle dieses Herrn sein. Das forderte Strafe, noch am selben Abend traf es ihn wie ein Donnerschlag, er sah sich in hellen Flammen und fiel in Ohnmacht. Man bemühte sich, ihn zu erwecken, aber er wälzte sich in der Stube, bis Blut aus Mund und Nase kam, verspürte, daß er sich in Hitze und Gestank befand, und hörte eine Stimme sagen, daß ihm dieser Zustand als Strafe für seine unnützen und eiteln Gedanken geschickt worden sei. Später wurde er dann von bösen Geistern mit Stricken gegeißelt und ihm versprochen, daß er alle Tage so gepeinigt werden solle, bis er sich entschlossen habe, in den Einsiedlerorden einzutreten. Diese Erlebnisse setzten sich, soweit die Aufzeichnungen reichen (13. Januar) fort.
Wir sehen, wie bei unserem armen Maler die Versuchungsphantasien von asketischen und endlich von Strafphantasien abgelöst werden; das Ende der Leidensgeschichte kennen wir bereits. Er begibt sich im Mai nach Mariazell, bringt dort die Geschichte von einer früheren, mit schwarzer Tinte geschriebenen Verschreibung vor, der er es offenbar zuschreibt, daß er noch vom Teufel geplagt werden kann, erhält auch diese zurück und ist geheilt.
Während dieses zweiten Aufenthaltes malt er die Bilder, die im Trophaeum kopiert sind, dann aber tut er etwas, was mit der Forderung der asketischen Phase seines Tagebuches zusammentrifft. Er geht zwar nicht in die Wüste, um Einsiedler zu werden, aber er tritt in den Orden der Barmherzigen Brüder ein: religiosus factus est.
Bei der Lektüre des Tagebuches gewinnen wir Verständnis für ein neues Stück des Zusammenhangs. Wir erinnern uns, daß der Maler sich dem Teufel verschrieben, weil er nach dem Tode des Vaters, verstimmt und arbeitsunfähig, Sorge hatte, seine Existenz zu erhalten. Diese Momente, Depression, Arbeitshemmung und Trauer um den Vater, sind irgendwie, auf einfache oder kompliziertere Art miteinander verknüpft. Vielleicht waren die Erscheinungen des Teufels darum so überreichlich mit Brüsten ausgestattet, weil der Böse sein Nährvater werden sollte. Die Hoffnung erfüllte sich nicht, es ging ihm auch weiterhin schlecht, er konnte nicht ordentlich arbeiten, oder er hatte kein Glück und fand nicht genug Arbeit. Der Geleitbrief des Pfarrers spricht von ihm als » hunc miserum omni auxilio destitutum«. Er war also nicht nur in moralischen Nöten, er litt auch materielle Not. In die Wiedergabe seiner späteren Visionen finden sich Bemerkungen eingestreut, die wie die Inhalte der erschauten Szenen zeigen, daß sich auch nach der erfolgreichen ersten Beschwörung daran nichts geändert hatte. Wir lernen einen Menschen kennen, der es zu nichts bringt, dem man auch darum kein Vertrauen schenkt. In der ersten Vision fragt ihn der Kavalier, was er eigentlich anfangen wolle, da sich niemand seiner annehme (» dieweillen ich von iedermann izt verlassen, waß ich anfangen würde«). Die erste Reihe der Visionen in Wien entspricht durchaus den Wunschphantasien des Armen, nach Genuß Hungernden, Verkommenen: Herrliche Säle, Wohlleben, silbernes Tafelgeschirr und schöne Frauen; hier wird nachgeholt, was wir im Teufelsverhältnis vermißt haben. Damals bestand eine Melancholie, die ihn genußunfähig machte, auf die lockendsten Anerbieten verzichten hieß. Seit der Beschwörung scheint die Melancholie überwunden, alle Gelüste des Weltkindes sind wieder rege.
In einer der asketischen Visionen beklagt er sich gegen die ihn führende Person (Christus), daß ihm niemand glauben wolle, so daß er dessentwegen was ihm anbefohlen, nicht vollziehen könne. Die Antwort, die er darauf erhält, bleibt uns leider dunkel (» so fer man mir nit glauben, waß aber geschechen, waiß ich wol, ist mir aber selbes auszusprechen vnmöglich«). Besonders aufklärend ist aber, was ihn sein göttlicher Führer bei den Einsiedlern erleben läßt. Er kommt in eine Höhle, in der ein alter Mann schon seit sechzig Jahren sitzt, und erfährt auf seine Frage, daß dieser Alte täglich von den Engeln Gottes gespeist wird. Und dann sieht er selbst, wie ein Engel dem Alten zu essen bringt: » Drei Schüßerl mit Speiß, ein Brot und ein Knödl und Getränk.« Nachdem der Einsiedler gespeist, nimmt der Engel alles zusammen und trägt es ab. Wir verstehen, welche Versuchung die frommen Visionen zu bieten haben, sie wollen ihn bewegen, eine Form der Existenz zu wählen, in der ihm die Nahrungssorgen abgenommen sind. Beachtenswert sind auch die Reden Christi in der letzten Vision. Nach der Drohung, wenn er sich nicht füge, werde etwas geschehen, daß er und die Leute [daran] glauben müßten, mahnt er direkt: » Ich solle die Leith nit achten, obwollen ich von ihnen verfolgt wurdte, oder von ihnen keine hilfflaistung empfienge, Gott würde mich nit verlasßen.«
Ch. Haitzmann war so weit Künstler und Weltkind, daß es ihm nicht leichtfiel, dieser sündigen Welt zu entsagen. Aber endlich tat er es doch mit Rücksicht auf seine hilflose Lage. Er trat in einen geistlichen Orden ein; damit war sein innerer Kampf wie seine materielle Not zu Ende. In seiner Neurose spiegelt sich dieser Ausgang darin, daß die Rückstellung einer angeblich ersten Verschreibung seine Anfälle und Visionen beseitigt. Eigentlich hatten beide Abschnitte seiner dämonologischen Erkrankung denselben Sinn gehabt. Er wollte immer nur sein Leben sichern, das erste Mal mit Hilfe des Teufels auf Kosten seiner Seligkeit, und als dieser versagt hatte und aufgegeben werden mußte, mit Hilfe des geistlichen Standes auf Kosten seiner Freiheit und der meisten Genußmöglichkeiten des Lebens. Vielleicht war Chr. Haitzmann nur selbst ein armer Teufel, der eben kein Glück hatte, vielleicht war er zu ungeschickt oder zu unbegabt, um sich selbst zu erhalten, und zählte zu jenen Typen, die als »ewige Säuglinge« bekannt sind, die sich von der beglückenden Situation an der Mutterbrust nicht losreißen können und durchs ganze Leben den Anspruch festhalten, von jemand anderem ernährt zu werden. Und so legte er in dieser Krankengeschichte den Weg vom Vater über den Teufel als Vaterersatz zu den frommen Patres zurück.
Seine Neurose erscheint oberflächlicher Betrachtung als ein Gaukelspiel, welches ein Stück des ernsthaften, aber banalen Lebenskampfes überdeckt. Dies Verhältnis ist gewiß nicht immer so, aber es kommt auch nicht gar so selten vor. Die Analytiker erleben es oft, wie unvorteilhaft es ist, einen Kaufmann zu behandeln, der »sonst gesund, seit einiger Zeit die Erscheinungen einer Neurose zeigt«. Die geschäftliche Katastrophe, von der sich der Kaufmann bedroht fühlt, wirft als Nebenwirkung diese Neurose auf, von der er auch den Vorteil hat, daß er hinter ihren Symptomen seine realen Lebenssorgen verheimlichen kann. Sonst aber ist sie überaus unzweckmäßig, da sie Kräfte in Anspruch nimmt, die vorteilhafter zur besonnenen Erledigung der gefährlichen Lage Verwendung fänden.
In weit zahlreicheren Fällen ist die Neurose selbständiger und unabhängiger von den Interessen der Lebenserhaltung und Behauptung. Im Konflikt, der die Neurose schafft, stehen entweder nur libidinöse Interessen auf dem Spiel oder libidinöse in inniger Verknüpfung mit solchen der Lebensbehauptung. Der Dynamismus der Neurose ist in allen drei Fällen der gleiche. Eine nicht real zu befriedigende Libidostauung schafft sich mit Hilfe der Regression zu alten Fixierungen Abfluß durch das verdrängte Unbewußte. Soweit das Ich des Kranken aus diesem Vorgang einen Krankheitsgewinn ziehen kann, läßt es die Neurose gewähren, deren ökonomische Schädlichkeit doch keinem Zweifel unterliegt. Auch die üble Lebenslage unseres Malers hätte keine Teufelsneurose bei ihm hervorgerufen, wenn aus seiner Not nicht eine verstärkte Vatersehnsucht erwachsen wäre. Nachdem aber die Melancholie und der Teufel abgetan waren, kam es bei ihm noch zum Kampf zwischen der libidinösen Lebenslust und der Einsicht, daß das Interesse der Lebenserhaltung gebieterisch Verzicht und Askese fordere. Es ist interessant, daß der Maler die Einheitlichkeit der beiden Stücke seiner Leidensgeschichte sehr wohl verspürt, denn er führt die eine wie die andere auf Verschreibungen, die er dem Teufel gegeben, zurück. Anderseits unterscheidet er nicht scharf zwischen den Einwirkungen des bösen Geistes und jenen der göttlichen Mächte, er hat für beide eine Bezeichnung: Erscheinungen des Teufels.
Einige Bemerkungen über den Begriff des Unbewußten in der Psychoanalyse (1912)
Ich möchte mit wenigen Worten und so klar als möglich darlegen, welcher Sinn dem Ausdruck »Unbewußtes« in der Psychoanalyse, nur in der Psychoanalyse, zukommt.
Eine Vorstellung –; oder jedes andere psychische Element –; kann jetzt in meinem Bewußtsein gegenwärtig sein und im nächsten Augenblick daraus verschwinden; sie kann nach einer Zwischenzeit ganz unverändert wiederum auftauchen, und zwar, wie wir es ausdrücken, aus der Erinnerung, nicht als Folge einer neuen Sinneswahrnehmung. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, sind wir zu der Annahme genötigt, daß die Vorstellung auch während der Zwischenzeit in unserem Geiste gegenwärtig gewesen sei, wenn sie auch im Bewußtsein latent blieb. In welcher Gestalt sie aber existiert haben kann, während sie im Seelenleben gegenwärtig und im Bewußtsein latent war, darüber können wir keine Vermutungen aufstellen.
An diesem Punkte müssen wir darauf gefaßt sein, dem philosophischen Einwurf zu begegnen, daß die latente Vorstellung nicht als Objekt der Psychologie vorhanden gewesen sei, sondern nur als physische Disposition für den Wiederablauf desselben psychischen Phänomens, nämlich eben jener Vorstellung. Aber wir können darauf erwidern, daß eine solche Theorie das Gebiet der eigentlichen Psychologie weit überschreitet, daß sie das Problem einfach umgeht, indem sie daran festhält, daß »bewußt« und »psychisch« identische Begriffe sind, und daß sie offenbar im Unrecht ist, wenn sie der Psychologie das Recht bestreitet, eine ihrer gewöhnlichsten Tatsachen, wie das Gedächtnis, durch ihre eigenen Hilfsmittel zu erklären.
Wir wollen nun die Vorstellung, die in unserem Bewußtsein gegenwärtig ist und die wir wahrnehmen, »bewußt« nennen und nur dies als Sinn des Ausdruckes »bewußt« gelten lassen; hingegen sollen latente Vorstellungen, wenn wir Grund zur Annahme haben, daß sie im Seelenleben enthalten sind –; wie es beim Gedächtnis der Fall war –;, mit dem Ausdruck »unbewußt« gekennzeichnet werden.
Eine unbewußte Vorstellung ist dann eine solche, die wir nicht bemerken, deren Existenz wir aber trotzdem auf Grund anderweitiger Anzeichen und Beweise zuzugeben bereit sind.
Dies könnte als eine recht uninteressante deskriptive oder klassifikatorische Arbeit aufgefaßt werden, wenn keine andere Erfahrung für unser Urteil in Betracht käme als die Tatsachen des Gedächtnisses oder die der Assoziation über unbewußte Mittelglieder. Aber das wohlbekannte Experiment der »posthypnotischen Suggestion« lehrt uns an der Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen bewußt und unbewußt festhalten und scheint ihren Wert zu erhöhen.
Bei diesem Experiment, wie es Bernheim ausgeführt hat, wird eine Person in einen hypnotischen Zustand versetzt und dann daraus erweckt. Während sie sich in dem hypnotischen Zustande, unter dem Einflusse des Arztes, befand, wurde ihr der Auftrag erteilt, eine bestimmte Handlung zu einem genau bestimmten Zeitpunkt, z. B. eine halbe Stunde später, auszuführen. Nach dem Erwachen ist allem Anscheine nach volles Bewußtsein und die gewöhnliche Geistesverfassung wiederum eingetreten, eine Erinnerung an den hypnotischen Zustand ist nicht vorhanden, und trotzdem drängt sich in dem vorher festgesetzten Augenblick der Impuls, dieses oder jenes zu tun, dem Geiste auf, und die Handlung wird mit Bewußtsein, wenn auch ohne zu wissen weshalb, ausgeführt. Es dürfte kaum möglich sein, eine andere Beschreibung des Phänomens zu geben, als mit den Worten, daß der Vorsatz im Geiste jener Person in latenter Form oder unbewußt vorhanden war, bis der gegebene Moment kam, in dem er dann bewußt geworden ist. Aber nicht in seiner Gänze ist er im Bewußtsein aufgetaucht, sondern nur die Vorstellung des auszuführenden Aktes. Alle anderen mit dieser Vorstellung assoziierten Ideen –; der Auftrag, der Einfluß des Arztes, die Erinnerung an den hypnotischen Zustand –;, blieben auch dann noch unbewußt.
Wir können aber aus einem solchen Experiment noch mehr lernen. Wir werden von einer rein beschreibenden zu einer dynamischen Auffassung des Phänomens hinübergeleitet. Die Idee der in der Hypnose aufgetragenen Handlung wurde in einem bestimmten Augenblick nicht bloß ein Objekt des Bewußtseins, sondern sie wurde auch wirksam, und dies ist die auffallendere Seite des Tatbestandes; sie wurde in Handlung übertragen, sobald das Bewußtsein ihre Gegenwart bemerkt hatte. Da der wirkliche Antrieb zum Handeln der Auftrag des Arztes ist, kann man kaum anders als einräumen, daß auch die Idee des Auftrages wirksam geworden ist.
Dennoch wurde dieser letztere Gedanke nicht ins Bewußtsein aufgenommen, wie es mit seinem Abkömmling, der Idee der Handlung, geschah; er verblieb unbewußt und war daher gleichzeitig wirksam und unbewußt.
Die posthypnotische Suggestion ist ein Produkt des Laboratoriums, eine künstlich geschaffene Tatsache. Aber wenn wir die Theorie der hysterischen Phänomene, die zuerst durch P. Janet aufgestellt und von Breuer und mir ausgearbeitet wurde, annehmen, so stehen uns natürliche Tatsachen in Fülle zur Verfügung, die den psychologischen Charakter der posthypnotischen Suggestion sogar noch klarer und deutlicher zeigen.
Das Seelenleben des hysterischen Patienten ist erfüllt mit wirksamen, aber unbewußten Gedanken; von ihnen stammen alle Symptome ab. Es ist in der Tat der auffälligste Charakterzug der hysterischen Geistesverfassung, daß sie von unbewußten Vorstellungen beherrscht wird. Wenn eine hysterische Frau erbricht, so kann sie dies wohl infolge der Idee tun, daß sie schwanger sei. Dennoch hat sie von dieser Idee keine Kenntnis, obwohl dieselbe durch eine der technischen Prozeduren der Psychoanalyse leicht in ihrem Seelenleben entdeckt und für sie bewußtgemacht werden kann. Wenn sie die Zuckungen und Gesten ausführt, die ihren »Anfall« ausmachen, so stellt sie sich nicht einmal die von ihr beabsichtigten Aktionen bewußt vor und beobachtet sie vielleicht mit den Gefühlen eines unbeteiligten Zuschauers. Nichtsdestoweniger vermag die Analyse nachzuweisen, daß sie ihre Rolle in der dramatischen Wiedergabe einer Szene aus ihrem Leben spielte, deren Erinnerung während der Attacke unbewußt wirksam war. Dasselbe Vorwalten wirksamer unbewußter Ideen wird durch die Analyse als das Wesentliche in der Psychologie aller anderen Formen von Neurose enthüllt.
Wir lernen also aus der Analyse neurotischer Phänomene, daß ein latenter oder unbewußter Gedanke nicht notwendigerweise schwach sein muß und daß die Anwesenheit eines solchen Gedankens im Seelenleben indirekte Beweise der zwingendsten Art gestattet, die dem direkten, durch das Bewußtsein gelieferten Beweis fast gleichwertig sind. Wir fühlen uns gerechtfertigt, unsere Klassifikation mit dieser Vermehrung unserer Kenntnisse in Übereinstimmung zu bringen, indem wir eine grundlegende Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von latenten und unbewußten Gedanken einführen. Wir waren gewohnt zu denken, daß jeder latente Gedanke dies infolge seiner Schwäche war und daß er bewußt wurde, sowie er Kraft erhielt. Wir haben nun die Überzeugung gewonnen, daß es gewisse latente Gedanken gibt, die nicht ins Bewußtsein eindringen, wie stark sie auch sein mögen. Wir wollen daher die latenten Gedanken der ersten Gruppe vorbewußt nennen, während wir den Ausdruck unbewußt (im eigentlichen Sinne) für die zweite Gruppe reservieren, die wir bei den Neurosen betrachtet haben. Der Ausdruck unbewußt, den wir bisher bloß im beschreibenden Sinne benützt haben, erhält jetzt eine erweiterte Bedeutung. Er bezeichnet nicht bloß latente Gedanken im allgemeinen, sondern besonders solche mit einem bestimmten dynamischen Charakter, nämlich diejenigen, die sich trotz ihrer Intensität und Wirksamkeit dem Bewußtsein fernehalten.
Ehe ich meine Auseinandersetzungen fortführe, will ich auf zwei Einwendungen Bezug nehmen, die sich voraussichtlich an diesem Punkte erheben. Die erste kann folgendermaßen formuliert werden: Anstatt uns die Hypothese der unbewußten Gedanken, von denen wir nichts wissen, anzueignen, täten wir besser anzunehmen, daß das Bewußtsein geteilt werden kann, so daß einzelne Gedanken oder andere Seelenvorgänge ein gesondertes Bewußtsein bilden können, das von der Hauptmasse bewußter psychischer Tätigkeit losgelöst und ihr entfremdet wurde. Wohlbekannte pathologische Fälle, wie jener des Dr. Azam, scheinen sehr geeignet zu sein zu beweisen, daß die Teilung des Bewußtseins keine phantastische Einbildung ist.
Ich gestatte mir, dieser Theorie entgegenzuhalten, daß sie einfach aus dem Mißbrauch mit dem Worte »bewußt« Kapital schlägt. Wir haben kein Recht, den Sinn dieses Wortes so weit auszudehnen, daß damit auch ein Bewußtsein bezeichnet werden kann, von dem sein Besitzer nichts weiß. Wenn Philosophen eine Schwierigkeit darin finden, an die Existenz eines unbewußten Gedankens zu glauben, so scheint mir die Existenz eines unbewußten Bewußtseins noch angreifbarer. Die Fälle, die man als Teilung des Bewußtseins beschreibt, wie der des Dr. Azam, können besser als Wandern des Bewußtseins angesehen werden, wobei diese Funktion –; oder was immer es sein mag –; zwischen zwei verschiedenen psychischen Komplexen hin- und herschwankt, die abwechselnd bewußt und unbewußt werden.
Der andere Einwand, der voraussichtlich erhoben werden wird, wäre der, daß wir auf die Psychologie der Normalen Folgerungen anwenden, die hauptsächlich aus dem Studium pathologischer Zustände stammen. Wir können ihn durch eine Tatsache erledigen, deren Kenntnis wir der Psychoanalyse verdanken. Gewisse Funktionsstörungen, die sich bei Gesunden höchst häufig ereignen, z. B. Lapsus linguae, Gedächtnis- und Sprachirrtümer, Namenvergessen usw., können leicht auf die Wirksamkeit starker unbewußter Gedanken zurückgeführt werden, geradeso wie die neurotischen Symptome. Wir werden mit einem zweiten, noch überzeugenderen Argument in einem späteren Abschnitt dieser Erörterung zusammentreffen.
Durch die Auseinanderhaltung vorbewußter und unbewußter Gedanken werden wir dazu veranlaßt, das Gebiet der Klassifikation zu verlassen und uns über die funktionalen und dynamischen Relationen in der Tätigkeit der Psyche eine Meinung zu bilden. Wir fanden ein wirksames Vorbewußtes, das ohne Schwierigkeit ins Bewußtsein übergeht, und ein wirksames Unbewußtes, das unbewußt bleibt und vom Bewußtsein abgeschnitten zu sein scheint.
Wir wissen nicht, ob diese zwei Arten psychischer Tätigkeit von Anfang an identisch oder ihrem Wesen nach entgegengesetzt sind, aber wir können uns fragen, warum sie im Verlaufe der psychischen Vorgänge verschieden geworden sein sollten. Auf diese Frage gibt uns die Psychoanalyse ohne Zögern klare Antwort. Es ist dem Erzeugnis des wirksamen Unbewußten keineswegs unmöglich, ins Bewußtsein einzudringen, aber zu dieser Leistung ist ein gewisser Aufwand von Anstrengung notwendig. Wenn wir es an uns selbst versuchen, erhalten wir das deutliche Gefühl einer Abwehr, die bewältigt werden muß, und wenn wir es bei einem Patienten hervorrufen, so erhalten wir die unzweideutigsten Anzeichen von dem, was wir Widerstand dagegen nennen. So lernen wir, daß der unbewußte Gedanke vom Bewußtsein durch lebendige Kräfte ausgeschlossen wird, die sich seiner Aufnahme entgegenstellen, während sie anderen Gedanken, den vorbewußten, nichts in den Weg legen. Die Psychoanalyse läßt keine Möglichkeit übrig, daran zu zweifeln, daß die Abweisung unbewußter Gedanken bloß durch die in ihrem Inhalt verkörperten Tendenzen hervorgerufen wird. Die nächstliegende und wahrscheinlichste Theorie, die wir in diesem Stadium unseres Wissens bilden können, ist die folgende: Das Unbewußte ist eine regelmäßige und unvermeidliche Phase in den Vorgängen, die unsere psychische Tätigkeit begründen; jeder psychische Akt beginnt als unbewußter und kann entweder so bleiben oder sich weiterentwickelnd zum Bewußtsein fortschreiten, je nachdem, ob er auf Widerstand trifft oder nicht. Die Unterscheidung zwischen vorbewußter und unbewußter Tätigkeit ist keine primäre, sondern wird erst hergestellt, nachdem die »Abwehr« ins Spiel getreten ist. Erst dann gewinnt der Unterschied zwischen vorbewußten Gedanken, die im Bewußtsein erscheinen und jederzeit dahin zurückkehren können, und unbewußten Gedanken, denen dies versagt bleibt, theoretischen sowie praktischen Wert. Eine grobe, aber ziemlich angemessene Analogie dieses supponierten Verhältnisses der bewußten Tätigkeit zur unbewußten bietet das Gebiet der gewöhnlichen Photographie. Das erste Stadium der Photographie ist das Negativ; jedes photographische Bild muß den »Negativprozeß« durchmachen, und einige dieser Negative, die in der Prüfung gut bestanden haben, werden zu dem »Positivprozeß« zugelassen, der mit dem Bilde endigt.
Aber die Unterscheidung zwischen vorbewußter und unbewußter Tätigkeit und die Erkenntnis der sie trennenden Schranke ist weder das letzte noch das bedeutungsvollste Resultat der psychoanalytischen Durchforschung des Seelenlebens. Es gibt ein psychisches Produkt, das bei den normalsten Personen anzutreffen ist und doch eine höchst auffallende Analogie zu den wildesten Erzeugnissen des Wahnsinns bietet und den Philosophen nicht verständlicher war als der Wahnsinn selbst. Ich meine die Träume. Die Psychoanalyse gründet sich auf die Traumanalyse; die Traumdeutung ist das vollständigste Stück Arbeit, das die junge Wissenschaft bis heute geleistet hat. Ein typischer Fall der Traumbildung kann folgendermaßen beschrieben werden: Ein Gedankenzug ist durch die geistige Tätigkeit des Tages wachgerufen worden und hat etwas von seiner Wirkungsfähigkeit zurückbehalten, durch die er dem allgemeinen Absinken des Interesses, welches den Schlaf herbeiführt und die geistige Vorbereitung für das Schlafen bildet, entgangen ist. Während der Nacht gelingt es diesem Gedankenzug, die Verbindung zu einem der unbewußten Wünsche zu finden, die von Kindheit an im Seelenleben des Träumers immer gegenwärtig, aber für gewöhnlich verdrängt und von seinem bewußten Dasein ausgeschlossen sind. Durch die von dieser unbewußten Unterstützung geliehene Kraft können die Gedanken, die Überbleibsel der Tagesarbeit, nun wiederum wirksam werden und im Bewußtsein in der Gestalt eines Traumes auftauchen. Es haben sich also dreierlei Dinge ereignet:
1) die Gedanken haben eine Verwandlung, Verkleidung und Entstellung durchgemacht, welche den Anteil des unbewußten Bundesgenossen darstellt;
2) den Gedanken ist es gelungen, das Bewußtsein zu einer Zeit zu besetzen, wo es ihnen nicht zugänglich hätte sein sollen;
3) ein Stück des Unbewußten, dem dies sonst unmöglich gewesen wäre, ist im Bewußtsein aufgetaucht.
Wir haben die Kunst gelernt, die » Tagesreste«: und die latenten Traumgedanken herauszufinden; durch ihren Vergleich mit dem manifesten Trauminhalt sind wir befähigt, uns ein Urteil über die Wandlungen, die sie durchgemacht haben, und über die Art und Weise, wie diese zustande gekommen sind, zu bilden.
Die latenten Traumgedanken unterscheiden sich in keiner Weise von den Erzeugnissen unserer gewöhnlichen bewußten Seelentätigkeit. Sie verdienen den Namen von vorbewußten Gedanken und können in der Tat in einem Zeitpunkte des Wachlebens bewußt gewesen sein. Aber durch die Verbindung mit den unbewußten Strebungen, die sie während der Nacht eingegangen sind, wurden sie den letzteren assimiliert, gewissermaßen auf den Zustand unbewußter Gedanken herabgedrückt und den Gesetzen, durch welche die unbewußte Tätigkeit geregelt wird, unterworfen. Hier ergibt sich die Gelegenheit zu lernen, was wir auf Grund von Überlegungen oder aus irgendeiner anderen Quelle empirischen Wissens nicht hätten erraten können, daß die Gesetze der unbewußten Seelentätigkeit sich im weiten Ausmaß von jenen der bewußten unterscheiden. Wir gewinnen durch Detailarbeit die Kenntnis der Eigentümlichkeiten des Unbewußten und können hoffen, daß wir durch gründlichere Erforschung der Vorgänge bei der Traumbildung noch mehr lernen werden.
Diese Untersuchung ist noch kaum zur Hälfte beendet, und eine Darlegung der bis jetzt erhaltenen Resultate ist nicht möglich, ohne in die höchst verwickelten Probleme der Traumdeutung einzugehen. Aber ich wollte diese Erörterung nicht abbrechen, ohne auf die Wandlung und den Fortschritt unseres Verständnisses des Unbewußten hinzuweisen, welche wir dem psychoanalytischen Studium der Träume verdanken.
Das Unbewußte schien uns anfangs bloß ein rätselhafter Charakter eines bestimmten psychischen Vorganges; nun bedeutet es uns mehr, es ist ein Anzeichen dafür, daß dieser Vorgang an der Natur einer gewissen psychischen Kategorie teilnimmt, die uns durch andere, bedeutsamere Charakterzüge bekannt ist, und daß er zu einem System psychischer Tätigkeit gehört, das unsere vollste Aufmerksamkeit verdient. Der Wert des Unbewußten als Index hat seine Bedeutung als Eigenschaft bei weitem hinter sich gelassen. Das System, welches sich uns durch das Kennzeichen kundgibt, daß die einzelnen Vorgänge, die es zusammensetzen, unbewußt sind, belegen wir mit dem Namen »das Unbewußte«, in Ermangelung eines besseren und weniger zweideutigen Ausdruckes. Ich schlage als Bezeichnung dieses Systems die Buchstaben » Ubw«, eine Abkürzung des Wortes »Unbewußt« vor.
Dies ist der dritte und wichtigste Sinn, den der Ausdruck » unbewußt« in der Psychoanalyse erworben hat.
Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit (1916)
Wenn der Arzt die psychoanalytische Behandlung eines Nervösen durchführt, so ist sein Interesse keineswegs in erster Linie auf dessen Charakter gerichtet. Er möchte viel eher wissen, was seine Symptome bedeuten, welche Triebregungen sich hinter ihnen verbergen und durch sie befriedigen, und über welche Stationen der geheimnisvolle Weg von jenen Triebwünschen zu diesen Symptomen geführt hat. Aber die Technik, der er folgen muß, nötigt den Arzt bald, seine Wißbegierde vorerst auf andere Objekte zu richten. Er bemerkt, daß seine Forschung durch Widerstände bedroht wird, die ihm der Kranke entgegensetzt, und darf diese Widerstände dem Charakter des Kranken zurechnen. Nun hat dieser Charakter den ersten Anspruch an sein Interesse.
Was sich der Bemühung des Arztes widersetzt, sind nicht immer die Charakterzüge, zu denen sich der Kranke bekennt und die ihm von seiner Umgebung zugesprochen werden. Oft zeigen sich Eigenschaften des Kranken bis zu ungeahnten Intensitäten gesteigert, von denen er nur ein bescheidenes Maß zu besitzen schien, oder es kommen Einstellungen bei ihm zum Vorschein, die sich in anderen Beziehungen des Lebens nicht verraten hatten. Mit der Beschreibung und Zurückführung einiger von diesen überraschenden Charakterzügen werden sich die nachstehenden Zeilen beschäftigen.
I. Die Ausnahmen
Die psychoanalytische Arbeit sieht sich immer wieder vor die Aufgabe gestellt, den Kranken zum Verzicht auf einen naheliegenden und unmittelbaren Lustgewinn zu bewegen. Er soll nicht auf Lust überhaupt verzichten; das kann man vielleicht keinem Menschen zumuten, und selbst die Religion muß ihre Forderung, irdische Lust fahrenzulassen, mit dem Versprechen begründen, dafür ein ungleich höheres Maß von wertvollerer Lust in einem Jenseits zu gewähren. Nein, der Kranke soll bloß auf solche Befriedigungen verzichten, denen eine Schädigung unfehlbar nachfolgt, er soll bloß zeitweilig entbehren, nur den unmittelbaren Lustgewinn gegen einen besser gesicherten, wenn auch aufgeschobenen, eintauschen lernen. Oder mit anderen Worten, er soll unter der ärztlichen Leitung jenen Fortschritt vom Lustprinzip zum Realitätsprinzip machen, durch welchen sich der reife Mann vom Kinde scheidet. Bei diesem Erziehungswerk spielt die bessere Einsicht des Arztes kaum eine entscheidende Rolle; er weiß ja in der Regel dem Kranken nichts anderes zu sagen, als was diesem sein eigener Verstand sagen kann. Aber es ist nicht dasselbe, etwas bei sich zu wissen und dasselbe von anderer Seite zu hören; der Arzt übernimmt die Rolle dieses wirksamen anderen; er bedient sich des Einflusses, den ein Mensch auf den anderen ausübt. Oder: erinnern wir uns daran, daß es in der Psychoanalyse üblich ist, das Ursprüngliche und Wurzelhafte anstelle des Abgeleiteten und Gemilderten einzusetzen, und sagen wir, der Arzt bedient sich bei seinem Erziehungswerk irgendeiner Komponente der Liebe. Er wiederholt bei solcher Nacherziehung wahrscheinlich nur den Vorgang, der überhaupt die erste Erziehung ermöglicht hat. Neben der Lebensnot ist die Liebe die große Erzieherin, und der unfertige Mensch wird durch die Liebe der ihm Nächsten dazu bewogen, auf die Gebote der Not zu achten und sich die Strafen für deren Übertretung zu ersparen.
Fordert man so von den Kranken einen vorläufigen Verzicht auf irgendeine Lustbefriedigung, ein Opfer, eine Bereitwilligkeit, zeitweilig für ein besseres Ende Leiden auf sich zu nehmen, oder auch nur den Entschluß, sich einer für alle geltenden Notwendigkeit zu unterwerfen, so stößt man auf einzelne Personen, die sich mit einer besonderen Motivierung gegen solche Zumutung sträuben. Sie sagen, sie haben genug gelitten und entbehrt, sie haben Anspruch darauf, von weiteren Anforderungen verschont zu werden, sie unterwerfen sich keiner unliebsamen Notwendigkeit mehr, denn sie seien Ausnahmen und gedenken es auch zu bleiben. Bei einem Kranken solcher Art war dieser Anspruch zu der Überzeugung gesteigert, daß eine besondere Vorsehung über ihn wache, die ihn vor derartigen schmerzlichen Opfern bewahren werde. Gegen innere Sicherheiten, die sich mit solcher Stärke äußern, richten die Argumente des Arztes nichts aus, aber auch sein Einfluß versagt zunächst, und er wird darauf hingewiesen, den Quellen nachzuspüren, aus welchen das schädliche Vorurteil gespeist wird.
Nun ist es wohl unzweifelhaft, daß ein jeder sich für eine »Ausnahme« ausgeben und Vorrechte vor den anderen beanspruchen möchte. Aber gerade darum bedarf es einer besonderen und nicht überall vorfindlichen Begründung, wenn er sich wirklich als Ausnahme verkündet und benimmt. Es mag mehr als nur eine solche Begründung geben; in den von mir untersuchten Fällen gelang es, eine gemeinsame Eigentümlichkeit der Kranken in deren früheren Lebensschicksalen nachzuweisen: Ihre Neurose knüpfte an ein Erlebnis oder an ein Leiden an, das sie in den ersten Kinderzeiten betroffen hatte, an dem sie sich unschuldig wußten und das sie als eine ungerechte Benachteiligung ihrer Person bewerten konnten. Die Vorrechte, die sie aus diesem Unrecht ableiteten, und die Unbotmäßigkeit, die sich daraus ergab, hatten nicht wenig dazu beigetragen, um die Konflikte, die später zum Ausbruch der Neurose führten, zu verschärfen. Bei einer dieser Patientinnen wurde die besprochene Einstellung zum Leben vollzogen, als sie erfuhr, daß ein schmerzhaftes organisches Leiden, welches sie an der Erreichung ihrer Lebensziele gehindert hatte, kongenitalen Ursprungs war. Solange sie dieses Leiden für eine zufällige spätere Erwerbung hielt, ertrug sie es geduldig; von ihrer Aufklärung an, es sei ein Stück mitgebrachter Erbschaft, wurde sie rebellisch. Der junge Mann, der sich von einer besonderen Vorsehung bewacht glaubte, war als Säugling das Opfer einer zufälligen Infektion durch seine Amme geworden und hatte sein ganzes späteres Leben von seinen Entschädigungsansprüchen wie von einer Unfallsrente gezehrt, ohne zu ahnen, worauf er seine Ansprüche gründete. In seinem Falle wurde die Analyse, welche dieses Ergebnis aus dunklen Erinnerungsresten und Symptomdeutungen konstruierte, durch Mitteilungen der Familie objektiv bestätigt.
Aus leicht verständlichen Gründen kann ich von diesen und anderen Krankengeschichten ein mehreres nicht mitteilen. Ich will auch auf die naheliegende Analogie mit der Charakterverbildung nach langer Kränklichkeit der Kinderjahre und im Benehmen ganzer Völker mit leidenschwerer Vergangenheit nicht eingehen. Dagegen werde ich es mir nicht versagen, auf jene von dem größten Dichter geschaffene Gestalt hinzuweisen, in deren Charakter der Ausnahmsanspruch mit dem Momente der kongenitalen Benachteiligung so innig verknüpft und durch dieses motiviert ist.
Im einleitenden Monolog zu Shakespeares Richard III. sagt Gloster, der spätere König:
Doch ich, zu Possenspielen nicht gemacht, Noch um zu buhlen mit verliebten Spiegeln; Ich, roh geprägt, entblößt von Liebes-Majestät Vor leicht sich dreh'nden Nymphen sich zu brüsten; Ich, um dies schöne Ebenmaß verkürzt, Von der Natur um Bildung falsch betrogen, Entstellt, verwahrlost, vor der Zeit gesandt In diese Welt des Atmens, halb kaum fertig Gemacht, und zwar so lahm und ungeziemend, Daß Hunde bellen, hink' ich wo vorbei; — — — — — — — — — Und darum, weil ich nicht als ein Verliebter Kann kürzen diese fein beredten Tage, Bin ich gewillt ein Bösewicht zu werden Und Feind den eitlen Freuden dieser Tage.
Unser erster Eindruck von dieser Programmrede wird vielleicht die Beziehung zu unserem Thema vermissen. Richard scheint nichts anderes zu sagen als: Ich langweile mich in dieser müßigen Zeit und ich will mich amüsieren. Weil ich aber wegen meiner Mißgestalt mich nicht als Liebender unterhalten kann, werde ich den Bösewicht spielen, intrigieren, morden und was mir sonst gefällt. Eine so frivole Motivierung müßte jede Spur von Anteilnahme beim Zuschauer ersticken, wenn sich nichts Ernsteres hinter ihr verbärge. Dann wäre aber auch das Stück psychologisch unmöglich, denn der Dichter muß bei uns einen geheimen Hintergrund von Sympathie für seinen Helden zu schaffen verstehen, wenn wir die Bewunderung für seine Kühnheit und Geschicklichkeit ohne inneren Einspruch verspüren sollen, und solche Sympathie kann nur im Verständnis, im Gefühle einer möglichen inneren Gemeinschaft mit ihm, begründet sein.
Ich meine darum, der Monolog Richards sagt nicht alles; er deutet bloß an und überläßt es uns, das Angedeutete auszuführen. Wenn wir aber diese Vervollständigung vornehmen, dann schwindet der Anschein von Frivolität, dann kommt die Bitterkeit und Ausführlichkeit, mit der Richard seine Mißgestalt geschildert hat, zu ihrem Rechte, und uns wird die Gemeinsamkeit klargemacht, die unsere Sympathie auch für den Bösewicht erzwingt. Es heißt dann: Die Natur hat ein schweres Unrecht an mir begangen, indem sie mir die Wohlgestalt versagt hat, welche die Liebe der Menschen gewinnt. Das Leben ist mir eine Entschädigung dafür schuldig, die ich mir holen werde. Ich habe den Anspruch darauf, eine Ausnahme zu sein, mich über die Bedenken hinwegzusetzen, durch die sich andere hindern lassen. Ich darf selbst Unrecht tun, denn an mir ist Unrecht geschehen –; und nun fühlen wir, daß wir selbst so werden könnten wie Richard, ja daß wir es im kleinen Maßstabe bereits sind. Richard ist eine gigantische Vergrößerung dieser einen Seite, die wir auch in uns finden. Wir glauben alle Grund zu haben, daß wir mit Natur und Schicksal wegen kongenitaler und infantiler Benachteiligung grollen; wir fordern alle Entschädigung für frühzeitige Kränkungen unseres Narzißmus, unserer Eigenliebe. Warum hat uns die Natur nicht die goldenen Locken Balders geschenkt oder die Stärke Siegfrieds oder die hohe Stirne des Genies, den edlen Gesichtsschnitt des Aristokraten? Warum sind wir in der Bürgerstube geboren anstatt im Königsschloß? Wir würden es ebensogut treffen, schön und vornehm zu sein wie alle, die wir jetzt darum beneiden müssen.
Es ist aber eine feine ökonomische Kunst des Dichters, daß er seinen Helden nicht alle Geheimnisse seiner Motivierung laut und restlos aussprechen läßt. Dadurch nötigt er uns, sie zu ergänzen, beschäftigt unsere geistige Tätigkeit, lenkt sie vom kritischen Denken ab und hält uns in der Identifizierung mit dem Helden fest. Ein Stümper an seiner Stelle würde alles, was er uns mitteilen will, in bewußten Ausdruck fassen und fände sich dann unserer kühlen, frei beweglichen Intelligenz gegenüber, die eine Vertiefung der Illusion unmöglich macht.
Wir wollen aber die »Ausnahmen« nicht verlassen, ohne zu bedenken, daß der Anspruch der Frauen auf Vorrechte und Befreiung von soviel Nötigungen des Lebens auf demselben Grunde ruht. Wie wir aus der psychoanalytischen Arbeit erfahren, betrachten sich die Frauen als infantil geschädigt, ohne ihre Schuld um ein Stück verkürzt und zurückgesetzt, und die Erbitterung so mancher Tochter gegen ihre Mutter hat zur letzten Wurzel den Vorwurf, daß sie sie als Weib anstatt als Mann zur Welt gebracht hat.
II. Die am Erfolge scheitern
Die psychoanalytische Arbeit hat uns den Satz geschenkt: Die Menschen erkranken neurotisch infolge der Versagung. Die Versagung der Befriedigung für ihre libidinösen Wünsche ist gemeint, und ein längerer Umweg ist nötig, um den Satz zu verstehen. Denn zur Entstehung der Neurose bedarf es eines Konflikts zwischen den libidinösen Wünschen eines Menschen und jenem Anteil seines Wesens, den wir sein Ich heißen, der Ausdruck seiner Selbsterhaltungstriebe ist und seine Ideale von seinem eigenen Wesen einschließt. Ein solcher pathogener Konflikt kommt nur dann zustande, wenn sich die Libido auf Wege und Ziele werfen will, die vom Ich längst überwunden und geächtet sind, die es also auch für alle Zukunft verboten hat, und das tut die Libido erst dann, wenn ihr die Möglichkeit einer ichgerechten idealen Befriedigung benommen ist. Somit wird die Entbehrung, die Versagung einer realen Befriedigung, die erste Bedingung für die Entstehung der Neurose, wenn auch lange nicht die einzige.
Um so mehr muß es überraschend, ja verwirrend wirken, wenn man als Arzt die Erfahrung macht, daß Menschen gelegentlich gerade dann erkranken, wenn ihnen ein tief begründeter und lange gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Es sieht dann so aus, als ob sie ihr Glück nicht vertragen würden, denn an dem ursächlichen Zusammenhange zwischen dem Erfolge und der Erkrankung kann man nicht zweifeln. So hatte ich Gelegenheit, in das Schicksal einer Frau Einsicht zu nehmen, das ich als vorbildlich für solche tragische Wendungen beschreiben will.
Von guter Herkunft und wohlerzogen, konnte sie als ganz junges Mädchen ihre Lebenslust nicht zügeln, riß sich vom Elternhause los und trieb sich abenteuernd in der Welt herum, bis sie die Bekanntschaft eines Künstlers machte, der ihren weiblichen Reiz zu schätzen wußte, aber auch die feinere Anlage an der Herabgewürdigten zu ahnen verstand. Er nahm sie in sein Haus und gewann an ihr eine treue Lebensgefährtin, der zum vollen Glück nur die bürgerliche Rehabilitierung zu fehlen schien. Nach jahrelangem Zusammenleben setzte er es durch, daß seine Familie sich mit ihr befreundete, und war nun bereit, sie zu seiner Frau vor dem Gesetze zu machen. In diesem Moment begann sie zu versagen. Sie vernachlässigte das Haus, dessen rechtmäßige Herrin sie nun werden sollte, hielt sich für verfolgt von den Verwandten, die sie in die Familie aufnehmen wollten, sperrte dem Manne durch sinnlose Eifersucht jeden Verkehr, hinderte ihn an seiner künstlerischen Arbeit und verfiel bald in unheilbare seelische Erkrankung.
Eine andere Beobachtung zeigte mir einen höchst respektablen Mann, der, selbst akademischer Lehrer, durch viele Jahre den begreiflichen Wunsch genährt hatte, der Nachfolger seines Meisters zu werden, der ihn selbst in die Wissenschaft eingeführt hatte. Als nach dem Rücktritte jenes Alten die Kollegen ihm mitteilten, daß kein anderer als er zu dessen Nachfolger ausersehen sei, begann er zaghaft zu werden, verkleinerte seine Verdienste, erklärte sich für unwürdig, die ihm zugedachte Stellung auszufüllen, und verfiel in eine Melancholie, die ihn für die nächsten Jahre von jeder Tätigkeit ausschaltete.
So verschieden diese beiden Fälle sonst sind, so treffen sie doch in dem einen zusammen, daß die Erkrankung auf die Wunscherfüllung hin auftritt und den Genuß derselben zunichte macht.
Der Widerspruch zwischen solchen Erfahrungen und dem Satze, der Mensch erkranke an Versagung, ist nicht unlösbar. Die Unterscheidung einer äußerlichen von einer inneren Versagung hebt ihn auf. Wenn in der Realität das Objekt weggefallen ist, an dem die Libido ihre Befriedigung finden kann, so ist dies eine äußerliche Versagung. Sie ist an sich wirkungslos, noch nicht pathogen, solange sich nicht eine innere Versagung zu ihr gesellt. Diese muß vom Ich ausgehen und der Libido andere Objekte streitig machen, deren sie sich nun bemächtigen will. Erst dann entsteht ein Konflikt und die Möglichkeit einer neurotischen Erkrankung, d. h. einer Ersatzbefriedigung auf dem Umwege über das verdrängte Unbewußte. Die innere Versagung kommt also in allen Fällen in Betracht, nur tritt sie nicht eher in Wirkung, als bis die äußerliche reale Versagung die Situation für sie vorbereitet hat. In den Ausnahmsfällen, wenn die Menschen am Erfolge erkranken, hat die innere Versagung für sich allein gewirkt, ja sie ist erst hervorgetreten, nachdem die äußerliche Versagung der Wunscherfüllung Platz gemacht hat. Daran bleibt etwas für den ersten Anschein Auffälliges, aber bei näherer Erwägung besinnen wir uns doch, es sei gar nicht ungewöhnlich, daß das Ich einen Wunsch als harmlos toleriert, solange er ein Dasein als Phantasie führt und ferne von der Erfüllung scheint, während es sich scharf gegen ihn zur Wehr setzt, sobald er sich der Erfüllung nähert und Realität zu werden droht. Der Unterschied gegen wohlbekannte Situationen der Neurosenbildung liegt nur darin, daß sonst innerliche Steigerungen der Libidobesetzung die bisher geringgeschätzte und geduldete Phantasie zum gefürchteten Gegner machen, während in unseren Fällen das Signal zum Ausbruch des Konflikts durch eine reale äußere Wandlung gegeben wird.
Die analytische Arbeit zeigt uns leicht, daß es Gewissensmächte sind, welche der Person verbieten, aus der glücklichen realen Veränderung den lange erhofften Gewinn zu ziehen. Eine schwierige Aufgabe aber ist es, Wesen und Herkunft dieser richtenden und strafenden Tendenzen zu erkunden, die uns durch ihre Existenz oft dort überraschen, wo wir sie zu finden nicht erwarteten. Was wir darüber wissen oder vermuten, will ich aus den bekannten Gründen nicht an Fällen der ärztlichen Beobachtung, sondern an Gestalten erörtern, die große Dichter aus der Fülle ihrer Seelenkenntnis erschaffen haben.
Eine Person, die nach erreichtem Erfolge zusammenbricht, nachdem sie mit unbeirrter Energie um ihn gerungen hat, ist Shakespeares Lady Macbeth. Es ist vorher kein Schwanken und kein Anzeichen eines inneren Kampfes in ihr, kein anderes Streben, als die Bedenken ihres ehrgeizigen und doch mildfühlenden Mannes zu besiegen. Dem Mordvorsatz will sie selbst ihre Weiblichkeit opfern, ohne zu erwägen, welche entscheidende Rolle dieser Weiblichkeit zufallen muß, wenn es dann gelten soll, das durch Verbrechen erreichte Ziel ihres Ehrgeizes zu behaupten.
(Akt I, Szene 5): »Kommt, ihr Geister, Die ihr auf Mordgedanken lauscht, entweiht mich. — — — — — — — An meine Brüste, Ihr Mordhelfer! Saugt mir Milch zu Galle!«
(Akt I, Szene 7): »Ich gab die Brust und weiß, Wie zärtlich man das Kind liebt, das man tränkt. Und doch, dieweil es mir ins Antlitz lächelt, Wollt' reißen ich von meinem Mutterbusen Sein zahnlos Mündlein, und sein Hirn ausschmettern, Hätt' ich's geschworen, wie du jenes schwurst!«
Eine einzige leise Regung des Widerstrebens ergreift sie vor der Tat:
(Akt II, Szene 2): »Hätt' er geglichen meinem Vater nicht Als er so schlief, ich hätt's getan.«
Nun, da sie Königin geworden durch den Mord an Duncan, meldet sich flüchtig etwas wie eine Enttäuschung, wie ein Überdruß. Wir wissen nicht, woher.
(Akt III, Szene 2): »Nichts hat man, alles Lüge, Gelingt der Wunsch, und fehlt doch die Genüge, 'S ist sichrer das zu sein, was wir zerstören, Als durch Zerstörung ew'ger Angst zu schwören.«
Doch hält sie aus. In der nach diesen Worten folgenden Szene des Banketts bewahrt sie allein die Besinnung, deckt die Verwirrung ihres Mannes, findet einen Vorwand, um die Gäste zu entlassen. Und dann entschwindet sie uns. Wir sehen sie (in der ersten Szene des fünften Aktes) als Somnambule wieder, an die Eindrücke jener Mordnacht fixiert. Sie spricht ihrem Manne wieder Mut zu wie damals:
»Pfui, mein Gemahl, pfui, ein Soldat und furchtsam? –; Was haben wir zu fürchten, wer es weiß? Niemand zieht unsere Macht zur Rechenschaft.« –; –; –;
Sie hört das Klopfen ans Tor, das ihren Mann nach der Tat erschreckte. Daneben aber bemüht sie sich, »die Tat ungeschehen zu machen, die nicht mehr ungeschehen werden« kann. Sie wäscht ihre Hände, die mit Blut befleckt sind und nach Blut riechen, und wird der Vergeblichkeit dieser Bemühung bewußt. Die Reue scheint sie niedergeworfen zu haben, die so reuelos schien. Als sie stirbt, findet Macbeth, der unterdes so unerbittlich geworden ist, wie sie sich anfänglich zeigte, nur die eine kurze Nachrede für sie:
(Akt V, Szene 5): »Sie konnte später sterben. Es war noch Zeit genug für solch ein Wort.«
Und nun fragt man sich, was hat diesen Charakter zerbrochen, der aus dem härtesten Metall geschmiedet schien? Ist's nur die Enttäuschung, das andere Gesicht, das die vollzogene Tat zeigt, sollen wir rückschließen, daß auch in der Lady Macbeth ein ursprünglich weiches und weiblich mildes Seelenleben sich zu einer Konzentration und Hochspannung emporgearbeitet hatte, der keine Andauer beschieden sein konnte, oder dürfen wir nach Anzeichen forschen, die uns diesen Zusammenbruch durch eine tiefere Motivierung menschlich näherbringen?
Ich halte es für unmöglich, hier eine Entscheidung zu treffen. Shakespeares Macbeth ist ein Gelegenheitsstück, zur Thronbesteigung des bisherigen Schottenkönigs James gedichtet. Der Stoff war gegeben und gleichzeitig von anderen Autoren behandelt worden, deren Arbeit Shakespeare wahrscheinlich in gewohnter Weise genützt hat. Er bot merkwürdige Anspielungen an die gegenwärtige Situation. Die »jungfräuliche« Elisabeth, von der ein Gerede wissen wollte, daß sie nie imstande gewesen wäre, ein Kind zu gebären, die sich einst bei der Nachricht von James' Geburt im schmerzlichen Aufschrei als »einen dürren Stamm« bezeichnet hatte [Fußnote]Vgl. Macbeth (Akt II, Szene 1): »Auf mein Haupt setzten sie unfruchtbar Gold, Ein dürres Zepter reichten sie der Faust, Daß es entgleite dann in fremde Hand, Da nicht mein Sohn mir nachfolgt.« –; –; –;, war eben durch ihre Kinderlosigkeit genötigt worden, den Schottenkönig zu ihrem Nachfolger werden zu lassen. Der war aber der Sohn jener Maria, deren Hinrichtung sie, wenn auch widerwillig, angeordnet hatte und die trotz aller Trübung der Beziehungen durch politische Rücksichten doch ihre Blutsverwandte und ihr Gast genannt werden konnte..
Die Thronbesteigung Jakobs I. war wie eine Demonstration des Fluches der Unfruchtbarkeit und der Segnungen der fortlaufenden Generation. Und auf diesen nämlichen Gegensatz ist die Entwicklung in Shakespeares Macbeth eingestellt. Die Schicksalsschwestern haben ihm verheißen, daß er selbst König werden, dem Banquo aber, daß seine Kinder die Krone überkommen sollen. Macbeth empört sich gegen diesen Schicksalsspruch, er begnügt sich nicht mit der Befriedigung des eigenen Ehrgeizes, er will Gründer einer Dynastie sein und nicht zum Vorteile Fremder gemordet haben. Man übersieht diesen Punkt, wenn man in Shakespeares Stück nur die Tragödie des Ehrgeizes erblicken will. Es ist klar, da Macbeth selbst nicht ewig leben kann, so gibt es für ihn nur einen Weg, den Teil der Prophezeiung, der ihm widerstrebt, zu entkräften, wenn er nämlich selbst Kinder hat, die ihm nachfolgen können. Er scheint sie auch von seinem starken Weibe zu erwarten:
(Akt I, Szene 7): »Du, gebier nur Söhne, Nur Männer sollte dein unschreckbar Mark Zusammensetzen.« — — — — —
Und ebenso klar ist, wenn er in dieser Erwartung getäuscht wird, dann muß er sich dem Schicksal unterwerfen, oder sein Handeln verliert Ziel und Zweck und verwandelt sich in das blinde Wüten eines zum Untergange Verurteilten, der vorher noch, was ihm erreichbar ist, vernichten will. Wir sehen, daß Macbeth diese Entwicklung durchmacht, und auf der Höhe der Tragödie finden wir jenen erschütternden, so oft schon als vieldeutig erkannten Ausruf, der den Schlüssel für seine Wandlung enthalten könnte, den Ausruf Macduffs:
(Akt IV, Szene 3): »Er hat keine Kinder.«
Das heißt gewiß: Nur weil er selbst kinderlos ist, konnte er meine Kinder morden, aber es kann auch mehr in sich fassen, und vor allem könnte es das tiefste Motiv bloßlegen, welches sowohl Macbeth weit über seine Natur hinausdrängt, als auch den Charakter der harten Frau an seiner einzigen schwachen Stelle trifft. Hält man aber Umschau von dem Gipfelpunkt, den diese Worte Macduffs bezeichnen, so sieht man das ganze Stück von Beziehungen auf das Vater-Kinderverhältnis durchsetzt. Der Mord des gütigen Duncan ist wenig anders als ein Vatermord; im Falle Banquos hat Macbeth den Vater getötet, während ihm der Sohn entgeht; bei Macduff tötet er die Kinder, weil ihm der Vater entflohen ist. Ein blutiges und gekröntes Kind lassen ihm die Schicksalsschwestern in der Beschwörungsszene erscheinen; das bewaffnete Haupt vorher ist wohl Macbeth selbst. Im Hintergrunde aber erhebt sich die düstere Gestalt des Rächers Macduff, der selbst eine Ausnahme von den Gesetzen der Generation ist, da er nicht von seiner Mutter geboren, sondern aus ihrem Leib geschnitten wurde.
Es wäre nun durchaus im Sinne der auf Talion aufgebauten poetischen Gerechtigkeit, wenn die Kinderlosigkeit Macbeths und die Unfruchtbarkeit seiner Lady die Strafe wären für ihre Verbrechen gegen die Heiligkeit der Generation, wenn Macbeth nicht Vater werden könnte, weil er den Kindern den Vater und dem Vater die Kinder geraubt, und wenn sich so an der Lady Macbeth die Entweihung vollzogen hatte, zu der sie die Geister des Mordes aufgerufen hat. Ich glaube, man verstünde ohneweiters die Erkrankung der Lady, die Verwandlung ihres Frevelmuts in Reue, als Reaktion auf ihre Kinderlosigkeit, durch die sie von ihrer Ohnmacht gegen die Satzungen der Natur überzeugt und gleichzeitig daran gemahnt wird, daß ihr Verbrechen durch ihr eigenes Verschulden um den besseren Teil seines Ertrags gebracht worden ist.
In der Chronik von Holinshed (1577), aus welcher Shakespeare den Stoff des Macbeth schöpfte, findet die Lady nur eine einzige Erwähnung als Ehrgeizige, die ihren Mann zum Morde aufstachelt, um selbst Königin zu werden. Von ihren weiteren Schicksalen und von einer Entwicklung ihres Charakters ist nicht die Rede. Dagegen scheint es, als ob dort die Wandlung im Charakter Macbeths zum blutigen Wüterich ähnlich motiviert werden sollte, wie wir es eben versucht haben. Denn bei Holinshed liegen zwischen dem Morde an Duncan, durch den Macbeth König wird, und seinen weiteren Missetaten zehn Jahre, in denen er sich als strenger, aber gerechter Herrscher erweist. Erst nach diesem Zeitraume tritt bei ihm die Änderung ein, unter dem Einflusse der quälenden Befürchtung, daß die Banquo erteilte Prophezeiung sich ebenso erfüllen könne wie die seines eigenen Schicksals. Nun erst läßt er Banquo töten und wird wie bei Shakespeare von einem Verbrechen zum andern fortgerissen. Es wird auch bei Holinshed nicht ausdrücklich gesagt, daß es seine Kinderlosigkeit ist, welche ihn auf diesen Weg treibt, aber es bleibt Zeit und Raum für diese naheliegende Motivierung. Anders bei Shakespeare. In atemraubender Hast jagen in der Tragödie die Ereignisse an uns vorüber, so daß sich aus den Angaben der Personen im Stücke etwa eine Woche als die Zeitdauer ihres Ablaufes berechnen läßt [Fußnote]Darmstetter (1881, LXXV).. Durch diese Beschleunigung wird all unseren Konstruktionen über die Motivierung des Umschwungs im Charakter Macbeths und seiner Lady der Boden entzogen. Es fehlt die Zeit, innerhalb welcher die fortgesetzte Enttäuschung der Kinderhoffnung das Weib zermürben und den Mann in trotzige Raserei treiben könnte, und es bleibt der Widerspruch bestehen, daß so viele feine Zusammenhänge innerhalb des Stückes und zwischen ihm und seinem Anlaß ein Zusammentreffen im Motiv der Kinderlosigkeit anstreben, während die zeitliche Ökonomie der Tragödie eine Charakterentwicklung aus anderen als den innerlichsten Motiven ausdrücklich ablehnt.
Welches aber diese Motive sein können, die in so kurzer Zeit aus dem zaghaften Ehrgeizigen einen hemmungslosen Wüterich und aus der stahlharten Anstifterin eine von Reue zerknirschte Kranke machen, das läßt sich meines Erachtens nicht erraten. Ich meine, wir müssen darauf verzichten, das dreifach geschichtete Dunkel zu durchdringen, zu dem sich die schlechte Erhaltung des Textes, die unbekannte Intention des Dichters und der geheime Sinn der Sage hier verdichtet haben. Ich möchte es auch nicht gelten lassen, daß jemand einwende, solche Untersuchungen seien müßig angesichts der großartigen Wirkung, die die Tragödie auf den Zuschauer ausübt. Der Dichter kann uns zwar durch seine Kunst während der Darstellung überwältigen und unser Denken dabei lähmen, aber er kann uns nicht daran hindern, daß wir uns nachträglich bemühen, diese Wirkung aus ihrem psychologischen Mechanismus zu begreifen. Auch die Bemerkung, es stehe dem Dichter frei, die natürliche Zeitfolge der von ihm vorgeführten Begebenheiten in beliebiger Weise zu verkürzen, wenn er durch das Opfer der gemeinen Wahrscheinlichkeit eine Steigerung des dramatischen Effekts erzielen kann, scheint mir hier nicht an ihrem Platze. Denn ein solches Opfer ist doch nur zu rechtfertigen, wo es bloß die Wahrscheinlichkeit stört [Fußnote]Wie in der Werbung Richards III. um Anna an der Bahre des von ihm ermordeten Königs., aber nicht, wo es die kausale Verknüpfung aufhebt, und der dramatischen Wirkung wäre kaum Abbruch geschehen, wenn der Zeitablauf unbestimmt gelassen wäre, anstatt durch ausdrückliche Äußerungen auf wenige Tage eingeengt zu werden.
Es fällt so schwer, ein Problem wie das des Macbeth als unlösbar zu verlassen, daß ich noch den Versuch wage, eine Bemerkung anzufügen, die nach einem neuen Ausweg weist. Ludwig Jekels hat kürzlich in einer Shakespeare-Studie ein Stück der Technik des Dichters zu erraten geglaubt, welches auch für Macbeth in Betracht kommen könnte. Er meint, daß Shakespeare häufig einen Charakter in zwei Personen zerlegt, von denen dann jede unvollkommen begreiflich erscheint, solange man sie nicht mit der anderen wiederum zur Einheit zusammensetzt. So könnte es auch mit Macbeth und der Lady sein, und dann würde es natürlich zu nichts führen, wollte man sie als selbständige Person fassen und nach der Motivierung ihrer Umwandlung forschen, ohne auf den sie ergänzenden Macbeth Rücksicht zu nehmen. Ich folge dieser Spur nicht weiter, aber ich will doch anführen, was in so auffälliger Weise diese Auffassung stützt, daß die Angstkeime, die in der Mordnacht bei Macbeth hervorbrechen, nicht bei ihm, sondern bei der Lady zur Entwicklung gelangen [Fußnote]Vgl. Darmstetter, l. c.. Er ist es, der vor der Tat die Halluzination des Dolches gehabt hat, aber sie, die später der geistigen Erkrankung verfällt; er hat nach dem Morde im Hause schreien gehört: Schlaft nicht mehr, Macbeth mordet den Schlaf und also soll Macbeth nicht mehr schlafen, aber wir vernehmen nichts davon, daß König Macbeth nicht mehr schläft, während wir sehen, daß die Königin aus ihrem Schlafe aufsteht und nachtwandelnd ihre Schuld verrät; er stand hilflos da mit blutigen Händen und klagte, daß all des Meergottes Flut nicht reinwasche seine Hand; sie tröstete damals: Ein wenig Wasser spült uns ab die Tat, aber dann ist sie es, die eine Viertelstunde lang ihre Hände wäscht und die Befleckung des Blutes nicht beseitigen kann. »Alle Wohlgerüche Arabiens machen nicht süßduftend diese kleine Hand.« (Akt V, Szene 1.) So erfüllt sich an ihr, was er in seiner Gewissensangst gefürchtet; sie wird die Reue nach der Tat, er wird der Trotz, sie erschöpfen miteinander die Möglichkeiten der Reaktion auf das Verbrechen, wie zwei uneinige Anteile einer einzigen psychischen Individualität und vielleicht Nachbilder eines einzigen Vorbildes.
Haben wir an der Gestalt der Lady Macbeth die Frage nicht beantworten können, warum sie nach dem Erfolge als Kranke zusammenbricht, so winkt uns vielleicht eine bessere Aussicht bei der Schöpfung eines anderen großen Dramatikers, der die Aufgabe der psychologischen Rechenschaft mit unnachsichtiger Strenge zu verfolgen liebt.
Rebekka Gamvik, die Tochter einer Hebamme, ist von ihrem Adoptivvater Doktor West zur Freidenkerin und Verächterin jener Fesseln erzogen worden, welche eine auf religiösem Glauben gegründete Sittlichkeit den Lebenswünschen anlegen möchte. Nach dem Tode des Doktors verschafft sie sich Aufnahme in Rosmersholm, dem Stammsitze eines alten Geschlechtes, dessen Mitglieder das Lachen nicht kennen und die Freude einer starren Pflichterfüllung geopfert haben. Auf Rosmersholm hausen der Pastor Johannes Rosmer und seine kränkliche, kinderlose Gattin Beate. »Von wildem, unbezwinglichem Gelüst« nach der Liebe des adeligen Mannes ergriffen, beschließt Rebekka, die Frau, die ihr im Wege steht, wegzuräumen, und bedient sich dabei ihres »mutigen, freigeborenen«, durch keine Rücksichten gehemmten Willens. Sie spielt ihr ein ärztliches Buch in die Hand, in dem die Kindererzeugung als der Zweck der Ehe hingestellt wird, so daß die Arme an der Berechtigung ihrer Ehe irrewird, sie läßt sie erraten, daß Rosmer, dessen Lektüre und Gedankengänge sie teilt, im Begriffe ist, sich vom alten Glauben loszumachen und die Partei der Aufklärung zu nehmen, und nachdem sie so das Vertrauen der Frau in die sittliche Verläßlichkeit ihres Mannes erschüttert hat, gibt sie ihr endlich zu verstehen, daß sie selbst, Rebekka, bald das Haus verlassen wird, um die Folgen eines unerlaubten Verkehrs mit Rosmer zu verheimlichen. Der verbrecherische Plan gelingt. Die arme Frau, die für schwermütig und unzurechnungsfähig gegolten hat, stürzt sich vom Mühlensteg herab ins Wasser, im Gefühle des eigenen Unwertes und um dem Glücke des geliebten Mannes nicht im Wege zu sein.
Seit Jahr und Tag leben nun Rebekka und Rosmer allein auf Rosmersholm in einem Verhältnis, welches er für eine rein geistige und ideelle Freundschaft halten will. Als aber von außen her die ersten Schatten der Nachrede auf dieses Verhältnis fallen und gleichzeitig quälende Zweifel in Rosmer rege gemacht werden, aus welchen Motiven seine Frau in den Tod gegangen ist, bittet er Rebekka, seine zweite Frau zu werden, um der traurigen Vergangenheit eine neue lebendige Wirklichkeit entgegenstellen zu können. (Akt II.) Sie jubelt bei diesem Antrage einen Augenblick lang auf, aber schon im nächsten erklärt sie, es sei unmöglich, und wenn er weiter in sie dringe, werde sie »den Weg gehen, den Beate gegangen ist«. Verständnislos nimmt Rosmer die Abweisung entgegen; noch unverständlicher aber ist sie für uns, die wir mehr von Rebekkas Tun und Absichten wissen. Wir dürfen bloß nicht daran zweifeln, daß ihr Nein ernst gemeint ist.
Wie konnte es kommen, daß die Abenteurerin mit dem mutigen, freigeborenen Willen, die sich ohne jede Rücksicht den Weg zur Verwirklichung ihrer Wünsche gebahnt, nun nicht zugreifen will, da ihr angeboten wird, die Frucht des Erfolges zu pflücken? Sie gibt uns selbst die Aufklärung im vierten Akt: »Das ist doch eben das Furchtbare, jetzt, da alles Glück der Welt mir mit vollen Händen geboten wird –; jetzt bin ich eine solche geworden, daß meine eigene Vergangenheit mir den Weg zum Glück versperrt.« Sie ist also eine andere geworden unterdes, ihr Gewissen ist erwacht, sie hat ein Schuldbewußtsein bekommen, welches ihr den Genuß versagt.
Und wodurch wurde ihr Gewissen geweckt? Hören wir sie selbst und überlegen wir dann, ob wir ihr voll Glauben schenken dürfen: »Es ist die Lebensanschauung des Hauses Rosmer –; oder wenigstens deine Lebensanschauung –;, die meinen Willen angesteckt hat ... Und ihn krank gemacht hat. Ihn geknechtet hat mit Gesetzen, die früher für mich nicht gegolten haben. Das Zusammenleben mit dir –; du, das hat meinen Sinn geadelt.«
Dieser Einfluß, ist hinzuzunehmen, hat sich erst geltend gemacht, als sie mit Rosmer allein zusammenleben durfte: »–; in Stille –; in Einsamkeit –; als du mir deine Gedanken alle ohne Vorbehalt gabst –; eine jegliche Stimmung, so weich und so fein wie du sie fühltest –;, da trat die große Umwandlung ein.«
Kurz vorher hatte sie die andere Seite dieser Wandlung beklagt: »Weil Rosmersholm mir die Kraft genommen hat, hier ist mein mutiger Wille gelähmt worden. Und verschandelt! Für mich ist die Zeit vorbei, da ich alles und jedes wagen durfte. Ich habe die Energie zum Handeln verloren, Rosmer.«
Diese Erklärung gibt Rebekka, nachdem sie sich durch ein freiwilliges Geständnis vor Rosmer und dem Rektor Kroll, dem Bruder der von ihr beseitigten Frau, als Verbrecherin bloßgestellt hat. Ibsen hat durch kleine Züge von meisterhafter Feinheit festgelegt, daß diese Rebekka nicht lügt, aber auch nie ganz aufrichtig ist. Wie sie trotz aller Freiheit von Vorurteilen ihr Alter um ein Jahr herabgesetzt hat, so ist auch ihr Geständnis vor den beiden Männern unvollständig und wird durch das Drängen Krolls in einigen wesentlichen Punkten ergänzt. Auch uns bleibt die Freiheit anzunehmen, daß die Aufklärung ihres Verzichts das eine nur preisgibt, um ein anderes zu verschweigen.
Gewiß, wir haben keinen Grund, ihrer Aussage zu mißtrauen, daß die Luft auf Rosmersholm, ihr Umgang mit dem edlen Rosmer, veredelnd und –; lähmend auf sie gewirkt hat. Sie sagt damit, was sie weiß und empfunden hat. Aber es brauchte nicht alles zu sein, was in ihr vorgegangen ist; auch ist es nicht notwendig, daß sie sich über alles Rechenschaft geben konnte. Der Einfluß Rosmers konnte auch nur ein Deckmantel sein, hinter dem sich eine andere Wirkung verbirgt, und nach dieser anderen Richtung weist ein bemerkenswerter Zug.
Noch nach ihrem Geständnis, in der letzten Unterredung, die das Stück beendet, bittet sie Rosmer nochmals, seine Frau zu werden. Er verzeiht ihr, was sie aus Liebe zu ihm verbrochen hat. Und nun antwortet sie nicht, was sie sollte, daß keine Verzeihung ihr das Schuldgefühl nehmen könne, das sie durch den tückischen Betrug an der armen Beate erworben, sondern sie belastet sich mit einem anderen Vorwurf, der uns bei der Freidenkerin fremdartig berühren muß, keinesfalls die Stelle verdient, an die er von Rebekka gesetzt wird: »Ach, mein Freund –; komm nie wieder darauf! Es ist ein Ding der Unmöglichkeit –;! Denn du mußt wissen, Rosmer, ich habe eine Vergangenheit.« Sie will natürlich andeuten, daß sie sexuelle Beziehungen zu einem anderen Manne gehabt hat, und wir wollen uns merken, daß ihr diese Beziehungen zu einer Zeit, da sie frei und niemandem verantwortlich war, ein stärkeres Hindernis der Vereinigung mit Rosmer dünken als ihr wirklich verbrecherisches Benehmen gegen seine Frau.
Rosmer lehnt es ab, von dieser Vergangenheit zu hören. Wir können sie erraten, obwohl alles, was dahin weist, im Stücke sozusagen unterirdisch bleibt und aus Andeutungen erschlossen werden muß. Aus Andeutungen freilich, die mit solcher Kunst eingefügt sind, daß ein Mißverständnis derselben unmöglich wird.
Zwischen Rebekkas erster Ablehnung und ihrem Geständnis geht etwas vor, was von entscheidender Bedeutung für ihr weiteres Schicksal ist. Der Rektor Kroll besucht sie, um sie durch die Mitteilung zu demütigen, er wisse, daß sie ein illegitimes Kind sei, die Tochter eben jenes Doktors West, der sie nach dem Tode ihrer Mutter adoptiert hat. Der Haß hat seinen Spürsinn geschärft, aber er meint nicht, ihr damit etwas Neues zu sagen. »In der Tat, ich meinte, Sie wüßten ganz genau Bescheid. Es wäre doch sonst recht merkwürdig gewesen, daß Sie sich von Dr. West adoptieren ließen –;.« »Und da nimmt er Sie zu sich –; gleich nach dem Tode Ihrer Mutter. Er behandelt Sie hart. Und doch bleiben Sie bei ihm. Sie wissen, daß er Ihnen nicht einen Pfennig hinterlassen wird. Sie haben ja auch nur eine Kiste Bücher bekommen. Und doch halten Sie bei ihm aus. Ertragen seine Launen. Pflegen ihn bis zum letzten Augenblick.« –; »Was Sie für ihn getan haben, das leite ich aus dem natürlichen Instinkt der Tochter her. Ihr ganzes übriges Auftreten halte ich für ein natürliches Ergebnis Ihrer Herkunft.«
Aber Kroll war im Irrtum. Rebekka hatte nichts davon gewußt, daß sie die Tochter des Dr. West sein sollte. Als Kroll mit dunklen Anspielungen auf ihre Vergangenheit begann, mußte sie annehmen, er meine etwas anderes. Nachdem sie begriffen hat, worauf er sich bezieht, kann sie noch eine Weile ihre Fassung bewahren, denn sie darf glauben, daß ihr Feind seiner Berechnung jenes Alter zugrunde gelegt hat, das sie ihm bei einem früheren Besuche fälschlich angegeben. Aber nachdem Kroll diese Einwendung siegreich zurückgewiesen: »Mag sein. Aber die Rechnung mag dennoch richtig sein, denn ein Jahr, ehe er angestellt wurde, ist West dort oben vorübergehend zu Besuch gewesen«, nach dieser neuen Mitteilung verliert sie jeden Halt. »Das ist nicht wahr.« –; Sie geht umher und ringt die Hände: »Es ist unmöglich. Sie wollen mir das bloß einreden. Das kann ja nun und nimmermehr wahr sein. Kann nicht wahr sein! Nun und nimmermehr –;!« Ihre Ergriffenheit ist so arg, daß Kroll sie nicht auf seine Mitteilung zurückzuführen vermag.
Kroll: »Aber, meine Liebe –; warum um Gottes willen, werden Sie denn so heftig? Sie machen mir geradezu Angst? Was soll ich glauben und denken –;!«
Rebekka: »Nichts. Sie sollen weder etwas glauben noch etwas denken.« Kroll: »Dann müßten Sie mir aber wirklich erklären, warum Sie sich diese Sache –; diese Möglichkeit so zu Herzen nehmen.«
Rebekka (faßt sich wieder): »Das ist doch sehr einfach, Herr Rektor. Ich habe doch keine Lust, für ein uneheliches Kind zu gelten.«
Das Rätsel im Benehmen Rebekkas läßt nur eine Lösung zu. Die Mitteilung, daß Dr. West ihr Vater sein kann, ist der schwerste Schlag, der sie betreffen konnte, denn sie war nicht nur die Adoptivtochter, sondern auch die Geliebte dieses Mannes. Als Kroll seine Reden begann, meinte sie, er wolle auf diese Beziehungen anspielen, die sie wahrscheinlich unter Berufung auf ihre Freiheit einbekannt hätte. Aber das lag dem Rektor ferne; er wußte nichts von dem Liebesverhältnis mit Dr. West, wie sie nichts von dessen Vaterschaft. Nichts anderes als dieses Liebesverhältnis kann sie im Sinne haben, wenn sie bei der letzten Weigerung gegen Rosmer vorschützt, sie habe eine Vergangenheit, die sie unwürdig mache, seine Frau zu werden. Wahrscheinlich hätte sie Rosmer, wenn er gewollt hätte, auch nur die eine Hälfte ihres Geheimnisses mitgeteilt und den schwereren Anteil desselben verschwiegen.
Aber nun verstehen wir freilich, daß diese Vergangenheit ihr als das schwerere Hindernis der Eheschließung erscheint, als das schwerere –; Verbrechen.
Nachdem sie erfahren hat, daß sie die Geliebte ihres eigenen Vaters gewesen ist, unterwirft sie sich ihrem jetzt übermächtig hervorbrechenden Schuldgefühl. Sie legt vor Rosmer und Kroll das Geständnis ab, durch das sie sich zur Mörderin stempelt, verzichtet endgültig auf das Glück, zu dem sie sich durch Verbrechen den Weg gebahnt hatte, und rüstet zur Abreise. Aber das eigentliche Motiv ihres Schuldbewußtseins, welches sie am Erfolge scheitern läßt, bleibt geheim. Wir haben gesehen, es ist noch etwas ganz anderes als die Atmosphäre von Rosmersholm und der sittigende Einfluß Rosmers.
Wer uns so weit gefolgt ist, wird jetzt nicht versäumen, einen Einwand vorzubringen, der dann manchen Zweifel rechtfertigen kann. Die erste Abweisung Rosmers durch Rebekka erfolgt ja vor dem zweiten Besuch Krolls, also vor seiner Aufdeckung ihrer unehelichen Geburt, und zu einer Zeit, da sie um ihren Inzest noch nicht weiß –; wenn wir den Dichter richtig verstanden haben. Doch ist diese Abweisung energisch und ernst gemeint. Das Schuldbewußtsein, das sie auf den Gewinn aus ihren Taten verzichten heißt, ist also schon vor ihrer Kenntnis um ihr Kapitalverbrechen wirksam, und wenn wir so viel zugeben, dann ist der Inzest als Quelle des Schuldbewußtseins vielleicht überhaupt zu streichen.
Wir haben bisher Rebekka West behandelt, als wäre sie eine lebende Person und nicht eine Schöpfung der von dem kritischesten Verstand geleiteten Phantasie des Dichters Ibsen. Wir dürfen versuchen, bei der Erledigung dieses Einwandes denselben Standpunkt festzuhalten. Der Einwand ist gut, ein Stück Gewissen war auch vor der Kenntnis des Inzests bei Rebekka erwacht. Es steht nichts im Wege, für diese Wandlung den Einfluß verantwortlich zu machen, den Rebekka selbst anerkennt und anklagt. Aber damit kommen wir von der Anerkennung des zweiten Motivs nicht frei. Das Benehmen Rebekkas bei der Mitteilung des Rektors, ihre unmittelbar darauffolgende Reaktion durch das Geständnis lassen keinen Zweifel daran, daß erst jetzt das stärkere und das entscheidende Motiv des Verzichts in Wirkung tritt. Es liegt eben ein Fall von mehrfacher Motivierung vor, bei dem hinter dem oberflächlicheren Motiv ein tieferes zum Vorschein kommt. Gebote der poetischen Ökonomie hießen den Fall so gestalten, denn dies tiefere Motiv sollte nicht laut erörtert werden, es mußte gedeckt bleiben, der bequemen Wahrnehmung des Zuhörers im Theater oder des Lesers entzogen, sonst hätten sich bei diesem schwere Widerstände erhoben, auf die peinlichsten Gefühle begründet, welche die Wirkung des Schauspiels in Frage stellen könnten.
Mit Recht dürfen wir aber verlangen, daß das vorgeschobene Motiv nicht ohne inneren Zusammenhang mit dem von ihm gedeckten sei, sondern sich als eine Milderung und Ableitung aus dem letzteren erweise. Und wenn wir dem Dichter zutrauen dürfen, daß seine bewußte poetische Kombination folgerichtig aus unbewußten Voraussetzungen hervorgegangen ist, so können wir auch den Versuch machen zu zeigen, daß er diese Forderung erfüllt hat. Rebekkas Schuldbewußtsein entspringt aus der Quelle des Inzestvorwurfs, noch ehe der Rektor ihr diesen mit analytischer Schärfe zum Bewußtsein gebracht hat. Wenn wir ausführend und ergänzend ihre vom Dichter angedeutete Vergangenheit rekonstruieren, so werden wir sagen, sie kann nicht ohne Ahnung der intimen Beziehung zwischen ihrer Mutter und dem Doktor West gewesen sein. Es muß ihr einen großen Eindruck gemacht haben, als sie die Nachfolgerin der Mutter bei diesem Manne wurde, und sie stand unter der Herrschaft des Ödipus-Komplexes, auch wenn sie nicht wußte, daß diese allgemeine Phantasie in ihrem Falle zur Wirklichkeit geworden war. Als sie nach Rosmersholm kam, trieb sie die innere Gewalt jenes ersten Erlebnisses dazu an, durch tatkräftiges Handeln dieselbe Situation herbeizuführen, die sich das erstemal ohne ihr Dazutun verwirklicht hatte, die Frau und Mutter zu beseitigen, um beim Manne und Vater ihre Stelle einzunehmen. Sie schildert mit überzeugender Eindringlichkeit, wie sie gegen ihren Willen genötigt wurde, Schritt um Schritt zur Beseitigung Beatens zu tun.
»Aber glaubt Ihr denn, ich ging und handelte mit kühler Überlegung! Damals war ich doch nicht, was ich heute bin, wo ich vor Euch stehe und erzähle. Und dann gibt es doch auch, sollte ich meinen, zwei Arten Willen in einem Menschen. Ich wollte Beate weg haben! Auf irgendeine Art. Aber ich glaubte doch nicht, es würde jemals dahin kommen. Bei jedem Schritt, den es mich reizte, vorwärts zu wagen, war es mir, als schrie etwas in mir: Nun nicht weiter! Keinen Schritt mehr! –; Und doch konnte ich es nicht lassen. Ich mußte noch ein winziges Spürchen weiter. Und noch ein einziges Spürchen. Und dann noch eins –; und immer noch eins –;. Und so ist es geschehen. Auf diese Weise geht so etwas vor sich.«
Das ist nicht Beschönigung, sondern wahrhafte Rechenschaft. Alles, was auf Rosmersholm mit ihr vorging, die Verliebtheit in Rosmer und die Feindseligkeit gegen seine Frau, war bereits Erfolg des Ödipus-Komplexes, erzwungene Nachbildung ihres Verhältnisses zu ihrer Mutter und zu Dr. West.
Und darum ist das Schuldgefühl, das sie zuerst die Werbung Rosmers abweisen läßt, im Grunde nicht verschieden von jenem größeren, das sie nach der Mitteilung Krolls zum Geständnis zwingt. Wie sie aber unter dem Einfluß des Dr. West zur Freidenkerin und Verächterin der religiösen Moral geworden war, so wandelte sie sich durch die neue Liebe zu Rosmer zum Gewissens- und Adelsmenschen. Soviel verstand sie selbst von ihren inneren Vorgängen, und darum durfte sie mit Recht den Einfluß Rosmers als das ihr zugänglich gewordene Motiv ihrer Änderung bezeichnen.
Der psychoanalytisch arbeitende Arzt weiß, wie häufig oder wie regelmäßig das Mädchen, welches als Dienerin, Gesellschafterin, Erzieherin in ein Haus eintritt, dort bewußt oder unbewußt am Tagtraum spinnt, dessen Inhalt dem Ödipus-Komplex entnommen ist, daß die Frau des Hauses irgendwie wegfallen und der Herr an deren Stelle sie zur Frau nehmen wird. Rosmersholm ist das höchste Kunstwerk der Gattung, welche diese alltägliche Phantasie der Mädchen behandelt. Es wird eine tragische Dichtung durch den Zusatz, daß dem Tagtraum der Heldin die ganz entsprechende Wirklichkeit in ihrer Vorgeschichte vorausgegangen ist [Fußnote]Der Nachweis des Inzestthemas in Rosmersholm ist bereits mit denselben Mitteln wie hier in dem überaus reichhaltigen Werke von O. Rank, Das Inzestmotiv in Dichtung und Sage, 1912, erbracht worden..
Nach langem Aufenthalte bei der Dichtung kehren wir nun zur ärztlichen Erfahrung zurück. Aber nur, um mit wenigen Worten die volle Übereinstimmung beider festzustellen. Die psychoanalytische Arbeit lehrt, daß die Gewissenskräfte, welche am Erfolg erkranken lassen anstatt wie sonst an der Versagung, in intimer Weise mit dem Ödipus-Komplex zusammenhängen, mit dem Verhältnis zu Vater und Mutter, wie vielleicht unser Schuldbewußtsein überhaupt.
III. Die Verbrecher aus Schuldbewußtsein
In den Mitteilungen über ihre Jugend, besonders über die Jahre der Vorpubertät, haben mir oft später sehr anständige Personen von unerlaubten Handlungen berichtet, die sie sich damals hatten zuschulden kommen lassen, von Diebstählen, Betrügereien und selbst Brandstiftungen. Ich pflegte über diese Angaben mit der Auskunft hinwegzugehen, daß die Schwäche der moralischen Hemmungen in dieser Lebenszeit bekannt sei, und versuchte nicht, sie in einen bedeutsameren Zusammenhang einzureihen. Aber endlich wurde ich durch grelle und günstigere Fälle, bei denen solche Vergehen begangen wurden, während die Kranken sich in meiner Behandlung befanden, und wo es sich um Personen jenseits jener jungen Jahre handelte, zum gründlicheren Studium solcher Vorfälle aufgefordert. Die analytische Arbeit brachte dann das überraschende Ergebnis, daß solche Taten vor allem darum vollzogen wurden, weil sie verboten und weil mit ihrer Ausführung eine seelische Erleichterung für den Täter verbunden war. Er litt an einem drückenden Schuldbewußtsein unbekannter Herkunft, und nachdem er ein Vergehen begangen hatte, war der Druck gemildert. Das Schuldbewußtsein war wenigstens irgendwie untergebracht.
So paradox es klingen mag, ich muß behaupten, daß das Schuldbewußtsein früher da war als das Vergehen, daß es nicht aus diesem hervorging, sondern umgekehrt das Vergehen aus dem Schuldbewußtsein. Diese Personen durfte man mit gutem Recht als Verbrecher aus Schuldbewußtsein bezeichnen. Die Präexistenz des Schuldgefühls hatte sich natürlich durch eine ganze Reihe von anderen Äußerungen und Wirkungen nachweisen lassen.
Die Feststellung eines Kuriosums setzt der wissenschaftlichen Arbeit aber kein Ziel. Es sind zwei weitere Fragen zu beantworten, woher das dunkle Schuldgefühl vor der Tat stammt und ob es wahrscheinlich ist, daß eine solche Art der Verursachung an den Verbrechen der Menschen einen größeren Anteil hat.
Die Verfolgung der ersten Frage versprach eine Auskunft über die Quelle des menschlichen Schuldgefühls überhaupt. Das regelmäßige Ergebnis der analytischen Arbeit lautete, daß dieses dunkle Schuldgefühl aus dem Ödipus-Komplex stamme, eine Reaktion sei auf die beiden großen verbrecherischen Absichten, den Vater zu töten und mit der Mutter sexuell zu verkehren. Im Vergleich mit diesen beiden waren allerdings die zur Fixierung des Schuldgefühls begangenen Verbrechen Erleichterungen für den Gequälten. Man muß sich hier daran erinnern, daß Vatermord und Mutterinzest die beiden großen Verbrechen der Menschen sind, die einzigen, die in primitiven Gesellschaften als solche verfolgt und verabscheut werden. Auch daran, wie nahe wir durch andere Untersuchungen der Annahme gekommen sind, daß die Menschheit ihr Gewissen, das nun als vererbte Seelenmacht auftritt, am Ödipus-Komplex erworben hat.
Die Beantwortung der zweiten Frage geht über die psychoanalytische Arbeit hinaus. Bei Kindern kann man ohneweiters beobachten, daß sie »schlimm« werden, um Strafe zu provozieren, und nach der Bestrafung beruhigt und zufrieden sind. Eine spätere analytische Untersuchung führt oft auf die Spur des Schuldgefühls, welches sie die Strafe suchen hieß. Von den erwachsenen Verbrechern muß man wohl alle die abziehen, die ohne Schuldgefühl Verbrechen begehen, die entweder keine moralischen Hemmungen entwickelt haben oder sich im Kampf mit der Gesellschaft zu ihrem Tun berechtigt glauben. Aber bei der Mehrzahl der anderen Verbrecher, bei denen, für die die Strafsatzungen eigentlich gemacht sind, könnte eine solche Motivierung des Verbrechens sehr wohl in Betracht kommen, manche dunkle Punkte in der Psychologie des Verbrechers erhellen und der Strafe eine neue psychologische Fundierung geben.
Ein Freund hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, daß der »Verbrecher aus Schuldgefühl« auch Nietzsche bekannt war. Die Präexistenz des Schuldgefühls und die Verwendung der Tat zur Rationalisierung desselben schimmern uns aus den Reden Zarathustras »Über den bleichen Verbrecher« entgegen. Überlassen wir es zukünftiger Forschung zu entscheiden, wieviele von den Verbrechern zu diesen »bleichen« zu rechnen sind.
Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds (1925)
Meine und meiner Schüler Arbeiten vertreten mit stetig wachsender Entschiedenheit die Forderung, daß die Analyse der Neurotiker auch die erste Kindheitsperiode, die Zeit der Frühblüte des Sexuallebens, durchdringen müsse. Nur wenn man die ersten Äußerungen der mitgebrachten Triebkonstitution und die Wirkungen der frühesten Lebenseindrücke erforscht, kann man die Triebkräfte der späteren Neurose richtig erkennen und ist gesichert gegen die Irrtümer, zu denen man durch die Umbildungen und Überlagerungen der Reifezeit verlockt würde. Diese Forderung ist nicht nur theoretisch bedeutsam, sie hat auch praktische Wichtigkeit, denn sie scheidet unsere Bemühungen von der Arbeit solcher Ärzte, die, nur therapeutisch orientiert, sich eine Strecke weit analytischer Methoden bedienen. Solch eine Frühzeitanalyse ist langwierig, mühselig und stellt Ansprüche an Arzt und Patient, deren Erfüllung die Praxis nicht immer entgegenkommt. Sie führt ferner in Dunkelheiten, durch welche uns noch immer die Wegweiser fehlen. Ja, ich meine, man darf den Analytikern die Versicherung geben, daß ihrer wissenschaftlichen Arbeit die Gefahr, mechanisiert und damit uninteressant zu werden, auch für die nächsten Jahrzehnte nicht droht.
Im folgenden teile ich ein Ergebnis der analytischen Forschung mit, das sehr wichtig wäre, wenn es sich als allgemein gültig erweisen ließe. Warum schiebe ich die Veröffentlichung nicht auf, bis mir eine reichere Erfahrung diesen Nachweis, wenn er zu erbringen ist, geliefert hat? Weil in meinen Arbeitsbedingungen eine Veränderung eingetreten ist, deren Folgen ich nicht verleugnen kann. Früher einmal gehörte ich nicht zu denen, die eine vermeintliche Neuheit nicht eine Weile bei sich behalten können, bis sie Bekräftigung oder Berichtigung gefunden hat. Die Traumdeutung und das ›Bruchstück einer Hysterie-Analyse‹ (der Fall Dora) sind, wenn nicht durch neun Jahre nach dem Horazischen Rezept, so doch durch vier bis fünf Jahre von mir unterdrückt worden, ehe ich sie der Öffentlichkeit preisgab. Aber damals dehnte sich die Zeit unabsehbar vor mir aus –; oceans of time, wie ein liebenswürdiger Dichter sagt –;, und das Material strömte mir so reichlich zu, daß ich mich der Erfahrungen kaum erwehren konnte. Auch war ich der einzige Arbeiter auf einem neuen Gebiet, meine Zurückhaltung brachte mir keine Gefahr und anderen keinen Schaden.
Das ist nun alles anders geworden. Die Zeit vor mir ist begrenzt, sie wird nicht mehr vollständig von der Arbeit ausgenützt; die Gelegenheiten, neue Erfahrungen zu machen, kommen also nicht so reichlich. Wenn ich etwas Neues zu sehen glaube, bleibt es mir unsicher, ob ich die Bestätigung abwarten kann. Auch ist alles bereits abgeschöpft, was an der Oberfläche dahintrieb; das übrige muß in langsamer Bemühung aus der Tiefe geholt werden. Endlich bin ich nicht mehr allein, eine Schar von eifrigen Mitarbeitern ist bereit, sich auch das Unfertige, unsicher Erkannte zunutze zu machen, ich darf ihnen den Anteil der Arbeit überlassen, den ich sonst selbst besorgt hätte. So fühle ich mich gerechtfertigt, diesmal etwas mitzuteilen, was dringend der Nachprüfung bedarf, ehe es in seinem Wert oder Unwert erkannt werden kann.
Wenn wir die ersten psychischen Gestaltungen des Sexuallebens beim Kinde untersuchten, nahmen wir regelmäßig das männliche Kind, den kleinen Knaben, zum Objekt. Beim kleinen Mädchen, meinten wir, müsse es ähnlich zugehen, aber doch in irgendeiner Weise anders. An welcher Stelle des Entwicklungsganges diese Verschiedenheit zu finden ist, das wollte sich nicht klar ergeben.
Die Situation des Ödipuskomplexes ist die erste Station, die wir beim Knaben mit Sicherheit erkennen. Sie ist uns leicht verständlich, weil in ihr das Kind an demselben Objekt festhält, das es bereits in der vorhergehenden Säuglings- und Pflegeperiode mit seiner noch nicht genitalen Libido besetzt hatte. Auch daß es dabei den Vater als störenden Rivalen empfindet, den es beseitigen und ersetzen möchte, leitet sich glatt aus den realen Verhältnissen ab. Daß die Ödipus-Einstellung des Knaben der phallischen Phase angehört und an der Kastrationsangst, also am narzißtischen Interesse für das Genitale, zugrunde geht, habe ich an anderer Stelle [Fußnote]›Der Untergang des Ödipuskomplexes‹. ausgeführt. Eine Erschwerung des Verständnisses ergibt sich aus der Komplikation, daß der Ödipuskomplex selbst beim Knaben doppelsinnig angelegt ist, aktiv und passiv, der bisexuellen Anlage entsprechend. Der Knabe will auch als Liebesobjekt des Vaters die Mutter ersetzen, was wir als feminine Einstellung bezeichnen.
An der Vorgeschichte des Ödipuskomplexes beim Knaben ist uns noch lange nicht alles klar. Wir kennen aus ihr eine Identifizierung mit dem Vater zärtlicher Natur, welcher der Sinn der Rivalität bei der Mutter noch abgeht. Ein anderes Element dieser Vorzeit ist die, wie ich meine, nie ausbleibende masturbatorische Betätigung am Genitale, die frühkindliche Onanie, deren mehr oder minder gewalttätige Unterdrückung von seiten der Pflegepersonen den Kastrationskomplex aktiviert. Wir nehmen an, daß diese Onanie am Ödipuskomplex hängt und die Abfuhr seiner Sexualerregung bedeutet. Ob sie von Anfang an diese Beziehung hat oder nicht vielmehr spontan als Organbetätigung auftritt und erst später den Anschluß an den Ödipuskomplex gewinnt, ist unsicher; die letztere Möglichkeit ist die weitaus wahrscheinlichere. Fraglich ist auch noch die Rolle des Bettnässens und seiner Abgewöhnung durch die Eingriffe der Erziehung. Wir bevorzugen die einfache Synthese, das fortgesetzte Bettnässen sei der Erfolg der Onanie, seine Unterdrückung werde vom Knaben wie eine Hemmung der Genitaltätigkeit, also im Sinne einer Kastrationsdrohung gewertet, aber ob wir damit jedesmal recht haben, steht dahin. Endlich läßt uns die Analyse schattenhaft erkennen, wie eine Belauschung des elterlichen Koitus in sehr früher Kinderzeit die erste sexuelle Erregung setzen und durch ihre nachträglichen Wirkungen der Ausgangspunkt für die ganze Sexualentwicklung werden kann. Die Onanie sowie die beiden Einstellungen des Ödipuskomplexes knüpfen späterhin an den in der Folge gedeuteten Eindruck an. Allein wir können nicht annehmen, daß solche Koitusbeobachtungen ein regelmäßiges Vorkommnis sind, und stoßen hier mit dem Problem der »Urphantasien« zusammen. So vieles ist also auch in der Vorgeschichte des Ödipuskomplexes beim Knaben noch ungeklärt, harrt der Sichtung und der Entscheidung, ob immer der nämliche Hergang anzunehmen ist oder ob nicht sehr verschiedenartige Vorstadien zum Treffpunkt der gleichen Endsituation führen.
Der Ödipuskomplex des kleinen Mädchens birgt ein Problem mehr als der des Knaben. Die Mutter war anfänglich beiden das erste Objekt, wir haben uns nicht zu verwundern, wenn der Knabe es für den Ödipuskomplex beibehält. Aber wie kommt das Mädchen dazu, es aufzugeben und dafür den Vater zum Objekt zu nehmen? In der Verfolgung dieser Frage habe ich einige Feststellungen machen können, die gerade auf die Vorgeschichte der Ödipus-Relation beim Mädchen Licht werfen können.
Jeder Analytiker hat die Frauen kennengelernt, die mit besonderer Intensität und Zähigkeit an ihrer Vaterbindung festhalten und an dem Wunsch, vom Vater ein Kind zu bekommen, in dem diese gipfelt. Man hat guten Grund anzunehmen, daß diese Wunschphantasie auch die Triebkraft ihrer infantilen Onanie war, und gewinnt leicht den Eindruck, hier vor einer elementaren, nicht weiter auflösbaren Tatsache des kindlichen Sexuallebens zu stehen. Eingehende Analyse gerade dieser Fälle zeigt aber etwas anderes, nämlich daß der Ödipuskomplex hier eine lange Vorgeschichte hat und eine gewissermaßen sekundäre Bildung ist.
Nach einer Bemerkung des alten Kinderarztes Lindner [Fußnote]Siehe: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. entdeckt das Kind die lustspendende Genitalzone –; Penis oder Klitoris –; während des Wonnesaugens (Lutschens). Ich will es dahingestellt sein lassen, ob das Kind diese neugewonnene Lustquelle wirklich zum Ersatz für die kürzlich verlorene Brustwarze der Mutter nimmt, worauf spätere Phantasien ( fellatio) deuten mögen. Kurz, die Genitalzone wird irgendeinmal entdeckt, und es scheint unberechtigt, den ersten Betätigungen an ihr einen psychischen Inhalt unterzulegen. Der nächste Schritt in der so beginnenden phallischen Phase ist aber nicht die Verknüpfung dieser Onanie mit den Objektbesetzungen des Ödipuskomplexes, sondern eine folgenschwere Entdeckung, die dem kleinen Mädchen beschieden ist. Es bemerkt den auffällig sichtbaren, groß angelegten Penis eines Bruders oder Gespielen, erkennt ihn sofort als überlegenes Gegenstück seines eigenen, kleinen und versteckten Organs und ist von da an dem Penisneid verfallen.
Ein interessanter Gegensatz im Verhalten der beiden Geschlechter: Im analogen Falle, wenn der kleine Knabe die Genitalgegend des Mädchens zuerst erblickt, benimmt er sich unschlüssig, zunächst wenig interessiert; er sieht nichts, oder er verleugnet seine Wahrnehmung, schwächt sie ab, sucht nach Auskünften, um sie mit seiner Erwartung in Einklang zu bringen. Erst später, wenn eine Kastrationsdrohung auf ihn Einfluß gewonnen hat, wird diese Beobachtung für ihn bedeutungsvoll werden; ihre Erinnerung oder Erneuerung regt einen fürchterlichen Affektsturm in ihm an und unterwirft ihn dem Glauben an die Wirklichkeit der bisher verlachten Androhung. Zwei Reaktionen werden aus diesem Zusammentreffen hervorgehen, die sich fixieren können und dann jede einzeln oder beide vereint oder zusammen mit anderen Momenten sein Verhältnis zum Weib dauernd bestimmen werden: Abscheu vor dem verstümmelten Geschöpf oder triumphierende Geringschätzung desselben. Aber diese Entwicklungen gehören einer, wenn auch nicht weit entfernten Zukunft an.
Anders das kleine Mädchen. Sie ist im Nu fertig mit ihrem Urteil und ihrem Entschluß. Sie hat es gesehen, weiß, daß sie es nicht hat, und will es haben [Fußnote]Hier ist der Anlaß, eine Behauptung zu berichtigen, die ich vor Jahren aufgestellt habe. Ich meinte, das Sexualinteresse der Kinder werde nicht wie das der Heranreifenden durch den Geschlechtsunterschied geweckt, sondern entzünde sich an dem Problem, woher die Kinder kommen. Das trifft also wenigstens für das Mädchen gewiß nicht zu. Beim Knaben wird es wohl das eine Mal so, das andere Mal anders zugehen können, oder bei beiden Geschlechtern werden die zufälligen Anlässe des Lebens darüber entscheiden..
An dieser Stelle zweigt der sogenannte Männlichkeitskomplex des Weibes ab, welcher der vorgezeichneten Entwicklung zur Weiblichkeit eventuell große Schwierigkeiten bereiten wird, wenn es nicht gelingt, ihn bald zu überwinden. Die Hoffnung, doch noch einmal einen Penis zu bekommen und dadurch dem Manne gleich zu werden, kann sich bis in unwahrscheinlich späte Zeiten erhalten und zum Motiv für sonderbare, sonst unverständliche Handlungen werden. Oder es tritt der Vorgang ein, den ich als Verleugnung bezeichnen möchte, der im kindlichen Seelenleben weder selten noch sehr gefährlich zu sein scheint, der aber beim Erwachsenen eine Psychose einleiten würde. Das Mädchen verweigert es, die Tatsache ihrer Kastration anzunehmen, versteift sich in der Überzeugung, daß sie doch einen Penis besitzt, und ist gezwungen, sich in der Folge so zu benehmen, als ob sie ein Mann wäre.
Die psychischen Folgen des Penisneides, soweit er nicht in der Reaktionsbildung des Männlichkeitskomplexes aufgeht, sind vielfältige und weittragende. Mit der Anerkennung seiner narzißtischen Wunde stellt sich –; gleichsam als Narbe –; ein Minderwertigkeitsgefühl beim Weibe her. Nachdem es den ersten Versuch, seinen Penismangel als persönliche Strafe zu erklären, überwunden und die Allgemeinheit dieses Geschlechtscharakters erfaßt hat, beginnt es, die Geringschätzung des Mannes für das in einem entscheidenden Punkt verkürzte Geschlecht zu teilen, und hält wenigstens in diesem Urteil an der eigenen Gleichstellung mit dem Manne fest [Fußnote]Ich habe schon in meiner ersten kritischen Äußerung ›Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung‹ (1914 d) erkannt, daß dies der Wahrheitskern der Adlerschen Lehre ist, die kein Bedenken trägt, die ganze Welt aus diesem einen Punkte (Organminderwertigkeit –; männlicher Protest –; Abrücken von der weiblichen Linie) zu erklären, und sich dabei rühmt, die Sexualität zugunsten des Machtstrebens ihrer Bedeutung beraubt zu haben! Das einzige »minderwertige« Organ, das ohne Zweideutigkeit diesen Namen verdient, wäre also die Klitoris. Anderseits hört man, daß Analytiker sich rühmen, trotz jahrzehntelanger Bemühung nichts von der Existenz eines Kastrationskomplexes wahrgenommen zu haben. Man muß sich vor der Größe dieser Leistung in Bewunderung beugen, wenn es auch nur eine negative Leistung, ein Kunststück im Übersehen und Verkennen ist. Die beiden Lehren ergeben ein interessantes Gegensatzpaar: Hier keine Spur von einem Kastrationskomplex, dort nichts anderes als Folgen desselben..
Auch wenn der Penisneid auf sein eigentliches Objekt verzichtet hat, hört er nicht auf zu existieren, er lebt in der Charaktereigenschaft der Eifersucht mit leichter Verschiebung fort. Gewiß ist die Eifersucht nicht allein einem Geschlecht eigen und begründet sich auf einer breiteren Basis, aber ich meine, daß sie doch im Seelenleben des Weibes eine weitaus größere Rolle spielt, weil sie aus der Quelle des abgelenkten Penisneides eine ungeheure Verstärkung bezieht. Ehe ich noch diese Ableitung der Eifersucht kannte, hatte ich für die bei Mädchen so häufige Onaniephantasie »Ein Kind wird geschlagen« eine erste Phase konstruiert, in der sie die Bedeutung hat, ein anderes Kind, auf das man als Rivalen eifersüchtig ist, soll geschlagen werden [Fußnote]›»Ein Kind wird geschlagen«‹.. Diese Phantasie scheint ein Relikt aus der phallischen Periode der Mädchen; die eigentümliche Starrheit, die mir an der monotonen Formel: Ein Kind wird geschlagen, auffiel, läßt wahrscheinlich noch eine besondere Deutung zu. Das Kind, das da geschlagen –; geliebkost wird, mag im Grunde nichts anderes sein als die Klitoris selbst, so daß die Aussage zu allertiefst das Eingeständnis der Masturbation enthält, die sich vom Anfang in der phallischen Phase bis in späte Zeiten an den Inhalt der Formel knüpft.
Eine dritte Abfolge des Penisneides scheint die Lockerung des zärtlichen Verhältnisses zum Mutterobjekt. Man versteht den Zusammenhang nicht sehr gut, überzeugt sich aber, daß am Ende fast immer die Mutter für den Penismangel verantwortlich gemacht wird, die das Kind mit so ungenügender Ausrüstung in die Welt geschickt hat. Der historische Hergang ist oft der, daß bald nach der Entdeckung der Benachteiligung am Genitale Eifersucht gegen ein anderes Kind auftritt, das von der Mutter angeblich mehr geliebt wird, wodurch eine Motivierung für die Lösung von der Mutterbindung gewonnen ist. Dazu stimmt es dann, wenn dies von der Mutter bevorzugte Kind das erste Objekt der in Masturbation auslaufenden Schlagephantasie wird.
Eine andere überraschende Wirkung des Penisneides –; oder der Entdeckung der Minderwertigkeit der Klitoris –; ist gewiß die wichtigste von allen. Ich hatte oftmals vorher den Eindruck gewonnen, daß das Weib im allgemeinen die Masturbation schlechter verträgt als der Mann, sich öfter gegen sie sträubt und außerstande ist, sich ihrer zu bedienen, wo der Mann unter gleichen Verhältnissen unbedenklich zu diesem Auskunftsmittel gegriffen hätte. Es ist begreiflich, daß die Erfahrung ungezählte Ausnahmen von diesem Satz aufweisen würde, wenn man ihn als Regel aufstellen wollte. Die Reaktionen der menschlichen Individuen beiderlei Geschlechts sind ja aus männlichen und weiblichen Zügen gemengt. Aber es blieb doch der Anschein übrig, daß der Natur des Weibes die Masturbation ferner liege, und man konnte zur Lösung des angenommenen Problems die Erwägung heranziehen, daß wenigstens die Masturbation an der Klitoris eine männliche Betätigung sei und daß die Entfaltung der Weiblichkeit die Wegschaffung der Klitorissexualität zur Bedingung habe. Die Analysen der phallischen Vorzeit haben mich nun gelehrt, daß beim Mädchen bald nach den Anzeichen des Penisneides eine intensive Gegenströmung gegen die Onanie auftritt, die nicht allein auf den Einfluß der erziehenden Pflegeperson zurückgeführt werden kann. Diese Regung ist offenbar ein Vorbote jenes Verdrängungsschubes, der zur Zeit der Pubertät ein großes Stück der männlichen Sexualität beseitigen wird, um Raum für die Entwicklung der Weiblichkeit zu schaffen. Es mag sein, daß diese erste Opposition gegen die autoerotische Betätigung ihr Ziel nicht erreicht. So war es auch in den von mir analysierten Fällen. Der Konflikt setzte sich dann fort, und das Mädchen tat damals wie später alles, um sich vom Zwang zur Onanie zu befreien. Manche späteren Äußerungen des Sexuallebens beim Weibe bleiben unverständlich, wenn man dies starke Motiv nicht erkennt.
Ich kann mir diese Auflehnung des kleinen Mädchens gegen die phallische Onanie nicht anders als durch die Annahme erklären, daß ihm diese lustbringende Betätigung durch ein nebenhergehendes Moment arg verleidet wird. Dieses Moment brauchte man dann nicht weit weg zu suchen; es müßte die mit dem Penisneid verknüpfte narzißtische Kränkung sein, die Mahnung, daß man es in diesem Punkte doch nicht mit dem Knaben aufnehmen kann und darum die Konkurrenz mit ihm am besten unterläßt. In solcher Weise drängt die Erkenntnis des anatomischen Geschlechtsunterschieds das kleine Mädchen von der Männlichkeit und von der männlichen Onanie weg in neue Bahnen, die zur Entfaltung der Weiblichkeit führen.
Vom Ödipuskomplex war bisher nicht die Rede, er hatte auch soweit keine Rolle gespielt. Nun aber gleitet die Libido des Mädchens –; man kann nur sagen: längs der vorgezeichneten symbolischen Gleichung Penis = Kind –; in eine neue Position. Es gibt den Wunsch nach dem Penis auf, um den Wunsch nach einem Kinde an die Stelle zu setzen, und nimmt in dieser Absicht den Vater zum Liebesobjekt. Die Mutter wird zum Objekt der Eifersucht, aus dem Mädchen ist ein kleines Weib geworden. Wenn ich einer vereinzelten analytischen Erhebung glauben darf, kann es in dieser neuen Situation zu körperlichen Sensationen kommen, die als vorzeitiges Erwachen des weiblichen Genitalapparates zu beurteilen sind. Wenn diese Vaterbindung später als verunglückt aufgegeben werden muß, kann sie einer Vateridentifizierung weichen, mit der das Mädchen zum Männlichkeitskomplex zurückkehrt und sich eventuell an ihm fixiert.
Ich habe nun das Wesentliche gesagt, das ich zu sagen hatte, und mache halt, um das Ergebnis zu überblicken. Wir haben Einsicht in die Vorgeschichte des Ödipuskomplexes beim Mädchen bekommen. Das Entsprechende beim Knaben ist ziemlich unbekannt. Beim Mädchen ist der Ödipuskomplex eine sekundäre Bildung. Die Auswirkungen des Kastrationskomplexes gehen ihm vorher und bereiten ihn vor. Für das Verhältnis zwischen Ödipus- und Kastrationskomplex stellt sich ein fundamentaler Gegensatz der beiden Geschlechter her. Während der Ödipuskomplex des Knaben am Kastrationskomplex zugrunde geht[Fußnote]Siehe ›Der Untergang des Ödipuskomplexes‹., wird der des Mädchens durch den Kastrationskomplex ermöglicht und eingeleitet. Dieser Widerspruch erhält seine Aufklärung, wenn man erwägt, daß der Kastrationskomplex dabei immer im Sinne seines Inhaltes wirkt, hemmend und einschränkend für die Männlichkeit, befördernd auf die Weiblichkeit. Die Differenz in diesem Stück der Sexualentwicklung beim Mann und Weib ist eine begreifliche Folge der anatomischen Verschiedenheit der Genitalien und der damit verknüpften psychischen Situation, sie entspricht dem Unterschied von vollzogener und bloß angedrohter Kastration. Unser Ergebnis ist also im Grunde eine Selbstverständlichkeit, die man hätte vorhersehen können.
Indes der Ödipuskomplex ist etwas so Bedeutsames, daß es auch nicht folgenlos bleiben kann, auf welche Weise man in ihn hineingeraten und von ihm losgekommen ist. Beim Knaben –; so habe ich in der letzterwähnten Publikation ausgeführt, an die ich hier überhaupt anknüpfe –; wird der Komplex nicht einfach verdrängt, er zerschellt förmlich unter dem Schock der Kastrationsdrohung. Seine libidinösen Besetzungen werden aufgegeben, desexualisiert und zum Teil sublimiert, seine Objekte dem Ich einverleibt, wo sie den Kern des Über-Ichs bilden und dieser Neuformation charakteristische Eigenschaften verleihen. Im normalen, besser gesagt: im idealen Falle besteht dann auch im Unbewußten kein Ödipuskomplex mehr, das Über-Ich ist sein Erbe geworden. Da der Penis –; im Sinne Ferenczis –; seine außerordentlich hohe narzißtische Besetzung seiner organischen Bedeutung für die Fortsetzung der Art verdankt, kann man die Katastrophe des Ödipuskomplexes –; die Abwendung vom Inzest, die Einsetzung von Gewissen und Moral –; als einen Sieg der Generation über das Individuum auffassen. Ein interessanter Gesichtspunkt, wenn man erwägt, daß die Neurose auf einem Sträuben des Ichs gegen den Anspruch der Sexualfunktion beruht. Aber das Verlassen des Standpunktes der individuellen Psychologie führt zunächst nicht zur Klärung der verschlungenen Beziehungen.
Beim Mädchen entfällt das Motiv für die Zertrümmerung des Ödipuskomplexes. Die Kastration hat ihre Wirkung bereits früher getan, und diese bestand darin, das Kind in die Situation des Ödipuskomplexes zu drängen. Dieser entgeht darum dem Schicksal, das ihm beim Knaben bereitet wird, er kann langsam verlassen, durch Verdrängung erledigt werden, seine Wirkungen weit in das für das Weib normale Seelenleben verschieben. Man zögert es auszusprechen, kann sich aber doch der Idee nicht erwehren, daß das Niveau des sittlich Normalen für das Weib ein anderes wird. Das Über-Ich wird niemals so unerbittlich, so unpersönlich, so unabhängig von seinen affektiven Ursprüngen, wie wir es vom Manne fordern. Charakterzüge, die die Kritik seit jeher dem Weibe vorgehalten hat, daß es weniger Rechtsgefühl zeigt als der Mann, weniger Neigung zur Unterwerfung unter die großen Notwendigkeiten des Lebens, sich öfter in seinen Entscheidungen von zärtlichen und feindseligen Gefühlen leiten läßt, fänden in der oben abgeleiteten Modifikation der Über-Ichbildung eine ausreichende Begründung. Durch den Widerspruch der Feministen, die uns eine völlige Gleichstellung und Gleichschätzung der Geschlechter aufdrängen wollen, wird man sich in solchen Urteilen nicht beirren lassen, wohl aber bereitwillig zugestehen, daß auch die Mehrzahl der Männer weit hinter dem männlichen Ideal zurückbleibt und daß alle menschlichen Individuen infolge ihrer bisexuellen Anlage und der gekreuzten Vererbung männliche und weibliche Charaktere in sich vereinigen, so daß die reine Männlichkeit und Weiblichkeit theoretische Konstruktionen bleiben mit ungesichertem Inhalt.
Ich bin geneigt, den hier vorgebrachten Ausführungen über die psychischen Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds Wert beizulegen, aber ich weiß, daß diese Schätzung nur aufrechtzuhalten ist, wenn sich die an einer Handvoll Fällen gemachten Funde allgemein bestätigen und als typisch herausstellen. Sonst bliebe es eben ein Beitrag zur Kenntnis der mannigfaltigen Wege in der Entwicklung des Sexuallebens.
In den schätzenswerten und inhaltreichen Arbeiten über den Männlichkeits- und Kastrationskomplex des Weibes von Abraham (1921), Horney (1923), Helene Deutsch (1925) findet sich vieles, was nahe an meine Darstellung rührt, nichts, was sich ganz mit ihr deckt, so daß ich diese Veröffentlichung auch in dieser Hinsicht rechtfertigen möchte.
Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten (1914)
Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse II
Es scheint mir nicht überflüssig, den Lernenden immer wieder daran zu mahnen, welche tiefgreifenden Veränderungen die psychoanalytische Technik seit ihren ersten Anfängen erfahren hat. Zuerst, in der Phase der Breuerschen Katharsis, die direkte Einstellung des Moments der Symptombildung und das konsequent festgehaltene Bemühen, die psychischen Vorgänge jener Situation reproduzieren zu lassen, um sie zu einem Ablauf durch bewußte Tätigkeit zu leiten. Erinnern und Abreagieren waren damals die mit Hilfe des hypnotischen Zustandes zu erreichenden Ziele. Sodann, nach dem Verzicht auf die Hypnose, drängte sich die Aufgabe vor, aus den freien Einfällen des Analysierten zu erraten, was er zu erinnern versagte. Durch die Deutungsarbeit und die Mitteilung ihrer Ergebnisse an den Kranken sollte der Widerstand umgangen werden; die Einstellung auf die Situationen der Symptombildung und jene anderen, die sich hinter dem Momente der Erkrankung ergaben, blieb erhalten, das Abreagieren trat zurück und schien durch den Arbeitsaufwand ersetzt, den der Analysierte bei der ihm aufgedrängten Überwindung der Kritik gegen seine Einfälle (bei der Befolgung der ψα Grundregel) zu leisten hatte. Endlich hat sich die konsequente heutige Technik herausgebildet, bei welcher der Arzt auf die Einstellung eines bestimmten Moments oder Problems verzichtet, sich damit begnügt, die jeweilige psychische Oberfläche des Analysierten zu studieren, und die Deutungskunst wesentlich dazu benützt, um die an dieser hervortretenden Widerstände zu erkennen und dem Kranken bewußtzumachen. Es stellt sich dann eine neue Art von Arbeitsteilung her: Der Arzt deckt die dem Kranken unbekannten Widerstände auf; sind diese erst bewältigt, so erzählt der Kranke oft ohne alle Mühe die vergessenen Situationen und Zusammenhänge. Das Ziel dieser Techniken ist natürlich unverändert geblieben. Deskriptiv: die Ausfüllung der Lücken der Erinnerung, dynamisch: die Überwindung der Verdrängungswiderstände.
Man muß der alten hypnotischen Technik dankbar dafür bleiben, daß sie uns einzelne psychische Vorgänge der Analyse in Isolierung und Schematisierung vorgeführt hat. Nur dadurch konnten wir den Mut gewinnen, komplizierte Situationen in der analytischen Kur selbst zu schaffen und durchsichtig zu erhalten.
Das Erinnern gestaltete sich nun in jenen hypnotischen Behandlungen sehr einfach. Der Patient versetzte sich in eine frühere Situation, die er mit der gegenwärtigen niemals zu verwechseln schien, teilte die psychischen Vorgänge derselben mit, soweit sie normal geblieben waren, und fügte daran, was sich durch die Umsetzung der damals unbewußten Vorgänge in bewußte ergeben konnte.
Ich schließe hier einige Bemerkungen an, die jeder Analytiker in seiner Erfahrung bestätigt gefunden hat. Das Vergessen von Eindrücken, Szenen, Erlebnissen reduziert sich zumeist auf eine »Absperrung« derselben. Wenn der Patient von diesem »Vergessenen« spricht, versäumt er selten hinzuzufügen: »Das habe ich eigentlich immer gewußt, nur nicht daran gedacht.« Er äußert nicht selten seine Enttäuschung darüber, daß ihm nicht genug Dinge einfallen wollen, die er als »vergessen« anerkennen kann, an die er nie wieder gedacht, seitdem sie vorgefallen sind. Indes findet auch diese Sehnsucht, zumal bei Konversionshysterien, ihre Befriedigung. Das »Vergessen« erfährt eine weitere Einschränkung durch die Würdigung der so allgemein vorhandenen Deckerinnerungen. In manchen Fällen habe ich den Eindruck empfangen, daß die bekannte, für uns theoretisch so bedeutsame Kindheitsamnesie durch die Deckerinnerungen vollkommen aufgewogen wird. In diesen ist nicht nur einiges Wesentliche aus dem Kindheitsleben erhalten, sondern eigentlich alles Wesentliche. Man muß nur verstehen, es durch die Analyse aus ihnen zu entwickeln. Sie repräsentieren die vergessenen Kinderjahre so zureichend wie der manifeste Trauminhalt die Traumgedanken.
Die andere Gruppe von psychischen Vorgängen, die man als rein interne Akte den Eindrücken und Ergebnissen entgegenstellen kann, Phantasien, Beziehungsvorgänge, Gefühlsregungen, Zusammenhänge, muß in ihrem Verhältnis zum Vergessen und Erinnern gesondert betrachtet werden. Hier ereignet es sich besonders häufig, daß etwas »erinnert« wird, was nie »vergessen« werden konnte, weil es zu keiner Zeit gemerkt wurde, niemals bewußt war, und es scheint überdies völlig gleichgültig für den psychischen Ablauf, ob ein solcher »Zusammenhang« bewußt war und dann vergessen wurde oder ob er es niemals zum Bewußtsein gebracht hat. Die Überzeugung, die der Kranke im Laufe der Analyse erwirbt, ist von einer solchen Erinnerung ganz unabhängig.
Besonders bei den mannigfachen Formen der Zwangsneurose schränkt sich das Vergessene meist auf die Auflösung von Zusammenhängen, Verkennung von Abfolgen, Isolierung von Erinnerungen ein.
Für eine besondere Art von überaus wichtigen Erlebnissen, die in sehr frühe Zeiten der Kindheit fallen und seinerzeit ohne Verständnis erlebt worden sind, nachträglich aber Verständnis und Deutung gefunden haben, läßt sich eine Erinnerung meist nicht erwecken. Man gelangt durch Träume zu ihrer Kenntnis und wird durch die zwingendsten Motive aus dem Gefüge der Neurose genötigt, an sie zu glauben, kann sich auch überzeugen, daß der Analysierte nach Überwindung seiner Widerstände das Ausbleiben des Erinnerungsgefühles (Bekanntschaftsempfindung) nicht gegen deren Annahme verwertet. Immerhin erfordert dieser Gegenstand so viel kritische Vorsicht und bringt so viel Neues und Befremdendes, daß ich ihn einer gesonderten Behandlung an geeignetem Materiale vorbehalte.
Von diesem erfreulich glatten Ablauf ist nun bei Anwendung der neuen Technik sehr wenig, oft nichts übriggeblieben. Es kommen auch hier Fälle vor, die sich ein Stück weit verhalten wie bei der hypnotischen Technik und erst später versagen; andere Fälle benehmen sich aber von vornherein anders. Halten wir uns zur Kennzeichnung des Unterschiedes an den letzteren Typus, so dürfen wir sagen, der Analysierte erinnere überhaupt nichts von dem Vergessenen und Verdrängten, sondern er agiere es. Er reproduziert es nicht als Erinnerung, sondern als Tat, er wiederholt es, ohne natürlich zu wissen, daß er es wiederholt.
Zum Beispiel: Der Analysierte erzählt nicht, er erinnere sich, daß er trotzig und ungläubig gegen die Autorität der Eltern gewesen sei, sondern er benimmt sich in solcher Weise gegen den Arzt. Er erinnert nicht, daß er in seiner infantilen Sexualforschung rat- und hilflos steckengeblieben ist, sondern er bringt einen Haufen verworrener Träume und Einfälle vor, jammert, daß ihm nichts gelinge, und stellt es als sein Schicksal hin, niemals eine Unternehmung zu Ende zu führen. Er erinnert nicht, daß er sich gewisser Sexualbetätigungen intensiv geschämt und ihre Entdeckung gefürchtet hat, sondern er zeigt, daß er sich der Behandlung schämt, der er sich jetzt unterzogen hat, und sucht diese vor allen geheimzuhalten usw.
Vor allem beginnt er die Kur mit einer solchen Wiederholung. Oft, wenn man einem Patienten mit wechselvoller Lebensgeschichte und langer Krankheitsgeschichte die psychoanalytische Grundregel mitgeteilt und ihn dann aufgefordert hat zu sagen, was ihm einfalle, und nun erwartet, daß sich seine Mitteilungen im Strom ergießen werden, erfährt man zunächst, daß er nichts zu sagen weiß. Er schweigt und behauptet, daß ihm nichts einfallen will. Das ist natürlich nichts anderes als die Wiederholung einer homosexuellen Einstellung, die sich als Widerstand gegen jedes Erinnern vordrängt. Solange er in Behandlung verbleibt, wird er von diesem Zwange zur Wiederholung nicht mehr frei; man versteht endlich, dies ist seine Art zu erinnern.
Natürlich wird uns das Verhältnis dieses Wiederholungszwanges zur Übertragung und zum Widerstande in erster Linie interessieren. Wir merken bald, die Übertragung ist selbst nur ein Stück Wiederholung und die Wiederholung ist die Übertragung der vergessenen Vergangenheit nicht nur auf den Arzt, sondern auch auf alle anderen Gebiete der gegenwärtigen Situation. Wir müssen also darauf gefaßt sein, daß der Analysierte sich dem Zwange zur Wiederholung, der nun den Impuls zur Erinnerung ersetzt, nicht nur im persönlichen Verhältnis zum Arzte hingibt, sondern auch in allen anderen gleichzeitigen Tätigkeiten und Beziehungen seines Lebens, zum Beispiel wenn er während der Kur ein Liebesobjekt wählt, eine Aufgabe auf sich nimmt, eine Unternehmung eingeht. Auch der Anteil des Widerstandes ist leicht zu erkennen. Je größer der Widerstand ist, desto ausgiebiger wird das Erinnern durch das Agieren (Wiederholen) ersetzt sein. Entspricht doch das ideale Erinnern des Vergessenen in der Hypnose einem Zustande, in welchem der Widerstand völlig beiseite geschoben ist. Beginnt die Kur unter der Patronanz einer milden und unausgesprochenen positiven Übertragung, so gestattet sie zunächst ein Vertiefen in die Erinnerung wie bei der Hypnose, währenddessen selbst die Krankheitssymptome schweigen; wird aber im weiteren Verlaufe diese Übertragung feindselig oder überstark und darum verdrängungsbedürftig, so tritt sofort das Erinnern dem Agieren den Platz ab. Von da an bestimmen dann die Widerstände die Reihenfolge des zu Wiederholenden. Der Kranke holt aus dem Arsenale der Vergangenheit die Waffen hervor, mit denen er sich der Fortsetzung der Kur erwehrt und die wir ihm Stück für Stück entwinden müssen.
Wir haben nun gehört, der Analysierte wiederholt, anstatt zu erinnern, er wiederholt unter den Bedingungen des Widerstandes; wir dürfen jetzt fragen, was wiederholt oder agiert er eigentlich? Die Antwort lautet, er wiederholt alles, was sich aus den Quellen seines Verdrängten bereits in seinem offenkundigen Wesen durchgesetzt hat, seine Hemmungen und unbrauchbaren Einstellungen, seine pathologischen Charakterzüge. Er wiederholt ja auch während der Behandlung alle seine Symptome. Und nun können wir merken, daß wir mit der Hervorhebung des Zwanges zur Wiederholung keine neue Tatsache, sondern nur eine einheitlichere Auffassung gewonnen haben. Wir machen uns nun klar, daß das Kranksein des Analysierten nicht mit dem Beginne seiner Analyse aufhören kann, daß wir seine Krankheit nicht als eine historische Angelegenheit, sondern als eine aktuelle Macht zu behandeln haben. Stück für Stück dieses Krankseins wird nun in den Horizont und in den Wirkungsbereich der Kur gerückt, und während der Kranke es als etwas Reales und Aktuelles erlebt, haben wir daran die therapeutische Arbeit zu leisten, die zum guten Teile in der Zurückführung auf die Vergangenheit besteht.
Das Erinnernlassen in der Hypnose mußte den Eindruck eines Experiments im Laboratorium machen. Das Wiederholenlassen während der analytischen Behandlung nach der neueren Technik heißt ein Stück realen Lebens heraufbeschwören und kann darum nicht in allen Fällen harmlos und unbedenklich sein. Das ganze Problem der oft unausweichlichen »Verschlimmerung während der Kur« schließt hier an.
Vor allem bringt es schon die Einleitung der Behandlung mit sich, daß der Kranke seine bewußte Einstellung zur Krankheit ändere. Er hat sich gewöhnlich damit begnügt, sie zu bejammern, sie als Unsinn zu verachten, in ihrer Bedeutung zu unterschätzen, hat aber sonst das verdrängende Verhalten, die Vogel-Strauß-Politik, die er gegen ihre Ursprünge übte, auf ihre Äußerungen fortgesetzt. So kann es kommen, daß er die Bedingungen seiner Phobie nicht ordentlich kennt, den richtigen Wortlaut seiner Zwangsideen nicht anhört oder die eigentliche Absicht seines Zwangsimpulses nicht erfaßt. Das kann die Kur natürlich nicht brauchen. Er muß den Mut erwerben, seine Aufmerksamkeit mit den Erscheinungen seiner Krankheit zu beschäftigen. Die Krankheit selbst darf ihm nichts Verächtliches mehr sein, vielmehr ein würdiger Gegner werden, ein Stück seines Wesens, das sich auf gute Motive stützt, aus dem es Wertvolles für sein späteres Leben zu holen gilt. Die Versöhnung mit dem Verdrängten, welches sich in den Symptomen äußert, wird so von Anfang an vorbereitet, aber es wird auch eine gewisse Toleranz fürs Kranksein eingeräumt. Werden nun durch dies neue Verhältnis zur Krankheit Konflikte verschärft und Symptome hervorgedrängt, die früher noch undeutlich waren, so kann man den Patienten darüber leicht durch die Bemerkung trösten, daß dies nur notwendige, aber vorübergehende Verschlechterungen sind und daß man keinen Feind umbringen kann, der abwesend oder nicht nahe genug ist. Der Widerstand kann aber die Situation für seine Absichten ausbeuten und die Erlaubnis, krank zu sein, mißbrauchen wollen. Er scheint dann zu demonstrieren: Schau her, was dabei herauskommt, wenn ich mich wirklich auf diese Dinge einlasse. Hab' ich nicht recht getan, sie der Verdrängung zu überlassen? Besonders jugendliche und kindliche Personen pflegen die in der Kur erforderliche Einlenkung auf das Kranksein gern zu einem Schwelgen in den Krankheitssymptomen zu benützen.
Weitere Gefahren entstehen dadurch, daß im Fortgange der Kur auch neue, tieferliegende Triebregungen, die sich noch nicht durchgesetzt hatten, zur Wiederholung gelangen können. Endlich können die Aktionen des Patienten außerhalb der Übertragung vorübergehende Lebensschädigungen mit sich bringen oder sogar so gewählt sein, daß sie die zu erreichende Gesundheit dauernd entwerten.
Die Taktik, welche der Arzt in dieser Situation einzuschlagen hat, ist leicht zu rechtfertigen. Für ihn bleibt das Erinnern nach alter Manier, das Reproduzieren auf psychischem Gebiete, das Ziel, an welchem er festhält, wenn er auch weiß, daß es bei der neuen Technik nicht zu erreichen ist. Er richtet sich auf einen beständigen Kampf mit dem Patienten ein, um alle Impulse auf psychischem Gebiete zurückzuhalten, welche dieser aufs Motorische lenken möchte, und feiert es als einen Triumph der Kur, wenn es gelingt, etwas durch die Erinnerungsarbeit zu erledigen, was der Patient durch eine Aktion abführen möchte. Wenn die Bindung durch die Übertragung eine irgend brauchbare geworden ist, so bringt es die Behandlung zustande, den Kranken an allen bedeutungsvolleren Wiederholungsaktionen zu hindern und den Vorsatz dazu in statu nascendi als Material für die therapeutische Arbeit zu verwenden. Vor der Schädigung durch die Ausführung seiner Impulse behütet man den Kranken am besten, wenn man ihn dazu verpflichtet, während der Dauer der Kur keine lebenswichtigen Entscheidungen zu treffen, etwa keinen Beruf, kein definitives Liebesobjekt zu wählen, sondern für alle diese Absichten den Zeitpunkt der Genesung abzuwarten.
Man schont dabei gern, was von der persönlichen Freiheit des Analysierten mit diesen Vorsichten vereinbar ist, hindert ihn nicht an der Durchsetzung belangloser, wenn auch törichter Absichten und vergißt nicht daran, daß der Mensch eigentlich nur durch Schaden und eigene Erfahrung klug werden kann. Es gibt wohl auch Fälle, die man nicht abhalten kann, sich während der Behandlung in irgendeine ganz unzweckmäßige Unternehmung einzulassen, und die erst nachher mürbe und für die analytische Bearbeitung zugänglich werden. Gelegentlich muß es auch vorkommen, daß man nicht die Zeit hat, den wilden Trieben den Zügel der Übertragung anzulegen, oder daß der Patient in einer Wiederholungsaktion das Band zerreißt, das ihn an die Behandlung knüpft. Ich kann als extremes Beispiel den Fall einer älteren Dame wählen, die wiederholt in Dämmerzuständen ihr Haus und ihren Mann verlassen hatte und irgendwohin geflüchtet war, ohne sich je eines Motives für dieses »Durchgehen« bewußt zu werden. Sie kam mit einer gut ausgebildeten zärtlichen Übertragung in meine Behandlung, steigerte dieselbe in unheimlich rascher Weise in den ersten Tagen und war am Ende einer Woche auch von mir »durchgegangen«, ehe ich noch Zeit gehabt hatte, ihr etwas zu sagen, was sie an dieser Wiederholung hätte hindern können.
Das Hauptmittel aber, den Wiederholungszwang des Patienten zu bändigen und ihn zu einem Motiv fürs Erinnern umzuschaffen, liegt in der Handhabung der Übertragung. Wir machen ihn unschädlich, ja vielmehr nutzbar, indem wir ihm sein Recht einräumen, ihn auf einem bestimmten Gebiete gewähren lassen. Wir eröffnen ihm die Übertragung als den Tummelplatz, auf dem ihm gestattet wird, sich in fast völliger Freiheit zu entfalten, und auferlegt ist, uns alles vorzuführen, was sich an pathogenen Trieben im Seelenleben des Analysierten verborgen hat. Wenn der Patient nur so viel Entgegenkommen zeigt, daß er die Existenzbedingungen der Behandlung respektiert, gelingt es uns regelmäßig, allen Symptomen der Krankheit eine neue Übertragungsbedeutung zu geben, seine gemeine Neurose durch eine Übertragungsneurose zu ersetzen, von der er durch die therapeutische Arbeit geheilt werden kann. Die Übertragung schafft so ein Zwischenreich zwischen der Krankheit und dem Leben, durch welches sich der Übergang von der ersteren zum letzteren vollzieht. Der neue Zustand hat alle Charaktere der Krankheit übernommen, aber er stellt eine artifizielle Krankheit dar, die überall unseren Eingriffen zugänglich ist. Er ist gleichzeitig ein Stück des realen Erlebens, aber durch besonders günstige Bedingungen ermöglicht und von der Natur eines Provisoriums. Von den Wiederholungsreaktionen, die sich in der Übertragung zeigen, führen dann die bekannten Wege zur Erweckung der Erinnerungen, die sich nach Überwindung der Widerstände wie mühelos einstellen.
Ich könnte hier abbrechen, wenn nicht die Überschrift dieses Aufsatzes mich verpflichten würde, ein weiteres Stück der analytischen Technik in die Darstellung zu ziehen. Die Überwindung der Widerstände wird bekanntlich dadurch eingeleitet, daß der Arzt den vom Analysierten niemals erkannten Widerstand aufdeckt und ihn dem Patienten mitteilt. Es scheint nun, daß Anfänger in der Analyse geneigt sind, diese Einleitung für die ganze Arbeit zu halten. Ich bin oft in Fällen zu Rate gezogen worden, in denen der Arzt darüber klagte, er habe dem Kranken seinen Widerstand vorgestellt, und doch habe sich nichts geändert, ja, der Widerstand sei erst recht erstarkt und die ganze Situation sei noch undurchsichtiger geworden. Die Kur scheine nicht weiterzugehen. Diese trübe Erwartung erwies sich dann immer als irrig. Die Kur war in der Regel im besten Fortgange; der Arzt hatte nur vergessen, daß das Benennen des Widerstandes nicht das unmittelbare Aufhören desselben zur Folge haben kann. Man muß dem Kranken die Zeit lassen, sich in den ihm nun bekannten Widerstand zu vertiefen, ihn durchzuarbeiten, ihn zu überwinden, indem er ihm zum Trotze die Arbeit nach der analytischen Grundregel fortsetzt. Erst auf der Höhe desselben findet man dann in gemeinsamer Arbeit mit dem Analysierten die verdrängten Triebregungen auf, welche den Widerstand speisen und von deren Existenz und Mächtigkeit sich der Patient durch solches Erleben überzeugt. Der Arzt hat dabei nichts anderes zu tun, als zuzuwarten und einen Ablauf zuzulassen, der nicht vermieden, auch nicht immer beschleunigt werden kann. Hält er an dieser Einsicht fest, so wird er sich oftmals die Täuschung, gescheitert zu sein, ersparen, wo er doch die Behandlung längs der richtigen Linie fortführt.
Dieses Durcharbeiten der Widerstände mag in der Praxis zu einer beschwerlichen Aufgabe für den Analysierten und zu einer Geduldsprobe für den Arzt werden. Es ist aber jenes Stück der Arbeit, welches die größte verändernde Einwirkung auf den Patienten hat und das die analytische Behandlung von jeder Suggestionsbeeinflussung unterscheidet. Theoretisch kann man es dem »Abreagieren« der durch die Verdrängung eingeklemmten Affektbeträge gleichstellen, ohne welches die hypnotische Behandlung einflußlos blieb.
Fetischismus (1927)
In den letzten Jahren hatte ich Gelegenheit, eine Anzahl von Männern, deren Objektwahl von einem Fetisch beherrscht war, analytisch zu studieren. Man braucht nicht zu erwarten, daß diese Personen des Fetisch wegen die Analyse aufgesucht hatten, denn der Fetisch wird wohl von seinen Anhängern als eine Abnormität erkannt, aber nur selten als ein Leidenssymptom empfunden; meist sind sie mit ihm recht zufrieden oder loben sogar die Erleichterungen, die er ihrem Liebesleben bietet. Der Fetisch spielte also in der Regel die Rolle eines Nebenbefundes.
Die Einzelheiten dieser Fälle entziehen sich aus naheliegenden Gründen der Veröffentlichung. Ich kann darum auch nicht zeigen, in welcher Weise zufällige Umstände zur Auswahl des Fetisch beigetragen haben. Am merkwürdigsten erschien ein Fall, in dem ein junger Mann einen gewissen »Glanz auf der Nase« zur fetischistischen Bedingung erhoben hatte. Das fand seine überraschende Aufklärung durch die Tatsache, daß der Patient eine englische Kinderstube gehabt hatte, dann aber nach Deutschland gekommen war, wo er seine Muttersprache fast vollkommen vergaß. Der aus den ersten Kinderzeiten stammende Fetisch war nicht deutsch, sondern englisch zu lesen, der »Glanz auf der Nase« war eigentlich ein »Blick auf die Nase« ( glance = Blick), die Nase war also der Fetisch, dem er übrigens nach seinem Belieben jenes besondere Glanzlicht verlieh, das andere nicht wahrnehmen konnten.
Die Auskunft, welche die Analyse über Sinn und Absicht des Fetisch gab, war in allen Fällen die nämliche. Sie ergab sich so ungezwungen und erschien mir so zwingend, daß ich bereit bin, dieselbe Lösung allgemein für alle Fälle von Fetischismus zu erwarten. Wenn ich nun mitteile, der Fetisch ist ein Penisersatz, so werde ich gewiß Enttäuschung hervorrufen. Ich beeile mich darum hinzuzufügen, nicht der Ersatz eines beliebigen, sondern eines bestimmten, ganz besonderen Penis, der in frühen Kinderjahren eine große Bedeutung hat, aber später verlorengeht. Das heißt: er sollte normalerweise aufgegeben werden, aber gerade der Fetisch ist dazu bestimmt, ihn vor dem Untergang zu behüten. Um es klarer zu sagen, der Fetisch ist der Ersatz für den Phallus des Weibes (der Mutter), an den das Knäblein geglaubt hat und auf den es –; wir wissen warum –; nicht verzichten will [Fußnote]Diese Deutung ist bereits 1910 in meiner Schrift Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci ohne Begründung mitgeteilt worden..
Der Hergang war also der, daß der Knabe sich geweigert hat, die Tatsache seiner Wahrnehmung, daß das Weib keinen Penis besitzt, zur Kenntnis zu nehmen. Nein, das kann nicht wahr sein, denn wenn das Weib kastriert ist, ist sein eigener Penisbesitz bedroht, und dagegen sträubt sich das Stück Narzißmus, mit dem die Natur vorsorglich gerade dieses Organ ausgestattet hat. Eine ähnliche Panik wird vielleicht der Erwachsene später erleben, wenn der Schrei ausgegeben wird, Thron und Altar sind in Gefahr, und sie wird zu ähnlich unlogischen Konsequenzen führen. Wenn ich nicht irre, würde Laforgue in diesem Falle sagen, der Knabe »skotomisiert« die Wahrnehmung des Penismangels beim Weibe [Fußnote]Ich berichtige mich aber selbst, indem ich hinzufüge, daß ich die besten Gründe habe anzunehmen, Laforgue würde dies überhaupt nicht sagen. Nach seinen eigenen Ausführungen ist »Skotomisation« ein Terminus, der aus der Deskription der Dementia praecox stammt, nicht durch die Übertragung psychoanalytischer Auffassung auf die Psychosen entstanden ist und auf die Vorgänge der Entwicklung und Neurosenbildung keine Anwendung hat. Die Darstellung im Text bemüht sich, diese Unverträglichkeit deutlich zu machen.. Ein neuer Terminus ist dann berechtigt, wenn er einen neuen Tatbestand beschreibt oder heraushebt. Das liegt hier nicht vor; das älteste Stück unserer psychoanalytischen Terminologie, das Wort »Verdrängung«, bezieht sich bereits auf diesen pathologischen Vorgang. Will man in ihm das Schicksal der Vorstellung von dem des Affekts schärfer trennen, den Ausdruck »Verdrängung« für den Affekt reservieren, so wäre für das Schicksal der Vorstellung »Verleugnung« die richtige deutsche Bezeichnung. »Skotomisation« scheint mir besonders ungeeignet, denn es weckt die Idee, als wäre die Wahrnehmung glatt weggewischt worden, so daß das Ergebnis dasselbe wäre, wie wenn ein Gesichtseindruck auf den blinden Fleck der Netzhaut fiele. Aber unsere Situation zeigt im Gegenteil, daß die Wahrnehmung geblieben ist und daß eine sehr energische Aktion unternommen wurde, ihre Verleugnung aufrechtzuhalten. Es ist nicht richtig, daß das Kind sich nach seiner Beobachtung am Weibe den Glauben an den Phallus des Weibes unverändert gerettet hat. Es hat ihn bewahrt, aber auch aufgegeben; im Konflikt zwischen dem Gewicht der unerwünschten Wahrnehmung und der Stärke des Gegenwunsches ist es zu einem Kompromiß gekommen, wie es nur unter der Herrschaft der unbewußten Denkgesetze –; der Primärvorgänge –; möglich ist. Ja, das Weib hat im Psychischen dennoch einen Penis, aber dieser Penis ist nicht mehr dasselbe, das er früher war. Etwas anderes ist an seine Stelle getreten, ist sozusagen zu seinem Ersatz ernannt worden und ist nun der Erbe des Interesses, das sich dem früheren zugewendet hatte. Dies Interesse erfährt aber noch eine außerordentliche Steigerung, weil der Abscheu vor der Kastration sich in der Schaffung dieses Ersatzes ein Denkmal gesetzt hat. Als Stigma indelebile der stattgehabten Verdrängung bleibt auch die Entfremdung gegen das wirkliche weibliche Genitale, die man bei keinem Fetischisten vermißt. Man überblickt jetzt, was der Fetisch leistet und wodurch er gehalten wird. Er bleibt das Zeichen des Triumphes über die Kastrationsdrohung und der Schutz gegen sie, er erspart es dem Fetischisten auch, ein Homosexueller zu werden, indem er dem Weib jenen Charakter verleiht, durch den es als Sexualobjekt erträglich wird. Im späteren Leben glaubt der Fetischist noch einen anderen Vorteil seines Genitalersatzes zu genießen. Der Fetisch wird von anderen nicht in seiner Bedeutung erkannt, darum auch nicht verweigert, er ist leicht zugänglich, die an ihn gebundene sexuelle Befriedigung ist bequem zu haben. Um was andere Männer werben und sich mühen müssen, das macht dem Fetischisten keine Beschwerde.
Der Kastrationsschreck beim Anblick des weiblichen Genitales bleibt wahrscheinlich keinem männlichen Wesen erspart. Warum die einen infolge dieses Eindruckes homosexuell werden, die anderen ihn durch die Schöpfung eines Fetisch abwehren und die übergroße Mehrzahl ihn überwindet, das wissen wir freilich nicht zu erklären. Möglich, daß wir unter der Anzahl der zusammenwirkenden Bedingungen diejenigen noch nicht kennen, welche für die seltenen pathologischen Ausgänge maßgebend sind; im übrigen müssen wir zufrieden sein, wenn wir erklären können, was geschehen ist, und dürfen die Aufgabe, zu erklären, warum etwas nicht geschehen ist, vorläufig von uns weisen.
Es liegt nahe zu erwarten, daß zum Ersatz des vermißten weiblichen Phallus solche Organe oder Objekte gewählt werden, die auch sonst als Symbole den Penis vertreten. Das mag oft genug stattfinden, ist aber gewiß nicht entscheidend. Bei der Einsetzung des Fetisch scheint vielmehr ein Vorgang eingehalten zu werden, der an das Haltmachen der Erinnerung bei traumatischer Amnesie gemahnt. Auch hier bleibt das Interesse wie unterwegs stehen, wird etwa der letzte Eindruck vor dem unheimlichen, traumatischen, als Fetisch festgehalten. So verdankt der Fuß oder Schuh seine Bevorzugung als Fetisch –; oder ein Stück derselben –; dem Umstand, daß die Neugierde des Knaben von unten, von den Beinen her nach dem weiblichen Genitale gespäht hat; Pelz und Samt fixieren –; wie längst vermutet wurde –; den Anblick der Genitalbehaarung, auf den der ersehnte des weiblichen Gliedes hätte folgen sollen; die so häufig zum Fetisch erkorenen Wäschestücke halten den Moment der Entkleidung fest, den letzten, in dem man das Weib noch für phallisch halten durfte. Ich will aber nicht behaupten, daß man die Determinierung des Fetisch jedesmal mit Sicherheit durchschaut. Die Untersuchung des Fetischismus ist all denen dringend zu empfehlen, die noch an der Existenz des Kastrationskomplexes zweifeln oder die meinen können, der Schreck vor dem weiblichen Genitale habe einen anderen Grund, leite sich z. B. von der supponierten Erinnerung an das Trauma der Geburt ab. Für mich hatte die Aufklärung des Fetisch noch ein anderes theoretisches Interesse.
Ich habe kürzlich auf rein spekulativem Wege den Satz gefunden, der wesentliche Unterschied zwischen Neurose und Psychose liege darin, daß bei ersterer das Ich im Dienste der Realität ein Stück des Es unterdrücke, während es sich bei der Psychose vom Es fortreißen lasse, sich von einem Stück der Realität zu lösen; ich bin auch später noch einmal auf dasselbe Thema zurückgekommen [Fußnote]›Neurose und Psychose‹ (1924 b) und ›Der Realitätsverlust bei Neurose und Psychose‹ (1924 e).. Aber bald darauf bekam ich Anlaß zu bedauern, daß ich mich so weit vorgewagt hatte. Aus der Analyse zweier junger Männer erfuhr ich, daß sie beide den Tod des geliebten Vaters im zweiten und im zehnten Jahr nicht zur Kenntnis genommen, »skotomisiert« hatten –; und doch hatte keiner von beiden eine Psychose entwickelt. Da war also ein gewiß bedeutsames Stück der Realität vom Ich verleugnet worden, ähnlich wie beim Fetischisten die unliebsame Tatsache der Kastration des Weibes. Ich begann auch zu ahnen, daß analoge Vorkommnisse im Kinderleben keineswegs selten sind, und konnte mich des Irrtums in der Charakteristik von Neurose und Psychose für überführt halten. Es blieb zwar eine Auskunft offen; meine Formel brauchte sich erst bei einem höheren Grad von Differenzierung im psychischen Apparat zu bewähren; dem Kind konnte gestattet sein, was sich beim Erwachsenen durch schwere Schädigung strafen mußte. Aber weitere Untersuchungen führten zu einer anderen Lösung des Widerspruchs.
Es stellte sich nämlich heraus, daß die beiden jungen Männer den Tod des Vaters ebensowenig »skotomisiert« hatten wie die Fetischisten die Kastration des Weibes. Es war nur eine Strömung in ihrem Seelenleben, welche den Tod des Vaters nicht anerkannt hatte; es gab auch eine andere, die dieser Tatsache vollkommen Rechnung trug; die wunschgerechte wie die realitätsgerechte Einstellung bestanden nebeneinander. Bei dem einen meiner beiden Fälle war diese Spaltung die Grundlage einer mittelschweren Zwangsneurose geworden; in allen Lebenslagen schwankte er zwischen zwei Voraussetzungen, der einen, daß der Vater noch am Leben sei und seine Tätigkeit behindere, und der entgegengesetzten, daß er das Recht habe, sich als den Nachfolger des verstorbenen Vaters zu betrachten. Ich kann also die Erwartung festhalten, daß im Fall der Psychose die eine, die realitätsgerechte Strömung, wirklich vermißt werden würde.
Wenn ich zur Beschreibung des Fetischismus zurückkehre, habe ich anzuführen, daß es noch zahlreiche und gewichtige Beweise für die zwiespältige Einstellung des Fetischisten zur Frage der Kastration des Weibes gibt. In ganz raffinierten Fällen ist es der Fetisch selbst, in dessen Aufbau sowohl die Verleugnung wie die Behauptung der Kastration Eingang gefunden haben. So war es bei einem Manne, dessen Fetisch in einem Schamgürtel bestand, wie er auch als Schwimmhose getragen werden kann. Dieses Gewandstück verdeckte überhaupt die Genitalien und den Unterschied der Genitalien. Nach dem Ausweis der Analyse bedeutete es sowohl, daß das Weib kastriert sei, als auch, daß es nicht kastriert sei, und ließ überdies die Annahme der Kastration des Mannes zu, denn alle diese Möglichkeiten konnten sich hinter dem Gürtel, dessen erster Ansatz in der Kindheit das Feigenblatt einer Statue gewesen war, gleich gut verbergen. Ein solcher Fetisch, aus Gegensätzen doppelt geknüpft, hält natürlich besonders gut. In anderen zeigt sich die Zwiespältigkeit an dem, was der Fetischist –; in der Wirklichkeit oder in der Phantasie –; an seinem Fetisch vornimmt. Es ist nicht erschöpfend, wenn man hervorhebt, daß er den Fetisch verehrt; in vielen Fällen behandelt er ihn in einer Weise, die offenbar einer Darstellung der Kastration gleichkommt. Dies geschieht besonders dann, wenn sich eine starke Vateridentifizierung entwickelt hat, in der Rolle des Vaters, denn diesem hatte das Kind die Kastration des Weibes zugeschrieben. Die Zärtlichkeit und die Feindseligkeit in der Behandlung des Fetisch, die der Verleugnung und der Anerkennung der Kastration gleichlaufen, vermengen sich bei verschiedenen Fällen in ungleichem Maße, so daß das eine oder das andere deutlicher kenntlich wird. Von hier aus glaubt man, wenn auch aus der Ferne, das Benehmen des Zopfabschneiders zu verstehen, bei dem sich das Bedürfnis, die geleugnete Kastration auszuführen, vorgedrängt hat. Seine Handlung vereinigt in sich die beiden miteinander unverträglichen Behauptungen: das Weib hat seinen Penis behalten, und der Vater hat das Weib kastriert. Eine andere Variante, aber auch eine völkerpsychologische Parallele zum Fetischismus möchte man in der Sitte der Chinesen erblicken, den weiblichen Fuß zuerst zu verstümmeln und den verstümmelten dann wie einen Fetisch zu verehren. Man könnte meinen, der chinesische Mann will es dem Weibe danken, daß es sich der Kastration unterworfen hat.
Schließlich darf man es aussprechen, das Normalvorbild des Fetisch ist der Penis des Mannes, wie das des minderwertigen Organs der reale kleine Penis des Weibes, die Klitoris.
Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens (1911)
Wir haben seit langem gemerkt, daß jede Neurose die Folge, also wahrscheinlich die Tendenz habe, den Kranken aus dem realen Leben herauszudrängen, ihn der Wirklichkeit zu entfremden. Eine derartige Tatsache konnte auch der Beobachtung P. Janets nicht entgehen; er sprach von einem Verluste » de la fonction du réel« als von einem besonderen Charakter der Neurotiker, ohne aber den Zusammenhang dieser Störung mit den Grundbedingungen der Neurose aufzudecken [Fußnote]Janet (1909)..
Die Einführung des Verdrängungsprozesses in die Genese der Neurose hat uns gestattet, in diesen Zusammenhang Einsicht zu nehmen. Der Neurotiker wendet sich von der Wirklichkeit ab, weil er sie –; ihr Ganzes oder Stücke derselben –; unerträglich findet. Den extremsten Typus dieser Abwendung von der Realität zeigen uns gewisse Fälle von halluzinatorischer Psychose, in denen jenes Ereignis verleugnet werden soll, welches den Wahnsinn hervorgerufen hat (Griesinger). Eigentlich tut aber jeder Neurotiker mit einem Stückchen der Realität das gleiche [Fußnote]Eine merkwürdig klare Ahnung dieser Verursachung hat kürzlich Otto Rank in einer Stelle Schopenhauers aufgezeigt. ( Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 2. S. Rank, 1910.). Es erwächst uns nun die Aufgabe, die Beziehung des Neurotikers und des Menschen überhaupt zur Realität auf ihre Entwicklung zu untersuchen und so die psychologische Bedeutung der realen Außenwelt in das Gefüge unserer Lehren aufzunehmen.
Wir haben uns in der auf Psychoanalyse begründeten Psychologie gewöhnt, die unbewußten seelischen Vorgänge zum Ausgange zu nehmen, deren Eigentümlichkeiten uns durch die Analyse bekannt worden sind. Wir halten diese für die älteren, primären, für Überreste aus einer Entwicklungsphase, in welcher sie die einzige Art von seelischen Vorgängen waren. Die oberste Tendenz, welcher diese primären Vorgänge gehorchen, ist leicht zu erkennen; sie wird als das Lust-Unlust-Prinzip (oder kürzer als das Lustprinzip) bezeichnet. Diese Vorgänge streben danach, Lust zu gewinnen; von solchen Akten, welche Unlust erregen können, zieht sich die psychische Tätigkeit zurück (Verdrängung). Unser nächtliches Träumen, unsere Wachtendenz, uns von peinlichen Eindrücken loszureißen, sind Reste von der Herrschaft dieses Prinzips und Beweise für dessen Mächtigkeit.
Ich greife auf Gedankengänge zurück, die ich an anderer Stelle (im allgemeinen Abschnitt der Traumdeutung) entwickelt habe, wenn ich supponiere, daß der psychische Ruhezustand anfänglich durch die gebieterischen Forderungen der inneren Bedürfnisse gestört wurde. In diesem Falle wurde das Gedachte (Gewünschte) einfach halluzinatorisch gesetzt, wie es heute noch allnächtlich mit unseren Traumgedanken geschieht [Fußnote]Der Schlafzustand kann das Ebenbild des Seelenlebens vor der Anerkennung der Realität wiederbringen, weil er die absichtliche Verleugnung derselben (Schlafwunsch) zur Voraussetzung nimmt.. Erst das Ausbleiben der erwarteten Befriedigung, die Enttäuschung, hatte zur Folge, daß dieser Versuch der Befriedigung auf halluzinatorischem Wege aufgegeben wurde. Anstatt seiner mußte sich der psychische Apparat entschließen, die realen Verhältnisse der Außenwelt vorzustellen und die reale Veränderung anzustreben. Damit war ein neues Prinzip der seelischen Tätigkeit eingeführt; es wurde nicht mehr vorgestellt, was angenehm, sondern was real war, auch wenn es unangenehm sein sollte [Fußnote]Ich will versuchen, die obige schematische Darstellung durch einige Ausführungen zu ergänzen: Es wird mit Recht eingewendet werden, daß eine solche Organisation, die dem Lustprinzip frönt und die Realität der Außenwelt vernachlässigt, sich nicht die kürzeste Zeit am Leben erhalten könnte, so daß sie überhaupt nicht hätte entstehen können. Die Verwendung einer derartigen Fiktion rechtfertigt sich aber durch die Bemerkung, daß der Säugling, wenn man nur die Mutterpflege hinzunimmt, ein solches psychisches System nahezu realisiert. Er halluziniert wahrscheinlich die Erfüllung seiner inneren Bedürfnisse, verrät seine Unlust bei steigendem Reiz und ausbleibender Befriedigung durch die motorische Abfuhr des Schreiens und Zappelns und erlebt darauf die halluzinierte Befriedigung. Er erlernt es später als Kind, diese Abfuhräußerungen absichtlich als Ausdrucksmittel zu gebrauchen. Da die Säuglingspflege das Vorbild der späteren Kinderfürsorge ist, kann die Herrschaft des Lustprinzips eigentlich erst mit der vollen psychischen Ablösung von den Eltern ein Ende nehmen. –; Ein schönes Beispiel eines von den Reizen der Außenwelt abgeschlossenen psychischen Systems, welches selbst seine Ernährungsbedürfnisse autistisch (nach einem Worte Bleulers) befriedigen kann, gibt das mit seinem Nahrungsvorrat in die Eischale eingeschlossene Vogelei, für das sich die Mutterpflege auf die Wärmezufuhr einschränkt. –; Ich werde es nicht als Korrektur, sondern nur als Erweiterung des in Rede stehenden Schemas ansehen, wenn man für das nach dem Lustprinzip lebende System Einrichtungen fordert, mittels deren es sich den Reizen der Realität entziehen kann. Diese Einrichtungen sind nur das Korrelat der »Verdrängung«, welche innere Unlustreize so behandelt, als ob sie äußere wären, sie also zur Außenwelt schlägt.. Diese Einsetzung des Realitätsprinzips erwies sich als ein folgenschwerer Schritt.
1) Zunächst machten die neuen Anforderungen eine Reihe von Adaptierungen des psychischen Apparats nötig, die wir infolge von ungenügender oder unsicherer Einsicht nur ganz beiläufig aufführen können.
Die erhöhte Bedeutung der äußeren Realität hob auch die Bedeutung der jener Außenwelt zugewendeten Sinnesorgane und des an sie geknüpften Bewußtseins, welches außer den bisher allein interessanten Lust- und Unlustqualitäten die Sinnesqualitäten auffassen lernte. Es wurde eine besondere Funktion eingerichtet, welche die Außenwelt periodisch abzusuchen hatte, damit die Daten derselben im vorhinein bekannt wären, wenn sich ein unaufschiebbares inneres Bedürfnis einstellte, die Aufmerksamkeit. Diese Tätigkeit geht den Sinneseindrücken entgegen, anstatt ihr Auftreten abzuwarten. Wahrscheinlich wurde gleichzeitig damit ein System von Merken eingesetzt, welches die Ergebnisse dieser periodischen Bewußtseinstätigkeit zu deponieren hatte, ein Teil von dem, was wir Gedächtnis heißen.
An Stelle der Verdrängung, welche einen Teil der auftauchenden Vorstellungen als unlusterzeugend von der Besetzung ausschloß, trat die unparteiische Urteilsfällung, welche entscheiden sollte, ob eine bestimmte Vorstellung wahr oder falsch, das heißt im Einklang mit der Realität sei oder nicht, und durch Vergleichung mit den Erinnerungsspuren der Realität darüber entschied.
Die motorische Abfuhr, die während der Herrschaft des Lustprinzips zur Entlastung des seelischen Apparats von Reizzuwächsen gedient hatte und dieser Aufgabe durch ins Innere des Körpers gesandte Innervationen (Mimik, Affektäußerungen) nachgekommen war, erhielt jetzt eine neue Funktion, indem sie zur zweckmäßigen Veränderung der Realität verwendet wurde. Sie wandelte sich zum Handeln.
Die notwendig gewordene Aufhaltung der motorischen Abfuhr (des Handelns) wurde durch den Denkprozeß besorgt, welcher sich aus dem Vorstellen herausbildete. Das Denken wurde mit Eigenschaften ausgestattet, welche dem seelischen Apparat das Ertragen der erhöhten Reizspannung während des Aufschubs der Abfuhr ermöglichten. Es ist im wesentlichen ein Probehandeln mit Verschiebung kleinerer Besetzungsquantitäten, unter geringer Verausgabung (Abfuhr) derselben. Dazu war eine Überführung der frei verschiebbaren Besetzungen in gebundene erforderlich, und eine solche wurde mittels einer Niveauerhöhung des ganzen Besetzungsvorganges erreicht. Das Denken war wahrscheinlich ursprünglich unbewußt, insoweit es sich über das bloße Vorstellen erhob und sich den Relationen der Objekteindrücke zuwendete, und erhielt weitere für das Bewußtsein wahrnehmbare Qualitäten erst durch die Bindung an die Wortreste.
2) Eine allgemeine Tendenz unseres seelischen Apparats, die man auf das ökonomische Prinzip der Aufwandersparnis zurückführen kann, scheint sich in der Zähigkeit des Festhaltens an den zur Verfügung stehenden Lustquellen und in der Schwierigkeit des Verzichts auf dieselben zu äußern. Mit der Einsetzung des Realitätsprinzips wurde eine Art Denktätigkeit abgespalten, die von der Realitätsprüfung frei gehalten und allein dem Lustprinzip unterworfen blieb [Fußnote]Ähnlich wie eine Nation, deren Reichtum auf der Ausbeutung ihrer Bodenschätze beruht, doch ein bestimmtes Gebiet reserviert, das im Urzustande belassen und von den Veränderungen der Kultur verschont werden soll (Yellowstonepark).. Es ist dies das Phantasieren, welches bereits mit dem Spielen der Kinder beginnt und später als Tagträumen fortgesetzt die Anlehnung an reale Objekte aufgibt.
3) Die Ablösung des Lustprinzips durch das Realitätsprinzip mit den aus ihr hervorgehenden psychischen Folgen, die hier in einer schematisierenden Darstellung in einen einzigen Satz gebannt ist, vollzieht sich in Wirklichkeit nicht auf einmal und nicht gleichzeitig auf der ganzen Linie. Während aber diese Entwicklung an den Ichtrieben vor sich geht, lösen sich die Sexualtriebe in sehr bedeutsamer Weise von ihnen ab. Die Sexualtriebe benehmen sich zunächst autoerotisch, sie finden ihre Befriedigung am eigenen Leib und gelangen daher nicht in die Situation der Versagung, welche die Einsetzung des Realitätsprinzips erzwungen hat. Wenn dann später bei ihnen der Prozeß der Objektfindung beginnt, erfährt er alsbald eine lange Unterbrechung durch die Latenzzeit, welche die Sexualentwicklung bis zur Pubertät verzögert. Diese beiden Momente –; Autoerotismus und Latenzperiode –; haben zur Folge, daß der Sexualtrieb in seiner psychischen Ausbildung aufgehalten wird und weit länger unter der Herrschaft des Lustprinzips verbleibt, welcher er sich bei vielen Personen überhaupt niemals zu entziehen vermag.
Infolge dieser Verhältnisse stellt sich eine nähere Beziehung her zwischen dem Sexualtrieb und der Phantasie einerseits, den Ichtrieben und den Bewußtseinstätigkeiten anderseits. Diese Beziehung tritt uns bei Gesunden wie Neurotikern als eine sehr innige entgegen, wenngleich sie durch diese Erwägungen aus der genetischen Psychologie als eine sekundäre erkannt wird. Der fortwirkende Autoerotismus macht es möglich, daß die leichtere momentane und phantastische Befriedigung am Sexualobjekte so lange an Stelle der realen, aber Mühe und Aufschub erfordernden festgehalten wird. Die Verdrängung bleibt im Reiche des Phantasierens allmächtig; sie bringt es zustande, Vorstellungen in statu nascendi, ehe sie dem Bewußtsein auffallen können, zu hemmen, wenn deren Besetzung zur Unlustentbindung Anlaß geben kann. Dies ist die schwache Stelle unserer psychischen Organisation, die dazu benutzt werden kann, um bereits rationell gewordene Denkvorgänge wieder unter die Herrschaft des Lustprinzips zu bringen. Ein wesentliches Stück der psychischen Disposition zur Neurose ist demnach durch die verspätete Erziehung des Sexualtriebs zur Beachtung der Realität und des weiteren durch die Bedingungen, welche diese Verspätung ermöglichen, gegeben.
4) Wie das Lust-Ich nichts anderes kann als wünschen, nach Lustgewinn arbeiten und der Unlust ausweichen, so braucht das Real-Ich nichts anderes zu tun, als nach Nutzen zu streben und sich gegen Schaden zu sichern [Fußnote]Den Vorzug des Real-Ichs vor dem Lust-Ich drückt Bernard Shaw treffend in den Worten aus: » To be able to choose the line of greatest advantage instead of yielding in the direction of least resistance.« ( Man and Superman; A Comedy and a Philosophy.). In Wirklichkeit bedeutet die Ersetzung des Lustprinzips durch das Realitätsprinzip keine Absetzung des Lustprinzips, sondern nur eine Sicherung desselben. Eine momentane, in ihren Folgen unsichere Lust wird aufgegeben, aber nur darum, um auf dem neuen Wege eine später kommende, gesicherte zu gewinnen. Doch ist der endopsychische Eindruck dieser Ersetzung ein so mächtiger gewesen, daß er sich in einem besonderen religiösen Mythus spiegelt. Die Lehre von der Belohnung im Jenseits für den –; freiwilligen oder aufgezwungenen –; Verzicht auf irdische Lüste ist nichts anderes als die mythische Projektion dieser psychischen Umwälzung. Die Religionen haben in konsequenter Verfolgung dieses Vorbildes den absoluten Lustverzicht im Leben gegen Versprechen einer Entschädigung in einem künftigen Dasein durchsetzen können; eine Überwindung des Lustprinzips haben sie auf diesem Wege nicht erreicht. Am ehesten gelingt diese Überwindung der Wissenschaft, die aber auch intellektuelle Lust während der Arbeit bietet und endlichen praktischen Gewinn verspricht.
5) Die Erziehung kann ohne weitere Bedenken als Anregung zur Überwindung des Lustprinzips, zur Ersetzung desselben durch das Realitätsprinzip beschrieben werden; sie will also jenem das Ich betreffenden Entwicklungsprozeß eine Nachhilfe bieten, bedient sich zu diesem Zwecke der Liebesprämien von Seiten der Erzieher und schlägt darum fehl, wenn das verwöhnte Kind glaubt, daß es diese Liebe ohnedies besitzt und ihrer unter keinen Umständen verlustig werden kann.
6) Die Kunst bringt auf einem eigentümlichen Weg eine Versöhnung der beiden Prinzipien zustande. Der Künstler ist ursprünglich ein Mensch, welcher sich von der Realität abwendet, weil er sich mit dem von ihr zunächst geforderten Verzicht auf Triebbefriedigung nicht befreunden kann und seine erotischen und ehrgeizigen Wünsche im Phantasieleben gewähren läßt. Er findet aber den Rückweg aus dieser Phantasiewelt zur Realität, indem er dank besonderer Begabungen seine Phantasien zu einer neuen Art von Wirklichkeiten gestaltet, die von den Menschen als wertvolle Abbilder der Realität zur Geltung zugelassen werden. Er wird so auf eine gewisse Weise wirklich der Held, König, Schöpfer, Liebling, der er werden wollte, ohne den gewaltigen Umweg über die wirkliche Veränderung der Außenwelt einzuschlagen. Er kann dies aber nur darum erreichen, weil die anderen Menschen die nämliche Unzufriedenheit mit dem real erforderlichen Verzicht verspüren wie er selbst, weil diese bei der Ersetzung des Lustprinzips durch das Realitätsprinzip resultierende Unzufriedenheit selbst ein Stück der Realität ist [Fußnote]Vgl. Ähnliches bei O. Rank (1907)..
7) Während das Ich die Umwandlung vom Lust-Ich zum Real-Ich durchmacht, erfahren die Sexualtriebe jene Veränderungen, die sie vom anfänglichen Autoerotismus durch verschiedene Zwischenphasen zur Objektliebe im Dienste der Fortpflanzungsfunktion führen. Wenn es richtig ist, daß jede Stufe dieser beiden Entwicklungsgänge zum Sitz einer Disposition für spätere neurotische Erkrankung werden kann, liegt es nahe, die Entscheidung über die Form der späteren Erkrankung (die Neurosenwahl) davon abhängig zu machen, in welcher Phase der Ich- und der Libidoentwicklung die disponierende Entwicklungshemmung eingetroffen ist. Die noch nicht studierten zeitlichen Charaktere der beiden Entwicklungen, deren mögliche Verschiebung gegeneinander, kommen so zu unvermuteter Bedeutung.
8) Der befremdendste Charakter der unbewußten (verdrängten) Vorgänge, an den sich jeder Untersucher nur mit großer Selbstüberwindung gewöhnt, ergibt sich daraus, daß bei ihnen die Realitätsprüfung nichts gilt, die Denkrealität gleichgesetzt wird der äußeren Wirklichkeit, der Wunsch der Erfüllung, dem Ereignis, wie es sich aus der Herrschaft des alten Lustprinzips ohneweiters ableitet. Darum wird es auch so schwer, unbewußte Phantasien von unbewußt gewordenen Erinnerungen zu unterscheiden. Man lasse sich aber nie dazu verleiten, die Realitätswertung in die verdrängten psychischen Bildungen einzutragen und etwa Phantasien darum für die Symptombildung geringzuschätzen, weil sie eben keine Wirklichkeiten sind, oder ein neurotisches Schuldgefühl anderswoher abzuleiten, weil sich kein wirklich ausgeführtes Verbrechen nachweisen läßt. Man hat die Verpflichtung, sich jener Währung zu bedienen, die in dem Lande, das man durchforscht, eben die herrschende ist, in unserem Falle der neurotischen Währung. Man versuche z. B., einen Traum wie den folgenden zu lösen. Ein Mann, der einst seinen Vater während seiner langen und qualvollen Todeskrankheit gepflegt, berichtet, daß er in den nächsten Monaten nach dessen Ableben wiederholt geträumt habe: der Vater sei wieder am Leben und er spreche mit ihm wie sonst. Dabei habe er es aber äußerst schmerzlich empfunden, daß der Vater doch schon gestorben war und es nur nicht wußte. Kein anderer Weg führt zum Verständnis des widersinnig klingenden Traumes als die Anfügung »nach seinem Wunsch« oder »infolge seines Wunsches« nach den Worten »daß der Vater doch gestorben war« und der Zusatz »daß er es wünschte« zu den letzten Worten. Der Traumgedanke lautet dann: Es sei eine schmerzliche Erinnerung für ihn, daß er dem Vater den Tod (als Erlösung) wünschen mußte, als er noch lebte, und wie schrecklich, wenn der Vater dies geahnt hätte. Es handelt sich dann um den bekannten Fall der Selbstvorwürfe nach dem Verlust einer geliebten Person, und der Vorwurf greift in diesem Beispiel auf die infantile Bedeutung des Todeswunsches gegen den Vater zurück.
Die Mängel dieses kleinen, mehr vorbereitenden als ausführenden Aufsatzes sind vielleicht nur zum geringen Anteil entschuldigt, wenn ich sie für unvermeidlich ausgebe. In den wenigen Sätzen über die psychischen Folgen der Adaptierung an das Realitätsprinzip mußte ich Meinungen andeuten, die ich lieber noch zurückgehalten hätte und deren Rechtfertigung gewiß keine kleine Mühe kosten wird. Doch will ich hoffen, daß es wohlwollenden Lesern nicht entgehen wird, wo auch in dieser Arbeit die Herrschaft des Realitätsprinzips beginnt.
Goethe-Preis (1930)
Brief an Dr. Alfons Paquet
Ich bin durch öffentliche Ehrungen nicht verwöhnt worden und habe mich darum so eingerichtet, daß ich solche entbehren konnte. Ich mag aber nicht bestreiten, daß mich die Verleihung des Goethe-Preises der Stadt Frankfurt sehr erfreut hat. Es ist etwas an ihm, was die Phantasie besonders erwärmt und eine seiner Bestimmungen räumt die Demütigung weg, die sonst durch solche Auszeichnungen mitbedingt wird.
Für Ihren Brief habe ich Ihnen besonderen Dank zu sagen, er hat mich ergriffen und verwundert. Von der liebenswürdigen Vertiefung in den Charakter meiner Arbeit abzusehen, habe ich doch nie zuvor die geheimen persönlichen Absichten derselben mit solcher Klarheit erkannt gefunden wie von Ihnen und hätte Sie gern gefragt, woher Sie es wissen.
Leider erfahre ich aus Ihrem Brief an meine Tochter, daß ich Sie in nächster Zeit nicht sehen soll, und Aufschub ist in meinen Lebenszeiten immerhin bedenklich. Natürlich bin ich gern bereit, den von Ihnen angekündigten Herrn (Dr. Michel) zu empfangen.
Zur Feier nach Frankfurt kann ich leider nicht kommen, ich bin zu gebrechlich für diese Unternehmung. Die Festgesellschaft wird nichts dadurch verlieren, meine Tochter Anna ist gewiß angenehmer anzusehen und anzuhören als ich. Sie soll einige Sätze vorlesen, die Goethes Beziehungen zur Psychoanalyse behandeln und die Analytiker selbst gegen den Vorwurf in Schutz nehmen, daß sie durch analytische Versuche an ihm die dem Großen schuldige Ehrfurcht verletzt haben. Ich hoffe, daß es angeht, das mir gestellte Thema: »Die inneren Beziehungen des Menschen und Forschers zu Goethe« in solcher Weise umzubeugen, oder Sie würden noch so liebenswürdig sein, mir davon abzuraten.
Ansprache im Frankfurter Goethe-Haus
Meine Lebensarbeit war auf ein einziges Ziel eingestellt. Ich beobachtete die feineren Störungen der seelischen Leistung bei Gesunden und Kranken und wollte aus solchen Anzeichen erschließen –; oder, wenn Sie es lieber hören: erraten –;, wie der Apparat gebaut ist, der diesen Leistungen dient, und welche Kräfte in ihm zusammen- und gegeneinanderwirken. Was wir, ich, meine Freunde und Mitarbeiter, auf diesem Wege lernen konnten, erschien uns bedeutsam für den Aufbau einer Seelenkunde, die normale wie pathologische Vorgänge als Teile des nämlichen natürlichen Geschehens verstehen läßt.
Von solcher Einengung ruft mich Ihre mich überraschende Auszeichnung zurück. Indem sie die Gestalt des großen Universellen heraufbeschwört, der in diesem Hause geboren wurde, in diesen Räumen seine Kindheit erlebte, mahnt sie, sich gleichsam vor ihm zu rechtfertigen, wirft sie die Frage auf, wie er sich verhalten hätte, wenn sein für jede Neuerung der Wissenschaft aufmerksamer Blick auch auf die Psychoanalyse gefallen wäre.
An Vielseitigkeit kommt Goethe ja Leonardo da Vinci, dem Meister der Renaissance, nahe, der Künstler und Forscher war wie er. Aber Menschenbilder können sich nie wiederholen, es fehlt auch nicht an tiefgehenden Unterschieden zwischen den beiden Großen. In Leonardos Natur vertrug sich der Forscher nicht mit dem Künstler, er störte ihn und erdrückte ihn vielleicht am Ende. In Goethes Leben fanden beide Persönlichkeiten Raum nebeneinander, sie lösten einander zeitweise in der Vorherrschaft ab. Es liegt nahe, die Störung bei Leonardo mit jener Entwicklungshemmung zusammenzubringen, die alles Erotische und damit die Psychologie seinem Interesse entrückte. In diesem Punkt durfte Goethes Wesen sich freier entfalten.
Ich denke, Goethe hätte nicht, wie so viele unserer Zeitgenossen, die Psychoanalyse unfreundlichen Sinnes abgelehnt. Er war ihr selbst in manchen Stücken nahegekommen, hatte in eigener Einsicht vieles erkannt, was wir seither bestätigen konnten, und manche Auffassungen, die uns Kritik und Spott eingetragen haben, werden von ihm wie selbstverständlich vertreten. So war ihm z. B. die unvergleichliche Stärke der ersten affektiven Bindungen des Menschenkindes vertraut. Er feierte sie in der Zueignung der Faust-Dichtung in Worten, die wir für jede unserer Analysen wiederholen könnten:
»Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Versuch' ich wohl, euch diesmal festzuhalten?« — — — — — — — »Gleich einer alten, halbverklungnen Sage Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf.«
Von der stärksten Liebesanziehung, die er als reifer Mann erfuhr, gab er sich Rechenschaft, indem er der Geliebten zurief: »Ach, du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester oder meine Frau.«
Er stellte somit nicht in Abrede, daß diese unvergänglichen ersten Neigungen Personen des eigenen Familienkreises zum Objekt nehmen.
Den Inhalt des Traumlebens umschreibt Goethe mit den so stimmungsvollen Worten:
»Was von Menschen nicht gewußt Oder nicht bedacht, Durch das Labyrinth der Brust Wandelt in der Nacht.«
Hinter diesem Zauber erkennen wir die altehrwürdige, unbestreitbar richtige Aussage des Aristoteles, das Träumen sei die Fortsetzung unserer Seelentätigkeit in den Schlafzustand, vereint mit der Anerkennung des Unbewußten, die erst die Psychoanalyse hinzugefügt hat. Nur das Rätsel der Traumentstellung findet dabei keine Auflösung.
In seiner vielleicht erhabensten Dichtung, der Iphigenie, zeigt uns Goethe ein ergreifendes Beispiel einer Entsühnung, einer Befreiung der leidenden Seele von dem Druck der Schuld, und er läßt diese Katharsis sich vollziehen durch einen leidenschaftlichen Gefühlsausbruch unter dem wohltätigen Einfluß einer liebevollen Teilnahme. Ja, er hat sich selbst wiederholt in psychischer Hilfeleistung versucht, so an jenem Unglücklichen, der in den Briefen Kraft genannt wird, an dem Professor Plessing, von dem er in der Campagne in Frankreich erzählt, und das Verfahren, das er anwendete, geht über das Vorgehen der katholischen Beichte hinaus und berührt sich in merkwürdigen Einzelheiten mit der Technik unserer Psychoanalyse. Ein von Goethe als scherzhaft bezeichnetes Beispiel einer psychotherapeutischen Beeinflussung möchte ich hier ausführlich mitteilen, weil es vielleicht weniger bekannt und doch sehr charakteristisch ist. Aus einem Brief an Frau v. Stein (Nr. 1444 vom 5. September 1785):
»Gestern Abend habe ich ein psychologisches Kunststück gemacht. Die Herder war immer noch auf das Hypochondrischste gespannt über alles, was ihr im Carlsbad unangenehmes begegnet war. Besonders von ihrer Hausgenossin. Ich ließ mir alles erzählen und beichten, fremde Untaten und eigene Fehler mit den kleinsten Umständen und Folgen, und zuletzt absolvirte ich sie und machte ihr scherzhaft unter dieser Formel begreiflich, daß diese Dinge nun abgethan und in die Tiefe des Meeres geworfen seyen. Sie ward selbst lustig darüber und ist würklich kurirt.«
Den Eros hat Goethe immer hochgehalten, seine Macht nie zu verkleinern versucht, ist seinen primitiven oder selbst mutwilligen Äußerungen nicht minder achtungsvoll gefolgt wie seinen hochsublimierten und hat, wie mir scheint, seine Wesenseinheit durch alle seine Erscheinungsformen nicht weniger entschieden vertreten als vor Zeiten Plato. Ja, vielleicht ist es mehr als zufälliges Zusammentreffen, wenn er in den Wahlverwandtschaften eine Idee aus dem Vorstellungskreis der Chemie auf das Liebesleben anwendete, eine Beziehung, von der der Name selbst der Psychoanalyse zeugt.
Ich bin auf den Vorwurf vorbereitet, wir Analytiker hätten das Recht verwirkt, uns unter die Patronanz Goethes zu stellen, weil wir die ihm schuldige Ehrfurcht verletzt haben, indem wir die Analyse auf ihn selbst anzuwenden versuchten, den großen Mann zum Objekt der analytischen Forschung erniedrigten. Ich aber bestreite zunächst, daß dies eine Erniedrigung beabsichtigt oder bedeutet.
Wir alle, die wir Goethe verehren, lassen uns doch ohne viel Sträuben die Bemühungen der Biographen gefallen, die sein Leben aus den vorhandenen Berichten und Aufzeichnungen wiederherstellen wollen. Was aber sollen uns diese Biographien leisten? Auch die beste und vollständigste könnte die beiden Fragen nicht beantworten, die allein wissenswert scheinen.
Sie würde das Rätsel der wunderbaren Begabung nicht aufklären, die den Künstler macht, und sie könnte uns nicht helfen, den Wert und die Wirkung seiner Werke besser zu erfassen. Und doch ist es unzweifelhaft, daß eine solche Biographie ein starkes Bedürfnis bei uns befriedigt. Wir verspüren dies so deutlich, wenn die Ungunst der historischen Überlieferung diesem Bedürfnis die Befriedigung versagt hat, z. B. im Falle Shakespeares. Es ist uns allen unleugbar peinlich, daß wir noch immer nicht wissen, wer die Komödien, Trauerspiele und Sonette Shakespeares verfaßt hat, ob wirklich der ungelehrte Sohn des Stratforder Kleinbürgers, der in London eine bescheidene Stellung als Schauspieler erreicht, oder doch eher der hochgeborene und feingebildete, leidenschaftlich unordentliche, einigermaßen deklassierte Aristokrat Edward de Vere, siebzehnter Earl of Oxford, erblicher Lord Great Chamberlain von England. Wie rechtfertigt sich aber ein solches Bedürfnis, von den Lebensumständen eines Mannes Kunde zu erhalten, wenn dessen Werke für uns so bedeutungsvoll geworden sind? Man sagt allgemein, es sei das Verlangen, uns einen solchen Mann auch menschlich näherzubringen. Lassen wir das gelten; es ist also das Bedürfnis, affektive Beziehungen zu solchen Menschen zu gewinnen, sie den Vätern, Lehrern, Vorbildern anzureihen, die wir gekannt oder deren Einfluß wir bereits erfahren haben, unter der Erwartung, daß ihre Persönlichkeiten ebenso großartig und bewundernswert sein werden wie die Werke, die wir von ihnen besitzen.
Immerhin wollen wir zugestehen, daß noch ein anderes Motiv im Spiele ist. Die Rechtfertigung des Biographen enthält auch ein Bekenntnis. Nicht herabsetzen zwar will der Biograph den Heros, sondern ihn uns näherbringen. Aber das heißt doch die Distanz, die uns von ihm trennt, verringern, wirkt doch in der Richtung einer Erniedrigung. Und es ist unvermeidlich, wenn wir vom Leben eines Großen mehr erfahren, werden wir auch von Gelegenheiten hören, in denen er es wirklich nicht besser gemacht hat als wir, uns menschlich wirklich nahegekommen ist. Dennoch meine ich, wir erklären die Bemühungen der Biographik für legitim. Unsere Einstellung zu Vätern und Lehrern ist nun einmal eine ambivalente, denn unsere Verehrung für sie deckt regelmäßig eine Komponente von feindseliger Auflehnung. Das ist ein psychologisches Verhängnis, läßt sich ohne gewaltsame Unterdrückung der Wahrheit nicht ändern und muß sich auf unser Verhältnis zu den großen Männern, deren Lebensgeschichte wir erforschen wollen, fortsetzen.
Wenn die Psychoanalyse sich in den Dienst der Biographik begibt, hat sie natürlich das Recht, nicht härter behandelt zu werden als diese selbst. Die Psychoanalyse kann manche Aufschlüsse bringen, die auf anderen Wegen nicht zu erhalten sind, und so neue Zusammenhänge aufzeigen in dem Webermeisterstück, das sich zwischen den Triebanlagen, den Erlebnissen und den Werken eines Künstlers ausbreitet. Da es eine der hauptsächlichsten Funktionen unseres Denkens ist, den Stoff der Außenwelt psychisch zu bewältigen, meine ich, man müßte der Psychoanalyse danken, wenn sie auf den großen Mann angewendet zum Verständnis seiner großen Leistung beiträgt. Aber ich gestehe, im Falle von Goethe haben wir es noch nicht weit gebracht. Das rührt daher, daß Goethe nicht nur als Dichter ein großer Bekenner war, sondern auch trotz der Fülle autobiographischer Aufzeichnungen ein sorgsamer Verhüller. Wir können nicht umhin, hier der Worte Mephistos zu gedenken:
»Das Beste, was du wissen kannst, Darfst du den Buben doch nicht sagen.«
Hysterische Phantasien und ihre Beziehung zur Bisexualität (1908)
Allgemein bekannt sind die Wahndichtungen der Paranoiker, welche die Größe und die Leiden des eigenen Ichs zum Inhalt haben und in ganz typischen, fast monotonen Formen auftreten. Durch zahlreiche Mitteilungen sind uns ferner die sonderbaren Veranstaltungen bekannt geworden, unter denen gewisse Perverse ihre sexuelle Befriedigung –; in der Idee oder Realität –; in Szene setzen. Dagegen dürfte es manchen wie eine Neuheit klingen, zu erfahren, daß ganz analoge psychische Bildungen bei allen Psychoneurosen, speziell bei Hysterie, regelmäßig vorkommen, und daß diese –; die sogenannten hysterischen Phantasien –; wichtige Beziehungen zur Verursachung der neurotischen Symptome erkennen lassen.
Gemeinsame Quelle und normales Vorbild all dieser phantastischen Schöpfungen sind die sogenannten Tagträume der Jugend, die in der Literatur bereits eine gewisse, obwohl noch nicht zureichende, Beachtung gefunden haben [Fußnote]Vgl. Breuer und Freud (1895), P. Janet (1898, Bd. 1), Havelock Ellis (deutsch von Kölscher, 1900), Freud (1900 a), Pick (1896).. Bei beiden Geschlechtern vielleicht gleich häufig, scheinen sie bei Mädchen und Frauen durchweg erotischer, bei Männern erotischer oder ehrgeiziger Natur zu sein. Doch darf man die Bedeutung des erotischen Moments auch bei Männern nicht in die zweite Linie rücken wollen; bei näherem Eingehen in den Tagtraum des Mannes ergibt sich gewöhnlich, daß all diese Heldentaten nur verrichtet, alle Erfolge nur errungen werden, um einem Weib zu gefallen und von ihr anderen Männern vorgezogen zu werden [Fußnote]Ähnlich urteilt hierüber H. Ellis, loc. cit., S. 185 f.. Diese Phantasien sind Wunschbefriedigungen, aus der Entbehrung und der Sehnsucht hervorgegangen; sie führen den Namen »Tagträume« mit Recht, denn sie geben den Schlüssel zum Verständnis der nächtlichen Träume, in denen nichts anderes als solche komplizierte, entstellte und von der bewußten psychischen Instanz mißverstandene Tagesphantasien den Kern der Traumbildung herstellen [Fußnote]Vgl. Freud: Traumdeutung (1900 a), Kapitel VI..
Diese Tagträume werden mit großem Interesse besetzt, sorgfältig gepflegt und meist sehr schamhaft behütet, als ob sie zu den intimsten Gütern der Persönlichkeit zählten. Auf der Straße erkennt man aber leicht den im Tagtraum Begriffenen an einem plötzlichen, wie abwesenden Lächeln, am Selbstgespräch oder an der laufartigen Beschleunigung des Ganges, womit er den Höhepunkt der erträumten Situation bezeichnet. –; Alle hysterischen Anfälle, die ich bisher untersuchen konnte, erwiesen sich nun als solche unwillkürlich hereinbrechende Tagträume. Die Beobachtung läßt nämlich keinen Zweifel darüber, daß es solche Phantasien ebensowohl unbewußt gibt wie bewußt, und sobald dieselben zu unbewußten geworden sind, können sie auch pathogen werden, d. h. sich in Symptomen und Anfällen ausdrücken. Unter günstigen Umständen kann man eine solche unbewußte Phantasie noch mit dem Bewußtsein erhaschen. Eine meiner Patientinnen, die ich auf ihre Phantasien aufmerksam gemacht hatte, erzählte mir, sie habe sich einmal auf der Straße plötzlich in Tränen gefunden, und bei raschem Besinnen, worüber sie eigentlich weine, sei sie der Phantasie habhaft geworden, daß sie mit einem stadtbekannten (ihr aber persönlich unbekannten) Klaviervirtuosen ein zärtliches Verhältnis eingegangen sei, ein Kind von ihm bekommen habe (sie war kinderlos) und dann mit dem Kinde von ihm im Elend verlassen worden sei. An dieser Stelle des Romanes brachen ihre Tränen hervor.
Die unbewußten Phantasien sind entweder von jeher unbewußt gewesen, im Unbewußten gebildet worden oder, was der häufigere Fall ist, sie waren einmal bewußte Phantasien, Tagträume, und sind dann mit Absicht vergessen worden, durch die »Verdrängung« ins Unbewußte geraten. Ihr Inhalt ist dann entweder der nämliche geblieben, oder er hat Abänderungen erfahren, so daß die jetzt unbewußte Phantasie einen Abkömmling der einst bewußten darstellt. Die unbewußte Phantasie steht nun in einer sehr wichtigen Beziehung zum Sexualleben der Person; sie ist nämlich identisch mit der Phantasie, welche derselben während einer Periode von Masturbation zur sexuellen Befriedigung gedient hat. Der masturbatorische (im weitesten Sinne: onanistische) Akt setzte sich damals aus zwei Stücken zusammen, aus der Hervorrufung der Phantasie und aus der aktiven Leistung zur Selbstbefriedigung auf der Höhe derselben. Diese Zusammensetzung ist bekanntlich selbst eine Verlötung [Fußnote]Vgl. Freud: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905 d).. Ursprünglich war die Aktion eine rein autoerotische Vornahme zur Lustgewinnung von einer bestimmten, erogen zu nennenden Körperstelle. Später verschmolz diese Aktion mit einer Wunschvorstellung aus dem Kreise der Objektliebe und diente zur teilweisen Realisierung der Situation, in welcher diese Phantasie gipfelte. Wenn dann die Person auf diese Art der masturbatorisch-phantastischen Befriedigung verzichtet, so wird die Aktion unterlassen, die Phantasie aber wird aus einer bewußten zu einer unbewußten. Tritt keine andere Weise der sexuellen Befriedigung ein, verbleibt die Person in der Abstinenz und gelingt es ihr nicht, ihre Libido zu sublimieren, das heißt die sexuelle Erregung auf ein höheres Ziel abzulenken, so ist jetzt die Bedingung dafür gegeben, daß die unbewußte Phantasie aufgefrischt werde, wuchere und sich mit der ganzen Macht des Liebesbedürfnisses wenigstens in einem Stück ihres Inhalts als Krankheitssymptom durchsetze.
Für eine ganze Reihe von hysterischen Symptomen sind solcher Art die unbewußten Phantasien die nächsten psychischen Vorstufen. Die hysterischen Symptome sind nichts anderes als die durch »Konversion« zur Darstellung gebrachten unbewußten Phantasien, und insofern es somatische Symptome sind, werden sie häufig genug aus dem Kreise der nämlichen Sexualempfindungen und motorischen Innervationen entnommen, welche ursprünglich die damals noch bewußte Phantasie begleitet hatten. Auf diese Weise wird die Onanieentwöhnung eigentlich rückgängig gemacht und das Endziel des ganzen pathologischen Vorganges, die Herstellung der seinerzeitigen primären Sexualbefriedigung, wird dabei zwar niemals vollkommen, aber immer in einer Art von Annäherung erreicht.
Das Interesse desjenigen, der die Hysterie studiert, wendet sich alsbald von den Symptomen derselben ab und den Phantasien zu, aus welchen erstere hervorgehen. Die Technik der Psychoanalyse gestattet es, von den Symptomen aus diese unbewußten Phantasien zunächst zu erraten und dann im Kranken bewußt werden zu lassen. Auf diesem Wege ist nun gefunden worden, daß die unbewußten Phantasien der Hysteriker den bewußt durchgeführten Befriedigungssituationen der Perversen inhaltlich völlig entsprechen, und wenn man um Beispiele solcher Art verlegen ist, braucht man sich nur an die welthistorischen Veranstaltungen der römischen Cäsaren zu erinnern, deren Tollheit natürlich nur durch die uneingeschränkte Machtfülle der Phantasiebildner bedingt ist. Die Wahnbildungen der Paranoiker sind ebensolche, aber unmittelbar bewußt gewordene Phantasien, die von der masochistisch-sadistischen Komponente des Sexualtriebes getragen werden und gleichfalls in gewissen unbewußten Phantasien der Hysterischen ihre vollen Gegenstücke finden können. Bekannt ist übrigens der auch praktisch bedeutsame Fall, daß Hysteriker ihre Phantasien nicht als Symptome, sondern in bewußter Realisierung zum Ausdrucke bringen und somit Attentate, Mißhandlungen, sexuelle Aggressionen fingieren und in Szene setzen.
Alles, was man über die Sexualität der Psychoneurotiker erfahren kann, wird auf diesem Wege der psychoanalytischen Untersuchung, der von den aufdringlichen Symptomen zu den verborgenen unbewußten Phantasien führt, ermittelt, darunter also auch das Faktum, dessen Mitteilung in den Vordergrund dieser kleinen vorläufigen Veröffentlichung gerückt werden soll.
Wahrscheinlich infolge der Schwierigkeiten, die dem Bestreben der unbewußten Phantasien, sich Ausdruck zu verschaffen, im Wege stehen, ist das Verhältnis der Phantasien zu den Symptomen kein einfaches, sondern ein mehrfach kompliziertes [Fußnote]Das nämliche gilt für die Beziehung zwischen den »latenten« Traumgedanken und den Elementen des »manifesten« Trauminhaltes. Siehe den Abschnitt über die »Traumarbeit« in des Verfassers Traumdeutung.. In der Regel, das heißt bei voller Entwicklung und nach längerem Bestände der Neurose, entspricht ein Symptom nicht einer einzigen unbewußten Phantasie, sondern einer Mehrzahl von solchen, und zwar nicht in willkürlicher Weise, sondern in gesetzmäßiger Zusammensetzung. Zu Beginn des Krankheitsfalles werden wohl nicht alle diese Komplikationen entwickelt sein.
Dem allgemeinen Interesse zuliebe überschreite ich hier den Zusammenhang dieser Mitteilung und füge eine Reihe von Formeln ein, die sich bemühen, das Wesen der hysterischen Symptome fortschreitend zu erschöpfen. Sie widersprechen einander nicht, sondern entsprechen teils vollständigeren und schärferen Fassungen, teils der Anwendung verschiedener Gesichtspunkte.
1) Das hysterische Symptom ist das Erinnerungssymbol gewisser wirksamer (traumatischer) Eindrücke und Erlebnisse.
2) Das hysterische Symptom ist der durch »Konversion« erzeugte Ersatz für die assoziative Wiederkehr dieser traumatischen Erlebnisse.
3) Das hysterische Symptom ist –; wie auch andere psychische Bildungen –; Ausdruck einer Wunscherfüllung.
4) Das hysterische Symptom ist die Realisierung einer der Wunscherfüllung dienenden, unbewußten Phantasie.
5) Das hysterische Symptom dient der sexuellen Befriedigung und stellt einen Teil des Sexuallebens der Person dar (entsprechend einer der Komponenten ihres Sexualtriebs).
6) Das hysterische Symptom entspricht der Wiederkehr einer Weise der Sexualbefriedigung, die im infantilen Leben real gewesen und seither verdrängt worden ist.
7) Das hysterische Symptom entsteht als Kompromiß aus zwei gegensätzlichen Affekt- oder Triebregungen, von denen die eine einen Partialtrieb oder eine Komponente der Sexualkonstitution zum Ausdrucke zu bringen, die andere dieselbe zu unterdrücken bemüht ist.
8) Das hysterische Symptom kann die Vertretung verschiedener unbewußter, nicht sexueller Regungen übernehmen, einer sexuellen Bedeutung aber nicht entbehren.
Unter diesen verschiedenen Bestimmungen ist es die siebente, welche das Wesen des hysterischen Symptoms als Realisierung einer unbewußten Phantasie am erschöpfendsten zum Ausdrucke bringt und mit der achten die Bedeutung des sexuellen Moments in richtiger Weise würdigt. Manche der vorhergehenden Formeln sind als Vorstufen in dieser Formel enthalten.
Infolge dieses Verhältnisses zwischen Symptomen und Phantasien gelingt es unschwer, von der Psychoanalyse der Symptome zur Kenntnis der das Individuum beherrschenden Komponenten des Sexualtriebes zu gelangen, wie ich es in den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie ausgeführt habe. Diese Untersuchung ergibt aber für manche Fälle ein unerwartetes Resultat. Sie zeigt, daß für viele Symptome die Auflösung durch eine unbewußte sexuelle Phantasie oder durch eine Reihe von Phantasien, von denen eine, die bedeutsamste und ursprünglichste, sexueller Natur ist, nicht genügt, sondern daß man zur Lösung des Symptoms zweier sexueller Phantasien bedarf, von denen die eine männlichen, die andere weiblichen Charakter hat, so daß eine dieser Phantasien einer homosexuellen Regung entspringt. Der in Formel 7 ausgesprochene Satz wird durch diese Neuheit nicht berührt, so daß ein hysterisches Symptom notwendigerweise einem Kompromiß zwischen einer libidinösen und einer Verdrängungsregung entspricht, nebstbei aber einer Vereinigung zweier libidinöser Phantasien von entgegengesetztem Geschlechtscharakter entsprechen kann.
Ich enthalte mich, Beispiele für diesen Satz zu geben. Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß kurze, zu einem Extrakt zusammengedrängte Analysen niemals den beweisenden Eindruck machen können, wegen dessen man sie herangezogen hat. Die Mitteilung voll analysierter Krankheitsfälle muß aber für einen anderen Ort aufgespart werden.
Ich begnüge mich also damit, den Satz aufzustellen und seine Bedeutung zu erläutern:
9) Ein hysterisches Symptom ist der Ausdruck einerseits einer männlichen, anderseits einer weiblichen unbewußten sexuellen Phantasie.
Ich bemerke ausdrücklich, daß ich diesem Satze eine ähnliche Allgemeingültigkeit nicht zusprechen kann, wie ich sie für die anderen Formeln in Anspruch genommen habe. Er trifft, soviel ich sehen kann, weder für alle Symptome eines Falles, noch für alle Fälle zu. Es ist im Gegenteile nicht schwer, Fälle aufzuzeigen, bei denen die entgegengesetztgeschlechtlichen Regungen gesonderten symptomatischen Ausdruck gefunden haben, so daß sich die Symptome der Hetero- und der Homosexualität so scharf voneinander scheiden lassen, wie die hinter ihnen verborgenen Phantasien. Doch ist das in der neunten Formel behauptete Verhältnis häufig genug, und wo es sich findet, bedeutsam genug, um eine besondere Hervorhebung zu verdienen. Es scheint mir die höchste Stufe der Kompliziertheit, zu der sich die Determinierung eines hysterischen Symptoms erheben kann, zu bedeuten, und ist also nur bei langem Bestände einer Neurose und bei großer Organisationsarbeit innerhalb derselben zu erwarten [Fußnote]I. Sadger, der kürzlich den in Rede stehenden Satz durch eigene Psychoanalysen selbständig aufgefunden hat (1907), tritt allerdings für dessen allgemeine Gültigkeit ein..
Die in immerhin zahlreichen Fällen nachweisbare bisexuelle Bedeutung hysterischer Symptome ist gewiß ein interessanter Beleg für die von mir aufgestellte Behauptung [Fußnote]Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie., daß die supponierte bisexuelle Anlage des Menschen sich bei den Psychoneurotikern durch Psychoanalyse besonders deutlich erkennen läßt. Ein durchaus analoger Vorgang aus dem nämlichen Gebiete ist es, wenn der Masturbant in seinen bewußten Phantasien sich sowohl in den Mann als auch in das Weib der vorgestellten Situation einzufühlen versucht, und weitere Gegenstücke zeigen gewisse hysterische Anfälle, in denen die Kranke gleichzeitig beide Rollen der zugrunde liegenden sexuellen Phantasie spielt, also zum Beispiel wie in einem Falle meiner Beobachtung, mit der einen Hand das Gewand an den Leib preßt (als Weib), mit der anderen es abzureißen sucht (als Mann). Diese widerspruchsvolle Gleichzeitigkeit bedingt zum guten Teile die Unverständlichkeit der doch sonst im Anfalle so plastisch dargestellten Situation und eignet sich also vortrefflich zur Verhüllung der wirksamen unbewußten Phantasie.
Bei der psychoanalytischen Behandlung ist es sehr wichtig, daß man auf die bisexuelle Bedeutung eines Symptomes vorbereitet sei. Man braucht sich dann nicht zu verwundern und nicht irre zu werden, wenn ein Symptom anscheinend ungemindert fortbesteht, obwohl man die eine seiner sexuellen Bedeutungen bereits gelöst hat. Es stützt sich dann noch auf die vielleicht nicht vermutete entgegengesetztgeschlechtliche. Auch kann man bei der Behandlung solcher Fälle beobachten, wie der Kranke sich der Bequemlichkeit bedient, während der Analyse der einen sexuellen Bedeutung mit seinen Einfällen fortwährend in das Gebiet der konträren Bedeutung, wie auf ein benachbartes Geleise, auszuweichen.
Konstruktionen in der Analyse
(1937)
I
Ein sehr verdienter Forscher, dem ich es immer hoch angerechnet, daß er der Psychoanalyse Gerechtigkeit erwiesen zu einer Zeit, da die meisten anderen sich über diese Verpflichtung hinaussetzten, hat doch einmal eine ebenso kränkende wie ungerechte Äußerung über unsere analytische Technik getan. Er sagte, wenn wir einem Patienten unsere Deutungen vortragen, verfahren wir gegen ihn nach dem berüchtigten Prinzip: Heads I win, tails you lose. Das heißt, wenn er uns zustimmt, dann ist es eben recht; wenn er aber widerspricht, dann ist es nur ein Zeichen seines Widerstandes, gibt uns also auch recht. Auf diese Weise behalten wir immer recht gegen die hilflose arme Person, die wir analysieren, gleichgiltig wie sie sich gegen unsere Zumutungen verhalten mag. Da es nun richtig ist, daß ein »Nein« unseres Patienten uns im allgemeinen nicht bestimmt, unsere Deutung als unrichtig aufzugeben, ist eine solche Entlarvung unserer Technik den Gegnern der Analyse sehr willkommen gewesen. Es verlohnt sich darum, eingehend darzustellen, wie wir das »Ja« und das »Nein« des Patienten während der analytischen Behandlung, den Ausdruck seiner Zustimmung und seines Widerspruchs, einzuschätzen pflegen. Freilich wird bei dieser Rechtfertigung kein ausübender Analytiker etwas erfahren, was er nicht schon weiß.
Es ist bekanntlich die Absicht der analytischen Arbeit, den Patienten dahin zu bringen, daß er die Verdrängungen – im weitesten Sinne verstanden – seiner Frühentwicklung wieder aufhebe, um sie durch Reaktionen zu ersetzen, wie sie einem Zustand von psychischer Gereiftheit entsprechen würden. Zu diesem Zwecke soll er bestimmte Erlebnisse und die durch sie hervorgerufenen Affektregungen wieder erinnern, die derzeit bei ihm vergessen sind. Wir wissen, daß seine gegenwärtigen Symptome und Hemmungen die Folgen solcher Verdrängungen, also der Ersatz für jenes Vergessene sind. Was für Materialien stellt er uns zur Verfügung, durch deren Ausnützung wir ihn auf den Weg führen können, die verlorenen Erinnerungen wiederzugewinnen? Mancherlei, Bruchstücke dieser Erinnerungen in seinen Träumen, an sich von unvergleichlichem Wert, aber in der Regel schwer entstellt durch alle die Faktoren, die an der Traumbildung Anteil haben; Einfälle, die er produziert, wenn er sich der »freien Assoziation« überläßt, aus denen wir Anspielungen auf die verdrängten Erlebnisse und Abkömmlinge der unterdrückten Affektregungen sowie der Reaktionen gegen sie herauszufinden vermögen; endlich Andeutung von Wiederholungen der dem Verdrängten zugehörigen Affekte in wichtigeren oder geringfügigen Handlungen des Patienten innerhalb wie außerhalb der analytischen Situation. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß das Verhältnis der Übertragung, das sich zum Analytiker herstellt, besonders geeignet ist, um die Wiederkehr solcher Affektbeziehungen zu begünstigen. Aus diesem Rohstoff – sozusagen – sollen wir das Gewünschte herstellen.
Das Gewünschte ist ein zuverlässiges und in allen wesentlichen Stücken vollständiges Bild der vergessenen Lebensjahre des Patienten. Hier werden wir aber daran gemahnt, daß die analytische Arbeit aus zwei ganz verschiedenen Stücken besteht, daß sie sich auf zwei gesonderten Schauplätzen vollzieht, an zwei Personen vor sich geht, von denen jedem eine andere Aufgabe zugewiesen ist. Man fragt sich einen Augenblick lang, warum man auf diese grundlegende Tatsache nicht längst aufmerksam gemacht wurde, aber man sagt sich sofort, daß einem hier nichts vorenthalten wurde, daß es sich um ein allgemein bekanntes, sozusagen selbstverständliches Faktum handelt, das nur hier in einer besonderen Absicht herausgehoben und für sich gewürdigt wird. Wir wissen alle, der Analysierte soll dazu gebracht werden, etwas von ihm Erlebtes und Verdrängtes zu erinnern, und die dynamischen Bedingungen dieses Vorgangs sind so interessant, daß das andere Stück der Arbeit, die Leistung des Analytikers, dagegen in den Hintergrund rückt. Der Analytiker hat von dem, worauf es ankommt, nichts erlebt und nichts verdrängt; seine Aufgabe kann es nicht sein, etwas zu erinnern. Was ist also seine Aufgabe? Er hat das Vergessene aus den Anzeichen, die es hinterlassen, zu erraten oder, richtiger ausgedrückt, zu konstruieren. Wie, wann und mit welchen Erläuterungen er seine Konstruktionen dem Analysierten mitteilt, das stellt die Verbindung her zwischen beiden Stücken der analytischen Arbeit, zwischen seinem Anteil und dem des Analysierten.
Seine Arbeit der Konstruktion oder, wenn man es so lieber hört, der Rekonstruktion, zeigt eine weitgehende Übereinstimmung mit der des Archäologen, der eine zerstörte und verschüttete Wohnstätte oder ein Bauwerk der Vergangenheit ausgräbt. Sie ist eigentlich damit identisch, nur daß der Analytiker unter besseren Bedingungen arbeitet, über mehr Hilfsmaterial verfügt, weil er sich um etwas noch Lebendes bemüht, nicht um ein zerstörtes Objekt, und vielleicht auch noch aus einem anderen Grunde. Aber wie der Archäologe aus stehengebliebenen Mauerresten die Wandungen des Gebäudes aufbaut, aus Vertiefungen im Boden die Anzahl und Stellung von Säulen bestimmt, aus den im Schutt gefundenen Resten die einstigen Wandverzierungen und Wandgemälde wiederherstellt, genauso geht der Analytiker vor, wenn er seine Schlüsse aus Erinnerungsbrocken, Assoziationen und aktiven Äußerungen des Analysierten zieht. Beiden bleibt das Recht zur Rekonstruktion durch Ergänzung und Zusammenfügung der erhaltenen Reste unbestritten. Auch manche Schwierigkeiten und Fehlerquellen sind für beide Fälle die nämlichen. Eine der heikelsten Aufgaben der Archäologie ist bekanntlich die Bestimmung des relativen Alters eines Fundes, und wenn ein Objekt in einer bestimmten Schicht zum Vorschein kommt, bleibt es oft zu entscheiden, ob es dieser Schicht angehört oder durch eine spätere Störung in die Tiefe geraten ist. Es ist leicht zu erraten, was bei den analytischen Konstruktionen diesem Zweifel entspricht.
Wir haben gesagt, der Analytiker arbeite unter günstigeren Verhältnissen als der Archäolog, weil er auch über Material verfügt, zu dem die Ausgrabungen kein Gegenstück bringen können, z. B. die Wiederholungen von aus der Frühzeit stammenden Reaktionen und alles, was durch die Übertragung an solchen Wiederholungen aufgezeigt wird. Außerdem kommt aber in Betracht, daß der Ausgräber es mit zerstörten Objekten zu tun hat, von denen große und wichtige Stücke ganz gewiß verlorengegangen sind, durch mechanische Gewalt, Feuer und Plünderung. Keiner Bemühung kann es gelingen, sie aufzufinden, um sie mit den erhaltenen Resten zusammenzusetzen. Man ist einzig und allein auf die Rekonstruktion angewiesen, die sich darum oft genug nicht über eine gewisse Wahrscheinlichkeit erheben kann. Anders ist es mit dem psychischen Objekt, dessen Vorgeschichte der Analytiker erheben will. Hier trifft regelmäßig zu, was sich beim archäologischen Objekt nur in glücklichen Ausnahmsfällen ereignet hat wie in Pompeji und mit dem Grab des Tutankhamen. Alles Wesentliche ist erhalten, selbst was vollkommen vergessen scheint, ist noch irgendwie und irgendwo vorhanden, nur verschüttet, der Verfügung des Individuums unzugänglich gemacht. Man darf ja bekanntlich bezweifeln, ob irgendeine psychische Bildung wirklich voller Zerstörung anheimfällt. Es ist nur eine Frage der analytischen Technik, ob es gelingen wird, das Verborgene vollständig zum Vorschein zu bringen. Dieser außerordentlichen Bevorzugung der analytischen Arbeit stehen nur zwei andere Tatsachen entgegen, nämlich daß das psychische Objekt unvergleichlich komplizierter ist als das materielle des Ausgräbers und daß unsere Kenntnis nicht genügend vorbereitet ist auf das, was wir finden sollen, da dessen intime Struktur noch soviel Geheimnisvolles birgt. Und nun kommt unser Vergleich der beiden Arbeiten auch zu seinem Ende, denn der Hauptunterschied der beiden liegt darin, daß für die Archäologie die Rekonstruktion das Ziel und das Ende der Bemühung ist, für die Analyse aber ist die Konstruktion nur eine Vorarbeit.
II
Vorarbeit allerdings nicht in dem Sinne, daß sie zuerst als Ganzes erledigt werden müßte, bevor man das nächste beginnt, etwa wie bei einem Hausbau, wo alle Mauern aufgerichtet und alle Fenster eingesetzt sein müssen, ehe man sich mit der inneren Dekoration der Gemächer beschäftigen kann. Jeder Analytiker weiß, daß es in der analytischen Behandlung anders zugeht, daß beide Arten von Arbeit nebeneinander herlaufen, die eine immer voran, die andere an sie anschließend. Der Analytiker bringt ein Stück Konstruktion fertig, teilt es dem Analysierten mit, damit es auf ihn wirke; dann konstruiert er ein weiteres Stück aus dem neu zuströmenden Material, verfährt damit auf dieselbe Weise, und in solcher Abwechslung weiter bis zum Ende. Wenn man in den Darstellungen der analytischen Technik so wenig von »Konstruktionen« hört, so hat dies seinen Grund darin, daß man anstatt dessen von »Deutungen« und deren Wirkung spricht. Aber ich meine, Konstruktion ist die weitaus angemessenere Bezeichnung. Deutung bezieht sich auf das, was man mit einem einzelnen Element des Materials, einem Einfall, einer Fehlleistung u. dgl., vornimmt. Eine Konstruktion ist es aber, wenn man dem Analysierten ein Stück seiner vergessenen Vorgeschichte etwa in folgender Art vorführt: »Bis zu Ihrem nten Jahr haben Sie sich als alleinigen und unbeschränkten Besitzer der Mutter betrachtet, dann kam ein zweites Kind und mit ihm eine schwere Enttäuschung. Die Mutter hat Sie für eine Weile verlassen, sich auch später Ihnen nicht mehr ausschließlich gewidmet. Ihre Empfindungen für die Mutter wurden ambivalent, der Vater gewann eine neue Bedeutung für Sie« und so weiter.
In unserem Aufsatz ist unsere Aufmerksamkeit ausschließlich dieser Vorarbeit der Konstruktionen zugewendet. Und da erhebt sich zuallererst die Frage, welche Garantien haben wir während der Arbeit an den Konstruktionen, daß wir nicht irregehen und den Erfolg der Behandlung durch die Vertretung einer unrichtigen Konstruktion aufs Spiel setzen? Es mag uns scheinen, daß diese Frage eine allgemeine Beantwortung überhaupt nicht zuläßt, aber noch vor dieser Erörterung wollen wir einer trostreichen Auskunft lauschen, die uns die analytische Erfahrung gibt. Die lehrt uns nämlich, es bringt keinen Schaden, wenn wir uns einmal geirrt und dem Patienten eine unrichtige Konstruktion als die wahrscheinliche historische Wahrheit vorgetragen haben. Es bedeutet natürlich einen Zeitverlust, und wer dem Patienten immer nur irrige Kombinationen zu erzählen weiß, wird ihm keinen guten Eindruck machen und es in seiner Behandlung nicht weit bringen, aber ein einzelner solcher Irrtum ist harmlos. Was in solchem Falle geschieht, ist vielmehr, daß der Patient wie unberührt bleibt, weder mit »Ja« noch mit »Nein« darauf reagiert. Das kann möglicherweise nur ein Aufschub seiner Reaktion sein; bleibt es aber so, dann dürfen wir den Schluß ziehen, daß wir uns geirrt haben, und werden dies ohne Einbuße an unserer Autorität bei passender Gelegenheit dem Patienten eingestehen. Diese Gelegenheit ist gegeben, wenn neues Material zum Vorschein gekommen ist, das eine bessere Konstruktion und somit die Korrektur des Irrtums gestattet. Die falsche Konstruktion fällt in solcher Art heraus, als ob sie nie gemacht worden wäre, ja in manchen Fällen gewinnt man den Eindruck, als hätte man, mit Polonius zu reden, den Wahrheitskarpfen grade mit Hilfe des Lügenköders gefangen. Die Gefahr, den Patienten durch Suggestion irrezuführen, indem man ihm Dinge »einredet«, an die man selbst glaubt, die er aber nicht annehmen sollte, ist sicherlich maßlos übertrieben worden. Der Analytiker müßte sich sehr inkorrekt benommen haben, wenn ihm ein solches Mißgeschick zustoßen könnte; vor allem hätte er sich vorzuwerfen, daß er den Patienten nicht zu Wort kommen ließ. Ich kann ohne Ruhmredigkeit behaupten, daß ein solcher Mißbrauch der »Suggestion« in meiner Tätigkeit sich niemals ereignet hat.
Aus dem Vorstehenden geht bereits hervor, daß wir keineswegs geneigt sind, die Anzeichen zu vernachlässigen, die sich aus der Reaktion des Patienten auf die Mitteilung einer unserer Konstruktionen ableiten. Wir wollen diesen Punkt eingehend behandeln. Es ist richtig, daß wir ein »Nein« des Analysierten nicht als vollwertig hinnehmen, aber ebensowenig lassen wir sein »Ja« gelten; es ist ganz ungerechtfertigt, uns zu beschuldigen, daß wir seine Äußerung in allen Fällen in eine Bestätigung umdeuten. In Wirklichkeit geht es nicht so einfach zu, machen wir uns die Entscheidung nicht so leicht.
Das direkte »Ja« des Analysierten ist vieldeutig. Es kann in der Tat anzeigen, daß er die vernommene Konstruktion als richtig anerkennt, es kann aber auch bedeutungslos sein oder selbst was wir »heuchlerisch« heißen können, indem es seinem Widerstand bequem ist, die nicht aufgedeckte Wahrheit durch eine solche Zustimmung weiterhin zu verbergen. Einen Wert hat dies »Ja« nur, wenn es von indirekten Bestätigungen gefolgt wird, wenn der Patient in unmittelbarem Anschluß an sein »Ja« neue Erinnerungen produziert, welche die Konstruktion ergänzen und erweitern. Nur in diesem Falle anerkennen wir das »Ja« als die volle Erledigung des betreffenden Punktes.
Das »Nein« des Analysierten ist ebenso vieldeutig und eigentlich noch weniger verwendbar als sein »Ja«. In seltenen Fällen erweist es sich als Ausdruck berechtigter Ablehnung; ungleich häufiger ist es Äußerung eines Widerstandes, der durch den Inhalt der mitgeteilten Konstruktion hervorgerufen wird, aber ebensowohl von einem anderen Faktor der komplexen analytischen Situation herrühren kann. Das »Nein« des Patienten beweist also nichts für die Richtigkeit der Konstruktion, es verträgt sich aber sehr gut mit dieser Möglichkeit. Da jede solche Konstruktion unvollständig ist, nur ein Stückchen des vergessenen Geschehens erfaßt, steht es uns frei anzunehmen, daß der Analysierte nicht eigentlich das ihm Mitgeteilte leugnet, sondern seinen Widerspruch von dem noch nicht aufgedeckten Anteil her aufrechthält. Er wird in der Regel seine Zustimmung erst dann äußern, wenn er die ganze Wahrheit erfahren hat, und die ist oft recht weitläufig. Die einzig sichere Deutung seines »Nein« ist also die auf Unvollständigkeit; die Konstruktion hat ihm gewiß nicht alles gesagt.
Es ergibt sich also, daß man aus den direkten Äußerungen des Patienten nach der Mitteilung einer Konstruktion wenig Anhaltspunkte gewinnen kann, ob man richtig oder unrichtig geraten hat. Um so interessanter ist es, daß es indirekte Arten der Bestätigung gibt, die durchaus zuverlässig sind. Eine derselben ist eine Redensart, die man in wenig abgeänderten Worten von den verschiedensten Personen wie über Verabredung zu hören bekommt. Sie lautet: » Das (daran) habe ich (oder: hätte ich) nie gedacht.« Man kann diese Äußerung unbedenklich übersetzen: »Ja, Sie haben das Unbewußte in diesem Falle richtig getroffen.« Leider hört man die dem Analytiker so erwünschte Formel häufiger nach Einzeldeutungen als nach der Mitteilung umfangreicher Konstruktionen. Eine ebenso wertvolle Bestätigung, diesmal positiv ausgedrückt, ist es, wenn der Analysierte mit einer Assoziation antwortet, die etwas dem Inhalt der Konstruktion Ähnliches oder Analoges enthält. Anstatt eines Beispieles hiefür aus einer Analyse, das leicht aufzufinden, aber weitläufig darzustellen wäre, möchte ich hier ein kleines außeranalytisches Erlebnis erzählen, das einen solchen Sachverhalt mit beinahe komisch wirkender Eindringlichkeit darstellt. Es handelte sich um einen Kollegen, der mich – es ist lange her – zum Konsiliarius in seiner ärztlichen Tätigkeit gewählt hatte. Eines Tages aber brachte er mir seine junge Frau, die ihm Ungelegenheiten bereitete. Sie verweigerte ihm unter allerlei Vorwänden den sexuellen Verkehr, und er erwartete offenbar von mir, daß ich sie über die Folgen ihres unzweckmäßigen Benehmens aufklären sollte. Ich ging darauf ein und setzte ihr auseinander, daß ihre Weigerung bei ihrem Mann wahrscheinlich bedauerliche Gesundheitsstörungen oder Versuchungen hervorrufen würde, die zum Verfall ihrer Ehe führen könnten. Dabei unterbrach er mich plötzlich, um mir zu sagen: »Der Engländer, bei dem Sie einen Hirntumor diagnostiziert haben, ist auch schon gestorben.« Die Rede schien zuerst unverständlich, das auch im Satze rätselhaft, es war von keinem anderen Gestorbenen gesprochen worden. Eine kurze Weile später verstand ich. Der Mann wollte mich offenbar bekräftigen, er wollte sagen: »Ja, Sie haben ganz gewiß recht, Ihre Diagnose bei dem Patienten hat sich auch bestätigt.« Es war ein volles Gegenstück zu den indirekten Bestätigungen durch Assoziationen, die wir in den Analysen erhalten. Daß an der Äußerung des Kollegen auch andere, von ihm beiseite geschobene Gedanken einen Anteil gehabt haben, will ich nicht bestreiten.
Die indirekte Bestätigung durch Assoziationen, die zum Inhalt der Konstruktion passen, die ein solches » auch« mit sich bringen, gibt unserem Urteil wertvolle Anhaltspunkte, um zu erraten, ob sich diese Konstruktion in der Fortsetzung der Analyse bewahrheiten wird. Besonders eindrucksvoll ist auch der Fall, wenn sich die Bestätigung mit Hilfe einer Fehlleistung in den direkten Widerspruch einschleicht. Ein schönes Beispiel dieser Art habe ich früher einmal an anderer Stelle veröffentlicht. In den Träumen des Patienten tauchte wiederholt der in Wien wohlbekannte Name Jauner auf, ohne in seinen Assoziationen genügende Aufklärung zu finden. Ich versuchte dann die Deutung, er meine wohl Gauner, wenn er Jauner sage, und der Patient antwortet prompt: »Das scheint mir doch zu jewagt.« Oder der Patient will die Zumutung, daß ihm eine bestimmte Zahlung zu hoch erscheine, mit den Worten zurückweisen: »Zehn Dollars spielen bei mir keine Rolle«, setzt aber anstatt Dollars die niedrigere Geldsorte ein und sagt: »Zehn Schilling.«
Wenn die Analyse unter dem Druck starker Momente steht, die eine negative therapeutische Reaktion erzwingen, wie Schuldbewußtsein, masochistisches Leidensbedürfnis, Sträuben gegen die Hilfeleistung des Analytikers, macht das Verhalten des Patienten nach der Mitteilung der Konstruktion uns oft die gesuchte Entscheidung sehr leicht. Ist die Konstruktion falsch, so ändert sich nichts beim Patienten; wenn sie aber richtig ist oder eine Annäherung an die Wahrheit bringt, so reagiert er auf sie mit einer unverkennbaren Verschlimmerung seiner Symptome und seines Allgemeinbefindens.
Zusammenfassend werden wir feststellen, wir verdienen nicht den Vorwurf, daß wir die Stellungnahme des Analysierten zu unseren Konstruktionen geringschätzig zur Seite drängen. Wir achten auf sie und entnehmen ihr oft wertvolle Anhaltspunkte. Aber diese Reaktionen des Patienten sind zumeist vieldeutig und gestatten keine endgültige Entscheidung. Nur die Fortsetzung der Analyse kann die Entscheidung über Richtigkeit oder Unbrauchbarkeit unserer Konstruktion bringen. Wir geben die einzelne Konstruktion für nichts anderes aus als für eine Vermutung, die auf Prüfung, Bestätigung oder Verwerfung wartet. Wir beanspruchen keine Autorität für sie, fordern vom Patienten keine unmittelbare Zustimmung, diskutieren nicht mit ihm, wenn er ihr zunächst widerspricht. Kurz, wir benehmen uns nach dem Vorbild einer bekannten Nestroyschen Figur, des Hausknechts, der für alle Fragen und Einwendungen die einzige Antwort bereit hat: » Im Laufe der Begebenheiten wird alles klar werden.«
III
Wie dies in der Fortsetzung der Analyse vor sich geht, auf welchen Wegen sich unsere Vermutung in die Überzeugung des Patienten verwandelt, das darzustellen lohnt kaum der Mühe; es ist aus täglicher Erfahrung jedem Analytiker bekannt und bietet dem Verständnis keine Schwierigkeit. Nur ein Punkt daran verlangt nach Untersuchung und Aufklärung. Der Weg, der von der Konstruktion des Analytikers ausgeht, sollte in der Erinnerung des Analysierten enden; er führt nicht immer so weit. Oft genug gelingt es nicht, den Patienten zur Erinnerung des Verdrängten zu bringen. Anstatt dessen erreicht man bei ihm durch korrekte Ausführung der Analyse eine sichere Überzeugung von der Wahrheit der Konstruktion, die therapeutisch dasselbe leistet wie eine wiedergewonnene Erinnerung. Unter welchen Umständen dies geschieht und wie es möglich wird, daß ein scheinbar unvollkommener Ersatz doch die volle Wirkung tut, das bleibt ein Stoff für spätere Forschung.
Ich werde diese kleine Mitteilung mit einigen Bemerkungen beschließen, die eine weitere Perspektive eröffnen. Es ist mir in einigen Analysen aufgefallen, daß die Mitteilung einer offenbar zutreffenden Konstruktion ein überraschendes und zunächst unverständliches Phänomen bei den Analysierten zum Vorschein brachte. Sie bekamen lebhafte Erinnerungen, von ihnen selbst als »überdeutlich« bezeichnet, aber sie erinnerten nicht etwa die Begebenheit, die der Inhalt der Konstruktion war, sondern Details, die diesem Inhalt nahestanden, z. B. die Gesichter der darin genannten Personen überscharf oder die Räume, in denen sich Ähnliches hätte zutragen können, oder, ein Stück weiter weg, die Einrichtungsgegenstände dieser Räumlichkeiten, von denen die Konstruktion natürlich nichts hatte wissen können. Dies geschah ebensowohl in Träumen unmittelbar nach der Mitteilung als auch im Wachen in phantasieartigen Zuständen. An diese Erinnerungen selbst schloß weiter nichts an; es lag dann nahe, sie als Ergebnis eines Kompromisses aufzufassen. Der »Auftrieb« des Verdrängten, durch die Mitteilung der Konstruktion rege geworden, hatte jene bedeutsamen Erinnerungsspuren zum Bewußtsein tragen wollen; einem Widerstand war es gelungen, zwar nicht die Bewegung aufzuhalten, aber wohl sie auf benachbarte, nebensächliche Objekte zu verschieben.
Diese Erinnerungen hätte man Halluzinationen nennen können, wenn zu ihrer Deutlichkeit der Glaube an ihre Aktualität hinzugekommen wäre. Aber die Analogie gewann an Bedeutung, als ich auf das gelegentliche Vorkommen wirklicher Halluzinationen bei anderen, gewiß nicht psychotischen Fällen aufmerksam wurde. Der Gedankengang ging dann weiter: Vielleicht ist es ein allgemeiner Charakter der Halluzination, bisher nicht genug gewürdigt, daß in ihr etwas in der Frühzeit Erlebtes und dann Vergessenes wiederkehrt, etwas, was das Kind gesehen oder gehört zur Zeit, da es noch kaum sprachfähig war, und was sich nun dem Bewußtsein aufdrängt, wahrscheinlich entstellt und verschoben in Wirkung der Kräfte, die sich einer solchen Wiederkehr widersetzen. Und bei der nahen Beziehung der Halluzination zu bestimmten Formen von Psychose darf unser Gedankengang noch weiter greifen. Vielleicht sind die Wahnbildungen, in denen wir diese Halluzinationen so regelmäßig eingefügt finden, selbst nicht so unabhängig vom Auftrieb des Unbewußten und von der Wiederkehr des Verdrängten, wie wir gemeinhin annehmen. Wir betonen im Mechanismus einer Wahnbildung in der Regel nur zwei Momente, die Abwendung von der Realwelt und deren Motive einerseits und den Einfluß der Wunscherfüllung auf den Inhalt des Wahns anderseits. Aber kann der dynamische Vorgang nicht eher der sein, daß die Abwendung von der Realität vom Auftrieb des Verdrängten ausgenützt wird, um seinen Inhalt dem Bewußtsein aufzudrängen, wobei die bei diesem Vorgang erregten Widerstände und die Tendenz zur Wunscherfüllung sich in die Verantwortlichkeit für die Entstellung und Verschiebung des Wiedererinnerten teilen? Das ist doch auch der uns bekannte Mechanismus des Traumes, den schon uralte Ahnung dem Wahnsinn gleichgesetzt hat.
Ich glaube nicht, daß diese Auffassung des Wahns vollkommen neu ist, aber sie betont doch einen Gesichtspunkt, der für gewöhnlich nicht in den Vordergrund gerückt wird. Wesentlich an ihr ist die Behauptung, daß der Wahnsinn nicht nur Methode hat, wie schon der Dichter erkannte, sondern daß auch ein Stück historischer Wahrheit in ihm enthalten ist, und es liegt uns nahe anzunehmen, daß der zwanghafte Glaube, den der Wahn findet, gerade aus solch infantiler Quelle seine Stärke bezieht. Mir stehen heute, um diese Theorie zu erweisen, nur Reminiszenzen zu Gebote, nicht frische Eindrücke. Es würde wahrscheinlich die Mühe lohnen, wenn man versuchte, entsprechende Krankheitsfälle nach den hier entwickelten Voraussetzungen zu studieren und auch ihre Behandlung danach einzurichten. Man würde die vergebliche Bemühung aufgeben, den Kranken von dem Irrsinn seines Wahns, von seinem Widerspruch zur Realität, zu überzeugen, und vielmehr in der Anerkennung des Wahrheitskerns einen gemeinsamen Boden finden, auf dem sich die therapeutische Arbeit entwickeln kann. Diese Arbeit bestünde darin, das Stück historischer Wahrheit von seinen Entstellungen und Anlehnungen an die reale Gegenwart zu befreien und es zurechtzurücken an die Stelle der Vergangenheit, der es zugehört. Die Verrückung aus der vergessenen Vorzeit in die Gegenwart oder in die Erwartung der Zukunft ist ja ein regelmäßiges Vorkommnis auch beim Neurotiker. Oft genug, wenn ihn ein Angstzustand erwarten läßt, daß sich etwas Schreckliches ereignen wird, steht er bloß unter dem Einfluß einer verdrängten Erinnerung, die zum Bewußtsein kommen möchte und nicht bewußt werden kann, daß etwas damals Schreckhaftes sich wirklich ereignet hat. Ich meine, man wird aus solchen Bemühungen an Psychotikern sehr viel Wertvolles erfahren, auch wenn ihnen der therapeutische Erfolg versagt bleibt.
Ich weiß, daß es nicht verdienstlich ist, ein so wichtiges Thema so beiläufig zu behandeln, wie es hier geschieht. Ich bin dabei der Verlockung einer Analogie gefolgt. Die Wahnbildungen der Kranken erscheinen mir als Äquivalente der Konstruktionen, die wir in den analytischen Behandlungen aufbauen, Versuche zur Erklärung und Wiederherstellung, die unter den Bedingungen der Psychose allerdings nur dazu führen können, das Stück Realität, das man in der Gegenwart verleugnet, durch ein anderes Stück zu ersetzen, das man in früher Vorzeit gleichfalls verleugnet hatte. Die intimen Beziehungen zwischen dem Stoff der gegenwärtigen Verleugnung und dem der damaligen Verdrängung aufzudecken wird die Aufgabe der Einzeluntersuchung. Wie unsere Konstruktion nur dadurch wirkt, daß sie ein Stück verlorengegangener Lebensgeschichte wiederbringt, so dankt auch der Wahn seine überzeugende Kraft dem Anteil historischer Wahrheit, den er an die Stelle der abgewiesenen Realität einsetzt. In solcher Art würde auch der Wahn sich dem Satze unterwerfen, den ich früher einmal nur für die Hysterie ausgesprochen habe, der Kranke leide an seinen Reminiszenzen. Diese kurze Formel wollte auch damals nicht die Komplikation der Krankheitsverursachung bestreiten und die Wirkung so vieler anderer Momente ausschließen.
Erfaßt man die Menschheit als ein Ganzes und setzt sie an die Stelle des einzelnen menschlichen Individuums, so findet man, daß auch sie Wahnbildungen entwickelt hat, die der logischen Kritik unzugänglich sind und der Wirklichkeit widersprechen. Wenn sie trotzdem eine außerordentliche Gewalt über die Menschen äußern können, so führt die Untersuchung zum gleichen Schluß wie beim einzelnen Individuum. Sie danken ihre Macht dem Gehalt an historischer Wahrheit, die sie aus der Verdrängung vergessener Urzeiten heraufgeholt haben.
Meine Ansichten über die Rolle der Sexualität in der Ätiologie der Neurosen (1906)
Ich bin der Meinung, daß man meine Theorie über die ätiologische Bedeutung des sexuellen Momentes für die Neurosen am besten würdigt, wenn man ihrer Entwicklung nachgeht. Ich habe nämlich keineswegs das Bestreben abzuleugnen, daß sie eine Entwicklung durchgemacht und sich während derselben verändert hat. Die Fachgenossen könnten in diesem Zugeständnis die Gewähr finden, daß diese Theorie nichts anderes ist als der Niederschlag fortgesetzter und vertiefter Erfahrungen. Was im Gegensatze hierzu der Spekulation entsprungen ist, das kann allerdings leicht mit einem Schlage vollständig und dann unveränderlich auftreten.
Die Theorie bezog sich ursprünglich bloß auf die als »Neurasthenie« zusammengefaßten Krankheitsbilder, unter denen mir zwei gelegentlich auch rein auftretende Typen auffielen, die ich als » eigentliche Neurasthenie« und als » Angstneurose« beschrieben habe. Es war ja immer bekannt, daß sexuelle Momente in der Verursachung dieser Formen eine Rolle spielen können, aber man fand dieselben weder regelmäßig wirksam, noch dachte man daran, ihnen einen Vorrang vor anderen ätiologischen Einflüssen einzuräumen. Ich wurde zunächst von der Häufigkeit grober Störungen in der vita sexualis der Nervösen überrascht; je mehr ich darauf ausging, solche Störungen zu suchen, wobei ich mir vorhielt, daß die Menschen alle in sexuellen Dingen die Wahrheit verhehlen, und je geschickter ich wurde, das Examen trotz einer anfänglichen Verneinung fortzusetzen, desto regelmäßiger ließen sich solche krank machende Momente aus dem Sexualleben auffinden, bis mir zu deren Allgemeinheit wenig zu fehlen schien. Man mußte aber von vornherein auf ein ähnlich häufiges Vorkommen sexueller Unregelmäßigkeiten unter dem Drucke der sozialen Verhältnisse in unserer Gesellschaft gefaßt sein und konnte im Zweifel bleiben, welches Maß von Abweichung von der normalen Sexualfunktion als Krankheitsursache betrachtet werden dürfe. Ich konnte daher auf den regelmäßigen Nachweis sexueller Noxen nur weniger Wert legen als auf eine zweite Erfahrung, die mir eindeutiger erschien. Es ergab sich, daß die Form der Erkrankung, ob Neurasthenie oder Angstneurose, eine konstante Beziehung zur Art der sexuellen Schädlichkeit zeige. In den typischen Fällen der Neurasthenie war regelmäßig Masturbation oder gehäufte Pollutionen, bei der Angstneurose waren Faktoren wie der coitus interruptus, die »frustrane Erregung« und andere nachweisbar, an denen das Moment der ungenügenden Abfuhr der erzeugten Libido das Gemeinsame schien. Erst seit dieser leicht zu machenden und beliebig oft zu bestätigenden Erfahrung hatte ich den Mut, für die sexuellen Einflüsse eine bevorzugte Stellung in der Ätiologie der Neurosen zu beanspruchen. Es kam hinzu, daß bei den so häufigen Mischformen von Neurasthenie und Angstneurose auch die Vermengung der für die beiden Formen angenommenen Ätiologien aufzuzeigen war und daß eine solche Zweiteilung in der Erscheinungsform der Neurose zu dem polaren Charakter der Sexualität (männlich und weiblich) gut zu stimmen schien.
Zur gleichen Zeit, während ich der Sexualität diese Bedeutung für die Entstehung der einfachen Neurosen zuwies [Fußnote]›Über die Berechtigung, von der Neurasthenie einen bestimmten Symptomenkomplex als »Angstneurose« abzutrennen‹ (1895 b)., huldigte ich noch in betreff der Psychoneurosen (Hysterie und Zwangsvorstellungen) einer rein psychologischen Theorie, in welcher das sexuelle Moment nicht anders als andere emotionelle Quellen in Betracht kam. Ich hatte im Verein mit J. Breuer und im Anschluß an Beobachtungen, die er gut ein Dezennium vorher an einer hysterischen Kranken gemacht hatte, den Mechanismus der Entstehung hysterischer Symptome mittels des Erweckens von Erinnerungen im hypnotischen Zustande studiert, und wir waren zu Aufschlüssen gelangt, welche gestatteten, die Brücke von der traumatischen Hysterie Charcots zur gemeinen, nicht traumatischen, zu schlagen [Fußnote]Studien über Hysterie (1895).. Wir waren zur Auffassung gelangt, daß die hysterischen Symptome Dauerwirkungen von psychischen Traumen sind, deren zugehörige Affektgröße durch besondere Bedingungen von bewußter Bearbeitung abgedrängt worden ist und sich darum einen abnormen Weg in die Körperinnervation gebahnt hat. Die Termini » eingeklemmter Affekt«, » Konversion« und » Abreagieren« fassen das Kennzeichnende dieser Anschauung zusammen.
Bei den nahen Beziehungen der Psychoneurosen zu den einfachen Neurosen, die ja so weit gehen, daß dem Ungeübten die diagnostische Unterscheidung nicht immer leichtfällt, konnte es aber nicht ausbleiben, daß die für das eine Gebiet gewonnene Erkenntnis auch für das andere Platz griff. Überdies führte, von solcher Beeinflussung abgesehen, auch die Vertiefung in den psychischen Mechanismus der hysterischen Symptome zu dem gleichen Ergebnis. Wenn man nämlich bei dem von Breuer und mir eingesetzten »kathartischen« Verfahren den psychischen Traumen, von denen sich die hysterischen Symptome ableiteten, immer weiter nachspürte, gelangte man endlich zu Erlebnissen, welche der Kindheit des Kranken angehörten und sein Sexualleben betrafen, und zwar auch in solchen Fällen, in denen eine banale Emotion nicht sexueller Natur den Ausbruch der Krankheit veranlaßt hatte. Ohne diese sexuellen Traumen der Kinderzeit in Betracht zu ziehen, konnte man weder die Symptome aufklären, deren Determinierung verständlich finden, noch deren Wiederkehr verhüten. Somit schien die unvergleichliche Bedeutung sexueller Erlebnisse für die Ätiologie der Psychoneurosen als unzweifelhaft festgestellt, und diese Tatsache ist auch bis heute einer der Grundpfeiler der Theorie geblieben.
Wenn man diese Theorie so darstellt, die Ursache der lebenslangen hysterischen Neurose liege in den meist an sich geringfügigen sexuellen Erlebnissen der frühen Kinderzeit, so mag sie allerdings befremdend genug klingen. Nimmt man aber auf die historische Entwicklung der Lehre Rücksicht, verlegt den Hauptinhalt derselben in den Satz, die Hysterie sei der Ausdruck eines besonderen Verhaltens der Sexualfunktion des Individuums und dieses Verhalten werde bereits durch die ersten in der Kindheit einwirkenden Einflüsse und Erlebnisse maßgebend bestimmt, so sind wir zwar um ein Paradoxon ärmer, aber um ein Motiv bereichert worden, den bisher arg vernachlässigten, höchst bedeutsamen Nachwirkungen der Kindheitseindrücke überhaupt unsere Aufmerksamkeit zu schenken.
Indem ich mir vorbehalte, die Frage, ob man in den sexuellen Kindererlebnissen die Ätiologie der Hysterie (und Zwangsneurose) sehen dürfe, weiter unten gründlicher zu behandeln, kehre ich zu der Gestaltung der Theorie zurück, welche diese in einigen kleinen, vorläufigen Publikationen der Jahre 1895 und 1896 angenommen hat [Fußnote]›Weitere Bemerkungen über die Abwehr-Neuropsychosen‹ (1896 b). – ›Zur Ätiologie der Hysterie‹ (1896 c).. Die Hervorhebung der angenommenen ätiologischen Momente gestattete damals, die gemeinen Neurosen als Erkrankungen mit aktueller Ätiologie den Psychoneurosen gegenüberzustellen, deren Ätiologie vor allem in den sexuellen Erlebnissen der Vorzeit zu suchen war. Die Lehre gipfelte in dem Satze: Bei normaler vita sexualis ist eine Neurose unmöglich.
Wenn ich auch diese Sätze noch heute nicht für unrichtig halte, so ist es doch nicht zu verwundern, daß ich in zehn Jahren fortgesetzter Bemühung um die Erkenntnis dieser Verhältnisse über meinen damaligen Standpunkt ein gutes Stück weit hinausgekommen bin und mich heute in der Lage glaube, die Unvollständigkeit, die Verschiebungen und die Mißverständnisse, an denen die Lehre damals litt, durch eingehendere Erfahrung zu korrigieren. Ein Zufall des damals noch spärlichen Materials hatte mir eine unverhältnismäßig große Anzahl von Fällen zugeführt, in deren Kindergeschichte die sexuelle Verführung durch Erwachsene oder andere ältere Kinder die Hauptrolle spielte. Ich überschätzte die Häufigkeit dieser (sonst nicht anzuzweifelnden) Vorkommnisse, da ich überdies zu jener Zeit nicht imstande war, die Erinnerungstäuschungen der Hysterischen über ihre Kindheit von den Spuren der wirklichen Vorgänge sicher zu unterscheiden, während ich seitdem gelernt habe, so manche Verführungsphantasie als Abwehrversuch gegen die Erinnerung der eigenen sexuellen Betätigung (Kindermasturbation) aufzulösen. Mit dieser Aufklärung entfiel die Betonung des »traumatischen« Elementes an den sexuellen Kindererlebnissen, und es blieb die Einsicht übrig, daß die infantile Sexualbetätigung (ob spontan oder provoziert) dem späteren Sexualleben nach der Reife die Richtung vorschreibt. Dieselbe Aufklärung, die ja den bedeutsamsten meiner anfänglichen Irrtümer korrigierte, mußte auch die Auffassung vom Mechanismus der hysterischen Symptome verändern. Dieselben erschienen nun nicht mehr als direkte Abkömmlinge der verdrängten Erinnerungen an sexuelle Kindheitserlebnisse, sondern zwischen die Symptome und die infantilen Eindrücke schoben sich nun die (meist in den Pubertätsjahren produzierten) Phantasien (Erinnerungsdichtungen) der Kranken ein, die auf der einen Seite sich aus und über den Kindheitserinnerungen aufbauten, auf der anderen sich unmittelbar in die Symptome umsetzten. Erst mit der Einführung des Elements der hysterischen Phantasien wurde das Gefüge der Neurose und deren Beziehung zum Leben der Kranken durchsichtig; auch ergab sich eine wirklich überraschende Analogie zwischen diesen unbewußten Phantasien der Hysteriker und den als Wahn bewußtgewordenen Dichtungen bei der Paranoia.
Nach dieser Korrektur waren die »infantilen Sexualtraumen« in gewissem Sinne durch den »Infantilismus der Sexualität« ersetzt. Eine zweite Abänderung der ursprünglichen Theorie lag nicht ferne. Mit der angenommenen Häufigkeit der Verführung in der Kindheit entfiel auch die übergroße Betonung der akzidentellen Beeinflussung der Sexualität, welcher ich bei der Verursachung des Krankseins die Hauptrolle zuschieben wollte, ohne darum konstitutionelle und hereditäre Momente zu leugnen. Ich hatte sogar gehofft, das Problem der Neurosenwahl, die Entscheidung darüber, welcher Form von Psychoneurose der Kranke verfallen solle, durch die Einzelheiten der sexuellen Kindererlebnisse zu lösen, und damals – wenn auch mit Zurückhaltung – gemeint, daß passives Verhalten bei diesen Szenen die spezifische Disposition zur Hysterie, aktives dagegen die für die Zwangsneurose ergebe. Auf diese Auffassung mußte ich später völlig Verzicht leisten, wenngleich manches Tatsächliche den geahnten Zusammenhang zwischen Passivität und Hysterie, Aktivität und Zwangsneurose in irgendeiner Weise aufrechtzuhalten gebietet. Mit dem Rücktritt der akzidentellen Einflüsse des Erlebens mußten die Momente der Konstitution und Heredität wieder die Oberhand behaupten, aber mit dem Unterschiede gegen die sonst herrschende Anschauung, daß bei mir die »sexuelle Konstitution« an die Stelle der allgemeinen neuropathischen Disposition trat. In meinen jüngst erschienenen Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905 d) habe ich den Versuch gemacht, die Mannigfaltigkeiten dieser sexuellen Konstitution sowie die Zusammengesetztheit des Sexualtriebes überhaupt und dessen Herkunft aus verschiedenen Beitragsquellen im Organismus zu schildern.
Immer noch im Zusammenhange mit der veränderten Auffassung der »sexuellen Kindertraumen« entwickelte sich nun die Theorie nach einer Richtung weiter, die schon in den Veröffentlichungen der Jahre 1894 bis 1896 angezeigt worden war. Ich hatte bereits damals, und noch ehe die Sexualität in die ihr gebührende Stellung in der Ätiologie eingesetzt war, als Bedingung für die pathogene Wirksamkeit eines Erlebnisses angegeben, daß dieses dem Ich unerträglich erscheinen und ein Bestreben zur Abwehr hervorrufen müsse [Fußnote]›Die Abwehr-Neuropsychosen: Versuch einer psychologischen Theorie der akquirierten Hysterie, vieler Phobien und Zwangsvorstellungen und gewisser halluzinatorischer Psychosen‹ (1894 a).. Auf diese Abwehr hatte ich die psychische Spaltung – oder wie man damals sagte: die Bewußtseinsspaltung – der Hysterie zurückgeführt. Gelang die Abwehr, so war das unerträgliche Erlebnis mit seinen Affektfolgen aus dem Bewußtsein und der Erinnerung des Ichs vertrieben; unter gewissen Verhältnissen entfaltete aber das Vertriebene als ein nun Unbewußtes seine Wirksamkeit und kehrte mittels der Symptome und der an ihnen haftenden Affekte ins Bewußtsein zurück, so daß die Erkrankung einem Mißglücken der Abwehr entsprach. Diese Auffassung hatte das Verdienst, auf das Spiel der psychischen Kräfte einzugehen und somit die seelischen Vorgänge der Hysterie den normalen anzunähern, anstatt die Charakteristik der Neurose in eine rätselhafte und weiter nicht analysierbare Störung zu verlegen.
Als nun weitere Erkundigungen bei normal gebliebenen Personen das unerwartete Ergebnis lieferten, daß deren sexuelle Kindergeschichte sich nicht wesentlich von dem Kinderleben der Neurotiker zu unterscheiden brauche, daß speziell die Rolle der Verführung bei ersteren die gleiche sei, traten die akzidentellen Einflüsse noch mehr gegen den der » Verdrängung« (wie ich anstatt »Abwehr« zu sagen begann) zurück. Es kam also nicht darauf an, was ein Individuum in seiner Kindheit an sexuellen Erregungen erfahren hatte, sondern vor allem auf seine Reaktion gegen diese Erlebnisse, ob es diese Eindrücke mit der »Verdrängung« beantwortet habe oder nicht. Bei spontaner infantiler Sexualbetätigung ließ sich zeigen, daß dieselbe häufig im Laufe der Entwicklung durch einen Akt der Verdrängung abgebrochen wurde. Das geschlechtsreife neurotische Individuum brachte so ein Stück »Sexualverdrängung« regelmäßig aus seiner Kindheit mit, das bei den Anforderungen des realen Lebens zur Äußerung kam, und die Psychoanalysen Hysterischer zeigten, daß ihre Erkrankung ein Erfolg des Konflikts zwischen der Libido und der Sexualverdrängung sei und daß ihre Symptome den Wert von Kompromissen zwischen beiden seelischen Strömungen haben.
Ohne eine ausführliche Erörterung meiner Vorstellungen von der Verdrängung könnte ich diesen Teil der Theorie nicht weiter aufklären. Es genüge, hier auf meine Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905 d) hinzuweisen, wo ich auf die somatischen Vorgänge, in denen das Wesen der Sexualität zu suchen ist, ein allerdings erst spärliches Licht zu werfen versucht habe. Ich habe dort ausgeführt, daß die konstitutionelle sexuelle Anlage des Kindes eine ungleich buntere ist, als man erwarten konnte, daß sie »polymorph pervers« genannt zu werden verdient und daß aus dieser Anlage durch Verdrängung gewisser Komponenten das sogenannte normale Verhalten der Sexualfunktion hervorgeht. Ich konnte durch den Hinweis auf die infantilen Charaktere der Sexualität eine einfache Verknüpfung zwischen Gesundheit, Perversion und Neurose herstellen. Die Norm ergab sich aus der Verdrängung gewisser Partialtriebe und Komponenten der infantilen Anlagen und der Unterordnung der übrigen unter das Primat der Genitalzonen im Dienste der Fortpflanzungsfunktion; die Perversionen entsprachen Störungen dieser Zusammenfassung durch die übermächtige zwangsartige Entwicklung einzelner dieser Partialtriebe, und die Neurose führte sich auf eine zu weitgehende Verdrängung der libidinösen Strebungen zurück. Da fast alle perversen Triebe der infantilen Anlage als symptombildende Kräfte bei der Neurose nachweisbar sind, sich aber bei ihr im Zustande der Verdrängung befinden, konnte ich die Neurose als das »Negativ« der Perversion bezeichnen.
Ich halte es der Hervorhebung wert, daß meine Anschauungen über die Ätiologie der Psychoneurosen bei allen Wandlungen doch zwei Gesichtspunkte nie verleugnet oder verlassen haben, die Schätzung der Sexualität und des Infantilismus. Sonst sind an die Stelle akzidenteller Einflüsse konstitutionelle Momente, für die rein psychologisch gemeinte »Abwehr« ist die organische »Sexualverdrängung« eingetreten. Sollte nun jemand fragen, wo ein zwingender Beweis für die behauptete ätiologische Bedeutung sexueller Faktoren bei den Psychoneurosen zu finden sei, da man doch diese Erkrankungen auf die banalsten Gemütsbewegungen und selbst auf somatische Anlässe hin ausbrechen sieht, auf eine spezifische Ätiologie in Gestalt besonderer Kindererlebnisse verzichten muß, so nenne ich die psychoanalytische Erforschung der Neurotiker als die Quelle, aus welcher die bestrittene Überzeugung zufließt. Man erfährt, wenn man sich dieser unersetzlichen Untersuchungsmethode bedient, daß die Symptome die Sexualbetätigung der Kranken darstellen, die ganze oder eine partielle, aus den Quellen normaler oder perverser Partialtriebe der Sexualität. Nicht nur, daß ein guter Teil der hysterischen Symptomatologie direkt aus den Äußerungen der sexuellen Erregtheit herstammt, nicht nur, daß eine Reihe von erogenen Zonen in der Neurose in Verstärkung infantiler Eigenschaften sich zur Bedeutung von Genitalien erhebt; die kompliziertesten Symptome selbst enthüllen sich als die konvertierten Darstellungen von Phantasien, welche eine sexuelle Situation zum Inhalte haben. Wer die Sprache der Hysterie zu deuten versteht, kann vernehmen, daß die Neurose nur von der verdrängten Sexualität der Kranken handelt. Man wolle nur die Sexualfunktion in ihrem richtigen, durch die infantile Anlage umschriebenen Umfange verstehen. Wo eine banale Emotion zur Verursachung der Erkrankung gerechnet werden muß, weist die Analyse regelmäßig nach, daß die nicht fehlende sexuelle Komponente des traumatischen Erlebnisses die pathogene Wirkung ausgeübt hat.
Wir sind unversehens von der Frage nach der Verursachung der Psychoneurosen zum Problem ihres Wesens vorgedrungen. Will man dem Rechnung tragen, was man durch die Psychoanalyse erfahren hat, so kann man nur sagen, das Wesen dieser Erkrankungen liege in Störungen der Sexualvorgänge, jener Vorgänge im Organismus, welche die Bildung und Verwendung der geschlechtlichen Libido bestimmen. Es ist kaum zu vermeiden, daß man sich diese Vorgänge in letzter Linie als chemische vorstelle, so daß man in den sogenannten aktuellen Neurosen die somatischen, in den Psychoneurosen außerdem noch die psychischen Wirkungen der Störungen im Sexualstoffwechsel erkennen dürfte. Die Ähnlichkeit der Neurosen mit den Intoxikations- und Abstinenzerscheinungen nach gewissen Alkaloiden, mit dem Morbus Basedowi und Morbus Addisoni drängt sich ohne weiteres klinisch auf, und so wie man diese beiden letzteren Erkrankungen nicht mehr als »Nervenkrankheiten« beschreiben darf, so werden wohl auch bald die echten »Neurosen« ihrer Namengebung zum Trotze aus dieser Klasse entfernt werden müssen.
Zur Ätiologie der Neurosen gehört dann alles, was schädigend auf die der Sexualfunktion dienenden Vorgänge einwirken kann. In erster Linie also die Noxen, welche die Sexualfunktion selbst betreffen, insoferne diese von der mit Kultur und Erziehung veränderlichen Sexualkonstitution als Schädlichkeiten angenommen werden. In zweiter Linie stehen alle andersartigen Noxen und Traumen, welche sekundär durch Allgemeinschädigung des Organismus die Sexualvorgänge in demselben zu schädigen vermögen. Man vergesse aber nicht, daß das ätiologische Problem bei den Neurosen mindestens ebenso kompliziert ist wie sonst bei der Krankheitsverursachung. Eine einzige pathogene Einwirkung ist fast niemals hinreichend; zu allermeist wird eine Mehrheit von ätiologischen Momenten erfordert, die einander unterstützen, die man also nicht in Gegensatz zueinander bringen darf. Dafür ist auch der Zustand des neurotischen Krankseins von dem der Gesundheit nicht scharf geschieden. Die Erkrankung ist das Ergebnis einer Summation, und das Maß der ätiologischen Bedingungen kann von irgendeiner Seite her vollgemacht werden. Die Ätiologie der Neurosen ausschließlich in der Heredität oder in der Konstitution zu suchen, wäre keine geringere Einseitigkeit, als wenn man einzig die akzidentellen Beeinflussungen der Sexualität im Leben zur Ätiologie erheben wollte, wenn sich doch die Aufklärung ergibt, daß das Wesen dieser Erkrankungen nur in einer Störung der Sexualvorgänge im Organismus gelegen ist.
Wien, im Juni 1905
Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre (1915)
[Fußnote]Die beiden nachstehenden Abhandlungen [die vorliegende sowie ›Trauer und Melancholie‹] stammen aus einer Sammlung, die ich ursprünglich unter dem Titel ›Zur Vorbereitung einer Metapsychologie‹ in Buchform veröffentlichen wollte. Sie schließen an Arbeiten an, welche im III. Jahrgang der Intern. Zeitschrift für ärztl. Psychoanalyse abgedruckt worden sind. (›Triebe und Triebschicksale‹ – ›Die Verdrängung‹ – ›Das Unbewußte‹). Absicht dieser Reihe ist die Klärung und Vertiefung der theoretischen Annahmen, die man einem psychoanalytischen System zugrunde legen könnte.
Wir werden bei verschiedenen Anlässen die Erfahrung machen können, wie vorteilhaft es für unsere Forschung ist, wenn wir gewisse Zustände und Phänomene zur Vergleichung heranziehen, die man als Normalvorbilder krankhafter Affektionen auffassen kann. Dahin gehören Affektzustände wie Trauer und Verliebtheit, aber auch der Zustand des Schlafes und das Phänomen des Träumens.
Wir sind nicht gewöhnt, viele Gedanken daran zu knüpfen, daß der Mensch allnächtlich die Hüllen ablegt, die er über seine Haut gezogen hat, und etwa noch die Ergänzungsstücke seiner Körperorgane, soweit es ihm gelungen ist, deren Mängel durch Ersatz zu decken, also die Brille, falschen Haare, Zähne usw. Man darf hinzufügen, daß er beim Schlafengehen eine ganz analoge Entkleidung seines Psychischen vornimmt, auf die meisten seiner psychischen Erwerbungen verzichtet und so von beiden Seiten her eine außerordentliche Annäherung an die Situation herstellt, welche der Ausgang seiner Lebensentwicklung war. Das Schlafen ist somatisch eine Reaktivierung des Aufenthalts im Mutterleibe mit der Erfüllung der Bedingungen von Ruhelage, Wärme und Reizabhaltung; ja viele Menschen nehmen im Schlafe die fötale Körperhaltung wieder ein. Der psychische Zustand der Schlafenden charakterisiert sich durch nahezu völlige Zurückziehung aus der Welt der Umgebung und Einstellung alles Interesses für sie.
Wenn man die psychoneurotischen Zustände untersucht, wird man veranlaßt, in jedem derselben die sogenannten zeitlichen Regressionen hervorzuheben, den Betrag des ihm eigentümlichen Rückgreifens in der Entwicklung. Man unterscheidet zwei solcher Regressionen, die der Ich- und die der Libidoentwicklung. Die letztere reicht beim Schlafzustand bis zur Herstellung des primitiven Narzißmus, die erstere bis zur Stufe der halluzinatorischen Wunschbefriedigung.
Was man von den psychischen Charakteren des Schlafzustandes weiß, hat man natürlich durch das Studium des Traumes erfahren. Zwar zeigt uns der Traum den Menschen, insofern er nicht schläft, aber er kann doch nicht umhin, uns dabei auch Charaktere des Schlafes selbst zu verraten. Wir haben aus der Beobachtung einige Eigentümlichkeiten des Traumes kennengelernt, die wir zunächst nicht verstehen konnten und nun mit leichter Mühe einreihen können. So wissen wir, der Traum sei absolut egoistisch, und die Person, die in seinen Szenen die Hauptrolle spiele, sei immer als die eigene zu agnoszieren. Das leitet sich nun leicht begreiflicherweise von dem Narzißmus des Schlafzustandes ab. Narzißmus und Egoismus fallen ja zusammen; das Wort »Narzißmus« will nur betonen, daß der Egoismus auch ein libidinöses Phänomen sei, oder, um es anders auszudrücken, der Narzißmus kann als die libidinöse Ergänzung des Egoismus bezeichnet werden. Ebenso verständlich wird auch die allgemein anerkannte und für rätselhaft gehaltene »diagnostische« Fähigkeit des Traumes, in welchem beginnende Körperleiden oft früher und deutlicher als im Wachen verspürt werden und alle gerade aktuellen Körperempfindungen ins Riesenhafte vergrößert auftreten. Diese Vergrößerung ist hypochondrischer Natur, sie hat zur Voraussetzung, daß alle psychische Besetzung von der Außenwelt auf das eigene Ich zurückgezogen wurde, und sie ermöglicht nun die frühzeitige Erkennung von körperlichen Veränderungen, die im Wachleben noch eine Weile unbemerkt geblieben wären.
Ein Traum zeigt uns an, daß etwas vorging, was den Schlaf stören wollte, und gestattet uns Einsicht in die Art, wie diese Störung abgewehrt werden konnte. Am Ende hat der Schlafende geträumt und kann seinen Schlaf fortsetzen; an Stelle des inneren Anspruches, der ihn beschäftigen wollte, ist ein äußeres Erlebnis getreten, dessen Anspruch erledigt worden ist. Ein Traum ist also auch eine Projektion, eine Veräußerlichung eines inneren Vorganges. Wir erinnern uns, daß wir die Projektion bereits an anderer Stelle unter den Mitteln der Abwehr begegnet haben. Auch der Mechanismus der hysterischen Phobie gipfelte darin, daß das Individuum sich durch Fluchtversuche vor einer äußeren Gefahr schützen durfte, welche an die Stelle eines inneren Triebanspruches getreten war. Eine gründliche Erörterung der Projektion sparen wir uns aber auf, bis wir zur Zergliederung jener narzißtischen Affektion gekommen sind, bei welcher dieser Mechanismus die auffälligste Rolle spielt.
Auf welche Weise kann aber der Fall herbeigeführt werden, daß die Absicht zu schlafen eine Störung erfährt? Die Störung kann von innerer Erregung oder von äußerem Reiz ausgehen. Wir wollen den minder durchsichtigen und interessanteren Fall der Störung von innen zuerst in Betracht ziehen; die Erfahrung zeigt uns als Erreger des Traumes Tagesreste, Denkbesetzungen, welche sich der allgemeinen Abziehung der Besetzungen nicht gefügt und ihr zum Trotz ein gewisses Maß von libidinösem oder anderem Interesse behalten haben. Der Narzißmus des Schlafes hat also hier von vornherein eine Ausnahme zulassen müssen, und mit dieser hebt die Traumbildung an. Diese Tagesreste lernen wir in der Analyse als latente Traumgedanken kennen und müssen sie nach ihrer Natur wie zufolge der ganzen Situation als vorbewußte Vorstellungen, als Angehörige des Systems Vbw gelten lassen.
Die weitere Aufklärung der Traumbildung gelingt nicht ohne Überwindung gewisser Schwierigkeiten. Der Narzißmus des Schlafzustandes bedeutet ja die Abziehung der Besetzung von allen Objektvorstellungen, sowohl der unbewußten wie der vorbewußten Anteile derselben. Wenn also gewisse »Tagesreste« besetzt geblieben sind, so hat es Bedenken anzunehmen, daß diese zur Nachtzeit soviel Energie erwerben, um sich die Beachtung des Bewußtseins zu erzwingen; man ist eher geneigt anzunehmen, daß die ihnen verbliebene Besetzung um vieles schwächer ist, als die ihnen tagsüber eigen war. Die Analyse überhebt uns hier weiterer Spekulationen, indem sie uns nachweist, daß diese Tagesreste eine Verstärkung aus den Quellen unbewußter Triebregungen bekommen müssen, wenn sie als Traumbildner auftreten sollen. Diese Annahme hat zunächst keine Schwierigkeiten, denn wir müssen glauben, daß die Zensur zwischen Vbw und Vbw im Schlafe sehr herabgesetzt, der Verkehr zwischen beiden Systemen also eher erleichtert ist.
Aber ein anderes Bedenken darf nicht verschwiegen werden. Wenn der narzißtische Schlafzustand die Einziehung aller Besetzungen der Systeme Ubw und Vbw zur Folge gehabt hat, so entfällt ja auch die Möglichkeit, daß die vorbewußten Tagesreste eine Verstärkung aus den unbewußten Triebregungen beziehen, die selbst ihre Besetzungen an das Ich abgegeben haben. Die Theorie der Traumbildung läuft hier in einen Widerspruch aus, oder sie muß durch eine Modifikation der Annahme über den Schlafnarzißmus gerettet werden.
Eine solche einschränkende Annahme wird, wie sich später ergeben soll, auch in der Theorie der Dementia praecox unabweisbar. Sie kann nur lauten, daß der verdrängte Anteil des Systems Ubw dem vom Ich ausgehenden Schlafwunsche nicht gehorcht, seine Besetzung ganz oder teilweise behält und sich überhaupt infolge der Verdrängung ein gewisses Maß von Unabhängigkeit vom Ich geschaffen hat. In weiterer Entsprechung müßte auch ein gewisser Betrag des Verdrängungsaufwandes (der Gegenbesetzung) die Nacht über aufrechterhalten werden, um der Triebgefahr zu begegnen, obwohl die Unzugänglichkeit aller Wege zur Affektentbindung und zur Motilität die Höhe der notwendigen Gegenbesetzung erheblich herabsetzen mag. Wir würden uns also die zur Traumbildung führende Situation folgenderart ausmalen: Der Schlafwunsch versucht alle vom Ich ausgeschickten Besetzungen einzuziehen und einen absoluten Narzißmus herzustellen. Das kann nur teilweise gelingen, denn das Verdrängte des Systems Ubw folgt dem Schlafwunsche nicht. Es muß also auch ein Teil der Gegenbesetzungen aufrechterhalten werden und die Zensur zwischen Ubw und Vbw, wenngleich nicht in voller Stärke, verbleiben. Soweit die Herrschaft des Ichs reicht, sind alle Systeme von Besetzungen entleert. Je stärker die ubw Triebbesetzungen sind, desto labiler ist der Schlaf. Wir kennen auch den extremen Fall, daß das Ich den Schlafwunsch aufgibt, weil es sich unfähig fühlt, die während des Schlafes frei gewordenen verdrängten Regungen zu hemmen, mit anderen Worten, daß es auf den Schlaf verzichtet, weil es sich vor seinen Träumen fürchtet.
Wir werden später die Annahme von der Widersetzlichkeit der verdrängten Regungen als eine folgenschwere schätzen lernen. Verfolgen wir nun die Situation der Traumbildung weiter.
Als zweiten Einbruch in den Narzißmus müssen wir die vorhin erwähnte Möglichkeit würdigen, daß auch einige der vorbewußten Tagesgedanken sich resistent erweisen und einen Teil ihrer Besetzung festhalten. Die beiden Fälle können im Grunde identisch sein; die Resistenz der Tagesreste mag sich auf die bereits im Wachleben bestehende Verknüpfung mit unbewußten Regungen zurückführen, oder es geht etwas weniger einfach zu, und die nicht ganz entleerten Tagesreste setzen sich erst im Schlafzustand, dank der erleichterten Kommunikation zwischen Vbw und Ubw, mit dem Verdrängten in Beziehung. In beiden Fällen erfolgt nun der nämliche entscheidende Fortschritt der Traumbildung: Es wird der vorbewußte Traumwunsch geformt, welcher der unbewußten Regung Ausdruck gibt in dem Material der vorbewußten Tagesreste. Diesen Traumwunsch sollte man von den Tagesresten scharf unterscheiden; er muß im Wachleben nicht bestanden haben, er kann bereits den irrationalen Charakter zeigen, den alles Unbewußte an sich trägt, wenn man es ins Bewußte übersetzt. Der Traumwunsch darf auch nicht mit den Wunschregungen verwechselt werden, die sich möglicherweise, aber gewiß nicht notwendigerweise, unter den vorbewußten (latenten) Traumgedanken befunden haben. Hat es aber solche vorbewußte Wünsche gegeben, so gesellt sich ihnen der Traumwunsch als wirksamste Verstärkung hinzu.
Es handelt sich nun um die weiteren Schicksale dieser in ihrem Wesen einen unbewußten Triebanspruch vertretenden Wunschregung, die sich im Vbw als Traumwunsch (wunscherfüllende Phantasie) gebildet hat. Sie könnte ihre Erledigung auf drei verschiedenen Wegen finden, sagt uns die Überlegung. Entweder auf dem Wege, der im Wachleben der normale wäre, aus dem Vbw zum Bewußtsein drängen oder sich mit Umgehung des Bw direkte motorische Abfuhr schaffen, oder den unvermuteten Weg nehmen, den uns die Beobachtung wirklich verfolgen läßt. Im ersteren Falle würde sie zu einer Wahnidee mit dem Inhalt der Wunscherfüllung, aber das geschieht im Schlafzustande nie. (Mit den metapsychologischen Bedingungen der seelischen Prozesse so wenig vertraut, können wir aus dieser Tatsache vielleicht den Wink entnehmen, daß die völlige Entleerung eines Systems es für Anregungen wenig ansprechbar macht.) Der zweite Fall, die direkte motorische Abfuhr, sollte durch das nämliche Prinzip ausgeschlossen sein, denn der Zugang zur Motilität liegt normalerweise noch ein Stück weiter weg von der Bewußtseinszensur, aber er kommt ausnahmsweise als Somnambulismus zur Beobachtung. Wir wissen nicht, welche Bedingungen dies ermöglichen und warum er sich nicht häufiger ereignet. Was bei der Traumbildung wirklich geschieht, ist eine sehr merkwürdige und ganz unvorhergesehene Entscheidung. Der im Vbw angesponnene und durch das Ubw verstärkte Vorgang nimmt einen rückläufigen Weg durch das Ubw zu der dem Bewußtsein sich aufdrängenden Wahrnehmung. Diese Regression ist die dritte Phase der Traumbildung. Wir wiederholen hier zur Übersicht die früheren: Verstärkung der vbw Tagesreste durch das Ubw – Herstellung des Traumwunsches.
Wir heißen eine solche Regression eine topische zum Unterschied von der vorhin erwähnten zeitlichen oder entwicklungsgeschichtlichen. Die beiden müssen nicht immer zusammenfallen, tun es aber gerade in dem uns vorliegenden Beispiele. Die Rückwendung des Ablaufes der Erregung vom Vbw durch das Ubw zur Wahrnehmung ist gleichzeitig die Rückkehr zu der frühen Stufe der halluzinatorischen Wunscherfüllung.
Es ist aus der Traumdeutung bekannt, in welcher Weise die Regression der vorbewußten Tagesreste bei der Traumbildung vor sich geht. Gedanken werden dabei in – vorwiegend visuelle – Bilder umgesetzt, also Wortvorstellungen auf die ihnen entsprechenden Sachvorstellungen zurückgeführt, im ganzen so, als ob eine Rücksicht auf Darstellbarkeit den Prozeß beherrschen würde. Nach vollzogener Regression erübrigt eine Reihe von Besetzungen im System Ubw, Besetzungen von Sacherinnerungen, auf welche der psychische Primärvorgang einwirkt, bis er durch deren Verdichtung und Verschiebung der Besetzungen zwischen ihnen den manifesten Trauminhalt gestaltet hat. Nur wo die Wortvorstellungen in den Tagesresten frische, aktuelle Reste von Wahrnehmungen sind, nicht Gedankenausdruck, werden sie wie Sachvorstellungen behandelt und unterliegen an sich den Einflüssen der Verdichtung und Verschiebung. Daher die in der Traumdeutung gegebene, seither zur Evidenz bestätigte Regel, daß Worte und Reden im Trauminhalt nicht neugebildet, sondern Reden des Traumtages (oder sonstigen frischen Eindrücken, auch aus Gelesenem) nachgebildet werden. Es ist sehr bemerkenswert, wie wenig die Traumarbeit an den Wortvorstellungen festhält; sie ist jederzeit bereit, die Worte miteinander zu vertauschen, bis sie jenen Ausdruck findet, welcher der plastischen Darstellung die günstigste Handhabe bietet [Fußnote]Der Rücksicht auf Darstellbarkeit schreibe ich auch die von Silberer betonte und vielleicht von ihm überschätzte Tatsache zu, daß manche Träume zwei gleichzeitig zutreffende und doch wesensverschiedene Deutungen gestatten, von denen Silberer die eine die analytische, die andere die anagogische heißt. Es handelt sich dann immer um Gedanken von sehr abstrakter Natur, die der Darstellung im Traume große Schwierigkeiten bereiten mußten. Man halte sich zum Vergleiche etwa die Aufgabe vor, den Leitartikel einer politischen Zeitung durch Illustrationen zu ersetzen! In solchen Fällen muß die Traumarbeit den abstrakten Gedankentext erst durch einen konkreteren ersetzen, welcher mit ihm irgendwie durch Vergleich, Symbolik, allegorische Anspielung, am besten aber genetisch verknüpft ist und der nun an seiner Stelle Material der Traumarbeit wird. Die abstrakten Gedanken ergeben die sogenannte anagogische Deutung, die wir bei der Deutungsarbeit leichter erraten als die eigentlich analytische. Nach einer richtigen Bemerkung von O. Rank sind gewisse Kurträume von analytisch behandelten Patienten die besten Vorbilder für die Auffassung solcher Träume mit mehrfacher Deutung..
In diesem Punkte zeigt sich nun der entscheidende Unterschied zwischen der Traumarbeit und der Schizophrenie. Bei letzterer werden die Worte selbst, in denen der vorbewußte Gedanke ausgedrückt war, Gegenstand der Bearbeitung durch den Primärvorgang; im Traume sind es nicht die Worte, sondern die Sachvorstellungen, auf welche die Worte zurückgeführt wurden. Der Traum kennt eine topische Regression, die Schizophrenie nicht; beim Traume ist der Verkehr zwischen ( vbw) Wortbesetzungen und ( ubw) Sachbesetzungen frei; für die Schizophrenie bleibt charakteristisch, daß er abgesperrt ist. Der Eindruck dieser Verschiedenheit wird gerade durch die Traumdeutungen, die wir in der psychoanalytischen Praxis vornehmen, abgeschwächt. Indem die Traumdeutung den Verlauf der Traumarbeit aufspürt, die Wege verfolgt, die von den latenten Gedanken zu den Traumelementen führen, die Ausbeutung der Wortzweideutigkeiten aufdeckt und die Wortbrücken zwischen verschiedenen Materialkreisen nachweist, macht sie einen bald witzigen, bald schizophrenen Eindruck und läßt uns daran vergessen, daß alle Operationen an Worten für den Traum nur Vorbereitung zur Sachregression sind.
Die Vollendung des Traumvorganges liegt darin, daß der regressiv verwandelte, zu einer Wunschphantasie umgearbeitete Gedankeninhalt als sinnliche Wahrnehmung bewußt wird, wobei er die sekundäre Bearbeitung erfährt, welcher jeder Wahrnehmungsinhalt unterliegt. Wir sagen, der Traumwunsch wird halluziniert und findet als Halluzination den Glauben an die Realität seiner Erfüllung. Gerade an dieses abschließende Stück der Traumbildung knüpfen sich die stärksten Unsicherheiten, zu deren Klärung wir den Traum in Vergleich mit ihm verwandten pathologischen Zuständen bringen wollen.
Die Bildung der Wunschphantasie und deren Regression zur Halluzination sind die wesentlichsten Stücke der Traumarbeit, doch kommen sie ihm nicht ausschließend zu. Vielmehr finden sie sich ebenso bei zwei krankhaften Zuständen, bei der akuten halluzinatorischen Verworrenheit, der Amentia (Meynerts), und in der halluzinatorischen Phase der Schizophrenie. Das halluzinatorische Delir der Amentia ist eine deutlich kennbare Wunschphantasie, oft völlig geordnet wie ein schöner Tagtraum. Man könnte ganz allgemein von einer halluzinatorischen Wunschpsychose sprechen und sie dem Traume wie der Amentia in gleicher Weise zuerkennen. Es kommen auch Träume vor, welche aus nichts anderem als aus sehr reichhaltigen, unentstellten Wunschphantasien bestehen. Die halluzinatorische Phase der Schizophrenie ist minder gut studiert; sie scheint in der Regel zusammengesetzter Natur zu sein, dürfte aber im wesentlichen einem neuen Restitutionsversuch entsprechen, der die libidinöse Besetzung zu den Objektvorstellungen zurückbringen will [Fußnote]Als ersten solchen Versuch haben wir in der Abhandlung über das ›Unbewußte‹ die Überbesetzung der Wortvorstellungen kennengelernt.. Die anderen halluzinatorischen Zustände bei mannigfaltigen pathologischen Affektionen kann ich nicht zum Vergleich heranziehen, weil ich hier weder über eigene Erfahrung verfüge noch die anderer verwerten kann.
Machen wir uns klar, daß die halluzinatorische Wunschpsychose – im Traume oder anderwärts – zwei keineswegs ineinanderfallende Leistungen vollzieht. Sie bringt nicht nur verborgene oder verdrängte Wünsche zum Bewußtsein, sondern stellt sie auch unter vollem Glauben als erfüllt dar. Es gilt dieses Zusammentreffen zu verstehen. Man kann keineswegs behaupten, die unbewußten Wünsche müßten für Realitäten gehalten werden, nachdem sie einmal bewußt geworden sind, denn unser Urteil ist bekanntermaßen sehr wohl imstande, Wirklichkeiten von noch so intensiven Vorstellungen und Wünschen zu unterscheiden. Dagegen scheint es gerechtfertigt anzunehmen, daß der Realitätsglaube an die Wahrnehmung durch die Sinne geknüpft ist. Wenn einmal ein Gedanke den Weg zur Regression bis zu den unbewußten Objekterinnerungsspuren und von da bis zur Wahrnehmung gefunden hat, so anerkennen wir seine Wahrnehmung als real. Die Halluzination bringt also den Realitätsglauben mit sich. Es fragt sich nun, welches die Bedingung für das Zustandekommen einer Halluzination ist. Die erste Antwort würde lauten: Die Regression, und somit die Frage nach der Entstehung der Halluzination durch die nach dem Mechanismus der Regression ersetzen. Die Antwort darauf brauchten wir für den Traum nicht lange schuldig zu bleiben. Die Regression der vbw Traumgedanken zu den Sacherinnerungsbildern ist offenbar die Folge der Anziehung, welche diese ubw Triebrepräsentanzen – z. B. verdrängte Erlebniserinnerungen – auf die in Worte gefaßten Gedanken ausüben. Allein wir merken bald, daß wir auf falsche Fährte geraten sind. Wäre das Geheimnis der Halluzination kein anderes als das der Regression, so müßte jede genug intensive Regression eine Halluzination mit Realitätsglauben ergeben. Wir kennen aber sehr wohl die Fälle, in denen ein regressives Nachdenken sehr deutliche visuelle Erinnerungsbilder zum Bewußtsein bringt, die wir darum keinen Augenblick für reale Wahrnehmung halten. Wir könnten uns auch sehr wohl vorstellen, daß die Traumarbeit bis zu solchen Erinnerungsbildern vordringt, uns die bisher unbewußten bewußtmacht und uns eine Wunschphantasie vorspiegelt, die wir sehnsüchtig empfinden, aber nicht als die reale Erfüllung des Wunsches anerkennen würden. Die Halluzination muß also mehr sein als die regressive Belebung der an sich ubw Erinnerungsbilder.
Halten wir uns noch vor, daß es von großer praktischer Bedeutung ist, Wahrnehmungen von noch so intensiv erinnerten Vorstellungen zu unterscheiden. Unser ganzes Verhältnis zur Außenwelt, zur Realität, hängt von dieser Fähigkeit ab. Wir haben die Fiktion aufgestellt, daß wir diese Fähigkeit nicht immer besaßen und daß wir zu Anfang unseres Seelenlebens wirklich das befriedigende Objekt halluzinierten, wenn wir das Bedürfnis nach ihm verspürten. Aber die Befriedigung blieb in solchem Falle aus, und der Mißerfolg muß uns sehr bald bewogen haben, eine Einrichtung zu schaffen, mit deren Hilfe eine solche Wunschwahrnehmung von einer realen Erfüllung unterschieden und im weiteren vermieden werden konnte. Wir haben mit anderen Worten sehr frühzeitig die halluzinatorische Wunschbefriedigung aufgegeben und eine Art der Realitätsprüfung eingerichtet. Die Frage erhebt sich nun, worin bestand diese Realitätsprüfung, und wie bringt es die halluzinatorische Wunschpsychose des Traumes und der Amentia u. dgl. zustande, sie aufzuheben und den alten Modus der Befriedigung wiederherzustellen.
Die Antwort läßt sich geben, wenn wir nun darangehen, das dritte unserer psychischen Systeme, das System Bw, welches wir bisher vom Vbw nicht scharf gesondert haben, näher zu bestimmen. Wir haben uns schon in der Traumdeutung entschließen müssen, die bewußte Wahrnehmung als die Leistung eines besonderen Systems in Anspruch zu nehmen, dem wir gewisse merkwürdige Eigenschaften zugeschrieben haben und mit guten Gründen noch weitere Charaktere beilegen werden. Dieses dort W genannte System bringen wir zur Deckung mit dem System Bw, an dessen Arbeit in der Regel das Bewußtwerden hängt. Noch immer aber deckt sich die Tatsache des Bewußtwerdens nicht völlig mit der Systemzugehörigkeit, denn wir haben ja erfahren, daß sinnliche Erinnerungsbilder bemerkt werden können, denen wir unmöglich einen psychischen Ort im System Bw oder W zugestehen können. Allein die Behandlung dieser Schwierigkeit darf wiederum aufgeschoben werden, bis wir das System Bw selbst als Mittelpunkt unseres Interesses einstellen können. Für unseren gegenwärtigen Zusammenhang darf uns die Annahme gestattet werden, daß die Halluzination in einer Besetzung des Systems Bw ( W) besteht, die aber nicht wie normal von außen, sondern von innen her erfolgt, und daß sie zur Bedingung hat, die Regression müsse so weit gehen, daß sie dies System selbst erreicht und sich dabei über die Realitätsprüfung hinaussetzen kann.
Wir haben in einem früheren Zusammenhang (›Triebe und Triebschicksale‹) für den noch hilflosen Organismus die Fähigkeit in Anspruch genommen, mittels seiner Wahrnehmungen eine erste Orientierung in der Welt zu schaffen, indem er »außen« und »innen« nach der Beziehung zu einer Muskelaktion unterscheidet. Eine Wahrnehmung, die durch eine Aktion zum Verschwinden gebracht wird, ist als eine äußere, als Realität erkannt; wo solche Aktion nichts ändert, kommt die Wahrnehmung aus dem eigenen Körperinnern, sie ist nicht real. Es ist dem Individuum wertvoll, daß es ein solches Kennzeichen der Realität besitzt, welches gleichzeitig eine Abhilfe gegen sie bedeutet, und es wollte gern mit ähnlicher Macht gegen seine oft unerbittlichen Triebansprüche ausgestattet sein. Darum wendet es solche Mühe daran, was ihm von innen her beschwerlich wird, nach außen zu versetzen, zu projizieren.
Diese Leistung der Orientierung in der Welt durch Unterscheidung von innen und außen müssen wir nun nach einer eingehenden Zergliederung des seelischen Apparates dem System Bw ( W) allein zuschreiben. Bw muß über eine motorische Innervation verfügen, durch welche festgestellt wird, ob die Wahrnehmung zum Verschwinden zu bringen ist oder sich resistent verhält. Nichts anderes als diese Einrichtung braucht die Realitätsprüfung zu sein [Fußnote]Über die Unterscheidung einer Aktualitäts- von einer Realitätsprüfung siehe an späterer Stelle.. Näheres darüber können wir nicht aussagen, da Natur und Arbeitsweise des Systems Bw noch zuwenig bekannt sind. Die Realitätsprüfung werden wir als eine der großen Institutionen des Ichs neben die uns bekannt gewordenen Zensuren zwischen den psychischen Systemen hinstellen und erwarten, daß uns die Analyse der narzißtischen Affektionen andere solcher Institutionen aufzudecken verhilft.
Hingegen können wir schon jetzt aus der Pathologie erfahren, auf welche Weise die Realitätsprüfung aufgehoben oder außer Tätigkeit gesetzt werden kann, und zwar werden wir es in der Wunschpsychose, der Amentia, unzweideutiger erkennen als am Traum: Die Amentia ist die Reaktion auf einen Verlust, den die Realität behauptet, der aber vom Ich als unerträglich verleugnet werden soll. Darauf bricht das Ich die Beziehung zur Realität ab, es entzieht dem System der Wahrnehmungen Bw die Besetzung oder vielleicht besser eine Besetzung, deren besondere Natur noch Gegenstand einer Untersuchung werden kann. Mit dieser Abwendung von der Realität ist die Realitätsprüfung beseitigt, die – unverdrängten, durchaus bewußten – Wunschphantasien können ins System vordringen und werden von dort aus als bessere Realität anerkannt. Eine solche Entziehung darf den Verdrängungsvorgängen beigeordnet werden; die Amentia bietet uns das interessante Schauspiel einer Entzweiung des Ichs mit einem seiner Organe, welches ihm vielleicht am getreuesten diente und am innigsten verbunden war [Fußnote]Man kann von hier aus die Vermutung wagen, daß auch die toxischen Halluzinosen, z. B. das Alkoholdelirium, in analoger Weise zu verstehen sind. Der unerträgliche Verlust, der von der Realität auferlegt wird, wäre eben der des Alkohols, Zuführung desselben hebt die Halluzinationen auf..
Was bei der Amentia die »Verdrängung« leistet, das macht beim Traum der freiwillige Verzicht. Der Schlafzustand will nichts von der Außenwelt wissen, interessiert sich nicht für die Realität oder nur insoweit, als das Verlassen des Schlafzustandes, das Erwachen, in Betracht kommt. Er zieht also auch die Besetzung vom System Bw ab, wie von den anderen Systemen, dem Vbw und dem Ubw, soweit die in ihnen vorhandenen Positionen dem Schlafwunsch gehorchen. Mit dieser Unbesetztheit des Systems Bw ist die Möglichkeit einer Realitätsprüfung aufgegeben, und die Erregungen, welche vom Schlafzustand unabhängig den Weg der Regression eingeschlagen haben, werden ihn frei finden bis zum System Bw, in welchem sie als unbestrittene Realität gelten werden [Fußnote]Das Prinzip der Unerregbarkeit unbesetzter Systeme erscheint hier für das Bw ( W) außer Kraft gesetzt. Aber es kann sich um nur teilweise Aufhebung der Besetzung handeln, und gerade für das Wahrnehmungssystem werden wir eine Anzahl von Erregungsbedingungen annehmen müssen, die von denen anderer Systeme weit abweichen. – Der unsicher tastende Charakter dieser metapsychologischen Erörterungen soll natürlich in keiner Weise verschleiert oder beschönigt werden. Erst weitere Vertiefung kann zu einem gewissen Grade von Wahrscheinlichkeit führen.. Für die halluzinatorische Psychose der Dementia praecox werden wir aus unseren Erwägungen ableiten, daß sie nicht zu den Eingangssymptomen der Affektion gehören kann. Sie wird erst ermöglicht, wenn das Ich des Kranken so weit zerfallen ist, daß die Realitätsprüfung nicht mehr die Halluzination verhindert.
Zur Psychologie der Traumvorgänge erhalten wir das Resultat, daß alle wesentlichen Charaktere des Traumes durch die Bedingung des Schlafzustandes determiniert werden. Der alte Aristoteles behält mit seiner unscheinbaren Aussage, der Traum sei die seelische Tätigkeit des Schlafenden, in allen Stücken recht. Wir konnten ausführen: ein Rest von seelischer Tätigkeit, dadurch ermöglicht, daß sich der narzißtische Schlafzustand nicht ausnahmslos durchsetzen ließ. Das lautet ja nicht viel anders, als was Psychologen und Philosophen von jeher gesagt haben, ruht aber auf ganz abweichenden Ansichten über den Bau und die Leistung des seelischen Apparates, die den Vorzug vor den früheren haben, daß sie auch alle Einzelheiten des Traumes unserem Verständnis nahebringen konnten.
Werfen wir am Ende noch einen Blick auf die Bedeutung, welche eine Topik des Verdrängungsvorganges für unsere Einsicht in den Mechanismus der seelischen Störungen gewinnt. Beim Traum betrifft die Entziehung der Besetzung (Libido, Interesse) alle Systeme gleichmäßig, bei den Übertragungsneurosen wird die vbw Besetzung zurückgezogen, bei der Schizophrenie die des Ubw, bei der Amentia die des Bw.
Mitteilung eines der psychoanalytischen Theorie widersprechenden Falles von Paranoia (1915)
Vor Jahren ersuchte mich ein bekannter Rechtsanwalt um Begutachtung eines Falles, dessen Auffassung ihm zweifelhaft erschien. Eine junge Dame hatte sich an ihn gewendet, um Schutz gegen die Verfolgungen eines Mannes zu finden, der sie zu einem Liebesverhältnis bewogen hatte. Sie behauptete, daß dieser Mann ihre Gefügigkeit mißbraucht hatte, um von ungesehenen Zuschauern photographische Aufnahmen ihres zärtlichen Beisammenseins herstellen zu lassen; nun läge es in seiner Hand, sie durch das Zeigen dieser Bilder zu beschämen und zum Aufgeben ihrer Stellung zu zwingen. Der Rechtsfreund war erfahren genug, das krankhafte Gepräge dieser Anklage zu erkennen, meinte aber, es komme so viel im Leben vor, was man für unglaubwürdig halten möchte, daß ihm das Urteil eines Psychiaters über die Sache wertvoll wäre. Er versprach, mich ein nächstes Mal in Gesellschaft der Klägerin zu besuchen.
Ehe ich meinen Bericht fortsetze, will ich bekennen, daß ich das Milieu der zu untersuchenden Begebenheit zur Unkenntlichkeit verändert habe, aber auch nichts anderes als dies. Ich halte es sonst für einen Mißbrauch, aus irgendwelchen, wenn auch aus den besten Motiven, Züge einer Krankengeschichte in der Mitteilung zu entstellen, da man unmöglich wissen kann, welche Seite des Falles ein selbständig urteilender Leser herausgreifen wird, und somit Gefahr läuft, diesen letzteren in die Irre zu führen.
Die Patientin, die ich nun bald darauf kennenlernte, war ein dreißigjähriges Mädchen von ungewöhnlicher Anmut und Schönheit; sie schien viel jünger zu sein, als sie angab, und machte einen echt weiblichen Eindruck. Gegen den Arzt benahm sie sich voll ablehnend und gab sich keine Mühe, ihr Mißtrauen zu verbergen. Offenbar nur unter dem Drucke des mitanwesenden Rechtsfreundes erzählte sie die folgende Geschichte, die mir ein später zu erwähnendes Problem aufgab. Ihre Mienen und Affektäußerungen verrieten dabei nichts von einer schamhaften Befangenheit, wie sie der Einstellung zu dem fremden Zuhörer entsprochen hätte. Sie stand ausschließlich unter dem Banne der Besorgnis, die sich aus ihrem Erlebnis ergeben hatte.
Sie war jahrelang Angestellte in einem großen Institut gewesen, in dem sie einen verantwortlichen Posten zur eigenen Befriedigung und zur Zufriedenheit der Vorgesetzten innehatte. Liebesbeziehungen zu Männern hatte sie nie gesucht; sie lebte ruhig neben einer alten Mutter, deren einzige Stütze sie war. Geschwister fehlten, der Vater war vor vielen Jahren gestorben. In der letzten Zeit hatte sich ein männlicher Beamter desselben Bureaus ihr genähert, ein sehr gebildeter, einnehmender Mann, dem auch sie ihre Sympathie nicht versagen konnte. Eine Heirat zwischen ihnen war durch äußere Verhältnisse ausgeschlossen, aber der Mann wollte nichts davon wissen, dieser Unmöglichkeit wegen den Verkehr aufzugeben. Er hielt ihr vor, wie unsinnig es sei, wegen sozialer Konventionen auf alles zu verzichten, was sie sich beide wünschten, worauf sie ein unzweifelhaftes Anrecht hätten und was wie nichts anderes zur Erhöhung des Lebens beitrüge. Da er versprochen hatte, sie nicht in Gefahr zu bringen, willigte sie endlich ein, ihn in seiner Junggesellenwohnung bei Tage zu besuchen. Dort kam es nun zu Küssen und Umarmungen, sie lagerten sich nebeneinander, er bewunderte ihre zum Teil enthüllte Schönheit. Mitten in dieser Schäferstunde wurde sie durch ein einmaliges Geräusch wie ein Pochen oder Ticken erschreckt. Es kam von der Gegend des Schreibtisches her, welcher schräg vor dem Fenster stand; der Zwischenraum zwischen Tisch und Fenster war zum Teil von einem schweren Vorhang eingenommen. Sie erzählte, daß sie den Freund sofort nach der Bedeutung des Geräusches gefragt und von ihm die Auskunft bekommen hatte, es rühre wahrscheinlich von der kleinen, auf dem Schreibtisch befindlichen Stehuhr her; ich werde mir aber die Freiheit nehmen, zu diesem Teil ihres Berichts später eine Bemerkung zu machen.
Als sie das Haus verließ, traf sie noch auf der Treppe mit zwei Männern zusammen, die bei ihrem Anblick einander etwas zuflüsterten. Einer der beiden Unbekannten trug einen verhüllten Gegenstand wie ein Kästchen. Die Begegnung beschäftigte ihre Gedanken; noch auf dem Heimwege bildete sie die Kombination, dies Kästchen könnte leicht ein photographischer Apparat gewesen sein, der Mann, der es trug, ein Photograph, der während ihrer Anwesenheit im Zimmer hinter dem Vorhang versteckt geblieben war, und das Ticken, das sie gehört, das Geräusch des Abdrückens, nachdem der Mann die besonders verfängliche Situation herausgefunden, die er im Bilde festhalten wollte. Ihr Argwohn gegen den Geliebten war von da an nicht mehr zum Schweigen zu bringen; sie verfolgte ihn mündlich und schriftlich mit der Anforderung, ihr Aufklärung und Beruhigung zu geben, und mit Vorwürfen, erwies sich aber unzugänglich gegen die Versicherungen, die er ihr machte, mit denen er die Aufrichtigkeit seiner Gefühle und die Grundlosigkeit ihrer Verdächtigung vertrat. Endlich wandte sie sich an den Advokaten, erzählte ihm ihr Erlebnis und übergab ihm die Briefe, die sie in dieser Angelegenheit von dem Verdächtigten erhalten hatte. Ich konnte später in einige dieser Briefe Einsicht nehmen; sie machten mir den besten Eindruck; ihr Hauptinhalt war das Bedauern, daß ein so schönes, zärtliches Einvernehmen durch diese »unglückselige krankhafte Idee« zerstört worden sei.
Es bedarf wohl keiner Rechtfertigung, daß ich das Urteil des Beschuldigten auch zu dem meinigen machte. Aber der Fall hatte für mich ein anderes als bloß diagnostisches Interesse. Es war in der psychoanalytischen Literatur behauptet worden, daß der Paranoiker gegen eine Verstärkung seiner homosexuellen Strebungen ankämpft, was im Grunde auf eine narzißtische Objektwahl zurückweist. Es war ferner gedeutet worden, daß der Verfolger im Grunde der Geliebte oder der ehemals Geliebte sei. Aus der Zusammensetzung beider Aufstellungen ergibt sich die Forderung, der Verfolger müsse von demselben Geschlecht sein wie der Verfolgte. Den Satz von der Bedingtheit der Paranoia durch die Homosexualität hatten wir allerdings nicht als allgemein und ausnahmslos gültig hingestellt, aber nur darum nicht, weil unsere Beobachtungen nicht genug zahlreich waren. Er gehörte sonst zu jenen, die infolge gewisser Zusammenhänge nur dann bedeutungsvoll sind, wenn sie Allgemeinheit beanspruchen können. In der psychiatrischen Literatur fehlte es gewiß nicht an Fällen, in denen sich der Kranke von Angehörigen des anderen Geschlechtes verfolgt glaubte, aber es blieb ein anderer Eindruck, von solchen Fällen zu lesen, als einen derselben selbst vor sich zu sehen. Was ich und meine Freunde hatten beobachten und analysieren können, hatte bisher die Beziehung der Paranoia zur Homosexualität ohne Schwierigkeit bestätigt. Der hier vorgeführte Fall sprach mit aller Entschiedenheit dagegen. Das Mädchen schien die Liebe zu einem Mann abzuwehren, indem sie den Geliebten unmittelbar in den Verfolger verwandelte; vom Einfluß des Weibes, von einem Sträuben gegen eine homosexuelle Bindung war nichts zu finden.
Bei dieser Sachlage war es wohl das Einfachste, die Parteinahme für eine allgemein gültige Abhängigkeit des Verfolgungswahnes von der Homosexualität und alles, was sich weiter daran knüpfte, wieder aufzugeben. Man mußte wohl auf diese Erkenntnis verzichten, wenn man sich nicht etwa durch diese Abweichung von der Erwartung bestimmen ließ, sich auf die Seite des Rechtsfreundes zu schlagen und wie er ein richtig gedeutetes Erlebnis anstatt einer paranoischen Kombination anzuerkennen. Ich sah aber einen anderen Ausweg, welcher die Entscheidung zunächst hinausschob. Ich erinnerte mich daran, wie oft man in die Lage gekommen war, psychisch Kranke falsch zu beurteilen, weil man sich nicht eindringlich genug mit ihnen beschäftigt und so zu wenig von ihnen erfahren hatte. Ich erklärte also, es sei mir unmöglich, heute ein Urteil zu äußern, und bitte sie vielmehr, mich ein zweites Mal zu besuchen, um mir die Geschichte ausführlicher und mit allen, diesmal vielleicht übergangenen, Nebenumständen zu erzählen. Durch die Vermittlung des Advokaten erreichte ich dies Zugeständnis von der sonst unwilligen Patientin; er kam mir auch durch die Erklärung zu Hilfe, daß bei dieser zweiten Unterredung seine Anwesenheit überflüssig sei.
Die zweite Erzählung der Patientin hob die frühere nicht auf, brachte aber solche Ergänzungen, daß alle Zweifel und Schwierigkeiten wegfielen. Vor allem, sie hatte den jungen Mann nicht einmal, sondern zweimal in seiner Wohnung besucht. Beim zweiten Zusammensein ereignete sich die Störung durch das Geräusch, an welches sie ihren Verdacht angeknüpft hatte; den ersten Besuch hatte sie bei der ersten Mitteilung unterschlagen, ausgelassen, weil er ihr nicht mehr bedeutsam vorkam. Bei diesem ersten Besuch hatte sich nichts Auffälliges zugetragen, wohl aber am Tage nachher. Die Abteilung des großen Unternehmens, bei welcher sie tätig war, stand unter der Leitung einer alten Dame, die sie mit den Worten beschrieb: »Sie hat weiße Haare wie meine Mutter.« Sie war es gewöhnt, von dieser alten Vorgesetzten sehr zärtlich behandelt, auch wohl manchmal geneckt zu werden, und hielt sich für ihren besonderen Liebling. Am Tage nach ihrem ersten Besuch bei dem jungen Beamten erschien dieser in den Geschäftsräumen, um der alten Dame etwas dienstlich mitzuteilen, und während er leise mit dieser sprach, entstand in ihr plötzlich die Gewißheit, er mache ihr Mitteilung von dem gestrigen Abenteuer, ja, er unterhalte längst ein Verhältnis mit ihr, von dem sie selbst nur bisher nichts gemerkt habe. Die weißhaarige, mütterliche Alte wisse nun alles. Im weiteren Verlaufe des Tages konnte sie aus dem Benehmen und den Äußerungen der Alten diesen ihren Verdacht bekräftigen. Sie ergriff die nächste Gelegenheit, den Geliebten wegen seines Verrates zur Rede zu stellen. Der sträubte sich natürlich energisch gegen das, was er eine unsinnige Zumutung hieß, und es gelang ihm in der Tat, sie für diesmal von ihrem Wahn abzubringen, so daß sie einige Zeit – ich glaube einige Wochen – später vertrauensvoll genug war, den Besuch in seiner Wohnung zu wiederholen. Das Weitere ist uns aus der ersten Erzählung der Patientin bekannt.
Was wir neu erfahren haben, macht zunächst dem Zweifel an der krankhaften Natur der Verdächtigung ein Ende. Unschwer erkennt man, daß die weißhaarige Vorsteherin ein Mutterersatz ist, daß der geliebte Mann trotz seiner Jugend an die Stelle des Vaters gerückt wird und daß es die Macht des Mutterkomplexes ist, welche die Kranke zwingt, ein Liebesverhältnis zwischen den beiden ungleichen Partnern, aller Unwahrscheinlichkeit zum Trotze, anzunehmen. Damit verflüchtigt sich aber auch der anscheinende Widerspruch gegen die von der psychoanalytischen Lehre genährte Erwartung, eine überstarke homosexuelle Bindung werde sich als die Bedingung zur Entwicklung eines Verfolgungswahnes herausstellen. Der ursprüngliche Verfolger, die Instanz, deren Einfluß man sich entziehen will, ist auch in diesem Falle nicht der Mann, sondern das Weib. Die Vorsteherin weiß von den Liebesbeziehungen des Mädchens, mißbilligt sie und gibt ihr diese Verurteilung durch geheimnisvolle Andeutungen zu erkennen. Die Bindung an das gleiche Geschlecht widersetzt sich den Bemühungen, ein Mitglied des anderen Geschlechts zum Liebesobjekt zu gewinnen. Die Liebe zur Mutter wird zur Wortführerin all der Strebungen, welche in der Rolle eines »Gewissens« das Mädchen bei dem ersten Schritt auf dem neuen, in vielen Hinsichten gefährlichen Weg zur normalen Sexualbefriedigung zurückhalten wollen, und sie erreicht es auch, die Beziehung zum Manne zu stören.
Wenn die Mutter die Sexualbetätigung der Tochter hemmt oder aufhält, so erfüllt sie eine normale Funktion, welche durch Kindheitsbeziehungen vorgezeichnet ist, starke, unbewußte Motivierungen besitzt und die Sanktion der Gesellschaft gefunden hat. Sache der Tochter ist es, sich von diesem Einfluß abzulösen und sich auf Grund breiter, rationeller Motivierung für ein Maß von Gestattung oder Versagung des Sexualgenusses zu entscheiden. Verfällt sie bei dem Versuch dieser Befreiung in neurotische Erkrankung, so liegt ein in der Regel überstarker, sicherlich aber unbeherrschter Mutterkomplex vor, dessen Konflikt mit der neuen libidinösen Strömung je nach der verwendbaren Disposition in der Form dieser oder jener Neurose erledigt wird. In allen Fällen werden die Erscheinungen der neurotischen Reaktion nicht durch die gegenwärtige Beziehung zur aktuellen Mutter, sondern durch die infantilen Beziehungen zum urzeitlichen Mutterbild bestimmt werden.
Von unserer Patientin wissen wir, daß sie seit langen Jahren vaterlos war, wir dürfen auch annehmen, daß sie nicht bis zum Alter von dreißig Jahren frei vom Manne geblieben wäre, wenn ihr nicht eine starke Gefühlsbindung an die Mutter eine Stütze geboten hätte. Diese Stütze wird ihr zur lästigen Fessel, da ihre Libido auf den Anruf einer eindringlichen Werbung zum Manne zu streben beginnt. Sie sucht sie abzustreifen, sich ihrer homosexuellen Bindung zu entledigen. Ihre Disposition – von der hier nicht die Rede zu sein braucht – gestattet, daß dies in der Form der paranoischen Wahnbildung vor sich gehe. Die Mutter wird also zur feindseligen, mißgünstigen Beobachterin und Verfolgerin. Sie könnte als solche überwunden werden, wenn nicht der Mutterkomplex die Macht behielte, die in seiner Absicht liegende Fernhaltung vom Manne durchzusetzen. Am Ende dieser ersten Phase des Konflikts hat sie sich also der Mutter entfremdet und dem Manne nicht angeschlossen. Beide konspirieren ja gegen sie. Da gelingt es der kräftigen Bemühung des Mannes, sie entscheidend an sich zu ziehen. Sie überwindet den Einspruch der Mutter und ist bereit, dem Geliebten eine neue Zusammenkunft zu gewähren. Die Mutter kommt in den weiteren Geschehnissen nicht mehr vor; wir dürfen aber daran festhalten, daß in dieser Phase der geliebte Mann nicht direkt zum Verfolger geworden war, sondern auf dem Wege über die Mutter und kraft seiner Beziehung zur Mutter, welcher in der ersten Wahnbildung die Hauptrolle zugefallen war.
Man sollte nun glauben, der Widerstand sei endgültig überwunden und das bisher an die Mutter gebundene Mädchen habe es erreicht, einen Mann zu lieben. Aber nach dem zweiten Beisammensein erfolgt eine neue Wahnbildung, welche es durch geschickte, Benützung einiger Zufälligkeiten durchsetzt, diese Liebe zu verderben, und somit die Absicht des Mutterkomplexes erfolgreich fortführt. Es erscheint uns noch immer befremdlich, daß das Weib sich der Liebe zum Manne mit Hilfe eines paranoischen Wahnes erwehren sollte. Ehe wir aber dieses Verhältnis näher beleuchten, wollen wir den Zufälligkeiten einen Blick schenken, auf welche sich die zweite Wahnbildung, die allein gegen den Mann gerichtete, stützt.
Halb entkleidet auf dem Diwan neben dem Geliebten liegend, hört sie ein Geräusch wie ein Ticken, Klopfen, Pochen, dessen Ursache sie nicht kennt, das sie aber später deutet, nachdem sie auf der Treppe des Hauses zwei Männern begegnet ist, von denen einer etwas wie ein verdecktes Kästchen trägt. Sie gewinnt die Überzeugung, daß sie im Auftrage des Geliebten während des intimen Beisammenseins belauscht und photographiert wurde. Es liegt uns natürlich fern zu denken, wenn dies unglückselige Geräusch sich nicht ereignet hätte, wäre auch die Wahnbildung nicht zustande gekommen. Wir erkennen vielmehr hinter dieser Zufälligkeit etwas Notwendiges, was sich ebenso zwanghaft durchsetzen mußte wie die Annahme eines Liebesverhältnisses zwischen dem geliebten Manne und der alten, zum Mutterersatz erkorenen Vorsteherin. Die Beobachtung des Liebesverkehres der Eltern ist ein selten vermißtes Stück aus dem Schatze unbewußter Phantasien, die man bei allen Neurotikern, wahrscheinlich bei allen Menschenkindern, durch die Analyse auffinden kann. Ich heiße diese Phantasiebildungen, die der Beobachtung des elterlichen Geschlechtsverkehres, die der Verführung, der Kastration und andere, Urphantasien und werde an anderer Stelle deren Herkunft sowie ihr Verhältnis zum individuellen Erleben eingehend untersuchen. Das zufällige Geräusch spielt also nur die Rolle einer Provokation, welche die typische, im Elternkomplex enthaltene Phantasie von der Belauschung aktiviert. Ja, es ist fraglich, ob wir es als ein »zufälliges« bezeichnen sollen. Wie O. Rank mir bemerkt hat, ist es vielmehr ein notwendiges Requisit der Belauschungsphantasie und wiederholt entweder das Geräusch, durch welches sich der Verkehr der Eltern verrät, oder auch das, wodurch sich das lauschende Kind zu verraten fürchtet. Nun erkennen wir aber mit einem Male, auf welchem Boden wir uns befinden. Der Geliebte ist noch immer der Vater, an Stelle der Mutter ist sie selbst getreten. Die Belauschung muß dann einer fremden Person zugeteilt werden. Es wird uns ersichtlich, auf welche Weise sie sich von der homosexuellen Abhängigkeit von der Mutter frei gemacht hat. Durch ein Stückchen Regression; anstatt die Mutter zum Liebesobjekt zu nehmen, hat sie sich mit ihr identifiziert, ist sie selbst zur Mutter geworden. Die Möglichkeit dieser Regression weist auf den narzißtischen Ursprung ihrer homosexuellen Objektwahl und somit auf die bei ihr vorhandene Disposition zur paranoischen Erkrankung hin. Man könnte einen Gedankengang entwerfen, der zu demselben Ergebnis führt wie diese Identifizierung: »Wenn die Mutter das tut, darf ich es auch; ich habe dasselbe Recht wie die Mutter.«
Man kann in der Aufhebung der Zufälligkeiten einen Schritt weiter gehen, ohne zu fordern, daß ihn der Leser mitmache, denn das Unterbleiben einer tieferen analytischen Untersuchung macht es in unserem Falle unmöglich, hier über eine gewisse Wahrscheinlichkeit hinauszukommen. Die Kranke hatte in unserer ersten Besprechung angegeben, daß sie sich sofort nach der Ursache des Geräusches erkundigt und die Auskunft erhalten habe, wahrscheinlich habe die auf dem Schreibtisch befindliche kleine Standuhr getickt. Ich nehme mir die Freiheit, diese Mitteilung als eine Erinnerungstäuschung aufzulösen. Es ist mir viel glaubhafter, daß sie zunächst jede Reaktion auf das Geräusch unterlassen und daß ihr dies erst nach dem Zusammentreffen mit den beiden Männern auf der Treppe bedeutungsvoll erschienen ist. Den Erklärungsversuch aus dem Ticken der Uhr wird der Mann, der das Geräusch vielleicht überhaupt nicht gehört hatte, später einmal gewagt haben, als ihn der Argwohn des Mädchens bestürmte. »Ich weiß nicht, was du da gehört haben kannst; vielleicht hat gerade die Standuhr getickt, wie sie es manchmal tut.« Solche Nachträglichkeit in der Verwertung von Eindrücken und solche Verschiebung in der Erinnerung sind gerade bei der Paranoia häufig und für sie charakteristisch. Da ich aber den Mann nie gesprochen habe und die Analyse des Mädchens nicht fortsetzen konnte, bleibt meine Annahme unbeweisbar.
Ich könnte es wagen, in der Zersetzung der angeblich realen »Zufälligkeit« noch weiter zu gehen. Ich glaube überhaupt nicht, daß die Standuhr getickt hat oder daß ein Geräusch zu hören war. Die Situation, in der sie sich befand, rechtfertigte eine Empfindung von Pochen oder Klopfen an der Klitoris. Dies war es dann, was sie nachträglich als Wahrnehmung von einem äußeren Objekt hinausprojizierte. Ganz Ähnliches ist im Traume möglich. Eine meiner hysterischen Patientinnen berichtete einmal einen kurzen Wecktraum, zu dem sich kein Material von Einfällen ergeben wollte. Der Traum hieß: Es klopft, und sie wachte auf. Es hatte niemand an die Tür geklopft, aber sie war in den Nächten vorher durch die peinlichen Sensationen von Pollutionen geweckt worden und hatte nun ein Interesse daran zu erwachen, sobald sich die ersten Zeichen der Genitalerregung einstellten. Es hatte an der Klitoris geklopft. Den nämlichen Projektionsvorgang möchte ich bei unserer Paranoika an die Stelle des zufälligen Geräusches setzen. Ich werde selbstverständlich nicht dafür einstehen, daß mir die Kranke bei einer flüchtigen Bekanntschaft unter allen Anzeichen eines ihr unliebsamen Zwanges einen aufrichtigen Bericht über die Vorgänge bei den beiden zärtlichen Zusammenkünften gegeben, aber die vereinzelte Klitoriskontraktion stimmt wohl zu ihrer Behauptung, daß eine Vereinigung der Genitalien dabei nicht stattgefunden habe. An der resultierenden Ablehnung des Mannes hat sicherlich neben dem »Gewissen« auch die Unbefriedigung ihren Anteil.
Wir kehren nun zu der auffälligen Tatsache zurück, daß sich die Kranke der Liebe zum Manne mit Hilfe einer paranoischen Wahnbildung erwehrt. Den Schlüssel zum Verständnis gibt die Entwicklungsgeschichte dieses Wahnes. Dieser richtete sich ursprünglich, wie wir erwarten durften, gegen das Weib, aber nun wurde auf dem Boden der Paranoia der Fortschritt vom Weibe zum Manne als Objekt vollzogen. Ein solcher Fortschritt ist bei der Paranoia nicht gewöhnlich; wir finden in der Regel, daß der Verfolgte an denselben Personen, also auch an demselben Geschlecht, fixiert bleibt, dem seine Liebeswahl vor der paranoischen Umwandlung galt. Aber er wird durch die neurotische Affektion nicht ausgeschlossen; unsere Beobachtung dürfte für viele andere vorbildlich sein. Es gibt außerhalb der Paranoia viele ähnliche Vorgänge, welche bisher nicht unter diesem Gesichtspunkte zusammengefaßt worden sind, darunter sehr allgemein bekannte. So wird z. B. der sogenannte Neurastheniker durch seine unbewußte Bindung an inzestuöse Liebesobjekte davon abgehalten, ein fremdes Weib zum Objekt zu nehmen, und in seiner Sexualbetätigung auf die Phantasie eingeschränkt. Auf dem Boden der Phantasie bringt er aber den ihm versagten Fortschritt zustande und kann Mutter und Schwester durch fremde Objekte ersetzen. Da bei diesen der Einspruch der Zensur entfällt, wird ihm die Wahl dieser Ersatzpersonen in seinen Phantasien bewußt.
Die Phänomene des versuchten Fortschrittes, von dem neuen meist regressiv erworbenen Boden her, stellen sich den Bemühungen zur Seite, welche bei manchen Neurosen unternommen werden, um eine bereits innegehabte, aber verlorene Position der Libido wiederzugewinnen. Die beiden Reihen von Erscheinungen sind begrifflich kaum voneinander zu trennen. Wir neigen allzusehr zu der Auffassung, daß der Konflikt, welcher der Neurose zugrunde liegt, mit der Symptombildung abgeschlossen sei. In Wirklichkeit geht der Kampf vielfach auch nach der Symptombildung weiter. Auf beiden Seiten tauchen neue Triebanteile auf, welche ihn fortführen. Das Symptom selbst wird zum Objekt dieses Kampfes; Strebungen, die es behaupten wollen, messen sich mit anderen, die seine Aufhebung und die Herstellung des früheren Zustandes durchzusetzen bemüht sind. Häufig werden Wege gesucht, um das Symptom zu entwerten, indem man das Verlorene und durch das Symptom Versagte von anderen Zugängen her zu gewinnen trachtet. Diese Verhältnisse werfen ein klärendes Licht auf eine Aufstellung von C. G. Jung, demzufolge eine eigentümliche psychische Trägheit, die sich der Veränderung und dem Fortschritt widersetzt, die Grundbedingung der Neurose ist. Diese Trägheit ist in der Tat sehr eigentümlich; sie ist keine allgemeine, sondern eine höchst spezialisierte, sie ist auch auf ihrem Gebiete nicht Alleinherrscherin, sondern kämpft mit Fortschritts- und Wiederherstellungstendenzen, die sich selbst nach der Symptombildung der Neurose nicht beruhigen. Spürt man dem Ausgangspunkte dieser speziellen Trägheit nach, so enthüllt sie sich als die Äußerung von sehr frühzeitig erfolgten, sehr schwer lösbaren Verknüpfungen von Trieben mit Eindrücken und den in ihnen gegebenen Objekten, durch welche die Weiterentwicklung dieser Triebanteile zum Stillstand gebracht wurde. Oder, um es anders zu sagen, diese spezialisierte »psychische Trägheit« ist nur ein anderer, kaum ein besserer Ausdruck für das, was wir in der Psychoanalyse eine Fixierung zu nennen gewohnt sind.
Mythologische Parallele zu einer plastischen Zwangsvorstellung (1916)
Bei einem etwa 21jährigen Kranken werden die Produkte der unbewußten Geistesarbeit nicht nur als Zwangsgedanken, sondern auch als Zwangsbilder bewußt. Die beiden können einander begleiten oder unabhängig voneinander auftreten. Zu einer gewissen Zeit traten bei ihm innig verknüpft ein Zwangswort und ein Zwangsbild auf, wenn er seinen Vater ins Zimmer kommen sah. Das Wort lautete: »Vaterarsch«, das begleitende Bild stellte den Vater als einen nackten, mit Armen und Beinen versehenen Unterkörper dar, dem Kopf und Oberkörper fehlten. Die Genitalien waren nicht angezeigt, die Gesichtszüge auf dem Bauch aufgemalt.
Zur Erläuterung dieser mehr als gewöhnlich tollen Symptombildung ist zu bemerken, daß der intellektuell vollentwickelte und ethisch hochstrebende Mann bis über sein zehntes Jahr eine sehr lebhafte Analerotik in den verschiedensten Formen betätigt hatte. Nachdem sie überwunden war, wurde sein Sexualleben durch den späteren Kampf gegen die Genitalerotik auf die anale Vorstufe zurückgedrängt. Seinen Vater liebte und respektierte er sehr, fürchtete ihn auch nicht wenig; vom Standpunkte seiner hohen Ansprüche an Triebunterdrückung und Askese erschien ihm der Vater aber als der Vertreter der »Völlerei«, der aufs Materielle gerichteten Genußsucht.
»Vaterarsch« erklärte sich bald als mutwillige Verdeutschung des Ehrentitels »Patriarch«. Das Zwangsbild ist eine offenkundige Karikatur. Es erinnert an andere Darstellungen, die in herabsetzender Absicht die ganze Person durch ein einziges Organ, z. B. ihr Genitale ersetzen, an unbewußte Phantasien, welche zur Identifizierung des Genitales mit dem ganzen Menschen führen, und an scherzhafte Redensarten wie: »Ich bin ganz Ohr.«
Die Anbringung der Gesichtszüge auf dem Bauche der Spottfigur erschien mir zunächst sehr sonderbar. Ich erinnerte mich aber bald, ähnliches an französischen Karikaturen gesehen zu haben [Fußnote]Vgl.: ›Das unanständige Albion‹, Karikatur von Jean Véber aus dem Jahre 1901 auf England in Eduard Fuchs: Das erotische Element in der Karikatur, 1904. Der Zufall hat mich dann mit einer antiken Darstellung bekanntgemacht, die volle Übereinstimmung mit dem Zwangsbild meines Patienten zeigt.
N ach
der griechischen Sage war Demeter auf der Suche nach ihrer geraubten
Tochter nach Eleusis gekommen, fand Aufnahme bei Dysaules und seiner
Frau Baubo, verweigerte aber in ihrer tiefen Trauer, Speise und Trank
zu berühren. Da brachte sie die Wirtin Baubo zum Lachen, indem sie
plötzlich ihr Kleid aufhob und ihren Leib enthüllte. Die Diskussion
dieser Anekdote, die wahrscheinlich ein nicht mehr verstandenes
magisches Zeremoniell erklären soll, findet sich im vierten Bande
des Werkes Cultes,
mythes et religions,
1912, von Salomon Reinach. Ebendort wird auch erwähnt, daß sich bei
den Ausgrabungen des kleinasiatischen Priene Terrakotten gefunden
haben, welche diese Baubo darstellen. Sie zeigen einen Frauenleib
ohne Kopf und Brust, auf dessen Bauch ein Gesicht gebildet ist; der
aufgehobene Rock umrahmt dieses Gesicht wie eine Haarkrone. (S.
Reinach, ibid., S. 117.)
ach
der griechischen Sage war Demeter auf der Suche nach ihrer geraubten
Tochter nach Eleusis gekommen, fand Aufnahme bei Dysaules und seiner
Frau Baubo, verweigerte aber in ihrer tiefen Trauer, Speise und Trank
zu berühren. Da brachte sie die Wirtin Baubo zum Lachen, indem sie
plötzlich ihr Kleid aufhob und ihren Leib enthüllte. Die Diskussion
dieser Anekdote, die wahrscheinlich ein nicht mehr verstandenes
magisches Zeremoniell erklären soll, findet sich im vierten Bande
des Werkes Cultes,
mythes et religions,
1912, von Salomon Reinach. Ebendort wird auch erwähnt, daß sich bei
den Ausgrabungen des kleinasiatischen Priene Terrakotten gefunden
haben, welche diese Baubo darstellen. Sie zeigen einen Frauenleib
ohne Kopf und Brust, auf dessen Bauch ein Gesicht gebildet ist; der
aufgehobene Rock umrahmt dieses Gesicht wie eine Haarkrone. (S.
Reinach, ibid., S. 117.)
Neurose und Psychose (1924)
In meiner kürzlich erschienenen Schrift Das Ich und das Es habe ich eine Gliederung des seelischen Apparates angegeben, auf deren Grund sich eine Reihe von Beziehungen in einfacher und übersichtlicher Weise darstellen läßt. In anderen Punkten, zum Beispiel was die Herkunft und Rolle des Über-Ichs betrifft, bleibt genug des Dunkeln und Unerledigten. Man darf nun fordern, daß eine solche Aufstellung sich auch für andere Dinge als brauchbar und förderlich erweise, wäre es auch nur, um bereits Bekanntes in neuer Auffassung zu sehen, es anders zu gruppieren und überzeugender zu beschreiben. Mit solcher Anwendung könnte auch eine vorteilhafte Rückkehr von der grauen Theorie zur ewig grünenden Erfahrung verbunden sein.
Am genannten Orte sind die vielfältigen Abhängigkeiten des Ichs geschildert, seine Mittelstellung zwischen Außenwelt und Es und sein Bestreben, all seinen Herren gleichzeitig zu Willen zu sein. Im Zusammenhange eines von anderer Seite angeregten Gedankenganges, der sich mit der Entstehung und Verhütung der Psychosen beschäftigte, ergab sich mir nun eine einfache Formel, welche die vielleicht wichtigste genetische Differenz zwischen Neurose und Psychose behandelt: die Neurose sei der Erfolg eines Konflikts zwischen dem Ich und seinem Es, die Psychose aber der analoge Ausgang einer solchen Störung in den Beziehungen zwischen Ich und Außenwelt.
Es ist sicherlich eine berechtigte Mahnung, daß man gegen so einfache Problemlösungen mißtrauisch sein soll. Auch wird unsere äußerste Erwartung nicht weiter gehen, als daß diese Formel sich im gröbsten als richtig erweise. Aber auch das wäre schon etwas. Man besinnt sich auch sofort an eine ganze Reihe von Einsichten und Funden, welche unseren Satz zu bekräftigen scheinen. Die Übertragungsneurosen entstehen nach dem Ergebnis aller unserer Analysen dadurch, daß das Ich eine im Es mächtige Triebregung nicht aufnehmen und nicht zur motorischen Erledigung befördern will oder ihr das Objekt bestreitet, auf das sie zielt. Das Ich erwehrt sich ihrer dann durch den Mechanismus der Verdrängung; das Verdrängte sträubt sich gegen dieses Schicksal, schafft sich auf Wegen, über die das Ich keine Macht hat, eine Ersatzvertretung, die sich dem Ich auf dem Wege des Kompromisses aufdrängt, das Symptom; das Ich findet seine Einheitlichkeit durch diesen Eindringling bedroht und geschädigt, setzt den Kampf gegen das Symptom fort, wie es sich gegen die ursprüngliche Triebregung gewehrt hatte, und dies alles ergibt das Bild der Neurose. Es ist kein Einwand, daß das Ich, wenn es die Verdrängung vornimmt, im Grunde den Geboten seines Über-Ichs folgt, die wiederum solchen Einflüssen der realen Außenwelt entstammen, welche im Über-Ich ihre Vertretung gefunden haben. Es bleibt doch dabei, daß das Ich sich auf die Seite dieser Mächte geschlagen hat, daß in ihm deren Anforderungen stärker sind als die Triebansprüche des Es und daß das Ich die Macht ist, welche die Verdrängung gegen jenen Anteil des Es ins Werk setzt und durch die Gegenbesetzung des Widerstandes befestigt. Im Dienste des Über-Ichs und der Realität ist das Ich in Konflikt mit dem Es geraten, und dies ist der Sachverhalt bei allen Übertragungsneurosen.
Auf der anderen Seite wird es uns ebenso leicht, aus unserer bisherigen Einsicht in den Mechanismus der Psychosen Beispiele anzuführen, welche auf die Störung des Verhältnisses zwischen Ich und Außenwelt hinweisen. Bei der Amentia Meynerts, der akuten halluzinatorischen Verworrenheit, der vielleicht extremsten und frappantesten Form von Psychose, wird die Außenwelt entweder gar nicht wahrgenommen, oder ihre Wahrnehmung bleibt völlig unwirksam. Normalerweise beherrscht ja die Außenwelt das Ich auf zwei Wegen: erstens durch die immer von neuem möglichen aktuellen Wahrnehmungen, zweitens durch den Erinnerungsschatz früherer Wahrnehmungen, die als »Innenwelt« einen Besitz und Bestandteil des Ichs bilden. In der Amentia wird nun nicht nur die Annahme neuer Wahrnehmungen verweigert, es wird auch der Innenwelt, welche die Außenwelt als ihr Abbild bisher vertrat, die Bedeutung (Besetzung) entzogen; das Ich schafft sich selbstherrlich eine neue Außen- und Innenwelt, und es ist kein Zweifel an zwei Tatsachen, daß diese neue Welt im Sinne der Wunschregungen des Es aufgebaut ist und daß eine schwere, unerträglich erscheinende Wunschversagung der Realität das Motiv dieses Zerfalles mit der Außenwelt ist. Die innere Verwandtschaft dieser Psychose mit dem normalen Traum ist nicht zu verkennen. Die Bedingung des Träumens ist aber der Schlafzustand, zu dessen Charakteren die volle Abwendung von Wahrnehmung und Außenwelt gehört.
Von anderen Formen von Psychose, den Schizophrenien, weiß man, daß sie zum Ausgang in affektiven Stumpfsinn, das heißt zum Verlust alles Anteiles an der Außenwelt tendieren. Über die Genese der Wahnbildungen haben uns einige Analysen gelehrt, daß der Wahn wie ein aufgesetzter Fleck dort gefunden wird, wo ursprünglich ein Einriß in der Beziehung des Ichs zur Außenwelt entstanden war. Wenn die Bedingung des Konflikts mit der Außenwelt nicht noch weit auffälliger ist, als wir sie jetzt erkennen, so hat dies seinen Grund in der Tatsache, daß im Krankheitsbild der Psychose die Erscheinungen des pathogenen Vorganges oft von denen eines Heilungs- oder Rekonstruktionsversuches überdeckt werden.
Die gemeinsame Ätiologie für den Ausbruch einer Psychoneurose oder Psychose bleibt immer die Versagung, die Nichterfüllung eines jener ewig unbezwungenen Kindheitswünsche, die so tief in unserer phylogenetisch bestimmten Organisation wurzeln. Diese Versagung ist im letzten Grunde immer eine äußere; im einzelnen Fall kann sie von jener inneren Instanz (im Über-Ich) ausgehen, welche die Vertretung der Realitätsforderung übernommen hat. Der pathogene Effekt hängt nun davon ab, ob das Ich in solcher Konfliktspannung seiner Abhängigkeit von der Außenwelt treu bleibt und das Es zu knebeln versucht oder ob es sich vom Es überwältigen und damit von der Realität losreißen läßt. Eine Komplikation wird in diese anscheinend einfache Lage aber durch die Existenz des Über-Ichs eingetragen, welches in noch nicht durchschauter Verknüpfung Einflüsse aus dem Es wie aus der Außenwelt in sich vereinigt, gewissermaßen ein Idealvorbild für das ist, worauf alles Streben des Ichs abzielt, die Versöhnung seiner mehrfachen Abhängigkeiten. Das Verhalten des Über-Ichs wäre, was bisher nicht geschehen ist, bei allen Formen psychischer Erkrankung in Betracht zu ziehen. Wir können aber vorläufig postulieren, es muß auch Affektionen geben, denen ein Konflikt zwischen Ich und Über-Ich zugrunde liegt. Die Analyse gibt uns ein Recht anzunehmen, daß die Melancholie ein Muster dieser Gruppe ist, und dann würden wir für solche Störungen den Namen »narzißtische Psychoneurosen« in Anspruch nehmen. Es stimmt ja nicht übel zu unseren Eindrücken, wenn wir Motive finden, Zustände wie die Melancholie von den anderen Psychosen zu sondern. Dann merken wir aber, daß wir unsere einfache genetische Formel vervollständigen konnten, ohne sie fallenzulassen. Die Übertragungsneurose entspricht dem Konflikt zwischen Ich und Es, die narzißtische Neurose dem zwischen Ich und Über-Ich, die Psychose dem zwischen Ich und Außenwelt. Wir wissen freilich zunächst nicht zu sagen, ob wir wirklich neue Einsichten gewonnen oder nur unseren Formelschatz bereichert haben, aber ich meine, diese Anwendungsmöglichkeit muß uns doch Mut machen, die vorgeschlagene Gliederung des seelischen Apparates in Ich, Über-Ich und Es weiter im Auge zu behalten.
Die Behauptung, daß Neurosen und Psychosen durch die Konflikte des Ichs mit seinen verschiedenen herrschenden Instanzen entstehen, also einem Fehlschlagen in der Funktion des Ichs entsprechen, das doch das Bemühen zeigt, all die verschiedenen Ansprüche miteinander zu versöhnen, fordert eine andere Erörterung zu ihrer Ergänzung heraus. Man möchte wissen, unter welchen Umständen und durch welche Mittel es dem Ich gelingt, aus solchen gewiß immer vorhandenen Konflikten ohne Erkrankung zu entkommen. Dies ist nun ein neues Forschungsgebiet, auf dem sich gewiß die verschiedensten Faktoren zur Berücksichtigung einfinden werden. Zwei Momente lassen sich aber sofort herausheben. Der Ausgang aller solchen Situationen wird unzweifelhaft von ökonomischen Verhältnissen, von den relativen Größen der miteinander ringenden Strebungen abhängen. Und ferner: es wird dem Ich möglich sein, den Bruch nach irgendeiner Seite dadurch zu vermeiden, daß es sich selbst deformiert, sich Einbußen an seiner Einheitlichkeit gefallen läßt, eventuell sogar sich zerklüftet oder zerteilt. Damit rückten die Inkonsequenzen, Verschrobenheiten und Narrheiten der Menschen in ein ähnliches Licht wie ihre sexuellen Perversionen, durch deren Annahme sie sich ja Verdrängungen ersparen.
Zum Schlusse ist der Frage zu gedenken, welches der einer Verdrängung analoge Mechanismus sein mag, durch den das Ich sich von der Außenwelt ablöst. Ich meine, dies ist ohne neue Untersuchungen nicht zu beantworten, aber er müßte, wie die Verdrängung, eine Abziehung der vom Ich ausgeschickten Besetzung zum Inhalt haben.
Notiz über den “Wunderblock” (1925)
Wenn ich meinem Gedächtnis mißtraue – der Neurotiker tut dies bekanntlich in auffälligem Ausmaße, aber auch der Normale hat allen Grund dazu –, so kann ich dessen Funktion ergänzen und versichern, indem ich mir eine schriftliche Aufzeichnung mache. Die Fläche, welche diese Aufzeichnung bewahrt, die Schreibtafel oder das Blatt Papier, ist dann gleichsam ein materialisiertes Stück des Erinnerungsapparates, den ich sonst unsichtbar in mir trage. Wenn ich mir nur den Ort merke, an dem die so fixierte »Erinnerung« untergebracht ist, so kann ich sie jederzeit nach Belieben »reproduzieren« und bin sicher, daß sie unverändert geblieben, also den Entstellungen entgangen ist, die sie vielleicht in meinem Gedächtnis erfahren hätte.
Wenn ich mich dieser Technik zur Verbesserung meiner Gedächtnisfunktion in ausgiebiger Weise bedienen will, bemerke ich, daß mir zwei verschiedene Verfahren zu Gebote stehen. Ich kann erstens eine Schreibfläche wählen, welche die ihr anvertraute Notiz unbestimmt lange unversehrt bewahrt, also ein Blatt Papier, das ich mit Tinte beschreibe. Ich erhalte dann eine »dauerhafte Erinnerungsspur«. Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, daß die Aufnahmsfähigkeit der Schreibfläche sich bald erschöpft. Das Blatt ist vollgeschrieben, hat keinen Raum für neue Aufzeichnungen, und ich sehe mich genötigt, ein anderes, noch unbeschriebenes Blatt in Verwendung zu nehmen. Auch kann der Vorzug dieses Verfahrens, das eine »Dauerspur« liefert, seinen Wert für mich verlieren, nämlich wenn mein Interesse an der Notiz nach einiger Zeit erloschen ist und ich sie nicht mehr »im Gedächtnis behalten« will. Das andere Verfahren ist von beiden Mängeln frei. Wenn ich zum Beispiel mit Kreide auf eine Schiefertafel schreibe, so habe ich eine Aufnahmsfläche, die unbegrenzt lange aufnahmsfähig bleibt und deren Aufzeichnungen ich zerstören kann, sobald sie mich nicht mehr interessieren, ohne die Schreibfläche selbst verwerfen zu müssen. Der Nachteil ist hier, daß ich eine Dauerspur nicht erhalten kann. Will ich neue Notizen auf die Tafel bringen, so muß ich die, mit denen sie bereits bedeckt ist, wegwischen. Unbegrenzte Aufnahmsfähigkeit und Erhaltung von Dauerspuren scheinen sich also für die Vorrichtungen, mit denen wir unser Gedächtnis substituieren, auszuschließen, es muß entweder die aufnehmende Fläche erneut oder die Aufzeichnung vernichtet werden.
Die Hilfsapparate, welche wir zur Verbesserung oder Verstärkung unserer Sinnesfunktionen erfunden haben, sind alle so gebaut wie das Sinnesorgan selbst oder Teile desselben (Brille, photographische Kamera, Hörrohr usw.). An diesem Maß gemessen, scheinen die Hilfsvorrichtungen für unser Gedächtnis besonders mangelhaft zu sein, denn unser seelischer Apparat leistet gerade das, was diese nicht können; er ist in unbegrenzter Weise aufnahmsfähig für immer neue Wahrnehmungen und schafft doch dauerhafte – wenn auch nicht unveränderliche – Erinnerungsspuren von ihnen. Ich habe schon in der Traumdeutung 1900 die Vermutung ausgesprochen, daß diese ungewöhnliche Fähigkeit auf die Leistung zweier verschiedener Systeme (Organe des seelischen Apparates) aufzuteilen sei. Wir besäßen ein System W-Bw, welches die Wahrnehmungen aufnimmt, aber keine Dauerspur von ihnen bewahrt, so daß es sich gegen jede neue Wahrnehmung wie ein unbeschriebenes Blatt verhalten kann. Die Dauerspuren der auf genommenen Erregungen kämen in dahinter gelegenen »Erinnerungssystemen« zustande. Später ( Jenseits des Lustprinzips) habe ich die Bemerkung hinzugefügt, das unerklärliche Phänomen des Bewußtseins entstehe im Wahrnehmungssystem an Stelle der Dauerspuren.
Vor einiger Zeit ist nun unter dem Namen Wunderblock ein kleines Gerät in den Handel gekommen, das mehr zu leisten verspricht als das Blatt Papier oder die Schiefertafel. Es will nicht mehr sein als eine Schreibtafel, von der man die Aufzeichnungen mit einer bequemen Hantierung entfernen kann. Untersucht man es aber näher, so findet man in seiner Konstruktion eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit dem von mir supponierten Bau unseres Wahrnehmungsapparats und überzeugt sich, daß es wirklich beides liefern kann, eine immer bereite Aufnahmsfläche und Dauerspuren der aufgenommenen Aufzeichnungen.
Der Wunderblock ist eine in einen Papierrand gefaßte Tafel aus dunkelbräunlicher Harz- oder Wachsmasse, über welche ein dünnes, durchscheinendes Blatt gelegt ist, am oberen Ende an der Wachstafel fest haftend, am unteren ihr frei anliegend. Dieses Blatt ist der interessantere Anteil des kleinen Apparats. Es besteht selbst aus zwei Schichten, die außer an den beiden queren Rändern voneinander abgehoben werden können. Die obere Schicht ist eine durchsichtige Zelluloidplatte, die untere ein dünnes, also durchscheinendes Wachspapier. Wenn der Apparat nicht gebraucht wird, klebt die untere Fläche des Wachspapiers der oberen Fläche der Wachstafel leicht an.
Man gebraucht diesen Wunderblock, indem man die Aufschreibung auf der Zelluloidplatte des die Wachstafel deckenden Blattes ausführt. Dazu bedarf es keines Bleistifts oder einer Kreide, denn das Schreiben beruht nicht darauf, daß Material an die aufnehmende Fläche abgegeben wird. Es ist eine Rückkehr zur Art, wie die Alten auf Ton- und Wachstäfelchen schrieben. Ein spitzer Stilus ritzt die Oberfläche, deren Vertiefungen die »Schrift« ergeben. Beim Wunderblock geschieht dieses Ritzen nicht direkt, sondern unter Vermittlung des darüberliegenden Deckblattes. Der Stilus drückt an den von ihm berührten Stellen die Unterfläche des Wachspapiers an die Wachstafel an, und diese Furchen werden an der sonst glatten weißlichgrauen Oberfläche des Zelluloids als dunkle Schrift sichtbar. Will man die Aufschreibung zerstören, so genügt es, das zusammengesetzte Deckblatt von seinem freien, unteren Rand her mit leichtem Griff von der Wachstafel abzuheben. Der innige Kontakt zwischen Wachspapier und Wachstafel an den geritzten Stellen, auf dem das Sichtbarwerden der Schrift beruhte, wird damit gelöst und stellt sich auch nicht her, wenn die beiden einander wieder berühren. Der Wunderblock ist nun schriftfrei und bereit, neue Aufzeichnungen aufzunehmen.
Die kleinen Unvollkommenheiten des Geräts haben für uns natürlich kein Interesse, da wir nur dessen Annäherung an die Struktur des seelischen Wahrnehmungsapparats verfolgen wollen.
Wenn man, während der Wunderblock beschrieben ist, die Zelluloidplatte vorsichtig vom Wachspapier abhebt, so sieht man die Schrift ebenso deutlich auf der Oberfläche des letzteren und kann die Frage stellen, wozu die Zelluloidplatte des Deckblattes überhaupt notwendig ist. Der Versuch zeigt dann, daß das dünne Papier sehr leicht in Falten gezogen oder zerrissen werden würde, wenn man es direkt mit dem Stilus beschriebe. Das Zelluloidblatt ist also eine schützende Hülle für das Wachspapier, die schädigende Einwirkungen von außen abhalten soll. Das Zelluloid ist ein »Reizschutz«; die eigentlich reizaufnehmende Schicht ist das Papier. Ich darf nun darauf hinweisen, daß ich im Jenseits des Lustprinzips ausgeführt habe, unser seelischer Wahrnehmungsapparat bestehe aus zwei Schichten, einem äußeren Reizschutz, der die Größe der ankommenden Erregungen herabsetzen soll, und aus der reizaufnehmenden Oberfläche dahinter, dem System W-Bw.
Die Analogie hätte nicht viel Wert, wenn sie sich nicht weiter verfolgen ließe. Hebt man das ganze Deckblatt – Zelluloid und Wachspapier – von der Wachstafel ab, so verschwindet die Schrift und stellt sich, wie erwähnt, auch später nicht wieder her. Die Oberfläche des Wunderblocks ist schriftfrei und von neuem aufnahmsfähig. Es ist aber leicht festzustellen, daß die Dauerspur des Geschriebenen auf der Wachstafel selbst erhalten bleibt und bei geeigneter Belichtung lesbar ist. Der Block liefert also nicht nur eine immer von neuem verwendbare Aufnahmsfläche wie die Schiefertafel, sondern auch Dauerspuren der Aufschreibung wie der gewöhnliche Papierblock; er löst das Problem, die beiden Leistungen zu vereinigen, indem er sie auf zwei gesonderte, miteinander verbundene Bestandteile – Systeme – verteilt. Das ist aber ganz die gleiche Art, wie nach meiner oben erwähnten Annahme unser seelischer Apparat die Wahrnehmungsfunktion erledigt. Die reizaufnehmende Schicht – das System W-Bw – bildet keine Dauerspuren, die Grundlagen der Erinnerung kommen in anderen, anstoßenden Systemen zustande.
Es braucht uns dabei nicht zu stören, daß die Dauerspuren der empfangenen Aufzeichnungen beim Wunderblock nicht verwertet werden; es genügt, daß sie vorhanden sind. Irgendwo muß ja die Analogie eines solchen Hilfsapparats mit dem vorbildlichen Organ ein Ende finden. Der Wunderblock kann ja auch nicht die einmal verlöschte Schrift von innen her wieder »reproduzieren«; er wäre wirklich ein Wunderblock, wenn er das wie unser Gedächtnis vollbringen könnte. Immerhin erscheint es mir jetzt nicht allzu gewagt, das aus Zelluloid und Wachspapier bestehende Deckblatt mit dem System W-Bw und seinem Reizschutz, die Wachstafel mit dem Unbewußten dahinter, das Sichtbarwerden der Schrift und ihr Verschwinden mir dem Aufleuchten und Vergehen des Bewußtseins bei der Wahrnehmung gleichzustellen. Ich gestehe aber, daß ich geneigt bin, die Vergleichung noch weiter zu treiben.
Beim Wunderblock verschwindet die Schrift jedesmal, wenn der innige Kontakt zwischen dem den Reiz empfangenden Papier und der den Eindruck bewahrenden Wachstafel aufgehoben wird. Das trifft mit einer Vorstellung zusammen, die ich mir längst über die Funktionsweise des seelischen Wahrnehmungsapparats gemacht, aber bisher für mich behalten habe. Ich habe angenommen, daß Besetzungsinnervationen in raschen periodischen Stößen aus dem Inneren in das völlig durchlässige System W-Bw geschickt und wieder zurückgezogen werden. Solange das System in solcher Weise besetzt ist, empfängt es die von Bewußtsein begleiteten Wahrnehmungen und leitet die Erregung weiter in die unbewußten Erinnerungssysteme; sobald die Besetzung zurückgezogen wird, erlischt das Bewußtsein, und die Leistung des Systems ist sistiert. Es wäre so, als ob das Unbewußte mittels des Systems W-Bw der Außenwelt Fühler entgegenstrecken würde, die rasch zurückgezogen werden, nachdem sie deren Erregungen verkostet haben. Ich ließ also die Unterbrechungen, die beim Wunderblock von außen her geschehen, durch die Diskontinuität der Innervationsströmung zustande kommen, und an Stelle einer wirklichen Kontaktaufhebung stand in meiner Annahme die periodisch eintretende Unerregbarkeit des Wahrnehmungssystems. Ich vermutete ferner, daß diese diskontinuierliche Arbeitsweise des Systems W-Bw der Entstehung der Zeitvorstellung zugrunde liegt.
Denkt man sich, daß während eine Hand die Oberfläche des Wunderblocks beschreibt, eine andere periodisch das Deckblatt desselben von der Wachstafel abhebt, so wäre das eine Versinnlichung der Art, wie ich mir die Funktion unseres seelischen Wahrnehmungsapparats vorstellen wollte.
Psychische Behandlung (1890)
(Seelenbehandlung)
Psyche ist ein griechisches Wort und lautet in deutscher Übersetzung Seele. Psychische Behandlung heißt demnach Seelenbehandlung. Man könnte also meinen, daß darunter verstanden wird: Behandlung der krankhaften Erscheinungen des Seelenlebens. Dies ist aber nicht die Bedeutung dieses Wortes. Psychische Behandlung will vielmehr besagen: Behandlung von der Seele aus, Behandlung – seelischer oder körperlicher Störungen – mit Mitteln, welche zunächst und unmittelbar auf das Seelische des Menschen einwirken.
Ein solches Mittel ist vor allem das Wort, und Worte sind auch das wesentliche Handwerkszeug der Seelenbehandlung. Der Laie wird es wohl schwer begreiflich finden, daß krankhafte Störungen des Leibes und der Seele durch »bloße« Worte des Arztes beseitigt werden sollen. Er wird meinen, man mute ihm zu, an Zauberei zu glauben. Er hat damit nicht so unrecht; die Worte unserer täglichen Reden sind nichts anderes als abgeblaßter Zauber. Es wird aber notwendig sein, einen weiteren Umweg einzuschlagen, um verständlich zu machen, wie die Wissenschaft es anstellt, dem Worte wenigstens einen Teil seiner früheren Zauberkraft wiederzugeben.
Auch die wissenschaftlich geschulten Ärzte haben den Wert der Seelenbehandlung erst in neuerer Zeit schätzen gelernt. Dies erklärt sich leicht, wenn man an den Entwicklungsgang der Medizin im letzten Halbjahrhundert denkt. Nach einer ziemlich unfruchtbaren Zeit der Abhängigkeit von der sogenannten Naturphilosophie hat die Medizin unter dem glücklichen Einfluß der Naturwissenschaften die größten Fortschritte als Wissenschaft wie als Kunst gemacht, den Aufbau des Organismus aus mikroskopisch kleinen Einheiten (den Zellen) ergründet, die einzelnen Lebensverrichtungen (Funktionen) physikalisch und chemisch verstehen gelernt, die sichtbaren und greifbaren Veränderungen der Körperteile, welche Folgen der verschiedenen Krankheitsprozesse sind, unterschieden, anderseits auch die Zeichen gefunden, durch welche sich tiefliegende Krankheitsvorgänge noch an Lebenden verraten, hat ferner eine große Anzahl der belebten Krankheitserreger entdeckt und mit Hilfe der neugewonnenen Einsichten die Gefahren schwerer operativer Eingriffe ganz außerordentlich herabgesetzt. Alle diese Fortschritte und Entdeckungen betrafen das Leibliche des Menschen, und so kam es infolge einer nicht richtigen, aber leicht begreiflichen Urteilsrichtung dazu, daß die Ärzte ihr Interesse auf das Körperliche einschränkten und die Beschäftigung mit dem Seelischen den von ihnen mißachteten Philosophen gerne überließen.
Zwar hatte die moderne Medizin genug Anlaß, den unleugbar vorhandenen Zusammenhang zwischen Körperlichem und Seelischem zu studieren, aber dann versäumte sie niemals, das Seelische als bestimmt durch das Körperliche und abhängig von diesem darzustellen. So wurde hervorgehoben, daß die geistigen Leistungen an das Vorhandensein eines normal entwickelten und hinreichend ernährten Gehirns gebunden sind und bei jeder Erkrankung dieses Organs in Störungen verfallen; daß die Einführung von Giftstoffen in den Kreislauf gewisse Zustände von Geisteskrankheit zu erzeugen gestattet, oder im kleinen, daß die Träume des Schlafenden je nach den Reizen verändert werden, welche man zum Zwecke des Versuches auf ihn einwirken läßt.
Das Verhältnis zwischen Leiblichem und Seelischem (beim Tier wie beim Menschen) ist eines der Wechselwirkung, aber die andere Seite dieses Verhältnisses, die Wirkung des Seelischen auf den Körper, fand in früheren Zeiten wenig Gnade vor den Augen der Ärzte. Sie schienen es zu scheuen, dem Seelenleben eine gewisse Selbständigkeit einzuräumen, als ob sie damit den Boden der Wissenschaftlichkeit verlassen würden.
Diese einseitige Richtung der Medizin auf das Körperliche hat in den letzten anderthalb Jahrzehnten allmählich eine Änderung erfahren, welche unmittelbar von der ärztlichen Tätigkeit ausgegangen ist. Es gibt nämlich eine große Anzahl von leichter und schwerer Kranken, welche durch ihre Störungen und Klagen große Anforderungen an die Kunst der Ärzte stellen, bei denen aber sichtbare und greifbare Zeichen des Krankheitsprozesses weder im Leben noch nach dem Tode aufzufinden sind, trotz aller Fortschritte in den Untersuchungsmethoden der wissenschaftlichen Medizin. Eine Gruppe dieser Kranken wird durch die Reichhaltigkeit und Vielgestaltigkeit des Krankheitsbildes auffällig; sie können nicht geistig arbeiten infolge von Kopfschmerz oder von Versagen der Aufmerksamkeit, ihre Augen schmerzen beim Lesen, ihre Beine ermüden beim Gehen, sind dumpf schmerzhaft oder eingeschlafen, ihre Verdauung ist gestört durch peinliche Empfindungen, Aufstoßen oder Magenkrämpfe, der Stuhlgang erfolgt nicht ohne Nachhilfe, der Schlaf ist aufgehoben usw. Sie können alle diese Leiden gleichzeitig haben oder nacheinander, oder nur eine Auswahl derselben; es ist offenbar in allen Fällen dieselbe Krankheit. Dabei sind die Zeichen der Krankheit oftmals veränderlicher Art, sie lösen einander ab und ersetzen einander; derselbe Kranke, der bisher leistungsunfähig war wegen Kopfschmerzen, aber eine ziemlich gute Verdauung hatte, kann am nächsten Tag sich eines freien Kopfes erfreuen, aber von da an die meisten Speisen schlecht vertragen. Auch verlassen ihn seine Leiden plötzlich bei einer eingreifenden Veränderung seiner Lebensverhältnisse; auf einer Reise kann er sich ganz wohl fühlen und die verschiedenartigste Kost ohne Schaden genießen, nach Hause zurückgekehrt, muß er sich vielleicht wieder auf Sauermilch einschränken. Bei einigen dieser Kranken kann die Störung – ein Schmerz oder eine lähmungsartige Schwäche – sogar plötzlich die Körperseite wechseln, von rechts auf das entsprechende Körpergebiet links überspringen. Bei allen aber kann man die Beobachtung machen, daß die Leidenszeichen sehr deutlich unter dem Einfluß von Aufregungen, Gemütsbewegungen, Sorgen usw. stehen, sowie daß sie verschwinden, der vollen Gesundheit Platz machen können, ohne selbst nach langem Bestand Spuren zu hinterlassen.
Die ärztliche Forschung hat endlich ergeben, daß solche Personen nicht als Magenkranke oder Augenkranke u. dgl. zu betrachten und zu behandeln sind, sondern daß es sich bei ihnen um ein Leiden des gesamten Nervensystems handeln muß. Die Untersuchung des Gehirnes und der Nerven solcher Kranker hat aber bisher keine greifbare Veränderung auffinden lassen, und manche Züge des Krankheitsbildes verbieten sogar die Erwartung, daß man solche Veränderungen, wie sie imstande wären, die Krankheit zu erklären, einst mit feineren Untersuchungsmitteln werde nachweisen können. Man hat diese Zustände Nervosität (Neurasthenie, Hysterie) genannt und bezeichnet sie als bloß »funktionelle« Leiden des Nervensystems'. Übrigens ist auch bei vielen beständigeren nervösen Leiden und bei solchen, die nur seelische Krankheitszeichen ergeben (sogenannte Zwangsideen, Wahnideen, Verrücktheit), die eingehende Untersuchung des Gehirns (nach dem Tode des Kranken) ergebnislos geblieben.
Es trat die Aufgabe an die Ärzte heran, die Natur und Herkunft der Krankheitsäußerungen bei diesen Nervösen oder Neurotikern zu untersuchen. Dabei wurde dann die Entdeckung gemacht, daß wenigstens bei einem Teil dieser Kranken die Zeichen des Leidens von nichts anderem herrühren als von einem veränderten Einfluß ihres Seelenlebens auf ihren Körper, daß also die nächste Ursache der Störung im Seelischen zu suchen ist. Welches die entfernteren Ursachen jener Störung sind, von der das Seelische betroffen wurde, das nun seinerseits auf das Körperliche störend einwirkt, das ist eine andere Frage und kann hier füglich außer Betracht gelassen werden. Aber die ärztliche Wissenschaft hatte hier die Anknüpfung gefunden, um der bisher vernachlässigten Seite in der Wechselbeziehung zwischen Leib und Seele ihre Aufmerksamkeit im vollen Maße zuzuwenden.
Erst wenn man das Krankhafte studiert, lernt man das Normale verstehen. Über den Einfluß des Seelischen auf den Körper war vieles immer bekannt gewesen, was erst jetzt in die richtige Beleuchtung rückte. Das alltäglichste, regelmäßig und bei jedermann zu beobachtende Beispiel von seelischer Einwirkung auf den Körper bietet der sogenannte » Ausdruck der Gemütsbewegungen«. Fast alle seelischen Zustände eines Menschen äußern sich in den Spannungen und Erschlaffungen seiner Gesichtsmuskeln, in der Einstellung seiner Augen, der Blutfüllung seiner Haut, der Inanspruchnahme seines Stimmapparates und in den Haltungen seiner Glieder, vor allem der Hände. Diese begleitenden körperlichen Veränderungen bringen dem Betreffenden meist keinen Nutzen, sie sind im Gegenteil oft seinen Absichten im Wege, wenn er seine Seelenvorgänge vor anderen verheimlichen will, aber sie dienen den anderen als verläßliche Zeichen, aus denen man auf die seelischen Vorgänge schließen kann und denen man mehr vertraut als den etwa gleichzeitigen absichtlichen Äußerungen in Worten. Kann man einen Menschen während gewisser seelischer Tätigkeiten einer genaueren Untersuchung unterziehen, so findet man weitere körperliche Folgen derselben in den Veränderungen seiner Herztätigkeit, in dem Wechsel der Blutverteilung in seinem Körper u. dgl.
Bei gewissen Seelenzuständen, die man » Affekte« heißt, ist die Mitbeteiligung des Körpers so augenfällig und so großartig, daß manche Seelenforscher sogar gemeint haben, das Wesen der Affekte bestehe nur in diesen ihren körperlichen Äußerungen. Es ist allgemein bekannt, welch außerordentliche Veränderungen im Gesichtsausdruck, im Blutumlauf, in den Absonderungen, in den Erregungszuständen der willkürlichen Muskeln, unter dem Einfluß z. B. der Furcht, des Zornes, des Seelenschmerzes, des geschlechtlichen Entzückens zustande kommen. Minder bekannt, aber vollkommen sichergestellt sind andere körperliche Wirkungen der Affekte, die nicht mehr zum Ausdruck derselben gehören. Anhaltende Affektzustände von peinlicher oder, wie man sagt, »depressiver« Natur, wie Kummer, Sorge und Trauer, setzen die Ernährung des Körpers im ganzen herab, verursachen, daß die Haare bleichen, das Fett schwindet und die Wandungen der Blutgefäße krankhaft verändert werden. Umgekehrt sieht man unter dem Einfluß freudiger Erregungen, des »Glückes«, den ganzen Körper aufblühen und die Person manche Kennzeichen der Jugend wiedergewinnen. Die großen Affekte haben offenbar viel mit der Widerstandsfähigkeit gegen Erkrankung an Ansteckungen zu tun; es ist ein gutes Beispiel davon, wenn ärztliche Beobachter angeben, daß die Geneigtheit zu den Lagererkrankungen und zur Ruhr (Dysenterie) bei den Angehörigen einer geschlagenen Armee sehr viel bedeutender ist als unter den Siegern. Die Affekte, und zwar fast ausschließlich die depressiven, werden aber auch häufig genug selbst zu Krankheitsursachen sowohl für Krankheiten des Nervensystems mit anatomisch nachweisbaren Veränderungen als auch für Krankheiten anderer Organe, wobei man anzunehmen hat, daß die betreffende Person eine bis dahin unwirksame Eignung zu dieser Krankheit schon vorher besessen hat.
Bereits ausgebildete Krankheitszustände können durch stürmische Affekte sehr erheblich beeinflußt werden, meistens im Sinne einer Verschlechterung, aber es fehlt auch nicht an Beispielen dafür, daß ein großer Schreck, ein plötzlicher Kummer durch eine eigentümliche Umstimmung des Organismus einen gut begründeten Krankheitszustand heilsam beeinflußt oder selbst aufgehoben hat. Daß endlich die Dauer des Lebens durch depressive Affekte erheblich abgekürzt werden kann sowie daß ein heftiger Schreck, eine brennende » Kränkung« oder Beschämung dem Leben ein plötzliches Ende setzen kann, unterliegt keinem Zweifel; merkwürdigerweise wird letztere Wirkung auch mitunter als Folge einer unerwarteten großen Freude beobachtet.
Die Affekte im engeren Sinne sind durch eine ganz besondere Beziehung zu den körperlichen Vorgängen ausgezeichnet, aber strenggenommen sind alle Seelenzustände, auch diejenigen, welche wir als »Denkvorgänge« zu betrachten gewohnt sind, in gewissem Maße » affektiv«, und kein einziger von ihnen entbehrt der körperlichen Äußerungen und der Fähigkeit, körperliche Vorgänge zu verändern. Selbst beim ruhigen Denken in »Vorstellungen« werden dem Inhalt dieser Vorstellungen entsprechend beständig Erregungen zu den glatten und gestreiften Muskeln abgeleitet, welche durch geeignete Verstärkung deutlich gemacht werden können und die Erklärung für manche auffällige, ja vermeintlich »übernatürliche« Erscheinungen geben. So z. B. erklärt sich das sogenannte » Gedankenerraten«: durch die kleinen, unwillkürlichen Muskelbewegungen, die das »Medium« ausführt, wenn man mit ihm Versuche anstellt, etwa sich von ihm leiten läßt, um einen versteckten Gegenstand aufzufinden. Die ganze Erscheinung verdient eher den Namen eines Gedankenverratens.
Die Vorgänge des Willens und der Aufmerksamkeit sind gleichfalls imstande, die leiblichen Vorgänge tief zu beeinflussen und bei körperlichen Krankheiten als Förderer oder als Hemmungen eine große Rolle zu spielen. Ein großer englischer Arzt hat von sich berichtet, daß es ihm gelingt, an jeder Körperstelle, auf die er seine Aufmerksamkeit lenken will, mannigfache Empfindungen und Schmerzen hervorzurufen, und die Mehrzahl der Menschen scheint sich ähnlich wie er zu verhalten. Bei der Beurteilung von Schmerzen, die man sonst zu den körperlichen Erscheinungen rechnet, ist überhaupt deren überaus deutliche Abhängigkeit von seelischen Bedingungen in Betracht zu ziehen. Die Laien, welche solche seelische Einflüsse gerne unter dem Namen der »Einbildung« zusammenfassen, pflegen vor Schmerzen infolge von Einbildung im Gegensatz zu den durch Verletzung, Krankheit oder Entzündung verursachten wenig Respekt zu haben. Aber das ist ein offenbares Unrecht; mag die Ursache von Schmerzen welche immer sein, auch die Einbildung, die Schmerzen selbst sind darum nicht weniger wirklich und nicht weniger heftig.
Wie Schmerzen durch Zuwendung der Aufmerksamkeit erzeugt oder gesteigert werden, so schwinden sie auch bei Ablenkung der Aufmerksamkeit. Bei jedem Kind kann man diese Erfahrung zur Beschwichtigung verwerten; der erwachsene Krieger verspürt den Schmerz der Verletzung nicht im fieberhaften Eifer des Kampfes; der Märtyrer wird sehr wahrscheinlich in der Überhitzung seines religiösen Gefühls, in der Hinwendung all seiner Gedanken auf den ihm winkenden himmlischen Lohn vollkommen unempfindlich gegen den Schmerz seiner Qualen. Der Einfluß des Willens auf Krankheitsvorgänge des Körpers ist weniger leicht durch Beispiele zu belegen, es ist aber sehr wohl möglich, daß der Vorsatz, gesund zu werden, oder der Wille zu sterben selbst für den Ausgang schwerer und zweifelhafter Erkrankungsfälle nicht ohne Bedeutung ist.
Den größten Anspruch an unser Interesse hat der seelische Zustand der Erwartung, mittels dessen eine Reihe der wirksamsten seelischen Kräfte für Erkrankung und Genesung von körperlichen Leiden regegemacht werden können. Die ängstliche Erwartung ist gewiß nichts Gleichgültiges für den Erfolg; es wäre wichtig, mit Sicherheit zu wissen, ob sie so viel für das Krankwerden leistet, als man ihr zutraut, ob es z. B. auf Wahrheit beruht, daß während der Herrschaft einer Epidemie diejenigen am ehesten gefährdet sind, die zu erkranken fürchten. Der gegenteilige Zustand, die hoffnungsvolle und gläubige Erwartung, ist eine wirkende Kraft, mit der wir strenggenommen bei allen unseren Behandlungs- und Heilungsversuchen zu rechnen haben. Wir könnten uns sonst die Eigentümlichkeiten der Wirkungen, die wir an den Medikamenten und Heileingriffen beobachten, nicht erklären. Am greifbarsten wird aber der Einfluß der gläubigen Erwartung bei den sogenannten Wunderheilungen, die sich noch heute unter unseren Augen ohne Mitwirkung ärztlicher Kunst vollziehen. Die richtigen Wunderheilungen erfolgen bei Gläubigen unter dem Einfluß von Veranstaltungen, welche geeignet sind, die religiösen Gefühle zu steigern, also an Orten, wo ein wundertätiges Gnadenbild verehrt wird, wo eine heilige oder göttliche Person sich den Menschenkindern gezeigt und ihnen Linderung als Entgelt für Anbetung versprochen hat oder wo die Reliquien eines Heiligen als Schatz aufbewahrt werden. Es scheint dem religiösen Glauben allein nicht leicht zu werden, auf dem Wege der Erwartung die Krankheit zu verdrängen, denn bei den Wunderheilungen sind meist noch andere Veranstaltungen mit im Spiele. Die Zeiten, zu denen man die göttliche Gnade sucht, müssen durch besondere Beziehungen ausgezeichnet sein; körperliche Mühsal, die sich der Kranke auferlegt, die Beschwerden und Opfer der Pilgerfahrt müssen ihn für diese Gnade besonders würdigen.
Es wäre bequem, aber sehr unrichtig, wenn man diesen Wunderheilungen einfach den Glauben verweigern und die Berichte über sie durch Zusammentreffen von frommem Betrug und ungenauer Beobachtung aufklären wollte. Sooft dieser Erklärungsversuch auch recht haben mag, er hat doch nicht die Kraft, die Tatsache der Wunderheilungen überhaupt wegzuräumen. Diese kommen wirklich vor, haben sich zu allen Zeiten ereignet und betreffen nicht nur Leiden seelischer Herkunft, die also ihre Gründe in der »Einbildung« haben, auf welche gerade die Umstände der Wallfahrt besonders wirken können, sondern auch »organisch« begründete Krankheitszustände, die vorher allen ärztlichen Bemühungen widerstanden hatten.
Doch liegt keine Nötigung vor, zur Erklärung der Wunderheilungen andere als seelische Mächte heranzuziehen. Wirkungen, die für unsere Erkenntnis als unbegreiflich gelten könnten, kommen auch unter solchen Bedingungen nicht zum Vorschein. Es geht alles natürlich zu; ja die Macht der religiösen Gläubigkeit erfährt hier eine Verstärkung durch mehrere echt menschliche Triebkräfte. Der fromme Glaube des einzelnen wird durch die Begeisterung der Menschenmenge gesteigert, in deren Mitte er sich dem heiligen Ort zu nähern pflegt. Durch solche Massenwirkung können alle seelischen Regungen des einzelnen Menschen ins Maßlose gehoben werden. Wo ein einzelner die Heilung am Gnadenorte sucht, da ist es der Ruf, das Ansehen des Ortes, welche den Einfluß der Menschenmenge ersetzt, da kommt also doch wieder nur die Macht der Menge zur Wirkung. Dieser Einfluß macht sich auch noch auf anderem Wege geltend. Da es bekannt ist, daß die göttliche Gnade sich stets nur einigen wenigen unter den vielen um sie Werbenden zuwendet, möchte jeder unter diesen Ausgezeichneten und Ausgewählten sein; der in jedem einzelnen schlummernde Ehrgeiz kommt der frommen Gläubigkeit zu Hilfe. Wo so viel starke Kräfte zusammenwirken, dürfen wir uns nicht wundern, wenn gelegentlich das Ziel wirklich erreicht wird.
Auch die religiös Ungläubigen brauchen auf Wunderheilungen nicht zu verzichten. Das Ansehen und die Massenwirkung ersetzen ihnen vollauf den religiösen Glauben. Es gibt jederzeit Modekuren und Modeärzte, die besonders die vornehme Gesellschaft beherrschen, in welcher das Bestreben, es einander zuvorzutun und es den Vornehmsten gleichzutun, die mächtigsten seelischen Triebkräfte darstellen. Solche Modekuren entfalten Heilwirkungen, die nicht in ihrem Machtbereich gelegen sind, und die nämlichen Mittel leisten in der Hand des Modearztes, der etwa als der Helfer einer hervorragenden Persönlichkeit bekannt geworden ist, weit mehr, als sie anderen Ärzten leisten können. So gibt es menschliche Wundertäter ebenso wie göttliche; nur nützen sich diese von der Gunst der Mode und der Nachahmung zu Ansehen erhobenen Menschen rasch ab, wie es der Natur der für sie wirkenden Mächte entspricht.
Die begreifliche Unzufriedenheit mit der oft unzulänglichen Hilfe der ärztlichen Kunst, vielleicht auch die innere Auflehnung gegen den Zwang des wissenschaftlichen Denkens, welcher dem Menschen die Unerbittlichkeit der Natur widerspiegelt, haben zu allen Zeiten und in unseren Tagen von neuem eine merkwürdige Bedingung für die Heilkraft von Personen und Mitteln geschaffen. Die gläubige Erwartung will sich nur herstellen, wenn der Helfer kein Arzt ist und sich rühmen kann, von der wissenschaftlichen Begründung der Heilkunst nichts zu verstehen, wenn das Mittel nicht durch genaue Prüfung erprobt, sondern etwa durch eine volkstümliche Vorliebe empfohlen ist. Daher die Überfülle von Naturheilkünsten und Naturheilkünstlern, die auch jetzt wieder den Ärzten die Ausübung ihres Berufes streitig machen und von denen wir wenigstens mit einiger Sicherheit aussagen können, daß sie den Heilungsuchenden weit öfter schaden als nützen. Haben wir hier Grund, auf die gläubige Erwartung der Kranken zu schelten, so dürfen wir doch nicht so undankbar sein zu vergessen, daß die nämliche Macht unausgesetzt auch unsere eigenen ärztlichen Bemühungen unterstützt. Die Wirkung wahrscheinlich eines jeden Mittels, das der Arzt verordnet, eines jeden Eingriffes, den er vornimmt, setzt sich aus zwei Anteilen zusammen. Den einen, der bald größer, bald kleiner, niemals ganz zu vernachlässigen ist, stellt das seelische Verhalten des Kranken bei. Die gläubige Erwartung, mit welcher er dem unmittelbaren Einfluß der ärztlichen Maßregel entgegenkommt, hängt einerseits von der Größe seines eigenen Strebens nach Genesung ab, anderseits von seinem Zutrauen, daß er die richtigen Schritte dazu getan, also von seiner Achtung vor der ärztlichen Kunst überhaupt, ferner von der Macht, die er der Person seines Arztes zugesteht, und selbst von der rein menschlichen Zuneigung, welche der Arzt in ihm erweckt hat. Es gibt Ärzte, denen die Fähigkeit, das Zutrauen der Kranken zu gewinnen, in höherem Grade eignet als anderen; der Kranke verspürt die Erleichterung dann oft bereits, wenn er den Arzt in sein Zimmer kommen sieht.
Die Ärzte haben von jeher, in alten Zeiten noch viel ausgiebiger als heute, Seelenbehandlung ausgeübt. Wenn wir unter Seelenbehandlung verstehen die Bemühung, beim Kranken die der Heilung günstigsten seelischen Zustände und Bedingungen hervorzurufen, so ist diese Art ärztlicher Behandlung die geschichtlich älteste. Den alten Völkern stand kaum etwas anderes als psychische Behandlung zu Gebote; sie versäumten auch nie, die Wirkung von Heiltränken und Heilmaßnahmen durch eindringliche Seelenbehandlung zu unterstützen. Die bekannten Anwendungen von Zauberformeln, die Reinigungsbäder, die Hervorlockung von Orakelträumen durch den Schlaf im Tempelraum u. a. können nur auf seelischem Wege heilend gewirkt haben. Die Persönlichkeit des Arztes selbst schuf sich ein Ansehen, das sich direkt von der göttlichen Macht ableitete, da die Heilkunst in ihren Anfängen in den Händen der Priester war. So war die Person des Arztes damals wie heute einer der Hauptumstände zur Erzielung des für die Heilung günstigen Seelenzustandes beim Kranken.
Wir beginnen nun auch den »Zauber« des Wortes zu verstehen. Worte sind ja die wichtigsten Vermittler für den Einfluß, den ein Mensch auf den anderen ausüben will; Worte sind gute Mittel, um seelische Veränderungen bei dem hervorzurufen, an den sie gerichtet werden, und darum klingt es nicht länger rätselhaft, wenn behauptet wird, daß der Zauber des Wortes Krankheitserscheinungen beseitigen kann, zumal solche, die selbst in seelischen Zuständen begründet sind.
Allen seelischen Einflüssen, welche sich als wirksam zur Beseitigung von Krankheiten erwiesen haben, haftet etwas Unberechenbares an. Affekte, Zuwendung des Willens, Ablenkung der Aufmerksamkeit, gläubige Erwartung, alle diese Mächte, welche gelegentlich die Erkrankung aufheben, versäumen in anderen Fällen, dies zu leisten, ohne daß man die Natur der Krankheit für den verschiedenen Erfolg verantwortlich machen könnte. Es ist offenbar die Selbstherrlichkeit der seelisch so verschiedenen Persönlichkeiten, welche der Regelmäßigkeit des Heilerfolges im Wege steht. Seitdem nun die Ärzte die Bedeutung des seelischen Zustandes für die Heilung klar erkannt haben, ist ihnen der Versuch nahegelegt, es nicht mehr dem Kranken zu überlassen, welcher Betrag von seelischem Entgegenkommen sich in ihm herstellen mag, sondern den günstigen Seelenzustand zielbewußt mit geeigneten Mitteln zu erzwingen. Mit dieser Bemühung nimmt die moderne Seelenbehandlung ihren Anfang.
Es ergeben sich so eine ganze Anzahl von Behandlungsweisen, einzelne von ihnen selbstverständlich, andere erst nach verwickelten Voraussetzungen dem Verständnis zugänglich. Selbstverständlich ist es etwa, daß der Arzt, der heute nicht mehr als Priester oder als Besitzer geheimer Wissenschaft Bewunderung einflößen kann, seine Persönlichkeit so hält, daß er das Zutrauen und ein Stück der Neigung seines Kranken erwerben kann. Es dient dann einer zweckmäßigen Verteilung, wenn ihm solcher Erfolg nur bei einer beschränkten Anzahl von Kranken gelingt, während andere durch ihren Bildungsgrad und ihre Zuneigung zu anderen ärztlichen Personen hingezogen werden. Mit der Aufhebung der freien Ärztewahl aber wird eine wichtige Bedingung für die seelische Beeinflussung der Kranken vernichtet.
Eine ganze Reihe sehr wirksamer seelischer Mittel muß sich der Arzt entgehen lassen. Er hat entweder nicht die Macht, oder er darf sich das Recht nicht anmaßen, sie anzuwenden. Dies gilt vor allem für die Hervorrufung starker Affekte, also für die wichtigsten Mittel, mit denen das Seelische aufs Körperliche wirkt. Das Schicksal heilt Krankheiten oft durch große freudige Erregungen, durch Befriedigung von Bedürfnissen, Erfüllung von Wünschen; damit kann der Arzt, der außerhalb seiner Kunst oft selbst ein Ohnmächtiger ist, nicht wetteifern. Furcht und Schrecken zu Heilzwecken zu erzeugen, wird etwa eher in seiner Macht stehen, aber er wird sich außer bei Kindern sehr bedenken müssen, zu solchen zweischneidigen Maßregeln zu greifen. Anderseits schließen sich alle Beziehungen zum Kranken, die mit zärtlichen Gefühlen verknüpft sind, für den Arzt wegen der Lebensbedeutung dieser Seelenlagen aus. Und somit erschiene seine Machtfülle zur seelischen Veränderung seiner Kranken von vornherein so sehr eingeschränkt, daß die absichtlich betriebene Seelenbehandlung keinen Vorteil gegen die frühere Art verspräche.
Der Arzt kann etwa Willenstätigkeit und Aufmerksamkeit des Kranken zu lenken versuchen und hat bei verschiedenen Krankheitszuständen guten Anlaß dazu. Wenn er den, der sich gelähmt glaubt, beharrlich dazu nötigt, die Bewegungen auszuführen, die der Kranke angeblich nicht kann, oder bei dem Ängstlichen, der wegen einer sicherlich nicht vorhandenen Krankheit untersucht zu werden verlangt, die Untersuchung verweigert, wird er die richtige Behandlung eingeschlagen haben; aber diese vereinzelten Gelegenheiten geben kaum ein Recht, die Seelenbehandlung als ein besonderes Heilverfahren aufzustellen. Dagegen hat sich dem Arzt auf einem eigentümlichen und nicht vorherzusehenden Wege die Möglichkeit geboten, einen tiefen, wenn auch vorübergehenden Einfluß auf das Seelenleben seiner Kranken zu nehmen und diesen zu Heilzwecken auszunützen.
Es ist seit langer Zeit bekannt gewesen, aber erst in den letzten Jahrzehnten über jede Anzweiflung erhoben worden, daß es möglich ist, Menschen durch gewisse sanfte Einwirkungen in einen ganz eigentümlichen seelischen Zustand zu versetzen, der mit dem Schlaf viel Ähnlichkeit hat und darum als Hypnose bezeichnet wird. Die Verfahren zur Herbeiführung der Hypnose haben auf den ersten Blick nicht viel untereinander gemein. Man kann hypnotisieren, indem man einen glänzenden Gegenstand durch einige Minuten unverwandt ins Auge fassen läßt oder indem man eine Taschenuhr durch dieselbe Zeit an das Ohr der Versuchsperson hält, oder dadurch, daß man wiederholt über Gesicht und Glieder derselben mit seinen eigenen, flach gehaltenen Händen aus geringer Entfernung streicht. Man kann aber dasselbe erreichen, wenn man der Person, die man hypnotisieren will, das Eintreten des hypnotischen Zustandes und seiner Besonderheiten mit ruhiger Sicherheit ankündigt, ihr die Hypnose also »einredet«. Man kann auch beide Verfahren miteinander verbinden. Man läßt etwa die Person Platz nehmen, hält ihr einen Finger vor die Augen, trägt ihr auf, denselben starr anzusehen, und sagt ihr dann: »Sie fühlen sich müde. Ihre Augen fallen schon zu, Sie können sie nicht offenhalten. Ihre Glieder sind schwer, Sie können sich nicht mehr rühren. Sie schlafen ein« usw. Man merkt doch, daß diesen Verfahren allen eine Fesselung der Aufmerksamkeit gemeinsam ist; bei den erstangeführten handelt es sich um Ermüdung der Aufmerksamkeit durch schwache und gleichmäßige Sinnesreize. Wie es zugeht, daß das bloße Einreden genau den nämlichen Zustand hervorruft wie die anderen Verfahren, das ist noch nicht befriedigend aufgeklärt. Geübte Hypnotiseure geben an, daß man auf solche Weise bei etwa 80 Prozent der Versuchspersonen eine deutliche hypnotische Veränderung erzielt. Man hat aber keine Anzeichen, aus denen man im vorhinein erraten könnte, welche Personen hypnotisierbar sind und welche nicht. Ein Krankheitszustand gehört keineswegs zu den Bedingungen der Hypnose, normale Menschen sollen sich besonders leicht hypnotisieren lassen, und von den Nervösen ist ein Teil sehr schwer hypnotisierbar, während Geisteskranke ganz und gar widerspenstig sind. Der hypnotische Zustand hat sehr verschiedene Abstufungen; in seinem leichtesten Grade verspürt der Hypnotisierte nur etwas wie eine geringe Betäubung, der höchste und durch besondere Merkwürdigkeiten ausgezeichnete Grad wird Somnambulismus genannt wegen seiner Ähnlichkeit mit dem als natürliche Erscheinung beobachteten Schlafwandeln. Die Hypnose ist aber keineswegs ein Schlaf wie unser nächtliches Schlafen oder wie der künstliche, durch Schlafmittel erzeugte. Es treten Veränderungen in ihr auf, und es zeigen sich seelische Leistungen bei ihr erhalten, die dem normalen Schlafe fehlen.
Manche Erscheinungen der Hypnose, z. B. die Veränderungen der Muskeltätigkeit, haben nur wissenschaftliches Interesse. Das bedeutsamste aber und das für uns wichtigste Zeichen der Hypnose liegt in dem Benehmen des Hypnotisierten gegen seinen Hypnotiseur. Während der Hypnotisierte sich gegen die Außenwelt sonst verhält wie ein Schlafender, also sich mit all seinen Sinnen von ihr abgewendet hat, ist er wach für die Person, die ihn in Hypnose versetzt hat, hört und sieht nur diese, versteht sie und gibt ihr Antwort. Diese Erscheinung, die man den Rapport in der Hypnose heißt, findet ein Gegenstück in der Art, wie manche Menschen, z. B. die Mutter, die ihr Kind nährt, schlafen. Sie ist so auffällig, daß sie uns das Verständnis des Verhältnisses zwischen Hypnotisiertem und Hypnotiseur vermitteln sollte.
Daß sich die Welt des Hypnotisierten sozusagen auf den Hypnotiseur einschränkt, ist aber nicht das einzige. Es kommt dazu, daß der erstere vollkommen gefügig gegen den letzteren wird, gehorsam und gläubig, und zwar bei tiefer Hypnose in fast schrankenloser Weise. Und in der Ausführung dieses Gehorsams und dieser Gläubigkeit zeigt es sich nun als Charakter des hypnotischen Zustandes, daß der Einfluß des Seelenlebens auf das Körperliche beim Hypnotisierten außerordentlich erhöht ist. Wenn der Hypnotiseur sagt: »Sie können Ihren Arm nicht bewegen«, so fällt der Arm wie unbeweglich herab; der Hypnotisierte strengt offenbar alle seine Kraft an und kann ihn nicht bewegen. Wenn der Hypnotiseur sagt: »Ihr Arm bewegt sich von selbst, Sie können ihn nicht aufhalten«, so bewegt sich dieser Arm, und man sieht den Hypnotisierten vergebliche Anstrengungen machen, ihn ruhigzustellen. Die Vorstellung, die der Hypnotiseur dem Hypnotisierten durch das Wort gegeben hat, hat genau jenes seelisch-körperliche Verhalten bei ihm hervorgerufen, das ihrem Inhalt entspricht. Darin liegt einerseits Gehorsam, anderseits aber Steigerung des körperlichen Einflusses einer Idee. Das Wort ist hier wirklich wieder zum Zauber geworden.
Dasselbe auf dem Gebiete der Sinneswahrnehmungen. Der Hypnotiseur sagt: »Sie sehen eine Schlange, Sie riechen eine Rose, Sie hören die schönste Musik«, und der Hypnotisierte sieht, riecht, hört, wie die ihm eingegebene Vorstellung es von ihm verlangt. Woher weiß man, daß der Hypnotisierte diese Wahrnehmungen wirklich hat? Man könnte meinen, er stelle sich nur so an; aber es ist doch kein Grund, daran zu zweifeln, denn er benimmt sich ganz so, als ob er sie wirklich hätte, äußert alle dazugehörigen Affekte, kann auch unter Umständen nach der Hypnose von seinen eingebildeten Wahrnehmungen und Erlebnissen berichten. Man merkt dann, daß er gesehen und gehört hat, wie wir im Traum sehen und hören, d. h., er hat halluziniert. Er ist offenbar so sehr gläubig gegen den Hypnotiseur, daß er überzeugt ist, eine Schlange müsse zu sehen sein, wenn der Hypnotiseur sie ihm ankündigt, und diese Überzeugung wirkt so stark auf das Körperliche, daß er die Schlange wirklich sieht, wie es übrigens gelegentlich auch bei nicht hypnotisierten Personen geschehen kann.
Nebenbei bemerkt, eine solche Gläubigkeit, wie sie der Hypnotisierte für seinen Hypnotiseur bereit hat, findet sich außer der Hypnose im wirklichen Leben nur beim Kinde gegen die geliebten Eltern, und eine derartige Einstellung des eigenen Seelenlebens auf das einer anderen Person mit ähnlicher Unterwerfung hat ein einziges, aber dann vollwertiges Gegenstück in manchen Liebesverhältnissen mit voller Hingebung. Das Zusammentreffen von Alleinschätzung und gläubigem Gehorsam gehört überhaupt zur Kennzeichnung des Liebens.
Über den hypnotischen Zustand ist noch einiges zu berichten. Die Rede des Hypnotiseurs, welche die beschriebenen zauberhaften Wirkungen äußert, heißt man die Suggestion, und man hat sich gewöhnt, diesen Namen auch dort anzuwenden, wo zunächst bloß die Absicht vorliegt, eine ähnliche Wirkung hervorzubringen. Wie Bewegung und Empfindung, gehorchen auch alle anderen Seelentätigkeiten des Hypnotisierten dieser Suggestion, während er aus eigenem Antriebe nichts zu unternehmen pflegt. Man kann den hypnotischen Gehorsam für eine Reihe von höchst merkwürdigen Versuchen ausnützen, die tiefe Einblicke in das seelische Getriebe gestatten und dem Zuschauer eine unvertilgbare Überzeugung von der nicht geahnten Macht des Seelischen über das Körperliche schaffen. Wie man den Hypnotisierten nötigen kann zu sehen, was nicht da ist, so kann man ihm auch verbieten, etwas, was da ist und sich seinen Sinnen aufdrängen will, z. B. eine bestimmte Person, zu sehen (die sogenannte negative Halluzination), und diese Person findet es dann unmöglich, sich dem Hypnotisierten durch irgendwelche Reizungen bemerklich zu machen; sie wird von ihm »wie Luft« behandelt. Man kann dem Hypnotisierten die Suggestion erteilen, eine gewisse Handlung erst eine bestimmte Zeit nach dem Aufwachen aus der Hypnose auszuführen (die posthypnotische Suggestion), und der Hypnotisierte hält die Zeit ein und führt mitten in seinem wachen Zustand die suggerierte Handlung aus, ohne einen Grund für sie angeben zu können. Fragt man ihn dann, warum er dies jetzt getan hat, so beruft er sich entweder auf einen dunklen Drang, dem er nicht widerstehen konnte, oder er erfindet einen halbwegs einleuchtenden Vorwand, während er den wahren Grund, die ihm erteilte Suggestion, nicht erinnert.
Das Erwachen aus der Hypnose erfolgt mühelos durch das Machtwort des Hypnotiseurs: »Wachen Sie auf.« Bei den tiefsten Hypnosen fehlt dann die Erinnerung für alles, was während der Hypnose unter dem Einfluß des Hypnotiseurs erlebt wurde. Dieses Stück Seelenleben bleibt gleichsam abgesondert von dem sonstigen. Andere Hypnotisierte haben eine traumhafte Erinnerung, und noch andere erinnern sich zwar an alles, berichten aber, daß sie unter einem seelischen Zwang gestanden hatten, gegen den es keinen Widerstand gab.
Der wissenschaftliche Gewinn, den die Bekanntschaft mit den hypnotischen Tatsachen Ärzten und Seelenforschern gebracht hat, kann nicht leicht überschätzt werden. Um nun aber die praktische Bedeutung der neuen Erkenntnisse zu würdigen, wolle man an Stelle des Hypnotiseurs den Arzt, an Stelle des Hypnotisierten den Kranken setzen. Scheint da die Hypnose nicht berufen, alle Bedürfnisse des Arztes, insoferne er als »Seelenarzt« gegen den Kranken auftreten will, zu befriedigen? Die Hypnose schenkt dem Arzt eine Autorität, wie sie wahrscheinlich niemals ein Priester oder Wundermann besessen hat, indem sie alles seelische Interesse des Hypnotisierten auf die Person des Arztes vereinigt; sie schafft die Eigenmächtigkeit des Seelenlebens beim Kranken ab, in der wir das launenhafte Hemmnis für die Äußerung seelischer Einflüsse auf den Körper erkannt haben; sie stellt an und für sich eine Steigerung der Seelenherrschaft über das Körperliche her, die sonst nur unter den stärksten Affekteinwirkungen beobachtet wird, und durch die Möglichkeit, das in der Hypnose dem Kranken Eingegebene erst nachher im Normalzustand zum Vorschein kommen zu lassen (posthypnotische Suggestion), gibt sie dem Arzt die Mittel in die Hand, seine große Macht während der Hypnose zur Veränderung des Kranken im wachen Zustande zu verwenden. So ergäbe sich ein einfaches Muster für die Art der Heilung durch Seelenbehandlung. Der Arzt versetzt den Kranken in den Zustand der Hypnose, erteilt ihm die nach den jeweiligen Umständen abgeänderte Suggestion, daß er nicht krank ist, daß er nach dem Erwachen von seinen Leidenszeichen nichts verspüren wird, weckt ihn dann auf und darf sich der Erwartung hingeben, daß die Suggestion ihre Schuldigkeit gegen die Krankheit getan hat. Dieses Verfahren wäre etwa, wenn eine einzige Anwendung nicht genug genützt hat, die nötige Anzahl von Malen zu wiederholen.
Ein einziges Bedenken könnte Arzt und Patienten von der Anwendung selbst eines so vielversprechenden Heilverfahrens abhalten. Wenn sich nämlich ergeben sollte, daß die Versetzung in Hypnose ihren Nutzen durch einen Schaden auf anderer Seite wettmacht, z. B. eine dauernde Störung oder Schwächung im Seelenleben des Hypnotisierten hinterläßt. Die bisher gemachten Erfahrungen reichen nun bereits aus, um dieses Bedenken zu beseitigen; einzelne Hypnotisierungen sind völlig harmlos, selbst häufig wiederholte Hypnosen im ganzen unschädlich. Nur eines ist hervorzuheben: wo die Verhältnisse eine fortdauernde Anwendung der Hypnose notwendig machen, da stellt sich eine Gewöhnung an die Hypnose und eine Abhängigkeit vom hypnotisierenden Arzt her, die nicht in der Absicht des Heilverfahrens gelegen sein kann.
Die hypnotische Behandlung bedeutet nun wirklich eine große Erweiterung des ärztlichen Machtbereiches und somit einen Fortschritt der Heilkunst. Man kann jedem Leidenden den Rat geben, sich ihr anzuvertrauen, wenn sie von einem kundigen und vertrauenswürdigen Arzte ausgeübt wird. Aber man sollte sich der Hypnose in anderer Weise bedienen, als es heute zumeist geschieht. Gewöhnlich greift man zu dieser Behandlungsart erst, wenn alle anderen Mittel im Stiche gelassen haben, der Leidende bereits verzagt und unmutig geworden ist. Dann verläßt man seinen Arzt, der nicht hypnotisieren kann oder es nicht ausübt, und wendet sich an einen fremden Arzt, der meist nichts anderes übt und nichts anderes kann als hypnotisieren. Beides ist unvorteilhaft für den Kranken. Der Hausarzt sollte selbst mit der hypnotischen Heilmethode vertraut sein und diese von Anfang an anwenden, wenn er den Fall und die Person dafür geeignet hält. Die Hypnose sollte dort, wo sie überhaupt brauchbar ist, gleichwertig neben den anderen Heilverfahren stehen, nicht eine letzte Zuflucht oder gar einen Abfall von der Wissenschaftlichkeit zur Kurpfuscherei bedeuten. Brauchbar aber ist das hypnotische Heilverfahren nicht nur bei allen nervösen Zuständen und den durch »Einbildung« entstandenen Störungen, sowie zur Entwöhnung von krankhaften Gewohnheiten (Trunksucht, Morphinsucht, geschlechtliche Verirrungen), sondern auch bei vielen Organkrankheiten, selbst entzündlichen, wo man die Aussicht hat, bei Fortbestand des Grundleidens die den Kranken zunächst belästigenden Zeichen desselben, wie die Schmerzen, Bewegungshemmung u. dgl., zu beseitigen. Die Auswahl der Fälle für die Verwendung des hypnotischen Verfahrens ist durchwegs von der Entscheidung des Arztes abhängig.
Nun ist es aber an der Zeit, den Eindruck zu zerstreuen, als wäre mit dem Hilfsmittel der Hypnose für den Arzt eine Zeit bequemer Wundertäterei angebrochen. Es sind noch mannigfache Umstände in Betracht zu ziehen, die geeignet sind, unsere Ansprüche an das hypnotische Heilverfahren erheblich herabzusetzen und die beim Kranken etwa rege gewordenen Hoffnungen auf ihr berechtigtes Maß zurückzuführen. Vor allem stellt sich die eine Grundvoraussetzung als unhaltbar heraus, daß es gelungen wäre, durch die Hypnose den Kranken die störende Eigenmächtigkeit in ihrem seelischen Verhalten zu benehmen. Sie bewahren dieselbe und beweisen sie bereits in ihrer Stellungnahme gegen den Versuch, sie zu hypnotisieren. Wenn oben gesagt wurde, daß etwa 80 Prozent der Menschen hypnotisierbar sind, so ist diese große Zahl nur dadurch zustande gekommen, daß man alle Fälle, die irgendeine Spur von Beeinflussung zeigen, zu den positiven Fällen gerechnet hat. Wirklich tiefe Hypnosen mit vollkommener Gefügigkeit, wie man sie bei der Beschreibung zum Muster wählt, sind eigentlich selten, jedenfalls nicht so häufig, wie es im Interesse der Heilung erwünscht wäre. Man kann den Eindruck dieser Tatsache wieder abschwächen, indem man hervorhebt, daß die Tiefe der Hypnose und die Gefügigkeit gegen die Suggestionen nicht gleichen Schritt miteinander halten, so daß man oft bei leichter hypnotischer Betäubung doch gute Wirkung der Suggestion beobachten kann. Aber auch, wenn man die hypnotische Gefügigkeit als das Wesentlichere des Zustandes selbständig nimmt, muß man zugestehen, daß die einzelnen Menschen ihre Eigenart darin zeigen, daß sie sich nur bis zu einem bestimmten Grad von Gefügigkeit beeinflussen lassen, bei dem sie dann haltmachen. Die einzelnen Personen zeigen also sehr verschiedene Grade von Brauchbarkeit für das hypnotische Heilverfahren. Gelänge es, Mittel aufzufinden, durch welche man alle diese besonderen Stufen des hypnotischen Zustandes bis zur vollkommenen Hypnose steigern könnte, so wäre die Eigenart der Kranken wieder aufgehoben, das Ideal der Seelenbehandlung verwirklicht. Aber dieser Fortschritt ist bisher nicht geglückt; es hängt noch immer weit mehr vom Kranken als vom Arzt ab, welcher Grad von Gefügigkeit sich der Suggestion zur Verfügung stellen wird, d. h., es liegt wiederum im Belieben des Kranken.
Noch bedeutsamer ist ein anderer Gesichtspunkt. Wenn man die höchst merkwürdigen Erfolge der Suggestion im hypnotischen Zustand schildert, vergißt man gerne daran, daß es sich hierbei wie bei allen seelischen Wirkungen auch um Größen- oder Stärkenverhältnisse handelt. Wenn man einen gesunden Menschen in tiefe Hypnose versetzt hat und ihm nun aufträgt, in eine Kartoffel zu beißen, die man ihm als Birne vorstellt, oder ihm einredet, er sehe einen Bekannten, den er grüßen müsse, so wird man leicht volle Gefügigkeit sehen, weil kein ernster Grund beim Hypnotisierten vorhanden ist, welcher sich gegen die Suggestion sträuben könnte. Aber schon bei anderen Aufträgen, wenn man z. B. von einem sonst schamhaften Mädchen verlangt, sich zu entblößen, oder von einem ehrlichen Mann, sich einen wertvollen Gegenstand durch Diebstahl anzueignen, kann man einen Widerstand bei dem Hypnotisierten bemerken, der selbst so weit gehen kann, daß er der Suggestion den Gehorsam verweigert. Man lernt daraus, daß in der besten Hypnose die Suggestion nicht eine unbegrenzte Macht ausübt, sondern nur eine Macht von bestimmter Stärke. Kleine Opfer bringt der Hypnotisierte, mit großen hält er, ganz wie im Wachen, zurück. Hat man es nun mit einem Kranken zu tun und drängt ihn durch die Suggestion zum Verzicht auf die Krankheit, so merkt man, daß dies für ihn ein großes und nicht ein kleines Opfer bedeutet. Die Macht der Suggestion mißt sich zwar auch dann mit der Kraft, welche die Krankheitserscheinungen geschaffen hat und sie festhält, aber die Erfahrung zeigt, daß letztere von einer ganz anderen Größenordnung ist als der hypnotische Einfluß. Derselbe Kranke, der sich in jede – nicht gerade anstößige – Traumlage, die man ihm eingibt, voll gefügig hineinfindet, kann vollkommen widerspenstig gegen die Suggestion bleiben, welche ihm etwa seine eingebildete Lähmung abspricht. Dazu kommt noch in der Praxis, daß gerade nervöse Kranke meist schlecht hypnotisierbar sind, so daß nicht der volle hypnotische Einfluß, sondern nur ein Bruchteil desselben den Kampf gegen die starken Kräfte aufzunehmen hat, mit denen die Krankheit im Seelenleben verankert ist.
Der Suggestion ist also nicht von vornherein der Sieg über die Krankheit sicher, wenn einmal die Hypnose und selbst eine tiefe Hypnose gelungen ist. Es bedarf dann noch immer eines Kampfes, und der Ausgang ist sehr häufig ungewiß. Gegen ernstliche Störungen seelischer Herkunft richtet man daher mit einmaliger Hypnose nichts aus. Mit der Wiederholung der Hypnose fällt aber der Eindruck des Wunders, auf das sich der Kranke vielleicht gefaßt gemacht hat. Man kann es dann erzielen, daß bei wiederholten Hypnosen die anfänglich mangelnde Beeinflussung der Krankheit immer deutlicher wird, bis sich ein befriedigender Erfolg herstellt. Aber eine solche hypnotische Behandlung kann ebenso mühselig und zeitraubend verlaufen wie nur irgendeine andere.
Eine andere Art, wie sich die relative Schwäche der Suggestion im Vergleich mit dem zu bekämpfenden Leiden verrät, ist die, daß die Suggestion zwar die Aufhebung der Krankheitserscheinungen zustande bringt, aber nur für kurze Zeit. Nach Ablauf dieser Zeit sind die Leidenszeichen wieder da und müssen durch neuerliche Hypnose mit Suggestion wieder vertrieben werden. Wiederholt sich dieser Ablauf oft genug, so erschöpft er gewöhnlich die Geduld des Kranken wie die des Arztes und hat das Aufgeben der hypnotischen Behandlung zur Folge. Auch sind dies die Fälle, in denen sich bei dem Kranken die Abhängigkeit vom Arzt und eine Art Sucht nach der Hypnose herzustellen pflegen.
Es ist gut, wenn der Kranke diese Mängel der hypnotischen Heilmethode und die Möglichkeiten der Enttäuschung bei ihrer Anwendung kennt. Die Heilkraft der hypnotischen Suggestion ist ja etwas Tatsächliches, sie bedarf der übertreibenden Anpreisung nicht. Anderseits ist es leicht verständlich, wenn die Ärzte, denen die hypnotische Seelenbehandlung soviel mehr versprochen hatte, als sie halten konnte, nicht müde werden, nach anderen Verfahren zu suchen, welche eine eingreifendere oder minder unberechenbare Einwirkung auf die Seele des Kranken ermöglichen. Man darf sich der sicheren Erwartung hingeben, daß die zielbewußte moderne Seelenbehandlung, welche ja eine ganz junge Wiederbelebung alter Heilmethoden darstellt, den Ärzten noch weit kräftigere Waffen zum Kampfe gegen die Krankheit in die Hände geben wird. Eine tiefere Einsicht in die Vorgänge des Seelenlebens, deren erste Anfänge gerade auf den hypnotischen Erfahrungen ruhen, wird Mittel und Wege dazu weisen.
Psychopathische Personen auf der Bühne (1942)
Wenn der Zweck des Schauspiels dahin geht, »Furcht und Mitleid« zu erwecken, eine »Reinigung der Affekte« herbeizuführen, wie seit Aristoteles angenommen wird, so kann man dieselbe Absicht etwas ausführlicher beschreiben, indem man sagt, es handle sich um die Eröffnung von Lust- oder Genußquellen aus unserem Affektleben wie beim Komischen, Witz usw. aus unserer Intelligenzarbeit, durch welche viele solcher Quellen unzugänglich gemacht worden sind. Gewiß ist das Austoben der eigenen Affekte dabei in erster Linie anzuführen, und der daraus resultierende Genuß entspricht einerseits der Erleichterung durch ausgiebige Abfuhr, andererseits wohl der sexuellen Miterregung, die, darf man annehmen, als Nebengewinn bei jeder Affekterweckung abfällt und dem Menschen das so sehr gewünschte Gefühl der Höherspannung seines psychischen Niveaus liefert. Das teilnehmende Zuschauen beim Schau-Spiel leistet dem Erwachsenen dasselbe wie das Spiel dem Kinde, dessen tastende Erwartung, es dem Erwachsenen gleichtun zu können, so befriedigt wird. Der Zuschauer erlebt zu wenig, er fühlt sich als »Misero, dem nichts Großes passieren kann«, er hat seinen Ehrgeiz, als Ich im Mittelpunkt des Weltgetriebes zu stehen, längst dämpfen, besser verschieben müssen, er will fühlen, wirken, alles so gestalten, wie er möchte, kurz Held sein, und die Dichter-Schauspieler ermöglichen ihm das, indem sie ihm die Identifizierung mit einem Helden gestatten. Sie ersparen ihm auch etwas dabei, denn der Zuschauer weiß wohl, daß solches Betätigen seiner Person im Heldentum nicht ohne Schmerzen, Leiden und schwere Befürchtungen, die fast den Genuß aufheben, möglich ist; er weiß auch, daß er nur ein Leben hat und vielleicht in einem solchen Kampf gegen die Widerstände erliegen wird. Daher hat sein Genuß die Illusion zur Voraussetzung, das heißt die Milderung des Leidens durch die Sicherheit, daß es erstens ein anderer ist, der dort auf der Bühne handelt und leidet, und zweitens doch nur ein Spiel, aus dem seiner persönlichen Sicherheit kein Schaden erwachsen kann. Unter solchen Umständen darf er sich als »Großen« genießen, unterdrückten Regungen wie dem Freiheitsbedürfnis in religiöser, politischer, sozialer und sexueller Hinsicht ungescheut nachgeben und sich in den einzelnen großen Szenen des dargestellten Lebens nach allen Richtungen austoben.
Dies sind aber Genußbedingungen, die mehreren Formen der Dichtung gemeinsam sind. Die Lyrik dient vor allem dem Austoben intensiver vielfacher Empfindungen, wie seinerzeit der Tanz, das Epos soll hauptsächlich den Genuß der großen heldenhaften Persönlichkeit in ihren Siegen ermöglichen, das Drama aber tiefer in die Affektmöglichkeiten herabsteigen, die Unglückserwartungen noch zum Genuß gestalten, und zeigt daher den Helden im Kampf vielmehr mit einer masochistischen Befriedigung im Unterliegen. Man könnte das Drama geradezu durch diese Relation zum Leiden und Unglück charakterisieren, sei es, daß wie im Schauspiel nur die Sorge geweckt und dann beschwichtigt oder wie in der Tragödie das Leiden verwirklicht wird. Die Entstehung des Dramas aus Opferhandlungen (Bock und Sündenbock) im Kult der Götter kann nicht ohne Beziehung zu diesem Sinn des Dramas sein, es beschwichtigt gleichsam die beginnende Auflehnung gegen die göttliche Weltordnung, die das Leiden festgesetzt hat. Die Helden sind zunächst Aufrührer gegen Gott oder ein Göttliches, und aus dem Elendsgefühl des Schwächeren gegen die Gottesgewalt soll durch masochistische Befriedigung und direkten Genuß der doch als groß betonten Persönlichkeit Lust gezogen werden. Es ist dies die Prometheusstimmung des Menschen, aber mit der kleinlichen Bereitwilligkeit versetzt, sich doch durch eine momentane Befriedigung zeitweilig beschwichtigen zu lassen.
Alle Arten von Leiden sind also das Thema des Dramas, aus denen es dem Zuhörer Lust zu verschaffen verspricht, und daraus ergibt sich als erste Kunstformbedingung, daß es den Zuhörer nicht leiden mache, daß es das erregte Mitleiden durch die dabei möglichen Befriedigungen zu kompensieren verstehe, gegen welche Regel von neueren Dichtern besonders oft gefehlt wird.
Doch schränkt sich dieses Leiden bald auf seelisches Leiden ein, denn körperlich leiden will niemand, der weiß, wie bald das dabei veränderte Körpergefühl allem seelischen Genießen ein Ende macht. Wer krank ist, hat nur einen Wunsch: gesund zu werden, den Zustand zu verlassen, der Arzt soll kommen, das Medikament, die Hemmung des Phantasiespiels aufhören, das uns selbst aus unseren Leiden Genuß zu schöpfen verwöhnt hat. Wenn sich der Zuschauer in den körperlich Kranken versetzt, findet er nichts von Genuß und psychischer Leistungsfähigkeit in sich vor, und darum ist der körperlich Kranke nur als Requisit, nicht als Held auf der Bühne möglich, insofern nicht besondere psychische Seiten des Krankseins doch die psychische Arbeit ermöglichen, zum Beispiel die Verlassenheit des Kranken im Philoktet oder die Hoffnungslosigkeit des Kranken in den Schwindsuchtstücken.
Seelische Leiden kennt der Mensch aber wesentlich im Zusammenhang mit den Verhältnissen, unter denen sie erworben werden, und daher braucht das Drama eine Handlung, aus der solche Leiden stammen, und fängt mit der Einführung in diese Handlung an. Scheinbare Ausnahme, wenn manche Stücke fertige seelische Leiden bringen wie Ajax, Philoktet, denn infolge der Bekanntheit der Stoffe hebt sich der Vorhang im griechischen Drama immer gleichsam mitten im Stück. Es ist nun leicht, die Bedingungen dieser Handlung erschöpfend darzustellen, es muß eine Handlung von Konflikt sein, Anstrengung des Willens und Widerstand enthalten. Die erste und großartigste Erfüllung dieser Bedingung geschah durch den Kampf gegen das Göttliche. Es ist schon gesagt worden, daß diese Tragödie auflehnerisch ist, während Dichter und Zuhörer für den Rebellen Partei nehmen. Je weniger man dann dem Göttlichen zutraut, desto mehr gewinnt die menschliche Ordnung, die man für die Leiden mit immer mehr Einsicht verantwortlich macht, und so ist der nächste Kampf der des Helden gegen die menschliche soziale Gemeinschaft, die bürgerliche Tragödie. Eine andere Erfüllung ist die des Kampfes zwischen Menschen selbst, die Charaktertragödie, die alle Erregungen des Agons für sich hat und mit Gewinn sich zwischen hervorragenden von den Einschränkungen menschlicher Institutionen befreiten Personen abspielt, eigentlich mehr als einen Helden haben muß. Verquickungen zwischen beiden Fällen, Kampf des Helden gegen Institutionen, die sich in starken Charakteren verkörpern, sind natürlich ohne weiteres zulässig. Die reine Charaktertragödie entbehrt der Genußquelle der Auflehnung, die im sozialen Stück zum Beispiel bei Ibsen wieder so mächtig hervortritt wie in den Königsdramen der griechischen Klassiker.
Wenn sich religiöses, Charakter- und soziales Drama wesentlich durch den Kampfplatz unterscheiden, auf dem die Handlung vor sich geht, aus der das Leiden stammt, so folgen wir nun dem Drama auf einen weiteren Kampfplatz, auf dem es ganz psychologisches Drama wird. Im Seelenleben des Helden selbst kommt es zum Leiden schaffenden Kampf zwischen verschiedenen Regungen, ein Kampf, der nicht mit dem Untergang des Helden, sondern mit dem einer Regung, also mit Verzicht enden muß. Jede Vereinigung dieser Bedingung mit früheren, also denen beim sozialen und Charakter-Drama, ist natürlich möglich, insofern die Institution gerade jenen inneren Konflikt hervorruft. Hier ist die Stelle für die Liebestragödien, insofern die Unterdrückung der Liebe durch die soziale Kultur, durch menschliche Einrichtungen oder den aus der Oper bekannten Kampf zwischen »Liebe und Pflicht« den Ausgangspunkt von fast ins Unendliche variierenden Konfliktsituationen bildet. Ebenso unendlich wie die erotischen Tagträume der Menschen.
Die Reihe der Möglichkeiten erweitert sich aber, und das psychologische Drama wird zum psychopathologischen, wenn nicht mehr der Konflikt zweier annähernd gleich bewußten Regungen, sondern der zwischen einer bewußten und einer verdrängten Quelle des Leidens ist, an dem wir teilnehmen und aus dem wir Lust ziehen sollen. Bedingung des Genusses ist hier, daß der Zuschauer auch ein Neurotiker sei. Denn nur ihm wird die Freilegung und gewissermaßen bewußte Anerkennung der verdrängten Regung Lust bereiten können anstatt bloß Abneigung; beim Nichtneurotiker wird solche bloß auf Abneigung stoßen und die Bereitschaft hervorrufen, den Akt der Verdrängung zu wiederholen, denn diese ist hier gelungen – der verdrängten Regung ist durch den einmaligen Verdrängungsaufwand voll das Gleichgewicht gehalten. Beim Neurotiker ist die Verdrängung im Mißlingen begriffen, labil und bedarf beständig neuen Aufwandes, der durch die Anerkennung erspart wird. Nur bei ihm besteht ein solcher Kampf, der Gegenstand des Dramas sein kann, aber auch bei ihm wird der Dichter nicht bloß Befreiungs genuß, sondern auch Widerstand erzeugen.
Das erste dieser modernen Dramen ist der Hamlet. Es behandelt das Thema, wie ein bisher normaler Mensch durch die besondere Natur der ihm gestellten Aufgabe zum Neurotiker wird, in dem eine bisher glücklich verdrängte Regung sich zur Geltung zu bringen sucht. Der Hamlet zeichnet sich durch drei Charaktere aus, die für unsere Frage wichtig scheinen. 1. Daß der Held nicht psychopathisch ist, sondern es in der uns beschäftigenden Handlung erst wird. 2. Daß die verdrängte Regung zu jenen gehört, die bei uns allen in gleicher Weise verdrängt ist, deren Verdrängung zu den Grundlagen unserer persönlichen Entwicklung gehört, während die Situation gerade an dieser Verdrängung rüttelt. Durch diese beiden Bedingungen wird es uns leicht, uns im Helden wiederzufinden; wir sind desselben Konflikts fähig wie er, denn »wer unter gewissen Umständen seinen Verstand nicht verliert, hat keinen zu verlieren«. 3. Aber es scheint als Bedingung der Kunstform, daß die zum Bewußtsein ringende Regung, so sicher sie kenntlich ist, so wenig mit deutlichem Namen genannt wird, so daß sich der Vorgang im Hörer wieder mit abgewandter Aufmerksamkeit vollzieht und er von Gefühlen ergriffen wird, anstatt sich Rechenschaft zu geben. Dadurch wird gewiß ein Stück des Widerstandes erspart, wie man es in der analytischen Arbeit sieht, wo die Abkömmlinge des Verdrängten infolge des geringeren Widerstandes zum Bewußtsein kommen, das sich dem Verdrängten selbst versagt. Ist doch der Konflikt im Hamlet so sehr versteckt, daß ich ihn erst erraten mußte.
Es ist möglich, daß infolge der Nichtbeachtung dieser drei Bedingungen so viele andere psychopathische Figuren für die Bühne ebenso unbrauchbar werden, wie sie es fürs Leben sind. Denn der kranke Neurotiker ist für uns ein Mensch, in dessen Konflikt wir keine Einsicht gewinnen können, wenn er ihn fertig mitbringt. Umgekehrt, wenn wir diesen Konflikt kennen, vergessen wir, daß er ein Kranker ist, so wie er bei Kenntnis desselben aufhört, selbst krank zu sein. Aufgabe des Dichters wäre es, uns in dieselbe Krankheit zu versetzen, was am besten geschieht, wenn wir die Entwicklung mit ihm mitmachen. Besonders wird dies dort notwendig sein, wo die Verdrängung nicht bereits bei uns besteht, also erst hergestellt werden muß, was einen Schritt in der Verwendung der Neurose auf der Bühne über Hamlet hinaus darstellt. Wo uns die fremde und fertige Neurose entgegentritt, werden wir im Leben nach dem Arzt rufen und die Figur für bühnenunfähig halten.
Dieser Fehler scheint bei Der Anderen von Bahr vorzuliegen, außerdem der andere im Problem liegende, daß es uns nicht möglich ist, von dem Vorrecht des einen, das Mädchen voll zu befriedigen, eine nachfühlende Überzeugung zu gewinnen. Ihr Fall kann also nicht der unsere werden. Außerdem der dritte, daß nichts zu erraten bleibt und der volle Widerstand gegen diese Bedingtheit der Liebe, die wir nicht mögen, in uns wachgerufen wird. Die Bedingung der abgelenkten Aufmerksamkeit scheint die wichtigste der hier geltenden Formbedingungen zu sein.
Im allgemeinen wird sich etwa sagen lassen, daß die neurotische Labilität des Publikums und die Kunst des Dichters, Widerstände zu vermeiden und Vorlust zu geben, allein die Grenze der Verwendung abnormer Charaktere bestimmen kann.
Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung (1912)
Die technischen Regeln, die ich hier in Vorschlag bringe, haben sich mir aus der langjährigen eigenen Erfahrung ergeben, nachdem ich durch eigenen Schaden von der Verfolgung anderer Wege zurückgekommen war. Man wird leicht bemerken, daß sie sich, wenigstens viele von ihnen, zu einer einzigen Vorschrift zusammensetzen. Ich hoffe, daß ihre Berücksichtigung den analytisch tätigen Ärzten viel unnützen Aufwand ersparen und sie vor manchem Übersehen behüten wird; aber ich muß ausdrücklich sagen, diese Technik hat sich als die einzig zweckmäßige für meine Individualität ergeben; ich wage es nicht in Abrede zu stellen, daß eine ganz anders konstituierte ärztliche Persönlichkeit dazu gedrängt werden kann, eine andere Einstellung gegen den Kranken und gegen die zu lösende Aufgabe zu bevorzugen.
(a) Die nächste Aufgabe, vor die sich der Analytiker gestellt sieht, der mehr als einen Kranken im Tage so behandelt, wird ihm auch als die schwierigste erscheinen. Sie besteht ja darin, alle die unzähligen Namen, Daten, Einzelheiten der Erinnerung, Einfälle und Krankheitsproduktionen während der Kur, die ein Patient im Laufe von Monaten und Jahren vorbringt, im Gedächtnis zu behalten und sie nicht mit ähnlichem Material zu verwechseln, das von anderen gleichzeitig oder früher analysierten Patienten herrührt. Ist man gar genötigt, täglich sechs, acht Kranke oder selbst mehr zu analysieren, so wird eine Gedächtnisleistung, der solches gelingt, bei Außenstehenden Unglauben, Bewunderung oder selbst Bedauern wecken. In jedem Falle wird man auf die Technik neugierig sein, welche die Bewältigung einer solchen Fülle gestattet, und wird erwarten, daß dieselbe sich besonderer Hilfsmittel bediene.
Indes ist diese Technik eine sehr einfache. Sie lehnt alle Hilfsmittel, wie wir hören werden, selbst das Niederschreiben ab und besteht einfach darin, sich nichts besonders merken zu wollen und allem, was man zu hören bekommt, die nämliche »gleichschwebende Aufmerksamkeit«, wie ich es schon einmal genannt habe, entgegenzubringen. Man erspart sich auf diese Weise eine Anstrengung der Aufmerksamkeit, die man doch nicht durch viele Stunden täglich festhalten könnte, und vermeidet eine Gefahr, die von dem absichtlichen Aufmerken unzertrennlich ist. Sowie man nämlich seine Aufmerksamkeit absichtlich bis zu einer gewissen Höhe anspannt, beginnt man auch unter dem dargebotenen Materiale auszuwählen; man fixiert das eine Stück besonders scharf, eliminiert dafür ein anderes und folgt bei dieser Auswahl seinen Erwartungen oder seinen Neigungen. Gerade dies darf man aber nicht; folgt man bei der Auswahl seinen Erwartungen, so ist man in Gefahr, niemals etwas anderes zu finden, als was man bereits weiß; folgt man seinen Neigungen, so wird man sicherlich die mögliche Wahrnehmung fälschen. Man darf nicht darauf vergessen, daß man ja zumeist Dinge zu hören bekommt, deren Bedeutung erst nachträglich erkannt wird.
Wie man sieht, ist die Vorschrift, sich alles gleichmäßig zu merken, das notwendige Gegenstück zu der Anforderung an den Analysierten, ohne Kritik und Auswahl alles zu erzählen, was ihm einfällt. Benimmt sich der Arzt anders, so macht er zum großen Teile den Gewinn zunichte, der aus der Befolgung der »psychoanalytischen Grundregel« von seiten des Patienten resultiert. Die Regel für den Arzt läßt sich so aussprechen: Man halte alle bewußten Einwirkungen von seiner Merkfähigkeit ferne und überlasse sich völlig seinem »unbewußten Gedächtnisse«, oder rein technisch ausgedrückt: Man höre zu und kümmere sich nicht darum, ob man sich etwas merke.
Was man auf diese Weise bei sich erreicht, genügt allen Anforderungen während der Behandlung. Jene Bestandteile des Materials, die sich bereits zu einem Zusammenhange fügen, werden für den Arzt auch bewußt verfügbar; das andere, noch zusammenhanglose, chaotisch ungeordnete, scheint zunächst versunken, taucht aber bereitwillig im Gedächtnisse auf, sobald der Analysierte etwas Neues vorbringt, womit es sich in Beziehung bringen und wodurch es sich fortsetzen kann. Man nimmt dann lächelnd das unverdiente Kompliment des Analysierten wegen eines »besonders guten Gedächtnisses« entgegen, wenn man nach Jahr und Tag eine Einzelheit reproduziert, die der bewußten Absicht, sie im Gedächtnisse zu fixieren, wahrscheinlich entgangen wäre.
Irrtümer in diesem Erinnern ereignen sich nur zu Zeiten und an Stellen, wo man durch die Eigenbeziehung gestört wird (s. unten), hinter dem Ideale des Analytikers also in arger Weise zurückbleibt. Verwechslungen mit dem Materiale anderer Patienten kommen recht selten zustande. In einem Streite mit dem Analysierten, ob und wie er etwas einzelnes gesagt habe, bleibt der Arzt zumeist im Rechte [Fußnote]Der Analysierte behauptet oft, eine gewisse Mitteilung bereits früher gemacht zu haben, während man ihm mit ruhiger Überlegenheit versichern kann, sie erfolge jetzt zum erstenmal. Es stellt sich dann heraus, daß der Analysierte früher einmal die Intention zu dieser Mitteilung gehabt hat, an ihrer Ausführung aber durch einen noch bestehenden Widerstand gehindert wurde. Die Erinnerung an diese Intention ist für ihn ununterscheidbar von der Erinnerung an deren Ausführung..
(b) Ich kann es nicht empfehlen, während der Sitzungen mit dem Analysierten Notizen in größerem Umfange zu machen, Protokolle anzulegen u. dgl. Abgesehen von dem ungünstigen Eindruck, den dies bei manchen Patienten hervorruft, gelten dagegen die nämlichen Gesichtspunkte, die wir beim Merken gewürdigt haben. Man trifft notgedrungen eine schädliche Auswahl aus dem Stoffe, während man nachschreibt oder stenographiert, und man bindet ein Stück seiner eigenen Geistestätigkeit, das in der Deutung des Angehörten eine bessere Verwendung finden soll. Man kann ohne Vorwurf Ausnahmen von dieser Regel zulassen für Daten, Traumtexte oder einzelne bemerkenswerte Ergebnisse, die sich leicht aus dem Zusammenhange lösen lassen und für eine selbständige Verwendung als Beispiele geeignet sind. Aber ich pflege auch dies nicht zu tun. Beispiele schreibe ich am Abend nach Abschluß der Arbeit aus dem Gedächtnis nieder; Traumtexte, an denen mir gelegen ist, lasse ich von den Patienten nach der Erzählung des Traumes fixieren.
(c) Die Niederschrift während der Sitzung mit dem Patienten könnte durch den Vorsatz gerechtfertigt werden, den behandelten Fall zum Gegenstande einer wissenschaftlichen Publikation zu machen. Das kann man ja prinzipiell kaum versagen. Aber man muß doch im Auge behalten, daß genaue Protokolle in einer analytischen Krankengeschichte weniger leisten, als man von ihnen erwarten sollte. Sie gehören, strenggenommen, jener Scheinexaktheit an, für welche uns die »moderne« Psychiatrie manche auffällige Beispiele zur Verfügung stellt. Sie sind in der Regel ermüdend für den Leser und bringen es doch nicht dazu, ihm die Anwesenheit bei der Analyse zu ersetzen. Wir haben überhaupt die Erfahrung gemacht, daß der Leser, wenn er dem Analytiker glauben will, ihm auch Kredit für das bißchen Bearbeitung einräumt, das er an seinem Material vorgenommen hat; wenn er die Analyse und den Analytiker aber nicht ernst nehmen will, so setzt er sich auch über getreue Behandlungsprotokolle hinweg. Dies scheint nicht der Weg, um dem Mangel an Evidenz abzuhelfen, der an den psychoanalytischen Darstellungen gefunden wird.
(d) Es ist zwar einer der Ruhmestitel der analytischen Arbeit, daß Forschung und Behandlung bei ihr zusammenfallen, aber die Technik, die der einen dient, widersetzt sich von einem gewissen Punkte an doch der anderen. Es ist nicht gut, einen Fall wissenschaftlich zu bearbeiten, solange seine Behandlung noch nicht abgeschlossen ist, seinen Aufbau zusammenzusetzen, seinen Fortgang erraten zu wollen, von Zeit zu Zeit Aufnahmen des gegenwärtigen Status zu machen, wie das wissenschaftliche Interesse es fordern würde. Der Erfolg leidet in solchen Fällen, die man von vornherein der wissenschaftlichen Verwertung bestimmt und nach deren Bedürfnissen behandelt; dagegen gelingen jene Fälle am besten, bei denen man wie absichtslos verfährt, sich von jeder Wendung überraschen läßt, und denen man immer wieder unbefangen und voraussetzungslos entgegentritt. Das richtige Verhalten für den Analytiker wird darin bestehen, sich aus der einen psychischen Einstellung nach Bedarf in die andere zu schwingen, nicht zu spekulieren und zu grübeln, solange er analysiert, und erst dann das gewonnene Material der synthetischen Denkarbeit zu unterziehen, nachdem die Analyse abgeschlossen ist. Die Unterscheidung der beiden Einstellungen würde bedeutungslos, wenn wir bereits im Besitze aller oder doch der wesentlichen Erkenntnisse über die Psychologie des Unbewußten und über die Struktur der Neurosen wären, die wir aus der psychoanalytischen Arbeit gewinnen können. Gegenwärtig sind wir von diesem Ziele noch weit entfernt und dürfen uns die Wege nicht verschließen, um das bisher Erkannte nachzuprüfen und Neues dazu zu finden.
(e) Ich kann den Kollegen nicht dringend genug empfehlen, sich während der psychoanalytischen Behandlung den Chirurgen zum Vorbild zu nehmen, der alle seine Affekte und selbst sein menschliches Mitleid beiseite drängt und seinen geistigen Kräften ein einziges Ziel setzt: die Operation so kunstgerecht als möglich zu vollziehen. Für den Psychoanalytiker wird unter den heute waltenden Umständen eine Affektstrebung am gefährlichsten, der therapeutische Ehrgeiz, mit seinem neuen und viel angefochtenen Mittel etwas zu leisten, was überzeugend auf andere wirken kann. Damit bringt er nicht nur sich selbst in eine für die Arbeit ungünstige Verfassung, er setzt sich auch wehrlos gewissen Widerständen des Patienten aus, von dessen Kräftespiel ja die Genesung in erster Linie abhängt. Die Rechtfertigung dieser vom Analytiker zu fordernden Gefühlskälte liegt darin, daß sie für beide Teile die vorteilhaftesten Bedingungen schafft, für den Arzt die wünschenswerte Schonung seines eigenen Affektlebens, für den Kranken das größte Ausmaß von Hilfeleistung, das uns heute möglich ist. Ein alter Chirurg hatte zu seinem Wahlspruch die Worte genommen: Je le pansai, Dieu le guérit[Fußnote]Ich verband ihn, Gott heilte ihn. Mit etwas Ähnlichem sollte sich der Analytiker zufriedengeben.
(f) Es ist leicht zu erraten, in welchem Ziele diese einzeln vorgebrachten Regeln zusammentreffen. Sie wollen alle beim Arzte das Gegenstück zu der für den Analysierten aufgestellten »psychoanalytischen Grundregel« schaffen. Wie der Analysierte alles mitteilen soll, was er in seiner Selbstbeobachtung erhascht, mit Hintanhaltung aller logischen und affektiven Einwendungen, die ihn bewegen wollen, eine Auswahl zu treffen, so soll sich der Arzt in den Stand setzen, alles ihm Mitgeteilte für die Zwecke der Deutung, der Erkennung des verborgenen Unbewußten zu verwerten, ohne die vom Kranken aufgegebene Auswahl durch eine eigene Zensur zu ersetzen, in eine Formel gefaßt: er soll dem gebenden Unbewußten des Kranken sein eigenes Unbewußtes als empfangendes Organ zuwenden, sich auf den Analysierten einstellen wie der Receiver des Telephons zum Teller eingestellt ist. Wie der Receiver die von Schallwellen angeregten elektrischen Schwankungen der Leitung wieder in Schallwellen verwandelt, so ist das Unbewußte des Arztes befähigt, aus den ihm mitgeteilten Abkömmlingen des Unbewußten dieses Unbewußte, welches die Einfälle des Kranken determiniert hat, wiederherzustellen.
Wenn der Arzt aber imstande sein soll, sich seines Unbewußten in solcher Weise als Instrument bei der Analyse zu bedienen, so muß er selbst eine psychologische Bedingung in weitem Ausmaße erfüllen. Er darf in sich selbst keine Widerstände dulden, welche das von seinem Unbewußten Erkannte von seinem Bewußtsein abhalten, sonst würde er eine neue Art von Auswahl und Entstellung in die Analyse einführen, welche weit schädlicher wäre als die durch Anspannung seiner bewußten Aufmerksamkeit hervorgerufene. Es genügt nicht hiefür, daß er selbst ein annähernd normaler Mensch sei, man darf vielmehr die Forderung aufstellen, daß er sich einer psychoanalytischen Purifizierung unterzogen und von jenen Eigenkomplexen Kenntnis genommen habe, die geeignet wären, ihn in der Erfassung des vom Analysierten Dargebotenen zu stören. An der disqualifizierenden Wirkung solcher eigener Defekte kann billigerweise nicht gezweifelt werden; jede ungelöste Verdrängung beim Arzte entspricht nach einem treffenden Worte von W. Stekel] einem »blinden Fleck« in seiner analytischen Wahrnehmung.
Vor Jahren erwiderte ich auf die Frage, wie man ein Analytiker werden könne: Durch die Analyse seiner eigenen Träume. Gewiß reicht diese Vorbereitung für viele Personen aus, aber nicht für alle, die die Analyse erlernen möchten. Auch gelingt es nicht allen, die eigenen Träume ohne fremde Hilfe zu deuten. Ich rechne es zu den vielen Verdiensten der Züricher analytischen Schule, daß sie die Bedingung verschärft und in der Forderung niedergelegt hat, es solle sich jeder, der Analysen an anderen ausführen will, vorher selbst einer Analyse bei einem Sachkundigen unterziehen. Wer es mit der Aufgabe ernst meint, sollte diesen Weg wählen, der mehr als einen Vorteil verspricht; das Opfer, sich ohne Krankheitszwang einer fremden Person eröffnet zu haben, wird reichlich gelohnt. Man wird nicht nur seine Absicht, das Verborgene der eigenen Person kennenzulernen, in weit kürzerer Zeit und mit geringerem affektiven Aufwand verwirklichen, sondern auch Eindrücke und Überzeugungen am eigenen Leibe gewinnen, die man durch das Studium von Büchern und Anhören von Vorträgen vergeblich anstrebt. Endlich ist auch der Gewinn aus der dauernden seelischen Beziehung nicht gering anzuschlagen, die sich zwischen dem Analysierten und seinem Einführenden herzustellen pflegt.
Eine solche Analyse eines praktisch Gesunden wird begreiflicherweise unabgeschlossen bleiben. Wer den hohen Wert der durch sie erworbenen Selbsterkenntnis und Steigerung der Selbstbeherrschung zu würdigen weiß, wird die analytische Erforschung seiner eigenen Person nachher als Selbstanalyse fortsetzen und sich gerne damit bescheiden, daß er in sich wie außerhalb seiner immer Neues zu finden erwarten muß. Wer aber als Analytiker die Vorsicht der Eigenanalyse verschmäht hat, der wird nicht nur durch die Unfähigkeit bestraft, über ein gewisses Maß an seinen Kranken zu lernen, er unterliegt auch einer ernsthafteren Gefahr, die zur Gefahr für andere werden kann. Er wird leicht in die Versuchung geraten, was er in dumpfer Selbstwahrnehmung von den Eigentümlichkeiten seiner eigenen Person erkennt, als allgemeingültige Theorie in die Wissenschaft hinauszuprojizieren, er wird die psychoanalytische Methode in Mißkredit bringen und Unerfahrene irreleiten.
(g) Ich füge noch einige andere Regeln an, in welchen der Übergang gemacht wird von der Einstellung des Arztes zur Behandlung des Analysierten.
Es ist gewiß verlockend für den jungen und eifrigen Psychoanalytiker, daß er viel von der eigenen Individualität einsetze, um den Patienten mit sich fortzureißen und ihn im Schwung über die Schranken seiner engen Persönlichkeit zu erheben. Man sollte meinen, es sei durchaus zulässig, ja zweckmäßig für die Überwindung der beim Kranken bestehenden Widerstände, wenn der Arzt ihm Einblick in die eigenen seelischen Defekte und Konflikte gestattet, ihm durch vertrauliche Mitteilungen aus seinem Leben die Gleichstellung ermöglicht. Ein Vertrauen ist doch das andere wert, und wer Intimität vom anderen fordert, muß ihm doch auch solche bezeugen.
Allein, im psychoanalytischen Verkehre läuft manches anders ab, als wir es nach den Voraussetzungen der Bewußtseinspsychologie erwarten dürfen. Die Erfahrung spricht nicht für die Vorzüglichkeit einer solchen affektiven Technik. Es ist auch nicht schwer einzusehen, daß man mit ihr den psychoanalytischen Boden verläßt und sich den Suggestionsbehandlungen annähert. Man erreicht so etwa, daß der Patient eher und leichter mitteilt, was ihm selbst bekannt ist und was er aus konventionellen Widerständen noch eine Weile zurückgehalten hätte. Für die Aufdeckung des dem Kranken Unbewußten leistet diese Technik nichts, sie macht ihn nur noch unfähiger, tiefere Widerstände zu überwinden, und sie versagt in schwereren Fällen regelmäßig an der regegemachten Unersättlichkeit des Kranken, der dann gerne das Verhältnis umkehren möchte und die Analyse des Arztes interessanter findet als die eigene. Auch die Lösung der Übertragung, eine der Hauptaufgaben der Kur, wird durch die intime Einstellung des Arztes erschwert, so daß der etwaige Gewinn zu Anfang schließlich mehr als wettgemacht wird. Ich stehe darum nicht an, diese Art der Technik als eine fehlerhafte zu verwerfen. Der Arzt soll undurchsichtig für den Analysierten sein und wie eine Spiegelplatte nichts anderes zeigen, als was ihm gezeigt wird. Es ist allerdings praktisch nichts dagegen zu sagen, wenn ein Psychotherapeut ein Stück Analyse mit einer Portion Suggestivbeeinflussung vermengt, um in kürzerer Zeit sichtbare Erfolge zu erzielen, wie es zum Beispiel in Anstalten notwendig wird, aber man darf verlangen, daß er selbst nicht im Zweifel darüber sei, was er vornehme, und daß er wisse, seine Methode sei nicht die der richtigen Psychoanalyse.
(h) Eine andere Versuchung ergibt sich aus der erzieherischen Tätigkeit, die dem Arzte bei der psychoanalytischen Behandlung ohne besonderen Vorsatz zufällt. Bei der Lösung von Entwicklungshemmungen macht es sich von selbst, daß der Arzt in die Lage kommt, den frei gewordenen Strebungen neue Ziele anzuweisen. Es ist dann nur ein begreiflicher Ehrgeiz, wenn er sich bemüht, die Person, auf deren Befreiung von der Neurose er soviel Mühe aufgewendet hat, auch zu etwas besonders Vortrefflichem zu machen, und ihren Wünschen hohe Ziele vorschreibt. Aber auch hiebei sollte der Arzt sich in der Gewalt haben und weniger die eigenen Wünsche als die Eignung des Analysierten zur Richtschnur nehmen. Nicht alle Neurotiker bringen viel Talent zur Sublimierung mit; von vielen unter ihnen kann man annehmen, daß sie überhaupt nicht erkrankt wären, wenn sie die Kunst, ihre Triebe zu sublimieren, besessen hätten. Drängt man sie übermäßig zur Sublimierung und schneidet ihnen die nächsten und bequemsten Triebbefriedigungen ab, so macht man ihnen das Leben meist noch schwieriger, als sie es ohnedies empfinden. Als Arzt muß man vor allem tolerant sein gegen die Schwäche des Kranken, muß sich bescheiden, auch einem nicht Vollwertigen ein Stück Leistungs- und Genußfähigkeit wiedergewonnen zu haben. Der erzieherische Ehrgeiz ist sowenig zweckmäßig wie der therapeutische. Es kommt außerdem in Betracht, daß viele Personen gerade an dem Versuche erkrankt sind, ihre Triebe über das von ihrer Organisation gestattete Maß hinaus zu sublimieren, und daß sich bei den zur Sublimierung Befähigten dieser Prozeß von selbst zu vollziehen pflegt, sobald ihre Hemmungen durch die Analyse überwunden sind. Ich meine also, das Bestreben, die analytische Behandlung regelmäßig zur Triebsublimierung zu verwenden, ist zwar immer lobenswert, aber keineswegs in allen Fällen empfehlenswert.
(i) In welchen Grenzen soll man die intellektuelle Mitarbeit des Analysierten bei der Behandlung in Anspruch nehmen? Es ist schwer, hierüber etwas allgemein Gültiges auszusagen. Die Persönlichkeit des Patienten entscheidet in erster Linie. Aber Vorsicht und Zurückhaltung sind hiebei jedenfalls zu beobachten. Es ist unrichtig, dem Analysierten Aufgaben zu stellen, er solle seine Erinnerung sammeln, über eine gewisse Zeit seines Lebens nachdenken u. dgl. Er hat vielmehr vor allem zu lernen, was keinem leichtfällt anzunehmen, daß durch geistige Tätigkeit von der Art des Nachdenkens, daß durch Willens- und Aufmerksamkeitsanstrengung keines der Rätsel der Neurose gelöst wird, sondern nur durch die geduldige Befolgung der psychoanalytischen Regel, welche die Kritik gegen das Unbewußte und dessen Abkömmlinge auszuschalten gebietet. Besonders unerbittlich sollte man auf der Befolgung dieser Regel bei jenen Kranken bestehen, die die Kunst üben, bei der Behandlung ins Intellektuelle auszuweichen, dann viel und oft sehr weise über ihren Zustand reflektieren und es sich so ersparen, etwas zu seiner Bewältigung zu tun. Ich nehme darum bei meinen Patienten auch die Lektüre analytischer Schriften nicht gerne zu Hilfe; ich verlange, daß sie an der eigenen Person lernen sollen, und versichere ihnen, daß sie dadurch mehr und Wertvolleres erfahren werden, als ihnen die gesamte psychoanalytische Literatur sagen könnte. Ich sehe aber ein, daß es unter den Bedingungen eines Anstaltsaufenthaltes sehr vorteilhaft werden kann, sich der Lektüre zur Vorbereitung der Analysierten und zur Herstellung einer Atmosphäre von Beeinflussung zu bedienen.
Am dringendsten möchte ich davor warnen, um die Zustimmung und Unterstützung von Eltern oder Angehörigen zu werben, indem man ihnen ein – einführendes oder tiefergehendes – Werk unserer Literatur zu lesen gibt. Meist reicht dieser wohlgemeinte Schritt hin, um die naturgemäße, irgendeinmal unvermeidliche Gegnerschaft der Angehörigen gegen die psychoanalytische Behandlung der Ihrigen vorzeitig losbrechen zu lassen, so daß es überhaupt nicht zum Beginne der Behandlung kommt.
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daß die fortschreitende Erfahrung der Psychoanalytiker bald zu einer Einigung über die Fragen der Technik führen wird, wie man am zweckmäßigsten die Neurotiker behandeln solle. Was die Behandlung der »Angehörigen« betrifft, so gestehe ich meine völlige Ratlosigkeit ein und setze auf deren individuelle Behandlung überhaupt wenig Zutrauen.
Trauer und Melancholie (1917)
Nachdem uns der Traum als Normalvorbild der narzißtischen Seelenstörungen gedient hat, wollen wir den Versuch machen, das Wesen der Melancholie durch ihre Vergleichung mit dem Normalaffekt der Trauer zu erhellen. Wir müssen aber diesmal ein Bekenntnis vorausschicken, welches vor Überschätzung des Ergebnisses warnen soll. Die Melancholie, deren Begriffsbestimmung auch in der deskriptiven Psychiatrie schwankend ist, tritt in verschiedenartigen klinischen Formen auf, deren Zusammenfassung zur Einheit nicht gesichert scheint, von denen einige eher an somatische als an psychogene Affektionen mahnen. Unser Material beschränkt sich, abgesehen von den Eindrücken, die jedem Beobachter zu Gebote stehen, auf eine kleine Anzahl von Fällen, deren psychogene Natur keinem Zweifel unterlag. So werden wir den Anspruch auf allgemeine Gültigkeit unserer Ergebnisse von vornherein fallenlassen und uns mit der Erwägung trösten, daß wir mit unseren gegenwärtigen Forschungsmitteln kaum etwas finden können, was nicht typisch wäre, wenn nicht für eine ganze Klasse von Affektionen, so doch für eine kleinere Gruppe.
Die Zusammenstellung von Melancholie und Trauer erscheint durch das Gesamtbild der beiden Zustände gerechtfertigt [Fußnote]Auch Abraham, dem wir die bedeutsamste unter den wenigen analytischen Studien über den Gegenstand verdanken, ist von dieser Vergleichung ausgegangen (1912).. Auch die Anlässe zu beiden aus den Lebenseinwirkungen fallen dort, wo sie überhaupt durchsichtig sind, zusammen. Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal usw. Unter den nämlichen Einwirkungen zeigt sich bei manchen Personen, die wir darum unter den Verdacht einer krankhaften Disposition setzen, an Stelle der Trauer eine Melancholie. Es ist auch sehr bemerkenswert, daß es uns niemals einfällt, die Trauer als einen krankhaften Zustand zu betrachten und dem Arzt zur Behandlung zu übergeben, obwohl sie schwere Abweichungen vom normalen Lebensverhalten mit sich bringt. Wir vertrauen darauf, daß sie nach einem gewissen Zeitraum überwunden sein wird, und halten eine Störung derselben für unzweckmäßig, selbst für schädlich.
Die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tief schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt, durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert. Dies Bild wird unserem Verständnis nähergerückt, wenn wir erwägen, daß die Trauer dieselben Züge aufweist, bis auf einen einzigen; die Störung des Selbstgefühls fällt bei ihr weg. Sonst aber ist es dasselbe. Die schwere Trauer, die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person, enthält die nämliche schmerzliche Stimmung, den Verlust des Interesses für die Außenwelt – soweit sie nicht an den Verstorbenen mahnt –, den Verlust der Fähigkeit, irgendein neues Liebesobjekt zu wählen – was den Betrauerten ersetzen hieße –, die Abwendung von jeder Leistung, die nicht mit dem Andenken des Verstorbenen in Beziehung steht. Wir fassen es leicht, daß diese Hemmung und Einschränkung des Ichs der Ausdruck der ausschließlichen Hingabe an die Trauer ist, wobei für andere Absichten und Interessen nichts übrigbleibt. Eigentlich erscheint uns dieses Verhalten nur darum nicht pathologisch, weil wir es so gut zu erklären wissen.
Wir werden auch den Vergleich gutheißen, der die Stimmung der Trauer eine »schmerzliche« nennt. Seine Berechtigung wird uns wahrscheinlich einleuchten, wenn wir imstande sind, den Schmerz ökonomisch zu charakterisieren.
Worin besteht nun die Arbeit, welche die Trauer leistet? Ich glaube, daß es nichts Gezwungenes enthalten wird, sie in folgender Art darzustellen: Die Realitätsprüfung hat gezeigt, daß das geliebte Objekt nicht mehr besteht, und erläßt nun die Aufforderung, alle Libido aus ihren Verknüpfungen mit diesem Objekt abzuziehen. Dagegen erhebt sich ein begreifliches Sträuben – es ist allgemein zu beobachten, daß der Mensch eine Libidoposition nicht gern verläßt, selbst dann nicht, wenn ihm Ersatz bereits winkt. Dies Sträuben kann so intensiv sein, daß eine Abwendung von der Realität und ein Festhalten des Objekts durch eine halluzinatorische Wunschpsychose (siehe die vorige Abhandlung) zustande kommt. Das Normale ist, daß der Respekt vor der Realität den Sieg behält. Doch kann ihr Auftrag nicht sofort erfüllt werden. Er wird nun im einzelnen unter großem Aufwand von Zeit und Besetzungsenergie durchgeführt und unterdes die Existenz des verlorenen Objekts psychisch fortgesetzt. Jede einzelne der Erinnerungen und Erwartungen, in denen die Libido an das Objekt geknüpft war, wird eingestellt, überbesetzt und an ihr die Lösung der Libido vollzogen. Warum diese Kompromißleistung der Einzeldurchführung des Realitätsgebotes so außerordentlich schmerzhaft ist, läßt sich in ökonomischer Begründung gar nicht leicht angeben. Es ist merkwürdig, daß uns diese Schmerzunlust selbstverständlich erscheint. Tatsächlich wird aber das Ich nach der Vollendung der Trauerarbeit wieder frei und ungehemmt.
Wenden wir nun auf die Melancholie an, was wir von der Trauer erfahren haben. In einer Reihe von Fällen ist es offenbar, daß auch sie Reaktion auf den Verlust eines geliebten Objekts sein kann; bei anderen Veranlassungen kann man erkennen, daß der Verlust von mehr ideeller Natur ist. Das Objekt ist nicht etwa real gestorben, aber es ist als Liebesobjekt verlorengegangen (z. B. der Fall einer verlassenen Braut). In noch anderen Fällen glaubt man an der Annahme eines solchen Verlustes festhalten zu sollen, aber man kann nicht deutlich erkennen, was verloren wurde, und darf um so eher annehmen, daß auch der Kranke nicht bewußt erfassen kann, was er verloren hat. Ja, dieser Fall könnte auch dann noch vorliegen, wenn der die Melancholie veranlassende Verlust dem Kranken bekannt ist, indem er zwar weiß wen, aber nicht, was er an ihm verloren hat. So würde uns nahegelegt, die Melancholie irgendwie auf einen dem Bewußtsein entzogenen Objektverlust zu beziehen, zum Unterschied von der Trauer, bei welcher nichts an dem Verluste unbewußt ist.
Bei der Trauer fanden wir Hemmung und Interesselosigkeit durch die das Ich absorbierende Trauerarbeit restlos aufgeklärt. Eine ähnliche innere Arbeit wird auch der unbekannte Verlust bei der Melancholie zur Folge haben und darum für die Hemmung der Melancholie verantwortlich werden. Nur daß uns die melancholische Hemmung einen rätselhaften Eindruck macht, weil wir nicht sehen können, was die Kranken so vollständig absorbiert. Der Melancholiker zeigt uns noch eines, was bei der Trauer entfällt, eine außerordentliche Herabsetzung seines Ichgefühls, eine großartige Ichverarmung. Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden, bei der Melancholie ist es das Ich selbst. Der Kranke schildert uns sein Ich als nichtswürdig, leistungsunfähig und moralisch verwerflich, er macht sich Vorwürfe, beschimpft sich und erwartet Ausstoßung und Strafe. Er erniedrigt sich vor jedem anderen, bedauert jeden der Seinigen, daß er an seine so unwürdige Person gebunden sei. Er hat nicht das Urteil einer Veränderung, die an ihm vorgefallen ist, sondern streckt seine Selbstkritik über die Vergangenheit aus; er behauptet, niemals besser gewesen zu sein. Das Bild dieses – vorwiegend moralischen – Kleinheitswahnes vervollständigt sich durch Schlaflosigkeit, Ablehnung der Nahrung und eine psychologisch höchst merkwürdige Überwindung des Triebes, der alles Lebende am Leben festzuhalten zwingt.
Es wäre wissenschaftlich wie therapeutisch gleich unfruchtbar, dem Kranken zu widersprechen, der solche Anklagen gegen sein Ich vorbringt. Er muß wohl irgendwie recht haben und etwas schildern, was sich so verhält, wie es ihm erscheint. Einige seiner Angaben müssen wir ja ohne Einschränkung sofort bestätigen. Er ist wirklich so interesselos, so unfähig zur Liebe und zur Leistung, wie er sagt. Aber das ist, wie wir wissen, sekundär, ist die Folge der inneren, uns unbekannten, der Trauer vergleichbaren Arbeit, welche sein Ich aufzehrt. In einigen anderen Selbstanklagen scheint er uns gleichfalls recht zu haben und die Wahrheit nur schärfer zu erfassen als andere, die nicht melancholisch sind. Wenn er sich in gesteigerter Selbstkritik als kleinlichen, egoistischen, unaufrichtigen, unselbständigen Menschen schildert, der nur immer bestrebt war, die Schwächen seines Wesens zu verbergen, so mag er sich unseres Wissens der Selbsterkenntnis ziemlich angenähert haben, und wir fragen uns nur, warum man erst krank werden muß, um solcher Wahrheit zugänglich zu sein. Denn es leidet keinen Zweifel, wer eine solche Selbsteinschätzung gefunden hat und sie vor anderen äußert – eine Schätzung, wie sie Prinz Hamlet für sich und alle anderen bereit hat [Fußnote]› Use every man after his desert, and who shall 'scape whipping?‹, Hamlet, II. Akt, 2. Szene. –, der ist krank, ob er nun die Wahrheit sagt oder sich mehr oder weniger unrecht tut. Es ist auch nicht schwer zu bemerken, daß zwischen dem Ausmaß der Selbsterniedrigung und ihrer realen Berechtigung nach unserem Urteil keine Entsprechung besteht. Die früher brave, tüchtige und pflichttreue Frau wird in der Melancholie nicht besser von sich sprechen als die in Wahrheit nichtsnutzige, ja vielleicht hat die erstere mehr Aussicht, an Melancholie zu erkranken, als die andere, von der auch wir nichts Gutes zu sagen wüßten. Endlich muß uns auffallen, daß der Melancholiker sich doch nicht ganz so benimmt wie ein normalerweise von Reue und Selbstvorwurf Zerknirschter. Es fehlt das Schämen vor anderen, welches diesen letzteren Zustand vor allem charakterisieren würde, oder es tritt wenigstens nicht auffällig hervor. Man könnte am Melancholiker beinahe den gegenteiligen Zug einer aufdringlichen Mitteilsamkeit hervorheben, die an der eigenen Bloßstellung eine Befriedigung findet.
Es ist also nicht wesentlich, ob der Melancholiker mit seiner peinlichen Selbstherabsetzung insofern recht hat, als diese Kritik mit dem Urteil der anderen zusammentrifft. Es muß sich vielmehr darum handeln, daß er seine psychologische Situation richtig beschreibt. Er hat seine Selbstachtung verloren und muß guten Grund dazu haben. Wir stehen dann allerdings vor einem Widerspruch, der uns ein schwer lösbares Rätsel aufgibt. Nach der Analogie mit der Trauer mußten wir schließen, daß er einen Verlust am Objekte erlitten hat; aus seinen Aussagen geht ein Verlust an seinem Ich hervor.
Ehe wir uns mit diesem Widerspruch beschäftigen, verweilen wir einen Moment lang bei dem Einblick, den uns die Affektion des Melancholikers in die Konstitution des menschlichen Ichs gewährt. Wir sehen bei ihm, wie sich ein Teil des Ichs dem anderen gegenüberstellt, es kritisch wertet, es gleichsam zum Objekt nimmt. Unser Verdacht, daß die hier vom Ich abgespaltene kritische Instanz auch unter anderen Verhältnissen ihre Selbständigkeit erweisen könne, wird durch alle weiteren Beobachtungen bestätigt werden. Wir werden wirklich Grund finden, diese Instanz vom übrigen Ich zu sondern. Was wir hier kennenlernen, ist die gewöhnlich Gewissen genannte Instanz; wir werden sie mit der Bewußtseinszensur und der Realitätsprüfung zu den großen Ichinstitutionen rechnen und irgendwo auch die Beweise dafür finden, daß sie für sich allein erkranken kann. Das Krankheitsbild der Melancholie läßt das moralische Mißfallen am eigenen Ich vor anderen Ausstellungen hervortreten: körperliche Gebrechen, Häßlichkeit, Schwäche, soziale Minderwertigkeit sind weit seltener Gegenstand der Selbsteinschätzung; nur die Verarmung nimmt unter den Befürchtungen oder Behauptungen des Kranken eine bevorzugte Stelle ein.
Zur Aufklärung des vorhin aufgestellten Widerspruches führt dann eine Beobachtung, die nicht einmal schwer anzustellen ist. Hört man die mannigfachen Selbstanklagen des Melancholikers geduldig an, so kann man sich endlich des Eindruckes nicht erwehren, daß die stärksten unter ihnen zur eigenen Person oft sehr wenig passen, aber mit geringfügigen Modifikationen einer anderen Person anzupassen sind, die der Kranke liebt, geliebt hat oder lieben sollte. Sooft man den Sachverhalt untersucht, bestätigt er diese Vermutung. So hat man denn den Schlüssel des Krankheitsbildes in der Hand, indem man die Selbstvorwürfe als Vorwürfe gegen ein Liebesobjekt erkennt, die von diesem weg auf das eigene Ich gewälzt sind.
Die Frau, die laut ihren Mann bedauert, daß er an eine so untüchtige Frau gebunden ist, will eigentlich die Untüchtigkeit des Mannes anklagen, in welchem Sinne diese auch gemeint sein mag. Man braucht sich nicht so sehr zu verwundern, daß einige echte Selbstvorwürfe unter die rückgewendeten eingestreut sind; sie dürfen sich vordrängen, weil sie dazu verhelfen, die anderen zu verdecken und die Erkenntnis des Sachverhaltes unmöglich zu machen, sie stammen ja auch aus dem Für und Wider des Liebesstreites, der zum Liebesverlust geführt hat. Auch das Benehmen der Kranken wird jetzt um vieles verständlicher. Ihre Klagen sind Anklagen, gemäß dem alten Sinne des Wortes; sie schämen und verbergen sich nicht, weil alles Herabsetzende, was sie von sich aussagen, im Grunde von einem anderen gesagt wird; und sie sind weit davon entfernt, gegen ihre Umgebung die Demut und Unterwürfigkeit zu bezeugen, die allein so unwürdigen Personen geziemen würde, sie sind vielmehr im höchsten Grade quälerisch, immer wie gekränkt und als ob ihnen ein großes Unrecht widerfahren wäre. Dies ist alles nur möglich, weil die Reaktionen ihres Benehmens noch von der seelischen Konstellation der Auflehnung ausgehen, welche dann durch einen gewissen Vorgang in die melancholische Zerknirschung übergeführt worden ist.
Es hat dann keine Schwierigkeit, diesen Vorgang zu rekonstruieren. Es hatte eine Objektwahl, eine Bindung der Libido an eine bestimmte Person bestanden; durch den Einfluß einer realen« Kränkung oder Enttäuschung von Seiten der geliebten Person trat eine Erschütterung dieser Objektbeziehung ein. Der Erfolg war nicht der normale einer Abziehung der Libido von diesem Objekt und Verschiebung derselben auf ein neues, sondern ein anderer, der mehrere Bedingungen für sein Zustandekommen zu erfordern scheint. Die Objektbesetzung erwies sich als wenig resistent, sie wurde aufgehoben, aber die freie Libido nicht auf ein anderes Objekt verschoben, sondern ins Ich zurückgezogen. Dort fand sie aber nicht eine beliebige Verwendung, sondern diente dazu, eine Identifizierung des Ichs mit dem aufgegebenen Objekt herzustellen. Der Schatten des Objekts fiel so auf das Ich, welches nun von einer besonderen Instanz wie ein Objekt, wie das verlassene Objekt, beurteilt werden konnte. Auf diese Weise hatte sich der Objektverlust in einen Ichverlust verwandelt, der Konflikt zwischen dem Ich und der geliebten Person in einen Zwiespalt zwischen der Ichkritik und dem durch Identifizierung veränderten Ich.
Von den Voraussetzungen und Ergebnissen eines solchen Vorganges läßt sich einiges unmittelbar erraten. Es muß einerseits eine starke Fixierung an das Liebesobjekt vorhanden sein, anderseits aber im Widerspruch dazu eine geringe Resistenz der Objektbesetzung. Dieser Widerspruch scheint nach einer treffenden Bemerkung von O. Rank zu fordern, daß die Objektwahl auf narzißtischer Grundlage erfolgt sei, so daß die Objektbesetzung, wenn sich Schwierigkeiten gegen sie erheben, auf den Narzißmus regredieren kann. Die narzißtische Identifizierung mit dem Objekt wird dann zum Ersatz der Liebesbesetzung, was den Erfolg hat, daß die Liebesbeziehung trotz des Konflikts mit der geliebten Person nicht aufgegeben werden muß. Ein solcher Ersatz der Objektliebe durch Identifizierung ist ein für die narzißtischen Affektionen bedeutsamer Mechanismus; K. Landauer hat ihn kürzlich in dem Heilungsvorgang einer Schizophrenie aufdecken können (1914). Er entspricht natürlich der Regression von einem Typus der Objektwahl auf den ursprünglichen Narzißmus. Wir haben an anderer Stelle ausgeführt, daß die Identifizierung die Vorstufe der Objektwahl ist und die erste, in ihrem Ausdruck ambivalente Art, wie das Ich ein Objekt auszeichnet. Es möchte sich dieses Objekt einverleiben, und zwar der oralen oder kannibalischen Phase der Libidoentwicklung entsprechend, auf dem Wege des Fressens. Auf diesen Zusammenhang führt Abraham wohl mit Recht die Ablehnung der Nahrungsaufnahme zurück, welche sich bei schwerer Ausbildung des melancholischen Zustandes kundgibt.
Der von der Theorie geforderte Schluß, welcher die Disposition zur melancholischen Erkrankung oder eines Stückes von ihr in die Vorherrschaft des narzißtischen Typus der Objektwahl verlegt, entbehrt leider noch der Bestätigung durch die Untersuchung. Ich habe in den einleitenden Sätzen dieser Abhandlung bekannt, daß das empirische Material, auf welches diese Studie gebaut ist, für unsere Ansprüche nicht zureicht. Dürfen wir eine Übereinstimmung der Beobachtung mit unseren Ableitungen annehmen, so würden wir nicht zögern, die Regression von der Objektbesetzung auf die noch dem Narzißmus angehörige orale Libidophase in die Charakteristik der Melancholie aufzunehmen. Identifizierungen mit dem Objekt sind auch bei den Übertragungsneurosen keineswegs selten, vielmehr ein bekannter Mechanismus der Symptombildung, zumal bei der Hysterie. Wir dürfen aber den Unterschied der narzißtischen Identifizierung von der hysterischen darin erblicken, daß bei ersterer die Objektbesetzung aufgelassen wird, während sie bei letzterer bestehenbleibt und eine Wirkung äußert, die sich gewöhnlich auf gewisse einzelne Aktionen und Innervationen beschränkt. Immerhin ist die Identifizierung auch bei den Übertragungsneurosen der Ausdruck einer Gemeinschaft, welche Liebe bedeuten kann. Die narzißtische Identifizierung ist die ursprünglichere und eröffnet uns den Zugang zum Verständnis der weniger gut studierten hysterischen.
Die Melancholie entlehnt also einen Teil ihrer Charaktere der Trauer, den anderen Teil dem Vorgang der Regression von der narzißtischen Objektwahl zum Narzißmus. Sie ist einerseits wie die Trauer Reaktion auf den realen Verlust des Liebesobjekts, aber sie ist überdies mit einer Bedingung behaftet, welche der normalen Trauer abgeht oder dieselbe, wo sie hinzutritt, in eine pathologische verwandelt. Der Verlust des Liebesobjekts ist ein ausgezeichneter Anlaß, um die Ambivalenz der Liebesbeziehungen zur Geltung und zum Vorschein zu bringen. Wo die Disposition zur Zwangsneurose vorhanden ist, verleiht darum der Ambivalenzkonflikt der Trauer eine pathologische Gestaltung und zwingt sie, sich in der Form von Selbstvorwürfen, daß man den Verlust des Liebesobjekts selbst verschuldet, d. h. gewollt habe, zu äußern. In solchen zwangsneurotischen Depressionen nach dem Tode geliebter Personen wird uns vorgeführt, was der Ambivalenzkonflikt für sich allein leistet, wenn die regressive Einziehung der Libido nicht mit dabei ist. Die Anlässe der Melancholie gehen meist über den klaren Fall des Verlustes durch den Tod hinaus und umfassen alle die Situationen von Kränkung, Zurücksetzung und Enttäuschung, durch welche ein Gegensatz von Lieben und Hassen in die Beziehung eingetragen oder eine vorhandene Ambivalenz verstärkt werden kann. Dieser Ambivalenzkonflikt, bald mehr realer, bald mehr konstitutiver Herkunft, ist unter den Voraussetzungen der Melancholie nicht zu vernachlässigen. Hat sich die Liebe zum Objekt, die nicht aufgegeben werden kann, während das Objekt selbst aufgegeben wird, in die narzißtische Identifizierung geflüchtet, so betätigt sich an diesem Ersatzobjekt der Haß, indem er es beschimpft, erniedrigt, leiden macht und an diesem Leiden eine sadistische Befriedigung gewinnt. Die unzweifelhaft genußreiche Selbstquälerei der Melancholie bedeutet ganz wie das entsprechende Phänomen der Zwangsneurose die Befriedigung von sadistischen und Haßtendenzen [Fußnote]Über deren Unterscheidung siehe den Aufsatz über ›Triebe und Triebschicksale‹. die einem Objekt gelten und auf diesem Wege eine Wendung gegen die eigene Person erfahren haben. Bei beiden Affektionen pflegt es den Kranken noch zu gelingen, auf dem Umwege über die Selbstbestrafung Rache an den ursprünglichen Objekten zu nehmen und ihre Lieben durch Vermittlung des Krankseins zu quälen, nachdem sie sich in die Krankheit begeben haben, um ihnen ihre Feindseligkeit nicht direkt zeigen zu müssen. Die Person, welche die Gefühlsstörung des Kranken hervorgerufen, nach welcher sein Kranksein orientiert ist, ist doch gewöhnlich in der nächsten Umgebung des Kranken zu finden. So hat die Liebesbesetzung des Melancholischen für sein Objekt ein zweifaches Schicksal erfahren; sie ist zum Teil auf die Identifizierung regrediert, zum anderen Teil aber unter dem Einfluß des Ambivalenzkonflikts auf die ihm nähere Stufe des Sadismus zurückversetzt worden.
Erst dieser Sadismus löst uns das Rätsel der Selbstmordneigung, durch welche die Melancholie so interessant und so – gefährlich wird. Wir haben als den Urzustand, von dem das Triebleben ausgeht, eine so großartige Selbstliebe des Ichs erkannt, wir sehen in der Angst, die bei Lebensbedrohung auftritt, einen so riesigen Betrag der narzißtischen Libido frei werden, daß wir es nicht erfassen, wie dies Ich seiner Selbstzerstörung zustimmen könne. Wir wußten zwar längst, daß kein Neurotiker Selbstmordabsichten verspürt, der solche nicht von einem Mordimpuls gegen andere auf sich zurückwendet, aber es blieb unverständlich, durch welches Kräftespiel eine solche Absicht sich zur Tat durchsetzen kann. Nun lehrt uns die Analyse der Melancholie, daß das Ich sich nur dann töten kann, wenn es durch die Rückkehr der Objektbesetzung sich selbst wie ein Objekt behandeln kann, wenn es die Feindseligkeit gegen sich richten darf, die einem Objekt gilt und die die ursprüngliche Reaktion des Ichs gegen Objekte der Außenwelt vertritt. (Siehe ›Triebe und Triebschicksale‹.) So ist bei der Regression von der narzißtischen Objektwahl das Objekt zwar aufgehoben worden, aber es hat sich doch mächtiger erwiesen als das Ich selbst. In den zwei entgegengesetzten Situationen der äußersten Verliebtheit und des Selbstmordes wird das Ich, wenn auch auf gänzlich verschiedenen Wegen, vom Objekt überwältigt.
Es liegt dann noch nahe, für den einen auffälligen Charakter der Melancholie, das Hervortreten der Verarmungsangst, die Ableitung der aus ihren Verbindungen gerissenen und regressiv verwandelten Analerotik zuzulassen.
Die Melancholie stellt uns noch vor andere Fragen, deren Beantwortung uns zum Teil entgeht. Daß sie nach einem gewissen Zeitraum abgelaufen ist, ohne nachweisbare grobe Veränderungen zu hinterlassen, diesen Charakter teilt sie mit der Trauer. Dort fanden wir die Auskunft, die Zeit werde für die Detaildurchführung des Gebotes der Realitätsprüfung benötigt, nach welcher Arbeit das Ich seine Libido vom verlorenen Objekt freibekommen habe. Mit einer analogen Arbeit können wir das Ich während der Melancholie beschäftigt denken; das ökonomische Verständnis des Herganges bleibt hier wie dort aus. Die Schlaflosigkeit der Melancholie bezeugt wohl die Starrheit des Zustandes, die Unmöglichkeit, die für den Schlaf erforderliche allgemeine Einziehung der Besetzungen durchzuführen. Der melancholische Komplex verhält sich wie eine offene Wunde, zieht von allen Seiten Besetzungsenergien an sich (die wir bei den Übertragungsneurosen »Gegenbesetzungen« geheißen haben) und entleert das Ich bis zur völligen Verarmung; er kann sich leicht resistent gegen den Schlafwunsch des Ichs erweisen. – Ein wahrscheinlich somatisches, psychogen nicht aufzuklärendes Moment kommt in der regelmäßigen Linderung des Zustandes zur Abendzeit zum Vorschein. An diese Erörterungen schließt die Frage an, ob nicht Ichverlust ohne Rücksicht auf das Objekt (rein narzißtische Ichkränkung) hinreicht, das Bild der Melancholie zu erzeugen, und ob nicht direkt toxische Verarmung an Ichlibido gewisse Formen der Affektion ergeben kann.
Die merkwürdigste und aufklärungsbedürftigste Eigentümlichkeit der Melancholie ist durch ihre Neigung gegeben, in den symptomatisch gegensätzlichen Zustand der Manie umzuschlagen. Bekanntlich hat nicht jede Melancholie dieses Schicksal. Manche Fälle verlaufen in periodischen Rezidiven, deren Intervalle entweder keine oder eine nur sehr geringfügige Tönung von Manie erkennen lassen. Andere zeigen jene regelmäßige Abwechslung von melancholischen und manischen Phasen, die in der Aufstellung des zyklischen Irreseins Ausdruck gefunden hat. Man wäre versucht, diese Fälle von der psychogenen Auffassung auszuschließen, wenn nicht die psychoanalytische Arbeit gerade für mehrere dieser Erkrankungen Auflösung wie therapeutische Beeinflussung zustande gebracht hätte. Es ist also nicht nur gestattet, sondern sogar geboten, eine analytische Aufklärung der Melancholie auch auf die Manie auszudehnen.
Ich kann nicht versprechen, daß dieser Versuch voll befriedigend ausfallen wird. Er reicht vielmehr nicht weit über die Möglichkeit einer ersten Orientierung hinaus. Es stehen uns hier zwei Anhaltspunkte zu Gebote, der erste ein psychoanalytischer Eindruck, der andere eine, man darf wohl sagen, allgemeine ökonomische Erfahrung. Der Eindruck, dem bereits mehrere psychoanalytische Forscher Worte geliehen haben, geht dahin, daß die Manie keinen anderen Inhalt hat als die Melancholie, daß beide Affektionen mit demselben »Komplex« ringen, dem das Ich wahrscheinlich in der Melancholie erlegen ist, während es ihn in der Manie bewältigt oder beiseite geschoben hat. Den anderen Anhalt gibt die Erfahrung, daß alle Zustände von Freude, Jubel, Triumph, die uns das Normalvorbild der Manie zeigen, die nämliche ökonomische Bedingtheit erkennen lassen. Es handelt sich bei ihnen um eine Einwirkung, durch welche ein großer, lange unterhaltener oder gewohnheitsmäßig hergestellter psychischer Aufwand endlich überflüssig wird, so daß er für mannigfache Verwendungen und Abfuhrmöglichkeiten bereitsteht. Also zum Beispiel: Wenn ein armer Teufel durch einen großen Geldgewinn plötzlich der chronischen Sorge um das tägliche Brot enthoben wird, wenn ein langes und mühseliges Ringen sich am Ende durch den Erfolg gekrönt sieht, wenn man in die Lage kommt, einen drückenden Zwang, eine lange fortgesetzte Verstellung mit einem Schlage aufzugeben u. dgl. Alle solche Situationen zeichnen sich durch die gehobene Stimmung, die Abfuhrzeichen des freudigen Affekts, und durch die gesteigerte Bereitwilligkeit zu allerlei Aktionen aus, ganz wie die Manie und im vollen Gegensatz zur Depression und Hemmung der Melancholie. Man kann wagen, es auszusprechen, daß die Manie nichts anderes ist als ein solcher Triumph, nur daß es wiederum dem Ich verdeckt bleibt, was es überwunden hat und worüber es triumphiert. Den in dieselbe Reihe von Zuständen gehörigen Alkoholrausch wird man – insofern er ein heiterer ist – ebenso zurechtlegen dürfen; es handelt sich bei ihm wahrscheinlich um die toxisch erzielte Aufhebung von Verdrängungsaufwänden. Die Laienmeinung nimmt gern an, daß man in solcher maniakalischer Verfassung darum so bewegungs- und unternehmungslustig ist, weil man so »gut aufgelegt« ist. Diese falsche Verknüpfung wird man natürlich auflösen müssen. Es ist jene erwähnte ökonomische Bedingung im Seelenleben erfüllt worden, und darum ist man einerseits in so heiterer Stimmung und anderseits so ungehemmt im Tun.
Setzen wir die beiden Andeutungen zusammen, so ergibt sich: In der Manie muß das Ich den Verlust des Objekts (oder die Trauer über den Verlust oder vielleicht das Objekt selbst) überwunden haben, und nun ist der ganze Betrag von Gegenbesetzung, den das schmerzhafte Leiden der Melancholie aus dem Ich an sich gezogen und gebunden hatte, verfügbar geworden. Der Manische demonstriert uns auch unverkennbar seine Befreiung von dem Objekt, an dem er gelitten hatte, indem er wie ein Heißhungriger auf neue Objektbesetzungen ausgeht. Diese Aufklärung klingt ja plausibel, aber sie ist erstens noch zu wenig bestimmt und läßt zweitens mehr neue Fragen und Zweifel auftauchen, als wir beantworten können. Wir wollen uns der Diskussion derselben nicht entziehen, wenn wir auch nicht erwarten können, durch sie hindurch den Weg zur Klarheit zu finden.
Zunächst: Die normale Trauer überwindet ja auch den Verlust des Objekts und absorbiert gleichfalls während ihres Bestandes alle Energien des Ichs. Warum stellt sich bei ihr die ökonomische Bedingung für eine Phase des Triumphes nach ihrem Ablaufe auch nicht andeutungsweise her? Ich finde es unmöglich, auf diesen Einwand kurzerhand zu antworten. Er macht uns auch darauf aufmerksam, daß wir nicht einmal sagen können, durch welche ökonomischen Mittel die Trauer ihre Aufgabe löst; aber vielleicht kann hier eine Vermutung aushelfen. An jede einzelne der Erinnerungen und Erwartungssituationen, welche die Libido an das verlorene Objekt geknüpft zeigen, bringt die Realität ihr Verdikt heran, daß das Objekt nicht mehr existiere, und das Ich, gleichsam vor die Frage gestellt, ob es dieses Schicksal teilen will, läßt sich durch die Summe der narzißtischen Befriedigungen, am Leben zu sein, bestimmen, seine Bindung an das vernichtete Objekt zu lösen. Man kann sich etwa vorstellen, diese Lösung gehe so langsam und schrittweise vor sich, daß mit der Beendigung der Arbeit auch der für sie erforderliche Aufwand zerstreut ist [Fußnote]Der ökonomische Gesichtspunkt ist bisher in psychoanalytischen Arbeiten wenig berücksichtigt worden. Als Ausnahme sei der Aufsatz von V. Tausk, ›Entwertung des Verdrängungsmotivs durch Rekompense‹ (1913) hervorgehoben..
Es ist verlockend, von der Mutmaßung über die Arbeit der Trauer den Weg zu einer Darstellung der melancholischen Arbeit zu suchen. Da kommt uns zuerst eine Unsicherheit in den Weg. Wir haben bisher den topischen Gesichtspunkt bei der Melancholie noch kaum berücksichtigt und die Frage nicht aufgeworfen, in und zwischen welchen psychischen Systemen die Arbeit der Melancholie vor sich geht. Was von den psychischen Vorgängen der Affektion spielt sich noch an den aufgelassenen unbewußten Objektbesetzungen, was an deren Identifizierungsersatz im Ich ab?
Es spricht sich nun rasch aus und schreibt sich leicht nieder, daß die »unbewußte (Ding-) Vorstellung des Objekts von der Libido verlassen wird«. Aber in Wirklichkeit ist diese Vorstellung durch ungezählte Einzeleindrücke (unbewußte Spuren derselben) vertreten, und die Durchführung dieser Libidoabziehung kann nicht ein momentaner Vorgang sein, sondern gewiß wie bei der Trauer ein langwieriger, allmählich fortschreitender Prozeß. Ob er an vielen Stellen gleichzeitig beginnt oder eine irgendwie bestimmte Reihenfolge enthält, läßt sich ja nicht leicht unterscheiden; in den Analysen kann man oft feststellen, daß bald diese, bald jene Erinnerung aktiviert ist und daß die gleichlautenden, durch ihre Monotonie ermüdenden Klagen doch jedesmal von einer anderen unbewußten Begründung herrühren. Wenn das Objekt keine so große, durch tausendfältige Verknüpfung verstärkte Bedeutung für das Ich hat, so ist sein Verlust auch nicht geeignet, eine Trauer oder eine Melancholie zu verursachen. Der Charakter der Einzeldurchführung der Libidoablösung ist also der Melancholie wie der Trauer in gleicher Weise zuzuschreiben, stützt sich wahrscheinlich auf die gleichen ökonomischen Verhältnisse und dient denselben Tendenzen.
Die Melancholie hat aber, wie wir gehört haben, etwas mehr zum Inhalt als die normale Trauer. Das Verhältnis zum Objekt ist bei ihr kein einfaches, es wird durch den Ambivalenzkonflikt kompliziert. Die Ambivalenz ist entweder konstitutionell, d. h. sie hängt jeder Liebesbeziehung dieses Ichs an, oder sie geht gerade aus den Erlebnissen hervor, welche die Drohung des Objektverlustes mit sich bringen. Die Melancholie kann darum in ihren Veranlassungen weit über die Trauer hinausgehen, welche in der Regel nur durch den Realverlust, den Tod des Objekts, ausgelöst wird. Es spinnt sich also bei der Melancholie eine Unzahl von Einzelkämpfen um das Objekt an, in denen Haß und Liebe miteinander ringen, die eine, um die Libido vom Objekt zu lösen, die andere, um diese Libidoposition gegen den Ansturm zu behaupten. Diese Einzelkämpfe können wir in kein anderes System verlegen als in das Ubw, in das Reich der sachlichen Erinnerungsspuren (im Gegensatz zu den Wortbesetzungen). Ebendort spielen sich auch die Lösungsversuche bei der Trauer ab, aber bei dieser letzteren besteht kein Hindernis dagegen, daß sich diese Vorgänge auf dem normalen Wege durch das Vbw zum Bewußtsein fortsetzen. Dieser Weg ist für die melancholische Arbeit gesperrt, vielleicht infolge einer Mehrzahl von Ursachen oder des Zusammenwirkens derselben. Die konstitutive Ambivalenz gehört an und für sich dem Verdrängten an, die traumatischen Erlebnisse mit dem Objekt mögen anderes Verdrängte aktiviert haben. So bleibt alles an diesen Ambivalenzkämpfen dem Bewußtsein entzogen, bis nicht der für die Melancholie charakteristische Ausgang eingetreten ist. Er besteht, wie wir wissen, darin, daß die bedrohte Libidobesetzung endlich das Objekt verläßt, aber nur, um sich auf die Stelle des Ichs, von der sie ausgegangen war, zurückzuziehen. Die Liebe hat sich so durch ihre Flucht ins Ich der Aufhebung entzogen. Nach dieser Regression der Libido kann der Vorgang bewußt werden und repräsentiert sich dem Bewußtsein als ein Konflikt zwischen einem Teil des Ichs und der kritischen Instanz.
Was das Bewußtsein von der melancholischen Arbeit erfährt, ist also nicht das wesentliche Stück derselben, auch nicht jenes, dem wir einen Einfluß auf die Lösung des Leidens zutrauen können. Wir sehen, daß das Ich sich herabwürdigt und gegen sich wütet, und verstehen sowenig wie der Kranke, wozu das führen und wie sich das ändern kann. Dem unbewußten Stück der Arbeit können wir eine solche Leistung eher zuschreiben, weil es nicht schwerfällt, eine wesentliche Analogie zwischen der Arbeit der Melancholie und jener der Trauer herauszufinden. Wie die Trauer das Ich dazu bewegt, auf das Objekt zu verzichten, indem es das Objekt für tot erklärt und dem Ich die Prämie des Amlebenbleibens bietet, so lockert auch jeder einzelne Ambivalenzkampf die Fixierung der Libido an das Objekt, indem er dieses entwertet, herabsetzt, gleichsam auch erschlägt. Es ist die Möglichkeit gegeben, daß der Prozeß im Ubw zu Ende komme, sei es nachdem die Wut sich ausgetobt hat, sei es nachdem das Objekt als wertlos aufgegeben wurde. Es fehlt uns der Einblick, welche dieser beiden Möglichkeiten regelmäßig oder vorwiegend häufig der Melancholie ein Ende bereitet und wie diese Beendigung den weiteren Verlauf des Falles beeinflußt. Das Ich mag dabei die Befriedigung genießen, daß es sich als das Bessere, als dem Objekt überlegen anerkennen darf.
Mögen wir diese Auffassung der melancholischen Arbeit auch annehmen, sie kann uns doch das eine nicht leisten, auf dessen Erklärung wir ausgegangen sind. Unsere Erwartung, die ökonomische Bedingung für das Zustandekommen der Manie nach abgelaufener Melancholie aus der Ambivalenz abzuleiten, welche diese Affektion beherrscht, könnte sich auf Analogien aus verschiedenen anderen Gebieten stützen; aber es gibt eine Tatsache, vor welcher sie sich beugen muß. Von den drei Voraussetzungen der Melancholie: Verlust des Objekts, Ambivalenz und Regression der Libido ins Ich, finden wir die beiden ersten bei den Zwangsvorwürfen nach Todesfällen wieder. Dort ist es die Ambivalenz, die unzweifelhaft die Triebfeder des Konflikts darstellt, und die Beobachtung zeigt, daß nach Ablauf desselben nichts von einem Triumph einer manischen Verfassung erübrigt. Wir werden so auf das dritte Moment als das einzig wirksame hingewiesen. Jene Anhäufung von zunächst gebundener Besetzung, welche nach Beendigung der melancholischen Arbeit frei wird und die Manie ermöglicht, muß mit der Regression der Libido auf den Narzißmus zusammenhängen. Der Konflikt im Ich, den die Melancholie für den Kampf um das Objekt eintauscht, muß ähnlich wie eine schmerzhafte Wunde wirken, die eine außerordentlich hohe Gegenbesetzung in Anspruch nimmt. Aber hier wird es wiederum zweckmäßig sein, haltzumachen und die weitere Aufklärung der Manie zu verschieben, bis wir Einsicht in die ökonomische Natur zunächst des körperlichen und dann des ihm analogen seelischen Schmerzes gewonnen haben. Wir wissen es ja schon, daß der Zusammenhang der verwickelten seelischen Probleme uns nötigt, jede Untersuchung unvollendet abzubrechen, bis ihr die Ergebnisse einer anderen zu Hilfe kommen können [Fußnote]S. die weitere Fortsetzung des Problems der Manie in Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921 c).
Triebe und Triebschicksale (1915)
Wir haben oftmals die Forderung vertreten gehört, daß eine Wissenschaft über klaren und scharf definierten Grundbegriffen aufgebaut sein soll. In Wirklichkeit beginnt keine Wissenschaft mit solchen Definitionen, auch die exaktesten nicht. Der richtige Anfang der wissenschaftlichen Tätigkeit besteht vielmehr in der Beschreibung von Erscheinungen, die dann weiterhin gruppiert, angeordnet und in Zusammenhänge eingetragen werden. Schon bei der Beschreibung kann man es nicht vermeiden, gewisse abstrakte Ideen auf das Material anzuwenden, die man irgendwoher, gewiß nicht aus der neuen Erfahrung allein, herbeiholt. Noch unentbehrlicher sind solche Ideen – die späteren Grundbegriffe der Wissenschaft – bei der weiteren Verarbeitung des Stoffes. Sie müssen zunächst ein gewisses Maß von Unbestimmtheit an sich tragen; von einer klaren Umzeichnung ihres Inhaltes kann keine Rede sein. Solange sie sich in diesem Zustande befinden, verständigt man sich über ihre Bedeutung durch den wiederholten Hinweis auf das Erfahrungsmaterial, dem sie entnommen scheinen, das aber in Wirklichkeit ihnen unterworfen wird. Sie haben also strenge genommen den Charakter von Konventionen, wobei aber alles darauf ankommt, daß sie doch nicht willkürlich gewählt werden, sondern durch bedeutsame Beziehungen zum empirischen Stoffe bestimmt sind, die man zu erraten vermeint, noch ehe man sie erkennen und nachweisen kann. Erst nach gründlicherer Erforschung des betreffenden Erscheinungsgebietes kann man auch dessen wissenschaftliche Grundbegriffe schärfer erfassen und sie fortschreitend so abändern, daß sie in großem Umfange brauchbar und dabei durchaus widerspruchsfrei werden. Dann mag es auch an der Zeit sein, sie in Definitionen zu bannen. Der Fortschritt der Erkenntnis duldet aber auch keine Starrheit der Definitionen. Wie das Beispiel der Physik in glänzender Weise lehrt, erfahren auch die in Definitionen festgelegten »Grundbegriffe« einen stetigen Inhaltswandel.
Ein solcher konventioneller, vorläufig noch ziemlich dunkler Grundbegriff, den wir aber in der Psychologie nicht entbehren können, ist der des Triebes. Versuchen wir es, ihn von verschiedenen Seiten her mit Inhalt zu erfüllen.
Zunächst von Seiten der Physiologie. Diese hat uns den Begriff des Reizes und das Reflexschema gegeben, demzufolge ein von außen her an das lebende Gewebe (der Nervensubstanz) gebrachter Reiz durch Aktion nach außen abgeführt wird. Diese Aktion wird dadurch zweckmäßig, daß sie die gereizte Substanz der Einwirkung des Reizes entzieht, aus dem Bereich der Reizwirkung entrückt.
Wie verhält sich nun der »Trieb« zum »Reiz«? Es hindert uns nichts, den Begriff des Triebes unter den des Reizes zu subsumieren: der Trieb sei ein Reiz für das Psychische. Aber wir werden sofort davor gewarnt, Trieb und psychischen Reiz gleichzusetzen. Es gibt offenbar für das Psychische noch andere Reize als die Triebreize, solche, die sich den physiologischen Reizen weit ähnlicher benehmen. Wenn z. B. ein starkes Licht auf das Auge fällt, so ist das kein Triebreiz; wohl aber, wenn sich die Austrocknung der Schlundschleimhaut fühlbar macht oder die Anätzung der Magenschleimhaut [Fußnote]Vorausgesetzt nämlich, daß diese inneren Vorgänge die organischen Grundlagen der Bedürfnisse Durst und Hunger sind..
Wir haben nun Material für die Unterscheidung von Triebreiz und anderem (physiologischem) Reiz, der auf das Seelische einwirkt, gewonnen. Erstens: Der Triebreiz stammt nicht aus der Außenwelt, sondern aus dem Innern des Organismus selbst. Er wirkt darum auch anders auf das Seelische und erfordert zu seiner Beseitigung andere Aktionen. Ferner: Alles für den Reiz Wesentliche ist gegeben, wenn wir annehmen, er wirke wie ein einmaliger Stoß; er kann dann auch durch eine einmalige zweckmäßige Aktion erledigt werden, als deren Typus die motorische Flucht vor der Reizquelle hinzustellen ist. Natürlich können sich diese Stöße auch wiederholen und summieren, aber das ändert nichts an der Auffassung des Vorganges und an den Bedingungen der Reizaufhebung. Der Trieb hingegen wirkt nie wie eine momentane Stoßkraft, sondern immer wie eine konstante Kraft. Da er nicht von außen, sondern vom Körperinnern her angreift, kann auch keine Flucht gegen ihn nützen. Wir heißen den Triebreiz besser »Bedürfnis«; was dieses Bedürfnis aufhebt, ist die » Befriedigung«. Sie kann nur durch eine zielgerechte (adäquate) Veränderung der inneren Reizquelle gewonnen werden.
Stellen wir uns auf den Standpunkt eines fast völlig hilflosen, in der Welt noch unorientierten Lebewesens, welches Reize in seiner Nervensubstanz auffängt. Dies Wesen wird sehr bald in die Lage kommen, eine erste Unterscheidung zu machen und eine erste Orientierung zu gewinnen. Es wird einerseits Reize verspüren, denen es sich durch eine Muskelaktion (Flucht) entziehen kann, diese Reize rechnet es zu einer Außenwelt; anderseits aber auch noch Reize, gegen welche eine solche Aktion nutzlos bleibt, die trotzdem ihren konstant drängenden Charakter behalten; diese Reize sind das Kennzeichen einer Innenwelt, der Beweis für Triebbedürfnisse. Die wahrnehmende Substanz des Lebewesens wird so an der Wirksamkeit ihrer Muskeltätigkeit einen Anhaltspunkt gewonnen haben, um ein »Außen« von einem »Innen« zu scheiden.
Wir finden also das Wesen des Triebes zunächst in seinen Hauptcharakteren, der Herkunft von Reizquellen im Innern des Organismus, dem Auftreten als konstante Kraft, und leiten davon eines seiner weiteren Merkmale, seine Unbezwingbarkeit durch Fluchtaktionen ab. Während dieser Erörterungen mußte uns aber etwas auffallen, was uns ein weiteres Eingeständnis abnötigt. Wir bringen nicht nur gewisse Konventionen als Grundbegriffe an unser Erfahrungsmaterial heran, sondern bedienen uns auch mancher komplizierter Voraussetzungen, um uns bei der Bearbeitung der psychologischen Erscheinungswelt leiten zu lassen. Die wichtigste dieser Voraussetzungen haben wir bereits angeführt; es erübrigt uns nur noch, sie ausdrücklich hervorzuheben. Sie ist biologischer Natur, arbeitet mit dem Begriff der Tendenz (eventuell der Zweckmäßigkeit) und lautet: Das Nervensystem ist ein Apparat, dem die Funktion erteilt ist, die anlangenden Reize wieder zu beseitigen, auf möglichst niedriges Niveau herabzusetzen, oder der, wenn es nur möglich wäre, sich überhaupt reizlos erhalten wollte. Nehmen wir an der Unbestimmtheit dieser Idee vorläufig keinen Anstoß und geben wir dem Nervensystem die Aufgabe – allgemein gesprochen: der Reizbewältigung. Wir sehen dann, wie sehr die Einführung der Triebe das einfache physiologische Reflexschema kompliziert. Die äußeren Reize stellen nur die eine Aufgabe, sich ihnen zu entziehen, dies geschieht dann durch Muskelbewegungen, von denen endlich eine das Ziel erreicht und dann als die zweckmäßige zur erblichen Disposition wird. Die im Innern des Organismus entstehenden Triebreize sind durch diesen Mechanismus nicht zu erledigen. Sie stellen also weit höhere Anforderungen an das Nervensystem, veranlassen es zu verwickelten, ineinandergreifenden Tätigkeiten, welche die Außenwelt so weit verändern, daß sie der inneren Reizquelle die Befriedigung bietet, und nötigen es vor allem, auf seine ideale Absicht der Reizfernhaltung zu verzichten, da sie eine unvermeidliche kontinuierliche Reizzufuhr unterhalten. Wir dürfen also wohl schließen, daß sie, die Triebe, und nicht die äußeren Reize, die eigentlichen Motoren der Fortschritte sind, welche das so unendlich leistungsfähige Nervensystem auf seine gegenwärtige Entwicklungshöhe gebracht haben. Natürlich steht nichts der Annahme im Wege, daß die Triebe selbst, wenigstens zum Teil, Niederschläge äußerer Reizwirkungen sind, welche im Laufe der Phylogenese auf die lebende Substanz verändernd einwirkten.
Wenn wir dann finden, daß die Tätigkeit auch der höchstentwickelten Seelenapparate dem Lustprinzip unterliegt, d. h. durch Empfindungen der Lust-Unlustreihe automatisch reguliert wird, so können wir die weitere Voraussetzung schwerlich abweisen, daß diese Empfindungen die Art, wie die Reizbewältigung vor sich geht, wiedergeben. Sicherlich in dem Sinne, daß die Unlustempfindung mit Steigerung, die Lustempfindung mit Herabsetzung des Reizes zu tun hat. Die weitgehende Unbestimmtheit dieser Annahme wollen wir aber sorgfältig festhalten, bis es uns etwa gelingt, die Art der Beziehung zwischen Lust-Unlust und den Schwankungen der auf das Seelenleben wirkenden Reizgrößen zu erraten. Es sind gewiß sehr mannigfache und nicht sehr einfache solcher Beziehungen möglich.
Wenden wir uns nun von der biologischen Seite her der Betrachtung des Seelenlebens zu, so erscheint uns der »Trieb« als ein Grenzbegriff zwischen Seelischem und Somatischem, als psychischer Repräsentant der aus dem Körperinnern stammenden, in die Seele gelangenden Reize, als ein Maß der Arbeitsanforderung, die dem Seelischen infolge seines Zusammenhanges mit dem Körperlichen auferlegt ist.
Wir können nun einige Termini diskutieren, welche im Zusammenhang mit dem Begriffe Trieb gebraucht werden, wie: Drang, Ziel, Objekt, Quelle des Triebes.
Unter dem Drange eines Triebes versteht man dessen motorisches Moment, die Summe von Kraft oder das Maß von Arbeitsanforderung, das er repräsentiert. Der Charakter des Drängenden ist eine allgemeine Eigenschaft der Triebe, ja das Wesen derselben. Jeder Trieb ist ein Stück Aktivität; wenn man lässigerweise von passiven Trieben spricht, kann man nichts anderes meinen als Triebe mit passivem Ziele.
Das Ziel eines Triebes ist allemal die Befriedigung, die nur durch Aufhebung des Reizzustandes an der Triebquelle erreicht werden kann. Aber wenn auch dies Endziel für jeden Trieb unveränderlich bleibt, so können doch verschiedene Wege zum gleichen Endziel führen, so daß sich mannigfache nähere oder intermediäre Ziele für einen Trieb ergeben können, die miteinander kombiniert oder gegeneinander vertauscht werden. Die Erfahrung gestattet uns auch, von » zielgehemmten« Trieben zu sprechen bei Vorgängen, die ein Stück weit in der Richtung der Triebbefriedigung zugelassen werden, dann aber eine Hemmung oder Ablenkung erfahren. Es ist anzunehmen, daß auch mit solchen Vorgängen eine partielle Befriedigung verbunden ist.
Das Objekt des Triebes ist dasjenige, an welchem oder durch welches der Trieb sein Ziel erreichen kann. Es ist das variabelste am Triebe, nicht ursprünglich mit ihm verknüpft, sondern ihm nur infolge seiner Eignung zur Ermöglichung der Befriedigung zugeordnet. Es ist nicht notwendig ein fremder Gegenstand, sondern ebensowohl ein Teil des eigenen Körpers. Es kann im Laufe der Lebensschicksale des Triebes beliebig oft gewechselt werden; dieser Verschiebung des Triebes fallen die bedeutsamsten Rollen zu. Es kann der Fall vorkommen, daß dasselbe Objekt gleichzeitig mehreren Trieben zur Befriedigung dient, nach Alfred Adler der Fall der Triebverschränkung. Eine besonders innige Bindung des Triebes an das Objekt wird als Fixierung desselben hervorgehoben. Sie vollzieht sich oft in sehr frühen Perioden der Triebentwicklung und macht der Beweglichkeit des Triebes ein Ende, indem sie der Lösung intensiv widerstrebt.
Unter der Quelle des Triebes versteht man jenen somatischen Vorgang in einem Organ oder Körperteil, dessen Reiz im Seelenleben durch den Trieb repräsentiert ist. Es ist unbekannt, ob dieser Vorgang regelmäßig chemischer Natur ist oder auch der Entbindung anderer, z. B. mechanischer Kräfte entsprechen kann. Das Studium der Triebquellen gehört der Psychologie nicht mehr an; obwohl die Herkunft aus der somatischen Quelle das schlechtweg Entscheidende für den Trieb ist, wird er uns im Seelenleben doch nicht anders als durch seine Ziele bekannt. Die genauere Erkenntnis der Triebquellen ist für die Zwecke der psychologischen Forschung nicht durchwegs erforderlich. Manchmal ist der Rückschluß aus den Zielen des Triebes auf dessen Quellen gesichert.
Soll man annehmen, daß die verschiedenen aus dem Körperlichen stammenden, auf das Seelische wirkenden Triebe auch durch verschiedene Qualitäten ausgezeichnet sind und darum in qualitativ verschiedener Art sich im Seelenleben benehmen? Es scheint nicht gerechtfertigt; man reicht vielmehr mit der einfacheren Annahme aus, daß die Triebe alle qualitativ gleichartig sind und ihre Wirkung nur den Erregungsgrößen, die sie führen, verdanken, vielleicht noch gewissen Funktionen dieser Quantität. Was die psychischen Leistungen der einzelnen Triebe voneinander unterscheidet, läßt sich auf die Verschiedenheit der Triebquellen zurückführen. Es kann allerdings erst in einem späteren Zusammenhange klargelegt werden, was das Problem der Triebqualität bedeutet.
Welche Triebe darf man aufstellen und wie viele? Dabei ist offenbar der Willkür ein weiter Spielraum gelassen. Man kann nichts dagegen einwenden, wenn jemand den Begriff eines Spieltriebes, Destruktionstriebes, Geselligkeitstriebes in Anwendung bringt, wo der Gegenstand es fordert und die Beschränkung der psychologischen Analyse es zuläßt. Man sollte aber die Frage nicht außer acht lassen, ob diese einerseits so sehr spezialisierten Triebmotive nicht eine weitere Zerlegung in der Richtung nach den Triebquellen gestatten, so daß nur die weiter nicht zerlegbaren Urtriebe eine Bedeutung beanspruchen können.
Ich habe vorgeschlagen, von solchen Urtrieben zwei Gruppen zu unterscheiden, die der Ich- oder Selbsterhaltungstriebe und die der Sexualtriebe. Dieser Aufstellung kommt aber nicht die Bedeutung einer notwendigen Voraussetzung zu, wie z. B. der Annahme über die biologische Tendenz des seelischen Apparates (s. oben); sie ist eine bloße Hilfskonstruktion, die nicht länger festgehalten werden soll, als sie sich nützlich erweist, und deren Ersetzung durch eine andere an den Ergebnissen unserer beschreibenden und ordnenden Arbeit wenig ändern wird. Der Anlaß zu dieser Aufstellung hat sich aus der Entwicklungsgeschichte der Psychoanalyse ergeben, welche die Psychoneurosen, und zwar die als »Übertragungsneurosen« zu bezeichnende Gruppe derselben (Hysterie und Zwangsneurose), zum ersten Objekt nahm und an ihnen zur Einsicht gelangte, daß ein Konflikt zwischen den Ansprüchen der Sexualität und denen des Ichs an der Wurzel jeder solchen Affektion zu finden sei. Es ist immerhin möglich, daß ein eindringendes Studium der anderen neurotischen Affektionen (vor allem der narzißtischen Psychoneurosen: der Schizophrenien) zu einer Abänderung dieser Formel und somit zu einer anderen Gruppierung der Urtriebe nötigen wird. Aber gegenwärtig kennen wir diese neue Formel nicht und haben auch noch kein Argument gefunden, welches der Gegenüberstellung von Ich- und Sexualtrieben ungünstig wäre.
Es ist mir überhaupt zweifelhaft, ob es möglich sein wird, auf Grund der Bearbeitung des psychologischen Materials entscheidende Winke zur Scheidung und Klassifizierung der Triebe zu gewinnen. Es erscheint vielmehr notwendig, zum Zwecke dieser Bearbeitung bestimmte Annahmen über das Triebleben an das Material heranzubringen, und es wäre wünschenswert, daß man diese Annahmen einem anderen Gebiete entnehmen könnte, um sie auf die Psychologie zu übertragen. Was die Biologie hiefür leistet, läuft der Sonderung von Ich- und Sexualtrieben gewiß nicht zuwider. Die Biologie lehrt, daß die Sexualität nicht gleichzustellen ist den anderen Funktionen des Individuums, da ihre Tendenzen über das Individuum hinausgehen und die Produktion neuer Individuen, also die Erhaltung der Art, zum Inhalt haben. Sie zeigt uns ferner, daß zwei Auffassungen des Verhältnisses zwischen Ich und Sexualität wie gleichberechtigt nebeneinanderstehen, die eine, nach welcher das Individuum die Hauptsache ist und die Sexualität als eine seiner Betätigungen, die Sexualbefriedigung als eines seiner Bedürfnisse wertet, und eine andere, derzufolge das Individuum ein zeitweiliger und vergänglicher Anhang an das quasi unsterbliche Keimplasma ist, welches ihm von der Generation anvertraut wurde. Die Annahme, daß sich die Sexualfunktion durch einen besonderen Chemismus von den anderen Körpervorgängen scheidet, bildet, soviel ich weiß, auch eine Voraussetzung der Ehrlichschen biologischen Forschung.
Da das Studium des Trieblebens vom Bewußtsein her kaum übersteigbare Schwierigkeiten bietet, bleibt die psychoanalytische Erforschung der Seelenstörungen die Hauptquelle unserer Kenntnis. Ihrem Entwicklungsgang entsprechend hat uns aber die Psychoanalyse bisher nur über die Sexualtriebe einigermaßen befriedigende Auskünfte bringen können, weil sie gerade nur diese Triebgruppe an den Psychoneurosen wie isoliert beobachten konnte. Mit der Ausdehnung der Psychoanalyse auf die anderen neurotischen Affektionen wird gewiß auch unsere Kenntnis der Ichtriebe begründet werden, obwohl es vermessen erscheint, auf diesem weiteren Forschungsgebiete ähnlich günstige Bedingungen für die Beobachtung zu erwarten.
Zu einer allgemeinen Charakteristik der Sexualtriebe kann man folgendes aussagen: Sie sind zahlreich, entstammen vielfältigen organischen Quellen, betätigen sich zunächst unabhängig voneinander und werden erst spät zu einer mehr oder minder vollkommenen Synthese zusammengefaßt. Das Ziel, das jeder von ihnen anstrebt, ist die Erreichung der Organlust; erst nach vollzogener Synthese treten sie in den Dienst der Fortpflanzungsfunktion, womit sie dann als Sexualtriebe allgemein kenntlich werden. Bei ihrem ersten Auftreten lehnen sie sich zuerst an die Erhaltungstriebe an, von denen sie sich erst allmählich ablösen, folgen auch bei der Objektfindung den Wegen, die ihnen die Ichtriebe weisen. Ein Anteil von ihnen bleibt den Ichtrieben zeitlebens gesellt und stattet diese mit libidinösen Komponenten aus, welche während der normalen Funktion leicht übersehen und erst durch die Erkrankung klargelegt werden. Sie sind dadurch ausgezeichnet, daß sie in großem Ausmaße vikariierend füreinander eintreten und leicht ihre Objekte wechseln können. Infolge der letztgenannten Eigenschaften sind sie zu Leistungen befähigt, die weitab von ihren ursprünglichen Zielhandlungen liegen. ( Sublimierung.)
Die Untersuchung, welche Schicksale Triebe im Laufe der Entwicklung und des Lebens erfahren können, werden wir auf die uns besser bekannten Sexualtriebe einschränken müssen. Die Beobachtung lehrt uns als solche Triebschicksale folgende kennen:
Die Verkehrung ins Gegenteil.
Die Wendung gegen die eigene Person.
Die Verdrängung.
Die Sublimierung.
Da ich die Sublimierung hier nicht zu behandeln gedenke, die Verdrängung aber ein besonderes Kapitel beansprucht, erübrigt uns nur Beschreibung und Diskussion der beiden ersten Punkte. Mit Rücksicht auf Motive, welche einer direkten Fortsetzung der Triebe entgegenwirken, kann man die Triebschicksale auch als Arten der Abwehr gegen die Triebe darstellen.
Die Verkehrung ins Gegenteil löst sich bei näherem Zusehen in zwei verschiedene Vorgänge auf, in die Wendung eines Triebes von der Aktivität zur Passivität und in die inhaltliche Verkehrung. Beide Vorgänge sind, weil wesensverschieden, auch gesondert zu behandeln.
Beispiele für den ersteren Vorgang ergeben die Gegensatzpaare Sadismus–Masochismus und Schaulust–Exhibition. Die Verkehrung betrifft nur die Ziele des Triebes; für das aktive Ziel: quälen, beschauen, wird das passive: gequält werden, beschaut werden eingesetzt. Die inhaltliche Verkehrung findet sich in dem einen Falle der Verwandlung des Liebens in ein Hassen.
Die Wendung gegen die eigene Person wird uns durch die Erwägung nahegelegt, daß der Masochismus ja ein gegen das eigene Ich gewendeter Sadismus ist, die Exhibition das Beschauen des eigenen Körpers mit einschließt. Die analytische Beobachtung läßt auch keinen Zweifel daran bestehen, daß der Masochist das Wüten gegen seine Person, der Exhibitionist das Entblößen derselben mitgenießt. Das Wesentliche an dem Vorgang ist also der Wechsel des Objektes bei ungeändertem Ziel.
Es kann uns indes nicht entgehen, daß Wendung gegen die eigene Person und Wendung von der Aktivität zur Passivität in diesen Beispielen zusammentreffen oder zusammenfallen. Zur Klarstellung der Beziehungen wird eine gründlichere Untersuchung unerläßlich. Beim Gegensatzpaar Sadismus–Masochismus kann man den Vorgang folgendermaßen darstellen:
a) Der Sadismus besteht in Gewalttätigkeit, Machtbetätigung gegen eine andere Person als Objekt.
b) Dieses Objekt wird aufgegeben und durch die eigene Person ersetzt. Mit der Wendung gegen die eigene Person ist auch die Verwandlung des aktiven Triebzieles in ein passives vollzogen.
c) Es wird neuerdings eine fremde Person als Objekt gesucht, welche infolge der eingetretenen Zielverwandlung die Rolle des Subjekts übernehmen muß.
Fall c ist der des gemeinhin so genannten Masochismus. Die Befriedigung erfolgt auch bei ihm auf dem Wege des ursprünglichen Sadismus, indem sich das passive Ich phantastisch in seine frühere Stelle versetzt, die jetzt dem fremden Subjekt überlassen ist. Ob es auch eine direktere masochistische Befriedigung gibt, ist durchaus zweifelhaft. Ein ursprünglicher Masochismus, der nicht auf die beschriebene Art aus dem Sadismus entstanden wäre, scheint nicht vorzukommen [Fußnote]In späteren Arbeiten (siehe: ›Das ökonomische Problem des Masochismus‹, 1924) habe ich im Zusammenhang mit Problemen des Trieblebens mich zu einer gegenteiligen Auffassung bekannt.. Daß die Annahme der Stufe b nicht überflüssig ist, geht wohl aus dem Verhalten des sadistischen Triebes bei der Zwangsneurose hervor. Hier findet sich die Wendung gegen die eigene Person ohne die Passivität gegen eine neue. Die Verwandlung geht nur bis zur Stufe b. Aus der Quälsucht wird Selbstquälerei, Selbstbestrafung, nicht Masochismus. Das aktive Verbum wandelt sich nicht in das Passivum, sondern in ein reflexives Medium.
Die Auffassung des Sadismus wird auch durch den Umstand beeinträchtigt, daß dieser Trieb neben seinem allgemeinen Ziel (vielleicht besser: innerhalb desselben) eine ganz spezielle Zielhandlung anzustreben scheint. Neben der Demütigung, Überwältigung, die Zufügung von Schmerzen. Nun scheint die Psychoanalyse zu zeigen, daß das Schmerzzufügen unter den ursprünglichen Zielhandlungen des Triebes keine Rolle spielt. Das sadistische Kind zieht die Zufügung von Schmerzen nicht in Betracht und beabsichtigt sie nicht. Wenn sich aber einmal die Umwandlung in Masochismus vollzogen hat, eignen sich die Schmerzen sehr wohl, ein passives masochistisches Ziel abzugeben, denn wir haben allen Grund anzunehmen, daß auch die Schmerz- wie andere Unlustempfindungen auf die Sexualerregung übergreifen und einen lustvollen Zustand erzeugen, um dessentwillen man sich auch die Unlust des Schmerzes gefallen lassen kann. Ist das Empfinden von Schmerzen einmal ein masochistisches Ziel geworden, so kann sich rückgreifend auch das sadistische Ziel, Schmerzen zuzufügen, ergeben, die man, während man sie anderen erzeugt, selbst masochistisch in der Identifizierung mit dem leidenden Objekt genießt. Natürlich genießt man in beiden Fällen nicht den Schmerz selbst, sondern die ihn begleitende Sexualerregung, und dies dann als Sadist besonders bequem. Das Schmerzgenießen wäre also ein ursprünglich masochistisches Ziel, das aber nur beim ursprünglich Sadistischen zum Triebziele werden kann.
Der Vollständigkeit zuliebe füge ich an, daß das Mitleid nicht als ein Ergebnis der Triebverwandlung beim Sadismus beschrieben werden kann, sondern die Auffassung einer Reaktionsbildung gegen den Trieb (über den Unterschied s. später) erfordert.
Etwas andere und einfachere Ergebnisse liefert die Untersuchung eines anderen Gegensatzpaares, der Triebe, die das Schauen und Sichzeigen zum Ziele haben. (Voyeur und Exhibitionist in der Sprache der Perversionen.) Auch hier kann man die nämlichen Stufen aufstellen wie im vorigen Falle: a) Das Schauen als Aktivität gegen ein fremdes Objekt gerichtet; b) das Aufgeben des Objektes, die Wendung des Schautriebes gegen einen Teil des eigenen Körpers, damit die Verkehrung in Passivität und die Aufstellung des neuen Zieles: beschaut zu werden; c) die Einsetzung eines neuen Subjektes, dem man sich zeigt, um von ihm beschaut zu werden. Es ist auch kaum zweifelhaft, daß das aktive Ziel früher auftritt als das passive, das Schauen dem Beschautwerden vorangeht. Aber eine bedeutsame Abweichung vom Falle des Sadismus liegt darin, daß beim Schautrieb eine noch frühere Stufe als die mit a bezeichnete zu erkennen ist. Der Schautrieb ist nämlich zu Anfang seiner Betätigung autoerotisch, er hat wohl ein Objekt, aber er findet es am eigenen Körper. Erst späterhin wird er dazu geleitet (auf dem Wege der Vergleichung), dies Objekt mit einem analogen des fremden Körpers zu vertauschen (Stufe a). Diese Vorstufe ist nun dadurch interessant, daß aus ihr die beiden Situationen des resultierenden Gegensatzpaares hervorgehen, je nachdem der Wechsel an der einen oder anderen Stelle vorgenommen wird. Das Schema für den Schautrieb könnte lauten:
-
α) Selbst ein Sexualglied beschauen
=
Sexualglied von eigener Person beschaut werden
|
|
β) Selbst fremdes Objekt beschauen (aktive Schaulust)
γ) Eigenes Objekt von fremder Person beschaut werden. (Zeigelust, Exhibition).
Eine solche Vorstufe fehlt dem Sadismus, der sich von vornherein auf ein fremdes Objekt richtet, obwohl es nicht gerade widersinnig wäre, sie aus den Bemühungen des Kindes, das seiner eigenen Glieder Herr werden will, zu konstruieren [Fußnote]Siehe Anmerkung 2 auf Seite 91..
Für beide hier betrachteten Triebbeispiele gilt die Bemerkung, daß die Triebverwandlung durch Verkehrung der Aktivität in Passivität und Wendung gegen die eigene Person eigentlich niemals am ganzen Betrag der Triebregung vorgenommen wird. Die ältere, aktive Triebrichtung bleibt in gewissem Ausmaße neben der jüngeren, passiven bestehen, auch wenn der Prozeß der Triebumwandlung sehr ausgiebig ausgefallen ist. Die einzig richtige Aussage über den Schautrieb müßte lauten, daß alle Entwicklungsstufen des Triebes, die autoerotische Vorstufe wie die aktive und passive Endgestaltung nebeneinander bestehenbleiben, und diese Behauptung wird evident, wenn man anstatt der Triebhandlungen den Mechanismus der Befriedigung zur Grundlage seines Urteiles nimmt. Vielleicht ist übrigens noch eine andere Auffassungs- und Darlegungsweise gerechtfertigt. Man kann sich jedes Triebleben in einzelne zeitlich geschiedene und innerhalb der (beliebigen) Zeiteinheit gleichartige Schübe zerlegen, die sich etwa zueinander verhalten wie sukzessive Lavaeruptionen. Dann kann man sich etwa vorstellen, die erste und ursprünglichste Trieberuption setze sich ungeändert fort und erfahre überhaupt keine Entwicklung. Ein nächster Schub unterliege von Anfang an einer Veränderung, etwa der Wendung zur Passivität, und addiere sich nun mit diesem neuen Charakter zum früheren hinzu usw. Überblickt man dann die Triebregung von ihrem Anfang an bis zu einem gewissen Haltepunkt, so muß die beschriebene Sukzession der Schübe das Bild einer bestimmten Entwicklung des Triebes ergeben.
Die Tatsache, daß zu jener späteren Zeit der Entwicklung neben einer Triebregung ihr (passiver) Gegensatz zu beobachten ist, verdient die Hervorhebung durch den trefflichen, von Bleuler eingeführten Namen: Ambivalenz.
Die Triebentwicklung wäre unserem Verständnis durch den Hinweis auf die Entwicklungsgeschichte des Triebes und die Permanenz der Zwischenstufen nahegerückt. Das Ausmaß der nachweisbaren Ambivalenz wechselt erfahrungsgemäß in hohem Grade bei Individuen, Menschengruppen oder Rassen. Eine ausgiebige Triebambivalenz bei einem heute Lebenden kann als archaisches Erbteil aufgefaßt werden, da wir Grund zur Annahme haben, der Anteil der unverwandelten aktiven Regungen am Triebleben sei in Urzeiten größer gewesen als durchschnittlich heute.
Wir haben uns daran gewöhnt, die frühe Entwicklungsphase des Ichs, während welcher dessen Sexualtriebe sich autoerotisch befriedigen, Narzißmus zu heißen, ohne zunächst die Beziehung zwischen Autoerotismus und Narzißmus in Diskussion zu ziehen. Dann müssen wir von der Vorstufe des Schautriebes, auf der die Schaulust den eigenen Körper zum Objekt hat, sagen, sie gehöre dem Narzißmus an, sei eine narzißtische Bildung. Aus ihr entwickle sich der aktive Schautrieb, indem er den Narzißmus verläßt, der passive Schautrieb halte aber das narzißtische Objekt fest. Ebenso bedeute die Umwandlung des Sadismus in Masochismus eine Rückkehr zum narzißtischen Objekt, während in beiden Fällen das narzißtische Subjekt durch Identifizierung mit einem anderen, fremden Ich vertauscht wird. Mit Rücksichtnahme auf die konstruierte narzißtische Vorstufe des Sadismus nähern wir uns so der allgemeineren Einsicht, daß die Triebschicksale der Wendung gegen das eigene Ich und der Verkehrung von Aktivität in Passivität von der narzißtischen Organisation des Ichs abhängig sind und den Stempel dieser Phase an sich tragen. Sie entsprechen vielleicht den Abwehrversuchen, die auf höheren Stufen der Ichentwicklung mit anderen Mitteln durchgeführt werden.
Wir besinnen uns hier, daß wir bisher nur die zwei Triebgegensatzpaare: Sadismus–Masochismus und Schaulust–Zeigelust in Erörterung gezogen haben. Es sind dies die bestbekannten ambivalent auftretenden Sexualtriebe. Die anderen Komponenten der späteren Sexualfunktion sind der Analyse noch nicht genug zugänglich geworden, um sie in ähnlicher Weise diskutieren zu können. Wir können von ihnen allgemein aussagen, daß sie sich autoerotisch betätigen, d. h., ihr Objekt verschwindet gegen das Organ, das ihre Quelle ist, und fällt in der Regel mit diesem zusammen. Das Objekt des Schautriebes, obwohl auch zuerst ein Teil des eigenen Körpers, ist doch nicht das Auge selbst, und beim Sadismus weist die Organquelle, wahrscheinlich die aktionsfähige Muskulatur, direkt auf ein anderes Objekt, sei es auch am eigenen Körper, hin. Bei den autoerotischen Trieben ist die Rolle der Organquelle so ausschlaggebend, daß nach einer ansprechenden Vermutung von P. Federn (1913) und L. Jekels (1913) Form und Funktion des Organs über die Aktivität und Passivität des Triebzieles entscheiden.
Die Verwandlung eines Triebes in sein (materielles) Gegenteil wird nur in einem Falle beobachtet, bei der Umsetzung von Liebe in Haß. Da diese beiden besonders häufig gleichzeitig auf dasselbe Objekt gerichtet vorkommen, ergibt diese Koexistenz auch das bedeutsamste Beispiel einer Gefühlsambivalenz.
Der Fall von Liebe und Haß erwirbt ein besonderes Interesse durch den Umstand, daß er der Einreihung in unsere Darstellung der Triebe widerstrebt. Man kann an der innigsten Beziehung zwischen diesen beiden Gefühlsgegensätzen und dem Sexualleben nicht zweifeln, muß sich aber natürlich dagegen sträuben, das Lieben etwa als einen besonderen Partialtrieb der Sexualität wie die anderen aufzufassen. Man möchte eher das Lieben als den Ausdruck der ganzen Sexualstrebung ansehen, kommt aber auch damit nicht zurecht und weiß nicht, wie man ein materielles Gegenteil dieser Strebung verstehen soll.
Das Lieben ist nicht nur eines, sondern dreier Gegensätze fähig. Außer dem Gegensatz: lieben–hassen gibt es den anderen: lieben–geliebt werden, und überdies setzen sich lieben und hassen zusammengenommen dem Zustande der Indifferenz oder Gleichgültigkeit entgegen. Von diesen drei Gegensätzen entspricht der zweite, der von lieben–geliebt werden, durchaus der Wendung von der Aktivität zur Passivität und läßt auch die nämliche Zurückführung auf eine Grundsituation wie beim Schautrieb zu. Diese heißt: sich selbst lieben, was für uns die Charakteristik des Narzißmus ist. Je nachdem nun das Objekt oder das Subjekt gegen ein fremdes vertauscht wird, ergibt sich die aktive Zielstrebung des Liebens oder die passive des Geliebtwerdens, von denen die letztere dem Narzißmus nahe verbleibt.
Vielleicht kommt man dem Verständnis der mehrfachen Gegenteile des Liebens näher, wenn man sich besinnt, daß das seelische Leben überhaupt von drei Polaritäten beherrscht wird, den Gegensätzen von:
Subjekt (Ich)–Objekt (Außenwelt).
Lust–Unlust.
Aktiv–Passiv.
Der Gegensatz von Ich–Nicht-Ich (Außen), (Subjekt–Objekt), wird dem Einzelwesen, wie wir bereits erwähnt haben, frühzeitig aufgedrängt durch die Erfahrung, daß es Außenreize durch seine Muskelaktion zum Schweigen bringen kann, gegen Triebreize aber wehrlos ist. Er bleibt vor allem in der intellektuellen Betätigung souverän und schafft die Grundsituation für die Forschung, die durch kein Bemühen abgeändert werden kann. Die Polarität von Lust–Unlust haftet an einer Empfindungsreihe, deren unübertroffene Bedeutung für die Entscheidung unserer Aktionen (Wille) bereits betont worden ist. Der Gegensatz von Aktiv–Passiv ist nicht mit dem von Ich-Subjekt–Außen-Objekt zu verwechseln. Das Ich verhält sich passiv gegen die Außenwelt, insoweit es Reize von ihr empfängt, aktiv, wenn es auf dieselben reagiert. Zu ganz besonderer Aktivität gegen die Außenwelt wird es durch seine Triebe gezwungen, so daß man unter Hervorhebung des Wesentlichen sagen könnte: Das Ich-Subjekt sei passiv gegen die äußeren Reize, aktiv durch seine eigenen Triebe. Der Gegensatz Aktiv–Passiv verschmilzt späterhin mit dem von Männlich–Weiblich, der, ehe dies geschehen ist, keine psychologische Bedeutung hat. Die Verlötung der Aktivität mit der Männlichkeit, der Passivität mit der Weiblichkeit tritt uns nämlich als biologische Tatsache entgegen; sie ist aber keineswegs so regelmäßig durchgreifend und ausschließlich, wie wir anzunehmen geneigt sind.
Die drei seelischen Polaritäten gehen die bedeutsamsten Verknüpfungen miteinander ein. Es gibt eine psychische Ursituation, in welcher zwei derselben zusammentreffen. Das Ich findet sich ursprünglich, zu allem Anfang des Seelenlebens, triebbesetzt und zum Teil fähig, seine Triebe an sich selbst zu befriedigen. Wir heißen diesen Zustand den des Narzißmus, die Befriedigungsmöglichkeit die autoerotische [Fußnote]Ein Anteil der Sexualtriebe ist, wie wir wissen, dieser autoerotischen Befriedigung fähig, eignet sich also zum Träger der nachstehend geschilderten Entwicklung unter der Herrschaft des Lustprinzips. Die Sexualtriebe, welche von vornherein ein Objekt fordern, und die autoerotisch niemals zu befriedigenden Bedürfnisse der Ichtriebe stören natürlich diesen Zustand und bereiten die Fortschritte vor. Ja, der narzißtische Urzustand könnte nicht jene Entwicklung nehmen, wenn nicht jedes Einzelwesen eine Periode von Hilflosigkeit und Pflege durchmachte, währenddessen seine drängenden Bedürfnisse durch Dazutun von außen befriedigt und somit von der Entwicklung abgehalten würden.. Die Außenwelt ist derzeit nicht mit Interesse (allgemein gesprochen) besetzt und für die Befriedigung gleichgültig. Es fällt also um diese Zeit das Ich-Subjekt mit dem Lustvollen, die Außenwelt mit dem Gleichgültigen (eventuell als Reizquelle Unlustvollen) zusammen. Definieren wir zunächst das Lieben als die Relation des Ichs zu seinen Lustquellen, so erläutert die Situation, in der es nur sich selbst liebt und gegen die Welt gleichgültig ist, die erste der Gegensatzbeziehungen, in denen wir das »Lieben« gefunden haben.
Das Ich bedarf der Außenwelt nicht, insofern es autoerotisch ist, es bekommt aber Objekte aus ihr infolge der Erlebnisse der Icherhaltungstriebe und kann doch nicht umhin, innere Triebreize als unlustvoll für eine Zeit zu verspüren. Unter der Herrschaft des Lustprinzips vollzieht sich nun in ihm eine weitere Entwicklung. Es nimmt die dargebotenen Objekte, insofern sie Lustquellen sind, in sein Ich auf, introjiziert sich dieselben (nach dem Ausdrucke Ferenczis) und stößt anderseits von sich aus, was ihm im eigenen Innern Unlustanlaß wird. (Siehe später den Mechanismus der Projektion.)
Es wandelt sich so aus dem anfänglichen Real-Ich, welches Innen und Außen nach einem guten objektiven Kennzeichen unterschieden hat, in ein purifiziertes Lust-Ich, welches den Lustcharakter über jeden anderen setzt. Die Außenwelt zerfällt ihm in einen Lustanteil, den es sich einverleibt hat, und einen Rest, der ihm fremd ist. Aus dem eigenen Ich hat es einen Bestandteil ausgesondert, den es in die Außenwelt wirft und als feindlich empfindet. Nach dieser Umordnung ist die Deckung der beiden Polaritäten
Ich-Subjekt – mit Lust
Außenwelt – mit Unlust (von früher her Indifferenz)
wiederhergestellt.
Mit dem Eintreten des Objekts in die Stufe des primären Narzißmus erreicht auch der zweite Gegensinn des Liebens, das Hassen, seine Ausbildung.
Das Objekt wird dem Ich, wie wir gehört haben, zuerst von den Selbsterhaltungstrieben aus der Außenwelt gebracht, und es ist nicht abzuweisen, daß auch der ursprüngliche Sinn des Hassens die Relation gegen die fremde und reizzuführende Außenwelt bedeutet. Die Indifferenz ordnet sich dem Haß, der Abneigung, als Spezialfall ein, nachdem sie zuerst als dessen Vorläufer aufgetreten ist. Das Äußere, das Objekt, das Gehaßte wären zu allem Anfang identisch. Erweist sich späterhin das Objekt als Lustquelle, so wird es geliebt, aber auch dem Ich einverleibt, so daß für das purifizierte Lust-Ich das Objekt doch wiederum mit dem Fremden und Gehaßten zusammenfällt.
Wir merken aber jetzt auch, wie das Gegensatzpaar Liebe–Indifferenz die Polarität Ich–Außenwelt spiegelt, so reproduziert der zweite Gegensatz Liebe–Haß die mit der ersteren verknüpfte Polarität von Lust–Unlust. Nach der Ablösung der rein narzißtischen Stufe durch die Objektstufe bedeuten Lust und Unlust Relationen des Ichs zum Objekt. Wenn das Objekt die Quelle von Lustempfindungen wird, so stellt sich eine motorische Tendenz heraus, welche dasselbe dem Ich annähern, ins Ich einverleiben will; wir sprechen dann auch von der »Anziehung«, die das lustspendende Objekt ausübt, und sagen, daß wir das Objekt »lieben«. Umgekehrt, wenn das Objekt Quelle von Unlustempfindungen ist, bestrebt sich eine Tendenz, die Distanz zwischen ihm und dem Ich zu vergrößern, den ursprünglichen Fluchtversuch vor der reizausschickenden Außenwelt an ihm zu wiederholen. Wir empfinden die »Abstoßung« des Objekts und hassen es; dieser Haß kann sich dann zur Aggressionsneigung gegen das Objekt, zur Absicht, es zu vernichten, steigern.
Man könnte zur Not von einem Trieb aussagen, daß er das Objekt »liebt«, nach dem er zu seiner Befriedigung strebt. Daß ein Trieb ein Objekt »haßt«, klingt uns aber befremdend, so daß wir aufmerksam werden, die Beziehungen Liebe und Haß seien nicht für die Relationen der Triebe zu ihren Objekten verwendbar, sondern für die Relation des Gesamt-Ichs zu den Objekten reserviert. Die Beobachtung des gewiß sinnvollen Sprachgebrauches zeigt uns aber eine weitere Einschränkung in der Bedeutung von Liebe und Haß. Von den Objekten, welche der Icherhaltung dienen, sagt man nicht aus, daß man sie liebt, sondern betont, daß man ihrer bedarf, und gibt etwa einem Zusatz von andersartiger Relation Ausdruck, indem man Worte gebraucht, die ein sehr abgeschwächtes Lieben andeuten, wie: gerne haben, gerne sehen, angenehm finden.
Das Wort »lieben« rückt also immer mehr in die Sphäre der reinen Lustbeziehung des Ichs zum Objekt und fixiert sich schließlich an die Sexualobjekte im engeren Sinne und an solche Objekte, welche die Bedürfnisse sublimierter Sexualtriebe befriedigen. Die Scheidung der Ichtriebe von den Sexualtrieben, welche wir unserer Psychologie aufgedrängt haben, erweist sich so als konform mit dem Geiste unserer Sprache. Wenn wir nicht gewohnt sind zu sagen, der einzelne Sexualtrieb liebe sein Objekt, aber die adäquateste Verwendung des Wortes »lieben« in der Beziehung des Ichs zu seinem Sexualobjekt finden, so lehrt uns diese Beobachtung, daß dessen Verwendbarkeit in dieser Relation erst mit der Synthese aller Partialtriebe der Sexualität unter dem Primat der Genitalien und im Dienste der Fortpflanzungsfunktion beginnt.
Es ist bemerkenswert, daß im Gebrauche des Wortes »hassen« keine so innige Beziehung zur Sexuallust und Sexualfunktion zum Vorschein kommt, sondern die Unlustrelation die einzig entscheidende scheint. Das Ich haßt, verabscheut, verfolgt mit Zerstörungsabsichten alle Objekte, die ihm zur Quelle von Unlustempfindungen werden, gleichgültig ob sie ihm eine Versagung sexueller Befriedigung oder der Befriedigung von Erhaltungsbedürfnissen bedeuten. Ja, man kann behaupten, daß die richtigen Vorbilder für die Haßrelation nicht aus dem Sexualleben, sondern aus dem Ringen des Ichs um seine Erhaltung und Behauptung stammen.
Liebe und Haß, die sich uns als volle materielle Gegensätze vorstellen, stehen also doch in keiner einfachen Beziehung zueinander. Sie sind nicht aus der Spaltung eines Urgemeinsamen hervorgegangen, sondern haben verschiedene Ursprünge und haben ein jedes seine eigene Entwicklung durchgemacht, bevor sie sich unter dem Einfluß der Lust-Unlustrelation zu Gegensätzen formiert haben. Es erwächst uns hier die Aufgabe zusammenzustellen, was wir von der Genese von Liebe und Haß wissen.
Die Liebe stammt von der Fähigkeit des Ichs, einen Anteil seiner Triebregungen autoerotisch, durch die Gewinnung von Organlust zu befriedigen. Sie ist ursprünglich narzißtisch, übergeht dann auf die Objekte, die dem erweiterten Ich einverleibt worden sind, und drückt das motorische Streben des Ichs nach diesen Objekten als Lustquellen aus. Sie verknüpft sich innig mit der Betätigung der späteren Sexualtriebe und fällt, wenn deren Synthese vollzogen ist, mit dem Ganzen der Sexualstrebung zusammen. Vorstufen des Liebens ergeben sich als vorläufige Sexualziele, während die Sexualtriebe ihre komplizierte Entwicklung durchlaufen. Als erste derselben erkennen wir das Sicheinverleiben oder Fressen, eine Art der Liebe, welche mit der Aufhebung der Sonderexistenz des Objekts vereinbar ist, also als ambivalent bezeichnet werden kann. Auf der höheren Stufe der prägenitalen sadistisch-analen Organisation tritt das Streben nach dem Objekt in der Form des Bemächtigungsdranges auf, dem die Schädigung oder Vernichtung des Objekts gleichgültig ist. Diese Form und Vorstufe der Liebe ist in ihrem Verhalten gegen das Objekt vom Haß kaum zu unterscheiden. Erst mit der Herstellung der Genitalorganisation ist die Liebe zum Gegensatz vom Haß geworden.
Der Haß ist als Relation zum Objekt älter als die Liebe, er entspringt der uranfänglichen Ablehnung der reizspendenden Außenwelt von Seiten des narzißtischen Ichs. Als Äußerung der durch Objekte hervorgerufenen Unlustreaktion bleibt er immer in inniger Beziehung zu den Trieben der Icherhaltung, so daß Ichtriebe und Sexualtriebe leicht in einen Gegensatz geraten können, der den von Hassen und Lieben wiederholt. Wenn die Ichtriebe die Sexualfunktion beherrschen wie auf der Stufe der sadistisch-analen Organisation, so leihen sie auch dem Triebziel die Charaktere des Hasses.
Die Entstehungs- und Beziehungsgeschichte der Liebe macht es uns verständlich, daß sie so häufig »ambivalent«, d. h. in Begleitung von Haßregungen gegen das nämliche Objekt auftritt. Der der Liebe beigemengte Haß rührt zum Teil von den nicht völlig überwundenen Vorstufen des Liebens her, zum anderen Teil begründet er sich durch Ablehnungsreaktionen der Ichtriebe, die sich bei den häufigen Konflikten zwischen Ich- und Liebesinteressen auf reale und aktuelle Motive berufen können. In beiden Fällen geht also der beigemengte Haß auf die Quelle der Icherhaltungstriebe zurück. Wenn die Liebesbeziehung zu einem bestimmten Objekt abgebrochen wird, so tritt nicht selten Haß an deren Stelle, woraus wir den Eindruck einer Verwandlung der Liebe in Haß empfangen. Über diese Deskription hinaus führt dann die Auffassung, daß dabei der real motivierte Haß durch die Regression des Liebens auf die sadistische Vorstufe verstärkt wird, so daß das Hassen einen erotischen Charakter erhält und die Kontinuität einer Liebesbeziehung gewährleistet wird.
Die dritte Gegensätzlichkeit des Liebens, die Verwandlung des Liebens in ein Geliebtwerden, entspricht der Einwirkung der Polarität von Aktivität und Passivität und unterliegt derselben Beurteilung wie die Fälle des Schautriebes und des Sadismus.
Wir dürfen zusammenfassend hervorheben, die Triebschicksale bestehen im wesentlichen darin, daß die Triebregungen den Einflüssen der drei großen das Seelenleben beherrschenden Polaritäten unterzogen werden. Von diesen drei Polaritäten könnte man die der Aktivität–Passivität als die biologische, die von Ich–Außenwelt als die reale, endlich die von Lust–Unlust als die ökonomische bezeichnen.
Das Triebschicksal der Verdrängung wird den Gegenstand einer anschließenden Untersuchung bilden.
Über den Gegensinn der Urworte (1910)
In meiner Traumdeutung habe ich als unverstandenes Ergebnis der analytischen Bemühung eine Behauptung aufgestellt, die ich nun zu Eingang dieses Referates wiederholen werde [Fußnote]Die Traumdeutung, Kapitel VI: ›Die Traumarbeit‹.:
»Höchst auffällig ist das Verhalten des Traumes gegen die Kategorie von Gegensatz und Widerspruch. Dieser wird schlechtweg vernachlässigt. Das ›Nein‹ scheint für den Traum nicht zu existieren. Gegensätze werden mit besonderer Vorliebe zu einer Einheit zusammengezogen oder in einem dargestellt. Der Traum nimmt sich ja auch die Freiheit, ein beliebiges Element durch seinen Wunschgegensatz darzustellen, so daß man zunächst von keinem eines Gegenteils fähigen Elemente weiß, ob es in den Traumgedanken positiv oder negativ enthalten ist.«
Die Traumdeuter des Altertums scheinen von der Voraussetzung, daß ein Ding im Traume sein Gegenteil bedeuten könne, den ausgiebigsten Gebrauch gemacht zu haben. Gelegentlich ist diese Möglichkeit auch von modernen Traumforschern, insofern sie dem Traume überhaupt Sinn und Deutbarkeit zugestanden haben, erkannt [Fußnote]S. z. B. G. H. v. Schubert, Die Symbolik des Traumes, 4. Aufl. 1862, II. Kapitel: ›Die Sprache des Traumes‹.. Ich glaube auch keinen Widerspruch hervorzurufen, wenn ich annehme, daß alle diejenigen die oben zitierte Behauptung bestätigt gefunden haben, welche mir auf den Weg einer wissenschaftlichen Traumdeutung gefolgt sind.
Zum Verständnisse der sonderbaren Neigung der Traumarbeit, von der Verneinung abzusehen und durch dasselbe Darstellungsmittel Gegensätzliches zum Ausdrucke zu bringen, bin ich erst durch die zufällige Lektüre einer Arbeit des Sprachforschers K. Abel gelangt, welche, 1884 als selbständige Broschüre veröffentlicht, im nächsten Jahre auch unter die Sprachwissenschaftlichen Abhandlungen des Verfassers aufgenommen worden ist. Das Interesse des Gegenstandes wird es rechtfertigen, wenn ich die entscheidenden Stellen der Abelschen Abhandlung nach ihrem vollen Wortlaute (wenn auch mit Weglassung der meisten Beispiele) hier anführe. Wir erhalten nämlich die erstaunliche Aufklärung, daß die angegebene Praxis der Traumarbeit sich mit einer Eigentümlichkeit der ältesten uns bekannten Sprachen deckt.
Nachdem Abel das Alter der ägyptischen Sprache hervorgehoben, die lange Zeiten vor den ersten hieroglyphischen Inschriften entwickelt worden sein muß, fährt er fort (S. 4):
»In der ägyptischen Sprache nun, dieser einzigen Reliquie einer primitiven Welt, findet sich eine ziemliche Anzahl von Worten mit zwei Bedeutungen, deren eine das gerade Gegenteil der andern besagt. Man denke sich, wenn man solch augenscheinlichen Unsinn zu denken vermag, daß das Wort ›stark‹ in der deutschen Sprache sowohl ›stark‹ als ›schwach‹ bedeute; daß das Nomen ›Licht‹ in Berlin gebraucht werde, um sowohl ›Licht‹ als ›Dunkelheit‹ zu bezeichnen; daß ein Münchener Bürger das Bier ›Bier‹ nennte, während ein anderer dasselbe Wort anwendete, wenn er vom Wasser spräche, und man hat die erstaunliche Praxis, welcher sich die alten Ägypter in ihrer Sprache gewohnheitsmäßig hinzugeben pflegten. Wem kann man es verargen, wenn er dazu ungläubig den Kopf schüttelt? . . .« (Beispiele.)
(Ibid., S. 7): »Angesichts dieser und vieler ähnlicher Fälle antithetischer Bedeutung (siehe Anhang) kann es keinem Zweifel unterliegen, daß es in einer Sprache wenigstens eine Fülle von Worten gegeben hat, welche ein Ding und das Gegenteil dieses Dinges gleichzeitig bezeichneten. Wie erstaunlich es sei, wir stehen vor der Tatsache und haben damit zu rechnen.«
Der Autor weist nun die Erklärung dieses Sachverhaltes durch zufälligen Gleichlaut ab und verwahrt sich mit gleicher Entschiedenheit gegen die Zurückführung desselben auf den Tiefstand der ägyptischen Geistesentwicklung:
(Ibid., S. 9): »Nun war aber Ägypten nichts weniger als eine Heimat des Unsinnes. Es war im Gegenteil eine der frühesten Entwicklungsstätten der menschlichen Vernunft . . . Es kannte eine reine und würdevolle Moral und hatte einen großen Teil der zehn Gebote formuliert, als diejenigen Völker, welchen die heutige Zivilisation gehört, blutdürstigen Idolen Menschenopfer zu schlachten pflegten. Ein Volk, welches die Fackel der Gerechtigkeit und Kultur in so dunklen Zeiten entzündete, kann doch in seinem alltäglichen Reden und Denken nicht geradezu stupid gewesen sein . . . Wer Glas zu machen und ungeheure Blöcke maschinenmäßig zu heben und zu bewegen vermochte, muß doch mindestens Vernunft genug gehabt haben, um ein Ding nicht für sich selbst und gleichzeitig für sein Gegenteil anzusehen. Wie vereinen wir es nun damit, daß die Ägypter sich eine so sonderbare kontradiktorische Sprache gestatteten? . . . daß sie überhaupt den feindlichsten Gedanken ein und denselben lautlichen Träger zu geben und das, was sich gegenseitig am stärksten opponierte, in einer Art unlöslicher Union zu verbinden pflegten?«
Vor jedem Versuche einer Erklärung muß noch einer Steigerung dieses unbegreiflichen Verfahrens der ägyptischen Sprache gedacht werden. »Von allen Exzentrizitäten des ägyptischen Lexikons ist es vielleicht die außerordentlichste, daß es, außer den Worten, die entgegengesetzte Bedeutungen in sich vereinen, andere zusammengesetzte Worte besitzt, in denen zwei Vokabeln von entgegengesetzter Bedeutung zu einem Kompositum vereint werden, welches die Bedeutung nur eines von seinen beiden konstituierenden Gliedern besitzt. Es gibt also in dieser außerordentlichen Sprache nicht allein Worte, die sowohl ›stark‹ als ›schwach‹ oder sowohl ›befehlen‹ als ›gehorchen‹ besagen; es gibt auch Komposita wie ›altjung‹, ›fernnah‹, ›bindentrennen‹, ›außeninnen‹ . . ., die trotz ihrer das Verschiedenste einschließenden Zusammensetzung das erste nur ›jung‹, das zweite nur ›nah‹, das dritte nur ›verbinden‹, das vierte nur ›innen‹ bedeuten . . . Man hat also bei diesen zusammengesetzten Worten begriffliche Widersprüche geradezu absichtlich vereint, nicht um einen dritten Begriff zu schaffen, wie im Chinesischen mitunter geschieht, sondern nur, um durch das Kompositum die Bedeutung eines seiner kontradiktorischen Glieder, das allein dasselbe bedeutet haben würde, auszudrücken . . .«
Indes ist das Rätsel leichter gelöst, als es scheinen will. Unsere Begriffe entstehen durch Vergleichung. »Wäre es immer hell, so würden wir zwischen hell und dunkel nicht unterscheiden und demgemäß weder den Begriff noch das Wort der Helligkeit haben können . . .« »Es ist offenbar, alles auf diesem Planeten ist relativ und hat unabhängige Existenz, nur insofern es in seinen Beziehungen zu und von anderen Dingen unterschieden wird . . .« »Da jeder Begriff somit der Zwilling seines Gegensatzes ist, wie konnte er zuerst gedacht, wie konnte er anderen, die ihn zu denken versuchten, mitgeteilt werden, wenn nicht durch die Messung an seinem Gegensatz? . . .« (Ibid., S. 15): »Da man den Begriff der Stärke nicht konzipieren konnte, außer im Gegensatze zur Schwäche, so enthielt das Wort, welches ›stark‹ besagte, eine gleichzeitige Erinnerung an ›schwach‹, als durch welche es erst zum Dasein gelangte. Dieses Wort bezeichnete in Wahrheit weder ›stark‹ noch ›schwach‹, sondern das Verhältnis zwischen beiden und den Unterschied beider, welcher beide gleichmäßig erschuf . . .« »Der Mensch hat eben seine ältesten und einfachsten Begriffe nicht anders erringen können als im Gegensatze zu ihrem Gegensatz und erst allmählich die beiden Seiten der Antithese sondern und die eine ohne bewußte Messung an der andern denken gelernt.«
Da die Sprache nicht nur zum Ausdruck der eigenen Gedanken, sondern wesentlich zur Mitteilung derselben an andere dient, kann man die Frage aufwerfen, auf welche Weise hat der »Urägypter« dem Nebenmenschen zu erkennen gegeben, »welche Seite des Zwitterbegriffes er jedesmal meinte«? In der Schrift geschah dies mit Hilfe der sogenannten »determinativen« Bilder, welche, hinter die Buchstabenzeichen gesetzt, den Sinn derselben angeben und selbst nicht zur Aussprache bestimmt sind. (Ibid., S. 18): »Wenn das ägyptische Wort ken ›stark‹ bedeuten soll, steht hinter seinem alphabetisch geschriebenen Laut das Bild eines aufrechten, bewaffneten Mannes; wenn dasselbe Wort ›schwach‹ auszudrücken hat, folgt den Buchstaben, die den Laut darstellen, das Bild eines hockenden, lässigen Menschen. In ähnlicher Weise werden die meisten anderen zweideutigen Worte von erklärenden Bildern begleitet.« In der Sprache diente nach Abels Meinung die Geste dazu, dem gesprochenen Worte das gewünschte Vorzeichen zu geben.
Die »ältesten Wurzeln« sind es, nach Abel, an denen die Erscheinung des antithetischen Doppelsinnes beobachtet wird. Im weiteren Verlaufe der Sprachentwicklung schwand nun diese Zweideutigkeit, und im Altägyptischen wenigstens lassen sich alle Übergänge bis zur Eindeutigkeit des modernen Sprachschatzes verfolgen. »Die ursprünglich doppelsinnigen Worte legen sich in der späteren Sprache in je zwei einsinnige auseinander, indem jeder der beiden entgegengesetzten Sinne je eine lautliche ›Ermäßigung‹ (Modifikation) derselben Wurzel für sich allein okkupiert.« So z. B. spaltet sich schon im Hieroglyphischen selbst ken »starkschwach« in ken »stark« und kan »schwach«. »Mit anderen Worten, die Begriffe, die nur antithetisch gefunden werden konnten, werden dem menschlichen Geiste im Laufe der Zeit genügend angeübt, um jedem ihrer beiden Teile eine selbständige Existenz zu ermöglichen und jedem somit seinen separaten lautlichen Vertreter zu verschaffen.«
Der fürs Ägyptische leicht zu führende Nachweis kontradiktorischer Urbedeutungen läßt sich nach Abel auch auf die semitischen und indoeuropäischen Sprachen ausdehnen. »Wie weit dieses in anderen Sprachfamilien geschehen kann, bleibt abzuwarten; denn obschon der Gegensinn ursprünglich den Denkenden jeder Rasse gegenwärtig gewesen sein muß, so braucht derselbe nicht überall in den Bedeutungen erkennbar geworden oder erhalten zu sein.«
Abel hebt ferner hervor, daß der Philosoph Bain diesen Doppelsinn der Worte, wie es scheint, ohne Kenntnis der tatsächlichen Phänomene aus rein theoretischen Gründen als eine logische Notwendigkeit gefordert hat. Die betreffende Stelle ( Logic, Bd. 1, 54) beginnt mit den Sätzen:
»The essential relativity of all knowledge, thought or consciousness cannot but show itself in language. If everything that we can know is viewed as a transition from something else, every experience must have two sides; and either every name must have a double meaning, or else for every meaning there must be two names.«
Aus dem »Anhang von Beispielen des ägyptischen, indogermanischen und arabischen Gegensinnes« hebe ich einige Fälle hervor, die auch uns Sprachunkundigen Eindruck machen können: Im Lateinischen heißt altus hoch und tief, sacer heilig und verflucht, wo also noch der volle Gegensinn ohne Modifikation des Wortlautes besteht. Die phonetische Abänderung zur Sonderung der Gegensätze wird belegt durch Beispiele wie clamare schreien – clam leise, still; siccus trocken – succus Saft. Im Deutschen bedeutet Boden heute noch das Oberste wie das Unterste im Haus. Unserem bös (schlecht) entspricht ein bass (gut), im Altsächsischen bat (gut) gegen englisch bad (schlecht); im Englischen to lock (schließen) gegen deutsch Lücke, Loch. Deutsch kleben – englisch to cleave (spalten); deutsch Stumm – Stimme usw. So käme vielleicht noch die vielbelachte Ableitung lucus a non lucendo zu einem guten Sinn.
In seiner Abhandlung über den ›Ursprung der Sprache‹ (1885, S. 305) macht Abel noch auf andere Spuren alter Denkmühen aufmerksam. Der Engländer sagt noch heute, um »ohne« auszudrücken, without, also »mitohne« und ebenso der Ostpreuße. With selbst, das heute unserem »mit« entspricht, hat ursprünglich sowohl »mit« als auch »ohne« geheißen, wie noch aus withdraw (fortgehen), withhold (entziehen) zu erkennen ist. Dieselbe Wandlung erkennen wir im deutschen wider (gegen) und wieder (zusammen mit).
Für den Vergleich mit der Traumarbeit hat noch eine andere, höchst sonderbare Eigentümlichkeit der altägyptischen Sprache Bedeutung. »Im Ägyptischen können die Worte – wir wollen zunächst sagen, scheinbar – sowohl Laut wie Sinn umdrehen. Angenommen, das deutsche Wort gut wäre ägyptisch, so könnte es neben gut auch schlecht bedeuten, neben gut auch tug lauten. Von solchen Lautumdrehungen, die zu zahlreich sind, um durch Zufälligkeit erklärt zu werden, kann man auch reichliche Beispiele aus den arischen und semitischen Sprachen beibringen. Wenn man sich zunächst aufs Germanische beschränkt, merke man: Topf – pot; hoat – tub; wait – täuwen; hurry – Ruhe; care – reck; Balken – Klobe, club. Zieht man die anderen indogermanischen Sprachen mit in Betracht, so wächst die Zahl der dazugehörigen Fälle entsprechend, z. B.: capere – packen; ren – Niere; the leaf (Blatt) – folium;dum-a[Fußnote]russisch: denken, θυμός – sanskrit mêdh, mûdha, Mut; Rauchen – russisch Kur-ít; kreischen – to shriek usw.«
Das Phänomen der Lautumdrehung sucht Abel aus einer Doppelung, Reduplikation der Wurzel zu erklären. Hier würden wir eine Schwierigkeit empfinden, dem Sprachforscher zu folgen. Wir erinnern uns daran, wie gerne die Kinder mit der Umkehrung des Wortlautes spielen und wie häufig sich die Traumarbeit der Umkehrung ihres Darstellungsmaterials zu verschiedenen Zwecken bedient. (Hier sind es nicht mehr Buchstaben, sondern Bilder, deren Reihenfolge verkehrt wird.) Wir würden also eher geneigt sein, die Lautumdrehung auf ein tiefergreifendes Moment zurückzuführen [Fußnote]Über das Phänomen der Lautumdrehung (Metathesis), welches zur Traumarbeit vielleicht noch innigere Beziehungen hat als der Gegensinn (Antithese), vgl. noch W. Meyer-Rinteln, in: Kölnische Zeitung vom 7. März 1909..
In der Übereinstimmung zwischen der eingangs hervorgehobenen Eigentümlichkeit der Traumarbeit und der von dem Sprachforscher aufgedeckten Praxis der ältesten Sprachen dürfen wir eine Bestätigung unserer Auffassung vom regressiven, archaischen Charakter des Gedankenausdruckes im Traume erblicken. Und als unabweisbare Vermutung drängt sich uns Psychiatern auf, daß wir die Sprache des Traumes besser verstehen und leichter übersetzen würden, wenn wir von der Entwicklung der Sprache mehr wüßten [Fußnote]Es liegt auch nahe anzunehmen, daß der ursprüngliche Gegensinn der Worte den vorgebildeten Mechanismus darstellt, der von dem Versprechen zum Gegenteile im Dienste mannigfacher Tendenzen ausgenützt wird..
Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene (1893)
Meine Herren! [Fußnote]Vortrag, gehalten von Dr. Sigm. Freud in der Sitzung des »Wiener med. Club« am 11. Januar 1893. Vom Vortr. revidiertes Original-Stenogramm der Wiener Med. Presse. Ich trete heute vor Sie hin mit der Absicht, Ihnen das Referat über eine Arbeit zu erstatten, deren erster Teil unter dem Namen Josef Breuers und dem meinigen bereits im Zentralblatt für Neurologie publiziert wurde. Wie Sie aus dem Titel der Arbeit ersehen, handelt sie von der Pathogenese der hysterischen Symptome und läßt erraten, daß die nächsten Gründe für die Entstehung hysterischer Symptome auf dem Gebiete des psychischen Lebens zu suchen sind.
Ehe ich aber weiter auf den Inhalt dieser gemeinsamen Arbeit eingehe, muß ich Ihnen sagen, an welche Stelle sie gehört, und muß Ihnen den Autor und Fund nennen, an den wir, wenigstens der Sache nach, angeknüpft haben, wenngleich die Entwicklung unseres Beitrages eine durchaus selbständige war.
Sie wissen, meine Herren, alle unsere neuen Fortschritte im Verständnis und in der Erkenntnis der Hysterie knüpfen an die Arbeiten von Charcot an. Charcot hat in der ersten Hälfte der achtziger Jahre angefangen, seine Aufmerksamkeit der »großen Neurose«, wie die Franzosen sagen, der Hysterie zu schenken. In einer Reihe von Forschungen hat er es dahin gebracht, Regelmäßigkeit und Gesetz dort nachzuweisen, wo unzulängliche oder verdrossene klinische Beobachtung anderer nur Simulation oder rätselhafte Willkür gesehen. Man kann sagen, direkt oder indirekt geht auf seine Anregung alles zurück, was wir in der letzten Zeit Neues von der Hysterie erfahren haben. Unter den vielfachen Arbeiten Charcots steht aber meiner Schätzung nach keine höher als jene, in welcher er uns die traumatischen Lähmungen, welche bei Hysterie auftreten, verstehen lehrte, und da es gerade diese Arbeit ist, als deren Fortsetzung die unsere erscheint, bitte ich Sie zu gestatten, daß ich dieses Thema nochmals ausführlicher vor Ihnen behandle.
Nehmen Sie den Fall an, ein Individuum, welches vorher nicht krank gewesen, vielleicht nicht einmal hereditär belastet sei, werde von einem Trauma betroffen. Dieses Trauma muß gewisse Bedingungen erfüllen; es muß schwer sein, d. h. von der Art, daß die Vorstellung einer Lebensgefahr, der Bedrohung der Existenz damit verbunden ist; es darf aber nicht schwer sein in dem Sinne, daß die psychische Tätigkeit dabei aufhört; sonst entfällt der Effekt, den wir davon erwarten; es darf also z. B. nicht mit einer Gehirnerschütterung, mit einer wirklichen schweren Verletzung einhergehen. Ferner muß dieses Trauma eine besondere Beziehung zu einem Körperteil haben. Nehmen Sie an, ein schweres Scheit Holz trifft einen Arbeiter auf die Schulter. Dieser Stoß wirft ihn nieder, doch überzeugt er sich bald, daß nichts geschehen sei, und er geht mit einer leichten Quetschung nach Hause. Nach einigen Wochen oder nach Monaten erwacht er eines morgens und bemerkt, daß der Arm, den das Trauma getroffen hat, schlaff, gelähmt herabhängt, nachdem er ihn in der Zwischenzeit, gewissermaßen in der Inkubationszeit, vollkommen gut gebraucht hat. Wenn es ein typischer Fall war, so kann es vorkommen, daß sich eigentümliche Anfälle einstellen, daß das Individuum nach einer Aura plötzlich zusammenfällt, tobt, deliriert, und wenn es in diesem Delirium spricht, ist daraus zu entnehmen, daß sich in ihm die Szene des Unfalles, etwa mit verschiedenen Phantasmen ausgeschmückt, wiederholt. Was ist hier vorgegangen, wie ist dieses Phänomen zu erklären?
Charcot erklärt diesen Vorgang, indem er ihn reproduziert, indem er die Lähmung künstlich an einem Kranken erzeugt. Er bedarf dazu eines Kranken, der sich schon in einem hysterischen Zustand befindet, des Zustandes der Hypnose und des Mittels der Suggestion. Einen solchen Kranken versetzt er in tiefe Hypnose, gibt ihm einen leichten Schlag auf den Arm, dieser Arm fällt herab, ist gelähmt und zeigt genau dieselben Symptome wie bei spontaner traumatischer Lähmung. Dieser Schlag kann auch ersetzt werden durch direkte verbale Suggestion: »Du, dein Arm ist gelähmt«; auch da zeigt die Lähmung den nämlichen Charakter.
Versuchen wir, diese beiden Fälle miteinander zu analogisieren. Hier das Trauma, dort die traumatische Suggestion; der Endeffekt, die Lähmung, ist in beiden Fällen ganz der nämliche. Wenn das Trauma des einen Falles im anderen Falle ersetzt werden kann durch die verbale Suggestion, so liegt es nahe anzunehmen, daß auch bei der spontanen traumatischen Lähmung eine solche Vorstellung an der Entstehung der Lähmung schuld war, und in der Tat berichtet eine Anzahl von Kranken, daß sie im Moment des Traumas wirklich die Empfindung hatten, daß ihr Arm zerschmettert sei. Dann wäre das Trauma wirklich durchaus gleichzusetzen der verbalen Suggestion. Dann fehlt aber noch ein Drittes, um die Analogie zu vervollständigen. Damit die Vorstellung »der Arm ist gelähmt« bei dem Kranken wirklich eine Lähmung hervorrufen konnte, war notwendig, daß sich der Kranke im Zustand der Hypnose befinde. Der Arbeiter befand sich aber nicht in Hypnose, wir können jedoch annehmen, daß er sich während des Traumas in einem besonderen Geisteszustand befand, und Charcot ist geneigt, diesen Affekt gleichzustellen dem künstlich hervorgerufenen Zustand der Hypnose. Damit ist die traumatische spontane Lähmung vollständig erklärt und in Analogie gebracht mit der durch Suggestion erzeugten Lähmung, und das Entstehen des Symptoms ist durch die Umstände des Traumas eindeutig determiniert.
Dasselbe Experiment hat Charcot aber auch zur Erklärung der Kontrakturen und Schmerzen, welche bei traumatischer Hysterie auftreten, wiederholt, und ich möchte sagen, daß Charcot selbst kaum in irgendeinem anderen Punkte so tief in das Verständnis der Hysterie eingedrungen ist wie gerade in dieser Frage. Aber hier endet seine Analyse, wir erfahren nicht, wie andere Symptome entstehen, und vor allem nicht, wie die hysterischen Symptome bei der gemeinen, nicht traumatischen Hysterie zustande kommen.
Meine Herren! Ungefähr gleichzeitig, als Charcot die hystero-traumatischen Lähmungen auf diese Weise durchleuchtete, hat Dr. Breuer 1880–1882 einer jungen Dame seinen ärztlichen Beistand geschenkt, welche sich – durch nicht traumatische Ätiologie – bei der Pflege ihres kranken Vaters eine schwere und komplizierte Hysterie mit Lähmungen, Kontrakturen, Sprach- und Sehstörungen und allen möglichen psychischen Besonderheiten zugezogen hatte. Dieser Fall wird seine Bedeutung für die Geschichte der Hysterie behalten, denn er war der erste Fall, wo es dem Arzte gelang, alle Symptome des hysterischen Zustandes zu durchleuchten, von jedem Symptom die Herkunft zu erfahren und gleichzeitig den Weg zu finden, dieses Symptom wieder zum Verschwinden zu bringen; es war sozusagen der erste durchsichtig gemachte Fall von Hysterie. Dr. Breuer bewahrte die Schlußfolgerungen, welche dieser Fall ziehen ließ, bei sich, bis er die Gewißheit erlangt hatte, daß er nicht vereinzelt dastehe. Nachdem ich im Jahre 1886 von einem Studienaufenthalt bei Charcot zurückgekehrt war, begann ich, in stetem Einvernehmen mit Breuer, eine größere Reihe von hysterischen Kranken genau zu beobachten und nach dieser Richtung hin zu untersuchen, und fand, daß das Verhalten jener ersten Patientin in der Tat ein typisches war und daß die Schlüsse, zu welchen dieser Fall berechtigte, auf eine größere Reihe, wenn nicht auf die Gesamtzahl der Hysterischen übertragen werden dürfen.
Unser Material bestand aus Fällen von gemeiner, also nicht traumatischer Hysterie; wir gingen so vor, daß wir uns bei jedem einzelnen Symptom nach den Umständen erkundigten, unter denen dieses Symptom zuerst aufgetreten war, und uns auf diese Art auch über die Veranlassung Klarheit zu verschaffen suchten, welche möglicherweise für dieses Symptom maßgebend sein konnte. Nun meinen Sie ja nicht, daß das eine einfache Arbeit ist. Wenn Sie Patienten in dieser Beziehung ausfragen, so bekommen sie meist zunächst gar keine Antwort; in einer kleinen Reihe von Fällen haben die Kranken ihre Gründe, das, was sie wissen, nicht zu sagen, in einer größeren Anzahl haben die Patienten tatsächlich keine Ahnung von dem Zusammenhange der Symptome. Der Weg, auf welchem etwas zu erfahren ist, ist schwierig und folgendermaßen: Man muß die Kranken in Hypnose versetzen und sie dann nach der Herkunft eines gewissen Symptomes ausfragen, wann dasselbe zum ersten Male aufgetreten und an was sie sich dabei erinnern. In diesem Zustande kehrt die Erinnerung, über welche sie im wachen Zustande nicht verfügen, zurück. Auf diese Art haben wir erfahren, daß, um es grob zu sagen, hinter den meisten, wenn nicht hinter allen Phänomenen der Hysterie ein mit Affekt betontes Erlebnis steckt und daß ferner dieses Erlebnis von solcher Art ist, daß es das Symptom, welches sich darauf bezieht, unmittelbar verstehen läßt, daß also dieses Symptom wieder eindeutig determiniert ist. Jetzt kann ich bereits den ersten Satz formulieren, zu welchem wir gelangt sind, wenn Sie mir gestatten, dieses mit Affekt betonte Erlebnis gleichzustellen jenem großen traumatischen Erlebnis, welches der traumatischen Hysterie zugrunde liegt: Es besteht eine volle Analogie zwischen der traumatischen Lähmung und der gemeinen, nicht traumatischen Hysterie. Der Unterschied ist nur der, daß dort ein großes Trauma eingewirkt hat, während hier selten ein einziges großes Ereignis zu konstatieren ist, sondern eine Reihe von affektvollen Eindrücken; eine ganze Leidensgeschichte. Es hat aber nichts Gezwungenes, diese Leidensgeschichte, welche sich bei Hysterischen als veranlassendes Moment ergibt, mit jenem Unfall bei der traumatischen Hysterie gleichzustellen, denn es zweifelt heute niemand mehr, daß auch bei dem großen mechanischen Trauma der traumatischen Hysterie es nicht das mechanische Moment ist, welches zur Wirkung kommt, sondern der Schreckaffekt, das psychische Trauma. Es ergibt sich also daraus als erstes, daß das Schema der traumatischen Hysterie, wie es Charcot für die hysterischen Lähmungen gegeben hat, ganz allgemein für alle hysterischen Phänomene oder wenigstens für die größte Zahl derselben gilt; überall handelt es sich um die Wirkung psychischer Traumen, welche die Natur der so entstehenden Symptome eindeutig bestimmen.
Gestatten Sie mir nun, Ihnen hierfür einige Beispiele vorzuführen. Zunächst ein Beispiel für das Auftreten von Kontrakturen. Die bereits erwähnte Patientin Breuers wies während der ganzen Zeit ihrer Krankheit eine Kontraktur des rechten Armes auf. In der Hypnose stellte sich heraus, daß sie zur Zeit, als sie noch nicht erkrankt war, einmal folgendes Trauma erlitten hatte: Sie saß halbschlummernd am Bette des kranken Vaters und hatte den rechten Arm über die Sessellehne hängen, wobei ihr derselbe einschlief. In diesem Momente hatte sie eine schreckhafte Halluzination, welche sie mit ihrem Arm abwehren wollte, was aber nicht gelang. Darüber erschrak sie heftig, und damit war die Sache vorläufig auch abgetan. Erst mit dem Ausbruch der Hysterie kam es zur Kontraktur dieses Armes. Bei einer anderen Kranken beobachtete ich ein eigenartiges Schnalzen mit der Zunge mitten in der Rede, ähnlich dem Balzen des Auerhahns. Ich kannte dieses Symptom an ihr bereits monatelang und hielt es für einen Tic. Erst als ich zufällig einmal in der Hypnose mich nach dem Ursprung desselben erkundigte, stellte sich heraus, daß das Geräusch bei zwei Gelegenheiten zum ersten Male aufgetreten war, wo sie beide Male den festen Vorsatz hatte, sich absolut ruhig zu verhalten, einmal als sie ihr schwerkrankes Kind pflegte – Krankenpflege kommt oft in der Ätiologie der Hysterie vor – und sich vornahm, dasselbe, das eben eingeschlafen war, durch kein Geräusch zu wecken. Aber die Furcht vor der Tat schlug in die Aktion um (hysterischer Gegenwille!) und, die Lippen aufeinander pressend, machte sie jenes schnalzende Geräusch mit der Zunge. Dasselbe Symptom entstand viele Jahre später ein zweites Mal, als sie sich gleichfalls vorgenommen hatte, sich absolut ruhig zu verhalten, und verblieb von da an. Oft reicht eine einzige Veranlassung nicht hin, um ein Symptom zu fixieren, wenn aber dieses selbe Symptom mehrere Male mit einem gewissen Affekt auftritt, dann fixiert es sich und bleibt.
Eines der häufigsten Symptome der Hysterie ist Anorexie und Erbrechen. Ich kenne eine ganze Reihe von Fällen, welche das Zustandekommen dieses Symptomes in einfacher Weise erklären. So persistierte bei einer Kranken das Erbrechen, nachdem sie einen sie kränkenden Brief unmittelbar vor dem Essen gelesen und nach demselben alles wieder erbrochen hatte. In anderen Fällen läßt sich der Ekel vor dem Essen mit aller Bestimmtheit darauf beziehen, daß Personen durch die Institution des gemeinsamen Tisches genötigt sind, mit Personen zusammen zu essen, die sie verabscheuen. Der Ekel überträgt sich dann von der Person auf das Essen. Besonders interessant in dieser Beziehung war jene erwähnte Frau mit dem Tic; diese Frau aß ungemein wenig und nur gezwungen; in der Hypnose erfuhr ich, daß eine Reihe von psychischen Traumen schließlich dieses Symptom, den Ekel vor dem Essen, hervorgebracht hatte. Schon als Kind wurde sie von der sehr strengen Mutter angehalten, das Fleisch, welches sie zu Mittag nicht gegessen hatte, zwei Stunden nach Tisch kalt und mit dem erstarrten Fett zu essen; sie tat dies mit großem Ekel und behielt die Erinnerung daran, so daß sie, auch als sie später nicht mehr zu dieser Strafe gezwungen war, stets mit Ekel zu Tisch ging. 10 Jahre später teilte sie den Tisch mit einem Verwandten, welcher tuberkulös war und während des Essens stets über den Tisch hinüber in die Spuckschale spuckte; einige Zeit später war sie gezwungen, mit einem Verwandten zu essen, von welchem sie wußte, daß er an einer ansteckenden Krankheit leide. Die Patientin Breuers benahm sich eine Zeitlang wie eine Hydrophobische; in der Hypnose stellte sich als Grund hierfür heraus, daß sie einmal unvermutet einen Hund aus einem ihrer Wassergläser hatte trinken gesehen.
Auch das Symptom der Schlaflosigkeit und Schlafstörung findet meist die präziseste Erklärung. Eine Frau konnte z. B. durch Jahre erst um 6 Uhr früh einschlafen. Sie hatte lange Zeit Tür an Tür mit ihrem kranken Mann geschlafen, welcher morgens um 6 Uhr aufstand. Von dieser Zeit an fand sie Ruhe zu schlafen, und so benahm sie sich auch dann viele Jahre später während einer hysterischen Erkrankung. Ein anderer Fall betraf einen Mann. Ein Hysteriker schläft seit 12 Jahren sehr schlecht; aber seine Schlaflosigkeit ist von ganz eigener Art. Während er im Sommer ausgezeichnet schläft, schläft er im Winter recht schlecht, und ganz besonders schlecht im November. Womit dies zusammenhängt, davon hat er keine Ahnung. Das Examen ergibt, daß er vor 12 Jahren im November bei seinem an Diphtheritis erkrankten Kind viele Nächte hindurch gewacht hatte.
Ein Beispiel von Sprachstörung liefert die wiederholt erwähnte Patientin Breuers. Diese sprach während einer langen Periode ihrer Krankheit nur englisch; weder sprach, noch verstand sie das Deutsche. Dieses Symptom ließ sich auf ein Ereignis noch vor Ausbruch ihrer Krankheit zurückführen. In einem Zustande großer Angst versuchte sie zu beten, fand aber keine Worte. Endlich fielen ihr ein paar Worte eines englischen Kindergebetes ein. Als sie später erkrankte, stand ihr nur das Englische zur Verfügung.
Nicht in allen Fällen ist die Determination des Symptoms durch das psychische Trauma so durchsichtig. Es besteht oft nur eine sozusagen symbolische Beziehung zwischen der Veranlassung und dem hysterischen Symptom. Das bezieht sich besonders auf Schmerzen. So litt eine Kranke an bohrenden Schmerzen zwischen den Augenbrauen. Der Grund dafür lag darin, daß sie einmal als Kind von ihrer Großmutter prüfend, »durchbohrend« angeschaut worden war. Dieselbe Patientin litt eine Zeitlang an ganz unmotivierten, heftigen Schmerzen in der rechten Ferse. Diese Schmerzen hatten, wie sich herausstellte, Beziehung zu einer Vorstellung, welche die Patientin hatte, als sie zuerst in die Welt eingeführt wurde; es überkam sie damals die Angst, daß sie das »richtige« oder »rechte Auftreten« nicht finden könnte. Solche Symbolisierungen werden von vielen Kranken für eine ganze Reihe von sogenannten Neuralgien und Schmerzen in Anspruch genommen. Es besteht gleichsam eine Absicht, den psychischen Zustand durch einen körperlichen auszudrücken, und der Sprachgebrauch bietet hierfür die Brücke. Gerade für die typischen hysterischen Symptome, wie Hemianästhesie, Gesichtsfeldeinengung, epileptiforme Konvulsionen etc., ist es aber nicht möglich, einen derartigen psychischen Mechanismus nachzuweisen. Für die hysterogenen Zonen hingegen ist es uns oftmals gelungen.
Mit diesen Beispielen, welche ich aus einer Reihe von Beobachtungen herausgegriffen habe, wäre der Beweis geliefert, daß man die Phänomene der gemeinen Hysterie ruhig nach demselben Schema auffassen darf wie die der traumatischen Hysterie, daß somit jede Hysterie als traumatische Hysterie aufgefaßt werden kann im Sinne des psychischen Traumas und daß jedes Phänomen nach der Art des Traumas determiniert ist.
Die weitere Frage, welche zu beantworten wäre, ist nun, welches ist die Art des ursächlichen Zusammenhanges zwischen jenem Anlaß, den wir in der Hypnose erfahren haben, und dem Phänomen, welches später als hysterisches Dauersymptom bleibt? Ein solcher Zusammenhang könnte ein mannigfacher sein. Er könnte etwa von der Art sein, wie wir ihn als Typus der Auslösung anführen. Wenn beispielsweise jemand, der zu Tuberkulose disponiert ist, einen Schlag aufs Knie bekommt, in dessen Gefolge sich eine tuberkulöse Gelenkentzündung entwickelt, so ist das eine einfache Auslösung. Aber so verhält es sich bei der Hysterie nicht. Es gibt noch eine andere Art der Verursachung, und das ist die direkte. Wollen wir uns dieselbe durch das Bild des Fremdkörpers veranschaulichen. Ein solcher wirkt als reizende Krankheitsursache fort und fort, bis er entfernt ist. Cessante causa cessat effectus[Fußnote]Fällt die Ursache weg, entfällt auch die Wirkung. Die Beobachtung Breuers lehrt, daß zwischen dem psychischen Trauma und dem hysterischen Phänomen ein Zusammenhang der letzten Art besteht. Breuer hat nämlich bei seiner ersten Patientin folgende Erfahrung gemacht: Der Versuch, die Veranlassung eines Symptomes zu erfahren, ist gleichzeitig ein therapeutisches Manöver. Der Moment, in welchem der Arzt erfährt, bei welcher Gelegenheit ein Symptom zum ersten Male aufgetreten ist und wodurch es bedingt war, ist auch derjenige, in dem dieses Symptom verschwindet. Wenn ein Kranker beispielsweise das Symptom der Schmerzen bietet und wir forschen in der Hypnose nach, woher er diese Schmerzen habe, so kommt eine Reihe von Erinnerungen über ihn. Wenn es gelingt, den Kranken zu einer recht lebhaften Erinnerung zu bringen, so sieht er die Dinge mit ursprünglicher Wirklichkeit vor sich, man merkt, daß der Kranke unter der vollen Herrschaft eines Affektes steht, und wenn man ihn dann nötigt, diesem Affekte Worte zu leihen, so sieht man, daß unter Erzeugung eines heftigen Affektes diese Erscheinung der Schmerzen noch einmal mit großem Ausdruck auftritt und daß von da an dieses Symptom als Dauersymptom verschwunden ist. So gestaltete sich der Vorgang in all den angeführten Beispielen. Es hat sich dabei die interessante Tatsache ergeben, daß die Erinnerung an dieses Ereignis außerordentlich viel lebhafter war als an andere und daß der damit verbundene Affekt so groß war, als er etwa bei dem wirklichen Erlebnis gewesen war. Man muß annehmen, daß jenes psychische Trauma in der Tat in dem betreffenden Individuum noch fortwirkt und das hysterische Phänomen unterhält und daß es zu Ende ist, sowie sich der Patient darüber ausgesprochen hat.
Ich habe soeben bemerkt, daß, wenn man nach unserem Verfahren durch Ausforschung in der Hypnose auf das psychische Trauma gekommen ist, man dabei findet, daß die Erinnerung, um die es sich handelt, ganz ungewöhnlich stark ist und ihren vollen Affekt bewahrt hat. Es entsteht nun die Frage, woher kommt es, daß ein Ereignis, das vor so langer Zeit, etwa vor 10 oder 20 Jahren, vorgefallen ist, fortwährend seine Gewalt über das Individuum äußert, warum diese Erinnerungen nicht der Abnützung, der Usur, dem Vergessen verfallen.
Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich einige Erwägungen über die Bedingungen der Abnützung des Inhalts unseres Vorstellungslebens vorausschicken. Man kann hier von einem Satze ausgehen, welcher folgendermaßen lautet: Wenn ein Mensch einen psychischen Eindruck erfährt, so wird etwas in seinem Nervensystem gesteigert, was wir momentan die Erregungssumme nennen wollen. Nun besteht in jedem Individuum, um seine Gesundheit zu erhalten, das Bestreben, diese Erregungssumme wieder zu verkleinern. Die Steigerung der Erregungssumme geschieht auf sensiblen Bahnen, die Verkleinerung auf motorischen Bahnen. Man kann also sagen, wenn jemandem etwas zustößt, so reagiert er darauf motorisch. Man kann nun ruhig behaupten, daß es von dieser Reaktion abhängt, wieviel von dem anfänglichen psychischen Eindruck zurückbleibt. Erörtern wir das an einem besonderen Beispiele. Ein Mensch erfahre eine Beleidigung, einen Schlag oder dergleichen, so ist das psychische Trauma mit einer Steigerung der Erregungssumme des Nervensystemes verbunden. Es entsteht dann instinktiv die Neigung, diese gesteigerte Erregung sofort zu vermindern, er schlägt zurück, und nun ist ihm leichter, er hat vielleicht adäquat reagiert, d. h. er hat so viel abgeführt, als ihm zugeführt wurde. Nun gibt es verschiedene Arten dieser Reaktion. Für ganz leichte Erregungssteigerungen genügen vielleicht Veränderungen des eigenen Körpers, Weinen, Schimpfen, Toben und dergleichen. Je intensiver das psychische Trauma, desto größer ist die adäquate Reaktion. Die adäquateste Reaktion ist aber immer die Tat. Aber, wie ein englischer Autor geistreich bemerkte, derjenige, welcher dem Feinde statt des Pfeiles ein Schimpfwort entgegenschleuderte, war der Begründer der Zivilisation, so ist das Wort der Ersatz für die Tat und unter Umständen der einzige Ersatz (Beichte). Es gibt also neben der adäquaten Reaktion eine minder adäquate. Wenn nun die Reaktion auf ein psychisches Trauma gänzlich unterblieben ist, dann behält die Erinnerung daran den Affekt, den sie ursprünglich hatte. Wenn also jemand, der beleidigt worden ist, die Beleidigung nicht vergelten kann, weder durch einen Gegenschlag noch durch ein Schimpfwort, dann ist die Möglichkeit gegeben, daß die Erinnerung an diesen Vorgang bei ihm wieder denselben Affekt hervorruft, wie er zu Anfang vorhanden war. Eine Beleidigung, die vergolten ist, wenn auch nur durch Worte, wird anders erinnert als eine, die hingenommen werden mußte, und der Sprachgebrauch bezeichnet auch charakteristischerweise eben das schweigend erduldete Leiden als »Kränkung«. Wenn also die Reaktion auf das psychische Trauma aus irgendeinem Grunde unterbleiben mußte, behält dasselbe seinen ursprünglichen Affekt, und wo sich der Mensch des Reizzuwachses nicht durch »Abreagieren« entledigen kann, ist die Möglichkeit gegeben, daß das betreffende Ereignis für ihn zu einem psychischen Trauma wird. Der gesunde psychische Mechanismus hat allerdings andere Mittel, den Affekt eines psychischen Traumas zu erledigen, auch wenn die motorische Reaktion und die Reaktion durch Worte versagt ist, nämlich die assoziative Verarbeitung, die Erledigung durch kontrastierende Vorstellungen. Wenn der Beleidigte nicht zurückschlägt, auch nicht schimpft, so kann er doch den Affekt der Beleidigung dadurch vermindern, daß er in sich kontrastierende Vorstellungen von der eigenen Würde, von der Würdelosigkeit des Beleidigers u.s.w. wachruft. Ob nun der Gesunde in der einen oder in der anderen Weise eine Beleidigung erledigt, gelangt er immer zu dem Ende, daß der Affekt, welcher ursprünglich stark in der Erinnerung haftete, endlich an Intensität verliert und daß die schließlich affektlose Erinnerung mit der Zeit dem Vergessen, der Usur anheimfällt.
Nun haben wir gefunden, daß sich bei Hysterischen lauter Eindrücke finden, welche nicht affektlos geworden sind und deren Erinnerung eine lebhafte geblieben ist. Wir kommen also darauf, daß diese pathogen gewordenen Erinnerungen bei Hysterischen eine besondere Ausnahmsstellung zur Usur einnehmen, und die Beobachtung zeigt, daß es sich bei allen Anlässen, welche zu Ursachen hysterischer Phänomene geworden sind, um psychische Traumen handelt, die nicht vollständig abreagiert, nicht vollständig erledigt worden sind. Wir können also sagen, der Hysterische leidet an unvollständig abreagierten psychischen Traumen.
Man findet zwei Gruppen von Bedingungen, unter welchen Erinnerungen pathogen werden. In der einen Gruppe findet man als Inhalt der Erinnerungen, auf welche hysterische Phänomene zurückgehen, solche Vorstellungen, bei denen das Trauma ein allzu großes war, so daß es dem Nervensystem an Macht gebrach, um sich dessen auf irgendeine Art zu entledigen, ferner Vorstellungen, bei welchen soziale Gründe eine Reaktion unmöglich machen (so häufig im Eheleben), endlich ist es möglich, daß der Betreffende die Reaktion einfach verweigert, auf ein psychisches Trauma überhaupt nicht reagieren will. Da findet sich häufig als Inhalt der hysterischen Delirien gerade jener Vorstellungskreis, welchen die Kranken im normalen Zustand mit aller Gewalt von sich gewiesen, gehemmt und unterdrückt haben (z. B. Gotteslästerung und Erotismen in den hysterischen Delirien der Nonnen). In einer anderen Reihe von Fällen liegt aber der Grund, warum die motorische Reaktion ausfiel, nicht an dem Inhalt des psychischen Traumas, sondern an anderen Umständen. Man findet sehr häufig als Inhalt und Ursache hysterischer Phänomene Erlebnisse, welche an und für sich ganz geringfügig sind, aber dadurch eine hohe Bedeutung gewonnen haben, daß sie in ganz besonders wichtige Momente krankhaft gesteigerter Disposition gefallen sind. Es hat sich etwa der Affekt des Schreckens in einem anderen schweren Affekt ereignet und ist dadurch zu solcher Bedeutung gekommen. Derartige Zustände sind kurzdauernd und sozusagen außer Verkehr mit dem sonstigen geistigen Leben des Individuums. In einem solchen Zustand der Autohypnose kann das Individuum eine Vorstellung, welche in ihm auftrat, nicht derartig assoziativ erledigen, wie im wachen Zustande. Die längere Beschäftigung mit diesen Phänomenen machte es uns wahrscheinlich, daß es sich bei jeder Hysterie um ein Rudiment der sogenannten double conscience, des doppelten Bewußtseins handele und daß die Neigung zu dieser Dissoziation und damit zum Auftreten abnormer Bewußtseinszustände, die wir als »hypnoide« bezeichnen wollen, das Grundphänomen der Hysterie sei.
Sehen wir uns nun um, in welcher Weise unsere Therapie wirkt. Dieselbe kommt einem der heißesten Wünsche der Menschheit entgegen, nämlich dem Wunsche, etwas zweimal tun zu dürfen. Es hat jemand ein psychisches Trauma erfahren, ohne darauf genügend zu reagieren; man läßt ihn dasselbe ein zweites Mal erleben, aber in der Hypnose und nötigt ihn jetzt, die Reaktion zu vervollständigen. Er entledigt sich nun des Affekts der Vorstellung, der früher sozusagen eingeklemmt war, und damit ist die Wirkung dieser Vorstellung aufgehoben. Also wir heilen nicht die Hysterie, aber einzelne Symptome derselben dadurch, daß wir die unerledigte Reaktion vollziehen lassen.
Meinen Sie nun nicht, daß damit für die Therapie der Hysterie sehr viel gewonnen wäre. So wie die Neurosen hat auch die Hysterie ihre tieferen Gründe, und diese sind es, welche der Therapie eine gewisse, oft sehr fühlbare Schranke setzen.
Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens (1912)
1
Wenn der psychoanalytische Praktiker sich fragt, wegen welches Leidens er am häufigsten um Hilfe angegangen wird, so muß er – absehend von der vielgestaltigen Angst – antworten: wegen psychischer Impotenz. Diese sonderbare Störung betrifft Männer von stark libidinösem Wesen und äußert sich darin, daß die Exekutivorgane der Sexualität die Ausführung des geschlechtlichen Aktes verweigern, obwohl sie sich vorher und nachher als intakt und leistungsfähig erweisen können und obwohl eine starke psychische Geneigtheit zur Ausführung des Aktes besteht. Die erste Anleitung zum Verständnis seines Zustandes erhält der Kranke selbst, wenn er die Erfahrung macht, daß ein solches Versagen nur beim Versuch mit gewissen Personen auftritt, während es bei anderen niemals in Frage kommt. Er weiß dann, daß es eine Eigenschaft des Sexualobjekts ist, von welcher die Hemmung seiner männlichen Potenz ausgeht, und berichtet manchmal, er habe die Empfindung eines Hindernisses in seinem Innern, die Wahrnehmung eines Gegenwillens, der die bewußte Absicht mit Erfolg störe. Er kann aber nicht erraten, was dies innere Hindernis ist und welche Eigenschaft des Sexualobjekts es zur Wirkung bringt. Hat er solches Versagen wiederholt erlebt, so urteilt er wohl in bekannter fehlerhafter Verknüpfung, die Erinnerung an das erste Mal habe als störende Angstvorstellung die Wiederholungen erzwungen; das erste Mal selbst führt er aber auf einen »zufälligen« Eindruck zurück.
Psychoanalytische Studien über die psychische Impotenz sind bereits von mehreren Autoren angestellt und veröffentlicht worden [Fußnote]M. Steiner (1907) – W. Stekel (1908) – Ferenczi (1908).. Jeder Analytiker kann die dort gebotenen Aufklärungen aus eigener ärztlicher Erfahrung bestätigen. Es handelt sich wirklich um die hemmende Einwirkung gewisser psychischer Komplexe, die sich der Kenntnis des Individuums entziehen. Als allgemeinster Inhalt dieses pathogenen Materials hebt sich die nicht überwundene inzestuöse Fixierung an Mutter und Schwester hervor. Außerdem ist der Einfluß von akzidentellen peinlichen Eindrücken, die sich an die infantile Sexualbetätigung knüpfen, zu berücksichtigen und jene Momente, die ganz allgemein die auf das weibliche Sexualobjekt zu richtende Libido verringern [Fußnote]W. Stekel (1908, 191 ff.)..
Unterzieht man Fälle von greller psychischer Impotenz einem eindringlichen Studium mittels der Psychoanalyse, so gewinnt man folgende Auskunft über die dabei wirksamen psychosexuellen Vorgänge. Die Grundlage des Leidens ist hier wiederum – wie sehr wahrscheinlich bei allen neurotischen Störungen – eine Hemmung in der Entwicklungsgeschichte der Libido bis zu ihrer normal zu nennenden Endgestaltung. Es sind hier zwei Strömungen nicht zusammengetroffen, deren Vereinigung erst ein völlig normales Liebesverhalten sichert, zwei Strömungen, die wir als die zärtliche und die sinnliche voneinander unterscheiden können.
Von diesen beiden Strömungen ist die zärtliche die ältere. Sie stammt aus den frühesten Kinderjahren, hat sich auf Grund der Interessen des Selbsterhaltungstriebes gebildet und richtet sich auf die Personen der Familie und die Vollzieher der Kinderpflege. Sie hat von Anfang an Beiträge von den Sexualtrieben, Komponenten von erotischem Interesse mitgenommen, die schon in der Kindheit mehr oder minder deutlich sind, beim Neurotiker in allen Fällen durch die spätere Psychoanalyse aufgedeckt werden. Sie entspricht der primären kindlichen Objektwahl. Wir ersehen aus ihr, daß die Sexualtriebe ihre ersten Objekte in der Anlehnung an die Schätzungen der Ichtriebe finden, geradeso, wie die ersten Sexualbefriedigungen in Anlehnung an die zur Lebenserhaltung notwendigen Körperfunktionen erfahren werden. Die »Zärtlichkeit« der Eltern und Pflegepersonen, die ihren erotischen Charakter selten verleugnet (»das Kind ein erotisches Spielzeug«), tut sehr viel dazu, die Beiträge der Erotik zu den Besetzungen der Ichtriebe beim Kinde zu erhöhen und sie auf ein Maß zu bringen, welches in der späteren Entwicklung in Betracht kommen muß, besonders wenn gewisse andere Verhältnisse dazu ihren Beistand leihen.
Diese zärtlichen Fixierungen des Kindes setzen sich durch die Kindheit fort und nehmen immer wieder Erotik mit sich, welche dadurch von ihren sexuellen Zielen abgelenkt wird. Im Lebensalter der Pubertät tritt nun die mächtige »sinnliche« Strömung hinzu, die ihre Ziele nicht mehr verkennt. Sie versäumt es anscheinend niemals, die früheren Wege zu gehen und nun mit weit stärkeren Libidobeträgen die Objekte der primären infantilen Wahl zu besetzen. Aber da sie dort auf die unterdessen aufgerichteten Hindernisse der Inzestschranke stößt, wird sie das Bestreben äußern, von diesen real ungeeigneten Objekten möglichst bald den Übergang zu anderen, fremden Objekten zu finden, mit denen sich ein reales Sexualleben durchführen läßt. Diese fremden Objekte werden immer noch nach dem Vorbild (der Imago) der infantilen gewählt werden, aber sie werden mit der Zeit die Zärtlichkeit an sich ziehen, die an die früheren gekettet war. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen – nach der biblischen Vorschrift – und seinem Weibe nachgehen, Zärtlichkeit und Sinnlichkeit sind dann beisammen. Die höchsten Grade von sinnlicher Verliebtheit werden die höchste psychische Wertschätzung mit sich bringen. (Die normale Überschätzung des Sexualobjekts von Seiten des Mannes.)
Für das Mißlingen dieses Fortschrittes im Entwicklungsgang der Libido werden zwei Momente maßgebend sein. Erstens das Maß von realer Versagung, welches sich der neuen Objektwahl entgegensetzen und sie für das Individuum entwerten wird. Es hat ja keinen Sinn, sich der Objektwahl zuzuwenden, wenn man überhaupt nicht wählen darf oder keine Aussicht hat, etwas Ordentliches wählen zu können. Zweitens das Maß der Anziehung, welches die zu verlassenden infantilen Objekte äußern können und das proportional ist der erotischen Besetzung, die ihnen noch in der Kindheit zuteil wurde. Sind diese beiden Faktoren stark genug, so tritt der allgemeine Mechanismus der Neurosenbildung in Wirksamkeit. Die Libido wendet sich von der Realität ab, wird von der Phantasietätigkeit aufgenommen (Introversion), verstärkt die Bilder der ersten Sexualobjekte, fixiert sich an dieselben. Das Inzesthindernis nötigt aber die diesen Objekten zugewendete Libido, im Unbewußten zu verbleiben. Die Betätigung der jetzt dem Unbewußten angehörigen sinnlichen Strömung in onanistischen Akten tut das Ihrige dazu, um diese Fixierung zu verstärken. Es ändert nichts an diesem Sachverhalt, wenn der Fortschritt nun in der Phantasie vollzogen wird, der in der Realität mißglückt ist, wenn in den zur onanistischen Befriedigung führenden Phantasiesituationen die ursprünglichen Sexualobjekte durch fremde ersetzt werden. Die Phantasien werden durch diesen Ersatz bewußtseinsfähig, an der realen Unterbringung der Libido wird ein Fortschritt nicht vollzogen.
Es kann auf diese Weise geschehen, daß die ganze Sinnlichkeit eines jungen Menschen im Unbewußten an inzestuöse Objekte gebunden oder, wie wir auch sagen können, an unbewußte inzestuöse Phantasien fixiert wird. Das Ergebnis ist dann eine absolute Impotenz, die etwa noch durch die gleichzeitig erworbene wirkliche Schwächung der den Sexualakt ausführenden Organe versichert wird.
Für das Zustandekommen der eigentlich sogenannten psychischen Impotenz werden mildere Bedingungen erfordert. Die sinnliche Strömung darf nicht in ihrem ganzen Betrag dem Schicksal verfallen, sich hinter der zärtlichen verbergen zu müssen, sie muß stark oder ungehemmt genug geblieben sein, um sich zum Teil den Ausweg in die Realität zu erzwingen. Die Sexualbetätigung solcher Personen läßt aber an den deutlichsten Anzeichen erkennen, daß nicht die volle psychische Triebkraft hinter ihr steht. Sie ist launenhaft, leicht zu stören, oft in der Ausführung inkorrekt, wenig genußreich. Vor allem aber muß sie der zärtlichen Strömung ausweichen. Es ist also eine Beschränkung in der Objektwahl hergestellt worden. Die aktiv gebliebene sinnliche Strömung sucht nur nach Objekten, die nicht an die ihr verpönten inzestuösen Personen mahnen; wenn von einer Person ein Eindruck ausgeht, der zu hoher psychischer Wertschätzung führen könnte, so läuft er nicht in Erregung der Sinnlichkeit, sondern in erotisch unwirksame Zärtlichkeit aus. Das Liebesleben solcher Menschen bleibt in die zwei Richtungen gespalten, die von der Kunst als himmlische und irdische (oder tierische) Liebe personifiziert werden. Wo sie lieben, begehren sie nicht, und wo sie begehren, können sie nicht lieben. Sie suchen nach Objekten, die sie nicht zu lieben brauchen, um ihre Sinnlichkeit von ihren geliebten Objekten fernzuhalten, und das sonderbare Versagen der psychischen Impotenz tritt nach den Gesetzen der »Komplexempfindlichkeit« und der »Rückkehr des Verdrängten« dann auf; wenn an dem zur Vermeidung des Inzests gewählten Objekt ein oft unscheinbarer Zug an das zu vermeidende Objekt erinnert.
Das Hauptschutzmittel gegen solche Störung, dessen sich der Mensch in dieser Liebesspaltung bedient, besteht in der psychischen Erniedrigung des Sexualobjektes, während die dem Sexualobjekt normalerweise zustehende Überschätzung dem inzestuösen Objekt und dessen Vertretungen reserviert wird. Sowie die Bedingung der Erniedrigung erfüllt ist, kann sich die Sinnlichkeit frei äußern, bedeutende sexuelle Leistungen und hohe Lust entwickeln. Zu diesem Ergebnis trägt noch ein anderer Zusammenhang bei. Personen, bei denen die zärtliche und die sinnliche Strömung nicht ordentlich zusammengeflossen sind, haben auch meist ein wenig verfeinertes Liebesleben; perverse Sexualziele sind bei ihnen erhalten geblieben, deren Nichterfüllung als empfindliche Lusteinbuße verspürt wird, deren Erfüllung aber nur am erniedrigten, geringgeschätzten Sexualobjekt möglich erscheint.
Die in dem ersten Beitrag [Fußnote]›Über einen besonderen Typus der Objektwahl beim Manne‹, S. 193, oben. erwähnten Phantasien des Knaben, welche die Mutter zur Dirne herabsetzen, werden nun nach ihren Motiven verständlich. Es sind Bemühungen, die Kluft zwischen den beiden Strömungen des Liebeslebens wenigstens in der Phantasie zu überbrücken, die Mutter durch Erniedrigung zum Objekt für die Sinnlichkeit zu gewinnen.
2
Wir haben uns bisher mit einer ärztlich-psychologischen Untersuchung der psychischen Impotenz beschäftigt, welche in der Überschrift dieser Abhandlung keine Rechtfertigung findet. Es wird sich aber zeigen, daß wir dieser Einleitung bedurft haben, um den Zugang zu unserem eigentlichen Thema zu gewinnen.
Wir haben die psychische Impotenz reduziert auf das Nichtzusammentreffen der zärtlichen und der sinnlichen Strömung im Liebesleben und diese Entwicklungshemmung selbst erklärt durch die Einflüsse der starken Kindheitsfixierungen und der späteren Versagung in der Realität bei Dazwischenkunft der Inzestschranke. Gegen diese Lehre ist vor allem eines einzuwenden: sie gibt uns zu viel, sie erklärt uns, warum gewisse Personen an psychischer Impotenz leiden, läßt uns aber rätselhaft erscheinen, daß andere diesem Leiden entgehen konnten. Da alle in Betracht kommenden ersichtlichen Momente, die starke Kindheitsfixierung, die Inzestschranke und die Versagung in den Jahren der Entwicklung nach der Pubertät, bei so ziemlich allen Kulturmenschen als vorhanden anzuerkennen sind, wäre die Erwartung berechtigt, daß die psychische Impotenz ein allgemeines Kulturleiden und nicht die Krankheit einzelner sei.
Es läge nahe, sich dieser Folgerung dadurch zu entziehen, daß man auf den quantitativen Faktor der Krankheitsverursachung hinweist, auf jenes Mehr oder Minder im Beitrag der einzelnen Momente, von dem es abhängt, ob ein kenntlicher Krankheitserfolg zustande kommt oder nicht. Aber obwohl ich diese Antwort als richtig anerkennen möchte, habe ich doch nicht die Absicht, die Folgerung selbst hiemit abzuweisen. Ich will im Gegenteil die Behauptung aufstellen, daß die psychische Impotenz weit verbreiteter ist, als man glaubt, und daß ein gewisses Maß dieses Verhaltens tatsächlich das Liebesleben des Kulturmenschen charakterisiert.
Wenn man den Begriff der psychischen Impotenz weiter faßt und ihn nicht mehr auf das Versagen der Koitusaktion bei vorhandener Lustabsicht und bei intaktem Genitalapparat einschränkt, so kommen zunächst alle jene Männer hinzu, die man als Psychanästhetiker bezeichnet, denen die Aktion nie versagt, die sie aber ohne besonderen Lustgewinn vollziehen; Vorkommnisse, die häufiger sind, als man glauben möchte. Die psychoanalytische Untersuchung solcher Fälle deckt die nämlichen ätiologischen Momente auf, welche wir bei der psychischen Impotenz im engeren Sinne gefunden haben, ohne daß die symptomatischen Unterschiede zunächst eine Erklärung finden. Von den anästhetischen Männern führt eine leicht zu rechtfertigende Analogie zur ungeheuren Anzahl der frigiden Frauen, deren Liebesverhalten tatsächlich nicht besser beschrieben oder verstanden werden kann als durch die Gleichstellung mit der geräuschvolleren psychischen Impotenz des Mannes [Fußnote]Wobei gerne zugestanden sein soll, daß die Frigidität der Frau ein komplexes, auch von anderer Seite her zugängliches Thema ist..
Wenn wir aber nicht nach einer Erweiterung des Begriffes der psychischen Impotenz, sondern nach den Abschattungen ihrer. Symptomatologie ausschauen, dann können wir uns der Einsicht nicht verschließen, daß das Liebesverhalten des Mannes in unserer heutigen Kulturwelt überhaupt den Typus der psychischen Impotenz an sich trägt. Die zärtliche und die sinnliche Strömung sind bei den wenigsten unter den Gebildeten gehörig miteinander verschmolzen; fast immer fühlt sich der Mann in seiner sexuellen Betätigung durch den Respekt vor dem Weibe beengt und entwickelt seine volle Potenz erst, wenn er ein erniedrigtes Sexualobjekt vor sich hat, was wiederum durch den Umstand mitbegründet ist, daß in seine Sexualziele perverse Komponenten eingehen, die er am geachteten Weibe zu befriedigen sich nicht getraut. Einen vollen sexuellen Genuß gewährt es ihm nur, wenn er sich ohne Rücksicht der Befriedigung hingeben darf, was er zum Beispiel bei seinem gesitteten Weibe nicht wagt. Daher rührt dann sein Bedürfnis nach einem erniedrigten Sexualobjekt, einem Weibe, das ethisch minderwertig ist, dem er ästhetische Bedenken nicht zuzutrauen braucht, das ihn nicht in seinen anderen Lebensbeziehungen kennt und beurteilen kann. Einem solchen Weibe widmet er am liebsten seine sexuelle Kraft, auch wenn seine Zärtlichkeit durchaus einem höherstehenden gehört. Möglicherweise ist auch die so häufig zu beobachtende Neigung von Männern der höchsten Gesellschaftsklassen, ein Weib aus niederem Stande zur dauernden Geliebten oder selbst zur Ehefrau zu wählen, nichts anderes als die Folge des Bedürfnisses nach dem erniedrigten Sexualobjekt, mit welchem psychologisch die Möglichkeit der vollen Befriedigung verknüpft ist.
Ich stehe nicht an, die beiden bei der echten psychischen Impotenz wirksamen Momente, die intensive inzestuöse Fixierung der Kindheit und die reale Versagung der Jünglingszeit, auch für dies so häufige Verhalten der kulturellen Männer im Liebesleben verantwortlich zu machen. Es klingt wenig anmutend und überdies paradox, aber es muß doch gesagt werden, daß, wer im Liebesleben wirklich frei und damit auch glücklich werden soll, den Respekt vor dem Weibe überwunden, sich mit der Vorstellung des Inzests mit Mutter oder Schwester befreundet haben muß. Wer sich dieser Anforderung gegenüber einer ernsthaften Selbstprüfung unterwirft, wird ohne Zweifel in sich finden, daß er den Sexualakt im Grunde doch als etwas Erniedrigendes beurteilt, was nicht nur leiblich befleckt und verunreinigt. Die Entstehung dieser Wertung, die er sich gewiß nicht gerne bekennt, wird er nur in jener Zeit seiner Jugend suchen können, in welcher seine sinnliche Strömung bereits stark entwickelt, ihre Befriedigung aber am fremden Objekt fast ebenso verboten war wie die am inzestuösen.
Die Frauen stehen in unserer Kulturwelt unter einer ähnlichen Nachwirkung ihrer Erziehung und überdies unter der Rückwirkung des Verhaltens der Männer. Es ist für sie natürlich ebensowenig günstig, wenn ihnen der Mann nicht mit seiner vollen Potenz entgegentritt, wie wenn die anfängliche Überschätzung der Verliebtheit nach der Besitzergreifung von Geringschätzung abgelöst wird. Von einem Bedürfnis nach Erniedrigung des Sexualobjekts ist bei der Frau wenig zu bemerken; im Zusammenhange damit steht es gewiß, wenn sie auch etwas der Sexualüberschätzung beim Manne Ähnliches in der Regel nicht zustande bringt. Die lange Abhaltung von der Sexualität und das Verweilen der Sinnlichkeit in der Phantasie hat für sie aber eine andere bedeutsame Folge. Sie kann dann oft die Verknüpfung der sinnlichen Betätigung mit dem Verbot nicht mehr auflösen und erweist sich als psychisch impotent, d. h. frigid, wenn ihr solche Betätigung endlich gestattet wird. Daher rührt bei vielen Frauen das Bestreben, das Geheimnis noch bei erlaubten Beziehungen eine Weile festzuhalten, bei anderen die Fähigkeit, normal zu empfinden, sobald die Bedingung des Verbots in einem geheimen Liebesverhältnis wiederhergestellt ist; dem Manne untreu, sind sie imstande, dem Liebhaber eine Treue zweiter Ordnung zu bewahren.
Ich meine, die Bedingung des Verbotenen im weiblichen Liebesleben ist dem Bedürfnis nach Erniedrigung des Sexualobjekts beim Manne gleichzustellen. Beide sind Folgen des langen Aufschubes zwischen Geschlechtsreife und Sexualbetätigung, den die Erziehung aus kulturellen Gründen fordert. Beide suchen die psychische Impotenz aufzuheben, welche aus dem Nichzusammentreffen zärtlicher und sinnlicher Regungen resultiert. Wenn der Erfolg der nämlichen Ursachen beim Weibe so sehr verschieden von dem beim Manne ausfällt, so läßt sich dies vielleicht auf einen anderen Unterschied im Verhalten der beiden Geschlechter zurückführen. Das kulturelle Weib pflegt das Verbot der Sexualbetätigung während der Wartezeit nicht zu überschreiten und erwirbt so die innige Verknüpfung zwischen Verbot und Sexualität. Der Mann durchbricht zumeist dieses Verbot unter der Bedingung der Erniedrigung des Objekts und nimmt daher diese Bedingung in sein späteres Liebesleben mit.
Angesichts der in der heutigen Kulturwelt so lebhaften Bestrebungen nach einer Reform des Sexuallebens ist es nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß die psychoanalytische Forschung Tendenzen so wenig kennt wie irgendeine andere. Sie will nichts anderes als Zusammenhänge aufdecken, indem sie Offenkundiges auf Verborgenes zurückführt. Es soll ihr dann recht sein, wenn die Reformen sich ihrer Ermittlungen bedienen, um Vorteilhafteres an Stelle des Schädlichen zu setzen. Sie kann aber nicht vorhersagen, ob andere Institutionen nicht andere, vielleicht schwerere Opfer zur Folge haben müßten.
3
Die Tatsache, daß die kulturelle Zügelung des Liebeslebens eine allgemeinste Erniedrigung der Sexualobjekte mit sich bringt, mag uns veranlassen, unseren Blick von den Objekten weg auf die Triebe selbst zu lenken. Der Schaden der anfänglichen Versagung des Sexualgenusses äußert sich darin, daß dessen spätere Freigebung in der Ehe nicht mehr voll befriedigend wirkt. Aber auch die uneingeschränkte Sexualfreiheit von Anfang an führt zu keinem besseren Ergebnis. Es ist leicht festzustellen, daß der psychische Wert des Liebesbedürfnisses sofort sinkt, sobald ihm die Befriedigung bequem gemacht wird. Es bedarf eines Hindernisses, um die Libido in die Höhe zu treiben, und wo die natürlichen Widerstände gegen die Befriedigung nicht ausreichen, haben die Menschen zu allen Zeiten konventionelle eingeschaltet, um die Liebe genießen zu können. Dies gilt für Individuen wie für Völker. In Zeiten, in denen die Liebesbefriedigung keine Schwierigkeiten fand, wie etwa während des Niederganges der antiken Kultur, wurde die Liebe wertlos, das Leben leer, und es bedurfte starker Reaktionsbildungen, um die unentbehrlichen Affektwerte wiederherzustellen. In diesem Zusammenhange kann man behaupten, daß die asketische Strömung des Christentums für die Liebe psychische Wertungen geschaffen hat, die ihr das heidnische Altertum nie verleihen konnte. Zur höchsten Bedeutung gelangte sie bei den asketischen Mönchen, deren Leben fast allein von dem Kampfe gegen die libidinöse Versuchung ausgefüllt war.
Man ist gewiß zunächst geneigt, die Schwierigkeiten, die sich hier ergeben, auf allgemeine Eigenschaften unserer organischen Triebe zurückzuführen. Es ist gewiß auch allgemein richtig, daß die psychische Bedeutung eines Triebes mit seiner Versagung steigt. Man versuche es, eine Anzahl der allerdifferenziertesten Menschen gleichmäßig dem Hungern auszusetzen. Mit der Zunahme des gebieterischen Nahrungsbedürfnisses werden alle individuellen Differenzen sich verwischen und an ihrer Statt die uniformen Äußerungen des einen ungestillten Triebes auftreten. Aber trifft es auch zu, daß mit der Befriedigung eines Triebes sein psychischer Wert allgemein so sehr herabsinkt? Man denke z. B. an das Verhältnis des Trinkers zum Wein. Ist es nicht richtig, daß dem Trinker der Wein immer die gleiche toxische Befriedigung bietet, die man mit der erotischen so oft in der Poesie verglichen hat und auch vom Standpunkte der wissenschaftlichen Auffassung vergleichen darf? Hat man je davon gehört, daß der Trinker genötigt ist, sein Getränk beständig zu wechseln, weil ihm das gleichbleibende bald nicht mehr schmeckt? Im Gegenteil, die Gewöhnung knüpft das Band zwischen dem Manne und der Sorte Wein, die er trinkt, immer enger. Kennt man beim Trinker ein Bedürfnis, in ein Land zu gehen, in dem der Wein teurer oder der Weingenuß verboten ist, um seiner sinkenden Befriedigung durch die Einschiebung solcher Erschwerungen aufzuhelfen? Nichts von alldem. Wenn man die Äußerungen unserer großen Alkoholiker, z. B. Böcklins, über ihr Verhältnis zum Wein anhört [Fußnote]G. Floerke (1902, 16)., es klingt wie die reinste Harmonie, ein Vorbild einer glücklichen Ehe. Warum ist das Verhältnis des Liebenden zu seinem Sexualobjekt so sehr anders?
Ich glaube, man müßte sich, so befremdend es auch klingt, mit der Möglichkeit beschäftigen, daß etwas in der Natur des Sexualtriebes selbst dem Zustandekommen der vollen Befriedigung nicht günstig ist. Aus der langen und schwierigen Entwicklungsgeschichte des Triebes heben sich sofort zwei Momente hervor, die man für solche Schwierigkeit verantwortlich machen könnte. Erstens ist infolge des zweimaligen Ansatzes zur Objektwahl mit Dazwischenkunft der Inzestschranke das endgültige Objekt des Sexualtriebes nie mehr das ursprüngliche, sondern nur ein Surrogat dafür. Die Psychoanalyse hat uns aber gelehrt: wenn das ursprüngliche Objekt einer Wunschregung infolge von Verdrängung verlorengegangen ist, so wird es häufig durch eine unendliche Reihe von Ersatzobjekten vertreten, von denen doch keines voll genügt. Dies mag uns die Unbeständigkeit in der Objektwahl, den »Reizhunger« erklären, der dem Liebesleben der Erwachsenen so häufig eignet.
Zweitens wissen wir, daß der Sexualtrieb anfänglich in eine große Reihe von Komponenten zerfällt – vielmehr aus einer solchen hervorgeht –, von denen nicht alle in dessen spätere Gestaltung aufgenommen werden können, sondern vorher unterdrückt oder anders verwendet werden müssen. Es sind vor allem die koprophilen Triebanteile, die sich als unverträglich mit unserer ästhetischen Kultur erwiesen, wahrscheinlich, seitdem wir durch den aufrechten Gang unser Riechorgan von der Erde abgehoben haben; ferner ein gutes Stück der sadistischen Antriebe, die zum Liebesleben gehören. Aber alle solche Entwicklungsvorgänge betreffen nur die oberen Schichten der komplizierten Struktur. Die fundamentellen Vorgänge, welche die Liebeserregung liefern, bleiben ungeändert. Das Exkrementelle ist allzu innig und untrennbar mit dem Sexuellen verwachsen, die Lage der Genitalien – inter urinas et faeces – bleibt das bestimmende unveränderliche Moment. Man könnte hier, ein bekanntes Wort des großen Napoleon variierend, sagen: die Anatomie ist das Schicksal. Die Genitalien selbst haben die Entwicklung der menschlichen Körperformen zur Schönheit nicht mitgemacht, sie sind tierisch geblieben, und so ist auch die Liebe im Grunde heute ebenso animalisch, wie sie es von jeher war. Die Liebestriebe sind schwer erziehbar, ihre Erziehung ergibt bald zuviel, bald zuwenig. Das, was die Kultur aus ihnen machen will, scheint ohne fühlbare Einbuße an Lust nicht erreichbar, die Fortdauer der unverwerteten Regungen gibt sich bei der Sexualtätigkeit als Unbefriedigung zu erkennen.
So müßte man sich denn vielleicht mit dem Gedanken befreunden, daß eine Ausgleichung der Ansprüche des Sexualtriebes mit den Anforderungen der Kultur überhaupt nicht möglich ist, daß Verzicht und Leiden sowie in weitester Ferne die Gefahr des Erlöschens des Menschengeschlechts infolge seiner Kulturentwicklung nicht abgewendet werden können. Diese trübe Prognose ruht allerdings auf der einzigen Vermutung, daß die kulturelle Unbefriedigung die notwendige Folge gewisser Besonderheiten ist, welche der Sexualtrieb unter dem Drucke der Kultur angenommen hat. Die nämliche Unfähigkeit des Sexualtriebes, volle Befriedigung zu ergeben, sobald er den ersten Anforderungen der Kultur unterlegen ist, wird aber zur Quelle der großartigsten Kulturleistungen, welche durch immer weitergehende Sublimierung seiner Triebkomponenten bewerkstelligt werden. Denn welches Motiv hätten die Menschen, sexuelle Triebkräfte anderen Verwendungen zuzuführen, wenn sich aus denselben bei irgendeiner Verteilung volle Lustbefriedigung ergeben hätte? Sie kämen von dieser Lust nicht wieder los und brächten keinen weiteren Fortschritt zustande. So scheint es, daß sie durch die unausgleichbare Differenz zwischen den Anforderungen der beiden Triebe – des sexuellen und des egoistischen – zu immer höheren Leistungen befähigt werden, allerdings unter einer beständigen Gefährdung, welcher die Schwächeren gegenwärtig in der Form der Neurose erliegen.
Die Wissenschaft hat weder die Absicht zu schrecken noch zu trösten. Aber ich bin selbst gern bereit zuzugeben, daß so weittragende Schlußfolgerungen wie die obenstehenden auf breiterer Basis aufgebaut sein sollten und daß vielleicht andere Entwicklungseinrichtungen der Menschheit das Ergebnis der hier isoliert behandelten zu korrigieren vermögen.
Über die Berechtigung, von der Neurasthenie einen bestimmten Symptomenkomplex als “Angstneurose” abzutrennen (1895)
Es ist schwierig, etwas Allgemeingültiges von der Neurasthenie auszusagen, solange man diesen Krankheitsnamen all das bedeuten läßt, wofür Beard ihn gebraucht hat. Die Neuropathologie, meine ich, kann nur dabei gewinnen, wenn man den Versuch macht, von der eigentlichen Neurasthenie alle jene neurotischen Störungen abzusondern, deren Symptome einerseits untereinander fester verknüpft sind als mit den typischen neurasthenischen Symptomen (dem Kopfdruck, der Spinalirritation, der Dyspepsie mit Flatulenz und Obstipation), und die anderseits in ihrer Ätiologie und ihrem Mechanismus wesentliche Verschiedenheiten von der typischen neurasthenischen Neurose erkennen lassen. Nimmt man diese Absicht an, so wird man bald ein ziemlich einförmiges Bild der Neurasthenie gewonnen haben. Man wird es dann dahin bringen, schärfer, als es bisher gelungen ist, verschiedene Pseudoneurasthenien (das Bild der organisch vermittelten nasalen Reflexneurose, die nervösen Störungen der Kachexien und der Arteriosklerose, die Vorstadien der progressiven Paralyse und mancher Psychosen) von echter Neurasthenie zu unterscheiden, ferner werden sich – nach Möbius' Vorschlag – manche Status nervosi der hereditär Degenerierten abseits stellen lassen, und man wird auch Gründe finden, manche Neurosen, die man heute Neurasthenie heißt, besonders intermittierender oder periodischer Natur, vielmehr der Melancholie zuzurechnen. Die einschneidendste Veränderung bahnt man aber an, wenn man sich entschließt, von der Neurasthenie jenen Symptomenkomplex abzutrennen, den ich im folgenden beschreiben werde und der die oben aufgestellten Bedingungen in besonders zureichender Weise erfüllt. Die Symptome dieses Komplexes stehen klinisch einander weit näher als den echt neurasthenischen (d. h. sie kommen häufig zusammen vor, vertreten einander im Krankheitsverlauf), und Ätiologie wie Mechanismus dieser Neurose sind grundverschieden von der Ätiologie und dem Mechanismus der echten Neurasthenie, wie sie uns nach solcher Sonderung erübrigt.
Ich nenne diesen Symptomenkomplex »Angstneurose«, weil dessen sämtliche Bestandteile sich um das Hauptsymptom der Angst gruppieren lassen, weil jeder einzelne von ihnen eine bestimmte Beziehung zur Angst besitzt. Ich glaubte, mit dieser Auffassung der Symptome der Angstneurose originell zu sein, bis mir ein interessanter Vortrag von E. Hecker [Fußnote]E. Hecker (1893). – Die Angst wird geradezu unter den Hauptsymptomen der Neurasthenie angeführt in der Studie von Kaan (1893). in die Hände fiel, in welchem ich die nämliche Deutung mit aller wünschenswerten Klarheit und Vollständigkeit dargelegt fand. Hecker löst die von ihm als Äquivalente oder Rudimente des Angstanfalles erkannten Symptome allerdings nicht aus dem Zusammenhange der Neurasthenie, wie ich es beabsichtige; allein dies rührt offenbar daher, daß er auf die Verschiedenheit der ätiologischen Bedingungen hier und dort keine Rücksicht genommen hat. Mit der Kenntnis dieser letzteren Differenz entfällt jeder Zwang, die Angstsymptome mit demselben Namen wie die echt neurasthenischen zu bezeichnen, denn die sonst willkürliche Namengebung hat vor allem den Zweck, uns die Aufstellung allgemeiner Behauptungen zu erleichtern.
I. Die klinische Symptomatologie der Angstneurose
Was ich »Angstneurose« nenne, kommt in vollständiger oder rudimentärer Ausbildung, isoliert oder in Kombination mit anderen Neurosen zur Beobachtung. Die einigermaßen vollständigen und dabei isolierten Fälle sind natürlich diejenigen, welche den Eindruck, daß die Angstneurose klinische Selbständigkeit besitze, besonders unterstützen. In anderen Fällen steht man vor der Aufgabe, aus einem Symptomenkomplex, welcher einer » gemischten Neurose« entspricht, diejenigen herauszuklauben und zu sondern, die nicht der Neurasthenie, Hysterie u. dgl., sondern der Angstneurose zugehören.
Das klinische Bild der Angstneurose umfaßt folgende Symptome:
1) Die allgemeine Reizbarkeit. Diese ist ein häufiges nervöses Symptom, als solches vielen Status nervosi eigen. Ich führe sie hier an, weil sie bei der Angstneurose konstant vorkommt und theoretisch bedeutsam ist. Gesteigerte Reizbarkeit deutet ja stets auf Anhäufung von Erregung oder auf Unfähigkeit, Anhäufung zu ertragen, also auf absolute oder relative Reizanhäufung. Einer besonderen Hervorhebung wert finde ich den Ausdruck dieser gesteigerten Reizbarkeit durch eine Gehörshyperästhesie, eine Überempfindlichkeit gegen Geräusche, welches Symptom sicherlich durch die mitgeborene innige Beziehung zwischen Gehörseindrücken und Erschrecken zu erklären ist. Die Gehörshyperästhesie findet sich häufig als Ursache der Schlaflosigkeit, von welcher mehr als eine Form zur Angstneurose gehört.
2) Die ängstliche Erwartung. Ich kann den Zustand, den ich meine, nicht besser erläutern als durch diesen Namen und einige beigefügte Beispiele. Eine Frau z. B., die an ängstlicher Erwartung leidet, denkt bei jedem Hustenstoße ihres katarrhalisch affizierten Mannes an Influenzapneumonie und sieht im Geiste seinen Leichenzug vorüberziehen. Wenn sie auf dem Wege nach Hause zwei Personen vor ihrem Haustor beisammenstehend sieht, kann sie sich des Gedankens nicht erwehren, daß eines ihrer Kinder aus dem Fenster gestürzt sei; wenn sie die Glocke läuten hört, so bringt man ihr eine Trauerbotschaft u. dgl., während doch in allen diesen Fällen kein besonderer Anlaß zur Verstärkung einer bloßen Möglichkeit vorliegt.
Die ängstliche Erwartung klingt natürlich stetig ins Normale ab, umfaßt alles, was man gemeinhin als »Ängstlichkeit, Neigung zu pessimistischer Auffassung der Dinge« bezeichnet, geht aber so oft als möglich über solche plausible Ängstlichkeit hinaus und ist häufig selbst für den Kranken als eine Art von Zwang erkenntlich. Für eine Form der ängstlichen Erwartung, nämlich für die in bezug auf die eigene Gesundheit, kann man den alten Krankheitsnamen Hypochondrie reservieren. Die Hypochondrie geht nicht immer der Höhe der allgemeinen ängstlichen Erwartung parallel, sie verlangt als Vorbedingung die Existenz von Parästhesien und peinlichen Körperempfindungen, und so wird die Hypochondrie die Form, welche die echten Neurastheniker bevorzugen, sobald sie, was häufig geschieht, der Angstneurose verfallen.
Eine weitere Äußerung der ängstlichen Erwartung dürfte die bei moralisch empfindlicheren Personen so häufige Neigung zur Gewissensangst, zur Skrupulosität und Pedanterie sein, die gleichfalls vom Normalen bis zur Steigerung als Zweifelsucht variiert.
Die ängstliche Erwartung ist das Kernsymptom der Neurose; in ihr liegt auch ein Stück von der Theorie derselben frei zutage. Man kann etwa sagen, daß hier ein Quantum Angst frei flottierend vorhanden ist, welches bei der Erwartung die Auswahl der Vorstellungen beherrscht und jederzeit bereit ist, sich mit irgendeinem passenden Vorstellungsinhalt zu verbinden.
3) Es ist dies nicht die einzige Art, wie die fürs Bewußtsein meist latente, aber konstant lauernde Ängstlichkeit sich äußern kann. Diese kann vielmehr auch plötzlich ins Bewußtsein hereinbrechen, ohne vom Vorstellungsablauf geweckt zu werden, und so einen Angstanfall hervorrufen. Ein solcher Angstanfall besteht entweder einzig aus dem Angstgefühle ohne jede assoziierte Vorstellung oder mit der naheliegenden Deutung der Lebensvernichtung, des »Schlagtreffens«, des drohenden Wahnsinns, oder aber dem Angstgefühle ist irgendwelche Parästhesie beigemengt (ähnlich der hysterischen Aura), oder endlich mit der Angstempfindung ist eine Störung irgend einer oder mehrerer Körperfunktionen, der Atmung, Herztätigkeit, der vasomotorischen Innervation, der Drüsentätigkeit verbunden. Aus dieser Kombination hebt der Patient bald das eine, bald das andere Moment besonders hervor, er klagt über »Herzkrampf«, »Atemnot«, »Schweißausbrüche«, »Heißhunger« u. dgl., und in seiner Darstellung tritt das Angstgefühl häufig ganz zurück oder wird recht unkenntlich als ein »Schlechtwerden«, »Unbehagen« usw. bezeichnet.
4) Interessant und diagnostisch bedeutsam ist nun, daß das Maß der Mischung dieser Elemente im Angstanfalle ungemein variiert und daß nahezu jedes begleitende Symptom den Anfall ebensowohl allein konstituieren kann wie die Angst selbst. Es gibt demnach rudimentäre Angstanfälle und Äquivalente des Angstanfalles, wahrscheinlich alle von der gleichen Bedeutung, die einen großen und bis jetzt wenig gewürdigten Reichtum an Formen zeigen. Das genauere Studium dieser larvierten Angstzustände (Hecker) und ihre diagnostische Trennung von anderen Anfällen dürfte bald zur notwendigen Arbeit für den Neuropathologen werden.
Ich füge hier nur die Liste der mir bekannten Formen des Angstanfalles an:
a) Mit Störungen der Herztätigkeit, Herzklopfen, mit kurzer Arrhythmie, mit länger anhaltender Tachykardie bis zu schweren Schwächezuständen des Herzens, deren Unterscheidung von organischer Herzaffektion nicht immer leicht ist; Pseudoangina pectoris, ein diagnostisch heikles Gebiet!
b) Mit Störungen der Atmung, mehrere Formen von nervöser Dyspnoe, asthmaartigem Anfalle u. dgl. Ich hebe hervor, daß selbst diese Anfälle nicht immer von kenntlicher Angst begleitet sind.
c) Anfälle von Schweißausbrüchen, oft nächtlich.
d) Anfälle von Zittern und Schütteln, die nur zu leicht mit hysterischen verwechselt werden.
e) Anfälle von Heißhunger, oft mit Schwindel verbunden.
f) Anfallsweise auftretende Diarrhöen.
g) Anfälle von lokomotorischem Schwindel.
h) Anfälle von sogenannten Kongestionen, so ziemlich alles, was man vasomotorische Neurasthenie genannt hat.
i) Anfälle von Parästhesien (diese aber selten ohne Angst oder ein ähnliches Unbehagen).
5) Nichts als eine Abart des Angstanfalles ist sehr häufig das nächtliche Aufschrecken ( pavor nocturnus der Erwachsenen), gewöhnlich mit Angst, mit Dyspnoe, Schweiß u. dgl. verbunden. Diese Störung bedingt eine zweite Form von Schlaflosigkeit im Rahmen der Angstneurose. – Es ist mir übrigens unzweifelhaft geworden, daß auch der pavor nocturnus der Kinder eine Form zeigt, die zur Angstneurose gehört. Der hysterische Anstrich, die Verknüpfung der Angst mit der Reproduktion eines hiezu geeigneten Erlebnisses oder Traumes, lassen den pavor nocturnus der Kinder als etwas Besonderes erscheinen; er kommt aber auch rein vor, ohne Traum oder wiederkehrende Halluzination.
6) Eine hervorragende Stellung in der Symptomengruppe der Angstneurose nimmt der » Schwindel« ein, der in seinen leichtesten Formen besser als »Taumel« zu bezeichnen ist, in schwererer Ausbildung als »Schwindelanfall« mit oder ohne Angst zu den folgenschwersten Symptomen der Neurose gehört. Der Schwindel der Angstneurose ist weder ein Drehschwindel, noch läßt er, wie der Ménièresche Schwindel, einzelne Ebenen und Richtungen hervorheben. Er gehört dem lokomotorischen oder koordinatorischen Schwindel an wie der Schwindel bei Augenmuskellähmung; er besteht in einem spezifischen Mißbehagen, begleitet von den Empfindungen, daß der Boden wogt, die Beine versinken, daß es unmöglich ist, sich weiter aufrecht zu halten, und dabei sind die Beine bleischwer, zittern oder knicken ein. Zum Hinstürzen führt dieser Schwindel nie. Dagegen möchte ich behaupten, daß ein solcher Schwindelanfall auch durch einen Anfall von tiefer Ohnmacht vertreten werden kann. Andere ohnmachtartige Zustände bei der Angstneurose scheinen von einem Herzkollaps abzuhängen.
Der Schwindelanfall ist nicht selten von der schlimmsten Art von Angst begleitet, häufig mit Herz- und Atemstörungen kombiniert. Höhenschwindel, Berg- und Abgrundschwindel finden sich nach meinen Beobachtungen gleichfalls bei der Angstneurose häufig vor; auch weiß ich nicht, ob man noch berechtigt ist, nebenher einen vertigo a stomacho laeso anzuerkennen.
7) Auf Grund der chronischen Ängstlichkeit (ängstliche Erwartung) einerseits, der Neigung zum Schwindelangstanfalle anderseits entwickeln sich zwei Gruppen von typischen Phobien, die erste auf die allgemein physiologischen Bedrohungen, die andere auf die Lokomotion bezüglich. Zur ersten Gruppe gehören die Angst vor Schlangen, Gewitter, Dunkelheit, Ungeziefer u. dgl., sowie die typische moralische Überbedenklichkeit, Formen der Zweifelsucht; hier wird die disponible Angst einfach zur Verstärkung von Abneigungen verwendet, die jedem Menschen instinktiv eingepflanzt sind. Gewöhnlich bildet sich eine zwangsartig wirkende Phobie aber erst dann, wenn eine Reminiszenz an ein Erlebnis hinzukommt, bei welchem diese Angst sich äußern konnte, z. B. nachdem der Kranke ein Gewitter im Freien mitgemacht hat. Man tut unrecht, solche Fälle einfach als Fortdauer starker Eindrücke erklären zu wollen; was diese Erlebnisse bedeutsam und ihre Erinnerung dauerhaft macht, ist doch nur die Angst, die damals hervortreten konnte und heute ebenso hervortreten kann. Mit anderen Worten, solche Eindrücke bleiben kräftig nur bei Personen mit »ängstlicher Erwartung«.
Die andere Gruppe enthält die Agoraphobie mit allen ihren Nebenarten, sämtliche charakterisiert durch die Beziehung auf die Lokomotion. Ein vorausgegangener Schwindelanfall findet sich hiebei häufig als Begründung der Phobie; ich glaube nicht, daß man ihn jedesmal postulieren darf. Gelegentlich sieht man, daß nach einem ersten Schwindelanfall ohne Angst die Lokomotion zwar beständig von der Sensation des Schwindels begleitet wird, aber ohne Einschränkung möglich bleibt, daß dieselbe aber unter den Bedingungen des Alleinseins, der engen Straße u. dgl. versagt, wenn einmal sich zum Schwindelanfalle Angst hinzugesellt hat.
Das Verhältnis dieser Phobien zu den Phobien der Zwangsneurose, deren Mechanismus ich in einem früheren Aufsatze [Fußnote]›Die Abwehr-Neuropsychosen‹ (1894 a). in diesem Blatte aufgedeckt habe, ist folgender Art: Die Übereinstimmung liegt darin, daß hier wie dort eine Vorstellung zwangsartig wird durch die Verknüpfung mit einem disponiblen Affekt. Der Mechanismus der Affektversetzung gilt also für beide Arten von Phobien. Bei den Phobien der Angstneurose ist aber 1) dieser Affekt ein monotoner, stets der der Angst; 2) stammt er nicht von einer verdrängten Vorstellung her, sondern erweist sich bei psychologischer Analyse als nicht weiter reduzierbar, wie er auch durch Psychotherapie nicht anfechtbar ist. Der Mechanismus der Substitution gilt also für die Phobien der Angstneurose nicht.
Beiderlei Arten von Phobien (oder Zwangsvorstellungen) kommen häufig nebeneinander vor, obwohl die atypischen Phobien, die auf Zwangsvorstellungen beruhen, nicht notwendig auf dem Boden der Angstneurose erwachsen müssen. Ein sehr häufiger, anscheinend komplizierter Mechanismus stellt sich heraus, wenn bei einer ursprünglich einfachen Phobie der Angstneurose der Inhalt der Phobie durch eine andere Vorstellung substituiert wird, die Substitution also nachträglich zur Phobie hinzukommt. Zur Substitution werden am häufigsten die » Schutzmaßregeln« benützt, die ursprünglich zur Bekämpfung der Phobie versucht worden sind. So entsteht z. B. die Grübelsucht aus dem Bestreben, sich den Gegenbeweis zu liefern, daß man nicht verrückt ist, wie die hypochondrische Phobie behauptet: das Zaudern und Zweifeln, noch vielmehr das Repetieren der folie du doute entspringt dem berechtigten Zweifel in die Sicherheit des eigenen Gedankenablaufes, da man sich doch so hartnäckiger Störung durch die zwangsartige Vorstellung bewußt ist u. dgl. Man kann daher behaupten, daß auch viele Syndrome der Zwangsneurose, wie die folie du doute und Ähnliches, klinisch, wenn auch nicht begrifflich, der Angstneurose zuzurechnen sind [Fußnote]›Obsessions et phobies‹ (1895 c)..
8) Die Verdauungstätigkeit erfährt bei der Angstneurose nur wenige, aber charakteristische Störungen. Sensationen wie Brechneigung und Übligkeiten sind nichts Seltenes, und das Symptom des Heißhungers kann allein oder mit anderen (Kongestionen) einen rudimentären Angstanfall abgeben; als chronische Veränderung, analog der ängstlichen Erwartung, findet man eine Neigung zur Diarrhöe, die zu den seltsamsten diagnostischen Irrtümern Anlaß gegeben hat. Wenn ich nicht irre, ist es diese Diarrhöe, auf welche Möbius (1894) unlängst in einem kleinen Aufsatze die Aufmerksamkeit gelenkt hat. Ich vermute ferner, Peyers reflektorische Diarrhöe, die er von Erkrankungen der Prostata ableitet (Peyer, 1893), ist nichts anderes als diese Diarrhöe der Angstneurose. Eine reflektorische Beziehung wird dadurch vorgetäuscht, daß in der Ätiologie der Angstneurose dieselben Faktoren ins Spiel kommen, die bei der Entstehung von solchen Prostataaffektionen u. dgl. tätig sind.
Das Verhalten der Magendarmtätigkeit bei der Angstneurose zeigt einen scharfen Gegensatz zu der Beeinflussung derselben Funktion bei der Neurasthenie. Mischfälle zeigen oft die bekannte »Abwechslung von Diarrhöe und Verstopfung«. Der Diarrhöe analog ist der Harndrang der Angstneurose.
9) Die Parästhesien, die den Schwindel- oder Angstanfall begleiten können, werden dadurch interessant, daß sie sich, ähnlich wie die Sensationen der hysterischen Aura, zu einer festen Reihenfolge assoziieren; doch finde ich diese assoziierten Empfindungen im Gegensatze zu den hysterischen atypisch und wechselnd. Eine weitere Ähnlichkeit mit der Hysterie wird dadurch erzeugt, daß bei der Angstneurose eine Art von Konversion[Fußnote]Freud: ›Abwehr-Neuropsychosen‹ (1894 a). auf körperliche Sensationen stattfindet, die sonst nach Belieben übersehen werden können, z. B. auf die rheumatischen Muskeln. Eine ganze Anzahl sogenannter Rheumatiker, die übrigens auch als solche nachweisbar sind, leidet eigentlich an – Angstneurose. Neben dieser Steigerung der Schmerzempfindlichkeit habe ich bei einer Anzahl von Fällen der Angstneurose eine Neigung zu Halluzinationen beobachtet, welch letztere sich nicht als hysterische deuten ließen.
10) Mehrere der genannten Symptome, welche den Angstanfall begleiten oder vertreten, kommen auch in chronischer Weise vor. Sie sind dann noch weniger leicht kenntlich, da die sie begleitende ängstliche Empfindung undeutlicher ausfällt als beim Angstanfall. Dies gilt besonders für die Diarrhöe, den Schwindel und die Parästhesien. Wie der Schwindelanfall durch einen Ohnmachtsanfall, so kann der chronische Schwindel durch die andauernde Empfindung großer Hinfälligkeit, Mattigkeit u. dgl. vertreten werden.
II. Vorkommen und Ätiologie der Angstneurose
In manchen Fällen von Angstneurose läßt sich eine Ätiologie überhaupt nicht erkennen. Es ist bemerkenswert, daß in solchen Fällen der Nachweis einer schweren hereditären Belastung selten auf Schwierigkeiten stößt.
Wo man aber Grund hat, die Neurose für eine erworbene zu halten, da findet man bei sorgfältigem, dahin zielendem Examen als ätiologisch wirksame Momente eine Reihe von Schädlichkeiten und Einflüssen aus dem Sexualleben. Dieselben scheinen zunächst mannigfaltiger Natur, lassen aber leicht den gemeinsamen Charakter herausfinden, der ihre gleichartige Wirkung auf das Nervensystem erklärt; sie finden sich ferner entweder allein oder neben anderen banalen Schädlichkeiten, denen man eine unterstützende Wirkung zuschreiben darf. Diese sexuelle Ätiologie der Angstneurose ist so überwiegend häufig nachzuweisen, daß ich mich getraue, für die Zwecke dieser kurzen Mitteilung die Fälle mit zweifelhafter oder andersartiger Ätiologie beiseite zu lassen.
Für die genauere Darstellung der ätiologischen Bedingungen, unter denen die Angstneurose vorkommt, wird es sich empfehlen, Männer und Frauen gesondert zu behandeln. Die Angstneurose stellt sich bei weiblichen Individuen – nun abgesehen von deren Disposition – in folgenden Fällen ein:
a) als virginale Angst oder Angst der Adoleszenten. Eine Anzahl von unzweideutigen Beobachtungen hat mir gezeigt, daß ein erstes Zusammentreffen mit dem sexuellen Problem, eine einigermaßen plötzliche Enthüllung des bisher Verschleierten, z. B. durch den Anblick eines sexuellen Aktes, eine Mitteilung oder Lektüre, bei heranreifenden Mädchen eine Angstneurose hervorrufen kann, die fast in typischer Weise mit Hysterie kombiniert ist;
b) als Angst der Neuvermählten. Junge Frauen, die bei den ersten Kohabitationen anästhetisch geblieben sind, verfallen nicht selten der Angstneurose, die wieder verschwindet, nachdem die Anästhesie normaler Empfindlichkeit Platz gemacht hat. Da die meisten jungen Frauen bei solcher anfänglicher Anästhesie gesund bleiben, bedarf es für das Zustandekommen dieser Angst Bedingungen, die ich auch angeben werde;
c) als Angst der Frauen, deren Männer ejaculatio praecox oder sehr herabgesetzte Potenz zeigen; und
d) deren Männer den coitus interruptus oder reservatus üben. Diese Fälle gehören zusammen, denn man kann sich bei der Analyse einer großen Anzahl von Beispielen leicht überzeugen, daß es nur darauf ankommt, ob die Frau beim Koitus zur Befriedigung gelangt oder nicht. Im letzteren Falle ist die Bedingung für die Entstehung der Angstneurose gegeben. Dagegen bleibt die Frau von der Neurose verschont, wenn der mit ejaculatio praecox behaftete Mann den congressus unmittelbar darauf mit besserem Erfolge wiederholen kann. Der congressus reservatus mittels des Kondoms stellt für die Frau keine Schädlichkeit dar, wenn sie sehr rasch erregbar und der Mann sehr potent ist; im andern Falle steht diese Art des Präventivverkehrs den andern an Schädlichkeit nicht nach. Der coitus interruptus ist fast regelmäßig eine Schädlichkeit; für die Frau wird er es aber nur dann, wenn der Mann ihn rücksichtslos übt, d. h. den Koitus unterbricht, sobald er der Ejakulation nahe ist, ohne sich um den Ablauf der Erregung der Frau zu kümmern. Wartet der Mann im Gegenteile die Befriedigung der Frau ab, so hat ein solcher Koitus für letztere die Bedeutung eines normalen; es erkrankt aber dann der Mann an Angstneurose. Ich habe eine große Anzahl von Beobachtungen gesammelt und analysiert, aus denen obige Sätze hervorgehen;
e) als Angst der Witwen und absichtlich Abstinenten, nicht selten in typischer Kombination mit Zwangsvorstellungen;
f) als Angst im Klimakterium während der letzten großen Steigerung der sexuellen Bedürftigkeit.
Die Fälle c, d und e enthalten die Bedingungen, unter denen die Angstneurose beim weiblichen Geschlecht am häufigsten und am ehesten unabhängig von hereditärer Disposition entsteht. An diesen – heilbaren, erworbenen – Fällen von Angstneurose werde ich den Nachweis zu führen versuchen, daß die aufgefundene sexuelle Schädlichkeit wirklich das ätiologische Moment der Neurose darstellt. Ich will nur vorher auf die sexuellen Bedingungen der Angstneurose bei Männern eingehen. Hier möchte ich folgende Gruppen aufstellen, die sämtlich ihre Analogien bei den Frauen finden.
a) Angst der absichtlich Abstinenten, häufig mit Symptomen der Abwehr (Zwangsvorstellungen, Hysterie) kombiniert. Die Motive, die für absichtliche Abstinenz maßgebend sind, bringen es mit sich, daß eine Anzahl von hereditär Veranlagten, Sonderlingen u. dgl. zu dieser Kategorie zählt.
b) Angst der Männer mit frustraner Erregung (während des Brautstandes), Personen, die (aus Furcht vor den Folgen des sexuellen Verkehrs) sich mit Betasten oder Beschauen des Weibes begnügen. Diese Gruppe von Bedingungen (die übrigens unverändert auf das andere Geschlecht zu übertragen ist – Brautschaft, Verhältnisse mit sexueller Schonung) liefert die reinsten Fälle der Neurose.
c) Angst der Männer, die coitus interruptus üben. Wie schon bemerkt, schädigt der coitus interruptus die Frau, wenn er ohne Rücksicht auf die Befriedigung der Frau geübt wird; er wird aber zur Schädlichkeit für den Mann, wenn dieser, um die Befriedigung der Frau zu erzielen, den Koitus willkürlich dirigiert, die Ejakulation aufschiebt. Auf solche Weise läßt sich verstehen, daß von den Ehepaaren, die im coitus interruptus leben, gewöhnlich nur ein Teil erkrankt. Bei Männern erzeugt der coitus interruptus übrigens nur selten reine Angstneurose, meist eine Vermengung derselben mit Neurasthenie.
d) Angst der Männer im Senium. Es gibt Männer, die wie die Frauen ein Klimakterium zeigen und zur Zeit ihrer abnehmenden Potenz und steigenden Libido Angstneurose produzieren.
Endlich muß ich noch zwei Fälle anschließen, die für beide Geschlechter gelten:
α) Die Neurastheniker infolge von Masturbation verfallen in Angstneurose, sobald sie von ihrer Art der sexuellen Befriedigung ablassen. Diese Personen haben sich besonders unfähig gemacht, die Abstinenz zu ertragen.
Ich bemerke hier als wichtig für das Verständnis der Angstneurose, daß eine irgend bemerkenswerte Ausbildung derselben nur bei potent gebliebenen Männern und bei nicht anästhetischen Frauen zustande kommt. Bei Neurasthenikern, die durch Masturbation bereits schwere Schädigung ihrer Potenz erworben haben, fällt die Angstneurose im Falle der Abstinenz recht dürftig aus und beschränkt sich meist auf Hypochondrie und leichten chronischen Schwindel. Die Frauen sind ja in ihrer Mehrheit als »potent« zu nehmen; eine wirklich impotente, d. h. wirklich anästhetische Frau ist gleichfalls der Angstneurose wenig zugänglich und erträgt die angeführten Schädlichkeiten auffällig gut.
Wieweit man etwa sonst berechtigt ist, konstante Beziehungen zwischen einzelnen ätiologischen Momenten und einzelnen Symptomen aus dem Komplex der Angstneurose anzunehmen, möchte ich hier noch nicht erörtern.
β) Die letzte der anzuführenden ätiologischen Bedingungen scheint zunächst überhaupt nicht sexueller Natur zu sein. Die Angstneurose entsteht, und zwar bei beiden Geschlechtern, auch durch das Moment der Überarbeitung, erschöpfender Anstrengung, z. B. nach Nachtwachen, Krankenpflegen und selbst nach schweren Krankheiten.
Der Haupteinwand gegen meine Aufstellung einer sexuellen Ätiologie der Angstneurose wird wohl dahin lauten: derartige abnorme Verhältnisse des Sexuallebens fänden sich so überaus häufig, daß sie überall zur Hand sein müssen, wo man nach ihnen sucht. Ihr Vorkommen in den angeführten Fällen von Angstneurose beweise also nicht, daß in ihnen die Ätiologie der Neurose aufgedeckt sei. Übrigens sei die Anzahl der Personen, die coitus interruptus u. dgl. treiben, unvergleichlich größer als die Anzahl der mit Angstneurose Behafteten, und die überwiegende Menge der ersteren befände sich bei dieser Schädlichkeit recht wohl.
Ich habe darauf zu erwidern, daß man bei der anerkannt übergroßen Häufigkeit der Neurosen und der Angstneurose speziell ein selten vorkommendes ätiologisches Moment gewiß nicht erwarten dürfe; ferner daß damit geradezu ein Postulat der Pathologie erfüllt sei, wenn sich bei einer ätiologischen Untersuchung das ätiologische Moment noch häufiger nachweisen lasse als dessen Wirkung, da ja für letztere noch andere Bedingungen (Disposition, Summation der spezifischen Ätiologie, Unterstützung durch andere, banale Schädlichkeiten) erfordert werden können; ferner, daß die detaillierte Zergliederung geeigneter Fälle von Angstneurose die Bedeutung des sexuellen Moments ganz unzweideutig erweist. Ich will mich hier aber nur auf das ätiologische Moment des coitus interruptus und auf die Hervorhebung einzelner beweisender Erfahrungen beschränken.
1) Solange die Angstneurose bei jungen Frauen noch nicht konstituiert ist, sondern in Ansätzen hervortritt, die immer wieder spontan verschwinden, läßt sich nachweisen, daß jeder solche Schub der Neurose auf einen Koitus mit mangelnder Befriedigung zurückgeht. Zwei Tage nach dieser Einwirkung, bei wenig resistenten Personen am Tage nachher, tritt regelmäßig der Angst- oder Schwindelanfall auf, an den sich andere Symptome der Neurose schließen, um – bei seltenerem ehelichen Verkehr – wieder miteinander abzuklingen. Eine zufällige Reise des Mannes, ein Aufenthalt im Gebirge, der mit Trennung des Ehepaares verbunden ist, tun gut; die zumeist in erster Linie eingeleitete gynäkologische Behandlung nützt dadurch, daß während ihrer Dauer der eheliche Verkehr aufgehoben ist. Merkwürdigerweise ist der Erfolg der lokalen Behandlung ein vorübergehender, stellt sich die Neurose noch im Gebirge wieder ein, sobald der Mann seinerseits in die Ferien tritt u. dgl. Läßt man als ein dieser Ätiologie kundiger Arzt bei noch nicht konstituierter Neurose den coitus interruptus durch normalen Verkehr ersetzen, so ergibt sich die therapeutische Probe auf die hier aufgestellte Behauptung. Die Angst ist behoben und kehrt ohne neuen, ähnlichen Anlaß nicht wieder.
2) In der Anamnese vieler Fälle von Angstneurose findet man bei Männern wie bei Frauen ein auffälliges Schwanken in der Intensität der Erscheinungen, ja im Kommen und Gehen des ganzen Zustandes. Dieses Jahr war fast ganz gut, das nächstfolgende gräßlich u. dgl., einmal fällt die Besserung zugunsten einer bestimmten Kur aus, die aber beim nächsten Anfalle ganz im Stich gelassen hat u. dgl. m. Erkundigt man sich nun nach Anzahl und Reihenfolge der Kinder und stellt diese Ehechronik dem eigentümlichen Verlauf der Neurose gegenüber, so ergibt sich als einfache Lösung, daß die Perioden von Besserung oder Wohlbefinden mit den Graviditäten der Frau zusammenfallen, während welcher natürlich der Anlaß für den Präventivverkehr entfallen war. Dem Manne aber hatte jene Kur, sei es beim Pfarrer Kneipp oder in der hydrotherapeutischen Anstalt, genützt, nach welcher er seine Frau gravid antraf.
3) Aus der Anamnese der Kranken ergibt sich häufig, daß die Symptome der Angstneurose zu einer bestimmten Zeit die einer andern Neurose, etwa der Neurasthenie, abgelöst und sich an deren Stelle gesetzt haben. Es läßt sich dann ganz regelmäßig nachweisen, daß kurz vor diesem Wechsel des Bildes ein entsprechender Wechsel in der Art der sexuellen Schädigung stattgefunden hat.
Während derartige, nach Belieben zu vermehrende Erfahrungen dem Arzte für eine gewisse Kategorie von Fällen die sexuelle Ätiologie geradezu aufdrängen, lassen sich andere Fälle, die sonst unverständlich blieben, mittels des Schlüssels der sexuellen Ätiologie wenigstens widerspruchslos verstehen und einreihen. Es sind dies jene sehr zahlreichen Fälle, in denen zwar alles vorhanden ist, was wir bei der vorigen Kategorie gefunden haben, die Erscheinungen der Angstneurose einerseits, das spezifische Moment des coitus interruptus anderseits, wo aber noch etwas anderes sich einschiebt, nämlich ein langes Intervall zwischen der vermeintlichen Ätiologie und deren Wirkung und etwa noch ätiologische Momente nicht sexueller Natur. Da ist z. B. ein Mann, der auf die Nachricht vom Tode seines Vaters einen Herzanfall bekommt und von da an der Angstneurose verfallen ist. Der Fall ist nicht zu verstehen, denn der Mann war bisher nicht nervös; der Tod des hochbejahrten Vaters erfolgte keineswegs unter besonderen Umständen, und man wird zugeben, daß das normale, erwartete Ableben eines alten Vaters nicht zu den Erlebnissen gehört, die einen gesunden Erwachsenen krank zu machen pflegen. Vielleicht wird die ätiologische Analyse durchsichtiger, wenn ich hinzunehme, daß dieser Mann seit elf Jahren den coitus interruptus mit Rücksicht auf seine Frau ausübt. Die Erscheinungen sind wenigstens genau die nämlichen, wie sie bei anderen Personen nach kurzer derartiger sexueller Schädigung und ohne Dazwischenkunft eines anderen Traumas auftreten. Ähnlich zu beurteilen ist der Fall einer Frau, deren Angstneurose nach dem Verlust eines Kindes ausbricht, oder des Studenten, der in der Vorbereitung zu seiner letzten Staatsprüfung durch die Angstneurose gestört wird. Ich finde die Wirkung hier wie dort nicht durch die angegebene Ätiologie erklärt. Man muß sich nicht beim Studieren »überarbeiten«, und eine gesunde Mutter pflegt auf den Verlust eines Kindes nur mit normaler Trauer zu reagieren. Vor allem aber würde ich erwarten, daß der Student durch Überarbeitung eine Kephalasthenie, die Mutter in unserem Beispiele eine Hysterie akquirieren sollte. Daß sie beide Angstneurose bekommen, veranlaßt mich, Wert darauf zu legen, daß die Mutter seit acht Jahren im ehelichen coitus interruptus lebt, der Student aber seit drei Jahren ein warmes Liebesverhältnis mit einem »anständigen« Mädchen unterhält, das er nicht schwängern darf.
Diese Ausführungen laufen auf die Behauptung hinaus, daß die spezifische sexuelle Schädlichkeit des coitus interruptus dort, wo sie nicht imstande ist, für sich allein die Angstneurose hervorzurufen, doch wenigstens zu ihrer Erwerbung disponiert. Die Angstneurose bricht dann aus, sobald zur latenten Wirkung des spezifischen Moments die Wirkung einer anderen, banalen Schädlichkeit hinzutritt. Letztere kann das spezifische Moment quantitativ vertreten, aber nicht qualitativ ersetzen. Das spezifische Moment bleibt stets dasjenige, welches die Form der Neurose bestimmt. Ich hoffe, diesen Satz für die Ätiologie der Neurosen auch in größerem Umfang erweisen zu können.
Ferner ist in den letzten Erörterungen die an sich nicht unwahrscheinliche Annahme enthalten, daß eine sexuelle Schädlichkeit wie der coitus interruptus sich durch Summation zur Geltung bringt. Je nach der Disposition des Individuums und der sonstigen Belastung von dessen Nervensystem wird es kürzere oder längere Zeit brauchen, ehe der Effekt dieser Summation sichtbar wird. Die Individuen, welche den coitus interruptus scheinbar ohne Nachteil ertragen, werden in Wirklichkeit durch denselben zu Störungen der Angstneurose disponiert, die irgend einmal spontan oder nach einem banalen, sonst unangemessenen Trauma losbrechen können, gerade wie der chronische Alkoholiker auf dem Wege der Summation endlich eine Zirrhose oder andere Erkrankung entwickelt oder unter dem Einfluß eines Fiebers in ein Delirium verfällt.
III. Ansätze zu einer Theorie der Angstneurose
Die nachstehenden Ausführungen beanspruchen nichts als den Wert eines ersten, tastenden Versuches, dessen Beurteilung die Aufnahme der im vorigen enthaltenen Tatsachen nicht beeinflussen sollte. Die Würdigung dieser »Theorie der Angstneurose« wird ferner noch dadurch erschwert, daß sie bloß einem Bruchstücke aus einer umfassenderen Darstellung der Neurosen entspricht.
In dem bisher über die Angstneurose Vorgebrachten sind bereits einige Anhaltspunkte für einen Einblick in den Mechanismus dieser Neurose enthalten. Zunächst die Vermutung, es dürfte sich um eine Anhäufung von Erregung handeln, sodann die überaus wichtige Tatsache, daß die Angst, die den Erscheinungen der Neurose zugrunde liegt, keine psychische Ableitung zuläßt. Eine solche wäre z. B. vorhanden, wenn sich als Grundlage der Angstneurose ein einmaliger oder wiederholter, berechtigter Schreck fände, der seither die Quelle der Bereitschaft zur Angst abgäbe. Allein dies ist nicht der Fall; durch einen einmaligen Schreck kann zwar eine Hysterie oder eine traumatische Neurose erworben werden, nie aber eine Angstneurose. Ich habe, da sich unter den Ursachen der Angstneurose der coitus interruptus so sehr in den Vordergrund drängt, anfangs gemeint, die Quelle der kontinuierlichen Angst könnte in der beim Akte jedesmal sich wiederholenden Furcht liegen, die Technik könnte mißglücken und demnach Konzeption erfolgen. Ich habe aber gefunden, daß dieser Gemütszustand der Frau oder des Mannes während des coitus interruptus für die Entstehung der Angstneurose gleichgültig ist, daß die gegen die Folgen einer möglichen Konzeption im Grunde gleichgültigen Frauen der Neurose ebenso ausgesetzt sind wie die vor dieser Möglichkeit Schaudernden und daß es nur darauf ankam, welcher Teil bei dieser sexuellen Technik seine Befriedigung einbüßte.
Einen weiteren Anhaltspunkt bietet die noch nicht erwähnte Beobachtung, daß in ganzen Reihen von Fällen die Angstneurose mit der deutlichsten Verminderung der sexuellen Libido, der psychischen Lust einhergeht, so daß die Kranken auf die Eröffnung, ihr Leiden rühre von »ungenügender Befriedigung«, regelmäßig antworten: Das sei unmöglich, gerade jetzt sei alles Bedürfnis bei ihnen erloschen. Aus all diesen Andeutungen, daß es sich um Anhäufung von Erregung handle, daß die Angst, welche solcher angehäuften Erregung wahrscheinlich entspricht, somatischer Herkunft sei, so daß also somatische Erregung angehäuft werde, ferner daß diese somatische Erregung sexueller Natur sei und daß eine Abnahme der psychischen Beteiligung an den Sexualvorgängen nebenher gehe – alle diese Andeutungen, sage ich, begünstigen die Erwartung, der Mechanismus der Angstneurose sei in der Ablenkung der somatischen Sexualerregung vom Psychischen und einer dadurch verursachten abnormen Verwendung dieser Erregung zu suchen.
Man kann sich diese Vorstellung vom Mechanismus der Angstneurose klarer machen, wenn man folgende Betrachtung über den Sexualvorgang akzeptiert, die sich zunächst auf den Mann bezieht. Im geschlechtsreifen männlichen Organismus wird – wahrscheinlich kontinuierlich – die somatische Sexualerregung produziert, die periodisch zu einem Reiz für das psychische Leben wird. Schalten wir, um unsere Vorstellungen darüber besser zu fixieren, ein, daß diese somatische Sexualerregung sich als Druck auf die mit Nervenendigungen versehene Wandung der Samenbläschen äußert, so wird diese viszerale Erregung zwar kontinuierlich anwachsen, aber erst von einer gewissen Höhe an imstande sein, den Widerstand der eingeschalteten Leitung bis zur Hirnrinde zu überwinden und sich als psychischer Reiz zu äußern. Dann aber wird die in der Psyche vorhandene sexuelle Vorstellungsgruppe mit Energie ausgestattet, und es entsteht der psychische Zustand libidinöser Spannung, welcher den Drang nach Aufhebung dieser Spannung mit sich bringt. Eine solche psychische Entlastung ist nur auf dem Wege möglich, den ich als spezifische oder adäquate Aktion bezeichnen will. Diese adäquate Aktion besteht für den männlichen Sexualtrieb in einem komplizierten spinalen Reflexakt, der die Entlastung jener Nervenendigungen zur Folge hat, und in allen psychisch zu leistenden Vorbereitungen für die Auslösung dieses Reflexes. Etwas anderes als die adäquate Aktion würde nichts fruchten, denn die somatische Sexualerregung setzt sich, nachdem sie einmal den Schwellenwert erreicht hat, kontinuierlich in psychische Erregung um; es muß durchaus dasjenige geschehen, was die Nervenendigungen von dem auf ihnen lastenden Druck befreit, somit die ganze derzeit vorhandene somatische Erregung aufhebt und der subkortikalen Leitung gestattet, ihren Widerstand herzustellen.
Ich werde es mir versagen, kompliziertere Fälle des Sexualvorganges in ähnlicher Weise darzustellen. Ich will nur noch die Behauptung aufstellen, daß dieses Schema im wesentlichen auch auf die Frau zu übertragen ist, trotz aller das Problem verwirrenden, artifiziellen Verzögerung und Verkümmerung des weiblichen Geschlechtstriebes. Es ist auch bei der Frau eine somatische Sexualerregung anzunehmen und ein Zustand, in dem diese Erregung psychischer Reiz wird, Libido, und den Drang nach der spezifischen Aktion hervorruft, an welche sich das Wollustgefühl knüpft. Nur ist man bei der Frau nicht imstande anzugeben, was etwa der Entspannung der Samenbläschen hier analog wäre.
In den Rahmen dieser Darstellung des Sexualvorganges läßt sich nun sowohl die Ätiologie der echten Neurasthenie als die der Angstneurose eintragen. Neurasthenie entsteht jedesmal, wenn die adäquate (Aktion) Entlastung durch eine minder adäquate ersetzt wird, der normale Koitus unter den günstigsten Bedingungen also durch eine Masturbation oder spontane Pollution; zur Angstneurose aber führen alle Momente, welche die psychische Verarbeitung der somatischen Sexualerregung verhindern. Die Erscheinungen der Angstneurose kommen zustande, indem die von der Psyche abgelenkte somatische Sexualerregung sich subkortikal, in ganz und gar nicht adäquaten Reaktionen ausgibt.
Ich will es nun versuchen, die vorhin angegebenen ätiologischen Bedingungen der Angstneurose daraufhin zu prüfen, ob sie den von mir aufgestellten gemeinsamen Charakter erkennen lassen. Als erstes ätiologisches Moment habe ich für den Mann die absichtliche Abstinenz angeführt. Abstinenz besteht in der Versagung der spezifischen Aktion, die sonst auf die Libido erfolgt. Eine solche Versagung wird zwei Konsequenzen haben können, nämlich, daß die somatische Erregung sich anhäuft, und dann zunächst, daß sie auf andere Wege abgelenkt wird, auf denen ihr eher Entladung winkt als auf dem Wege über die Psyche. Es wird also die Libido endlich sinken und die Erregung subkortikal als Angst sich äußern. Wo die Libido nicht verringert wird oder die somatische Erregung auf kurzem Wege in Pollutionen verausgabt wird oder infolge der Zurückdrängung wirklich versiegt, da entsteht eben alles andere als Angstneurose. Auf solche Weise führt die Abstinenz zur Angstneurose. Die Abstinenz ist aber auch das Wirksame an der zweiten ätiologischen Gruppe, der frustranen Erregung. Der dritte Fall, der des rücksichtsvollen coitus reservatus, wirkt dadurch, daß er die psychische Bereitschaft für den Sexualablauf stört, indem er neben der Bewältigung des Sexualaffekts eine andere, ablenkende, psychische Aufgabe einführt. Auch durch diese psychische Ablenkung schwindet allmählich die Libido, der weitere Verlauf ist dann derselbe wie im Falle der Abstinenz. Die Angst im Senium (Klimakterium der Männer) erfordert eine andere Erklärung. Hier läßt die Libido nicht nach; es findet aber, wie während des Klimakteriums der Weiber, eine solche Steigerung in der Produktion der somatischen Erregung statt, daß die Psyche für die Bewältigung derselben sich als relativ insuffizient erweist.
Keine größeren Schwierigkeiten bereitet die Subsumierung der ätiologischen Bedingungen bei der Frau unter den angeführten Gesichtspunkt. Der Fall der virginalen Angst ist besonders klar. Hier sind eben die Vorstellungsgruppen noch nicht genug entwickelt, mit denen sich die somatische Sexualerregung verknüpfen soll. Bei der anästhetischen Neuvermählten tritt die Angst nur dann auf, wenn die ersten Kohabitationen ein genügendes Maß von somatischer Erregung wecken. Wo die lokalen Zeichen solcher Erregtheit (wie spontane Reizempfindung, Harndrang u. dgl.) fehlen, da bleibt auch die Angst aus. Der Fall der ejaculatio praecox, des coitus interruptus erklärt sich ähnlich wie beim Manne dadurch, daß für den psychisch unbefriedigenden Akt allmählich die Libido schwindet, während die dabei wachgerufene Erregung subkortikal ausgegeben wird. Die Herstellung einer Entfremdung zwischen dem Somatischen und dem Psychischen im Ablauf der Sexualerregung erfolgt beim Weibe rascher und ist schwerer zu beseitigen als beim Manne. Der Fall der Witwenschaft und der gewollten Abstinenz sowie der Fall des Klimakteriums erledigt sich beim Weibe wohl ebenso wie beim Manne, doch kommt für den Fall der Abstinenz gewiß noch die absichtliche Verdrängung des sexuellen Vorstellungskreises hinzu, zu welcher die mit der Versuchung kämpfende abstinente Frau sich häufig entschließen muß, und ähnlich mag in der Zeit der Menopause der Abscheu wirken, den die alternde Frau gegen die übergroß gewordene Libido empfindet.
Auch die beiden zuletzt angeführten ätiologischen Bedingungen scheinen sich ohne Schwierigkeit einzuordnen.
Die Angstneigung der neurasthenisch gewordenen Masturbanten erklärt sich daraus, daß diese Personen so leicht in den Zustand der »Abstinenz« geraten, nachdem sie sich so lange gewöhnt hatten, jeder kleinen Quantität somatischer Erregung eine allerdings fehlerhafte Abfuhr zu schaffen. Endlich läßt der letzte Fall, die Entstehung der Angstneurose durch schwere Krankheit, Überarbeitung, erschöpfende Krankenpflege u. dgl., in Anlehnung an die Wirkungsweise des coitus interruptus die zwanglose Deutung zu, die Psyche werde hier durch Ablenkung insuffizient zur Bewältigung der somatischen Sexualerregung, einer Aufgabe, die ihr ja kontinuierlich obliegt. Man weiß, wie tief unter solchen Bedingungen die Libido sinken kann, und man hat hier ein schönes Beispiel einer Neurose, die zwar keine sexuelle Ätiologie, aber doch einen sexuellen Mechanismus erkennen läßt.
Die hier entwickelte Auffassung stellt die Symptome der Angstneurose gewissermaßen als Surrogate der unterlassenen spezifischen Aktion auf die Sexualerregung dar. Ich erinnere zur weiteren Unterstützung derselben daran, daß auch beim normalen Koitus die Erregung sich nebstbei als Atembeschleunigung, Herzklopfen, Schweißausbruch, Kongestion u. dgl. ausgibt. Im entsprechenden Angstanfalle unserer Neurose hat man die Dyspnoe, das Herzklopfen u. dgl. des Koitus isoliert und gesteigert vor sich.
Es könnte noch gefragt werden: Warum gerät denn das Nervensystem unter solchen Umständen, bei psychischer Unzulänglichkeit zur Bewältigung der Sexualerregung, in den eigentümlichen Affektzustand der Angst? Darauf ist andeutungsweise zu erwidern: Die Psyche gerät in den Affekt der Angst, wenn sie sich unfähig fühlt, eine von außen nahende Aufgabe (Gefahr) durch entsprechende Reaktion zu erledigen; sie gerät in die Neurose der Angst, wenn sie sich unfähig merkt, die endogen entstandene (Sexual-) Erregung auszugleichen. Sie benimmt sich also, als projizierte sie diese Erregung nach außen. Der Affekt und die ihm entsprechende Neurose stehen in fester Beziehung zueinander, der erstere ist die Reaktion auf eine exogene, die letztere die Reaktion auf die analoge endogene Erregung. Der Affekt ist ein rasch vorübergehender Zustand, die Neurose ein chronischer, weil die exogene Erregung wie ein einmaliger Stoß, die endogene wie eine konstante Kraft wirkt. Das Nervensystem reagiert in der Neurose gegen eine innere Erregungsquelle wie in dem entsprechenden Affekt gegen eine analoge äußere.
IV. Beziehung zu anderen Neurosen
Es erübrigen noch einige Bemerkungen über die Beziehungen der Angstneurose zu den anderen Neurosen nach Vorkommen und innerer Verwandtschaft.
Die reinsten Fälle von Angstneurose sind auch meist die ausgeprägtesten. Sie finden sich bei potenten jugendlichen Individuen, bei einheitlicher Ätiologie und nicht zu langem Bestande des Krankseins.
Häufiger ist allerdings das gleichzeitige und gemeinsame Vorkommen von Angstsymptomen mit solchen der Neurasthenie, Hysterie, der Zwangsvorstellungen, der Melancholie. Wollte man sich durch solche klinische Vermengung abhalten lassen, die Angstneurose als eine selbständige Einheit anzuerkennen, so müßte man konsequenterweise auch auf die mühsam erworbene Trennung von Hysterie und Neurasthenie wieder verzichten.
Für die Analyse der »gemischten Neurosen« kann ich den wichtigen Satz vertreten: Wo sich eine gemischte Neurose vorfindet, da läßt sich eine Vermengung mehrerer spezifischer Ätiologien nachweisen.
Eine solche Vielheit ätiologischer Momente, die eine gemischte Neurose bedingt, kann bloß zufällig zustande kommen, etwa indem eine neu hinzutretende Schädlichkeit ihre Wirkungen zu denen einer früher vorhandenen addiert; z. B. eine Frau, die von jeher Hysterika war, tritt zu einer gewissen Zeit ihrer Ehe in den coitus reservatus ein und erwirbt jetzt zu ihrer Hysterie eine Angstneurose; ein Mann, der bisher masturbiert hatte und neurasthenisch wurde, wird Bräutigam, erregt sich bei seiner Braut, und jetzt gesellt sich zur Neurasthenie eine frische Angstneurose hinzu.
In anderen Fällen ist die Mehrheit ätiologischer Momente keine zufällige, sondern das eine derselben hat das andere mit zur Wirkung gebracht; z. B. eine Frau, mit welcher ihr Mann coitus reservatus ohne Rücksicht auf ihre Befriedigung übt, sieht sich genötigt, die peinliche Erregung nach einem solchen Akt durch Masturbation zu beenden; sie zeigt infolgedessen nicht reine Angstneurose, sondern daneben Symptome von Neurasthenie; eine zweite Frau wird unter derselben Schädlichkeit mit lüsternen Bildern zu kämpfen haben, deren sie sich erwehren will, und wird auf solche Weise durch den coitus interruptus nebst der Angstneurose Zwangsvorstellungen erwerben; eine dritte Frau endlich wird infolge des coitus interruptus die Neigung zu ihrem Manne einbüßen, eine andere Neigung erwerben, welche sie sorgfältig geheimhält, und wird infolgedessen ein Gemenge von Angstneurose und Hysterie zeigen.
In einer dritten Kategorie von gemischten Neurosen ist der Zusammenhang der Symptome ein noch innigerer, indem die nämliche ätiologische Bedingung gesetzmäßig und gleichzeitig beide Neurosen hervorruft. So z. B. erzeugt die plötzliche sexuelle Aufklärung, die wir bei der virginalen Angst gefunden haben, immer auch Hysterie; die allermeisten Fälle von absichtlicher Abstinenz verknüpfen sich von Anfang an mit echten Zwangsvorstellungen; der coitus interruptus der Männer scheint mir niemals reine Angstneurose provozieren zu können, sondern stets eine Vermengung derselben mit Neurasthenie u. dgl.
Es geht aus diesen Erörterungen hervor, daß man die ätiologischen Bedingungen des Vorkommens noch unterscheiden muß von den spezifischen ätiologischen Momenten der Neurosen. Erstere, z. B. der coitus interruptus, die Masturbation, die Abstinenz, sind noch vieldeutig und können ein jedes verschiedene Neurosen produzieren; erst die aus ihnen abstrahierten ätiologischen Momente, wie inadäquate Entlastung, psychische Unzulänglichkeit, Abwehr mit Substitution, haben eine unzweideutige und spezifische Beziehung zur Ätiologie der einzelnen großen Neurosen.
Ihrem inneren Wesen nach zeigt die Angstneurose die interessantesten Übereinstimmungen und Verschiedenheiten gegen die anderen großen Neurosen, besonders gegen Neurasthenie und Hysterie. Mit der Neurasthenie teilt sie den einen Hauptcharakter, daß die Erregungsquelle, der Anlaß zur Störung, auf somatischem Gebiete liegt, anstatt wie bei Hysterie und Zwangsneurose auf psychischem. Im übrigen läßt sich eher eine Art von Gegensätzlichkeit zwischen den Symptomen der Neurasthenie und denen der Angstneurose erkennen, die etwa in den Schlagworten: Anhäufung – Verarmung an Erregung ihren Ausdruck fände. Diese Gegensätzlichkeit hindert nicht, daß sich die beiden Neurosen miteinander vermengen, zeigt sich aber doch darin, daß die extremsten Formen in beiden Fällen auch die reinsten sind.
Mit der Hysterie zeigt die Angstneurose zunächst eine Reihe von Übereinstimmungen in der Symptomatologie, deren genauere Würdigung noch aussteht. Das Auftreten der Erscheinungen als Dauersymptome oder in Anfällen, die auraartig gruppierten Parästhesien, die Hyperästhesien und Druckpunkte, die sich bei gewissen Surrogaten des Angstanfalles, bei der Dyspnoe und dem Herzanfalle finden, die Steigerung der etwa organisch berechtigten Schmerzen (durch Konversion): – diese und andere gemeinschaftliche Züge lassen sogar vermuten, daß manches, was man der Hysterie zurechnet, mit mehr Fug und Recht zur Angstneurose geschlagen werden dürfte. Geht man auf den Mechanismus der beiden Neurosen ein, soweit er sich bis jetzt hat durchschauen lassen, so ergeben sich Gesichtspunkte, welche die Angstneurose geradezu als das somatische Seitenstück zur Hysterie erscheinen lassen. Hier wie dort Anhäufung von Erregung – worin vielleicht die vorhin geschilderte Ähnlichkeit der Symptome gegründet ist; – hier wie dort eine psychische Unzulänglichkeit, der zufolge abnorme somatische Vorgänge zustande kommen. Hier wie dort tritt an Stelle einer psychischen Verarbeitung eine Ablenkung der Erregung in das Somatische ein; der Unterschied liegt bloß darin, daß die Erregung, in deren Verschiebung sich die Neurose äußert, bei der Angstneurose eine rein somatische (die somatische Sexualerregung), bei der Hysterie eine psychische (durch Konflikt hervorgerufene) ist. Es kann daher nicht wundernehmen, daß Hysterie und Angstneurose sich gesetzmäßig miteinander kombinieren wie bei der » virginalen Angst« oder der » sexuellen Hysterie«, daß die Hysterie eine Anzahl von Symptomen einfach der Angstneurose entlehnt u. dgl. Diese innigen Beziehungen der Angstneurose zur Hysterie geben auch ein neues Argument ab, um die Trennung der Angstneurose von der Neurasthenie zu fordern; denn verweigert man diese, so kann man auch die so mühsam erworbene und für die Theorie der Neurosen so unentbehrliche Unterscheidung von Neurasthenie und Hysterie nicht mehr aufrechterhalten.
Wien, im Dezember 1894
Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität (1920)
I
Die weibliche Homosexualität, gewiß nicht weniger häufig als die männliche, aber doch weit weniger lärmend als diese, ist nicht nur vom Strafgesetz übergangen, sondern auch von der psychoanalytischen Forschung vernachlässigt worden. Die Mitteilung eines einzelnen, nicht allzu grellen Falles, in dem es möglich wurde, dessen psychische Entstehungsgeschichte fast lückenlos und mit voller Sicherheit zu erkennen, mag daher einen gewissen Anspruch auf Beachtung erheben. Wenn die Darstellung nur die allgemeinsten Umrisse der Geschehnisse und die aus dem Falle gewonnenen Einsichten bringt und alle charakteristischen Einzelheiten unterschlägt, auf denen die Deutung ruht, so ist diese Einschränkung durch die von einem frischen Fall geforderte ärztliche Diskretion leicht erklärlich.
Ein achtzehnjähriges, schönes und kluges Mädchen aus sozial hochstehender Familie hat das Mißfallen und die Sorge seiner Eltern durch die Zärtlichkeit erweckt, mit der sie eine etwa zehn Jahr ältere Dame »aus der Gesellschaft« verfolgt. Die Eltern behaupten, daß diese Dame trotz ihres vornehmen Namens nichts anderes sei als eine Kokotte. Es sei von ihr bekannt, daß sie bei einer verheirateten Freundin lebt, mit der sie intime Beziehungen unterhält, während sie gleichzeitig in lockeren Liebesverhältnissen zu einer Anzahl von Männern steht. Das Mädchen bestreitet diese üble Nachrede nicht, läßt sich aber durch sie in der Verehrung der Dame nicht beirren, obwohl es ihr an Sinn für das Schickliche und Reinliche keineswegs gebricht. Kein Verbot und keine Überwachung hält sie ab, jede der spärlichen Gelegenheiten zum Beisammensein mit der Geliebten auszunützen, alle ihre Lebensgewohnheiten auszukundschaften, stundenlang vor ihrem Haustor oder an Trambahnhaltestellen auf sie zu warten, ihr Blumen zu schicken u. dgl. Es ist offenkundig, daß dies eine Interesse bei dem Mädchen alle anderen verschlungen hat. Sie kümmert sich nicht um ihre weitere Ausbildung, legt keinen Wert auf gesellschaftlichen Verkehr und mädchenhafte Vergnügungen und hält nur den Umgang mit einigen Freundinnen aufrecht, die ihr als Vertraute oder als Helferinnen dienen können. Wie weit es zwischen ihrer Tochter und jener zweifelhaften Dame gekommen ist, ob die Grenzen einer zärtlichen Schwärmerei bereits überschritten worden sind, wissen die Eltern nicht. Ein Interesse für junge Männer und Wohlgefallen an deren Huldigungen haben sie an dem Mädchen nie bemerkt; dagegen sind sie sich klar darüber, daß diese gegenwärtige Neigung für eine Frau nur in erhöhtem Maße fortsetzt, was sich in den letzten Jahren für andere weibliche Personen angezeigt und den Argwohn sowie die Strenge des Vaters wachgerufen hatte.
Zwei Stücke ihres Benehmens, scheinbar einander gegensätzlich, wurden dem Mädchen von den Eltern am stärksten verübelt. Daß sie keine Bedenken trug, sich öffentlich in belebten Straßen mit der anrüchigen Geliebten zu zeigen, und also die Rücksicht auf ihren eigenen Ruf vernachlässigte und daß sie kein Mittel der Täuschung, keine Ausrede und keine Lüge verschmähte, um die Zusammenkünfte mit ihr zu ermöglichen und zu decken. Also zuviel Offenheit in dem einen, vollste Verstellung im anderen Falle. Eines Tages traf es sich, was ja unter diesen Umständen einmal geschehen mußte, daß der Vater seiner Tochter in Begleitung jener ihm bekannt gewordenen Dame auf der Straße begegnete. Er ging mit einem zornigen Blick, der nichts Gutes ankündigte, an den beiden vorüber. Unmittelbar darauf riß sich das Mädchen los und stürzte sich über die Mauer in den dort nahen Einschnitt der Stadtbahn. Sie büßte diesen unzweifelhaft ernst gemeinten Selbstmordversuch mit einem langen Krankenlager, aber zum Glück mit nur geringer dauernder Schädigung. Nach ihrer Herstellung fand sie die Situation für ihre Wünsche günstiger als zuvor. Die Eltern wagten es nicht mehr, ihr ebenso entschieden entgegenzutreten, und die Dame, die sich bis dahin gegen ihre Werbung spröde ablehnend verhalten hatte, war durch einen so unzweideutigen Beweis ernster Leidenschaft gerührt und begann sie freundlicher zu behandeln.
Etwa ein halbes Jahr nach diesem Unfall wendeten sich die Eltern an den Arzt und stellten ihm die Aufgabe, ihre Tochter zur Norm zurückzubringen. Der Selbstmordversuch des Mädchens hatte ihnen wohl gezeigt, daß die Machtmittel der häuslichen Disziplin nicht imstande waren, die vorliegende Störung zu bewältigen. Es ist aber gut, hier die Stellung des Vaters und die der Mutter gesondert zu behandeln. Der Vater war ein ernsthafter, respektabler Mann, im Grunde sehr zärtlich, durch seine angenommene Strenge den Kindern etwas entfremdet. Sein Benehmen gegen die einzige Tochter wurde allzusehr durch Rücksichten auf seine Frau, ihre Mutter, bestimmt. Als er zuerst von den homosexuellen Neigungen der Tochter Kenntnis bekam, wallte er zornig auf und wollte sie durch Drohungen unterdrücken; er mag damals zwischen verschiedenen, gleich peinlichen Auffassungen geschwankt haben, ob er ein lasterhaftes, ein entartetes oder ein geisteskrankes Wesen in ihr sehen sollte. Auch nach dem Unfall brachte er es nicht zur Höhe jener überlegenen Resignation, welcher einer unserer ärztlichen Kollegen bei einer irgendwie ähnlichen Entgleisung in seiner Familie durch die Rede Ausdruck gab: »Es ist eben ein Malheur wie ein anderes!« Die Homosexualität seiner Tochter hatte etwas, was seine vollste Erbitterung weckte. Er war entschlossen, sie mit allen Mitteln zu bekämpfen; die in Wien so allgemein verbreitete Geringschätzung der Psychoanalyse hielt ihn nicht ab, sich an sie um Hilfe zu wenden. Wenn dieser Weg versagte, hatte er noch immer das stärkste Gegenmittel im Rückhalt; eine rasche Verheiratung sollte die natürlichen Instinkte des Mädchens wachrufen und dessen unnatürliche Neigungen ersticken.
Die Einstellung der Mutter des Mädchens war nicht so leicht zu durchschauen. Sie war eine noch jugendliche Frau, die dem Anspruch, selbst durch Schönheit zu gefallen, offenbar nicht entsagen wollte. Es war nur klar, daß sie die Schwärmerei ihrer Tochter nicht so tragisch nahm und sich keineswegs so sehr darüber entrüstete wie der Vater. Sie hatte sogar durch längere Zeit das Vertrauen des Mädchens in betreff ihrer Verliebtheit in jene Dame genossen; ihre Parteinahme dagegen schien wesentlich durch die schädliche Offenheit bestimmt, mit der die Tochter ihre Gefühle vor aller Welt kundgab. Sie war selbst durch mehrere Jahre neurotisch gewesen, erfreute sich großer Schonung von Seiten ihres Mannes, behandelte ihre Kinder recht ungleichmäßig, war eigentlich hart gegen die Tochter und überzärtlich mit ihren drei Knaben, von denen der jüngste ein Spätling war, gegenwärtig noch nicht drei Jahre alt. Bestimmteres über ihren Charakter zu erfahren war nicht leicht, denn infolge von Motiven, die erst später verstanden werden können, hielten die Angaben der Patientin über ihre Mutter stets eine Reserve ein, von der im Falle des Vaters keine Rede war.
Der Arzt, der die analytische Behandlung des Mädchens übernehmen sollte, hatte mehrere Gründe, sich unbehaglich zu fühlen. Er fand nicht die Situation vor, welche die Analyse anfordert und in der sie allein ihre Wirksamkeit erproben kann. Diese Situation sieht in ihrer idealen Ausprägung bekanntlich so aus, daß jemand, der sonst sein eigener Herr ist, an einem inneren Konflikt leidet, den er allein nicht zu Ende bringen kann, daß er dann zum Analytiker kommt, es ihm klagt und ihn um seine Hilfeleistung bittet. Der Arzt arbeitet dann Hand in Hand mit dem einen Anteil der krankhaft entzweiten Persönlichkeit gegen den anderen Partner des Konflikts. Andere Situationen als diese sind für die Analyse mehr oder minder ungünstig, fügen zu den inneren Schwierigkeiten des Falles neue hinzu. Situationen wie die des Bauherrn, der beim Architekten eine Villa nach seinem Geschmack und Bedürfnis bestellt, oder des frommen Stifters, der sich vom Künstler ein Heiligenbild malen läßt, in dessen Ecke dann sein eigenes Porträt als Anbetender Platz findet, sind mit den Bedingungen der Psychoanalyse im Grunde nicht vereinbar. Es kommt zwar alle Tage vor, daß sich ein Ehemann an den Arzt mit der Information wendet: »Meine Frau ist nervös, sie verträgt sich darum schlecht mit mir; machen Sie sie gesund, so daß wir wieder eine glückliche Ehe führen können.« Aber es stellt sich oft genug heraus, daß ein solcher Auftrag unausführbar ist, das heißt, daß der Arzt nicht das Ergebnis herstellen kann, wegen dessen der Mann die Behandlung wünschte. Sowie die Frau von ihren neurotischen Hemmungen befreit ist, setzt sie die Trennung der Ehe durch, deren Erhaltung nur unter der Voraussetzung ihrer Neurose möglich war. Oder Eltern verlangen, daß man ihr Kind gesund mache, welches nervös und unfügsam ist. Sie verstehen unter einem gesunden Kind ein solches, das den Eltern keine Schwierigkeiten bereitet, an dem sie ihre Freude haben können. Die Herstellung des Kindes mag dem Arzt gelingen, aber es geht nach der Genesung um so entschiedener seine eigenen Wege, und die Eltern sind jetzt weit mehr unzufrieden als vorher. Kurz, es ist nicht gleichgültig, ob ein Mensch aus eigenem Streben in die Analyse kommt oder darum, weil andere ihn dahin bringen, ob er selbst seine Veränderung wünscht oder nur seine Angehörigen, die ihn lieben oder von denen man solche Liebe erwarten sollte.
Als weitere ungünstige Momente waren die Tatsachen zu bewerten, daß das Mädchen ja keine Kranke war – sie litt nicht aus inneren Gründen, beklagte sich nicht über ihren Zustand – und daß die gestellte Aufgabe nicht darin bestand, einen neurotischen Konflikt zu lösen, sondern die eine Variante der genitalen Sexualorganisation in die andere überzuführen. Diese Leistung, die Beseitigung der genitalen Inversion oder Homosexualität, ist meiner Erfahrung niemals leicht erschienen. Ich habe vielmehr gefunden, daß sie nur unter besonders günstigen Umständen gelingt, und auch dann bestand der Erfolg wesentlich darin, daß man der homosexuell eingeengten Person den bis dahin versperrten Weg zum anderen Geschlechte frei machen konnte, also ihre volle bisexuelle Funktion wiederherstellte. Es lag dann in ihrem Belieben, ob sie den anderen, von der Gesellschaft geächteten Weg veröden lassen wollte, und in einzelnen Fällen hat sie es auch so getan. Man muß sich sagen, daß auch die normale Sexualität auf einer Einschränkung der Objektwahl beruht, und im allgemeinen ist das Unternehmen, einen vollentwickelten Homosexuellen in einen Heterosexuellen zu verwandeln, nicht viel aussichtsreicher als das umgekehrte, nur daß man dies letztere aus guten praktischen Gründen niemals versucht.
Die Erfolge der psychoanalytischen Therapie in der Behandlung der allerdings sehr vielgestaltigen Homosexualität sind der Zahl nach wirklich nicht bedeutsam. In der Regel vermag der Homosexuelle sein Lustobjekt nicht aufzugeben; es gelingt nicht, ihn zu überzeugen, daß er die Lust, auf die er hier verzichtet, im Falle der Umwandlung am anderen Objekt wiederfinden würde. Wenn er sich überhaupt in Behandlung begibt, so haben ihn zumeist äußere Motive dazu gedrängt, die sozialen Nachteile und Gefahren seiner Objektwahl, und solche Komponenten des Selbsterhaltungstriebes erweisen sich als zu schwach im Kampfe gegen die Sexualstrebungen. Man kann dann bald seinen geheimen Plan aufdecken, sich durch den eklatanten Mißerfolg dieses Versuches die Beruhigung zu schaffen, daß er das Möglichste gegen seine Sonderartung getan habe und sich ihr nun mit gutem Gewissen überlassen könne. Wo die Rücksicht auf geliebte Eltern und Angehörige den Versuch zur Heilung motiviert hat, da liegt der Fall etwas anders. Es sind dann wirklich libidinöse Strebungen vorhanden, die zur homosexuellen Objektwahl gegensätzliche Energien entwickeln können, aber deren Kraft reicht selten aus. Nur wo die Fixierung an das gleichgeschlechtliche Objekt noch nicht stark genug geworden ist oder wo sich erhebliche Ansätze und Reste der heterosexuellen Objektwahl vorfinden, also bei noch schwankender oder bei deutlich bisexueller Organisation, darf die Prognose der psychoanalytischen Therapie günstiger gestellt werden.
Aus diesen Gründen vermied ich es durchaus, den Eltern die Erfüllung ihres Wunsches in Aussicht zu stellen. Ich erklärte mich bloß bereit dazu, das Mädchen durch einige Wochen oder Monate sorgfältig zu studieren, um mich danach über die Aussichten einer Beeinflussung durch Fortsetzung der Analyse äußern zu können. In einer ganzen Anzahl von Fällen zerlegt sich ja die Analyse in zwei deutlich gesonderte Phasen; in einer ersten verschafft sich der Arzt die notwendigen Kenntnisse vom Patienten, macht ihn mit den Voraussetzungen und Postulaten der Analyse bekannt und entwickelt vor ihm die Konstruktion der Entstehung seines Leidens, zu welcher er sich auf Grund des von der Analyse gelieferten Materials berechtigt glaubt. In einer zweiten Phase bemächtigt sich der Patient selbst des ihm vorgelegten Stoffes, arbeitet an ihm, erinnert von dem bei ihm angeblich Verdrängten, was er erinnern kann, und trachtet, das andere in einer Art von Neubelebung zu wiederholen. Dabei kann er die Aufstellungen des Arztes bestätigen, ergänzen und richtigstellen. Erst während dieser Arbeit erfährt er durch die Überwindung von Widerständen die innere Veränderung, die man erzielen will, und gewinnt die Überzeugungen, die ihn von der ärztlichen Autorität unabhängig machen. Nicht immer sind diese beiden Phasen im Ablauf der analytischen Kur scharf voneinander geschieden; es kann dies nur geschehen, wenn der Widerstand bestimmte Bedingungen einhält. Aber wo es der Fall ist, kann man den Vergleich mit zwei entsprechenden Abschnitten einer Reise heranziehen. Der erste umfaßt alle notwendigen, heute so komplizierten und schwer zu erfüllenden Vorbereitungen, bis man endlich die Fahrkarte gelöst, den Perron betreten und seinen Platz im Wagen erobert hat. Man hat jetzt das Recht und die Möglichkeit, in das ferne Land zu reisen, aber man ist nach all diesen Vorarbeiten noch nicht dort, eigentlich dem Ziele um keinen Kilometer näher gerückt. Es gehört noch dazu, daß man die Reise selbst von einer Station zur anderen zurücklege, und dieses Stück der Reise ist mit der zweiten Phase gut vergleichbar.
Die Analyse bei meiner nunmehrigen Patientin verlief nach diesem Zweiphasenschema, wurde aber nicht über den Beginn der zweiten Phase hinaus fortgeführt. Eine besondere Konstellation des Widerstandes ermöglichte es trotzdem, die volle Bestätigung meiner Konstruktionen und eine im großen und ganzen zureichende Einsicht in den Entwicklungsgang ihrer Inversion zu gewinnen. Ehe ich aber die Ergebnisse der Analyse bei ihr darlege, muß ich einige Punkte erledigen, die ich entweder schon selbst gestreift oder die sich dem Leser als die ersten Gegenstände seines Interesses aufgedrängt haben.
Ich hatte die Prognose zum Teil davon abhängig gemacht, wie weit das Mädchen in der Befriedigung seiner Leidenschaft gekommen war. Die Auskunft, die ich während der Analyse erhielt, schien in dieser Hinsicht günstig. Bei keinem der Objekte ihrer Schwärmerei hatte sie mehr als einzelne Küsse und Umarmungen genossen, ihre Genitalkeuschheit, wenn man so sagen darf, war unversehrt geblieben. Die Halbweltdame gar, die die jüngsten und weitaus stärksten Gefühle bei ihr erweckt hatte, war spröde gegen sie geblieben, hatte ihr nie eine höhere Gunst gegönnt als die, ihr die Hand küssen zu dürfen. Das Mädchen machte wahrscheinlich eine Tugend aus ihrer Not, wenn sie immer wieder die Reinheit ihrer Liebe und ihre physische Abneigung gegen einen Sexualverkehr betonte. Vielleicht hatte sie aber nicht ganz unrecht, wenn sie von ihrer hehren Geliebten rühmte, daß sie, von vornehmer Herkunft und nur durch widrige Familienverhältnisse in ihre gegenwärtige Position gedrängt, sich auch hier noch ein ganzes Stück Würde bewahrt habe. Denn diese Dame pflegte ihr bei jedem Zusammentreffen zuzureden, ihre Neigung von ihr und von den Frauen überhaupt abzuwenden, und hatte sich bis zum Selbstmordversuch immer nur streng abweisend gegen sie benommen.
Ein zweiter Punkt, den ich alsbald aufzuklären versuchte, betraf die eigenen Motive des Mädchens, auf welche die analytische Behandlung sich etwa stützen konnte. Sie versuchte mich nicht durch die Behauptung zu täuschen, daß es ihr ein dringendes Bedürfnis sei, von ihrer Homosexualität befreit zu werden. Sie könne sich im Gegenteil gar keine andere Verliebtheit vorstellen, aber, setzte sie hinzu, der Eltern wegen wolle sie den therapeutischen Versuch ehrlich unterstützen, denn sie empfinde es sehr schwer, den Eltern solchen Kummer zu bereiten. Auch diese Äußerung mußte ich zunächst als günstig auffassen; ich konnte nicht ahnen, welche unbewußte Affekteinstellung sich hinter ihr verbarg. Was hier dann später zum Vorschein kam, hat die Gestaltung der Kur und deren vorzeitigen Abbruch entscheidend beeinflußt.
Nichtanalytische Leser werden längst die Beantwortung zweier anderer Fragen ungeduldig erwarten. Zeigte dieses homosexuelle Mädchen deutliche somatische Charaktere des anderen Geschlechts, und erwies sie sich als ein Fall von angeborener oder von erworbener (später entwickelter) Homosexualität ?
Ich verkenne die Bedeutung nicht, welche der ersteren Frage zukommt. Nur möge man diese Bedeutung nicht übertreiben und zu ihren Gunsten die Tatsachen verdunkeln, daß vereinzelte sekundäre Merkmale des anderen Geschlechts bei normalen menschlichen Individuen überhaupt sehr häufig vorkommen und daß sehr gut ausgeprägte somatische Charaktere des anderen Geschlechtes sich an Personen finden können, deren Objektwahl keine Abänderung im Sinne einer Inversion erfahren hat. Daß also, anders ausgedrückt, bei beiden Geschlechtern das Maß des physischen Hermaphroditismus von dem des psychischen in hohem Grade unabhängig ist. Als Einschränkung der beiden Sätze ist hinzuzufügen, daß diese Unabhängigkeit beim Manne deutlicher ist als beim Weibe, wo die körperliche und die seelische Ausprägung des entgegengesetzten Geschlechtscharakters eher regelmäßig zusammentreffen. Ich bin aber doch nicht in der Lage, die erste der hier gestellten Fragen für meinen Fall befriedigend zu beantworten. Der Psychoanalytiker pflegt sich ja eine eingehende körperliche Untersuchung seiner Patienten in bestimmten Fällen zu versagen. Eine auffällige Abweichung vom körperlichen Typus des Weibes bestand jedenfalls nicht, auch keine menstruale Störung. Wenn das schöne und wohlgebildete Mädchen den hohen Wuchs des Vaters und eher scharfe als mädchenhaft weiche Gesichtszüge zeigte, so mag man darin Andeutungen einer somatischen Männlichkeit erblicken. Auf männliches Wesen konnte man auch einige ihrer intellektuellen Eigenschaften beziehen, so die Schärfe ihres Verständnisses und die kühle Klarheit ihres Denkens, insoweit sie nicht unter der Herrschaft ihrer Leidenschaft stand. Doch sind diese Unterscheidungen eher konventionell als wissenschaftlich berechtigt. Bedeutsamer ist gewiß, daß sie in ihrem Verhalten zu ihrem Liebesobjekt durchaus den männlichen Typus angenommen hatte, also die Demut und großartige Sexualüberschätzung des liebenden Mannes zeigte, den Verzicht auf jede narzißtische Befriedigung, die Bevorzugung des Liebens vor dem Geliebtwerden. Sie hatte also nicht nur ein weibliches Objekt gewählt, sondern auch eine männliche Einstellung zu ihm gewonnen.
Die andere Frage, ob ihr Fall einer angeborenen oder einer erworbenen Homosexualität entsprach, soll durch die ganze Entwicklungsgeschichte ihrer Störung beantwortet werden. Dabei wird sich ergeben, inwieweit diese Fragestellung selbst unfruchtbar und unangemessen ist.
II
Auf eine so weitschweifige Einleitung kann ich nur eine ganz knappe und übersichtliche Darstellung der Libidogeschichte dieses Falles folgen lassen. Das Mädchen hatte in den Kinderjahren die normale Einstellung des weiblichen Ödipuskomplexes [Fußnote]Ich sehe in der Einführung des Terminus »Elektrakomplex« keinen Fortschritt oder Vorteil und möchte denselben nicht befürworten in wenig auffälliger Weise durchgemacht, später auch begonnen, den Vater durch den um wenig älteren Bruder zu ersetzen. Sexuelle Traumen in früher Jugend wurden weder erinnert noch durch die Analyse aufgedeckt. Die Vergleichung der Genitalien des Bruders mit den eigenen, die etwa zu Beginn der Latenzzeit (zu fünf Jahren oder etwas früher) vorfiel, hinterließ ihr einen starken Eindruck und war in ihren Nachwirkungen weit zu verfolgen. Auf frühinfantile Onanie deutete sehr wenig, oder die Analyse kam nicht so weit, um diesen Punkt aufzuklären. Die Geburt eines zweiten Bruders, als sie zwischen fünf und sechs Jahren alt war, äußerte keinen besonderen Einfluß auf ihre Entwicklung. In den Schul- und Vorpubertätsjahren wurde sie allmählich mit den Tatsachen des Sexuallebens bekannt und empfing dieselben mit dem normal zu nennenden, auch im Ausmaße nicht übertriebenen Gemenge von Lüsternheit und erschreckter Ablehnung. Alle diese Auskünfte erscheinen recht mager, ich kann auch nicht dafür einstehen, daß sie vollständig sind. Vielleicht war die Jugendgeschichte doch weit reichhaltiger; ich weiß es nicht. Die Analyse brach, wie gesagt, nach kurzer Zeit ab und lieferte darum eine Anamnese, die nicht viel verläßlicher ist als die anderen, mit gutem Recht beanstandeten Anamnesen von Homosexuellen. Das Mädchen war auch niemals neurotisch gewesen, brachte nicht ein hysterisches Symptom in die Analyse mit, so daß sich die Anlässe zur Durchforschung ihrer Kindergeschichte nicht so bald ergeben konnten.
Mit dreizehn und vierzehn Jahren zeigte sie eine nach dem Urteil aller übertrieben starke, zärtliche Vorliebe für einen kleinen, noch nicht dreijährigen Jungen, den sie in einem Kinderpark regelmäßig sehen konnte. Sie nahm sich des Kindes so herzlich an, daß daraus eine langdauernde freundschaftliche Beziehung zu den Eltern des Kleinen entstand. Man darf aus diesem Vorfall schließen, daß sie damals von einem starken Wunsche, selbst Mutter zu sein und ein Kind zu haben, beherrscht war. Aber kurze Zeit nachher wurde ihr der Knabe gleichgültig, und sie begann ein Interesse für reife, doch noch jugendliche Frauen zu zeigen, dessen Äußerungen ihr bald eine empfindliche Züchtigung von seiten des Vaters zuzogen.
Es wurde über jeden Zweifel sichergestellt, daß diese Wandlung zeitlich mit einem Ereignis in der Familie zusammenfällt, von dem wir demnach die Aufklärung der Wandlung erwarten dürfen. Vorher war ihre Libido auf Mütterlichkeit eingestellt gewesen, nachher war sie eine in reifere Frauen verliebte Homosexuelle, was sie seitdem geblieben ist. Dies für unser Verständnis so bedeutsame Ereignis war eine neue Gravidität der Mutter und die Geburt eines dritten Bruders, als sie etwa sechzehn Jahre alt war.
Der Zusammenhang, den ich nun im folgenden aufdecken werde, ist kein Produkt meiner Kombinationsgabe; er ist mir durch so vertrauenswürdiges analytisches Material nahegelegt worden, daß ich objektive Sicherheit für ihn beanspruchen kann. Insbesondere hat eine Reihe von ineinandergreifenden, leicht deutbaren Träumen für ihn entschieden.
Die Analyse ließ unzweideutig erkennen, daß die geliebte Dame ein Ersatz für die – Mutter war. Nun war diese selbst allerdings keine Mutter, aber sie war auch nicht die erste Liebe des Mädchens gewesen. Die ersten Objekte ihrer Neigung seit der Geburt des letzten Bruders waren wirklich Mütter, Frauen zwischen dreißig und fünfunddreißig Jahren, die sie mit ihren Kindern in der Sommerfrische oder im Familienverkehr der Großstadt kennenlernte. Die Bedingung der Mütterlichkeit wurde später fallengelassen, weil sie sich mit einer anderen, die immer gewichtiger wurde, in der Realität nicht gut vertrug. Die besonders intensive Bindung an die letzte Geliebte, die »Dame«, hatte noch einen anderen Grund, den das Mädchen eines Tages ohne Mühe auffand. Sie wurde durch die schlanke Erscheinung, die strenge Schönheit und das rauhe Wesen der Dame an ihren eigenen, etwas älteren Bruder gemahnt. Das endlich gewählte Objekt entsprach also nicht nur ihrem Frauen-, sondern auch ihrem Männerideal, es vereinigte die Befriedigung der homosexuellen Wunschrichtung mit jener der heterosexuellen. Bekanntlich hat die Analyse männlicher Homosexueller in zahlreichen Fällen das nämliche Zusammentreffen gezeigt, ein Wink, sich Wesen und Entstehung der Inversion nicht allzu einfach vorzustellen und die durchgängige Bisexualität des Menschen nicht aus dem Auge zu verlieren [Fußnote]Vgl. I. Sadger (1914).
Wie soll man es aber verstehen, daß das Mädchen gerade durch die Geburt eines späten Kindes, als sie selbst schon reif geworden war und eigene starke Wünsche hatte, bewogen wurde, ihre leidenschaftliche Zärtlichkeit der Gebärerin dieses Kindes, ihrer eigenen Mutter, zuzuwenden und an einer Vertreterin der Mutter zum Ausdruck zu bringen? Nach allem, was man sonst weiß, hätte man das Gegenteil erwarten sollen. Die Mütter pflegen sich unter solchen Umständen vor ihren beinahe heiratsfähigen Töchtern zu genieren, die Töchter haben für die Mutter ein aus Mitleid, Verachtung und Neid gemischtes Gefühl bereit, das nichts dazu beiträgt, die Zärtlichkeit für die Mutter zu steigern. Das Mädchen unserer Beobachtung hatte überhaupt wenig Grund, für ihre Mutter zärtlich zu empfinden. Der selbst noch jugendlichen Frau war diese rasch erblühte Tochter eine unbequeme Konkurrentin, sie setzte sie hinter den Knaben zurück, schränkte ihre Selbständigkeit möglichst ein und wachte besonders eifrig darüber, daß sie dem Vater ferne blieb. Ein Bedürfnis nach einer liebenswürdigeren Mutter mag also bei dem Mädchen von jeher gerechtfertigt gewesen sein; warum es aber damals und in Gestalt einer verzehrenden Leidenschaft aufflackerte, ist nicht begreiflich.
Die Erklärung ist die folgende: Das Mädchen befand sich in der Phase der Pubertätsauffrischung des infantilen Ödipuskomplexes, als die Enttäuschung über sie kam. Hell bewußt wurde ihr der Wunsch, ein Kind zu haben, und zwar ein männliches; daß es ein Kind vom Vater und dessen Ebenbild sein sollte, durfte ihr Bewußtes nicht erfahren. Aber da geschah es, daß nicht sie das Kind bekam, sondern die im Unbewußten gehaßte Konkurrentin, die Mutter. Empört und erbittert wendete sie sich vom Vater, ja vom Manne überhaupt ab. Nach diesem ersten großen Mißerfolg verwarf sie ihre Weiblichkeit und strebte nach einer anderen Unterbringung ihrer Libido.
Sie benahm sich dabei ganz ähnlich wie viele Männer, die nach einer ersten peinlichen Erfahrung dauernd mit dem treulosen Geschlecht der Frauen zerfallen und Weiberfeinde werden. Von einer der anziehendsten und unglücklichsten fürstlichen Persönlichkeiten unserer Lebenszeit wird erzählt, daß er darum homosexuell geworden, weil ihn die verlobte Braut mit einem fremden Gesellen hintergangen hatte. Ich weiß nicht, ob dies historische Wahrheit ist, aber ein Stück psychologischer Wahrheit steckt hinter diesem Gerücht. Unser aller Libido schwankt normalerweise lebenslang zwischen dem männlichen und dem weiblichen Objekt; der Junggeselle gibt seine Freundschaften auf, wenn er heiratet, und kehrt zum Stammtisch zurück, wenn seine Ehe schal geworden ist. Freilich, wo die Schwankung so gründlich und so endgültig ist, da richtet sich unsere Vermutung auf ein besonderes Moment, welches die eine oder die andere Seite entscheidend begünstigt, vielleicht nur auf den geeigneten Zeitpunkt gewartet hat, um die Objektwahl nach seinem Sinne durchzusetzen.
Unser Mädchen hatte also nach jener Enttäuschung den Wunsch nach dem Kinde, die Liebe zum Manne und die weibliche Rolle überhaupt von sich gewiesen. Und nun hätte offenbar sehr Verschiedenartiges geschehen können; was wirklich geschah, war das Extremste. Sie wandelte sich zum Manne um und nahm die Mutter an Stelle des Vaters zum Liebesobjekt [Fußnote]Es ist gar nicht so selten, daß man eine Liebesbeziehung dadurch abbricht, daß man sich selbst mit dem Objekt derselben identifiziert, was einer Art von Regression zum Narzißmus entspricht. Nachdem dies erfolgt ist, kann man bei neuerlicher Objektwahl leicht das dem früheren entgegengesetzte Geschlecht mit seiner Libido besetzen.. Ihre Beziehung zur Mutter war sicherlich von Anfang an ambivalent gewesen, es gelang leicht, die frühere Liebe zur Mutter wiederzubeleben und mit ihrer Hilfe die gegenwärtige Feindseligkeit gegen die Mutter zur Überkompensation zu bringen. Da mit der realen Mutter wenig anzufangen war, ergab sich aus der geschilderten Gefühlsumsetzung das Suchen nach einem Mutterersatz, an dem man mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit hängen konnte [Fußnote]Die hier beschriebenen Verschiebungen der Libido sind gewiß jedem Analytiker aus der Erforschung der Anamnesen von Neurotikern bekannt. Nur fallen sie bei diesen letzteren im zarten Kindesalter, zur Zeit der Frühblüte des Liebeslebens vor, bei unserem ganz und gar nicht neurotischen Mädchen vollziehen sie sich in den ersten Jahren nach der Pubertät, übrigens gleichfalls völlig unbewußt. Ob dieses zeitliche Moment sich nicht einstmals als sehr bedeutsam herausstellen wird?.
Ein praktisches Motiv aus ihren realen Beziehungen zur Mutter kam als »Krankheitsgewinn« noch hinzu. Die Mutter legte selbst noch Wert darauf, von Männern hofiert und gefeiert zu werden. Wenn sie also homosexuell wurde, der Mutter die Männer überließ, ihr sozusagen »auswich«, räumte sie etwas aus dem Wege, was bisher an der Mißgunst der Mutter Schuld getragen hatte [Fußnote]Da ein solches Ausweichen bisher unter den Ursachen der Homosexualität wie im Mechanismus der Libidofixierung überhaupt keine Erwähnung gefunden hat, will ich eine ähnliche analytische Beobachtung hier anschließen, die durch einen besonderen Umstand interessant ist. Ich habe einst zwei Zwillingsbrüder kennengelernt, die beide mit starken libidinösen Impulsen begabt waren. Der eine von ihnen hatte viel Glück bei Frauen und ließ sich in ungezählte Verhältnisse mit Frauen und Mädchen ein. Der andere war zuerst auf demselben Wege, aber dann wurde es ihm unangenehm, dem Bruder ins Gehege zu kommen, infolge seiner Ähnlichkeit bei intimen Anlässen mit ihm verwechselt zu werden, und er half sich dadurch, daß er homosexuell wurde. Er überließ dem Bruder die Frauen und war ihm so »ausgewichen«. Ein andermal behandelte ich einen jüngeren Mann, Künstler und unverkennbar bisexuell angelegt, bei dem sich die Homosexualität gleichzeitig mit einer Arbeitsstörung durchgesetzt hatte. Er floh in einem die Frauen und sein Werk. Die Analyse, die ihn zu beiden zurückführen konnte, wies die Scheu vor dem Vater als das mächtigste psychische Motiv für beide Störungen, eigentlich Entsagungen, nach. In seiner Vorstellung gehörten alle Frauen dem Vater, und er flüchtete zu den Männern aus Ergebenheit, um dem Konflikt mit dem Vater auszuweichen. Solche Motivierung der homosexuellen Objektwahl muß sich häufiger finden lassen; in den Urzeiten des Menschengeschlechts war es wohl so, daß alle Frauen dem Vater und Oberhaupt der Urhorde gehörten. – Bei Geschwistern, die nicht Zwillinge sind, spielt solches Ausweichen auch auf anderen Gebieten als dem der Liebeswahl eine große Rolle. Der ältere Bruder pflegt z. B. Musik und findet dafür Anerkennung, der jüngere, musikalisch weit begabter, bricht trotz seiner Sehnsucht danach das Musikstudium bald ab und ist nicht mehr zu bewegen, ein Instrument zu berühren. Es ist dies ein einzelnes Beispiel für ein sehr häufiges Vorkommen, und die Untersuchung der Motive, die zum Ausweichen anstatt zur Aufnahme der Konkurrenz führen, deckt sehr komplizierte psychische Bedingungen auf..
Die so gewonnene Libidoeinstellung wurde nun gefestigt, als das Mädchen merkte, wie unangenehm sie dem Vater war. Seit jener ersten Züchtigung wegen einer allzu zärtlichen Annäherung an eine Frau wußte sie, womit sie den Vater kränken und wie sie sich an ihm rächen konnte. Sie blieb jetzt homosexuell aus Trotz gegen den Vater. Sie machte sich auch kein Gewissen daraus, ihn auf jede Weise zu hintergehen und zu belügen. Gegen die Mutter war sie ja nur so weit unaufrichtig, als es nötig war, damit der Vater nichts erfahre. Ich hatte den Eindruck, daß sie nach dem Grundsatz der Talion handelte: »Hast du mich betrogen, so mußt du es dir gefallen lassen, daß ich auch dich betrüge.« Auch die auffälligen Unvorsichtigkeiten des sonst raffiniert klugen Mädchens kann ich nicht anders beurteilen. Der Vater mußte doch gelegentlich von ihrem Umgang mit der Dame erfahren, sonst wäre ihr die Rachebefriedigung, die ihr die dringendste war, entgangen. So sorgte sie dafür, indem sie sich mit der Angebeteten öffentlich zeigte, in den Straßen nahe dem Geschäftslokal des Vaters spazierenging und dergleichen. Auch diese Ungeschicklichkeiten geschahen nicht absichtslos. Es ist übrigens merkwürdig, daß beide Eltern sich so benahmen, als ob sie die geheime Psychologie der Tochter verstünden. Die Mutter zeigte sich tolerant, als ob sie das Ausweichen der Tochter als Gefälligkeit würdigte, der Vater raste, als fühlte er die gegen seine Person gerichtete Racheabsicht.
Die letzte Kräftigung erfuhr aber die Inversion des Mädchens, als sie in der »Dame« auf ein Objekt stieß, welches gleichzeitig dem noch am Bruder haftenden Anteil ihrer heterosexuellen Libido Befriedigung bot.
III
Die lineare Darstellung eignet sich wenig zur Beschreibung der verschlungenen und in verschiedenen seelischen Schichten ablaufenden seelischen Vorgänge. Ich bin genötigt, in der Diskussion des Falles innezuhalten und einiges von dem Mitgeteilten zu erweitern und zu vertiefen.
Ich habe erwähnt, daß das Mädchen in ihrem Verhältnis zur verehrten Dame den männlichen Typus der Liebe annahm. Ihre Demut und zärtliche Anspruchslosigkeit, » che poco spera e nulla chiede«, die Seligkeit, wenn ihr gestattet wurde, die Dame ein Stück weit zu begleiten und ihr beim Abschied die Hand zu küssen, die Freude, wenn sie sie als schön rühmen hörte, während die Anerkennung ihrer eigenen Schönheit von fremder Seite ihr gar nichts bedeutete, ihre Pilgerbesuche nach Örtlichkeiten, wo die Geliebte sich vorher einmal aufgehalten hatte, das Verstummen aller weiterreichenden sinnlichen Wünsche: alle diese kleinen Züge entsprachen etwa der ersten schwärmerischen Leidenschaft eines Jünglings für eine gefeierte Künstlerin, die er hoch über sich stehend glaubt und zu der er seinen Blick nur schüchtern zu erheben wagt. Die Übereinstimmung mit einem von mir beschriebenen »Typus der männlichen Objektwahl«, dessen Besonderheiten ich auf die Bindung an die Mutter zurückgeführt habe (1910 h), ging bis in die Einzelheiten. Es konnte auffällig erscheinen, daß sie durch den schlechten Leumund der Geliebten nicht im mindesten abgeschreckt wurde, obwohl ihre eigenen Beobachtungen sie von der Berechtigung dieser Nachrede genügend überzeugten. Sie war doch eigentlich ein wohlerzogenes und keusches Mädchen, das für ihre eigene Person sexuellen Abenteuern aus dem Wege gegangen war und grobsinnliche Befriedigungen als unästhetisch empfand. Aber bereits ihre ersten Schwärmereien hatten Frauen gegolten, denen man keine Neigung zu besonders strenger Sittlichkeit nachrühmte. Den ersten Protest des Vaters gegen ihre Liebeswahl hatte sie durch die Hartnäckigkeit hervorgerufen, mit der sie sich um den Verkehr mit einer Kinoschauspielerin an jenem Sommerorte bemühte. Dabei hatte es sich keineswegs um Frauen gehandelt, die etwa im Rufe der Homosexualität standen und ihr somit Aussicht auf solche Befriedigung geboten hätten; vielmehr warb sie unlogischerweise um kokette Frauen im gewöhnlichen Sinne des Wortes; eine homosexuelle, ihr gleichaltrige Freundin, die sich ihr bereitwilligst zur Verfügung stellte, wies sie ohne Bedenken ab. Der schlechte Ruf der »Dame« aber war geradezu eine Liebesbedingung für sie, und alles Rätselhafte dieses Verhaltens verschwindet, wenn wir uns erinnern, daß auch für jenen von der Mutter abgeleiteten männlichen Typus der Objektwahl die Bedingung besteht, daß die Geliebte irgendwie »sexuell anrüchig« sei, eigentlich eine Kokotte genannt werden dürfe. Als sie später erfuhr, in welchem Ausmaß diese Kennzeichnung für ihre verehrte Dame zutraf und daß diese einfach von der Preisgabe ihres Körpers lebte, bestand ihre Reaktion in einem großen Mitleid und in der Entwicklung von Phantasien und Vorsätzen, wie sie die Geliebte aus diesen unwürdigen Verhältnissen »retten« könne. Dieselben Rettungsbestrebungen sind uns bei den Männern jenes von mir beschriebenen Typus aufgefallen, und ich habe an der erwähnten Stelle die analytische Ableitung dieses Strebens zu geben versucht.
In ganz andere Regionen der Erklärung führt die Analyse des Selbstmordversuches, den ich als einen ernstgemeinten gelten lassen muß, der übrigens ihre Position sowohl bei den Eltern als auch bei der geliebten Dame beträchtlich verbesserte. Sie ging eines Tages mit ihr in einer Gegend und zu einer Stunde spazieren, wo eine Begegnung mit dem vom Bureau kommenden Vater nicht unwahrscheinlich war. Der Vater ging auch an ihnen vorüber und warf einen wütenden Blick auf sie und die ihm bereits bekannte Begleiterin. Kurz darauf stürzte sie sich in den Stadtbahngraben. Ihre Rechenschaft von der näheren Verursachung ihres Entschlusses klingt nun ganz plausibel. Sie hatte der Dame eingestanden, daß der Herr, der sie beide so böse angeschaut hatte, ihr Vater sei, der von diesem Verkehr absolut nichts wissen wolle. Die Dame war nun aufgebraust, hatte ihr befohlen, sie sofort zu verlassen und nie mehr zu erwarten oder anzureden, diese Geschichte müsse nun ein Ende haben. In der Verzweiflung darüber, daß sie so die Geliebte für immer verloren habe, wollte sie sich den Tod geben. Die Analyse gestattete aber eine andere und tiefer greifende Deutung hinter der ihrigen aufzudecken und durch ihre eigenen Träume zu stützen. Der Selbstmordversuch war, wie man erwarten durfte, außerdem noch zweierlei: eine Straferfüllung (Selbstbestrafung) und eine Wunscherfüllung. Als letztere bedeutete er die Durchsetzung jenes Wunsches, dessen Enttäuschung sie in die Homosexualität getrieben hatte, nämlich vom Vater ein Kind zu bekommen, denn nun kam sie durch die Schuld des Vaters nieder [Fußnote]Diese Deutungen der Wege des Selbstmordes durch sexuelle Wunscherfüllungen sind längst allen Analytikern vertraut. (Vergiften = schwanger werden, ertränken = gebären, von einer Höhe herabstürzen = niederkommen.). Es stellt die Verbindung dieser Tiefendeutung mit der dem Mädchen bewußten, oberflächlichen her, daß in diesem Moment die Dame genauso gesprochen hatte wie der Vater und das nämliche Verbot hatte ergehen lassen. Als Selbstbestrafung bürgt uns die Handlung des Mädchens dafür, daß sie starke Todeswünsche gegen den einen oder den anderen Elternteil in ihrem Unbewußten entwickelt hatte. Vielleicht aus Rachsucht gegen den ihre Liebe störenden Vater, noch wahrscheinlicher aber auch gegen die Mutter, als sie mit dem kleinen Bruder schwanger ging. Denn die Analyse hat uns zum Rätsel des Selbstmordes die Aufklärung gebracht, daß vielleicht niemand die psychische Energie, sich zu töten, findet, der nicht erstens dabei ein Objekt mittötet, mit dem er sich identifiziert hat, und der nicht zweitens dadurch einen Todeswunsch gegen sich selbst wendet, welcher gegen eine andere Person gerichtet war. Die regelmäßige Aufdeckung solcher unbewußter Todeswünsche beim Selbstmörder braucht übrigens weder zu befremden noch als Bestätigung unserer Ableitungen zu imponieren, denn das Unbewußte aller Lebenden ist von solchen Todeswünschen, selbst gegen sonst geliebte Personen, übervoll [Fußnote]Vgl. ›Zeitgemäßes über Krieg und Tod‹ (1915 b).. In der Identifizierung mit der Mutter, die an der Niederkunft mit diesem, ihr (der Tochter) vorenthaltenen, Kinde hätte sterben sollen, ist aber diese Straferfüllung selbst wieder eine Wunscherfüllung. Endlich, daß die verschiedensten starken Motive zusammenwirken mußten, um eine Tat wie die unseres Mädchens zu ermöglichen, wird unserer Erwartung nicht widersprechen.
In der Motivierung des Mädchens kommt der Vater nicht vor, nicht einmal die Angst vor seinem Zorne wird erwähnt. In der von der Analyse erratenen Motivierung fällt ihm die Hauptrolle zu. Dieselbe entscheidende Bedeutung hatte das Verhältnis zum Vater auch für den Verlauf und den Ausgang der analytischen Behandlung oder vielmehr Exploration. Hinter der vorgeschützten Rücksicht auf die Eltern, denen zuliebe sie den Versuch einer Umwandlung unterstützen wollte, verbarg sich die Trotz- und Racheeinstellung gegen den Vater, welche sie in der Homosexualität festhielt. Durch solche Deckung gesichert, gab der Widerstand ein großes Gebiet der analytischen Erforschung frei. Die Analyse vollzog sich fast ohne Anzeichen von Widerstand, unter reger intellektueller Beteiligung der Analysierten, aber auch bei völliger Gemütsruhe derselben. Als ich ihr einmal ein besonders wichtiges und sie nahe betreffendes Stück der Theorie auseinandersetzte, äußerte sie mit unnachahmlicher Betonung: »Ach, das ist ja sehr interessant«, wie eine Weltdame, die durch ein Museum geführt wird und Gegenstände, die ihr vollkommen gleichgültig sind, durch ein Lorgnon in Augenschein nimmt. Der Eindruck von ihrer Analyse näherte sich dem einer hypnotischen Behandlung, in welcher sich der Widerstand gleichfalls bis zu einer bestimmten Grenze zurückgezogen hat, an der er sich dann als unbesiegbar erweist. Dieselbe – russische – Taktik, könnte man sie nennen, befolgt der Widerstand sehr oft in Fällen von Zwangsneurose, die darum eine Zeitlang die klarsten Ergebnisse liefern und einen tiefen Einblick in die Verursachung der Symptome gestatten. Man beginnt dann sich zu wundern, warum so große Fortschritte im analytischen Verständnis auch nicht die leiseste Änderung in den Zwängen und Hemmungen des Kranken mit sich bringen, bis man endlich bemerkt, daß alles, was man zustande gebracht hat, mit dem Vorbehalt des Zweifels behaftet war, hinter welchem Schutzwall sich die Neurose sicher fühlen durfte. »Es wäre ja alles recht schön«, heißt es im Kranken, oft auch bewußterweise, »wenn ich dem Manne Glauben schenken müßte, aber davon ist ja keine Rede, und solange das nicht der Fall ist, brauche ich auch nichts zu ändern.« Nähert man sich dann der Motivierung dieses Zweifels, so bricht der Kampf mit den Widerständen ernsthaft los.
Bei unserem Mädchen war es nicht der Zweifel, sondern das affektive Moment der Rache am Vater, das ihre kühle Reserve ermöglichte, die Analyse deutlich in zwei Phasen zerlegte und die Ergebnisse der ersten Phase so vollständig und übersichtlich werden ließ. Es hatte auch den Anschein, als ob bei dem Mädchen nichts einer Übertragung auf den Arzt Ähnliches zustande gekommen wäre. Aber das ist natürlich ein Widersinn oder eine ungenaue Ausdrucksweise; irgendein Verhältnis zum Arzt muß sich doch herstellen, und dies wird zu allermeist aus einer infantilen Relation übertragen sein. In Wirklichkeit übertrug sie auf mich die gründliche Ablehnung des Mannes, von der sie seit ihrer Enttäuschung durch den Vater beherrscht war. Die Erbitterung gegen den Mann hat es in der Regel leicht, sich am Arzt zu befriedigen, sie braucht keine stürmischen Gefühlsäußerungen hervorzurufen, sie äußert sich einfach in der Vereitlung all seiner Bemühungen und im Festhalten am Kranksein. Ich weiß aus Erfahrung, wie schwierig es ist, den Analysierten zum Verständnis gerade dieser stummen Symptomatik zu bringen und solche latente, oft exzessiv große Feindseligkeit ohne Gefährdung der Kur bewußtzumachen. Ich brach also ab, sobald ich die Einstellung des Mädchens zum Vater erkannt hatte, und gab den Rat, den therapeutischen Versuch, wenn man Wert auf ihn legte, bei einer Ärztin fortführen zu lassen. Das Mädchen hatte unterdes dem Vater das Versprechen abgegeben, wenigstens den Verkehr mit der »Dame« zu unterlassen, und ich weiß nicht, ob mein Rat, dessen Motivierung ja durchsichtig ist, befolgt werden wird.
Ein einziges Mal kam auch in dieser Analyse etwas vor, was ich als positive Übertragung, als außerordentlich abgeschwächte Erneuerung der ursprünglichen leidenschaftlichen Verliebtheit in den Vater auffassen konnte. Auch diese Äußerung war vom Zusatz eines anderen Motivs nicht frei, ich erwähne sie aber, weil sie nach anderer Richtung ein interessantes Problem der analytischen Technik zur Frage bringt. Zu einer gewissen Zeit, nicht lange nach dem Beginne der Kur, brachte das Mädchen eine Reihe von Träumen vor, die, gebührend entstellt und in korrekter Traumsprache abgefaßt, doch leicht und sicher zu übersetzen waren. Ihr gedeuteter Inhalt war aber auffällig. Sie antizipierten die Heilung der Inversion durch die Behandlung, drückten ihre Freude über die ihr nun eröffneten Lebensaussichten aus, gestanden die Sehnsucht nach der Liebe eines Mannes und nach Kindern ein und konnten somit als erfreuliche Vorbereitung zur erwünschten Wandlung begrüßt werden. Der Widerspruch gegen ihre gleichzeitigen Äußerungen im Wachen war sehr groß. Sie machte mir kein Hehl daraus, daß sie zwar zu heiraten gedenke, aber nur um sich der Tyrannei des Vaters zu entziehen und ungestört ihren wirklichen Neigungen zu leben. Mit dem Manne, meinte sie etwas verächtlich, würde sie schon fertig werden, und endlich könne man ja, wie das Beispiel der verehrten Dame zeige, auch gleichzeitig sexuelle Beziehungen mit einem Manne und mit einer Frau haben. Durch irgendeinen leisen Eindruck gewarnt, erklärte ich ihr eines Tages, ich glaube diesen Träumen nicht, sie seien lügnerisch oder heuchlerisch, und ihre Absicht sei, mich zu betrügen, wie sie den Vater zu betrügen pflegte. Ich hatte recht, diese Art von Träumen blieb von dieser Aufklärung an aus. Ich glaube aber doch, neben der Absicht der Irreführung lag auch ein Stück Werbung in diesen Träumen; es war auch ein Versuch, mein Interesse und meine gute Meinung zu gewinnen, vielleicht um mich später desto gründlicher zu enttäuschen.
Ich kann mir vorstellen, daß der Hinweis auf die Existenz solch lügnerischer Gefälligkeitsträume bei manchen, die sich Analytiker nennen, einen wahren Sturm von hilfloser Entrüstung entfesseln wird. »Also kann auch das Unbewußte lügen, der wirkliche Kern unseres Seelenlebens, dasjenige in uns, was dem Göttlichen so viel näher ist als unser armseliges Bewußtsein! Wie kann man dann noch auf die Deutungen der Analyse und die Sicherheit unserer Erkenntnisse bauen?« Dagegen muß gesagt werden, daß die Anerkennung solch lügenhafter Träume eine erschütternde Neuheit nicht bedeutet. Ich weiß zwar, daß das Bedürfnis der Menschen nach Mystik unausrottbar ist und daß es unablässige Versuche macht, das durch die »Traumdeutung« der Mystik entrissene Gebiet für sie wiederzugewinnen, aber in dem Falle, der uns beschäftigt, liegt doch alles einfach genug. Der Traum ist nicht das »Unbewußte«, er ist die Form, in welche ein aus dem Vorbewußten oder selbst aus dem Bewußten des Wachlebens erübrigter Gedanke dank der Begünstigungen des Schlafzustandes umgegossen werden konnte. Im Schlafzustand hat er die Unterstützung unbewußter Wunschregungen gewonnen und dabei die Entstellung durch die »Traumarbeit« erfahren, welche durch die fürs Unbewußte geltenden Mechanismen bestimmt wird. Bei unserer Träumerin stammte die Absicht, mich irrezuführen, wie sie es beim Vater zu tun pflegte, gewiß aus dem Vorbewußten, wenn sie nicht etwa gar bewußt war; sie konnte sich nun durchsetzen, indem sie mit der unbewußten Wunschregung, dem Vater (oder Vaterersatz) zu gefallen, in Verbindung trat, und schuf so einen lügnerischen Traum. Die beiden Absichten, den Vater zu betrügen und dem Vater zu gefallen, stammen aus demselben Komplex; die erstere ist aus der Verdrängung der letzteren erwachsen, die spätere wird durch die Traumarbeit auf die frühere zurückgeführt. Von einer Entwürdigung des Unbewußten, von einer Erschütterung des Zutrauens in die Ergebnisse unserer Analyse kann also nicht die Rede sein.
Ich will die Gelegenheit nicht versäumen, auch einmal das Erstaunen darüber zu Worte kommen zu lassen, daß die Menschen so große und bedeutungsvolle Stücke ihres Liebeslebens durchmachen können, ohne viel davon zu bemerken, ja mitunter, ohne das mindeste davon zu ahnen, oder daß sie, wenn es zu ihrem Bewußtsein kommt, sich mit dem Urteil so gründlich darüber täuschen. Das geschieht nicht nur unter den Bedingungen der Neurose, wo wir mit dem Phänomen vertraut sind, sondern scheint auch sonst recht gewöhnlich zu sein. In unserem Falle entwickelt ein Mädchen eine Schwärmerei für Frauen, die von den Eltern zuerst nur als ärgerlich empfunden, aber kaum ernst genommen wird; sie selbst weiß wohl, wie sehr sie davon in Anspruch genommen wird, fühlt aber doch nur wenig von den Sensationen einer intensiven Verliebtheit, bis sich bei einer bestimmten Versagung eine ganz exzessive Reaktion ergibt, die allen Teilen zeigt, daß man es mit einer verzehrenden Leidenschaft von elementarer Stärke zu tun hat. Von den Voraussetzungen, die für das Hervorbrechen eines solchen seelischen Sturmes erforderlich sind, hat auch das Mädchen niemals etwas bemerkt. Andere Male trifft man auf Mädchen oder Frauen in schweren Depressionen, die, nach der möglichen Verursachung ihres Zustandes befragt, die Auskunft geben, sie haben wohl ein gewisses Interesse für eine bestimmte Person verspürt, aber es sei ihnen nicht tief gegangen und sie seien sehr bald damit fertig geworden, nachdem es aufgegeben werden mußte. Und doch ist dieser anscheinend so leicht ertragene Verzicht die Ursache der schweren Störung geworden. Oder man hat es mit Männern zu tun, die oberflächliche Liebesbeziehungen zu Frauen erledigt haben und erst aus den Folgeerscheinungen erfahren müssen, daß sie in das angeblich geringgeschätzte Objekt leidenschaftlich verliebt waren. Man erstaunt auch über die ungeahnten Wirkungen, die von einem künstlichen Abortus, der Tötung einer Leibesfrucht, ausgehen können, zu der man sich ohne Reue und Bedenken entschlossen hatte. Man sieht sich so genötigt, den Dichtern recht zu geben, die uns mit Vorliebe Personen schildern, welche lieben, ohne es zu wissen, oder die es nicht wissen, ob sie lieben, oder die zu hassen glauben, während sie lieben. Es scheint, daß gerade die Kunde, die unser Bewußtsein von unserem Liebesleben erhält, besonders leicht unvollständig, lückenhaft oder gefälscht sein kann. In diesen Erörterungen habe ich es natürlich nicht versäumt, den Anteil eines nachträglichen Vergessens in Abzug zu bringen.
IV
Ich kehre nun zu der vorhin abgebrochenen Diskussion des Falles zurück. Wir haben uns einen Überblick über die Kräfte verschafft, welche die Libido des Mädchens aus der normalen Ödipuseinstellung in die der Homosexualität überführt haben, und über die psychischen Wege, die dabei beschritten worden sind. Obenan unter diesen bewegenden Kräften stand der Eindruck der Geburt ihres kleinen Bruders, und somit ist uns nahegelegt, den Fall als einen von spät erworbener Inversion zu klassifizieren.
Allein hier werden wir auf ein Verhältnis aufmerksam, welches uns auch bei vielen anderen Beispielen von psychoanalytischer Aufklärung eines seelischen Vorganges entgegentritt. Solange wir die Entwicklung von ihrem Endergebnis aus nach rückwärts verfolgen, stellt sich uns ein lückenloser Zusammenhang her, und wir halten unsere Einsicht für vollkommen befriedigend, vielleicht für erschöpfend. Nehmen wir aber den umgekehrten Weg, gehen wir von den durch die Analyse gefundenen Voraussetzungen aus und suchen diese bis zum Resultat zu verfolgen, so kommt uns der Eindruck einer notwendigen und auf keine andere Weise zu bestimmenden Verkettung ganz abhanden. Wir merken sofort, es hätte sich auch etwas anderes ergeben können, und dies andere Ergebnis hätten wir ebensogut verstanden und aufklären können. Die Synthese ist also nicht so befriedigend wie die Analyse; mit anderen Worten, wir wären nicht imstande, aus der Kenntnis der Voraussetzungen die Natur des Ergebnisses vorherzusagen.
Es ist sehr leicht, diese betrübliche Erkenntnis auf ihre Ursachen zurückzuführen. Mögen uns auch die ätiologischen Faktoren, welche für einen bestimmten Erfolg maßgebend sind, vollständig bekannt sein, wir kennen sie doch nur nach ihrer qualitativen Eigenart und nicht nach ihrer relativen Stärke. Einige von ihnen werden als zu schwach von anderen unterdrückt werden und für das Endergebnis nicht in Betracht kommen. Wir wissen aber niemals vorher, welche der bestimmenden Momente sich als die schwächeren oder stärkeren erweisen werden. Wir sagen nur am Ende, die sich durchgesetzt haben, das waren die stärkeren. Somit ist die Verursachung in der Richtung der Analyse jedesmal sicher zu erkennen, deren Vorhersage in der Richtung der Synthese aber unmöglich.
Wir wollen also nicht behaupten, daß jedes Mädchen, dessen aus der Ödipuseinstellung der Pubertätsjahre herrührende Liebessehnsucht eine solche Enttäuschung erfährt, darum notwendigerweise der Homosexualität verfallen wird. Andersartige Reaktionen auf dieses Trauma werden im Gegenteil häufiger sein. Dann müssen aber bei diesem Mädchen besondere Momente den Ausschlag gegeben haben, solche außerhalb des Traumas, wahrscheinlich innerer Natur. Es hat auch keine Schwierigkeit, sie aufzuzeigen.
Bekanntlich braucht es auch beim Normalen eine gewisse Zeit, bis sich die Entscheidung über das Geschlecht des Liebesobjekts endgültig durchgesetzt hat. Homosexuelle Schwärmereien, übermäßig starke, sinnlich betonte Freundschaften sind bei beiden Geschlechtern in den ersten Jahren nach der Pubertät recht gewöhnlich. So war es auch bei unserem Mädchen, aber diese Neigungen zeigten sich bei ihr unzweifelhaft stärker und hielten länger an als bei anderen. Dazu kommt, daß diese Vorboten der späteren Homosexualität immer ihr bewußtes Leben eingenommen hatten, während die dem Ödipuskomplex entspringende Einstellung unbewußt geblieben war und nur in solchen Anzeichen wie jener Verzärtelung des kleinen Knaben zum Vorschein kam. Als Schulmädchen war sie lange Zeit verliebt in eine unnahbar strenge Lehrerin, einen offenkundigen Mutterersatz. Ein besonders lebhaftes Interesse für manche jungmütterliche Frauen hatte sie lange vor der Geburt des Bruders und um so sicherer lange Zeit vor jener ersten Zurechtweisung durch den Vater gezeigt. Ihre Libido lief also von sehr früher Zeit her in zwei Strömungen, von denen die oberflächlichere unbedenklich eine homosexuelle genannt werden darf. Diese war wahrscheinlich die direkte, unverwandelte Fortsetzung einer infantilen Fixierung an die Mutter. Möglicherweise haben wir durch unsere Analyse auch nichts anderes aufgedeckt als den Prozeß, der bei einem geeigneten Anlaß auch die tiefere heterosexuelle Libidoströmung in die manifeste homosexuelle überführte.
Ferner lehrte die Analyse, daß das Mädchen aus ihren Kinderjahren einen stark betonten »Männlichkeitskomplex« mitgebracht hatte. Lebhaft, rauflustig, durchaus nicht gewillt, hinter dem wenig älteren Bruder zurückzustehen, hatte sie seit jener Inspektion der Genitalien einen mächtigen Penisneid entwickelt, dessen Abkömmlinge immer noch ihr Denken erfüllten. Sie war eigentlich eine Frauenrechtlerin, fand es ungerecht, daß die Mädchen nicht dieselben Freiheiten genießen sollten wie die Burschen, und sträubte sich überhaupt gegen das Los der Frau. Zur Zeit der Analyse waren ihr Schwangerschaft und Kindergebären unliebsame Vorstellungen, wie ich vermute, auch wegen der damit verbundenen körperlichen Entstellung. Auf diese Abwehr hatte sich ihr mädchenhafter Narzißmus zurückgezogen [Fußnote]Vgl. Kriemhildes Bekenntnis im Nibelungenlied., der sich nicht mehr als Stolz auf ihre Schönheit äußerte. Verschiedene Anzeichen wiesen auf eine ehemals sehr starke Schau- und Exhibitionslust hin. Wer das Recht der Erwerbung in der Ätiologie nicht verkürzt sehen will, wird aufmerksam machen, daß das geschilderte Verhalten des Mädchens gerade so war, wie es durch die vereinte Wirkung der mütterlichen Zurücksetzung und der Vergleichung ihrer Genitalien mit denen des Bruders bei starker Mutterfixierung bestimmt werden mußte. Auch hier besteht eine Möglichkeit, etwas auf Prägung durch frühzeitig wirksamen äußeren Einfluß zurückzuführen, was man gern als konstitutionelle Eigenart aufgefaßt hätte. Und auch von dieser Erwerbung – wenn sie wirklich stattgefunden hat – wird ein Anteil auf Rechnung der mitgebrachten Konstitution zu setzen sein. So vermengt und vereinigt sich in der Beobachtung beständig, was wir in der Theorie zu einem Paar von Gegensätzen – Vererbung und Erwerbung – auseinanderlegen möchten.
Hatte ein früherer, vorläufiger Abschluß der Analyse zum Ausspruch geführt, es handle sich um einen Fall von später Erwerbung der Homosexualität, so drängt die jetzt vorgenommene Überprüfung des Materials vielmehr zum Schluß, es liege angeborene Homosexualität vor, die sich wie gewöhnlich erst in der Zeit nach der Pubertät fixiert und unverkennbar gezeigt habe. Jede dieser Klassifizierungen wird nur einem Anteil des durch Beobachtung festzustellenden Sachverhaltes gerecht, vernachlässigt den anderen. Wir treffen das Richtige, wenn wir den Wert dieser Fragestellung überhaupt gering veranschlagen.
Die Literatur der Homosexualität pflegt die Frage der Objektwahl einerseits und des Geschlechtscharakters und der geschlechtlichen Einstellung anderseits nicht scharf genug zu trennen, als ob die Entscheidung über den einen Punkt notwendigerweise mit der des anderen verknüpft wäre. Die Erfahrung zeigt jedoch das Gegenteil: Ein Mann mit überwiegend männlichen Eigenschaften, der auch den männlichen Typus des Liebeslebens zeigt, kann doch in bezug aufs Objekt invertiert sein, nur Männer anstatt Frauen lieben. Ein Mann, in dessen Charakter die weiblichen Eigenschaften augenfällig vorwiegen, ja, der sich in der Liebe wie ein Weib benimmt, sollte durch diese weibliche Einstellung auf den Mann als Liebesobjekt hingewiesen werden; er kann aber trotzdem heterosexuell sein, nicht mehr Inversion in bezug aufs Objekt zeigen als durchschnittlich ein Normaler. Dasselbe gilt für Frauen, auch bei ihnen treffen psychischer Geschlechtscharakter und Objektwahl nicht zu fester Relation zusammen. Das Geheimnis der Homosexualität ist also keineswegs so einfach, wie man es zum populären Gebrauch gern darstellt: Eine weibliche Seele, die darum den Mann lieben muß, zum Unglück in einen männlichen Körper geraten, oder eine männliche Seele, die unwiderstehlich vom Weib angezogen wird, leider in einen weiblichen Leib gebannt. Vielmehr handelt es sich um drei Reihen von Charakteren
Somatische Geschlechtscharaktere |
– |
Psychischer Geschlechtscharakter |
(Physischer Hermaphroditismus) |
|
(männl. Einstellung) (weibl. Einstellung) |
– Art der Objektwahl, |
||
die bis zu einem gewissen Grade voneinander unabhängig variieren und sich bei den einzelnen Individuen in mannigfachen Permutationen vorfinden. Die tendenziöse Literatur hat den Einblick in diese Verhältnisse erschwert, indem sie aus praktischen Motiven das dem Laien allein auffällige Verhalten im dritten Punkt, dem der Objektwahl, in den Vordergrund rückt und außerdem die Festigkeit der Beziehung zwischen diesem und dem ersten Punkt übertreibt. Sie versperrt sich auch den Weg, der zur tieferen Einsicht in all das führt, was man uniform als Homosexualität bezeichnet, indem sie sich gegen zwei Grundtatsachen sträubt, welche die psychoanalytische Forschung aufgedeckt hat. Die erste, daß die homosexuellen Männer eine besonders starke Fixierung an die Mutter erfahren haben; die zweite, daß alle Normalen neben ihrer manifesten Heterosexualität ein sehr erhebliches Ausmaß von latenter oder unbewußter Homosexualität erkennen lassen. Trägt man diesen Funden Rechnung, so ist es allerdings um die Annahme eines von der Natur in besonderer Laune geschaffenen »dritten Geschlechts« geschehen.
Die Psychoanalyse ist nicht dazu berufen, das Problem der Homosexualität zu lösen. Sie muß sich damit begnügen, die psychischen Mechanismen zu enthüllen, die zur Entscheidung in der Objektwahl geführt haben, und die Wege von ihnen zu den Triebanlagen zu verfolgen. Dann bricht sie ab und überläßt das übrige der biologischen Forschung, die gerade jetzt in den Versuchen von Steinach [Fußnote]Siehe A. Lipschütz (1919). so bedeutungsvolle Aufschlüsse über die Beeinflussung der obigen zweiten und dritten Reihe durch die erste zutage fördert. Sie steht auf gemeinsamem Boden mit der Biologie, indem sie eine ursprüngliche Bisexualität des menschlichen (wie des tierischen) Individuums zur Voraussetzung nimmt. Aber das Wesen dessen, was man im konventionellen oder im biologischen Sinne »männlich« und »weiblich« nennt, kann die Psychoanalyse nicht aufklären, sie übernimmt die beiden Begriffe und legt sie ihren Arbeiten zugrunde. Beim Versuche einer weiteren Zurückführung verflüchtigt sich ihr die Männlichkeit zur Aktivität, die Weiblichkeit zur Passivität, und das ist zu wenig. Inwieweit die Erwartung zulässig oder bereits durch Erfahrung bestätigt ist, es werde sich auch aus dem Stück Aufklärungsarbeit, welches in den Bereich der Analyse fällt, eine Handhabe zur Abänderung der Inversion ergeben, habe ich vorhin auszuführen versucht. Vergleicht man dieses Ausmaß von Beeinflussung mit den großartigen Umwälzungen, die Steinach in einzelnen Fällen durch operative Eingriffe erzielt hat, so macht es wohl keinen imposanten Eindruck. Indes wäre es Voreiligkeit oder schädliche Übertreibung, wenn wir uns jetzt schon Hoffnung auf eine allgemein brauchbare »Therapie« der Inversion machten. Die Fälle von männlicher Homosexualität, in denen Steinach Erfolg gehabt hat, erfüllten die nicht immer vorhandene Bedingung eines überdeutlichen somatischen »Hermaphroditismus«. Die Therapie einer weiblichen Homosexualität auf analogem Wege ist zunächst ganz unklar. Sollte sie in der Entfernung der wahrscheinlich hermaphroditischen Ovarien und Einpflanzung anderer, hoffentlich eingeschlechtiger, bestehen, so würde sie praktisch wenig Aussicht auf Anwendung haben. Ein weibliches Individuum, das sich männlich gefühlt und auf männliche Weise geliebt hat, wird sich kaum in die weibliche Rolle drängen lassen, wenn es diese nicht durchaus vorteilhafte Umwandlung mit dem Verzicht auf die Mutterschaft bezahlen muß.
Über die weibliche Sexualität (1931)
I
In der Phase des normalen Ödipuskomplexes finden wir das Kind an den gegengeschlechtlichen Elternteil zärtlich gebunden, während im Verhältnis zum gleichgeschlechtlichen die Feindseligkeit vorwiegt. Es macht uns keine Schwierigkeiten, dieses Ergebnis für den Knaben abzuleiten. Die Mutter war sein erstes Liebesobjekt; sie bleibt es, mit der Verstärkung seiner verliebten Strebungen und der tieferen Einsicht in die Beziehung zwischen Vater und Mutter muß der Vater zum Rivalen werden. Anders für das kleine Mädchen. Ihr erstes Objekt war doch auch die Mutter; wie findet sie den Weg zum Vater? Wie, wann und warum macht sie sich von der Mutter los? Wir haben längst verstanden, die Entwicklung der weiblichen Sexualität werde durch die Aufgabe kompliziert, die ursprünglich leitende genitale Zone, die Klitoris, gegen eine neue, die Vagina, aufzugeben. Nun erscheint uns eine zweite solche Wandlung, der Umtausch des ursprünglichen Mutterobjekts gegen den Vater, nicht weniger charakteristisch und bedeutungsvoll für die Entwicklung des Weibes. In welcher Art die beiden Aufgaben miteinander verknüpft sind, können wir noch nicht erkennen.
Frauen mit starker Vaterbindung sind bekanntlich sehr häufig; sie brauchen auch keineswegs neurotisch zu sein. An solchen Frauen habe ich die Beobachtungen gemacht, über die ich hier berichte und die mich zu einer gewissen Auffassung der weiblichen Sexualität veranlaßt haben. Zwei Tatsachen sind mir da vor allem aufgefallen. Die erste war: wo eine besonders intensive Vaterbindung bestand, da hatte es nach dem Zeugnis der Analyse vorher eine Phase von ausschließlicher Mutterbindung gegeben von gleicher Intensität und Leidenschaftlichkeit. Die zweite Phase hatte bis auf den Wechsel des Objekts dem Liebesleben kaum einen neuen Zug hinzugefügt. Die primäre Mutterbeziehung war sehr reich und vielseitig ausgebaut gewesen.
Die zweite Tatsache lehrte, daß man auch die Zeitdauer dieser Mutterbindung stark unterschätzt hatte. Sie reichte in mehreren Fällen bis weit ins vierte, in einem bis ins fünfte Jahr, nahm also den bei weitem längeren Anteil der sexuellen Frühblüte ein. Ja, man mußte die Möglichkeit gelten lassen, daß eine Anzahl von weiblichen Wesen in der ursprünglichen Mutterbindung steckenbleibt und es niemals zu einer richtigen Wendung zum Manne bringt.
Die präödipale Phase des Weibes rückt hiemit zu einer Bedeutung auf, die wir ihr bisher nicht zugeschrieben haben.
Da sie für alle Fixierungen und Verdrängungen Raum hat, auf die wir die Entstehung der Neurosen zurückführen, scheint es erforderlich, die Allgemeinheit des Satzes, der Ödipuskomplex sei der Kern der Neurose, zurückzunehmen. Aber wer ein Sträuben gegen diese Korrektur verspürt, ist nicht genötigt, sie zu machen. Einerseits kann man dem Ödipuskomplex den weiteren Inhalt geben, daß er alle Beziehungen des Kindes zu beiden Eltern umfaßt, anderseits kann man den neuen Erfahrungen auch Rechnung tragen, indem man sagt, das Weib gelange zur normalen positiven Ödipussituation erst, nachdem es eine vom negativen Komplex beherrschte Vorzeit überwunden. Wirklich ist während dieser Phase der Vater für das Mädchen nicht viel anderes als ein lästiger Rivale, wenngleich die Feindseligkeit gegen ihn nie die für den Knaben charakteristische Höhe erreicht. Alle Erwartungen eines glatten Parallelismus zwischen männlicher und weiblicher Sexualentwicklung haben wir ja längst aufgegeben.
Die Einsicht in die präödipale Vorzeit des Mädchens wirkt als Überraschung, ähnlich wie auf anderem Gebiet die Aufdeckung der minoisch-mykenischen Kultur hinter der griechischen.
Alles auf dem Gebiet dieser ersten Mutterbindung erschien mir so schwer analytisch zu erfassen, so altersgrau, schattenhaft, kaum wiederbelebbar, als ob es einer besonders unerbittlichen Verdrängung erlegen wäre. Vielleicht kam dieser Eindruck aber davon, daß die Frauen in der Analyse bei mir an der nämlichen Vaterbindung festhalten konnten, zu der sie sich aus der in Rede stehenden Vorzeit geflüchtet hatten. Es scheint wirklich, daß weibliche Analytiker, wie Jeanne Lampl-de Groot und Helene Deutsch, diese Tatbestände leichter und deutlicher wahrnehmen konnten, weil ihnen bei ihren Gewährspersonen die Übertragung auf einen geeigneten Mutterersatz zu Hilfe kam. Ich habe es auch nicht dahin gebracht, einen Fall vollkommen zu durchschauen, beschränke mich daher auf die Mitteilung der allgemeinsten Ergebnisse und führe nur wenige Proben aus meinen neuen Einsichten an. Dahin gehört, daß diese Phase der Mutterbindung eine besonders intime Beziehung zur Ätiologie der Hysterie vermuten läßt, was nicht überraschen kann, wenn man erwägt, daß beide, die Phase wie die Neurose, zu den besonderen Charakteren der Weiblichkeit gehören, ferner auch, daß man in dieser Mutterabhängigkeit den Keim der späteren Paranoia des Weibes findet [Fußnote]In dem bekannten Fall von Ruth Mack Brunswick (›Die Analyse eines Eifersuchtswahnes‹, 1928) geht die Affektion direkt aus der präödipalen (Schwester-) Fixierung hervor.. Denn dies scheint die überraschende, aber regelmäßig angetroffene Angst, von der Mutter umgebracht (aufgefressen?) zu werden, wohl zu sein. Es liegt nahe anzunehmen, daß diese Angst einer Feindseligkeit entspricht, die sich im Kind gegen die Mutter infolge der vielfachen Einschränkungen der Erziehung und Körperpflege entwickelt, und daß der Mechanismus der Projektion durch die Frühzeit der psychischen Organisation begünstigt wird.
II
Ich habe die beiden Tatsachen vorangestellt, die mir als neu aufgefallen sind, daß die starke Vaterabhängigkeit des Weibes nur das Erbe einer ebenso starken Mutterbindung antritt und daß diese frühere Phase durch eine unerwartet lange Zeitdauer angehalten hat. Nun will ich zurückgreifen, um diese Ergebnisse in das uns bekanntgewordene Bild der weiblichen Sexualentwicklung einzureihen, wobei Wiederholungen nicht zu vermeiden sein werden. Die fortlaufende Vergleichung mit den Verhältnissen beim Manne kann unserer Darstellung nur förderlich sein.
Zunächst ist unverkennbar, daß die für die menschliche Anlage behauptete Bisexualität beim Weib viel deutlicher hervortritt als beim Mann. Der Mann hat doch nur eine leitende Geschlechtszone, ein Geschlechtsorgan, während das Weib deren zwei besitzt: die eigentlich weibliche Vagina und die dem männlichen Glied analoge Klitoris. Wir halten uns für berechtigt anzunehmen, daß die Vagina durch lange Jahre so gut wie nicht vorhanden ist, vielleicht erst zur Zeit der Pubertät Empfindungen liefert. In letzter Zeit mehren sich allerdings die Stimmen der Beobachter, die vaginale Regungen auch in diese frühen Jahre verlegen. Das Wesentliche, was also an Genitalität in der Kindheit vorgeht, muß sich beim Weibe an der Klitoris abspielen. Das Geschlechtsleben des Weibes zerfällt regelmäßig in zwei Phasen, von denen die erste männlichen Charakter hat; erst die zweite ist die spezifisch weibliche. In der weiblichen Entwicklung gibt es so einen Prozeß der Überführung der einen Phase in die andere, dem beim Manne nichts analog ist. Eine weitere Komplikation entsteht daraus, daß sich die Funktion der virilen Klitoris in das spätere weibliche Geschlechtsleben fortsetzt in einer sehr wechselnden und gewiß nicht befriedigend verstandenen Weise. Natürlich wissen wir nicht, wie sich diese Besonderheiten des Weibes biologisch begründen; noch weniger können wir ihnen teleologische Absicht unterlegen.
Parallel dieser ersten großen Differenz läuft die andere auf dem Gebiet der Objektfindung. Beim Manne wird die Mutter zum ersten Liebesobjekt infolge des Einflusses von Nahrungszufuhr und Körperpflege, und sie bleibt es, bis sie durch ein ihr wesensähnliches oder von ihr abgeleitetes ersetzt wird. Auch beim Weib muß die Mutter das erste Objekt sein. Die Urbedingungen der Objektwahl sind ja für alle Kinder gleich. Aber am Ende der Entwicklung soll der Mann-Vater das neue Liebesobjekt geworden sein, d. h. dem Geschlechtswechsel des Weibes muß ein Wechsel im Geschlecht des Objekts entsprechen. Als neue Aufgaben der Forschung entstehen hier die Fragen, auf welchen Wegen diese Wandlung vor sich geht, wie gründlich oder unvollkommen sie vollzogen wird, welche verschiedenen Möglichkeiten sich bei dieser Entwicklung ergeben.
Wir haben auch bereits erkannt, daß eine weitere Differenz der Geschlechter sich auf das Verhältnis zum Ödipuskomplex bezieht. Unser Eindruck ist hier, daß unsere Aussagen über den Ödipuskomplex in voller Strenge nur für das männliche Kind passen und daß wir recht daran haben, den Namen Elektrakomplex abzulehnen, der die Analogie im Verhalten beider Geschlechter betonen will. Die schicksalhafte Beziehung von gleichzeitiger Liebe zu dem einen und Rivalitätshaß gegen den anderen Elternteil stellt sich nur für das männliche Kind her. Bei diesem ist es dann die Entdeckung der Kastrationsmöglichkeit, wie sie durch den Anblick des weiblichen Genitales erwiesen wird, die die Umbildung des Ödipuskomplexes erzwingt, die Schaffung des Über-Ichs herbeiführt und so all die Vorgänge einleitet, die auf die Einreihung des Einzelwesens in die Kulturgemeinschaft abzielen. Nach der Verinnerlichung der Vaterinstanz zum Über-Ich ist die weitere Aufgabe zu lösen, dies letztere von den Personen abzulösen, die es ursprünglich seelisch vertreten hat. Auf diesem merkwürdigen Entwicklungsweg ist gerade das narzißtische Genitalinteresse, das an der Erhaltung des Penis, zur Einschränkung der infantilen Sexualität gewendet worden.
Beim Manne erübrigt vom Einfluß des Kastrationskomplexes auch ein Maß von Geringschätzung für das als kastriert erkannte Weib. Aus dieser entwickelt sich im Extrem eine Hemmung der Objektwahl und bei Unterstützung durch organische Faktoren ausschließliche Homosexualität. Ganz andere sind die Wirkungen des Kastrationskomplexes beim Weib. Das Weib anerkennt die Tatsache seiner Kastration und damit auch die Überlegenheit des Mannes und seine eigene Minderwertigkeit, aber es sträubt sich auch gegen diesen unliebsamen Sachverhalt. Aus dieser zwiespältigen Einstellung leiten sich drei Entwicklungsrichtungen ab. Die erste führt zur allgemeinen Abwendung von der Sexualität. Das kleine Weib, durch den Vergleich mit dem Knaben geschreckt, wird mit seiner Klitoris unzufrieden, verzichtet auf seine phallische Betätigung und damit auf die Sexualität überhaupt wie auf ein gutes Stück seiner Männlichkeit auf anderen Gebieten. Die zweite Richtung hält in trotziger Selbstbehauptung an der bedrohten Männlichkeit fest; die Hoffnung, noch einmal einen Penis zu bekommen, bleibt bis in unglaublich späte Zeiten aufrecht, wird zum Lebenszweck erhoben, und die Phantasie, trotz alledem ein Mann zu sein, bleibt oft gestaltend für lange Lebensperioden. Auch dieser »Männlichkeitskomplex« des Weibes kann in manifest homosexuelle Objektwahl ausgehen. Erst eine dritte, recht umwegige Entwicklung mündet in die normal weibliche Endgestaltung aus, die den Vater als Objekt nimmt und so die weibliche Form des Ödipuskomplexes findet. Der Ödipuskomplex ist also beim Weib das Endergebnis einer längeren Entwicklung, er wird durch den Einfluß der Kastration nicht zerstört, sondern durch ihn geschaffen, er entgeht den starken feindlichen Einflüssen, die beim Mann zerstörend auf ihn einwirken, ja er wird allzuhäufig vom Weib überhaupt nicht überwunden. Darum sind auch die kulturellen Ergebnisse seines Zerfalls geringfügiger und weniger belangreich. Man geht wahrscheinlich nicht fehl, wenn man aussagt, daß dieser Unterschied in der gegenseitigen Beziehung von Ödipus- und Kastrationskomplex den Charakter des Weibes als soziales Wesen prägt [Fußnote]Man kann vorhersehen, daß die Feministen unter den Männern, aber auch unsere weiblichen Analytiker mit diesen Ausführungen nicht einverstanden sein werden. Sie dürften kaum die Einwendung zurückhalten, solche Lehren stammen aus dem »Männlichkeitskomplex« des Mannes und sollen dazu dienen, seiner angeborenen Neigung zur Herabsetzung und Unterdrückung des Weibes eine theoretische Rechtfertigung zu schaffen. Allein eine solche psychoanalytische Argumentation mahnt in diesem Falle, wie so häufig, an den berühmten »Stock mit zwei Enden« Dostojewskis. Die Gegner werden es ihrerseits begreiflich finden, daß das Geschlecht der Frauen nicht annehmen will, was der heiß begehrten Gleichstellung mit dem Manne zu widersprechen scheint. Die agonale Verwendung der Analyse führt offenbar nicht zur Entscheidung..
Die Phase der ausschließlichen Mutterbindung, die präödipal genannt werden kann, beansprucht also beim Weib eine weitaus größere Bedeutung, als ihr beim Mann zukommen kann. Viele Erscheinungen des weiblichen Sexuallebens, die früher dem Verständnis nicht recht zugänglich waren, finden in der Zurückführung auf sie ihre volle Aufklärung. Wir haben z. B. längst bemerkt, daß viele Frauen, die ihren Mann nach dem Vatervorbild gewählt oder ihn an die Vaterstelle gesetzt haben, doch in der Ehe an ihm ihr schlechtes Verhältnis zur Mutter wiederholen. Er sollte die Vaterbeziehung erben, und in Wirklichkeit erbt er die Mutterbeziehung. Das versteht man leicht als einen naheliegenden Fall von Regression. Die Mutterbeziehung war die ursprüngliche, auf sie war die Vaterbindung aufgebaut, und nun kommt in der Ehe das Ursprüngliche aus der Verdrängung zum Vorschein. Die Überschreibung affektiver Bindungen vom Mutter- auf das Vaterobjekt bildete ja den Hauptinhalt der zum Weibtum führenden Entwicklung.
Wenn wir bei so vielen Frauen den Eindruck bekommen, daß ihre Reifezeit vom Kampf mit dem Ehemann ausgefüllt wird, wie ihre Jugend im Kampf mit der Mutter verbracht wurde, so werden wir im Licht der vorstehenden Bemerkungen den Schluß ziehen, daß deren feindselige Einstellung zur Mutter nicht eine Folge der Rivalität des Ödipuskomplexes ist, sondern aus der Phase vorher stammt und in der Ödipussituation nur Verstärkung und Verwendung erfahren hat. So wird es auch durch direkte analytische Untersuchung bestätigt. Unser Interesse muß sich den Mechanismen zuwenden, die bei der Abwendung von dem so intensiv und ausschließlich geliebten Mutterobjekt wirksam geworden sind. Wir sind darauf vorbereitet, nicht ein einziges solches Moment, sondern eine ganze Reihe von solchen Momenten zu finden, die zum gleichen Endziel zusammenwirken.
Unter ihnen treten einige hervor, die durch die Verhältnisse der infantilen Sexualität überhaupt bedingt sind, also in gleicher Weise für das Liebesleben des Knaben gelten. In erster Linie ist hier die Eifersucht auf andere Personen zu nennen, auf Geschwister, Rivalen, neben denen auch der Vater Platz findet. Die kindliche Liebe ist maßlos, verlangt Ausschließlichkeit, gibt sich nicht mit Anteilen zufrieden. Ein zweiter Charakter ist aber, daß diese Liebe auch eigentlich ziellos, einer vollen Befriedigung unfähig ist, und wesentlich darum ist sie dazu verurteilt, in Enttäuschung auszugehen und einer feindlichen Einstellung Platz zu machen. In späteren Lebenszeiten kann das Ausbleiben einer Endbefriedigung einen anderen Ausgang begünstigen. Dies Moment mag wie bei den zielgehemmten Liebesbeziehungen die ungestörte Fortdauer der Libidobesetzung versichern, aber im Drang der Entwicklungsvorgänge ereignet es sich regelmäßig, daß die Libido die unbefriedigende Position verläßt, um eine neue aufzusuchen.
Ein anderes weit mehr spezifisches Motiv zur Abwendung von der Mutter ergibt sich aus der Wirkung des Kastrationskomplexes auf das penislose Geschöpf. Irgendeinmal macht das kleine Mädchen die Entdeckung seiner organischen Minderwertigkeit, natürlich früher und leichter, wenn es Brüder hat oder andere Knaben in der Nähe sind. Wir haben schon gehört, welche drei Richtungen sich dann voneinander scheiden: a) die zur Einstellung des ganzen Sexuallebens; b) die zur trotzigen Überbetonung der Männlichkeit; c) die Ansätze zur endgültigen Weiblichkeit. Genauere Zeitangaben zu machen und typische Verlaufsweisen festzulegen ist hier nicht leicht. Schon der Zeitpunkt der Entdeckung der Kastration ist wechselnd, manche andere Momente scheinen inkonstant und vom Zufall abhängig. Der Zustand der eigenen phallischen Betätigung kommt in Betracht, ebenso ob diese entdeckt wird oder nicht und welches Maß von Verhinderung nach der Entdeckung erlebt wird.
Die eigene phallische Betätigung, Masturbation an der Klitoris, wird vom kleinen Mädchen meist spontan gefunden, ist gewiß zunächst phantasielos. Dem Einfluß der Körperpflege an ihrer Erweckung wird durch die so häufige Phantasie Rechnung getragen, die Mutter, Amme oder Kinderfrau zur Verführerin macht. Ob die Onanie der Mädchen seltener und von Anfang an weniger energisch ist als die der Knaben, bleibt dahingestellt; es wäre wohl möglich. Auch wirkliche Verführung ist häufig genug, sie geht entweder von anderen Kindern oder von Pflegepersonen aus, die das Kind beschwichtigen, einschläfern oder von sich abhängig machen wollen. Wo Verführung einwirkt, stört sie regelmäßig den natürlichen Ablauf der Entwicklungsvorgänge; oft hinterläßt sie weitgehende und andauernde Konsequenzen.
Das Verbot der Masturbation wird, wie wir gehört haben, zum Anlaß, sie aufzugeben, aber auch zum Motiv der Auflehnung gegen die verbietende Person, also die Mutter oder den Mutterersatz, der später regelmäßig mit ihr verschmilzt. Die trotzige Behauptung der Masturbation scheint den Weg zur Männlichkeit zu eröffnen. Auch wo es dem Kind nicht gelungen ist, die Masturbation zu unterdrücken, zeigt sich die Wirkung des anscheinend machtlosen Verbots in seinem späteren Bestreben, sich mit allen Opfern von der ihm verleideten Befriedigung frei zu machen. Noch die Objektwahl des reifen Mädchens kann von dieser festgehaltenen Absicht beeinflußt werden. Der Groll wegen der Behinderung in der freien sexuellen Betätigung spielt eine große Rolle in der Ablösung von der Mutter. Dasselbe Motiv wird auch nach der Pubertät wieder zur Wirkung kommen, wenn die Mutter ihre Pflicht erkennt, die Keuschheit der Tochter zu behüten. Wir werden natürlich nicht daran vergessen, daß die Mutter der Masturbation des Knaben in gleicher Weise entgegentritt und somit auch ihm ein starkes Motiv zur Auflehnung schafft.
Wenn das kleine Mädchen durch den Anblick eines männlichen Genitales seinen eigenen Defekt erfährt, nimmt sie die unerwünschte Belehrung nicht ohne Zögern und ohne Sträuben an. Wie wir gehört haben, wird die Erwartung, auch einmal ein solches Genitale zu bekommen, hartnäckig festgehalten, und der Wunsch danach überlebt die Hoffnung noch um lange Zeit. In allen Fällen hält das Kind die Kastration zunächst nur für ein individuelles Mißgeschick, erst später dehnt es dieselbe auch auf einzelne Kinder, endlich auf einzelne Erwachsene aus. Mit der Einsicht in die Allgemeinheit dieses negativen Charakters stellt sich eine große Entwertung der Weiblichkeit, also auch der Mutter, her.
Es ist sehr wohl möglich, daß die vorstehende Schilderung, wie sich das kleine Mädchen gegen den Eindruck der Kastration und das Verbot der Onanie verhält, dem Leser einen verworrenen und widerspruchsvollen Eindruck macht. Das ist nicht ganz die Schuld des Autors. In Wirklichkeit ist eine allgemein zutreffende Darstellung kaum möglich. Bei verschiedenen Individuen findet man die verschiedensten Reaktionen, bei demselben Individuum bestehen die entgegengesetzten Einstellungen nebeneinander. Mit dem ersten Eingreifen des Verbots ist der Konflikt da, der von nun an die Entwicklung der Sexualfunktion begleiten wird. Es bedeutet auch eine besondere Erschwerung der Einsicht, daß man so große Mühe hat, die seelischen Vorgänge dieser ersten Phase von späteren zu unterscheiden, durch die sie überdeckt und für die Erinnerung entstellt werden. So wird z. B. später einmal die Tatsache der Kastration als Strafe für die onanistische Betätigung aufgefaßt, deren Ausführung aber dem Vater zugeschoben, was beides gewiß nicht ursprünglich sein kann. Auch der Knabe befürchtet die Kastration regelmäßig von Seiten des Vaters, obwohl auch bei ihm die Drohung zumeist von der Mutter ausgeht.
Wie dem auch sein mag, am Ende dieser ersten Phase der Mutterbindung taucht als das stärkste Motiv zur Abwendung von der Mutter der Vorwurf auf, daß sie dem Kind kein richtiges Genitale mitgegeben, d. h. es als Weib geboren hat. Nicht ohne Überraschung vernimmt man einen anderen Vorwurf, der etwas weniger weit zurückgreift: die Mutter hat dem Kind zu wenig Milch gegeben, es nicht lange genug genährt. Das mag in unseren kulturellen Verhältnissen recht oft zutreffen, aber gewiß nicht so oft, als es in der Analyse behauptet wird. Es scheint vielmehr, als sei diese Anklage ein Ausdruck der allgemeinen Unzufriedenheit der Kinder, die unter den kulturellen Bedingungen der Monogamie nach sechs bis neun Monaten der Mutterbrust entwöhnt werden, während die primitive Mutter sich zwei bis drei Jahre lang ausschließlich ihrem Kinde widmet, als wären unsere Kinder für immer ungesättigt geblieben, als hätten sie nie lang genug an der Mutterbrust gesogen. Ich bin aber nicht sicher, ob man nicht bei der Analyse von Kindern, die so lange gesäugt worden sind wie die Kinder der Primitiven, auf dieselbe Klage stoßen würde. So groß ist die Gier der kindlichen Libido! Überblickt man die ganze Reihe der Motivierungen, welche die Analyse für die Abwendung von der Mutter aufdeckt, daß sie es unterlassen hat, das Mädchen mit dem einzig richtigen Genitale auszustatten, daß sie es ungenügend ernährt hat, es gezwungen hat, die Mutterliebe mit anderen zu teilen, daß sie nie alle Liebeserwartungen erfüllt, und endlich, daß sie die eigene Sexualbetätigung zuerst angeregt und dann verboten hat, so scheinen sie alle zur Rechtfertigung der endlichen Feindseligkeit unzureichend. Die einen von ihnen sind unvermeidliche Abfolgen aus der Natur der infantilen Sexualität, die anderen nehmen sich aus wie später zurechtgemachte Rationalisierungen der unverstandenen Gefühlswandlung. Vielleicht geht es eher so zu, daß die Mutterbindung zugrunde gehen muß, gerade darum, weil sie die erste und so intensiv ist, ähnlich wie man es so oft an den ersten, in stärkster Verliebtheit geschlossenen Ehen der jungen Frauen beobachten kann. Hier wie dort würde die Liebeseinstellung an den unausweichlichen Enttäuschungen und an der Anhäufung der Anlässe zur Aggression scheitern. Zweite Ehen gehen in der Regel weit besser aus.
Wir können nicht so weit gehen zu behaupten, daß die Ambivalenz der Gefühlsbesetzungen ein allgemeingültiges psychologisches Gesetz ist, daß es überhaupt unmöglich ist, große Liebe für eine Person zu empfinden, ohne daß sich ein vielleicht ebenso großer Haß hinzugesellt oder umgekehrt. Dem Normalen und Erwachsenen gelingt es ohne Zweifel, beide Einstellungen voneinander zu sondern, sein Liebesobjekt nicht zu hassen und seinen Feind nicht auch lieben zu müssen. Aber das scheint das Ergebnis späterer Entwicklungen. In den ersten Phasen des Liebeslebens ist offenbar die Ambivalenz das Regelrechte. Bei vielen Menschen bleibt dieser archaische Zug über das ganze Leben erhalten, für die Zwangsneurotiker ist es charakteristisch, daß in ihren Objektbeziehungen Liebe und Haß einander die Waage halten. Auch für die Primitiven dürfen wir das Vorwiegen der Ambivalenz behaupten. Die intensive Bindung des kleinen Mädchens an seine Mutter müßte also eine stark ambivalente sein und unter der Mithilfe der anderen Momente gerade durch diese Ambivalenz zur Abwendung von ihr gedrängt werden, also wiederum infolge eines allgemeinen Charakters der infantilen Sexualität.
Gegen diesen Erklärungsversuch erhebt sich sofort die Frage: Wie wird es aber den Knaben möglich, ihre gewiß nicht weniger intensive Mutterbindung unangefochten festzuhalten? Ebenso rasch ist die Antwort bereit: Weil es ihnen ermöglicht ist, ihre Ambivalenz gegen die Mutter zu erledigen, indem sie all ihre feindseligen Gefühle beim Vater unterbringen. Aber erstens soll man diese Antwort nicht geben, ehe man die präödipale Phase der Knaben eingehend studiert hat, und zweitens ist es wahrscheinlich überhaupt vorsichtiger, sich einzugestehen, daß man diese Vorgänge, die man eben kennengelernt hat, noch gar nicht gut durchschaut.
III
Eine weitere Frage lautet: Was verlangt das kleine Mädchen von der Mutter? Welcher Art sind seine Sexualziele in jener Zeit der ausschließlichen Mutterbindung? Die Antwort, die man aus dem analytischen Material entnimmt, stimmt ganz mit unseren Erwartungen überein. Die Sexualziele des Mädchens bei der Mutter sind aktiver wie passiver Natur, und sie werden durch die Libidophasen bestimmt, die das Kind durchläuft. Das Verhältnis der Aktivität zur Passivität verdient hier unser besonderes Interesse. Es ist leicht zu beobachten, daß auf jedem Gebiet des seelischen Erlebens, nicht nur auf dem der Sexualität, ein passiv empfangener Eindruck beim Kind die Tendenz zu einer aktiven Reaktion hervorruft. Es versucht, das selbst zu machen, was vorhin an oder mit ihm gemacht worden ist. Es ist das ein Stück der Bewältigungsarbeit an der Außenwelt, die ihm auferlegt ist, und kann selbst dazu führen, daß es sich um die Wiederholung solcher Eindrücke bemüht, die es wegen ihres peinlichen Inhalts zu vermeiden Anlaß hätte. Auch das Kinderspiel wird in den Dienst dieser Absicht gestellt, ein passives Erlebnis durch eine aktive Handlung zu ergänzen und es gleichsam auf diese Art aufzuheben. Wenn der Doktor dem sich sträubenden Kind den Mund geöffnet hat, um ihm in den Hals zu schauen, so wird nach seinem Fortgehen das Kind den Doktor spielen und die gewalttätige Prozedur an einem kleinen Geschwisterchen wiederholen, das ebenso hilflos gegen es ist, wie es selbst gegen den Doktor war. Eine Auflehnung gegen die Passivität und eine Bevorzugung der aktiven Rolle ist dabei unverkennbar. Nicht bei allen Kindern wird diese Schwenkung von der Passivität zur Aktivität gleich regelmäßig und energisch ausfallen, bei manchen mag sie ausbleiben. Aus diesem Verhalten des Kindes mag man einen Schluß auf die relative Stärke der Männlichkeit und Weiblichkeit ziehen, die das Kind in seiner Sexualität an den Tag legen wird.
Die ersten sexuellen und sexuell mitbetonten Erlebnisse des Kindes bei der Mutter sind natürlich passiver Natur. Es wird von ihr gesäugt, gefüttert, gereinigt, gekleidet und zu allen Verrichtungen angewiesen. Ein Teil der Libido des Kindes bleibt an diesen Erfahrungen haften und genießt die mit ihnen verbundenen Befriedigungen, ein anderer Teil versucht sich an ihrer Umwendung zur Aktivität. An der Mutterbrust wird zuerst das Gesäugtwerden durch das aktive Saugen abgelöst. In den anderen Beziehungen begnügt sich das Kind entweder mit der Selbständigkeit, d. h. mit dem Erfolg, daß es selbst ausführt, was bisher mit ihm geschehen ist, oder mit aktiver Wiederholung seiner passiven Erlebnisse im Spiel, oder es macht wirklich die Mutter zum Objekt, gegen das es als tätiges Subjekt auftritt. Das letztere, was auf dem Gebiet der eigentlichen Betätigung vor sich geht, erschien mir lange Zeit hindurch unglaublich, bis die Erfahrung jeden Zweifel daran widerlegte.
Man hört selten davon, daß das kleine Mädchen die Mutter waschen, ankleiden oder zur Verrichtung ihrer exkrementellen Bedürfnisse mahnen will. Es sagt zwar gelegentlich: jetzt wollen wir spielen, daß ich die Mutter bin und du das Kind – aber zumeist erfüllt es sich diese aktiven Wünsche in indirekter Weise im Spiel mit der Puppe, in dem es selbst die Mutter darstellt wie die Puppe das Kind. Die Bevorzugung des Spiels mit der Puppe beim Mädchen im Gegensatz zum Knaben wird gewöhnlich als Zeichen der früh erwachten Weiblichkeit aufgefaßt. Nicht mit Unrecht, allein man soll nicht übersehen, daß es die Aktivität der Weiblichkeit ist, die sich hier äußert, und daß diese Vorliebe des Mädchens wahrscheinlich die Ausschließlichkeit der Bindung an die Mutter bei voller Vernachlässigung des Vaterobjekts bezeugt.
Die so überraschende sexuelle Aktivität des Mädchens gegen die Mutter äußert sich der Zeitfolge nach in oralen, sadistischen und endlich selbst phallischen, auf die Mutter gerichteten Strebungen. Die Einzelheiten sind hier schwer zu berichten, denn es handelt sich häufig um dunkle Triebregungen, die das Kind nicht psychisch erfassen konnte zur Zeit, da sie vorfielen, die darum erst eine nachträgliche Interpretation erfahren haben und dann in der Analyse in Ausdrucksweisen auftreten, die ihnen ursprünglich gewiß nicht zukamen. Mitunter begegnen sie uns als Übertragungen auf das spätere Vaterobjekt, wo sie nicht hingehören und das Verständnis empfindlich stören. Die aggressiven oralen und sadistischen Wünsche findet man in der Form, in welche sie durch frühzeitige Verdrängung genötigt werden, als Angst, von der Mutter umgebracht zu werden, die ihrerseits den Todeswunsch gegen die Mutter, wenn er bewußt wird, rechtfertigt. Wie oft diese Angst vor der Mutter sich an eine unbewußte Feindseligkeit der Mutter anlehnt, die das Kind errät, läßt sich nicht angeben. (Die Angst, gefressen zu werden, habe ich bisher nur bei Männern gefunden, sie wird auf den Vater bezogen, ist aber wahrscheinlich das Verwandlungsprodukt der auf die Mutter gerichteten oralen Aggression. Man will die Mutter auffressen, von der man sich genährt hat; beim Vater fehlt für diesen Wunsch der nächste Anlaß.)
Die weiblichen Personen mit starker Mutterbindung, an denen ich die präödipale Phase studieren konnte, haben übereinstimmend berichtet, daß sie den Klystieren und Darmeingießungen, die die Mutter bei ihnen vornahm, größten Widerstand entgegenzusetzen und mit Angst und Wutgeschrei darauf zu reagieren pflegten. Dies kann wohl ein sehr häufiges oder selbst regelmäßiges Verhalten der Kinder sein. Die Einsicht in die Begründung dieses besonders heftigen Sträubens gewann ich erst durch eine Bemerkung von Ruth Mack Brunswick, die sich gleichzeitig mit den nämlichen Problemen beschäftigte, sie möchte den Wutausbruch nach dem Klysma dem Orgasmus nach genitaler Reizung vergleichen. Die Angst dabei wäre als Umsetzung der regegemachten Aggressionslust zu verstehen. Ich meine, daß es wirklich so ist und daß auf der sadistisch-analen Stufe die intensive passive Reizung der Darmzone durch einen Ausbruch von Aggressionslust beantwortet wird, die sich direkt als Wut oder infolge ihrer Unterdrückung als Angst kundgibt. Diese Reaktion scheint in späteren Jahren zu versiegen.
Unter den passiven Regungen der phallischen Phase hebt sich hervor, daß das Mädchen regelmäßig die Mutter als Verführerin beschuldigt, weil sie die ersten oder doch die stärksten genitalen Empfindungen bei den Vornahmen der Reinigung und Körperpflege durch die Mutter (oder die sie vertretende Pflegeperson) verspüren mußte. Daß das Kind diese Empfindungen gerne mag und die Mutter auffordert, sie durch wiederholte Berührung und Reibung zu verstärken, ist mir oft von Müttern als Beobachtung an ihren zwei- bis dreijährigen Töchterchen mitgeteilt worden. Ich mache die Tatsache, daß die Mutter dem Kind so unvermeidlich die phallische Phase eröffnet, dafür verantwortlich, daß in den Phantasien späterer Jahre so regelmäßig der Vater als der sexuelle Verführer erscheint. Mit der Abwendung von der Mutter ist auch die Einführung ins Geschlechtsleben auf den Vater überschrieben worden.
In der phallischen Phase kommen endlich auch intensive aktive Wunschregungen gegen die Mutter zustande. Die Sexualbetätigung dieser Zeit gipfelt in der Masturbation an der Klitoris, dabei wird wahrscheinlich die Mutter vorgestellt, aber ob es das Kind zur Vorstellung eines Sexualziels bringt und welches dies Ziel ist, ist aus meiner Erfahrung nicht zu erraten. Erst wenn alle Interessen des Kindes durch die Ankunft eines Geschwisterchens einen neuen Antrieb erhalten haben, läßt sich ein solches Ziel klar erkennen. Das kleine Mädchen will der Mutter dies neue Kind gemacht haben, ganz so wie der Knabe, und auch seine Reaktion auf dies Ereignis und sein Benehmen gegen das Kind ist dasselbe. Das klingt ja absurd genug, aber vielleicht nur darum, weil es uns so ungewohnt klingt.
Die Abwendung von der Mutter ist ein höchst bedeutsamer Schritt auf dem Entwicklungsweg des Mädchens, sie ist mehr als ein bloßer Objektwechsel. Wir haben ihren Hergang und die Häufung ihrer vorgeblichen Motivierungen bereits beschrieben, nun fügen wir hinzu, daß Hand in Hand mit ihr ein starkes Absinken der aktiven und ein Anstieg der passiven Sexualregungen zu beobachten ist. Gewiß sind die aktiven Strebungen stärker von der Versagung betroffen worden, sie haben sich als durchaus unausführbar erwiesen und werden darum auch leichter von der Libido verlassen, aber auch auf Seite der passiven Strebungen hat es an Enttäuschungen nicht gefehlt. Häufig wird mit der Abwendung von der Mutter auch die klitoridische Masturbation eingestellt, oft genug wird mit der Verdrängung der bisherigen Männlichkeit des kleinen Mädchens ein gutes Stück ihres Sexualstrebens überhaupt dauernd geschädigt. Der Übergang zum Vaterobjekt wird mit Hilfe der passiven Strebungen vollzogen, soweit diese dem Umsturz entgangen sind. Der Weg zur Entwicklung der Weiblichkeit ist nun dem Mädchen freigegeben, insoferne er nicht durch die Reste der überwundenen präödipalen Mutterbindung eingeengt ist.
Überblickt man nun das hier beschriebene Stück der weiblichen Sexualentwicklung, so kann man ein bestimmtes Urteil über das Ganze der Weiblichkeit nicht zurückdrängen. Man hat die nämlichen libidinösen Kräfte wirksam gefunden wie beim männlichen Kind, konnte sich überzeugen, daß sie eine Zeitlang hier wie dort dieselben Wege einschlagen und zu den gleichen Ergebnissen kommen.
Es sind dann biologische Faktoren, die sie von ihren anfänglichen Zielen ablenken und selbst aktive, in jedem Sinne männliche Strebungen in die Bahnen der Weiblichkeit leiten. Da wir die Zurückführung der Sexualerregung auf die Wirkung bestimmter chemischer Stoffe nicht abweisen können, liegt zuerst die Erwartung nahe, daß uns die Biochemie eines Tages einen Stoff darstellen wird, dessen Gegenwart die männliche, und einen, der die weibliche Sexualerregung hervorruft. Aber diese Hoffnung scheint nicht weniger naiv als die andere, heute glücklich überwundene, unter dem Mikroskop die Erreger von Hysterie, Zwangsneurose, Melancholie usw. gesondert aufzufinden.
Es muß auch in der Sexualchemie etwas komplizierter zugehen. Für die Psychologie ist es aber gleichgültig, ob es einen einzigen sexuell erregenden Stoff im Körper gibt oder deren zwei oder eine Unzahl davon. Die Psychoanalyse lehrt uns, mit einer einzigen Libido auszukommen, die allerdings aktive und passive Ziele, also Befriedigungsarten, kennt. In diesem Gegensatz, vor allem in der Existenz von Libidostrebungen mit passiven Zielen, ist der Rest des Problems enthalten.
IV
Wenn man die analytische Literatur unseres Gegenstandes einsieht, überzeugt man sich, daß alles, was ich hier ausgeführt habe, dort bereits gegeben ist. Es wäre unnötig gewesen, diese Arbeit zu veröffentlichen, wenn nicht auf einem so schwer zugänglichen Gebiet jeder Bericht über eigene Erfahrungen und persönliche Auffassungen wertvoll sein könnte. Auch habe ich manches schärfer gefaßt und sorgfältiger isoliert. In einigen der anderen Abhandlungen wird die Darstellung unübersichtlich infolge der gleichzeitigen Erörterung der Probleme des Über-Ichs und des Schuldgefühls. Dem bin ich ausgewichen, ich habe bei der Beschreibung der verschiedenen Ausgänge dieser Entwicklungsphase auch nicht die Komplikationen behandelt, die sich ergeben, wenn das Kind infolge der Enttäuschung am Vater zur aufgelassenen Mutterbindung zurückkehrt oder nun im Laufe des Lebens wiederholt von einer Einstellung zur anderen herüberwechselt. Aber gerade weil meine Arbeit nur ein Beitrag ist unter anderen, darf ich mir eine eingehende Würdigung der Literatur ersparen und kann mich darauf beschränken, bedeutsamere Übereinstimmungen mit einigen und wichtigere Abweichungen von anderen dieser Arbeiten hervorzuheben.
In die eigentlich noch unübertroffene Schilderung Abrahams der ›Äußerungsformen des weiblichen Kastrationskomplexes‹ (1921) möchte man gerne das Moment der anfänglich ausschließlichen Mutterbindung eingefügt wissen. Der wichtigen Arbeit von Jeanne [Fußnote]Nach dem Wunsch der Autorin korrigiere ich so ihren Namen, der in der Zeitschrift als A. L. de Gr. angeführt ist. Lampl-de Groot (1927) muß ich in den wesentlichen Punkten zustimmen. Hier wird die volle Identität der präödipalen Phase bei Knaben und Mädchen erkannt, die sexuelle (phallische) Aktivität des Mädchens gegen die Mutter behauptet und durch Beobachtungen erwiesen. Die Abwendung von der Mutter wird auf den Einfluß der zur Kenntnis genommenen Kastration zurückgeführt, die das Kind dazu nötigt, das Sexualobjekt und damit auch oft die Onanie aufzugeben, für die ganze Entwicklung die Formel geprägt, daß das Mädchen eine Phase des »negativen« Ödipuskomplexes durchmacht, ehe sie in den positiven eintreten kann. Eine Unzulänglichkeit dieser Arbeit finde ich darin, daß sie die Abwendung von der Mutter als bloßen Objektwechsel darstellt und nicht darauf eingeht, daß sie sich unter den deutlichsten Zeichen von Feindseligkeit vollzieht. Diese Feindseligkeit findet volle Würdigung in der letzten Arbeit von Helene Deutsch (1930), woselbst auch die phallische Aktivität des Mädchens und die Intensität seiner Mutterbindung anerkannt werden. H. Deutsch gibt auch an, daß die Wendung zum Vater auf dem Weg der (bereits bei der Mutter rege gewordenen) passiven Strebungen geschieht. In ihrem früher (1925) veröffentlichten Buch Psychoanalyse der weiblichen Sexualfunktionen hatte die Autorin sich von der Anwendung des Ödipusschemas auch auf die präödipale Phase noch nicht frei gemacht und darum die phallische Aktivität des Mädchens als Identifizierung mit dem Vater gedeutet.
Fenichel (1930) betont mit Recht die Schwierigkeit zu erkennen, was von dem in der Analyse erhobenen Material unveränderter Inhalt der präödipalen Phase und was daran regressiv (oder anders) entstellt ist. Er anerkennt die phallische Aktivität des Mädchens nach Jeanne Lampl-de Groot nicht, verwahrt sich auch gegen die von Melanie Klein (1928) vorgenommene »Vorverlegung« des Ödipuskomplexes, dessen Beginn sie schon in den Anfang des zweiten Lebensjahres versetzt. Diese Zeitbestimmung, die notwendigerweise auch die Auffassung aller anderen Verhältnisse der Entwicklung verändert, deckt sich in der Tat nicht mit den Ergebnissen der Analyse an Erwachsenen und ist besonders unvereinbar mit meinen Befunden von der langen Andauer der präödipalen Mutterbindung der Mädchen. Einen Weg zur Milderung dieses Widerspruches weist die Bemerkung, daß wir auf diesem Gebiet noch nicht zu unterscheiden vermögen, was durch biologische Gesetze starr festgelegt und was unter dem Einfluß akzidentellen Erlebens beweglich und veränderlich ist. Wie es von der Wirkung der Verführung längst bekannt ist, können auch andere Momente, der Zeitpunkt der Geburt von Geschwistern, der Zeitpunkt der Entdeckung des Geschlechtsunterschieds, die direkte Beobachtung des Geschlechtsverkehrs, das werbende oder abweisende Benehmen der Eltern u. a., eine Beschleunigung und Reifung der kindlichen Sexualentwicklung herbeiführen.
Bei manchen Autoren zeigt sich die Neigung, die Bedeutung der ersten ursprünglichsten Libidoregungen des Kindes zugunsten späterer Entwicklungsvorgänge herabzudrücken, so daß jenen – extrem ausgedrückt – die Rolle verbliebe, nur gewisse Richtungen anzugeben, während die Intensitäten, welche diese Wege einschlagen, von späteren Regressionen und Reaktionsbildungen bestritten werden. So z. B. wenn K. Horney (1926) meint, daß der primäre Penisneid des Mädchens von uns weit überschätzt wird, während die Intensität des später entfalteten Männlichkeitsstrebens einem sekundären Penisneid zuzuschreiben ist, der zur Abwehr der weiblichen Regungen, speziell der weiblichen Bindung an den Vater, gebraucht wird. Das entspricht nicht meinen Eindrücken. So sicher die Tatsache späterer Verstärkungen durch Regression und Reaktionsbildung ist, so schwierig es auch sein mag, die relative Abschätzung der zusammenströmenden Libidokomponenten vorzunehmen, so meine ich doch, wir sollen nicht übersehen, daß jenen ersten Libidoregungen eine Intensität eigen ist, die allen späteren überlegen bleibt, eigentlich inkommensurabel genannt werden darf. Es ist gewiß richtig, daß zwischen der Vaterbindung und dem Männlichkeitskomplex eine Gegensätzlichkeit besteht – es ist der allgemeine Gegensatz zwischen Aktivität und Passivität, Männlichkeit und Weiblichkeit –, aber es gibt uns kein Recht anzunehmen, nur das eine sei primär, das andere verdanke seine Stärke nur der Abwehr. Und wenn die Abwehr gegen die Weiblichkeit so energisch ausfällt, woher kann sie sonst ihre Kraft beziehen als aus dem Männlichkeitsstreben, das seinen ersten Ausdruck im Penisneid des Kindes gefunden hat und darum nach ihm benannt zu werden verdient?
Ein ähnlicher Einwand ergibt sich gegen die Auffassung von Jones (1928), nach der das phallische Stadium bei Mädchen eher eine sekundäre Schutzreaktion sein soll als ein wirkliches Entwicklungsstadium. Das entspricht weder den dynamischen noch den zeitlichen Verhältnissen
Über einen besonderen Typus der Objektwahl beim Manne (1910)
Wir haben es bisher den Dichtern überlassen, uns zu schildern, nach welchen »Liebesbedingungen« die Menschen ihre Objektwahl treffen und wie sie die Anforderungen ihrer Phantasie mit der Wirklichkeit in Einklang bringen. Die Dichter verfügen auch über manche Eigenschaften, welche sie zur Lösung einer solchen Aufgabe befähigen, vor allem über die Feinfühligkeit für die Wahrnehmung verborgener Seelenregungen bei anderen und den Mut, ihr eigenes Unbewußtes laut werden zu lassen. Aber der Erkenntniswert ihrer Mitteilungen wird durch einen Umstand herabgesetzt. Die Dichter sind an die Bedingung gebunden, intellektuelle und ästhetische Lust sowie bestimmte Gefühlswirkungen zu erzielen, und darum können sie den Stoff der Realität nicht unverändert darstellen, sondern müssen Teilstücke desselben isolieren, störende Zusammenhänge auflösen, das Ganze mildern und Fehlendes ersetzen. Es sind dies Vorrechte der sogenannten »poetischen Freiheit«. Auch können sie nur wenig Interesse für die Herkunft und Entwicklung solcher seelischer Zustände äußern, die sie als fertige beschreiben. Somit wird es doch unvermeidlich, daß die Wissenschaft mit plumperen Händen und zu geringerem Lustgewinne sich mit denselben Materien beschäftige, an deren dichterischer Bearbeitung sich die Menschen seit Tausenden von Jahren erfreuen. Diese Bemerkungen mögen zur Rechtfertigung einer streng wissenschaftlichen Bearbeitung auch des menschlichen Liebeslebens dienen. Die Wissenschaft ist eben die vollkommenste Lossagung vom Lustprinzip, die unserer psychischen Arbeit möglich ist.
Während der psychoanalytischen Behandlungen hat man reichlich Gelegenheit, sich Eindrücke aus dem Liebesleben der Neurotiker zu holen, und kann sich dabei erinnern, daß man ähnliches Verhalten auch bei durchschnittlich Gesunden oder selbst bei hervorragenden Menschen beobachtet oder erfahren hat. Durch Häufung der Eindrücke infolge zufälliger Gunst des Materials treten dann einzelne Typen deutlicher hervor. Einen solchen Typus der männlichen Objektwahl will ich hier zuerst beschreiben, weil er sich durch eine Reihe von »Liebesbedingungen« auszeichnet, deren Zusammentreffen nicht verständlich, ja eigentlich befremdend ist, und weil er eine einfache psychoanalytische Aufklärung zuläßt.
(1) Die erste dieser Liebesbedingungen ist als geradezu spezifisch zu bezeichnen; sobald man sie vorfindet, darf man nach dem Vorhandensein der anderen Charaktere dieses Typus suchen. Man kann sie die Bedingung des » geschädigten Dritten« nennen; ihr Inhalt geht dahin, daß der Betreffende niemals ein Weib zum Liebesobjekt wählt, welches noch frei ist, also ein Mädchen oder eine alleinstehende Frau, sondern nur ein solches Weib, auf das ein anderer Mann als Ehegatte, Verlobter, Freund Eigentumsrechte geltend machen kann. Diese Bedingung zeigt sich in manchen Fällen so unerbittlich, daß dasselbe Weib zuerst übersehen oder selbst verschmäht werden kann, solange es niemandem angehört, während es sofort Gegenstand der Verliebtheit wird, sobald es in eine der genannten Beziehungen zu einem anderen Manne tritt.
(2) Die zweite Bedingung ist vielleicht minder konstant, aber nicht weniger auffällig. Der Typus wird erst durch ihr Zusammentreffen mit der ersten erfüllt, während die erste auch für sich allein in großer Häufigkeit vorzukommen scheint. Diese zweite Bedingung besagt, daß das keusche und unverdächtige Weib niemals den Reiz ausübt, der es zum Liebesobjekt erhebt, sondern nur das irgendwie sexuell anrüchige, an dessen Treue und Verläßlichkeit ein Zweifel gestattet ist. Dieser letztere Charakter mag in einer bedeutungsvollen Reihe variieren, von dem leisen Schatten auf dem Ruf einer dem Flirt nicht abgeneigten Ehefrau bis zur offenkundig polygamen Lebensführung einer Kokotte oder Liebeskünstlerin, aber auf irgend etwas dieser Art wird von den zu unserem Typus Gehörigen nicht verzichtet. Man mag diese Bedingung mit etwas Vergröberung die der » Dirnenliebe« heißen.
Wie die erste Bedingung Anlaß zur Befriedigung von agonalen, feindseligen Regungen gegen den Mann gibt, dem man das geliebte Weib entreißt, so steht die zweite Bedingung, die der Dirnenhaftigkeit des Weibes, in Beziehung zur Betätigung der Eifersucht, die für Liebende dieses Typus ein Bedürfnis zu sein scheint. Erst wenn sie eifersüchtig sein können, erreicht die Leidenschaft ihre Höhe, gewinnt das Weib seinen vollen Wert, und sie versäumen nie, sich eines Anlasses zu bemächtigen, der ihnen das Erleben dieser stärksten Empfindungen gestattet. Merkwürdigerweise ist es nicht der rechtmäßige Besitzer der Geliebten, gegen den sich diese Eifersucht richtet, sondern neu auftauchende Fremde, mit denen man die Geliebte in Verdacht bringen kann. In grellen Fällen zeigt der Liebende keinen Wunsch, das Weib für sich allein zu besitzen, und scheint sich in dem dreieckigen Verhältnis durchaus wohl zu fühlen. Einer meiner Patienten, der unter den Seitensprüngen seiner Dame entsetzlich gelitten hatte, hatte doch gegen ihre Verheiratung nichts einzuwenden, sondern förderte diese mit allen Mitteln; gegen den Mann zeigte er dann durch Jahre niemals eine Spur von Eifersucht. Ein anderer typischer Fall war in seinen ersten Liebesbeziehungen allerdings sehr eifersüchtig gegen den Ehegatten gewesen und hatte die Dame genötigt, den ehelichen Verkehr mit diesem einzustellen; in seinen zahlreichen späteren Verhältnissen benahm er sich aber wie die anderen und faßte den legitimen Mann nicht mehr als Störung auf.
Die folgenden Punkte schildern nicht mehr die vom Liebesobjekt geforderten Bedingungen, sondern das Verhalten des Liebenden gegen das Objekt seiner Wahl.
(3) Im normalen Liebesleben wird der Wert des Weibes durch seine sexuelle Integrität bestimmt und durch die Annäherung an den Charakter der Dirnenhaftigkeit herabgesetzt. Es erscheint daher als eine auffällige Abweichung vom Normalen, daß von den Liebenden unseres Typus die mit diesem Charakter behafteten Frauen als höchstwertige Liebesobjekte behandelt werden. Die Liebesbeziehungen zu diesen Frauen werden mit dem höchsten psychischen Aufwand bis zur Aufzehrung aller anderen Interessen betrieben; sie sind die einzigen Personen, die man lieben kann, und die Selbstanforderung der Treue wird jedesmal wieder erhoben, sooft sie auch in der Wirklichkeit durchbrochen werden mag. In diesen Zügen der beschriebenen Liebesbeziehungen prägt sich überdeutlich der zwanghafte Charakter aus, welcher ja in gewissem Grade jedem Falle von Verliebtheit eignet. Man darf aber aus der Treue und Intensität der Bindung nicht die Erwartung ableiten, daß ein einziges solches Liebesverhältnis das Liebesleben der Betreffenden ausfülle oder sich nur einmal innerhalb desselben abspiele. Vielmehr wiederholen sich Leidenschaften dieser Art mit den gleichen Eigentümlichkeiten – die eine das genaue Abbild der anderen – mehrmals im Leben der diesem Typus Angehörigen, ja die Liebesobjekte können nach äußeren Bedingungen, z. B. Wechsel von Aufenthalt und Umgebung, einander so häufig ersetzen, daß es zur Bildung einer langen Reihe kommt.
(4) Am überraschendsten wirkt auf den Beobachter die bei den Liebenden dieses Typus sich äußernde Tendenz, die Geliebte zu » retten«. Der Mann ist überzeugt, daß die Geliebte seiner bedarf, daß sie ohne ihn jeden sittlichen Halt verlieren und rasch auf ein bedauernswertes Niveau herabsinken würde. Er rettet sie also, indem er nicht von ihr läßt. Die Rettungsabsicht kann sich in einzelnen Fällen durch die Berufung auf die sexuelle Unverläßlichkeit und die sozial gefährdete Position der Geliebten rechtfertigen; sie tritt aber nicht minder deutlich hervor, wo solche Anlehnungen an die Wirklichkeit fehlen. Einer der zum beschriebenen Typus gehörigen Männer, der seine Damen durch kunstvolle Verführung und spitzfindige Dialektik zu gewinnen verstand, scheute dann im Liebesverhältnis keine Anstrengung, um die jeweilige Geliebte durch selbstverfaßte Traktate auf dem Wege der »Tugend« zu erhalten.
Überblickt man die einzelnen Züge des hier geschilderten Bildes, die Bedingungen der Unfreiheit und der Dirnenhaftigkeit der Geliebten, die hohe Wertung derselben, das Bedürfnis nach Eifersucht, die Treue, die sich doch mit der Auflösung in eine lange Reihe verträgt, und die Rettungsabsicht, so wird man eine Ableitung derselben aus einer einzigen Quelle für wenig wahrscheinlich halten. Und doch ergibt sich eine solche leicht bei psychoanalytischer Vertiefung in die Lebensgeschichte der in Betracht kommenden Personen. Diese eigentümlich bestimmte Objektwahl und das so sonderbare Liebesverhalten haben dieselbe psychische Abkunft wie im Liebesleben des Normalen, sie entspringen aus der infantilen Fixierung der Zärtlichkeit an die Mutter und stellen einen der Ausgänge dieser Fixierung dar. Im normalen Liebesleben erübrigen nur wenige Züge, welche das mütterliche Vorbild der Objektwahl unverkennbar verraten, so zum Beispiel die Vorliebe junger Männer für gereiftere Frauen; die Ablösung der Libido von der Mutter hat sich verhältnismäßig rasch vollzogen. Bei unserem Typus hingegen hat die Libido auch nach dem Eintritt der Pubertät so lange bei der Mutter verweilt, daß den später gewählten Liebesobjekten die mütterlichen Charaktere eingeprägt bleiben, daß diese alle zu leicht kenntlichen Muttersurrogaten werden. Es drängt sich hier der Vergleich mit der Schädelformation des Neugeborenen auf; nach protrahierter Geburt muß der Schädel des Kindes den Ausguß der mütterlichen Beckenenge darstellen.
Es obliegt uns nun, wahrscheinlich zu machen, daß die charakteristischen Züge unseres Typus, Liebesbedingungen wie Liebesverhalten, wirklich der mütterlichen Konstellation entspringen. Am leichtesten dürfte dies für die erste Bedingung, die der Unfreiheit des Weibes oder des geschädigten Dritten, gelingen. Man sieht ohne weiteres ein, daß bei dem in der Familie aufwachsenden Kinde die Tatsache, daß die Mutter dem Vater gehört, zum unabtrennbaren Stück des mütterlichen Wesens wird und daß kein anderer als der Vater selbst der geschädigte Dritte ist. Ebenso ungezwungen fügt sich der überschätzende Zug, daß die Geliebte die Einzige, Unersetzliche ist, in den infantilen Zusammenhang ein, denn niemand besitzt mehr als eine Mutter, und die Beziehung zu ihr ruht auf dem Fundament eines jedem Zweifel entzogenen und nicht zu wiederholenden Ereignisses.
Wenn die Liebesobjekte bei unserem Typus vor allem Muttersurrogate sein sollen, so wird auch die Reihenbildung verständlich, welche der Bedingung der Treue so direkt zu widersprechen scheint. Die Psychoanalyse belehrt uns auch durch andere Beispiele, daß das im Unbewußten wirksame Unersetzliche sich häufig durch die Auflösung in eine unendliche Reihe kundgibt, unendlich darum, weil jedes Surrogat doch die erstrebte Befriedigung vermissen läßt. So erklärt sich die unstillbare Fragelust der Kinder in gewissem Alter daraus, daß sie eine einzige Frage zu stellen haben, die sie nicht über ihre Lippen bringen, die Geschwätzigkeit mancher neurotisch geschädigter Personen aus dem Drucke eines Geheimnisses, das zur Mitteilung drängt und das sie aller Versuchung zum Trotze doch nicht verraten.
Dagegen scheint die zweite Liebesbedingung, die der Dirnenhaftigkeit des gewählten Objekts, einer Ableitung aus dem Mutterkomplex energisch zu widerstreben. Dem bewußten Denken des Erwachsenen erscheint die Mutter gern als Persönlichkeit von unantastbarer sittlicher Reinheit, und wenig anderes wirkt, wenn es von außen kommt, so beleidigend oder wird, wenn es von innen aufsteigt, so peinigend empfunden wie ein Zweifel an diesem Charakter der Mutter. Gerade dieses Verhältnis von schärfstem Gegensatze zwischen der »Mutter« und der »Dirne« wird uns aber anregen, die Entwicklungsgeschichte und das unbewußte Verhältnis dieser beiden Komplexe zu erforschen, wenn wir längst erfahren haben, daß im Unbewußten häufig in Eines zusammenfällt, was im Bewußtsein in zwei Gegensätze gespalten vorliegt. Die Untersuchung führt uns dann in die Lebenszeit zurück, in welcher der Knabe zuerst eine vollständigere Kenntnis von den sexuellen Beziehungen zwischen den Erwachsenen gewinnt, etwa in die Jahre der Vorpubertät. Brutale Mitteilungen von unverhüllt herabsetzender und aufrührerischer Tendenz machen ihn da mit dem Geheimnis des Geschlechtslebens bekannt, zerstören die Autorität der Erwachsenen, die sich als unvereinbar mit der Enthüllung ihrer Sexualbetätigung erweist. Was in diesen Eröffnungen den stärksten Einfluß auf den Neueingeweihten nimmt, das ist deren Beziehung zu den eigenen Eltern. Dieselbe wird oft direkt von dem Hörer abgelehnt, etwa mit den Worten: Es ist möglich, daß deine Eltern und andere Leute so etwas miteinander tun, aber von meinen Eltern ist es ganz unmöglich.
Als selten fehlendes Korollar zur »sexuellen Aufklärung« gewinnt der Knabe auch gleichzeitig die Kenntnis von der Existenz gewisser Frauen, die den geschlechtlichen Akt erwerbsmäßig ausüben und darum allgemein verachtet werden. Ihm selbst muß diese Verachtung ferne sein; er bringt für diese Unglücklichen nur eine Mischung von Sehnsucht und Grausen auf, sobald er weiß, daß auch er von ihnen in das Geschlechtsleben eingeführt werden kann, welches ihm bisher als der ausschließliche Vorbehalt der »Großen« galt. Wenn er dann den Zweifel nicht mehr festhalten kann, der für seine Eltern eine Ausnahme von den häßlichen Normen der Geschlechtsbetätigung fordert, so sagt er sich mit zynischer Korrektheit, daß der Unterschied zwischen der Mutter und der Hure doch nicht so groß sei, daß sie im Grunde das nämliche tun. Die aufklärenden Mitteilungen haben nämlich die Erinnerungsspuren seiner frühinfantilen Eindrücke und Wünsche in ihm geweckt und von diesen aus gewisse seelische Regungen bei ihm wieder zur Aktivität gebracht. Er beginnt die Mutter selbst in dem neugewonnenen Sinne zu begehren und den Vater als Nebenbuhler, der diesem Wunsche im Wege steht, von neuem zu hassen; er gerät, wie wir sagen, unter die Herrschaft des Ödipuskomplexes. Er vergißt es der Mutter nicht und betrachtet es im Lichte einer Untreue, daß sie die Gunst des sexuellen Verkehres nicht ihm, sondern dem Vater geschenkt hat. Diese Regungen haben, wenn sie nicht rasch vorüberziehen, keinen anderen Ausweg, als sich in Phantasien auszuleben, welche die Sexualbetätigung der Mutter unter den mannigfachsten Verhältnissen zum Inhalte haben, deren Spannung auch besonders leicht zur Lösung im onanistischen Akte führt. Infolge des beständigen Zusammenwirkens der beiden treibenden Motive, der Begehrlichkeit und der Rachsucht, sind Phantasien von der Untreue der Mutter die bei weitem bevorzugten; der Liebhaber, mit dem die Mutter die Untreue begeht, trägt fast immer die Züge des eigenen Ichs, richtiger gesagt, der eigenen, idealisierten, durch Altersreifung auf das Niveau des Vaters gehobenen Persönlichkeit. Was ich an anderer Stelle als »Familienroman« geschildert habe, umfaßt die vielfältigen Ausbildungen dieser Phantasietätigkeit und deren Verwebung mit verschiedenen egoistischen Interessen dieser Lebenszeit. Nach Einsicht in dieses Stück seelischer Entwicklung können wir es aber nicht mehr widerspruchsvoll und unbegreiflich finden, daß die Bedingung der Dirnenhaftigkeit der Geliebten sich direkt aus dem Mutterkomplex ableitet. Der von uns beschriebene Typus des männlichen Liebeslebens trägt die Spuren dieser Entwicklungsgeschichte an sich und läßt sich einfach verstehen als Fixierung an die Pubertätsphantasien des Knaben, die späterhin den Ausweg in die Realität des Lebens doch noch gefunden haben. Es macht keine Schwierigkeiten anzunehmen, daß die eifrig geübte Onanie der Pubertätsjahre ihren Beitrag zur Fixierung jener Phantasien geleistet hat.
Mit diesen Phantasien, welche sich zur Beherrschung des realen Liebeslebens aufgeschwungen haben, scheint die Tendenz, die Geliebte zu retten, nur in lockerer, oberflächlicher und durch bewußte Begründung erschöpfbarer Verbindung zu stehen. Die Geliebte bringt sich durch ihre Neigung zur Unbeständigkeit und Untreue in Gefahren, also ist es begreiflich, daß der Liebende sich bemüht, sie vor diesen Gefahren zu behüten, indem er ihre Tugend überwacht und ihren schlechten Neigungen entgegenarbeitet. Indes zeigt das Studium der Deckerinnerungen, Phantasien und nächtlichen Träume der Menschen, daß hier eine vortrefflich gelungene »Rationalisierung« eines unbewußten Motivs vorliegt, die einer gut geratenen sekundären Bearbeitung im Traume gleichzusetzen ist. In Wirklichkeit hat das Rettungsmotiv seine eigene Bedeutung und Geschichte und ist ein selbständiger Abkömmling des Mutter- oder, richtiger gesagt, des Elternkomplexes. Wenn das Kind hört, daß es sein Leben den Eltern verdankt, daß ihm die Mutter » das Leben geschenkt« hat, so vereinen sich bei ihm zärtliche mit großmannssüchtigen, nach Selbständigkeit ringenden Regungen, um den Wunsch entstehen zu lassen, den Eltern dieses Geschenk zurückzuerstatten, es ihnen durch ein gleichwertiges zu vergelten. Es ist, wie wenn der Trotz des Knaben sagen wollte: Ich brauche nichts vom Vater, ich will ihm alles zurückgeben, was ich ihn gekostet habe. Er bildet dann die Phantasie, den Vater aus einer Lebensgefahr zu retten, wodurch er mit ihm quitt wird, und diese Phantasie verschiebt sich häufig genug auf den Kaiser, König oder sonst einen großen Herrn und wird nach dieser Entstellung bewußtseinsfähig und selbst für den Dichter verwertbar. In der Anwendung auf den Vater überwiegt bei weitem der trotzige Sinn der Rettungsphantasie, der Mutter wendet sie meist ihre zärtliche Bedeutung zu. Die Mutter hat dem Kinde das Leben geschenkt, und es ist nicht leicht, dies eigenartige Geschenk durch etwas Gleichwertiges zu ersetzen. Bei geringem Bedeutungswandel, wie er im Unbewußten erleichtert ist – was man etwa dem bewußten Ineinanderfließen der Begriffe gleichstellen kann –, gewinnt das Retten der Mutter die Bedeutung von: ihr ein Kind schenken oder machen, natürlich ein Kind, wie man selbst ist. Die Entfernung vom ursprünglichen Sinne der Rettung ist keine allzu große, der Bedeutungswandel kein willkürlicher. Die Mutter hat einem ein Leben geschenkt, das eigene, und man schenkt ihr dafür ein anderes Leben, das eines Kindes, das mit dem eigenen Selbst die größte Ähnlichkeit hat. Der Sohn erweist sich dankbar, indem er sich wünscht, von der Mutter einen Sohn zu haben, der ihm selbst gleich ist, das heißt, in der Rettungsphantasie identifiziert er sich völlig mit dem Vater. Alle Triebe, die zärtlichen, dankbaren, lüsternen, trotzigen, selbstherrlichen, sind durch den einen Wunsch befriedigt, sein eigener Vater zu sein. Auch das Moment der Gefahr ist bei dem Bedeutungswandel nicht verlorengegangen; der Geburtsakt selbst ist nämlich die Gefahr, aus der man durch die Anstrengung der Mutter gerettet wurde. Die Geburt ist ebenso die allererste Lebensgefahr wie das Vorbild aller späteren, vor denen wir Angst empfinden, und das Erleben der Geburt hat uns wahrscheinlich den Affektausdruck, den wir Angst heißen, hinterlassen. Der Macduff der schottischen Sage, den seine Mutter nicht geboren hatte, der aus seiner Mutter Leib geschnitten wurde, hat darum auch die Angst nicht gekannt.
Der alte Traumdeuter Artemidoros hatte sicherlich recht mit der Behauptung, der Traum wandle seinen Sinn je nach der Person des Träumers. Nach den für den Ausdruck unbewußter Gedanken geltenden Gesetzen kann das »Retten« seine Bedeutung variieren, je nachdem es von einer Frau oder von einem Manne phantasiert wird. Es kann ebensowohl bedeuten: ein Kind machen = zur Geburt bringen (für den Mann) wie: selbst ein Kind gebären (für die Frau).
Insbesondere in der Zusammensetzung mit dem Wasser lassen sich diese verschiedenen Bedeutungen des Rettens in Träumen und Phantasien deutlich erkennen. Wenn ein Mann im Traume eine Frau aus dem Wasser rettet, so heißt das: er macht sie zur Mutter, was nach den vorstehenden Erörterungen gleichsinnig ist dem Inhalte: er macht sie zu seiner Mutter. Wenn eine Frau einen anderen (ein Kind) aus dem Wasser rettet, so bekennt sie sich damit wie die Königstochter in der Mosessage [Fußnote]Rank (1909). als seine Mutter, die ihn geboren hat.
Gelegentlich enthält auch die auf den Vater gerichtete Rettungsphantasie einen zärtlichen Sinn. Sie will dann den Wunsch ausdrücken, den Vater zum Sohne zu haben, das heißt einen Sohn zu haben, der so ist wie der Vater. Wegen all dieser Beziehungen des Rettungsmotivs zum Elternkomplex bildet die Tendenz, die Geliebte zu retten, einen wesentlichen Zug des hier beschriebenen Liebestypus.
Ich halte es nicht für notwendig, meine Arbeitsweise zu rechtfertigen, die hier wie bei der Aufstellung der Analerotik darauf hinausgeht, aus dem Beobachtungsmaterial zunächst extreme und scharf umschriebene Typen herauszuheben. Es gibt in beiden Fällen weit zahlreichere Individuen, in denen nur einzelne Züge dieses Typus oder diese nur in unscharfer Ausprägung festzustellen sind, und es ist selbstverständlich, daß erst die Darlegung des ganzen Zusammenhanges, in den diese Typen aufgenommen sind, deren richtige Würdigung ermöglicht.
Über einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, Paranoia und Homosexualität (1922)
A
Die Eifersucht gehört zu den Affektzuständen, die man ähnlich wie die Trauer als normal bezeichnen darf. Wo sie im Charakter und Benehmen eines Menschen zu fehlen scheint, ist der Schluß gerechtfertigt, daß sie einer starken Verdrängung erlegen ist und darum im unbewußten Seelenleben eine um so größere Rolle spielt. Die Fälle von abnorm verstärkter Eifersucht, mit denen die Analyse zu tun bekommt, erweisen sich als dreifach geschichtet. Die drei Schichten oder Stufen der Eifersucht verdienen die Namen der 1. konkurrierenden oder normalen, 2. der projizierten, 3. der wahnhaften.
Über die normale Eifersucht ist analytisch wenig zu sagen. Es ist leicht zu sehen, daß sie sich wesentlich zusammensetzt aus der Trauer, dem Schmerz um das verlorengeglaubte Liebesobjekt, und der narzißtischen Kränkung, soweit sich diese vom anderen sondern läßt, ferner aus feindseligen Gefühlen gegen den bevorzugten Rivalen und aus einem mehr oder minder großen Beitrag von Selbstkritik, die das eigene Ich für den Liebesverlust verantwortlich machen will. Diese Eifersucht ist, wenn wir sie auch normal heißen, keineswegs durchaus rationell, das heißt aus aktuellen Beziehungen entsprungen, den wirklichen Verhältnissen proportional und restlos vom bewußten Ich beherrscht, denn sie wurzelt tief im Unbewußten, setzt früheste Regungen der kindlichen Affektivität fort und stammt aus dem Ödipus- oder aus dem Geschwisterkomplex der ersten Sexualperiode. Es ist immerhin bemerkenswert, daß sie von manchen Personen bisexuell erlebt wird, das heißt beim Manne wird außer dem Schmerz um das geliebte Weib und dem Haß gegen den männlichen Rivalen auch Trauer um den unbewußt geliebten Mann und Haß gegen das Weib als Rivalin bei ihm zur Verstärkung wirksam. Ich weiß auch von einem Manne, der sehr arg unter seinen Eifersuchtsanfällen litt und die nach seinen Angaben ärgsten Qualen in der bewußten Versetzung in das ungetreue Weib durchmachte. Die Empfindung der Hilflosigkeit, die er dann verspürte, die Bilder, die er für seinen Zustand fand, als ob er wie Prometheus dem Geierfraß preisgegeben oder gefesselt in ein Schlangennest geworfen worden wäre, bezog er selbst auf den Eindruck mehrerer homosexueller Angriffe, die er als Knabe erlebt hatte.
Die Eifersucht der zweiten Schicht oder die projizierte geht beim Manne wie beim Weibe aus der eigenen, im Leben betätigten Untreue oder aus Antrieben zur Untreue hervor, die der Verdrängung verfallen sind. Es ist eine alltägliche Erfahrung, daß die Treue, zumal die in der Ehe geforderte, nur gegen beständige Versuchungen aufrechterhalten werden kann. »Wer dieselben in sich verleugnet, verspürt deren Andrängen doch so stark, daß er gerne einen unbewußten Mechanismus zu seiner Erleichterung in Anspruch nimmt. Eine solche Erleichterung, ja einen Freispruch vor seinem Gewissen erreicht er, wenn er die eigenen Antriebe zur Untreue auf die andere Partei, welcher er die Treue schuldig ist, projiziert. Dieses starke Motiv kann sich dann des Wahrnehmungsmaterials bedienen, welches die gleichartigen unbewußten Regungen des anderen Teiles verrät, und könnte sich durch die Überlegung rechtfertigen, daß der Partner oder die Partnerin wahrscheinlich auch nicht viel besser ist als man selbst [Fußnote]Vgl. die Strophe im Liede der Desdemona: Icalled my love false love; but what said he then? If I court moe women, you'll couch with moe men. (Ich nannt' ihn: Du Falscher. Was sagt er dazu? Schau ich nach den Mägdlein, nach den Büblein schielst du.).
Die gesellschaftlichen Sitten haben diesem allgemeinen Sachverhalt in kluger Weise Rechnung getragen, indem sie der Gefallsucht der verheirateten Frau und der Eroberungssucht des Ehemannes einen gewissen Spielraum gestatten in der Erwartung, die unabweisbare Neigung zur Untreue dadurch zu drainieren und unschädlich zu machen. Die Konvention setzt fest, daß beide Teile diese kleinen Schrittchen in der Richtung der Untreue einander nicht anzurechnen haben, und erreicht zumeist, daß die am fremden Objekt entzündete Begierde in einer gewissen Rückkehr zur Treue am eigenen Objekt befriedigt wird. Der Eifersüchtige will aber diese konventionelle Toleranz nicht anerkennen, er glaubt nicht, daß es ein Stillhalten oder Umkehren auf dem einmal betretenen Weg gibt, daß der gesellschaftliche »Flirt« auch eine Versicherung gegen wirkliche Untreue sein kann. In der Behandlung eines solchen Eifersüchtigen muß man es vermeiden, ihm das Material, auf das er sich stützt, zu bestreiten, man kann ihn nur zu einer anderen Einschätzung desselben bestimmen wollen.
Die durch solche Projektion entstandene Eifersucht hat zwar fast wahnhaften Charakter, sie widersteht aber nicht der analytischen Arbeit, welche die unbewußten Phantasien der eigenen Untreue aufdeckt. Schlimmer ist es mit der Eifersucht der dritten Schicht, der eigentlich wahnhaften. Auch diese geht aus verdrängten Untreuestrebungen hervor, aber die Objekte dieser Phantasien sind gleichgeschlechtlicher Art. Die wahnhafte Eifersucht entspricht einer vergorenen Homosexualität und behauptet mit Recht ihren Platz unter den klassischen Formen der Paranoia. Als Versuch zur Abwehr einer überstarken homosexuellen Regung wäre sie (beim Manne) durch die Formel zu umschreiben: Ich liebe ihn ja nicht, sie liebt ihn [Fußnote]Vgl. die Ausführungen zum Falle Schreber (1911 c)..
In einem Falle von Eifersuchtswahn wird man darauf vorbereitet sein, die Eifersucht aus allen drei Schichten zu finden, niemals die aus der dritten allein.
B
Paranoia. Aus bekannten Gründen entziehen sich Fälle von Paranoia zumeist der analytischen Untersuchung. Indes konnte ich doch in letzter Zeit aus dem intensiven Studium zweier Paranoiker einiges, was mir neu war, entnehmen.
Der erste Fall betraf einen jugendlichen Mann mit voll ausgebildeter Eifersuchtsparanoia, deren Objekt seine tadellos getreue Frau war. Eine stürmische Periode, in der ihn der Wahn ohne Unterbrechung beherrscht hatte, lag bereits hinter ihm. Als ich ihn sah, produzierte er nur noch gut gesonderte Anfälle, die über mehrere Tage anhielten und interessanterweise regelmäßig am Tage nach einem, übrigens für beide Teile befriedigenden, Sexualakt auftraten. Es ist der Schluß berechtigt, daß jedesmal nach der Sättigung der heterosexuellen Libido die mitgereizte homosexuelle Komponente sich ihren Ausdruck im Eifersuchtsanfall erzwang.
Sein Material bezog der Anfall aus der Beobachtung der kleinsten Anzeichen, durch welche sich die völlig unbewußte Koketterie der Frau, einem anderen unmerklich, ihm verraten hatte. Bald hatte sie den Herrn, der neben ihr saß, unabsichtlich mit ihrer Hand gestreift, bald ihr Gesicht zu sehr gegen ihn geneigt oder ein freundlicheres Lächeln aufgesetzt, als wenn sie mit ihrem Mann allein war. Für all diese Äußerungen ihres Unbewußten zeigte er eine außerordentliche Aufmerksamkeit und verstand sie immer richtig zu deuten, so daß er eigentlich immer recht hatte und die Analyse noch zur Rechtfertigung seiner Eifersucht anrufen konnte. Eigentlich reduzierte sich seine Abnormität darauf, daß er das Unbewußte seiner Frau schärfer beobachtete und dann weit höher einschätzte, als einem anderen eingefallen wäre.
Wir erinnern uns daran, daß auch die verfolgten Paranoiker sich ganz ähnlich benehmen. Auch sie anerkennen bei anderen nichts Indifferentes und verwerten in ihrem »Beziehungswahn« die kleinsten Anzeichen, die ihnen diese anderen, Fremden geben. Der Sinn ihres Beziehungswahnes ist nämlich, daß sie von allen Fremden etwas wie Liebe erwarten; diese anderen zeigen ihnen aber nichts dergleichen, sie lachen vor sich hin, fuchteln mit ihren Stöcken oder spucken sogar auf den Boden, wenn sie vorbeigehen, und das tut man wirklich nicht, wenn man an der Person, die in der Nähe ist, irgendein freundliches Interesse nimmt. Man tut es nur dann, wenn einem diese Person ganz gleichgültig ist, wenn man sie als Luft behandeln kann, und der Paranoiker hat bei der Grundverwandtschaft der Begriffe »fremd« und »feindlich« nicht so unrecht, wenn er solche Indifferenz im Verhältnis zu seiner Liebesforderung als Feindseligkeit empfindet.
Es ahnt uns nun, daß wir das Verhalten des eifersüchtigen wie des verfolgten Paranoikers sehr ungenügend beschreiben, wenn wir sagen, sie projizieren nach außen auf andere hin, was sie im eigenen Innern nicht wahrnehmen wollen.
Gewiß tun sie das, aber sie projizieren sozusagen nicht ins Blaue hinaus, nicht dorthin, wo sich nichts Ähnliches findet, sondern sie lassen sich von ihrer Kenntnis des Unbewußten leiten und verschieben auf das Unbewußte der anderen die Aufmerksamkeit, die sie dem eigenen Unbewußten entziehen. Unser Eifersüchtiger erkennt die Untreue seiner Frau an Stelle seiner eigenen; indem er die seiner Frau sich in riesiger Vergrößerung bewußtmacht, gelingt es ihm, die eigene unbewußt zu erhalten. Wenn wir sein Beispiel für maßgebend erachten, dürfen wir schließen, daß auch die Feindseligkeit, die der Verfolgte bei anderen findet, der Widerschein der eigenen feindseligen Gefühle gegen diese anderen ist. Da wir wissen, daß beim Paranoiker gerade die geliebteste Person des gleichen Geschlechts zum Verfolger wird, entsteht die Frage, woher diese Affektumkehrung rührt, und die naheliegende Antwort wäre, daß die stets vorhandene Gefühlsambivalenz die Grundlage für den Haß abgibt und die Nichterfüllung der Liebesansprüche ihn verstärkt. So leistet die Gefühlsambivalenz dem Verfolgten denselben Dienst zur Abwehr der Homosexualität wie unserem Patienten die Eifersucht.
Die Träume meines Eifersüchtigen bereiteten mir eine große Überraschung. Sie zeigten sich zwar nicht gleichzeitig mit dem Ausbruch des Anfalls, aber doch noch unter der Herrschaft des Wahns, waren vollkommen wahnfrei und ließen die zugrundeliegenden homosexuellen Regungen in nicht stärkerer Verkleidung als sonst gewöhnlich erkennen. Bei meiner geringen Erfahrung über die Träume von Paranoikern lag es mir damals nahe, allgemein anzunehmen, die Paranoia dringe nicht in den Traum.
Der Zustand der Homosexualität war bei diesem Patienten leicht zu überblicken. Er hatte keine Freundschaft und keine sozialen Interessen gebildet; man mußte den Eindruck bekommen, als ob erst der Wahn die weitere Entwicklung seiner Beziehungen zum Manne übernommen hätte, wie um ein Stück des Versäumten nachzuholen. Die geringe Bedeutung des Vaters in seiner Familie und ein beschämendes homosexuelles Trauma in frühen Knabenjahren hatten zusammengewirkt, um seine Homosexualität in die Verdrängung zu treiben und ihr den Weg zur Sublimierung zu verlegen. Seine ganze Jugendzeit war von einer starken Mutterbindung beherrscht. Unter vielen Söhnen war er der erklärte Liebling der Mutter und entwickelte auf sie bezüglich eine starke Eifersucht von normalem Typus. Als er später eine Ehewahl traf, wesentlich unter der Herrschaft des Motivs, die Mutter reich zu machen, äußerte sich sein Bedürfnis nach einer virginalen Mutter in zwanghaften Zweifeln an der Virginität seiner Braut. Die ersten Jahre seiner Ehe waren von Eifersucht frei. Er wurde dann seiner Frau untreu und ging ein langdauerndes Verhältnis mit einer anderen ein. Erst als er diese Liebesbeziehung, durch einen bestimmten Verdacht geschreckt, aufgegeben hatte, brach bei ihm eine Eifersucht vom zweiten, vom Projektionstypus, los, mit welcher er die Vorwürfe wegen seiner Untreue beschwichtigen konnte. Sie komplizierte sich bald durch das Hinzutreten der homosexuellen Regungen, deren Objekt der Schwiegervater war, zur vollen Eifersuchtsparanoia.
Mein zweiter Fall wäre wahrscheinlich ohne Analyse nicht als Paranoia persecutoria klassifiziert worden, aber ich mußte den jungen Mann als einen Kandidaten für diesen Krankheitsausgang auffassen. Es bestand bei ihm eine Ambivalenz im Verhältnis zum Vater von ganz außerordentlicher Spannweite. Er war einerseits der ausgesprochenste Rebell, der sich manifest in allen Stücken von den Wünschen und Idealen des Vaters weg entwickelt hatte, anderseits in tieferer Schicht noch immer der unterwürfigste Sohn, der nach dem Tode des Vaters sich in zärtlichem Schuldbewußtsein den Genuß des Weibes versagte. Seine realen Beziehungen zu Männern standen offenbar unter dem Zeichen des Mißtrauens; mit seinem starken Intellekte wußte er diese Einstellung zu rationalisieren und verstand es so einzurichten, daß er von Bekannten und Freunden betrogen und ausgebeutet wurde. Was ich Neues an ihm lernte, war, daß klassische Verfolgungsgedanken vorhanden sein können, ohne Glauben und Anwert zu finden. Sie blitzten während seiner Analyse gelegentlich auf, aber er legte ihnen keine Bedeutung bei und bespöttelte sie regelmäßig. Dies mag in vielen Fällen von Paranoia ähnlich vorkommen, und wenn eine solche Erkrankung losbricht, halten wir vielleicht die geäußerten Wahnideen für Neuproduktionen, während sie längst bestanden haben mögen.
Es scheint mir eine wichtige Einsicht, daß ein qualitatives Moment, das Vorhandensein gewisser neurotischer Bildungen, praktisch weniger bedeutet als das quantitative Moment, welchen Grad von Aufmerksamkeit, richtiger, welches Maß von Besetzung diese Gebilde an sich ziehen können. Die Erörterung unseres ersten Falles, der Eifersuchtsparanoia, hatte uns zur gleichen Wertschätzung des quantitativen Moments aufgefordert, indem sie uns zeigte, daß dort die Abnormität wesentlich in der Überbesetzung der Deutungen des fremden Unbewußten bestand. Aus der Analyse der Hysterie kennen wir längst eine analoge Tatsache. Die pathogenen Phantasien, Abkömmlinge verdrängter Triebregungen, werden lange Zeit neben dem normalen Seelenleben geduldet und wirken nicht eher pathogen, als bis sie aus einem Umschwung der Libidoökonomie eine Überbesetzung erhalten; erst dann bricht der Konflikt los, der zur Symptombildung führt. Wir werden so im Fortschritt unserer Erkenntnis immer mehr dazu gedrängt, den ökonomischen Gesichtspunkt in den Vordergrund zu rücken. Ich möchte auch die Frage aufwerfen, ob das hier betonte quantitative Moment nicht hinreicht, um die Phänomene zu decken, für die Bleuler und andere neuerdings den Begriff der »Schaltung« einführen wollen. Man müßte nur annehmen, daß eine Widerstandssteigerung in einer Richtung des psychischen Ablaufs eine Überbesetzung eines anderen Weges und damit die Einschaltung desselben in den Ablauf zur Folge hat.
Ein lehrreicher Gegensatz zeigte sich bei meinen zwei Fällen von Paranoia im Verhalten der Träume. Während im ersten Fall die Träume, wie erwähnt, wahnfrei waren, produzierte der andere Patient in großer Zahl Verfolgungsträume, die man als Vorläufer oder Ersatzbildungen für die Wahnideen gleichen Inhalts ansehen kann. Das Verfolgende, dem er sich nur mit großer Angst entziehen konnte, war in der Regel ein starker Stier oder ein anderes Symbol der Männlichkeit, das er manchmal noch im Traum selbst als Vatervertretung erkannte. Einmal berichtete er einen sehr charakteristischen paranoischen Übertragungstraum. Er sah, daß ich mich in seiner Gegenwart rasierte, und merkte am Geruche, daß ich dabei dieselbe Seife wie sein Vater gebrauchte. Das tat ich, um ihn zur Vaterübertragung auf meine Person zu nötigen. In der Wahl der geträumten Situation erwies sich unverkennbar die Geringschätzung des Patienten für seine paranoischen Phantasien und sein Unglaube gegen sie, denn der tägliche Augenschein konnte ihn belehren, daß ich überhaupt nicht in die Lage komme, mich einer Rasierseife zu bedienen, und also in diesem Punkte der Vaterübertragung keinen Anhalt biete.
Der Vergleich der Träume bei unseren beiden Patienten belehrt uns aber, daß unsere Fragestellung, ob die Paranoia (oder eine andere Psychoneurose) auch in den Traum dringen könne, nur auf einer unrichtigen Auffassung des Traumes beruht. Der Traum unterscheidet sich vom Wachdenken darin, daß er Inhalte (aus dem Bereich des Verdrängten) aufnehmen kann, die im Wachdenken nicht vorkommen dürfen. Davon abgesehen, ist er nur eine Form des Denkens, eine Umformung des vorbewußten Denkstoffes durch die Traumarbeit und ihre Bedingungen. Auf das Verdrängte ist unsere Terminologie der Neurosen nicht anwendbar, es kann weder hysterisch noch zwangsneurotisch, noch paranoisch genannt werden. Dagegen kann der andere Anteil des Stoffes, welcher der Traumbildung unterliegt, die vorbewußten Gedanken, normal sein oder den Charakter irgendeiner Neurose an sich tragen. Die vorbewußten Gedanken mögen Ergebnisse all jener pathogenen Prozesse sein, in denen wir das Wesen einer Neurose erkennen. Es ist nicht einzusehen, warum nicht jede solche krankhafte Idee die Umformung in einen Traum erfahren sollte. Ein Traum kann also ohne weiteres einer hysterischen Phantasie, einer Zwangsvorstellung, einer Wahnidee entsprechen, das heißt bei seiner Deutung eine solche ergeben. In unserer Beobachtung an zwei Paranoikern finden wir, daß der Traum des einen normal ist, während sich der Mann im Anfall befindet, und daß der des anderen einen paranoischen Inhalt hat, während der Mann noch über seine Wahnideen spottet. Der Traum hat also in beiden Fällen aufgenommen, was im Wachleben derzeit zurückgedrängt war. Aber auch das braucht nicht die Regel zu sein.
C
Homosexualität. Die Anerkennung des organischen Faktors der Homosexualität überhebt uns nicht der Verpflichtung, die psychischen Vorgänge bei ihrer Entstehung zu studieren. Der typische, bereits bei einer Unzahl von Fällen festgestellte Vorgang besteht darin, daß der bis dahin intensiv an die Mutter fixierte junge Mann einige Jahre nach abgelaufener Pubertät eine Wendung vornimmt, sich selbst mit der Mutter identifiziert und nach Liebesobjekten ausschaut, in denen er sich selbst wiederfinden kann, die er dann lieben möchte, wie die Mutter ihn geliebt hat. Als Merkzeichen dieses Prozesses stellt sich gewöhnlich für viele Jahre die Liebesbedingung her, daß die männlichen Objekte das Alter haben müssen, in dem bei ihm die Umwandlung erfolgt ist. Wir haben verschiedene Faktoren kennengelernt, die wahrscheinlich in wechselnder Stärke zu diesem Ergebnis beitragen. Zunächst die Mutterfixierung, die den Übergang zu einem anderen Weibobjekt erschwert. Die Identifizierung mit der Mutter ist ein Ausgang dieser Objektbindung und ermöglicht es gleichzeitig, diesem ersten Objekt in gewissem Sinne treu zu bleiben. Sodann die Neigung zur narzißtischen Objektwahl, die im allgemeinen näherliegt und leichter auszuführen ist als die Wendung zum anderen Geschlecht. Hinter diesem Moment verbirgt sich ein anderes von ganz besonderer Stärke, oder es fällt vielleicht mit ihm zusammen: die Hochschätzung des männlichen Organs und die Unfähigkeit, auf dessen Vorhandensein beim Liebesobjekt zu verzichten. Die Geringschätzung des Weibes, die Abneigung gegen dasselbe, ja der Abscheu vor ihm, leiten sich in der Regel von der früh gemachten Entdeckung ab, daß das Weib keinen Penis besitzt. Später haben wir noch als mächtiges Motiv für die homosexuelle Objektwahl die Rücksicht auf den Vater oder die Angst vor ihm kennengelernt, da der Verzicht auf das Weib die Bedeutung hat, daß man der Konkurrenz mit ihm (oder allen männlichen Personen, die für ihn eintreten) ausweicht. Die beiden letzten Motive, das Festhalten an der Penisbedingung sowie das Ausweichen, können dem Kastrationskomplex zugezählt werden. Mutterbindung – Narzißmus – Kastrationsangst, diese übrigens in keiner Weise spezifischen Momente hatten wir bisher in der psychischen Ätiologie der Homosexualität aufgefunden, und zu ihnen gesellten sich noch der Einfluß der Verführung, welche eine frühzeitige Fixierung der Libido verschuldet, sowie der des organischen Faktors, der die passive Rolle im Liebesleben begünstigt.
Wir haben aber niemals geglaubt, daß diese Analyse der Entstehung der Homosexualität vollständig ist. Ich kann heute auf einen neuen Mechanismus hinweisen, der zur homosexuellen Objektwahl führt, wenngleich ich nicht angeben kann, wie groß seine Rolle bei der Gestaltung der extremen, der manifesten und ausschließlichen Homosexualität anzuschlagen ist. Die Beobachtung machte mich auf mehrere Fälle aufmerksam, bei denen in früher Kindheit besonders starke eifersüchtige Regungen aus dem Mutterkomplex gegen Rivalen, meist ältere Brüder, aufgetreten waren. Diese Eifersucht führte zu intensiv feindseligen und aggressiven Einstellungen gegen die Geschwister, die sich bis zum Todeswunsch steigern konnten, aber der Entwicklung nicht standhielten. Unter den Einflüssen der Erziehung, gewiß auch infolge der anhaltenden Ohnmacht dieser Regungen, kam es zur Verdrängung derselben und zu einer Gefühlsumwandlung, so daß die früheren Rivalen nun die ersten homosexuellen Liebesobjekte wurden. Ein solcher Ausgang der Mutterbindung zeigt mehrfache interessante Beziehungen zu anderen uns bekannten Prozessen. Er ist zunächst das volle Gegenstück zur Entwicklung der Paranoia persecutoria, bei welcher die zuerst geliebten Personen zu den gehaßten Verfolgern werden, während hier die gehaßten Rivalen sich in Liebesobjekte umwandeln. Er stellt sich ferner als eine Übertreibung des Vorganges dar, welcher nach meiner Anschauung zur individuellen Genese der sozialen Triebe führt [Fußnote]Siehe Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921 c).. Hier wie dort sind zunächst eifersüchtige und feindselige Regungen vorhanden, die es nicht zur Befriedigung bringen können, und die zärtlichen wie die sozialen Identifizierungsgefühle entstehen als Reaktionsbildungen gegen die verdrängten Aggressionsimpulse.
Dieser neue Mechanismus der homosexuellen Objektwahl, die Entstehung aus überwundener Rivalität und verdrängter Aggressionsneigung, mengt sich in manchen Fällen den uns bekannten typischen Bedingungen bei. Man erfährt nicht selten aus der Lebensgeschichte Homosexueller, daß ihre Wendung eintrat, nachdem die Mutter einen anderen Knaben gelobt und als Vorbild angepriesen hatte. Dadurch wurde die Tendenz zur narzißtischen Objektwahl gereizt, und nach einer kurzen Phase scharfer Eifersucht war der Rivale zum Liebesobjekt geworden. Sonst aber sondert sich der neue Mechanismus dadurch ab, daß bei ihm die Umwandlung in viel früheren Jahren vor sich geht und die Mutteridentifizierung in den Hintergrund tritt. Auch führte er in den von mir beobachteten Fällen nur zu homosexuellen Einstellungen, welche die Heterosexualität nicht ausschlossen und keinen horror feminae mit sich brachten.
Es ist bekannt, daß eine ziemliche Anzahl homosexueller Personen sich durch besondere Entwicklung der sozialen Triebregungen und durch Hingabe an gemeinnützige Interessen auszeichnet. Man wäre versucht, dafür die theoretische Erklärung zu geben, daß ein Mann, der in anderen Männern mögliche Liebesobjekte sieht, sich gegen die Gemeinschaft der Männer anders benehmen muß als ein anderer, der genötigt ist, im Mann zunächst den Rivalen beim Weibe zu erblicken. Dem steht nur die Erwägung entgegen, daß es auch bei homosexueller Liebe Eifersucht und Rivalität gibt und daß die Gemeinschaft der Männer auch diese möglichen Rivalen umschließt. Aber auch, wenn man von dieser spekulativen Begründung absieht, kann die Tatsache für den Zusammenhang von Homosexualität und sozialem Empfinden nicht gleichgültig sein, daß die homosexuelle Objektwahl nicht selten aus frühzeitiger Überwindung der Rivalität mit dem Manne hervorgeht.
In der psychoanalytischen Betrachtung sind wir gewöhnt, die sozialen Gefühle als Sublimierungen homosexueller Objekteinstellungen aufzufassen. Bei den sozial gesinnten Homosexuellen wäre die Ablösung der sozialen Gefühle von der Objektwahl nicht voll geglückt.
Über « fausse reconnaissance » (« déjà raconté ») während der psychoanalytischen Arbeit (1914)
Es ereignet sich nicht selten während der Arbeit der Analyse, daß der Patient die Mitteilung eines von ihm erinnerten Faktums mit der Bemerkung begleitet, » das habe ich Ihnen aber schon erzählt«, während man selbst sicher zu sein glaubt, diese Erzählung von ihm noch niemals vernommen zu haben. Äußert man diesen Widerspruch gegen den Patienten, so wird er häufig energisch versichern, er wisse es ganz gewiß, er sei bereit, es zu beschwören, usw.; in demselben Maße wird aber die eigene Überzeugung von der Neuheit des Gehörten stärker. Es wäre nun ganz unpsychologisch, einen solchen Streit durch Überschreien oder Überbieten mit Beteuerungen entscheiden zu wollen. Ein solches Überzeugungsgefühl von der Treue seines Gedächtnisses hat bekanntlich keinen objektiven Wert, und da einer von beiden sich notwendigerweise irren muß, kann es ebensowohl der Arzt wie der Analysierte sein, welcher der Paramnesie verfallen ist. Man gesteht dies dem Patienten zu, bricht den Streit ab und verschiebt dessen Erledigung auf eine spätere Gelegenheit.
In einer Minderzahl von Fällen erinnert man sich dann selbst, die fragliche Mitteilung bereits gehört zu haben, und findet gleichzeitig das subjektive, oft weit hergeholte Motiv für deren zeitweilige Beseitigung. In der großen Mehrzahl aber ist es der Analysierte, der geirrt hat und auch dazu bewogen werden kann, es einzusehen. Die Erklärung für dieses häufige Vorkommnis scheint zu sein, daß er wirklich bereits die Absicht gehabt hat, diese Mitteilung zu machen, daß er eine vorbereitende Äußerung wirklich ein oder mehrere Male getan hat, dann aber durch den Widerstand abgehalten wurde, seine Absicht auszuführen, und nun die Erinnerung an die Intention mit der an die Ausführung derselben verwechselt.
Ich lasse nun alle die Fälle beiseite, in denen der Sachverhalt irgendwie zweifelhaft bleiben kann, und hebe einige andere hervor, die ein besonderes theoretisches Interesse haben. Es ereignet sich nämlich bei einzelnen Personen, und zwar wiederholt, daß sie die Behauptung, sie hätten dies oder jenes schon erzählt, besonders hartnäckig bei Mitteilungen vertreten, wo die Sachlage es ganz unmöglich macht, daß sie recht haben können. Was sie bereits früher einmal erzählt haben wollen und jetzt als etwas Altes, was auch der Arzt wissen müßte, wiedererkennen, sind dann Erinnerungen von höchstem Wert für die Analyse, Bestätigungen, auf welche man lange Zeit gewartet, Lösungen, die einem Teilstück der Arbeit ein Ende machen, an die der analysierende Arzt sicherlich eingehende Erörterungen geknüpft hätte. Angesichts dieser Verhältnisse gibt der Patient auch bald zu, daß ihn seine Erinnerung getäuscht haben muß, obwohl er sich die Bestimmtheit derselben nicht erklären kann.
Das Phänomen, welches der Analysierte in solchen Fällen bietet, hat Anspruch darauf, eine » fausse reconnaissance« genannt zu werden, und ist durchaus analog den anderen Fällen, in denen man spontan die Empfindung hat: In dieser Situation war ich schon einmal, das habe ich schon einmal erlebt (das » déjà vu«), ohne daß man je in die Lage käme, diese Überzeugung durch das Wiederauffinden jenes früheren Males im Gedächtnisse zu bewahrheiten. Es ist bekannt, daß dies Phänomen eine Fülle von Erklärungsversuchen hervorgerufen hat, die sich im allgemeinen in zwei Gruppen bringen lassen [Fußnote]S. eine der letzten Zusammenstellungen der betreffenden Literatur in H. Ellis, World of Dreams (1911).. In der einen wird der im Phänomen enthaltenen Empfindung Glauben geschenkt und angenommen, es handle sich wirklich darum, daß etwas erinnert werde; die Frage bleibt nur, was. Zu einer bei weitem zahlreicheren Gruppe treten jene Erklärungen zusammen, die vielmehr behaupten, daß hier eine Täuschung der Erinnerung vorliege, und die nun die Aufgabe haben nachzuspüren, wie es zu dieser paramnestischen Fehlleistung kommen könne. Im übrigen umfassen diese Versuche einen weiten Umkreis von Motiven, beginnend mit der uralten, dem Pythagoras zugeschriebenen Auffassung, daß das Phänomen des déjà vu einen Beweis für eine frühere individuelle Existenz enthalte, fortgesetzt über die auf die Anatomie gestützte Hypothese, daß ein zeitliches Auseinanderweichen in der Tätigkeit der beiden Hirnhemisphären das Phänomen begründe (Wigan, 1860), bis auf die rein psychologischen Theorien der meisten neueren Autoren, welche im déjà vu eine Äußerung einer Apperzeptionsschwäche erblicken und Ermüdung, Erschöpfung, Zerstreutheit für dasselbe verantwortlich machen.
Grasset hat im Jahre 1904 eine Erklärung des déjà vu gegeben, welche zu den »gläubigen« gerechnet werden muß. Er meinte, das Phänomen weise darauf hin, daß früher einmal eine unbewußte Wahrnehmung gemacht worden sei, welche erst jetzt unter dem Einfluß eines neuen und ähnlichen Eindruckes das Bewußtsein erreiche. Mehrere andere Autoren haben sich ihm angeschlossen und die Erinnerung an vergessenes Geträumtes zur Grundlage des Phänomens gemacht. In beiden Fällen würde es sich um die Belebung eines unbewußten Eindruckes handeln.
Ich habe im Jahre 1907, in der zweiten Auflage meiner Psychopathologie des Alltagslebens eine ganz ähnliche Erklärung der angeblichen Paramnesie vertreten, ohne die Arbeit von Grasset zu kennen oder zu erwähnen. Zu meiner Entschuldigung mag dienen, daß ich meine Theorie als Ergebnis einer psychoanalytischen Untersuchung gewann, die ich an einem sehr deutlichen, aber etwa 28 Jahre zurückliegenden Falle von déjà vu bei einer Patientin vornehmen konnte. Ich will die kleine Analyse hier nicht wiederholen. Sie ergab, daß die Situation, in welcher das déjà vu auftrat, wirklich geeignet war, die Erinnerung an ein früheres Erlebnis der Analysierten zu wecken. In der Familie, welche das damals zwölfjährige Kind besuchte, befand sich ein schwerkranker, dem Tode verfallener Bruder, und ihr eigener Bruder war einige Monate vorher in derselben Gefahr gewesen. An dies Gemeinsame hatte sich aber im Falle des ersteren Erlebnisses eine bewußtseinsunfähige Phantasie geknüpft – der Wunsch, der Bruder solle sterben –, und darum konnte die Analogie der beiden Fälle nicht bewußt werden. Die Empfindung derselben ersetzte sich durch das Phänomen des Schon-einmal-erlebt-Habens, indem sich die Identität von dem Gemeinsamen auf die Lokalität verschob.
Man weiß, daß der Name » déjà vu« für eine ganze Reihe analoger Phänomene steht, für ein » déjà entendu«, ein » déjà éprouvé«, ein » déjà senti«. Der Fall, den ich an Stelle vieler ähnlicher nun berichten werde, enthält ein » déjà raconté«, welches also von einem unbewußten, unausgeführt gebliebenen Vorsatz abzuleiten wäre.
Ein Patient erzählt im Laufe seiner Assoziationen: »Wie ich damals im Alter von fünf Jahren im Garten mit einem Messer gespielt und mir dabei den kleinen Finger durchgeschnitten habe – oh, ich habe nur geglaubt, daß er durchgeschnitten ist –, aber das habe ich Ihnen ja schon erzählt.«
Ich versichere, daß ich mich an nichts Ähnliches zu erinnern weiß. Er beteuert immer überzeugter, daß er sich darin nicht täuschen kann. Endlich mache ich dem Streit in der eingangs angegebenen Weise ein Ende und bitte ihn, die Geschichte auf alle Fälle zu wiederholen. Wir würden ja dann sehen.
»Als ich fünf Jahre alt war, spielte ich im Garten neben meiner Kinderfrau und schnitzelte mit meinem Taschenmesser an der Rinde eines jener Nußbäume, die auch in meinem Traum [Fußnote]Vgl. ›Märchenstoffe in Träumen‹ eine Rolle spielen [Fußnote]Korrektur bei späterer Erzählung: »Ich glaube, ich schnitt nicht in den Baum. Das ist eine Verschmelzung mit einer anderen Erinnerung, die auch halluzinatorisch gefälscht sein muß, daß ich in einen Baum einen Schnitt mit dem Messer machte und daß dabei Blut aus dem Baume kam.«. Plötzlich bemerkte ich mit unaussprechlichem Schrecken, daß ich mir den kleinen Finger der (rechten oder linken?) Hand so durchgeschnitten hatte, daß er nur noch an der Haut hing. Schmerz spürte ich keinen, aber eine große Angst. Ich getraute mich nicht, der wenige Schritte entfernten Kinderfrau etwas zu sagen, sank auf die nächste Bank und blieb da sitzen, unfähig, noch einen Blick auf den Finger zu werfen. Endlich wurde ich ruhig, faßte den Finger ins Auge, und siehe da, er war ganz unverletzt.«
Wir einigten uns bald darüber, daß er mir diese Vision oder Halluzination doch nicht erzählt haben könne. Er verstand sehr wohl, daß ich einen solchen Beweis für die Existenz der Kastrationsangst in seinem fünften Jahr doch nicht unverwertet gelassen hätte. Sein Widerstand gegen die Annahme des Kastrationskomplexes war damit gebrochen, aber er warf die Frage auf: »Warum habe ich so sicher geglaubt, daß ich diese Erinnerung schon erzählt habe?«
Dann fiel uns beiden ein, daß er wiederholt, bei verschiedenen Anlässen, aber jedesmal ohne Vorteil, folgende kleine Erinnerung vorgetragen hatte:
»Als der Onkel einmal verreiste, fragte er mich und die Schwester, was er uns mitbringen solle. Die Schwester wünschte sich ein Buch, ich ein Taschenmesser.« Nun verstanden wir diesen Monate vorher aufgetauchten Einfall als Deckerinnerung für die verdrängte Erinnerung und als Ansatz zu der infolge des Widerstandes unterbliebenen Erzählung vom vermeintlichen Verlust des kleinen Fingers (eines unverkennbaren Penisäquivalents). Das Messer, welches ihm der Onkel auch wirklich mitgebracht hatte, war nach seiner sicheren Erinnerung das nämliche, welches in der lange unterdrückten Mitteilung vorkam.
Ich glaube, es ist überflüssig, zur Deutung dieser kleinen Erfahrung, soweit sie auf das Phänomen der » fausse reconnaissance« Licht wirft, weiteres hinzuzufügen. Zum Inhalt der Vision des Patienten will ich bemerken, daß solche halluzinatorische Täuschungen gerade im Gefüge des Kastrationskomplexes nicht vereinzelt sind und daß sie ebensowohl zur Korrektur unerwünschter Wahrnehmungen dienen können.
Im Jahre 1911 stellte mir ein akademisch Gebildeter aus einer deutschen Universitätsstadt, den ich nicht kenne, dessen Alter mir unbekannt ist, folgende Mitteilung aus seiner Kindheit zur freien Verfügung:
»Bei der Lektüre Ihrer Kindheitserinnerung des Leonardo haben mich die Ausführungen auf S. 29 bis 31 zu innerem Widerspruch gereizt. Ihre Bemerkung, daß das männliche Kind von dem Interesse für sein eigenes Genitale beherrscht ist, weckte in mir eine Gegenbemerkung von der Art: ›Wenn das ein allgemeines Gesetz ist, so bin ich jedenfalls eine Ausnahme.‹ Die nun folgenden Zeilen (S. 31 bis 32 oben) las ich mit dem größten Staunen, jenem Staunen, von dem man bei Kenntnisnahme einer ganz neuartigen Tatsache erfaßt wird. Mitten in meinem Staunen kommt mir eine Erinnerung, die mich – zu meiner eigenen Überraschung – lehrt, daß mir jene Tatsache gar nicht so neu sein dürfte. Ich hatte nämlich zur Zeit, da ich mich mitten in der ›infantilen Sexualforschung‹ befand, durch einen glücklichen Zufall Gelegenheit, ein weibliches Genitale an einer kleinen Altersgenossin zu betrachten und habe hiebei ganz klar einen Penis von der Art meines eigenen bemerkt. Bald darauf hat mich aber der Anblick weiblicher Statuen und Akte in neue Verwirrung gestürzt, und ich habe, um diesem wissenschaftlichem Zwiespalt zu entrinnen, das folgende Experiment ersonnen: Ich brachte mein Genitale durch Aneinanderpressen der Oberschenkel zwischen diesen zum Verschwinden und konstatierte mit Befriedigung, daß hiedurch jeder Unterschied gegen den weiblichen Akt beseitigt sei. Offenbar, so dachte ich mir, war auch beim weiblichen Akt das Genitale auf gleiche Weise zum Verschwinden gebracht.«
»Hier nun kommt mir eine andere Erinnerung, die mir insofern schon von jeher von größter Wichtigkeit war, als sie die eine von den drei Erinnerungen ist, aus welchen meine Gesamterinnerung an meine früh verstorbene Mutter besteht. Meine Mutter steht vor dem Waschtisch und reinigt die Gläser und Waschbecken, während ich im selben Zimmer spiele und irgendeinen Unfug mache. Zur Strafe wird mir die Hand durchgeklopft: da sehe ich zu meinem größten Entsetzen, daß mein kleiner Finger herabfällt, und zwar gerade in den Wasserkübel fällt. Da ich meine Mutter erzürnt weiß, getraue ich mich nichts zu sagen und sehe mit noch gesteigertem Entsetzen, wie bald darauf der Wasserkübel vom Dienstmädchen hinausgetragen wird. Ich war lange überzeugt, daß ich einen Finger verloren habe, vermutlich bis in die Zeit, wo ich das Zählen lernte.«
»Diese Erinnerung, die mir – wie bereits erwähnt – durch ihre Beziehung zu meiner Mutter immer von größter Wichtigkeit war, habe ich oft zu deuten versucht: keine dieser Deutungen hat mich aber befriedigt. Erst jetzt – nach Lektüre Ihrer Schrift – ahne ich eine einfache, befriedigende Lösung des Rätsels.«
Eine andere Art der fausse reconnaissance kommt zur Befriedigung des Therapeuten nicht selten beim Abschluß einer Behandlung vor. Nachdem es gelungen ist, das verdrängte Ereignis realer oder psychischer Natur gegen alle Widerstände zur Annahme durchzusetzen, es gewissermaßen zu rehabilitieren, sagt der Patient: » Jetzt habe ich die Empfindung, ich habe es immer gewußt.« Damit ist die analytische Aufgabe gelöst.
Über infantile Sexualtheorien (1908)
Das Material, auf welches die nachstehende Zusammenstellung sich stützt, stammt aus mehreren Quellen. Erstens aus der unmittelbaren Beobachtung der Äußerungen und des Treibens der Kinder, zweitens aus den Mitteilungen erwachsener Neurotiker, die während einer psychoanalytischen Behandlung erzählen, was sie von ihrer Kinderzeit bewußt in Erinnerung haben, und zum dritten Anteile aus den Schlüssen, Konstruktionen und ins Bewußte übersetzten unbewußten Erinnerungen, die sich aus den Psychoanalysen mit Neurotikern ergeben.
Daß die erste dieser drei Quellen nicht für sich allein alles Wissenswerte geliefert hat, begründet sich durch das Verhalten der Erwachsenen gegen das kindliche Sexualleben. Man mutet den Kindern keine Sexualtätigkeit zu, gibt sich darum keine Mühe, eine solche zu beobachten, und unterdrückt anderseits die Äußerungen derselben, die der Aufmerksamkeit würdig wären. Die Gelegenheit, aus dieser lautersten und ergiebigsten Quelle zu schöpfen, ist daher eine recht eingeschränkte. Was aus den unbeeinflußten Mitteilungen Erwachsener über ihre bewußten Kindheitserinnerungen stammt, unterliegt höchstens der Einwendung der möglichen Verfälschung in der Rückschau, wird aber außerdem nach dem Gesichtspunkte zu werten sein, daß die Gewährspersonen später neurotisch geworden sind. Das Material der dritten Herkunft wird allen Anfechtungen unterliegen, die man gegen die Verläßlichkeit der Psychoanalyse und die Sicherheit der aus ihr gezogenen Schlüsse ins Feld zu führen pflegt; die Rechtfertigung dieses Urteils kann also hier nicht versucht werden; ich will nur versichern, daß derjenige, welcher die psychoanalytische Technik kennt und ausübt, ein weitgehendes Zutrauen zu ihren Ergebnissen gewinnt.
Für die Vollständigkeit meiner Resultate kann ich nicht einstehen, bloß für die Sorgfalt, mit der ich mich um ihre Gewinnung bemüht habe.
Eine schwierige Frage bleibt es zu entscheiden, inwieweit man das, was hier von den Kindern im allgemeinen berichtet wird, von allen Kindern, das heißt von jedem einzelnen Kinde, voraussetzen darf. Erziehungsdruck und verschiedene Intensität des Sexualtriebes werden gewiß große individuelle Schwankungen im Sexualverhalten des Kindes ermöglichen, vor allem das zeitliche Auftreten des kindlichen Sexualinteresses beeinflussen. Ich habe darum meine Darstellung nicht nach aufeinanderfolgenden Kindheitsepochen gegliedert, sondern in einem zusammengefaßt, was bei verschiedenen Kindern bald früher, bald später zur Geltung kommt. Es ist meine Überzeugung, daß sich doch kein Kind – kein vollsinniges wenigstens oder gar geistig begabtes – der Beschäftigung mit den sexuellen Problemen in den Jahren vor der Pubertät entziehen kann.
Ich denke nicht groß von dem Einwurfe, daß die Neurotiker eine besondere, durch degenerative Anlage ausgezeichnete Menschenklasse sind, aus deren Kinderleben auf die Kindheit anderer zu schließen untersagt sein müßte. Die Neurotiker sind Menschen wie andere auch, von den normalen nicht scharf abzugrenzen, in ihrer Kindheit nicht immer leicht von denjenigen, die später gesund bleiben, zu unterscheiden. Es ist eines der wertvollsten Ergebnisse unserer psychoanalytischen Untersuchungen, daß ihre Neurosen keinen besonderen, ihnen eigentümlich und allein zukommenden psychischen Inhalt haben, sondern daß sie, wie C. G. Jung es ausdrückt, an denselben Komplexen erkranken, mit denen auch wir Gesunde kämpfen. Der Unterschied ist nur der, daß die Gesunden diese Komplexe zu bewältigen wissen ohne groben, praktisch nachweisbaren Schaden, während den Nervösen die Unterdrückung dieser Komplexe nur um den Preis von kostspieligen Ersatzbildungen gelingt, also praktisch mißlingt. Nervöse und Normale stehen einander in der Kindheit natürlich noch viel näher als im späteren Leben, so daß ich einen methodischen Fehler nicht darin erblicken kann, die Mitteilungen von Neurotikern über ihre Kindheit zu Analogieschlüssen über das normale Kindheitsleben zu verwerten. Da aber die späteren Neurotiker sehr häufig einen besonders starken Geschlechtstrieb und eine Neigung zur Frühreife, vorzeitiger Äußerung desselben, in ihrer Konstitution mitbringen, werden sie uns vieles von der infantilen Sexualbetätigung greller und deutlicher erkennen lassen, als unserer ohnedies stumpfen Beobachtungsgabe an anderen Kindern möglich wäre. Der wirkliche Wert dieser von erwachsenen Neurotikern herrührenden Mitteilungen wird sich allerdings erst abschätzen lassen, wenn man nach dem Vorgange von Havelock Ellis auch die Kindheitserinnerungen erwachsener Gesunder der Sammlung gewürdigt haben wird.
Infolge der Ungunst äußerer wie innerer Verhältnisse haben die nachstehenden Mitteilungen vorwiegend nur auf die Sexualentwicklung des einen Geschlechtes, des männlichen nämlich, Bezug. Der Wert einer Sammlung aber, wie ich sie hier versuche, braucht kein bloß deskriptiver zu sein. Die Kenntnis der infantilen Sexualtheorien, wie sie sich im kindlichen Denken gestalten, kann nach verschiedenen Richtungen interessant sein, überraschenderweise auch für das Verständnis der Mythen und Märchen. Unentbehrlich bleibt sie aber für die Auffassung der Neurosen selbst, innerhalb deren diese kindlichen Theorien noch in Geltung sind und einen bestimmenden Einfluß auf die Gestaltung der Symptome gewinnen.
Wenn wir unter Verzicht auf unsere Leiblichkeit als bloß denkende Wesen, etwa von einem anderen Planeten her, die Dinge dieser Erde frisch ins Auge fassen könnten, so würde vielleicht nichts anderes unserer Aufmerksamkeit mehr auffallen als die Existenz zweier Geschlechter unter den Menschen, die, einander sonst so ähnlich, doch durch die äußerlichsten Anzeichen ihre Verschiedenheit betonen. Es scheint nun nicht, daß auch die Kinder diese Grundtatsache zum Ausgange ihrer Forschungen über sexuelle Probleme wählen. Da sie Vater und Mutter kennen, soweit sie sich ihres Lebens erinnern, nehmen sie deren Vorhandensein als eine weiter nicht zu untersuchende Realität hin, und ebenso verhält sich der Knabe gegen ein Schwesterchen, von dem er nur durch eine geringe Altersdifferenz von ein oder zwei Jahren getrennt ist. Der Wissensdrang der Kinder erwacht hier überhaupt nicht spontan, etwa infolge eines eingeborenen Kausalitätsbedürfnisses, sondern unter dem Stachel der sie beherrschenden eigensüchtigen Triebe, wenn sie – etwa nach Vollendung des zweiten Lebensjahres – von der Ankunft eines neuen Kindes betroffen werden. Diejenigen Kinder, deren Kinderstube nicht im Hause selbst eine solche Einquartierung empfängt, sind dann noch imstande, sich nach ihren Beobachtungen in anderen Häusern in diese Situation zu versetzen. Der selbst erfahrene oder mit Recht befürchtete Entgang an Fürsorge von Seiten der Eltern, die Ahnung, allen Besitz von nun an für alle Zeiten mit dem Neuankömmlinge teilen zu müssen, wirken erweckend auf das Gefühlsleben des Kindes und verschärfend auf seine Denkfähigkeit. Das ältere Kind äußert unverhohlene Feindseligkeit gegen den Konkurrenten, die sich in unliebenswürdiger Beurteilung desselben, in Wünschen, daß »der Storch ihn wieder mitnehmen möge«, und dergleichen Luft macht und gelegentlich selbst zu kleinen Attentaten auf das hilflos in der Wiege Daliegende führt. Eine größere Altersdifferenz schwächt den Ausdruck dieser primären Feindseligkeit in der Regel ab; ebenso kann in etwas späteren Jahren, wenn Geschwister ausbleiben, der Wunsch nach einem Gespielen, wie das Kind ihn anderswo beobachten konnte, die Oberhand erhalten.
Unter der Anregung dieser Gefühle und Sorgen kommt das Kind nun zur Beschäftigung mit dem ersten, großartigen Problem des Lebens und stellt sich die Frage, woher die Kinder kommen, die wohl zuerst lautet, woher dieses einzelne störende Kind gekommen ist. Den Nachklang dieser ersten Rätselfrage glaubt man in unbestimmt vielen Rätseln des Mythus und der Sage zu vernehmen; die Frage selbst ist, wie alles Forschen, ein Produkt der Lebensnot, als ob dem Denken die Aufgabe gestellt würde, das Wiedereintreffen so gefürchteter Ereignisse zu verhüten. Nehmen wir indes an, daß sich das Denken des Kindes alsbald von seiner Anregung frei macht und als selbständiger Forschertrieb weiterarbeitet. Wo das Kind nicht bereits zu sehr eingeschüchtert ist, schlägt es früher oder später den nächsten Weg ein, Antwort von seinen Eltern und Pflegepersonen, die ihm die Quelle des Wissens bedeuten, zu verlangen. Dieser Weg geht aber fehl. Das Kind erhält entweder ausweichende Antwort oder einen Verweis für seine Wißbegierde oder wird mit jener mythologisch bedeutsamen Auskunft abgefertigt, die in deutschen Landen lautet: Der Storch bringe die Kinder, die er aus dem Wasser hole. Ich habe Grund anzunehmen, daß weit mehr Kinder, als die Eltern ahnen, mit dieser Lösung unzufrieden sind und ihr energische Zweifel entgegensetzen, die nur nicht immer offen eingestanden werden. Ich weiß von einem dreijährigen Knaben, der nach erhaltener Aufklärung zum Schrecken seiner Kinderfrau vermißt wurde und sich am Ufer des großen Schloßteiches wiederfand, wohin er geeilt war, um die Kinder im Wasser zu beobachten, von einem anderen, der seinem Unglauben keine andere als die zaghafte Aussprache gestatten konnte, er wisse es besser, nicht der Storch bringe die Kinder, sondern der – Fischreiher. Es scheint mir aus vielen Mitteilungen hervorzugehen, daß die Kinder der Storchtheorie den Glauben verweigern, von dieser ersten Täuschung und Abweisung an aber ein Mißtrauen gegen die Erwachsenen in sich nähren, die Ahnung von etwas Verbotenem gewinnen, das ihnen von den »Großen« vorenthalten wird, und darum ihre weiteren Forschungen mit Geheimnis verhüllen. Sie haben dabei aber auch den ersten Anlaß eines »psychischen Konflikts« erlebt, indem Meinungen, für die sie eine triebartige Bevorzugung empfinden, die aber den Großen nicht »recht« sind, in Gegensatz zu anderen geraten, die durch die Autorität der »Großen« gehalten werden, ohne ihnen selbst genehm zu sein. Aus diesem psychischen Konflikte kann bald eine »psychische Spaltung« werden; die eine Meinung, mit der die Bravheit, aber auch die Sistierung des Nachdenkens verbunden ist, wird zur herrschenden bewußten; die andere, für die die Forscherarbeit unterdes neue Beweise erbracht hat, die nicht gelten sollen, zur unterdrückten, »unbewußten«. Der Kernkomplex der Neurose findet sich auf diese Weise konstituiert.
Ich habe kürzlich durch die Analyse eines fünfjährigen Knaben, die dessen Vater mit ihm angestellt und mir dann zur Veröffentlichung überlassen hat, den unwiderleglichen Nachweis für eine Einsicht erhalten, auf deren Spur mich die Psychoanalysen Erwachsener längst geführt hatten. Ich weiß jetzt, daß die Graviditätsveränderung der Mutter den scharfen Augen des Kindes nicht entgeht und daß dieses sehr wohl imstande ist, eine Weile nachher den richtigen Zusammenhang zwischen der Leibeszunahme der Mutter und dem Erscheinen des Kindes herzustellen. In dem erwähnten Falle war der Knabe dreieinhalb Jahre alt, als seine Schwester geboren wurde, und vierdreiviertel, als er sein besseres Wissen durch die unverkennbarsten Anspielungen erraten ließ. Diese frühzeitige Erkenntnis wird aber immer geheimgehalten und später im Zusammenhange mit den weiteren Schicksalen der kindlichen Sexualforschung verdrängt und vergessen.
Die »Storchfabel« gehört also nicht zu den infantilen Sexualtheorien; es ist im Gegenteile die Beobachtung der Tiere, die ihr Sexualleben so wenig verhüllen und denen sich das Kind so verwandt fühlt, die den Unglauben des Kindes bestärkt. Mit der Erkenntnis, das Kind wachse im Leibe der Mutter, die das Kind noch selbständig erwirbt, wäre es auf dem richtigen Wege, das Problem, an dem es zuerst seine Denkkraft erprobt, zu lösen. Im weiteren Fortschreiten wird es aber gehemmt durch eine Unwissenheit, die sich nicht ersetzen läßt, und durch falsche Theorien, welche der Zustand der eigenen Sexualität ihm aufdrängt.
Diese falschen Sexualtheorien, die ich nun erörtern werde, haben alle einen sehr merkwürdigen Charakter. Obwohl sie in grotesker Weise fehlgehen, enthalten sie doch, jede von ihnen, ein Stück echter Wahrheit, in dieser Zusammensetzung analog den »genial« geheißenen Lösungsversuchen Erwachsener an den für den Menschenverstand überschwierigen Weltproblemen. Das Richtige und Triftige an diesen Theorien erklärt sich durch deren Abkunft von den Komponenten des Sexualtriebes, die sich bereits im kindlichen Organismus regen; denn nicht psychische Willkür oder zufällige Eindrücke haben diese Annahmen entstehen lassen, sondern die Notwendigkeiten der psychosexuellen Konstitution, und darum können wir von typischen Sexualtheorien der Kinder sprechen, darum finden wir die nämlichen irrigen Meinungen bei allen Kindern, deren Sexualleben uns zugänglich wird.
Die erste dieser Theorien knüpft an die Vernachlässigung der Geschlechtsunterschiede an, die wir eingangs als kennzeichnend für das Kind hervorgehoben haben. Sie besteht darin, allen Menschen, auch den weiblichen Personen, einen Penis zuzusprechen, wie ihn der Knabe vom eigenen Körper kennt. Gerade in jener Sexualkonstitution, die wir als die »normale« anerkennen müssen, ist der Penis schon in der Kindheit die leitende erogene Zone, das hauptsächlichste autoerotische Sexualobjekt, und seine Wertschätzung spiegelt sich logisch in dem Unvermögen, eine dem Ich ähnliche Persönlichkeit ohne diesen wesentlichen Bestandteil vorzustellen. Wenn der kleine Knabe das Genitale eines Schwesterchens zu Gesicht bekommt, so zeigen seine Äußerungen, daß sein Vorurteil bereits stark genug ist, um die Wahrnehmung zu beugen; er konstatiert nicht etwa das Fehlen des Gliedes, sondern sagt regelmäßig, wie tröstend und vermittelnd: der ... ist aber noch klein; nun, wenn sie größer wird, wird er schon wachsen. Die Vorstellung des Weibes mit dem Penis kehrt noch spät in den Träumen des Erwachsenen wieder; in nächtlicher sexueller Erregung wirft er ein Weib nieder, entblößt es und bereitet sich zum Koitus, um dann beim Anblick des wohlausgebildeten Gliedes an Stelle der weiblichen Genitalien den Traum und die Erregung abzubrechen. Die zahlreichen Hermaphroditen des klassischen Altertums geben diese einst allgemeine infantile Vorstellung getreulich wieder; man kann beobachten, daß sie auf die meisten normalen Menschen nicht verletzend wirkt, während die wirklich von der Natur zugelassenen hermaphroditischen Bildungen der Genitalien fast immer den größten Abscheu erregen.
Wenn sich diese Vorstellung des Weibes mit dem Penis bei dem Kinde »fixiert«, allen Einflüssen des späteren Lebens widersteht und den Mann unfähig macht, bei seinem Sexualobjekt auf den Penis zu verzichten, so muß ein solches Individuum bei sonst normalem Sexualleben ein Homosexueller werden, seine Sexualobjekte unter den Männern suchen, die durch andere somatische und seelische Charaktere an das Weib erinnern. Das wirkliche Weib, wie es später erkannt wird, bleibt als Sexualobjekt unmöglich für ihn, da es des wesentlichen sexuellen Reizes entbehrt, ja im Zusammenhange mit einem anderen Eindruck des Kinderlebens kann es zum Abscheu für ihn werden. Das hauptsächlich von der Peniserregung beherrschte Kind hat sich gewöhnlich durch Reizung desselben mit der Hand Lust geschafft, ist von den Eltern oder Wartepersonen dabei ertappt und mit der Drohung, man werde ihm das Glied abschneiden, geschreckt worden. Die Wirkung dieser »Kastrationsdrohung« ist im richtigen Verhältnisse zur Schätzung dieses Körperteiles eine ganz außerordentlich tiefgreifende und nachhaltige. Sagen und Mythen zeugen von dem Aufruhr des kindlichen Gefühlslebens, von dem Entsetzen, das sich an den Kastrationskomplex knüpft, der dann später auch entsprechend widerwillig vom Bewußtsein erinnert wird. An diese Drohung mahnt nun das später wahrgenommene, als verstümmelt aufgefaßte Genitale des Weibes, und darum erweckt es beim Homosexuellen Grausen anstatt Lust. An dieser Reaktion kann nichts mehr geändert werden, wenn der Homosexuelle von der Wissenschaft erfährt, daß die kindliche Annahme, auch die Frau besitze einen Penis, doch nicht so irregeht. Die Anatomie hat die Klitoris innerhalb der weiblichen Schamspalte als das dem Penis homologe Organ erkannt, und die Physiologie der Sexualvorgänge hat hinzufügen können, daß dieser kleine und nicht mehr wachsende Penis sich in der Kindheit des Weibes tatsächlich wie ein echter und rechter Penis benimmt, daß er zum Sitz von Erregungen wird, die zu seiner Berührung veranlassen, daß seine Reizbarkeit der Sexualbetätigung des kleinen Mädchens männlichen Charakter verleiht und daß es eines Verdrängungsschubes in den Pubertätsjahren bedarf, um durch Hinwegräumung dieser männlichen Sexualität das Weib entstehen zu lassen. Wie nun viele Frauen in ihrer Sexualfunktion daran verkümmern, daß diese Klitoriserregbarkeit hartnäckig festgehalten wird, so daß sie im Koitusverkehr anästhetisch bleiben, oder daß die Verdrängung zu übermäßig erfolgt, so daß ihre Wirkung durch hysterische Ersatzbildung teilweise aufgehoben wird; dies alles gibt der infantilen Sexualtheorie, das Weib besitze wie der Mann einen Penis, nicht unrecht.
An dem kleinen Mädchen kann man mit Leichtigkeit beobachten, daß es die Schätzung des Bruders durchaus teilt. Es entwickelt ein großes Interesse für diesen Körperteil beim Knaben, das aber alsbald vom Neide kommandiert wird. Es fühlt sich benachteiligt, es macht Versuche, in solcher Stellung zu urinieren, wie es dem Knaben durch den Besitz des großen Penis ermöglicht wird, und wenn es den Wunsch äußert: Ich möchte lieber ein Bub sein, so wissen wir, welchem Mangel dieser Wunsch abhelfen soll.
Wenn das Kind den Andeutungen folgen könnte, die von der Erregung des Penis ausgehen, so würde es der Lösung seines Problems um ein Stück näher rücken. Daß das Kind im Leibe der Mutter wächst, ist offenbar nicht genug Erklärung. Wie kommt es hinein? Was gibt den Anstoß zu seiner Entwicklung? Daß der Vater etwas damit zu tun hat, ist wahrscheinlich; er erklärt ja, das Kind sei auch sein Kind [Fußnote]Vgl. hiezu die Analyse des fünfjährigen Knaben.. Anderseits hat der Penis gewiß auch seinen Anteil an diesen nicht zu erratenden Vorgängen, er bezeugt es durch seine Miterregung bei all dieser Gedankenarbeit. Mit dieser Erregung sind Antriebe verbunden, die das Kind sich nicht zu deuten weiß, dunkle Impulse zu gewaltsamem Tun, zum Eindringen, Zerschlagen, irgendwo ein Loch aufreißen. Aber wenn das Kind so auf dem besten Wege scheint, die Existenz der Scheide zu postulieren und dem Penis des Vaters ein solches Eindringen bei der Mutter zuzuschreiben als jenen Akt, durch den das Kind im Leibe der Mutter entsteht, so bricht an dieser Stelle doch die Forschung ratlos ab, denn ihr steht die Theorie im Wege, daß die Mutter einen Penis besitzt wie ein Mann, und die Existenz des Hohlraumes, der den Penis aufnimmt, bleibt für das Kind unentdeckt. Daß die Erfolglosigkeit der Denkbemühung dann ihre Verwerfung und ihr Vergessen erleichtert, wird man gern annehmen. Dieses Grübeln und Zweifeln wird aber vorbildlich für alle spätere Denkarbeit an Problemen, und der erste Mißerfolg wirkt für alle Zeiten lähmend fort.
Die Unkenntnis der Vagina ermöglicht dem Kinde auch die Überzeugung von der zweiten seiner Sexualtheorien. Wenn das Kind im Leibe der Mutter wächst und aus diesem entfernt wird, so kann dies nur auf dem einzig möglichen Wege der Darmöffnung geschehen. Das Kind muß entleert werden wie ein Exkrement, ein Stuhlgang. Wenn dieselbe Frage in späteren Kinderjahren Gegenstand des einsamen Nachdenkens oder der Besprechung zwischen zwei Kindern wird, so stellen sich wohl die Auskünfte ein, das Kind komme aus dem sich öffnenden Nabel oder der Bauch werde aufgeschnitten und das Kind herausgenommen, wie es dem Wolfe im Märchen von Rotkäppchen geschieht. Diese Theorien werden laut ausgesprochen und später auch bewußt erinnert; sie enthalten nichts Anstößiges mehr. Dieselben Kinder haben dann völlig vergessen, daß sie in früheren Jahren an eine andere Geburtstheorie glaubten, welcher gegenwärtig die seither eingetretene Verdrängung der analen Sexualkomponente im Wege steht. Damals war der Stuhlgang etwas, wovon in der Kinderstube ohne Scheu gesprochen werden durfte, das Kind stand seinen konstitutionellen koprophilen Neigungen noch nicht so ferne; es war keine Degradation, so zur Welt zu kommen wie ein Haufen Kot, den der Ekel noch nicht verdammt hatte. Die Kloakentheorie, die für so viele Tiere ja zu Recht besteht, war die natürlichste und die einzige, die sich dem Kinde als wahrscheinlich aufdrängen konnte.
Dann war es aber nur konsequent, daß das Kind das schmerzliche Vorrecht des Weibes, Kinder zu gebären, nicht gelten ließ. Wenn die Kinder durch den After geboren werden, so kann der Mann ebensogut gebären wie das Weib. Der Knabe kann also auch phantasieren, daß er selbst Kinder bekommt, ohne daß wir ihn darum femininer Neigungen zu beschuldigen brauchen. Er betätigt dabei nur seine noch regsame Analerotik.
Wenn sich die Kloakentheorie der Geburt im Bewußtsein späterer Kinderjahre erhält, was gelegentlich vorkommt, so bringt sie auch eine allerdings nicht mehr ursprüngliche Lösung der Frage nach der Entstehung der Kinder mit sich. Es ist dann wie im Märchen. Man ißt etwas Bestimmtes, und davon bekommt man ein Kind. Die Geisteskranke belebt diese infantile Geburtstheorie dann wieder. Die Maniaka etwa führt den besuchenden Arzt zu einem Häufchen Kot, das sie in einer Ecke ihrer Zelle abgesetzt hat, und sagt ihm lachend: Das ist das Kind, das ich heute geboren habe.
Die dritte der typischen Sexualtheorien ergibt sich den Kindern, wenn sie durch irgendeine der häuslichen Zufälligkeiten zu Zeugen des elterlichen Sexualverkehrs werden, über den sie dann doch nur sehr unvollständige Wahrnehmungen machen können. Welches Stück desselben dann immer in ihre Beobachtung fällt, ob die gegenseitige Lage der beiden Personen oder die Geräusche oder gewisse Nebenumstände, sie gelangen in allen Fällen zur nämlichen, wir können sagen sadistischen Auffassung des Koitus, sehen in ihm etwas, was der stärkere Teil dem schwächeren mit Gewalt antut, und vergleichen ihn, zumal die Knaben, mit einer Rauferei, wie sie sie aus ihrem Kinderverkehr kennen und die ja auch der Beimengung sexueller Erregung nicht ermangelt. Ich habe nicht feststellen können, daß die Kinder diesen von ihnen beobachteten Vorgang zwischen den Eltern als das zur Lösung des Kinderproblems erforderliche Stück agnoszieren würden; öfter hatte es den Anschein, als würde diese Beziehung von den Kindern gerade darum verkannt, weil sie dem Liebesakte solche Deutung ins Gewalttätige gegeben haben. Aber diese Auffassung macht selbst den Eindruck einer Wiederkehr jenes dunkeln Impulses zur grausamen Betätigung, der sich beim ersten Nachdenken über das Rätsel, woher die Kinder kommen, an die Peniserregung knüpfte. Es ist auch die Möglichkeit nicht abzuleugnen, daß jener frühzeitige sadistische Impuls, der den Koitus beinahe hätte erraten lassen, selbst unter dem Einflusse dunkelster Erinnerungen an den Verkehr der Eltern aufgetreten ist, für die das Kind, als es noch in den ersten Lebensjahren das Schlafzimmer der Eltern teilte, das Material aufgenommen hatte, ohne es damals zu verwerten [Fußnote]In dem 1794 veröffentlichten, autobiographischen Buche Monsieur Nicolas bestätigt Restif de la Bretonne dieses sadistische Mißverständnis des Koitus in der Erzählung eines Eindruckes aus seinem vierten Lebensjahre..
Die sadistische Theorie des Koitus, die in ihrer Isoliertheit zur Irreführung wird, wo sie hätte Bestätigung bringen können, ist wiederum der Ausdruck einer der angeborenen sexuellen Komponenten, die bei dem einzelnen Kinde mehr oder minder stark ausgeprägt sein mag, und sie hat daher ein Stück weit recht, errät zum Teil das Wesen des Geschlechtsaktes und den »Kampf der Geschlechter«, der ihm vorhergeht. Nicht selten ist das Kind auch in der Lage, diese seine Auffassung durch akzidentelle Wahrnehmungen zu stützen, die es zum Teil richtig, zum anderen wieder falsch, ja gegensätzlich erfaßt. In vielen Ehen sträubt sich die Frau wirklich regelmäßig gegen die eheliche Umarmung, die ihr keine Lust und die Gefahr neuer Schwangerschaft bringt, und so mag die Mutter dem für schlafend gehaltenen (oder sich schlafend stellenden) Kinde einen Eindruck bieten, der gar nicht anders denn als ein Wehren gegen eine Gewalttat gedeutet werden kann. Andere Male noch gibt die ganze Ehe dem aufmerksamen Kinde das Schauspiel eines unausgesetzten, in lauten Worten und unfreundlichen Gebärden sich äußernden Streites, wo dann das Kind sich nicht zu wundern braucht, daß dieser Streit sich auch in die Nacht fortsetzt und endlich durch dieselben Methoden ausgetragen wird, die das Kind im Verkehre mit seinen Geschwistern oder Spielgenossen zu gebrauchen gewöhnt ist.
Als eine Bestätigung seiner Auffassung sieht das Kind es aber auch an, wenn es Blutspuren im Bett oder an der Wäsche der Mutter entdeckt. Diese sind ihm ein Beweis dafür, daß in der Nacht wieder ein solcher Überfall des Vaters auf die Mutter stattgefunden hat, während wir dieselbe frische Blutspur lieber als Anzeichen einer Pause im sexuellen Verkehre deuten werden. Manche sonst unerklärliche »Blutscheu« der Nervösen findet durch diesen Zusammenhang ihre Aufklärung. Der Irrtum des Kindes deckt wiederum ein Stückchen Wahrheit; unter gewissen, bekannten Verhältnissen wird die Blutspur allerdings als Zeichen des eingeleiteten sexuellen Verkehres gewürdigt.
In loserem Zusammenhange mit dem unlösbaren Problem, woher die Kinder kommen, beschäftigt sich das Kind mit der Frage, was das Wesen und der Inhalt des Zustandes sei, den man »Verheiratetsein« heißt, und beantwortet diese Frage verschieden, je nach dem Zusammentreffen von zufälligen Wahrnehmungen bei den Eltern mit den eigenen noch lustbetonten Trieben. Nur daß es sich vom Verheiratetsein Lustbefriedigung verspricht und ein Hinwegsetzen über die Scham vermutet, scheint allen diesen Beantwortungen gemeinsam. Die Auffassung, die ich am häufigsten gefunden habe, lautet, daß » man voreinanderuriniert«; eine Abänderung, die so klingt, als ob sie symbolisch ein Mehrwissen andeuten wollte: daß der Mann in den Topf der Frau uriniert. Andere Male wird der Sinn des Heiratens darin verlegt: daß man einander den Popo zeigt (ohne sich zu schämen). In einem Falle, in dem es der Erziehung gelungen war, die Sexualerfahrung besonders lange aufzuschieben, kam das vierzehnjährige und bereits menstruierte Mädchen über Anregung der Lektüre auf die Idee, das Verheiratetsein bestehe in einer » Mischung des Blutes«, und da die eigene Schwester noch nicht die Periode hatte, versuchte die Lüsterne ein Attentat auf eine Besucherin, welche gestanden hatte, eben zu menstruieren, um sie zu dieser »Blutvermischung« zu nötigen.
Die infantilen Meinungen über das Wesen der Ehe, die nicht selten von der bewußten Erinnerung festgehalten werden, haben für die Symptomatik späterer neurotischer Erkrankung große Bedeutung. Sie schaffen sich zunächst Ausdruck in Kinderspielen, in denen man das miteinander tut, was das Verheiratetsein ausmacht, und dann später einmal kann sich der Wunsch, verheiratet zu sein, die infantile Ausdrucksform wählen, um in einer zunächst unkenntlichen Phobie oder einem entsprechenden Symptom aufzutreten [Fußnote]Die für die spätere Neurose bedeutsamsten Kinderspiele sind das »Doktorspiel« und »Papa- und Mama«-Spielen..
Es wären dies die wichtigsten der typischen, in frühen Kindheitsjahren und spontan, nur unter dem Einflüsse der sexuellen Triebkomponenten produzierten Sexualtheorien des Kindes. Ich weiß, daß ich weder die Vollständigkeit des Materials noch die Herstellung des lückenlosen Zusammenhanges mit dem sonstigen Kinderleben erreicht habe. Einzelne Nachträge kann ich hier noch anfügen, die sonst jeder Kundige vermißt hätte. So zum Beispiel die bedeutsame Theorie, daß man ein Kind durch einen Kuß bekommt, die wie selbstverständlich die Vorherrschaft der erogenen Mundzone verrät. Nach meiner Erfahrung ist diese Theorie ausschließlich feminin und wird als pathogen manchmal bei Mädchen angetroffen, bei denen die Sexualforschung in der Kindheit die stärksten Hemmungen erfahren hat. Eine meiner Patientinnen gelangte durch eine zufällige Wahrnehmung zur Theorie der » Couvade«, die bekanntlich bei manchen Völkern allgemeine Sitte ist und wahrscheinlich die Absicht hat, dem nie völlig zu besiegenden Zweifel an der Paternität zu widersprechen. Da ein etwas sonderbarer Onkel nach der Geburt seines Kindes tagelang zu Hause blieb und die Besucher im Schlafrock empfing, schloß sie, daß bei einer Geburt beide Eltern beteiligt seien und zu Bette gehen müßten.
Um das zehnte oder elfte Lebensjahr tritt die sexuelle Mitteilung an die Kinder heran. Ein Kind, welches in ungehemmteren sozialen Verhältnissen aufgewachsen ist oder sonst glücklichere Gelegenheit zur Beobachtung gefunden hat, teilt anderen mit, was es weiß, weil es sich dabei reif und überlegen empfinden kann. Was die Kinder so erfahren, ist meist das Richtige, das heißt, es wird ihnen die Existenz der Vagina und deren Bestimmung verraten, aber sonst sind diese Aufklärungen, die sie voneinander entlehnen, nicht selten mit Falschem vermengt, mit Überresten der älteren infantilen Sexualtheorien behaftet. Vollständig und zur Lösung des uralten Problems ausreichend sind sie fast nie. Wie früher die Unkenntnis der Vagina, so hindert jetzt die des Samens die Einsicht in den Zusammenhang. Das Kind kann nicht erraten, daß aus dem männlichen Geschlechtsglied noch eine andere Substanz entleert wird als der Harn, und gelegentlich zeigt sich ein »unschuldiges Mädchen« noch in der Brautnacht entrüstet darüber, daß der Mann »in sie hineinuriniere«. An diese Mitteilungen in den Jahren der Vorpubertät schließt sich nun ein neuer Aufschwung der kindlichen Sexualforschung; aber die Theorien, welche die Kinder jetzt schaffen, haben nicht mehr das typische und ursprüngliche Gepräge, das für die frühkindlichen, primären, charakteristisch war, solange die infantilen Sexualkomponenten ungehemmt und unverwandelt ihren Ausdruck in Theorien durchsetzen konnten. Die späteren Denkbemühungen zur Lösung der sexuellen Rätsel schienen mir die Sammlung nicht zu verlohnen, sie können auch auf pathogene Bedeutung wenig Anspruch mehr erheben. Ihre Mannigfaltigkeit ist natürlich in erster Linie von der Natur der erhaltenen Aufklärung abhängig; ihre Bedeutung liegt vielmehr darin, daß sie die unbewußtgewordenen Spuren jener ersten Periode des sexuellen Interesses wieder erwecken, so daß nicht selten masturbatorische Sexualbetätigung und ein Stück der Gefühlsablösung von den Eltern an sie anknüpft. Daher das verdammende Urteil der Erzieher, daß solche Aufklärung in diesen Jahren die Kinder »verderbe«.
Einige wenige Beispiele mögen zeigen, welche Elemente oft in diese späten Grübeleien der Kinder über das Sexualleben eingehen. Ein Mädchen hat von den Schulkolleginnen gehört, daß der Mann der Frau ein Ei gibt, welches sie in ihrem Leibe ausbrütet. Ein Knabe, der auch vom Ei gehört hat, identifiziert dieses »Ei« mit dem vulgär ebenso benannten Hoden und zerbricht sich den Kopf darüber, wie denn der Inhalt des Hodensackes sich immer wieder erneuern kann. Die Aufklärungen reichen selten so weit, um wesentliche Unsicherheiten über die Geschlechtsvorgänge zu verhüten. So können Mädchen zur Erwartung kommen, der Geschlechtsverkehr finde nur ein einziges Mal statt, dauere aber da sehr lange, vierundzwanzig Stunden, und von diesem einen Male kämen der Reihe nach alle Kinder. Man sollte meinen, dieses Kind habe Kenntnis von dem Fortpflanzungsvorgang bei gewissen Insekten gewonnen; aber diese Vermutung bestätigt sich nicht, die Theorie erscheint als eine selbständige Schöpfung. Andere Mädchen übersehen die Tragzeit, das Leben im Mutterleibe, und nehmen an, daß das Kind unmittelbar nach der Nacht des ersten Verkehrs zum Vorschein komme. Marcel Prevost hat diesen Jungmädchenirrtum in einer der Lettres de femmes zu einer lustigen Geschichte verarbeitet. Schwer zu erschöpfen und vielleicht im allgemeinen nicht uninteressant ist das Thema dieser späten Sexualforschung der Kinder oder auf der kindlichen Stufe zurückgehaltenen Adoleszenten, aber es liegt meinem Interesse ferner, und ich muß nur noch hervorheben, daß dabei von den Kindern viel Unrechtes zutage gefördert wird, was dazu bestimmt ist, älterer, besserer, aber unbewußtgewordener und verdrängter Erkenntnis zu widersprechen.
Auch die Art, wie die Kinder sich gegen die ihnen zugehenden Mitteilungen verhalten, hat ihre Bedeutung. Bei manchen ist die Sexualverdrängung so weit gediehen, daß sie nichts anhören wollen, und diesen gelingt es auch, bis in späte Jahre unwissend zu bleiben, scheinbar unwissend wenigstens, bis in der Psychoanalyse der Neurotischen das aus früher Kindheit stammende Wissen zum Vorschein kommt. Ich weiß auch von zwei Knaben zwischen zehn und dreizehn Jahren, welche die sexuelle Aufklärung zwar anhörten, aber dem Gewährsmanne die ablehnende Antwort gaben: Es ist möglich, daß dein Vater und andere Leute so etwas tun, aber von meinem Vater weiß ich es gewiß, daß er es nie tun würde. Wie mannigfaltig immer dieses spätere Benehmen der Kinder gegen die Befriedigung der sexuellen Wißbegierde sein mag, für ihre ersten Kinderjahre dürfen wir ein durchaus gleichförmiges Verhalten annehmen und glauben, daß sie damals alle aufs eifrigste bestrebt waren zu erfahren, was die Eltern miteinander tun, woraus dann die Kinder werden.
Über libidinöse Typen (1931)
Unsere Beobachtung zeigt uns, daß die einzelnen menschlichen Personen das allgemeine Bild des Menschen in einer kaum übersehbaren Mannigfaltigkeit verwirklichen. Wenn man dem berechtigten Bedürfnis nachgibt, in dieser Menge einzelne Typen zu unterscheiden, so wird man von vorneherein die Wahl haben, nach welchen Merkmalen und von welchen Gesichtspunkten man diese Sonderung vornehmen soll. Körperliche Eigenschaften werden für diesen Zweck gewiß nicht weniger brauchbar sein als psychische; am wertvollsten werden solche Unterscheidungen sein, die ein regelmäßiges Beisammensein von körperlichen und seelischen Merkmalen versprechen.
Es ist fraglich, ob es uns bereits jetzt möglich ist, Typen von solcher Leistung herauszufinden, wie es später einmal auf einer noch unbekannten Basis gewiß gelingen wird. Beschränkt man sich auf die Bemühung, bloß psychologische Typen aufzustellen, so haben die Verhältnisse der Libido den ersten Anspruch, der Einteilung als Grundlage zu dienen. Man darf fordern, daß diese Einteilung nicht bloß aus unserem Wissen oder unseren Annahmen über die Libido abgeleitet sei, sondern daß sie sich auch in der Erfahrung leicht wiederfinden lasse und daß sie ihr Teil dazu beitrage, die Masse unserer Beobachtungen für unsere Auffassung zu klären. Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß diese libidinösen Typen auch auf psychischem Gebiet nicht die einzig möglichen zu sein brauchen und daß man, von anderen Eigenschaften ausgehend, vielleicht eine ganze Reihe anderer psychologischer Typen aufstellen kann. Für alle solche Typen muß gelten, daß sie nicht mit Krankheitsbildern zusammenfallen dürfen. Sie sollen im Gegenteil alle die Variationen umfassen, die nach unserer praktisch gerichteten Schätzung in die Breite des Normalen fallen. Wohl aber können sie sich in ihren extremen Ausbildungen den Krankheitsbildern annähern und solcherart die vermeintliche Kluft zwischen dem Normalen und dem Pathologischen ausfüllen helfen.
Nun lassen sich je nach der vorwiegenden Unterbringung der Libido in den Provinzen des seelischen Apparats drei libidinöse Haupttypen unterscheiden. Deren Namengebung ist nicht ganz leicht; in Anlehnung an unsere Tiefenpsychologie möchte ich sie als den erotischen, den narzißtischen und den Zwangstypus bezeichnen.
Der erotische Typus ist leicht zu charakterisieren. Die Erotiker sind Personen, deren Hauptinteresse – der relativ größte Betrag ihrer Libido – dem Liebesleben zugewendet ist. Lieben, besonders aber Geliebtwerden, ist ihnen das Wichtigste. Sie werden von der Angst vor dem Liebesverlust beherrscht und sind darum besonders abhängig von den anderen, die ihnen die Liebe versagen können. Dieser Typus ist auch in seiner reinen Form recht häufig. Variationen desselben ergeben sich je nach der Vermengung mit einem andern Typus und dem gleichzeitigen Ausmaß von Aggression. Sozial wie kulturell vertritt dieser Typus die elementaren Triebansprüche des Es, dem die andern psychischen Instanzen gefügig geworden sind.
Der zweite Typus, dem ich den zunächst befremdlichen Namen Zwangstypus gegeben habe, zeichnet sich durch die Vorherrschaft des Über-Ichs aus, das sich unter hoher Spannung vom Ich absondert. Er wird von der Gewissensangst beherrscht an Stelle der Angst vor dem Liebesverlust, zeigt eine sozusagen innere Abhängigkeit anstatt der äußeren, entfaltet ein hohes Maß von Selbständigkeit und wird sozial zum eigentlichen, vorwiegend konservativen Träger der Kultur.
Der dritte, mit gutem Recht narzißtisch geheißene Typus ist wesentlich negativ charakterisiert. Keine Spannung zwischen Ich und Über-Ich – man würde von diesem Typus her kaum zur Aufstellung eines Über-Ichs gekommen sein –, keine Übermacht der erotischen Bedürfnisse, das Hauptinteresse auf die Selbsterhaltung gerichtet, unabhängig und wenig eingeschüchtert. Dem Ich ist ein großes Maß von Aggression verfügbar, das sich auch in Bereitschaft zur Aktivität kundgibt; im Liebesleben wird das Lieben vor dem Geliebtwerden bevorzugt. Menschen dieses Typus imponieren den andern als »Persönlichkeiten«, sind besonders geeignet, anderen als Anhalt zu dienen, die Rolle von Führern zu übernehmen, der Kulturentwicklung neue Anregungen zu geben oder das Bestehende zu schädigen.
Diese reinen Typen werden dem Verdacht der Ableitung aus der Theorie der Libido kaum entgehen. Man fühlt sich aber auf dem sicheren Boden der Erfahrung, wenn man sich nun den gemischten Typen zuwendet, die um so viel häufiger zur Beobachtung kommen als die reinen. Diese neuen Typen, der erotisch-zwanghafte, der erotisch-narzißtische und der narzißtische Zwangstypus, scheinen in der Tat eine gute Unterbringung der individuellen psychischen Strukturen, wie wir sie durch die Analyse kennengelernt haben, zu gestatten. Es sind längst vertraute Charakterbilder, auf die man bei der Verfolgung dieser Mischtypen gerät. Beim erotischen Zwangstypus scheint die Übermacht des Trieblebens durch den Einfluß des Über-Ichs eingeschränkt; die Abhängigkeit gleichzeitig von rezenten menschlichen Objekten und von den Relikten der Eltern, Erzieher und Vorbilder erreicht bei diesem Typus den höchsten Grad. Der erotisch-narzißtische ist vielleicht jener, dem man die größte Häufigkeit zusprechen muß. Er vereinigt Gegensätze, die sich in ihm gegenseitig ermäßigen können; man kann an ihm im Vergleich mit den beiden anderen erotischen Typen lernen, daß Aggression und Aktivität mit der Vorherrschaft des Narzißmus zusammengehen. Der narzißtische Zwangstypus endlich ergibt die kulturell wertvollste Variation, indem er zur äußeren Unabhängigkeit und Beachtung der Gewissensforderung die Fähigkeit zur kraftvollen Betätigung hinzufügt und das Ich gegen das Über-Ich verstärkt.
Man könnte meinen, einen Scherz zu machen, wenn man die Frage aufwirft, warum ein anderer theoretisch möglicher Mischtypus hier keine Erwähnung findet, nämlich der erotisch-zwanghaft-narzißtische. Aber die Antwort auf diesen Scherz ist ernsthaft: weil ein solcher Typus kein Typus mehr wäre, sondern die absolute Norm, die ideale Harmonie bedeuten würde. Man wird dabei inne, daß das Phänomen des Typus eben dadurch entsteht, daß von den drei Hauptverwendungen der Libido im seelischen Haushalt eine oder zwei auf Kosten der anderen begünstigt worden sind.
Man kann sich auch die Frage vorlegen, welches das Verhältnis dieser libidinösen Typen zur Pathologie ist, ob einige von ihnen zum Übergang in die Neurose besonders disponiert sind, und dann, welche Typen zu welchen Formen führen. Die Antwort wird lauten, daß die Aufstellung dieser libidinösen Typen kein neues Licht auf die Genese der Neurosen wirft. Nach dem Zeugnis der Erfahrung sind alle diese Typen ohne Neurose lebensfähig. Die reinen Typen mit dem unbestrittenen Übergewicht einer einzelnen seelischen Instanz scheinen die größere Aussicht zu haben, als reine Charakterbilder aufzutreten, während man von den gemischten Typen erwarten könnte, daß sie für die Bedingungen der Neurose einen günstigeren Boden bieten. Doch meine ich, man sollte über diese Verhältnisse nicht ohne besonders gerichtete, sorgfältige Nachprüfung entscheiden.
Daß die erotischen Typen im Falle der Erkrankung Hysterie ergeben, wie die Zwangstypen Zwangsneurose, scheint ja leicht zu erraten, ist aber auch an der zuletzt betonten Unsicherheit beteiligt. Die narzißtischen Typen, die bei ihrer sonstigen Unabhängigkeit der Versagung von seiten der Außenwelt ausgesetzt sind, enthalten eine besondere Disposition zur Psychose, wie sie auch wesentliche Bedingungen des Verbrechertums beistellen.
Die ätiologischen Bedingungen der Neurose sind bekanntlich noch nicht sicher erkannt. Die Veranlassungen der Neurose sind Versagungen und innere Konflikte, Konflikte zwischen den drei großen psychischen Instanzen, Konflikte innerhalb des Libidohaushalts infolge der bisexuellen Anlage, zwischen den erotischen und aggressiven Triebkomponenten. Was diese dem normalen psychischen Ablauf zugehörigen Vorgänge pathogen macht, bemüht sich die Neurosenpsychologie zu ergründen.
Über neurotische Erkrankungstypen (1912)
In den nachstehenden Sätzen soll auf Grund empirisch gewonnener Eindrücke dargestellt werden, welche Veränderungen der Bedingungen dafür maßgebend sind, daß bei den hiezu Disponierten eine neurotische Erkrankung zum Ausbruch komme. Es handelt sich also um die Frage der Krankheitsveranlassungen; von den Krankheitsformen wird wenig die Rede sein. Von anderen Zusammenstellungen der Erkrankungsanlässe wird sich diese durch den einen Charakter unterscheiden, daß sie die aufzuzählenden Veränderungen sämtlich auf die Libido des Individuums bezieht. Die Schicksale der Libido erkannten wir ja durch die Psychoanalyse als entscheidend für nervöse Gesundheit oder Krankheit. Auch über den Begriff der Disposition ist in diesem Zusammenhange kein Wort zu verlieren. Gerade die psychoanalytische Forschung hat uns ermöglicht, die neurotische Disposition in der Entwicklungsgeschichte der Libido nachzuweisen und die in ihr wirksamen Faktoren auf mitgeborene Varietäten der sexuellen Konstitution und in der frühen Kindheit erlebte Einwirkungen der Außenwelt zurückzuführen.
a) Der nächstliegende, am leichtesten auffindbare und am besten verständliche Anlaß zur neurotischen Erkrankung liegt in jenem äußeren Moment vor, welches allgemein als die Versagung beschrieben werden kann. Das Individuum war gesund, solange seine Liebesbedürftigkeit durch ein reales Objekt der Außenwelt befriedigt wurde; es wird neurotisch, sobald ihm dieses Objekt entzogen wird, ohne daß sich ein Ersatz dafür findet. Glück fällt hier mit Gesundheit, Unglück mit Neurose zusammen. Die Heilung fällt dem Schicksal, welches für die verlorene Befriedigungsmöglichkeit einen Ersatz schenken kann, leichter als dem Arzte.
Für diesen Typus, an dem wohl die Mehrzahl der Menschen Anteil hat, beginnt die Erkrankungsmöglichkeit also erst mit der Abstinenz, woraus man ermessen kann, wie bedeutungsvoll die kulturellen Einschränkungen der zugänglichen Befriedigung für die Veranlassung der Neurosen sein mögen. Die Versagung wirkt dadurch pathogen, daß sie die Libido aufstaut und nun das Individuum auf die Probe stellt, wie lange es diese Steigerung der psychischen Spannung ertragen und welche Wege es einschlagen wird, sich ihrer zu entledigen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, sich bei anhaltender realer Versagung der Befriedigung gesund zu erhalten, erstens, indem man die psychische Spannung in tatkräftige Energie umsetzt, welche der Außenwelt zugewendet bleibt und endlich eine reale Befriedigung der Libido von ihr erzwingt, und zweitens, indem man auf die libidinöse Befriedigung verzichtet, die aufgestaute Libido sublimiert und zur Erreichung von Zielen verwendet, die nicht mehr erotische sind und der Versagung entgehen. Daß beide Möglichkeiten in den Schicksalen der Menschen zur Verwirklichung kommen, beweist uns, daß Unglück nicht mit Neurose zusammenfällt und daß die Versagung nicht allein über Gesundheit oder Erkrankung der Betroffenen entscheidet. Die Wirkung der Versagung liegt zunächst darin, daß sie die bis dahin unwirksamen dispositionellen Momente zur Geltung bringt.
Wo diese in genügend starker Ausbildung vorhanden sind, besteht die Gefahr, daß die Libido introvertiert werde [Fußnote]Nach einem von C. G. Jung eingeführten Terminus.. Sie wendet sich von der Realität ab, welche durch die hartnäckige Versagung an Wert für das Individuum verloren hat, wendet sich dem Phantasieleben zu, in welchem sie neue Wunschbildungen schafft und die Spuren früherer, vergessener Wunschbildungen wiederbelebt. Infolge des innigen Zusammenhanges der Phantasietätigkeit mit dem in jedem Individuum vorhandenen infantilen, verdrängten und unbewußt gewordenen Material und dank der Ausnahmsstellung gegen die Realitätsprüfung, die dem Phantasieleben eingeräumt ist [Fußnote]Vgl. meine ›Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens‹., kann die Libido nun weiter rückläufig werden, auf dem Wege der Regression infantile Bahnen auffinden und ihnen entsprechende Ziele anstreben. Wenn diese Strebungen, die mit dem aktuellen Zustand der Individualität unverträglich sind, genug Intensität erworben haben, muß es zum Konflikt zwischen ihnen und dem andern Anteil der Persönlichkeit kommen, welcher in Relation zur Realität geblieben ist. Dieser Konflikt wird durch Symptombildungen gelöst und geht in manifeste Erkrankung aus. Daß der ganze Prozeß von der realen Versagung ausgegangen ist, spiegelt sich in dem Ergebnis wider, daß die Symptome, mit denen der Boden der Realität wieder erreicht wird, Ersatzbefriedigungen darstellen.
b) Der zweite Typus der Erkrankungsveranlassung ist keineswegs so augenfällig wie der erste und konnte wirklich erst durch eindringende analytische Studien im Anschluß an die Komplexlehre der Züricher Schule aufgedeckt werden [Fußnote]Vgl. Jung (1909).. Das Individuum erkrankt hier nicht infolge einer Veränderung in der Außenwelt, welche an die Stelle der Befriedigung die Versagung gesetzt hat, sondern infolge einer inneren Bemühung, um sich die in der Realität zugängliche Befriedigung zu holen. Es erkrankt an dem Versuch, sich der Realität anzupassen und die Realforderung zu erfüllen, wobei es auf unüberwindliche innere Schwierigkeiten stößt.
Es empfiehlt sich, die beiden Erkrankungstypen scharf gegeneinander abzusetzen, schärfer, als es die Beobachtung zumeist gestattet. Beim ersten Typus drängt sich eine Veränderung in der Außenwelt vor, beim zweiten fällt der Akzent auf eine innere Veränderung. Nach dem ersten Typus erkrankt man an einem Erlebnis, nach dem zweiten an einem Entwicklungsvorgang. Im ersten Falle wird die Aufgabe gestellt, auf Befriedigung zu verzichten, und das Individuum erkrankt an seiner Widerstandsunfähigkeit; im zweiten Falle lautet die Aufgabe, eine Art der Befriedigung gegen eine andere zu vertauschen, und die Person scheitert an ihrer Starrheit. Im zweiten Falle ist der Konflikt zwischen dem Bestreben, so zu verharren, wie man ist, und dem anderen, sich nach neuen Absichten und neuen Realforderungen zu verändern, von vornherein gegeben; im früheren Falle stellt er sich erst her, nachdem die gestaute Libido andere, und zwar unverträgliche Befriedigungsmöglichkeiten erwählt hat. Die Rolle des Konflikts und der vorherigen Fixierung der Libido sind beim zweiten Typus ungleich augenfälliger als beim ersten, bei dem sich solche unbrauchbare Fixierungen eventuell erst infolge der äußeren Versagung herstellen mögen.
Ein junger Mann, der seine Libido bisher durch Phantasien mit Ausgang in Masturbation befriedigt hatte und nun dieses dem Autoerotismus nahestehende Regime mit der realen Objektwahl vertauschen will, ein Mädchen, das seine ganze Zärtlichkeit dem Vater oder Bruder geschenkt hatte und nun für einen um sie werbenden Mann die bisher unbewußten, inzestuösen, Libidowünsche bewußt werden lassen soll, eine Frau, die auf ihre polygamen Neigungen und Prostitutionsphantasien verzichten möchte, um ihrem Mann eine treue Gefährtin und ihrem Kind eine tadellose Mutter zu werden: diese alle erkranken an den lobenswertesten Bestrebungen, wenn die früheren Fixierungen ihrer Libido stark genug sind, um sich einer Verschiebung zu widersetzen, wofür wiederum die Faktoren der Disposition, konstitutionelle Anlage und infantiles Erleben, entscheidend werden. Sie erleben alle sozusagen das Schicksal des Bäumleins im Grimmschen Märchen, das andere Blätter hat gewollt; vom hygienischen Standpunkt, der hier freilich nicht allein in Betracht kommt, könnte man ihnen nur wünschen, daß sie weiterhin so unentwickelt, so minderwertig und nichtsnutzig geblieben wären, wie sie es vor ihrer Erkrankung waren. Die Veränderung, welche die Kranken anstreben, aber nur unvollkommen oder gar nicht zustande bringen, hat regelmäßig den Wert eines Fortschrittes im Sinne des realen Lebens. Anders, wenn man mit ethischem Maßstabe mißt; man sieht die Menschen ebensooft erkranken, wenn sie ein Ideal abstreifen, als wenn sie es erreichen wollen.
Ungeachtet der sehr deutlichen Verschiedenheiten der beiden beschriebenen Erkrankungstypen, treffen sie doch im wesentlichen zusammen und lassen sich unschwer zu einer Einheit zusammenfassen. Die Erkrankung an Versagung fällt auch unter den Gesichtspunkt der Unfähigkeit zur Anpassung an die Realität, nämlich an den einen Fall, daß die Realität die Befriedigung der Libido versagt. Die Erkrankung unter den Bedingungen des zweiten Typus führt ohne weiteres zu einem Sonderfall der Versagung. Es ist hiebei zwar nicht jede Art der Befriedigung von der Realität versagt, wohl aber gerade die eine, welche das Individuum für die ihm einzig mögliche erklärt, und die Versagung geht nicht direkt von der Außenwelt, sondern primär von gewissen Strebungen des Ichs aus, aber die Versagung bleibt das Gemeinsame und Übergeordnete. Infolge des Konflikts, der beim zweiten Typus sofort einsetzt, werden beide Arten der Befriedigung, die gewohnte wie die angestrebte, gleichmäßig gehemmt; es kommt zur Libidostauung mit den von ihr ablaufenden Folgen wie im ersten Falle. Die psychischen Vorgänge auf dem Wege zur Symptombildung sind beim zweiten Typus eher übersichtlicher als beim ersten, da die pathogenen Fixierungen der Libido hier nicht erst herzustellen waren, sondern während der Gesundheit in Kraft bestanden hatten. Ein gewisses Maß von Introversion der Libido war meist schon vorhanden; ein Stück der Regression zum Infantilen wird dadurch erspart, daß die Entwicklung noch nicht den ganzen Weg zurückgelegt hatte.
c) Wie eine Übertreibung des zweiten Typus, der Erkrankung an der Realforderung, erscheint der nächste Typus, den ich als Erkrankung durch Entwicklungshemmung beschreiben will. Ein theoretischer Anspruch, ihn abzusondern, läge nicht vor, wohl aber ein praktischer, da es sich um Personen handelt, die erkranken, sobald sie das unverantwortliche Kindesalter überschreiten, und somit niemals eine Phase von Gesundheit, das heißt von im ganzen uneingeschränkter Leistungs- und Genußfähigkeit erreicht haben. Das Wesentliche des disponierenden Prozesses liegt in diesen Fällen klar zutage. Die Libido hat die infantilen Fixierungen niemals verlassen, die Realforderung tritt nicht plötzlich einmal an das ganz oder zum Teil gereifte Individuum heran, sondern wird durch den Tatbestand des Älterwerdens selbst gegeben, indem sie sich selbstverständlicherweise mit dem Alter des Individuums kontinuierlich ändert. Der Konflikt tritt gegen die Unzulänglichkeit zurück, doch müssen wir nach allen unseren sonstigen Einsichten ein Bestreben, die Kindheitsfixierungen zu überwinden, auch hier statuieren, sonst könnte niemals Neurose, sondern nur stationärer Infantilismus der Ausgang des Prozesses sein.
d) Wie der dritte Typus uns die disponierende Bedingung fast isoliert vorgeführt hatte, so macht uns der nun folgende vierte auf ein anderes Moment aufmerksam, dessen Wirksamkeit in allen Fällen in Betracht kommt und gerade darum leicht in einer theoretischen Erörterung übersehen werden könnte. Wir sehen nämlich Individuen erkranken, die bisher gesund gewesen waren, an die kein neues Erlebnis herangetreten ist, deren Relation zur Außenwelt keine Änderung erfahren hat, so daß ihre Erkrankung den Eindruck des Spontanen machen muß. Nähere Betrachtung solcher Fälle zeigt uns indes, daß sich in ihnen doch eine Veränderung vollzogen hat, die wir als höchst bedeutsam für die Krankheitsverursachung einschätzen müssen. Infolge des Erreichens eines gewissen Lebensabschnittes und im Anschlüsse an gesetzmäßige biologische Vorgänge hat die Quantität der Libido in ihrem seelischen Haushalt eine Steigerung erfahren, welche für sich allein hinreicht, das Gleichgewicht der Gesundheit umzuwerfen und die Bedingungen der Neurose herzustellen. Wie bekannt, sind solche eher plötzliche Libidosteigerungen mit der Pubertät und der Menopause, mit dem Erreichen gewisser Jahreszahlen bei Frauen, regelmäßig verbunden; bei manchen Menschen mögen sie sich überdies in noch unbekannten Periodizitäten äußern. Die Libidostauung ist hier das primäre Moment, sie wird pathogen infolge der relativen Versagung von Seiten der Außenwelt, die einem geringeren Libidoanspruch die Befriedigung noch gestattet hätte. Die unbefriedigte und gestaute Libido kann wieder die Wege zur Regression eröffnen und dieselben Konflikte anfachen, die wir für den Fall der absoluten äußeren Versagung festgestellt haben. Wir werden auf solche Weise daran gemahnt, daß wir das quantitative Moment bei keiner Überlegung über Krankheitsveranlassung außer acht lassen dürfen. Alle anderen Faktoren, die Versagung, Fixierung, Entwicklungshemmung, bleiben wirkungslos, insofern sie nicht ein gewisses Maß der Libido betreffen und eine Libidostauung von bestimmter Höhe hervorrufen. Dieses Maß von Libido, das uns für eine pathogene Wirkung unentbehrlich dünkt, ist für uns freilich nicht meßbar; wir können es nur postulieren, nachdem der Krankheitserfolg eingetreten ist. Nur nach einer Richtung dürfen wir es enger bestimmen; wir dürfen annehmen, daß es sich nicht um eine absolute Quantität handelt, sondern um das Verhältnis des wirksamen Libidobetrages zu jener Quantität von Libido, welche das einzelne Ich bewältigen, das heißt in Spannung erhalten, sublimieren oder direkt verwenden kann. Daher wird eine relative Steigerung der Libidoquantität dieselben Wirkungen haben können wie eine absolute. Eine Schwächung des Ichs durch organische Krankheit oder durch besondere Inanspruchnahme seiner Energie wird imstande sein, Neurosen zum Vorschein kommen zu lassen, die sonst trotz aller Disposition latent geblieben wären.
Die Bedeutung, welche wir der Libidoquantität für die Krankheitsverursachung zugestehen müssen, stimmt in wünschenswerter Weise zu zwei Hauptsätzen der Neurosenlehre, die sich aus der Psychoanalyse ergeben haben. Erstens zu dem Satze, daß die Neurosen aus dem Konflikt zwischen dem Ich und der Libido entspringen, zweitens zu der Einsicht, daß keine qualitative Verschiedenheit zwischen den Bedingungen der Gesundheit und denen der Neurose bestehe, daß die Gesunden vielmehr mit denselben Aufgaben der Bewältigung der Libido zu kämpfen haben, nur daß es ihnen besser gelungen ist.
Es erübrigt noch, einige Worte über das Verhältnis dieser Typen zur Erfahrung zu sagen. Wenn ich die Anzahl von Kranken überblicke, mit deren Analyse ich gerade jetzt beschäftigt bin, so muß ich feststellen, daß keiner von ihnen einen der vier Erkrankungstypen rein realisiert. Ich finde vielmehr bei jedem ein Stück der Versagung wirksam neben einem Anteil von Unfähigkeit, sich der Realforderung anzupassen; der Gesichtspunkt der Entwicklungshemmung, die ja mit der Starrheit der Fixierungen zusammenfällt, kommt bei allen in Betracht, und die Bedeutung der Libidoquantität dürfen wir, wie oben ausgeführt, niemals vernachlässigen. Ja, ich erfahre, daß bei mehreren unter diesen Kranken die Krankheit in Schüben zum Vorschein gekommen ist, zwischen welchen Intervalle von Gesundheit lagen, und daß jeder dieser Schübe sich auf einen anderen Typus von Veranlassung zurückführen läßt. Die Aufstellung dieser vier Typen hat also keinen hohen theoretischen Wert; es sind bloß verschiedene Wege zur Herstellung einer gewissen pathogenen Konstellation im seelischen Haushalt, nämlich der Libidostauung, welcher sich das Ich mit seinen Mitteln nicht ohne Schaden erwehren kann. Die Situation selbst wird aber nur pathogen infolge eines quantitativen Momentes; sie ist nicht etwa eine Neuheit für das Seelenleben und durch das Eindringen einer sogenannten »Krankheitsursache« geschaffen.
Eine gewisse praktische Bedeutung werden wir den Erkrankungstypen gerne zugestehen. Sie sind in einzelnen Fällen auch rein zu beobachten; auf den dritten und vierten Typus wären wir nicht aufmerksam geworden, wenn sie nicht die einzigen Veranlassungen der Erkrankung für manche Individuen enthielten. Der erste Typus hält uns den außerordentlich mächtigen Einfluß der Außenwelt vor Augen, der zweite den nicht minder bedeutsamen der Eigenart des Individuums, welche sich diesem Einflüsse widersetzt. Die Pathologie konnte dem Problem der Krankheitsveranlassung bei den Neurosen nicht gerecht werden, solange sie sich bloß um die Entscheidung bemühte, ob diese Affektionen endogener oder exogener Natur seien. Allen Erfahrungen, welche auf die Bedeutung der Abstinenz (im weitesten Sinne) als Veranlassung hinweisen, mußte sie immer den Einwand entgegensetzen, andere Personen vertrügen dieselben Schicksale, ohne zu erkranken. Wollte sie aber die Eigenart des Individuums als das für Krankheit und Gesundheit Wesentliche betonen, so mußte sie sich die Vorhaltung gefallen lassen, daß Personen mit solcher Eigenart die längste Zeit über gesund bleiben können, solange ihnen nur gestattet ist, diese Eigenart zu bewahren. Die Psychoanalyse hat uns gemahnt, den unfruchtbaren Gegensatz von äußeren und inneren Momenten, von Schicksal und Konstitution, aufzugeben, und hat uns gelehrt, die Verursachung der neurotischen Erkrankung regelmäßig in einer bestimmten psychischen Situation zu finden, welche auf verschiedenen Wegen hergestellt werden kann.
Über Psychotherapie (1905)
Meine Herren! Es sind ungefähr acht Jahre her, seitdem ich über Aufforderung Ihres betrauerten Vorsitzenden Professor von Reder in Ihrem Kreise über das Thema der Hysterie sprechen durfte. Ich hatte kurz zuvor (1895) in Gemeinschaft mit Doktor Josef Breuer die Studien über Hysterie veröffentlicht und den Versuch unternommen, auf Grund der neuen Erkenntnis, welche wir diesem Forscher verdanken, eine neuartige Behandlungsweise der Neurose einzuführen. Erfreulicherweise darf ich sagen, haben die Bemühungen unserer Studien Erfolg gehabt; die in ihnen vertretenen Ideen von der Wirkungsweise psychischer Traumen durch Zurückhaltung von Affekt und die Auffassung der hysterischen Symptome als Erfolge einer aus dem Seelischen ins Körperliche versetzten Erregung, Ideen, für welche wir die Termini »Abreagieren« und »Konversion« geschaffen hatten, sind heute allgemein bekannt und verstanden. Es gibt – wenigstens in deutschen Landen – keine Darstellung der Hysterie, die ihnen nicht bis zu einem gewissen Grade Rechnung tragen würde, und keinen Fachgenossen, der nicht zum mindesten ein Stück weit mit dieser Lehre ginge. Und doch mögen diese Sätze und diese Termini, solange sie noch frisch waren, befremdend genug geklungen haben!
Ich kann nicht dasselbe von dem therapeutischen Verfahren sagen, das gleichzeitig mit unserer Lehre den Fachgenossen vorgeschlagen wurde. Dasselbe kämpft noch heute um seine Anerkennung. Man mag spezielle Gründe dafür anrufen. Die Technik des Verfahrens war damals noch unausgebildet; ich vermochte es nicht, dem ärztlichen Leser des Buches jene Anweisungen zu geben, welche ihn befähigt hätten, eine derartige Behandlung vollständig durchzuführen. Aber gewiß wirken auch Gründe allgemeiner Natur mit. Vielen Ärzten erscheint noch heute die Psychotherapie als ein Produkt des modernen Mystizismus und im Vergleiche mit unseren physikalisch-chemischen Heilmitteln, deren Anwendung auf physiologische Einsichten gegründet ist, als geradezu unwissenschaftlich, des Interesses eines Naturforschers unwürdig. Gestatten Sie mir nun, vor Ihnen die Sache der Psychotherapie zu führen und hervorzuheben, was an dieser Verurteilung als unrecht oder Irrtum bezeichnet werden kann.
Lassen Sie mich also fürs erste daran mahnen, daß die Psychotherapie kein modernes Heilverfahren ist. Im Gegenteil, sie ist die älteste Therapie, deren sich die Medizin bedient hat. In dem lehrreichen Werke von Löwenfeld ( Lehrbuch der gesamten Psychotherapie) können Sie nachlesen, welche die Methoden der primitiven und der antiken Medizin waren. Sie werden dieselben zum größten Teil der Psychotherapie zuordnen müssen; man versetzte die Kranken zum Zwecke der Heilung in den Zustand der »gläubigen Erwartung«, der uns heute noch das nämliche leistet. Auch nachdem die Ärzte andere Heilmittel aufgefunden haben, sind psychotherapeutische Bestrebungen der einen oder der anderen Art in der Medizin niemals untergegangen.
Fürs zweite mache ich Sie darauf aufmerksam, daß wir Ärzte auf die Psychotherapie schon darum nicht verzichten können, weil eine andere, beim Heilungsvorgang sehr in Betracht kommende Partei – nämlich die Kranken – nicht die Absicht hat, auf sie zu verzichten. Sie wissen, welche Aufklärungen wir hierüber der Schule von Nancy (Liébeault, Bernheim) verdanken. Ein von der psychischen Disposition der Kranken abhängiger Faktor tritt, ohne daß wir es beabsichtigen, zur Wirkung eines jeden vom Arzte eingeleiteten Heilverfahrens hinzu, meist im begünstigenden, oft auch im hemmenden Sinne. Wir haben für diese Tatsache das Wort »Suggestion« anzuwenden gelernt, und Moebius hat uns gelehrt, daß die Unverläßlichkeit, die wir an so manchen unserer Heilmethoden beklagen, gerade auf die störende Einwirkung dieses übermächtigen Moments zurückzuführen ist. Wir Ärzte, Sie alle, treiben also beständig Psychotherapie, auch wo Sie es nicht wissen und nicht beabsichtigen; nur hat es einen Nachteil, daß Sie den psychischen Faktor in Ihrer Einwirkung auf den Kranken so ganz dem Kranken überlassen. Er wird auf diese Weise unkontrollierbar, undosierbar, der Steigerung unfähig. Ist es dann nicht ein berechtigtes Streben des Arztes, sich dieses Faktors zu bemächtigen, sich seiner mit Absicht zu bedienen, ihn zu lenken und zu verstärken? Nichts anderes als dies ist es, was die wissenschaftliche Psychotherapie Ihnen zumutet.
Zu dritt, meine Herren Kollegen, will ich Sie auf die altbekannte Erfahrung verweisen, daß gewisse Leiden, und ganz besonders die Psychoneurosen, seelischen Einflüssen weit zugänglicher sind als jeder anderen Medikation. Es ist keine moderne Rede, sondern ein Ausspruch alter Ärzte, daß diese Krankheiten nicht das Medikament heilt, sondern der Arzt, das heißt wohl die Persönlichkeit des Arztes, insofern er psychischen Einfluß durch sie ausübt. Ich weiß wohl, meine Herren Kollegen, daß bei Ihnen jene Anschauung sehr beliebt ist, welcher der Ästhetiker Vischer in seiner Faustparodie klassischen Ausdruck geliehen hat:
»Ich weiß, das Physikalische Wirkt öfters aufs Moralische.« [Fußnote]F. T. Vischer, Faust: der Tragödie III. Teil.
Aber sollte es nicht adäquater sein und häufiger zutreffen, daß man aufs Moralische eines Menschen mit moralischen, das heißt psychischen Mitteln einwirken kann?
Es gibt viele Arten und Wege der Psychotherapie. Alle sind gut, die zum Ziel der Heilung führen. Unsere gewöhnliche Tröstung: Es wird schon wieder gut werden!, mit der wir den Kranken gegenüber so freigebig sind, entspricht einer der psychotherapeutischen Methoden; nur sind wir bei tieferer Einsicht in das Wesen der Neurosen nicht genötigt gewesen, uns auf die Tröstung einzuschränken. Wir haben die Technik der hypnotischen Suggestion, der Psychotherapie durch Ablenkung, durch Übung, durch Hervorrufung zweckdienlicher Affekte entwickelt. Ich verachte keine derselben und würde sie alle unter geeigneten Bedingungen ausüben. Wenn ich mich in Wirklichkeit auf ein einziges Heilverfahren beschränkt habe, auf die von Breuer » kathartisch« genannte Methode, die ich lieber die » analytische« heiße, so sind bloß subjektive Motive für mich maßgebend gewesen. Infolge meines Anteiles an der Aufstellung dieser Therapie fühle ich die persönliche Verpflichtung, mich ihrer Erforschung und dem Ausbau ihrer Technik zu widmen. Ich darf behaupten, die analytische Methode der Psychotherapie ist diejenige, welche am eindringlichsten wirkt, am weitesten trägt, durch welche man die ausgiebigste Veränderung des Kranken erzielt. Wenn ich für einen Moment den therapeutischen Standpunkt verlasse, kann ich für sie geltend machen, daß sie die interessanteste ist, uns allein etwas über die Entstehung und den Zusammenhang der Krankheitserscheinungen lehrt. Infolge der Einsichten in den Mechanismus des seelischen Krankseins, die sie uns eröffnet, könnte sie allein imstande sein, über sich selbst hinauszuführen und uns den Weg zu noch anderen Arten therapeutischer Beeinflussung zu weisen.
In bezug auf diese kathartische oder analytische Methode der Psychotherapie gestatten Sie mir nun, einige Irrtümer zu verbessern und einige Aufklärungen zu geben.
(a) Ich merke, daß diese Methode sehr häufig mit der hypnotischen Suggestivbehandlung verwechselt wird, merke es daran, daß verhältnismäßig häufig auch Kollegen, deren Vertrauensmann ich sonst nicht bin, Kranke zu mir schicken, refraktäre Kranke natürlich, mit dem Auftrage, ich solle sie hypnotisieren. Nun habe ich seit etwa acht Jahren keine Hypnose mehr zu Zwecken der Therapie ausgeübt (vereinzelte Versuche ausgenommen) und pflege solche Sendungen mit dem Rate, wer auf die Hypnose baut, möge sie selbst machen, zu retournieren. In Wahrheit besteht zwischen der suggestiven Technik und der analytischen der größtmögliche Gegensatz, jener Gegensatz, den der große Leonardo da Vinci für die Künste in die Formeln per via di porre und per via di levare gefaßt hat. Die Malerei, sagt Leonardo, arbeitet per via di porre; sie setzt nämlich Farbenhäufchen hin, wo sie früher nicht waren, auf die nichtfarbige Leinwand; die Skulptur dagegen geht per via di levare vor, sie nimmt nämlich vom Stein so viel weg, als die Oberfläche der in ihm enthaltenen Statue noch bedeckt. Ganz ähnlich, meine Herren, sucht die Suggestivtechnik per via di porre zu wirken, sie kümmert sich nicht um Herkunft, Kraft und Bedeutung der Krankheitssymptome, sondern legt etwas auf, die Suggestion nämlich, wovon sie erwartet, daß es stark genug sein wird, die pathogene Idee an der Äußerung zu hindern. Die analytische Therapie dagegen will nicht auflegen, nichts Neues einführen, sondern wegnehmen, herausschaffen, und zu diesem Zwecke bekümmert sie sich um die Genese der krankhaften Symptome und den psychischen Zusammenhang der pathogenen Idee, deren Wegschaffung ihr Ziel ist. Auf diesem Wege der Forschung hat sie unserem Verständnis sehr bedeutende Förderung gebracht. Ich habe die Suggestionstechnik und mit ihr die Hypnose so frühzeitig aufgegeben, weil ich daran verzweifelte, die Suggestion so stark und so haltbar zu machen, wie es für die dauernde Heilung notwendig wäre. In allen schweren Fällen sah ich die daraufgelegte Suggestion wieder abbröckeln, und dann war das Kranksein oder ein dasselbe Ersetzendes wieder da. Außerdem mache ich dieser Technik den Vorwurf, daß sie uns die Einsicht in das psychische Kräftespiel verhüllt, z. B. uns den Widerstand nicht erkennen läßt, mit dem die Kranken an ihrer Krankheit festhalten, mit dem sie sich also auch gegen die Genesung sträuben und der doch allein das Verständnis ihres Benehmens im Leben ermöglicht.
(b) Es scheint mir der Irrtum unter den Kollegen weit verbreitet zu sein, daß die Technik der Forschung nach den Krankheitsanlässen und die Beseitigung der Erscheinungen durch diese Erforschung leicht und selbstverständlich sei. Ich schließe dies daraus, daß noch keiner von den vielen, die sich für meine Therapie interessieren und sichere Urteile über dieselbe von sich geben, mich je gefragt hat, wie ich es eigentlich mache. Das kann doch nur den einzigen Grund haben, daß sie meinen, es sei nichts zu fragen, es verstehe sich ganz von selbst. Auch höre ich mitunter mit Erstaunen, daß auf dieser oder jener Abteilung eines Spitals ein junger Arzt von seinem Chef den Auftrag erhalten hat, bei einer Hysterischen eine »Psychoanalyse« zu unternehmen. Ich bin überzeugt, man würde ihm nicht einen exstirpierten Tumor zur Untersuchung überlassen, ohne sich vorher versichert zu haben, daß er mit der histologischen Technik vertraut ist. Ebenso erreicht mich die Nachricht, dieser oder jener Kollege richte sich Sprechstunden mit einem Patienten ein, um eine psychische Kur mit ihm zu machen, während ich sicher bin, daß er die Technik einer solchen Kur nicht kennt. Er muß also erwarten, daß ihm der Kranke seine Geheimnisse entgegenbringen wird, oder sucht das Heil in irgendeiner Art von Beichte oder Anvertrauen. Es würde mich nicht wundern, wenn der so behandelte Kranke dabei eher zu Schaden als zum Vorteil käme. Das seelische Instrument ist nämlich nicht gar leicht zu spielen. Ich muß bei solchen Anlässen an die Rede eines weltberühmten Neurotikers denken, der freilich nie in der Behandlung eines Arztes gestanden, der nur in der Phantasie eines Dichters gelebt hat. Ich meine den Prinzen Hamlet von Dänemark. Der König hat die beiden Höflinge Rosenkranz und Güldenstern über ihn geschickt, um ihn auszuforschen, ihm das Geheimnis seiner Verstimmung zu entreißen. Er wehrt sie ab; da werden Flöten auf die Bühne gebracht. Hamlet nimmt eine Flöte und bittet den einen seiner Quäler, auf ihr zu spielen, es sei so leicht wie lügen. Der Höfling weigert sich, denn er kennt keinen Griff, und da er zu dem Versuch des Flötenspiels nicht zu bewegen ist, bricht Hamlet endlich los: »Nun seht ihr, welch ein nichtswürdiges Ding ihr aus mir macht? Ihr wollt auf mir spielen; ihr wollt in das Herz meines Geheimnisses dringen; ihr wollt mich von meiner tiefsten Note bis zum Gipfel meiner Stimme hinauf prüfen, und in diesem kleinen Instrument hier ist viel Musik, eine vortreffliche Stimme, dennoch könnt ihr es nicht zum Sprechen bringen. Wetter, denkt ihr, daß ich leichter zu spielen bin als eine Flöte? Nennt mich was für ein Instrument ihr wollt, ihr könnt mich zwar verstimmen, aber nicht auf mir spielen.« (III. Akt, 2.)
(c) Sie werden aus gewissen meiner Bemerkungen erraten haben, daß der analytischen Kur manche Eigenschaften anhaften, die sie von dem Ideal einer Therapie fernehalten. Tuto, cito, iucunde; das Forschen und Suchen deutet nicht eben auf Raschheit des Erfolges, und die Erwähnung des Widerstandes bereitet Sie auf die Erwartung von Unannehmlichkeiten vor. Gewiß, die psychoanalytische Behandlung stellt an den Kranken wie an den Arzt hohe Ansprüche; von ersterem verlangt sie das Opfer voller Aufrichtigkeit, gestaltet sich für ihn zeitraubend und daher auch kostspielig; für den Arzt ist sie gleichfalls zeitraubend und wegen der Technik, die er zu erlernen und auszuüben hat, ziemlich mühselig. Ich finde es auch selbst ganz berechtigt, daß man bequemere Heilmethoden in Anwendung bringt, solange man eben die Aussicht hat, mit diesen letzteren etwas zu erreichen. Auf diesen Punkt kommt es allein an; erzielt man mit dem mühevolleren und langwierigeren Verfahren erheblich mehr als mit dem kurzen und leichten, so ist das erstere trotz alledem gerechtfertigt. Denken Sie, meine Herren, um wieviel die Finsentherapie des Lupus unbequemer und kostspieliger ist als das früher gebräuchliche Ätzen und Schaben, und doch bedeutet es einen großen Fortschritt, bloß weil es mehr leistet; es heilt nämlich den Lupus radikal. Nun will ich den Vergleich nicht gerade durchsetzen; aber ein ähnliches Vorrecht darf doch die psychoanalytische Methode für sich in Anspruch nehmen. In Wirklichkeit habe ich meine therapeutische Methode nur an schweren und schwersten Fällen ausarbeiten und versuchen können; mein Material waren zuerst nur Kranke, die alles erfolglos versucht und durch Jahre in Anstalten geweilt hatten. Ich habe kaum Erfahrung genug gesammelt, um Ihnen sagen zu können, wie sich meine Therapie bei jenen leichteren, episodisch auftretenden Erkrankungen verhält, die wir unter den verschiedenartigsten Einflüssen und auch spontan abheilen sehen. Die psychoanalytische Therapie ist an dauernd existenzunfähigen Kranken und für solche geschaffen worden, und ihr Triumph ist es, daß sie eine befriedigende Anzahl von solchen dauernd existenzfähig macht. Gegen diesen Erfolg erscheint dann aller Aufwand geringfügig. Wir können uns nicht verhehlen, daß wir vor dem Kranken zu verleugnen pflegen, daß eine schwere Neurose in ihrer Bedeutung für das ihr unterworfene Individuum hinter keiner Kachexie, keinem der gefürchteten Allgemeinleiden zurücksteht.
(d) Die Indikationen und Gegenanzeigen dieser Behandlung sind infolge der vielen praktischen Beschränkungen, die meine Tätigkeit betroffen haben, kaum endgültig anzugeben. Indes will ich versuchen, einige Punkte mit Ihnen zu erörtern:
(1) Man übersehe nicht über die Krankheit den sonstigen Wert einer Person und weise Kranke zurück, welche nicht einen gewissen Bildungsgrad und einen einigermaßen verläßlichen Charakter besitzen. Man darf nicht vergessen, daß es auch Gesunde gibt, die nichts taugen, und daß man nur allzu leicht geneigt ist, bei solchen minderwertigen Personen alles, was sie existenzunfähig macht, auf die Krankheit zu schieben, wenn sie irgendeinen Anflug von Neurose zeigen. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß die Neurose ihren Träger keineswegs zum dégéneré stempelt, daß sie sich aber häufig genug mit den Erscheinungen der Degeneration vergesellschaftet an demselben Individuum findet. Die analytische Psychotherapie ist nun kein Verfahren zur Behandlung der neuropathischen Degeneration, sie findet im Gegenteil an derselben ihre Schranke. Sie ist auch bei Personen nicht anwendbar, die sich nicht selbst durch ihre Leiden zur Therapie gedrängt fühlen, sondern sich einer solchen nur infolge des Machtgebotes ihrer Angehörigen unterziehen. Die Eigenschaft, auf die es für die Brauchbarkeit zur psychoanalytischen Behandlung ankommt, die Erziehbarkeit, werden wir noch von einem anderen Gesichtspunkte würdigen müssen.
(2) Wenn man sichergehen will, beschränke man seine Auswahl auf Personen, die einen Normalzustand haben, da man sich im psychoanalytischen Verfahren von diesem aus des Krankhaften bemächtigt. Psychosen, Zustände von Verworrenheit und tiefgreifender (ich möchte sagen: toxischer) Verstimmung sind also für die Psychoanalyse, wenigstens wie sie bis jetzt ausgeübt wird, ungeeignet. Ich halte es für durchaus nicht ausgeschlossen, daß man bei geeigneter Abänderung des Verfahrens sich über diese Gegenindikation hinaussetzen und so eine Psychotherapie der Psychosen in Angriff nehmen könne.
(3) Das Alter der Kranken spielt bei der Auswahl zur psychoanalytischen Behandlung insofern eine Rolle, als bei Personen nahe an oder über fünfzig Jahre einerseits die Plastizität der seelischen Vorgänge zu fehlen pflegt, auf welche die Therapie rechnet – alte Leute sind nicht mehr erziehbar –, und als anderseits das Material, welches durchzuarbeiten ist, die Behandlungsdauer ins Unabsehbare verlängert. Die Altersgrenze nach unten ist nur individuell zu bestimmen; jugendliche Personen noch vor der Pubertät sind oft ausgezeichnet zu beeinflussen.
(4) Man wird nicht zur Psychoanalyse greifen, wenn es sich um die rasche Beseitigung drohender Erscheinungen handelt, also zum Beispiel bei einer hysterischen Anorexie.
Sie werden nun den Eindruck gewonnen haben, daß das Anwendungsgebiet der analytischen Psychotherapie ein sehr beschränktes ist, da Sie eigentlich nichts anderes als Gegenanzeigen von mir gehört haben. Nichtsdestoweniger bleiben Fälle und Krankheitsformen genug übrig, an denen diese Therapie sich erproben kann, alle chronischen Formen von Hysterie mit Resterscheinungen, das große Gebiet der Zwangszustände und Abulien und dergleichen.
Erfreulich ist es, daß man gerade den wertvollsten und sonst höchstentwickelten Personen auf solche Weise am ehesten Hilfe bringen kann. Wo aber mit der analytischen Psychotherapie nur wenig auszurichten war, da, darf man getrost behaupten, hätte irgendwelche andere Behandlung sicherlich gar nichts zustande gebracht.
(e) Sie werden mich gewiß fragen wollen, wie es bei Anwendung der Psychoanalyse mit der Möglichkeit, Schaden zu stiften, bestellt ist. Ich kann Ihnen darauf erwidern, wenn Sie nur billig urteilen wollen, diesem Verfahren dasselbe kritische Wohlwollen entgegenbringen, das Sie für unsere anderen therapeutischen Methoden bereit haben, so werden Sie meiner Meinung zustimmen müssen, daß bei einer mit Verständnis geleiteten analytischen Kur ein Schaden für den Kranken nicht zu befürchten ist. Anders wird vielleicht urteilen, wer als Laie gewohnt ist, alles, was sich in einem Krankheitsfalle begibt, der Behandlung zur Last zu legen. Es ist ja nicht lange her, daß unseren Wasserheilanstalten ein ähnliches Vorurteil entgegenstand. So mancher, dem man riet, eine solche Anstalt aufzusuchen, wurde bedenklich, weil er einen Bekannten gehabt hatte, der als Nervöser in die Anstalt kam und dort verrückt wurde. Es handelte sich, wie Sie erraten, um Fälle von beginnender allgemeiner Paralyse, die man im Anfangsstadium noch in einer Wasserheilanstalt unterbringen konnte und die dort ihren unaufhaltsamen Verlauf bis zur manifesten Geistesstörung genommen hatten; für die Laien war das Wasser schuld und Urheber dieser traurigen Veränderung. Wo es sich um neuartige Beeinflussungen handelt, halten sich auch Ärzte nicht immer von solchen Urteilsfehlern frei. Ich erinnere mich, einmal bei einer Frau den Versuch mit Psychotherapie gemacht zu haben, bei der ein gutes Stück ihrer Existenz in der Abwechslung von Manie und Melancholie verflossen war. Ich übernahm sie zu Ende einer Melancholie; es schien zwei Wochen lang gut zu gehen; in der dritten standen wir bereits zu Beginn der neuen Manie. Es war dies sicherlich eine spontane Veränderung des Krankheitsbildes, denn zwei Wochen sind keine Zeit, in welcher die analytische Psychotherapie irgend etwas zu leisten unternehmen kann, aber der hervorragende – jetzt schon verstorbene – Arzt, der mit mir die Kranke zu sehen bekam, konnte sich doch nicht der Bemerkung enthalten, daß an dieser »Verschlechterung« die Psychotherapie schuld sein dürfte. Ich bin ganz überzeugt, daß er sich unter anderen Bedingungen kritischer erwiesen hätte.
(f) Zum Schlusse, meine Herren Kollegen, muß ich mir sagen, es geht doch nicht an, Ihre Aufmerksamkeit so lange zugunsten der analytischen Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, ohne Ihnen zu sagen, worin diese Behandlung besteht und worauf sie sich gründet. Ich kann es zwar, da ich kurz sein muß, nur mit einer Andeutung tun. Diese Therapie ist also auf die Einsicht gegründet, daß unbewußte Vorstellungen – besser: die Unbewußtheit gewisser seelischer Vorgänge – die nächste Ursache der krankhaften Symptome ist. Eine solche Überzeugung vertreten wir gemeinsam mit der französischen Schule (Janet), die übrigens in arger Schematisierung das hysterische Symptom auf die unbewußte idée fixe zurückführt. Fürchten Sie nun nicht, daß wir dabei zu tief in die dunkelste Philosophie hineingeraten werden. Unser Unbewußtes ist nicht ganz dasselbe wie das der Philosophen, und überdies wollen die meisten Philosophen vom »unbewußten Psychischen« nichts wissen. Stellen Sie sich aber auf unseren Standpunkt, so werden Sie einsehen, daß die Übersetzung dieses Unbewußten im Seelenleben der Kranken in ein Bewußtes den Erfolg haben muß, deren Abweichung vom Normalen zu korrigieren und den Zwang aufzuheben, unter dem ihr Seelenleben steht. Denn der bewußte Wille reicht soweit als die bewußten psychischen Vorgänge, und jeder psychische Zwang ist durch das Unbewußte begründet. Sie brauchen auch niemals zu fürchten, daß der Kranke unter der Erschütterung Schaden nehme, welche der Eintritt des Unbewußten in sein Bewußtsein mit sich bringt, denn Sie können es sich theoretisch zurechtlegen, daß die somatische und affektive Wirkung der bewußt gewordenen Regung niemals so groß werden kann wie die der unbewußten. Wir beherrschen alle unsere Regungen doch nur dadurch, daß wir unsere höchsten, mit Bewußtsein verbundenen Seelenleistungen auf sie wenden.
Sie können aber auch einen anderen Gesichtspunkt für das Verständnis der psychoanalytischen Behandlung wählen. Die Aufdeckung und Übersetzung des Unbewußten geht unter beständigem Widerstand von Seiten des Kranken vor sich. Das Auftauchen dieses Unbewußten ist mit Unlust verbunden, und wegen dieser Unlust wird es von ihm immer wieder zurückgewiesen. In diesen Konflikt im Seelenleben des Kranken greifen Sie nun ein; gelingt es Ihnen, den Kranken dazu zu bringen, daß er aus Motiven besserer Einsicht etwas akzeptiert, was er zufolge der automatischen Unlustregulierung bisher zurückgewiesen (verdrängt) hat, so haben Sie ein Stück Erziehungsarbeit an ihm geleistet. Es ist ja schon Erziehung, wenn Sie einen Menschen, der nicht gern frühmorgens das Bett verläßt, dazu bewegen, es doch zu tun. Als eine solche Nacherziehung zur Überwindung innerer Widerstände können Sie nun die psychoanalytische Behandlung ganz allgemein auffassen. In keinem Punkte aber ist solche Nacherziehung bei den Nervösen mehr vonnöten als betreffs des seelischen Elements in ihrem Sexualleben. Nirgends haben ja Kultur und Erziehung so großen Schaden gestiftet wie gerade hier, und hier sind auch, wie Ihnen die Erfahrung zeigen wird, die beherrschbaren Ätiologien der Neurosen zu finden; das andere ätiologische Element, der konstitutionelle Beitrag, ist uns ja als etwas Unabänderliches gegeben. Hieraus erwächst aber eine wichtige an den Arzt zu stellende Anforderung. Er muß nicht nur selbst ein integrer Charakter sein – »das Moralische versteht sich ja von selbst«, wie die Hauptperson in Th. Vischers Auch Einer zu sagen pflegt –; er muß auch für seine eigene Person die Mischung von Lüsternheit und Prüderie überwunden haben, mit welcher leider so viele andere den sexuellen Problemen entgegenzutreten gewohnt sind.
Hier ist vielleicht der Platz für eine weitere Bemerkung. Ich weiß, daß meine Betonung der Rolle des Sexuellen für die Entstehung der Psychoneurosen in weiteren Kreisen bekanntgeworden ist. Ich weiß aber auch, daß Einschränkungen und nähere Bestimmungen beim großen Publikum wenig nützen; die Menge hat für wenig Raum in ihrem Gedächtnis und behält von einer Behauptung doch nur den rohen Kern, schafft sich ein leicht zu merkendes Extrem. Es mag auch manchen Ärzten so ergangen sein, daß ihnen als Inhalt meiner Lehre vorschwebt, ich führe die Neurosen in letzter Linie auf sexuelle Entbehrung zurück. An dieser fehlt es nicht unter den Lebensbedingungen unserer Gesellschaft. Wie nahe mag es nun bei solcher Voraussetzung liegen, den mühseligen Umweg über die psychische Kur zu vermeiden und direkt die Heilung anzustreben, indem man die sexuelle Betätigung als Heilmittel empfiehlt! Ich weiß nun nicht, was mich bewegen könnte, diese Folgerung zu unterdrücken, wenn sie berechtigt wäre. Die Sache liegt aber anders. Die sexuelle Bedürftigkeit und Entbehrung, das ist bloß der eine Faktor, der beim Mechanismus der Neurose ins Spiel tritt; bestünde er allein, so würde nicht Krankheit, sondern Ausschweifung die Folge sein. Der andere, ebenso unerläßliche Faktor, an den man allzu bereitwillig vergißt, ist die Sexualabneigung der Neurotiker, ihre Unfähigkeit zum Lieben, jener psychische Zug, den ich »Verdrängung« genannt habe. Erst aus dem Konflikt zwischen beiden Strebungen geht die neurotische Erkrankung hervor, und darum kann der Rat der sexuellen Betätigung bei den Psychoneurosen eigentlich nur selten als guter Rat bezeichnet werden.
Lassen Sie mich mit dieser abwehrenden Bemerkung schließen. Wir wollen hoffen, daß Ihr von jedem feindseligen Vorurteil gereinigtes Interesse für die Psychotherapie uns darin unterstützen wird, auch in der Behandlung der schweren Fälle von Psychoneurosen Erfreuliches zu leisten.
Über Triebumsetzungen, insbesondere der Analerotik (1917)
Vor einer Reihe von Jahren habe ich aus der psychoanalytischen Beobachtung die Vermutung geschöpft, daß das konstante Zusammentreffen der drei Charaktereigenschaften: ordentlich, sparsam und eigensinnig auf eine Verstärkung der analerotischen Komponente in der Sexualkonstitution solcher Personen hindeute, bei denen es aber im Laufe der Entwicklung durch Aufzehrung ihrer Analerotik zur Ausbildung solcher bevorzugter Reaktionsweisen des Ichs gekommen ist [Fußnote]›Charakter und Analerotik‹ (1908 b)..
Es lag mir damals daran, eine als tatsächlich erkannte Beziehung bekanntzugeben; um ihre theoretische Würdigung bekümmerte ich mich wenig. Seither hat sich wohl allgemein die Auffassung durchgesetzt, daß jede einzelne der drei Eigenschaften: Geiz, Pedanterie und Eigensinn aus den Triebquellen der Analerotik hervorgeht oder – vorsichtiger und vollständiger ausgedrückt – mächtige Zuschüsse aus diesen Quellen bezieht. Die Fälle, denen die Vereinigung der erwähnten drei Charakterfehler ein besonderes Gepräge aufdrückte (Analcharakter), waren eben nur die Extreme, an denen sich der uns interessierende Zusammenhang auch einer stumpfen Beobachtung verraten mußte.
Einige Jahre später habe ich aus einer Fülle von Eindrücken, geleitet durch eine besonders zwingende analytische Erfahrung, den Schluß gezogen, daß in der Entwicklung der menschlichen Libido vor der Phase des Genitalprimats eine »prägenitale Organisation« anzunehmen ist, in welcher der Sadismus und die Analerotik die leitenden Rollen spielen [Fußnote]›Die Disposition zur Zwangsneurose‹ (1913 i)..
Die Frage nach dem weiteren Verbleib der analerotischen Triebregungen war von da an unabweisbar. Welches wurde ihr Schicksal, nachdem sie durch die Herstellung der endgültigen Genitalorganisation ihre Bedeutung für das Sexualleben eingebüßt hatten? Blieben sie als solche, aber nun im Zustande der Verdrängung, fortbestehen, unterlagen sie der Sublimierung oder der Aufzehrung unter Umsetzung in Eigenschaften des Charakters, oder fanden sie Aufnahme in die neue, vom Primat der Genitalien bestimmte Gestaltung der Sexualität? Oder besser, da wahrscheinlich keines dieser Schicksale der Analerotik das ausschließliche sein dürfte, in welchem Ausmaß und in welcher Weise teilen sich diese verschiedenen Möglichkeiten in die Entscheidung über die Schicksale der Analerotik, deren organische Quellen ja durch das Auftreten der Genitalorganisation nicht verschüttet werden konnten?
Man sollte meinen, es könnte an Material für die Beantwortung dieser Fragen nicht fehlen, da die betreffenden Vorgänge von Entwicklung und Umsetzung sich bei allen Personen vollzogen haben müssen, die Gegenstand der psychoanalytischen Untersuchung werden. Allein dies Material ist so undurchsichtig, die Fülle von immer wiederkehrenden Eindrücken wirkt so verwirrend, daß ich auch heute keine vollständige Lösung des Problems, bloß Beiträge zur Lösung zu geben vermag. Ich brauche dabei der Gelegenheit nicht aus dem Wege zu gehen, wenn der Zusammenhang es gestattet, einige andere Triebumsetzungen zu erwähnen, welche nicht die Analerotik betreffen. Es bedarf endlich kaum der Hervorhebung, daß die beschriebenen Entwicklungsvorgänge – hier wie anderwärts in der Psychoanalyse – aus den Regressionen erschlossen worden sind, zu welchen sie durch die neurotischen Prozesse genötigt wurden.
Ausgangspunkt dieser Erörterungen kann der Anschein werden, daß in den Produktionen des Unbewußten – Einfällen, Phantasien und Symptomen – die Begriffe Kot (Geld, Geschenk), Kind und Penis schlecht auseinandergehalten und leicht miteinander vertauscht werden. Wenn wir uns so ausdrücken, wissen wir natürlich, daß wir Bezeichnungen, die für andere Gebiete des Seelenlebens gebräuchlich sind, mit Unrecht auf das Unbewußte übertragen und uns durch den Vorteil, welchen ein Vergleich mit sich bringt, verleiten lassen. Wiederholen wir also in einwandfreierer Form, daß diese Elemente im Unbewußten häufig behandelt werden, als wären sie einander äquivalent und dürften einander unbedenklich ersetzen.
Für die Beziehungen von »Kind« und »Penis« ist dies am leichtesten zu sehen. Es kann nicht gleichgültig sein, daß beide in der Symbolsprache des Traumes wie in der des täglichen Lebens durch ein gemeinsames Symbol ersetzt werden können. Das Kind heißt wie der Penis das » Kleine«. Es ist bekannt, daß die Symbolsprache sich oft über den Geschlechtsunterschied hinaussetzt. Das »Kleine«, das ursprünglich das männliche Glied meinte, mag also sekundär zur Bezeichnung des weiblichen Genitales gelangt sein.
Forscht man tief genug in der Neurose einer Frau, so stößt man nicht selten auf den verdrängten Wunsch, einen Penis wie der Mann zu besitzen. Akzidentelles Mißgeschick im Frauenleben, oft genug selbst Folge einer stark männlichen Anlage, hat diesen Kinderwunsch, den wir als »Penisneid« dem Kastrationskomplex einordnen, wieder aktiviert und ihn durch die Rückströmung der Libido zum Hauptträger der neurotischen Symptome werden lassen. Bei anderen Frauen läßt sich von diesem Wunsch nach dem Penis nichts nachweisen; seine Stelle nimmt der Wunsch nach dem Kind ein, dessen Versagung im Leben dann die Neurose auslösen kann. Es ist so, als ob diese Frauen begriffen hätten – was als Motiv doch unmöglich gewesen sein kann –, daß die Natur dem Weibe das Kind zum Ersatz für das andere gegeben hat, was sie ihm versagen mußte. Bei noch anderen Frauen erfährt man, daß beide Wünsche in der Kindheit vorhanden waren und einander abgelöst haben. Zuerst wollten sie einen Penis haben wie der Mann, und in einer späteren, immer noch infantilen Epoche trat der Wunsch nach einem Kind an die Stelle. Man kann den Eindruck nicht abweisen, daß akzidentelle Momente des Kinderlebens, die Anwesenheit oder das Fehlen von Brüdern, das Erleben der Geburt eines neuen Kindes zu günstiger Lebenszeit, die Schuld an dieser Mannigfaltigkeit tragen, so daß der Wunsch nach dem Penis doch im Grunde identisch wäre mit dem nach dem Kinde.
Wir können angeben, welches Schicksal der infantile Wunsch nach dem Penis erfährt, wenn die Bedingungen der Neurose im späteren Leben ausbleiben. Er verwandelt sich dann in den Wunsch nach dem Mann, er läßt sich also den Mann als Anhängsel an den Penis gefallen. Durch diese Wandlung wird eine gegen die weibliche Sexualfunktion gerichtete Regung zu einer ihr günstigen. Diesen Frauen wird hiemit ein Liebesleben nach dem männlichen Typus der Objektliebe ermöglicht, welches sich neben dem eigentlich weiblichen, vom Narzißmus abgeleiteten, behaupten kann. Wir haben schon gehört, daß es in anderen Fällen erst das Kind ist, welches den Übergang von der narzißtischen Selbstliebe zur Objektliebe herbeiführt. Es kann also auch in diesem Punkte das Kind durch den Penis vertreten werden.
Ich hatte einigemal Gelegenheit, Träume von Frauen nach den ersten Kohabitationen zu erfahren. Diese deckten unverkennbar den Wunsch auf, den Penis, den sie verspürt hatten, bei sich zu behalten, entsprachen also, von der libidinösen Begründung abgesehen, einer flüchtigen Regression vom Manne auf den Penis als Wunschobjekt. Man wird gewiß geneigt sein, den Wunsch nach dem Manne in rein rationalistischer Weise auf den Wunsch nach dem Kinde zurückzuführen, da ja irgend einmal verstanden wird, daß man ohne Dazutun des Mannes ein Kind nicht bekommen kann. Es dürfte aber eher so zugehen, daß der Wunsch nach dem Manne unabhängig vom Kindwunsch entsteht und daß, wenn er aus begreiflichen Motiven, die durchaus der Ichpsychologie angehören, auftaucht, der alte Wunsch nach dem Penis sich ihm als unbewußte libidinöse Verstärkung beigesellt.
Die Bedeutung des beschriebenen Vorganges liegt darin, daß er ein Stück der narzißtischen Männlichkeit des jungen Weibes in Weiblichkeit überführt und somit für die weibliche Sexualfunktion unschädlich macht. Auf einem anderen Wege wird nun auch ein Anteil der Erotik der prägenitalen Phase für die Verwendung in der Phase des Genitalprimats tauglich. Das Kind wird doch als »Lumpf« betrachtet (siehe die Analyse des kleinen Hans), als etwas, was sich durch den Darm vom Körper löst; somit kann ein Betrag libidinöser Besetzung, welcher dem Darminhalt gegolten hat, auf das durch den Darm geborene Kind ausgedehnt werden. Ein sprachliches Zeugnis dieser Identität von Kind und Kot ist in der Redensart: ein Kind schenken erhalten. Der Kot ist nämlich das erste Geschenk, ein Teil seines Körpers, von dem sich der Säugling nur auf Zureden der geliebten Person trennt, mit dem er ihr auch unaufgefordert seine Zärtlichkeit bezeigt, da er fremde Personen in der Regel nicht beschmutzt. (Ähnliche, wenn auch nicht so intensive Reaktionen mit dem Urin.) Bei der Defäkation ergibt sich für das Kind eine erste Entscheidung zwischen narzißtischer und objektliebender Einstellung. Es gibt entweder den Kot gefügig ab, »opfert« ihn der Liebe, oder hält ihn zur autoerotischen Befriedigung, später zur Behauptung seines eigenen Willens, zurück. Mit letzterer Entscheidung ist der Trotz (Eigensinn) konstituiert, der also einem narzißtischen Beharren bei der Analerotik entspringt.
Es ist wahrscheinlich, daß nicht Gold-Geld, sondern Geschenk die nächste Bedeutung ist, zu welcher das Kotinteresse fortschreitet. Das Kind kennt kein anderes Geld, als was ihm geschenkt wird, kein erworbenes und auch kein eigenes, ererbtes. Da Kot sein erstes Geschenk ist, überträgt es leicht sein Interesse von diesem Stoff auf jenen neuen, der ihm als wichtigstes Geschenk im Leben entgegentritt. Wer an dieser Herleitung des Geschenkes zweifelt, möge seine Erfahrung in der psychoanalytischen Behandlung zu Rate ziehen, die Geschenke studieren, die er als Arzt vom Kranken erhält, und die Übertragungsstürme beachten, welche er durch ein Geschenk an den Patienten hervorrufen kann.
Das Kotinteresse wird also zum Teil als Geldinteresse fortgesetzt, zum anderen Teil in den Wunsch nach dem Kinde übergeführt. In diesem Kindwunsch treffen nun eine analerotische und eine genitale Regung (Penisneid) zusammen. Der Penis hat aber auch eine vom Kindinteresse unabhängige analerotische Bedeutung. Das Verhältnis zwischen dem Penis und dem von ihm ausgefüllten und erregten Schleimhautrohr findet sich nämlich schon in der prägenitalen, sadistisch-analen Phase vorgebildet. Der Kotballen – oder die »Kotstange« nach dem Ausdruck eines Patienten – ist sozusagen der erste Penis, die von ihm gereizte Schleimhaut die des Enddarmes. Es gibt Personen, deren Analerotik bis zur Zeit der Vorpubertät (zehn bis zwölf Jahre) stark und unverändert geblieben ist; von ihnen erfährt man, daß sie schon während dieser prägenitalen Phase in Phantasien und perversen Spielereien eine der genitalen analoge Organisation entwickelt hatten, in welcher Penis und Vagina durch die Kotstange und den Darm vertreten waren. Bei anderen – Zwangsneurotikern – kann man das Ergebnis einer regressiven Erniedrigung der Genitalorganisation kennenlernen. Es äußert sich darin, daß alle ursprünglich genital konzipierten Phantasien ins Anale versetzt, der Penis durch die Kotstange, die Vagina durch den Darm ersetzt werden.
Wenn das Kotinteresse in normaler Weise zurückgeht, so wirkt die hier dargelegte organische Analogie dahin, daß es sich auf den Penis überträgt. Erfährt man später in der Sexualforschung, daß das Kind aus dem Darm geboren wird, so wird dieses zum Haupterben der Analerotik, aber der Vorgänger des Kindes war der Penis gewesen, in diesem wie in einem anderen Sinne.
Ich bin überzeugt, daß die vielfältigen Beziehungen in der Reihe Kot-Penis-Kind nun völlig unübersichtlich geworden sind, und will darum versuchen, dem Mangel durch eine graphische Darstellung abzuhelfen, in deren Diskussion dasselbe Material nochmals, aber in anderer Folge, gewürdigt werden kann. Leider ist dieses technische Mittel nicht schmiegsam genug für unsere Absichten, oder wir haben noch nicht gelernt, es in geeigneter Weise zu gebrauchen. Ich bitte jedenfalls, an das beistehende Schema keine strengen Anforderungen zu stellen.

Aus der Analerotik geht in narzißtischer Verwendung der Trotz hervor als eine bedeutsame Reaktion des Ichs gegen Anforderungen der anderen; das dem Kot zugewendete Interesse übergeht in Interesse für das Geschenk und dann für das Geld. Mit dem Auftreten des Penis entsteht beim Mädchen der Penisneid, der sich später in den Wunsch nach dem Mann als Träger eines Penis umsetzt. Vorher noch hat sich der Wunsch nach dem Penis in den Wunsch nach dem Kind verwandelt, oder der Kindwunsch ist an die Stelle des Peniswunsches getreten. Eine organische Analogie zwischen Penis und Kind (punktierte Linie) drückt sich durch den Besitz eines beiden gemeinsamen Symbols aus (»das Kleine«). Vom Kindwunsch führt dann ein rationeller Weg (doppelte Linie) zum Wunsch nach dem Mann. Die Bedeutung dieser Triebumsetzung haben wir bereits gewürdigt.
Ein anderes Stück des Zusammenhanges ist weit deutlicher beim Manne zu erkennen. Es stellt sich her, wenn die Sexualforschung des Kindes das Fehlen des Penis beim Weibe in Erfahrung gebracht hat. Der Penis wird somit als etwas vom Körper Ablösbares erkannt und tritt in Analogie zum Kot, welcher das erste Stück Leiblichkeit war, auf das man verzichten mußte. Der alte Analtrotz tritt so in die Konstitution des Kastrationskomplexes ein. Die organische Analogie, derzufolge der Darminhalt den Vorläufer des Penis während der prägenitalen Phase darstellte, kann als Motiv nicht in Betracht kommen; sie findet aber durch die Sexualforschung einen psychischen Ersatz.
Wenn das Kind auftritt, wird es durch die Sexualforschung als »Lumpf« erkannt und mit mächtigem, analerotischem Interesse besetzt. Einen zweiten Zuzug aus gleicher Quelle erhält der Kindwunsch, wenn die soziale Erfahrung lehrt, daß das Kind als Liebesbeweis, als Geschenk, aufgefaßt werden kann. Alle drei, Kotsäule, Penis und Kind, sind feste Körper, welche ein Schleimhautrohr (den Enddarm und die ihm nach einem guten Worte von Lou Andreas-Salomé gleichsam abgemietete Vagina) [Fußnote]›»Anal« und »Sexual«‹ (1916). bei ihrem Eindringen oder Herausdringen erregen. Der infantilen Sexualforschung kann von diesem Sachverhalt nur bekanntwerden, daß das Kind denselben Weg nimmt wie die Kotsäule; die Funktion des Penis wird von der kindlichen Forschung in der Regel nicht aufgedeckt. Doch ist es interessant zu sehen, daß eine organische Übereinstimmung nach so vielen Umwegen wieder im Psychischen als eine unbewußte Identität zum Vorschein kommt.
Über “wilde” Psychoanalyse (1910)
Vor einigen Tagen erschien in meiner Sprechstunde in Begleitung einer schützenden Freundin eine ältere Dame, die über Angstzustände klagte. Sie war in der zweiten Hälfte der Vierzigerjahre, ziemlich gut erhalten, hatte offenbar mit ihrer Weiblichkeit noch nicht abgeschlossen. Anlaß des Ausbruches der Zustände war die Scheidung von ihrem letzten Manne; die Angst hatte aber nach ihrer Angabe eine erhebliche Steigerung erfahren, seitdem sie einen jungen Arzt in ihrer Vorstadt konsultiert hatte; denn dieser hatte ihr auseinandergesetzt, daß die Ursache ihrer Angst ihre sexuelle Bedürftigkeit sei. Sie könne den Verkehr mit dem Manne nicht entbehren, und darum gebe es für sie nur drei Wege zur Gesundheit, entweder sie kehre zu ihrem Manne zurück, oder sie nehme einen Liebhaber, oder sie befriedige sich selbst. Seitdem sei sie überzeugt, daß sie unheilbar sei, denn zu ihrem Manne zurück wolle sie nicht, und die beiden anderen Mittel widerstrebten ihrer Moral und ihrer Religiosität. Zu mir aber sei sie gekommen, weil der Arzt ihr gesagt habe, das sei eine neue Einsicht, die man mir verdanke, und sie solle sich nur von mir die Bestätigung holen, daß es so sei und nicht anders. Die Freundin, eine noch ältere, verkümmert und ungesund aussehende Frau, beschwor mich dann, der Patientin zu versichern, daß sich der Arzt geirrt habe. Es könne doch nicht so sein, denn sie selbst sei seit langen Jahren Witwe und doch anständig geblieben, ohne an Angst zu leiden.
Ich will nicht bei der schwierigen Situation verweilen, in die ich durch diesen Besuch versetzt wurde, sondern das Verhalten des Kollegen beleuchten, der diese Kranke zu mir geschickt hatte. Vorher will ich einer Verwahrung gedenken, die vielleicht – oder hoffentlich – nicht überflüssig ist. Langjährige Erfahrung hat mich gelehrt – wie sie's auch jeden anderen lehren könnte –, nicht leichthin als wahr anzunehmen, was Patienten, insbesondere Nervöse, von ihrem Arzt erzählen. Der Nervenarzt wird nicht nur bei jeder Art von Behandlung leicht das Objekt, nach dem mannigfache feindselige Regungen des Patienten zielen; er muß es sich auch manchmal gefallen lassen, durch eine Art von Projektion die Verantwortung für die geheimen, verdrängten Wünsche der Nervösen zu übernehmen. Es ist dann eine traurige, aber bezeichnende Tatsache, daß solche Anwürfe nirgendwo leichter Glauben finden als bei anderen Ärzten.
Ich habe also das Recht zu hoffen, daß die Dame in meiner Sprechstunde mir einen tendenziös entstellten Bericht von den Äußerungen ihres Arztes gegeben hat und daß ich ein Unrecht an ihm, der mir persönlich unbekannt ist, begehe, wenn ich meine Bemerkungen über »wilde« Psychoanalyse gerade an diesen Fall anknüpfe. Aber ich halte dadurch vielleicht andere ab, an ihren Kranken unrecht zu tun.
Nehmen wir also an, daß der Arzt genauso gesprochen hat, wie mir die Patientin berichtete.
Es wird dann jeder leicht zu seiner Kritik vorbringen, daß ein Arzt, wenn er es für notwendig hält, mit einer Frau über das Thema der Sexualität zu verhandeln, dies mit Takt und Schonung tun müsse. Aber diese Anforderungen fallen mit der Befolgung gewisser technischer Vorschriften der Psychoanalyse zusammen, und überdies hätte der Arzt eine Reihe von wissenschaftlichen Lehren der Psychoanalyse verkannt oder mißverstanden und dadurch gezeigt, wie wenig weit er zum Verständnis von deren Wesen und Absichten vorgedrungen ist.
Beginnen wir mit den letzteren, den wissenschaftlichen Irrtümern. Die Ratschläge des Arztes lassen klar erkennen, in welchem Sinne er das »Sexualleben« erfaßt. Im populären nämlich, wobei unter sexuellen Bedürfnissen nichts anderes verstanden wird als das Bedürfnis nach dem Koitus oder analogen, den Orgasmus und die Entleerung der Geschlechtsstoffe bewirkenden Vornahmen. Es kann aber dem Arzt nicht unbekannt geblieben sein, daß man der Psychoanalyse den Vorwurf zu machen pflegt, sie dehne den Begriff des Sexuellen weit über den gebräuchlichen Umfang aus. Die Tatsache ist richtig; ob sie als Vorwurf verwendet werden darf, soll hier nicht erörtert werden. Der Begriff des Sexuellen umfaßt in der Psychoanalyse weit mehr; er geht nach unten wie nach oben über den populären Sinn hinaus. Diese Erweiterung rechtfertigt sich genetisch; wir rechnen zum »Sexualleben« auch alle Betätigungen zärtlicher Gefühle, die aus der Quelle der primitiven sexuellen Regungen hervorgegangen sind, auch wenn diese Regungen eine Hemmung ihres ursprünglich sexuellen Zieles erfahren oder dieses Ziel gegen ein anderes, nicht mehr sexuelles, vertauscht haben. Wir sprechen darum auch lieber von Psychosexualität, legen so Wert darauf, daß man den seelischen Faktor des Sexuallebens nicht übersehe und nicht unterschätze. Wir gebrauchen das Wort Sexualität in demselben umfassenden Sinne wie die deutsche Sprache das Wort »lieben«. Wir wissen auch längst, daß seelische Unbefriedigung mit allen ihren Folgen bestehen kann, wo es an normalem Sexualverkehr nicht mangelt, und halten uns als Therapeuten immer vor, daß von den unbefriedigten Sexualstrebungen, deren Ersatzbefriedigungen in der Form nervöser Symptome wir bekämpfen, oft nur ein geringes Maß durch den Koitus oder andere Sexualakte abzuführen ist.
Wer diese Auffassung der Psychosexualität nicht teilt, hat kein Recht, sich auf die Lehrsätze der Psychoanalyse zu berufen, in denen von der ätiologischen Bedeutung der Sexualität gehandelt wird. Er hat sich durch die ausschließliche Betonung des somatischen Faktors am Sexuellen das Problem gewiß sehr vereinfacht, aber er mag für sein Vorgehen allein die Verantwortung tragen.
Aus den Ratschlägen des Arztes leuchtet noch ein zweites und ebenso arges Mißverständnis hervor.
Es ist richtig, daß die Psychoanalyse angibt, sexuelle Unbefriedigung sei die Ursache der nervösen Leiden. Aber sagt sie nicht noch mehr? Will man als zu kompliziert beiseite lassen, daß sie lehrt, die nervösen Symptome entspringen aus einem Konflikt zwischen zwei Mächten, einer (meist übergroß gewordenen) Libido und einer allzu strengen Sexualablehnung oder Verdrängung? Wer auf diesen zweiten Faktor, dem wirklich nicht der zweite Rang angewiesen wurde, nicht vergißt, wird nie glauben können, daß Sexualbefriedigung an sich ein allgemein verläßliches Heilmittel gegen die Beschwerden der Nervösen sei. Ein guter Teil dieser Menschen ist ja der Befriedigung unter den gegebenen Umständen oder überhaupt nicht fähig. Wären sie dazu fähig, hätten sie nicht ihre inneren Widerstände, so würde die Stärke des Triebes ihnen den Weg zur Befriedigung weisen, auch wenn der Arzt nicht dazu raten würde. Was soll also ein solcher Rat, wie ihn der Arzt angeblich jener Dame erteilt hat?
Selbst wenn er sich wissenschaftlich rechtfertigen läßt, ist er unausführbar für sie. Wenn sie keine inneren Widerstände gegen die Onanie oder gegen ein Liebesverhältnis hätte, würde sie ja längst zu einem von diesen Mitteln gegriffen haben. Oder meint der Arzt, eine Frau von über vierzig Jahren wisse nichts davon, daß man sich einen Liebhaber nehmen kann, oder überschätzt er seinen Einfluß so sehr, daß er meint, ohne ärztliches Gutheißen würde sie sich nie zu einem solchen Schritt entschließen können?
Das scheint alles sehr klar, und doch ist zuzugeben, daß es ein Moment gibt, welches die Urteilsfällung oft erschwert. Manche der nervösen Zustände, die sogenannten Aktualneurosen wie die typische Neurasthenie und die reine Angstneurose, hängen offenbar von dem somatischen Faktor des Sexuallebens ab, während wir über die Rolle des psychischen Faktors und der Verdrängung bei ihnen noch keine gesicherte Vorstellung haben. In solchen Fällen ist es dem Arzte nahegelegt, eine aktuelle Therapie, eine Veränderung der somatischen sexuellen Betätigung, zunächst ins Auge zu fassen, und er tut dies mit vollem Recht, wenn seine Diagnose richtig war. Die Dame, die den jungen Arzt konsultierte, klagte vor allem über Angstzustände, und da nahm er wahrscheinlich an, sie leide an Angstneurose, und hielt sich für berechtigt, ihr eine somatische Therapie zu empfehlen. Wiederum ein bequemes Mißverständnis! Wer an Angst leidet, hat darum nicht notwendig eine Angstneurose; diese Diagnose ist nicht aus dem Namen abzuleiten; man muß wissen, welche Erscheinungen eine Angstneurose ausmachen, und sie von anderen, auch durch Angst manifestierten Krankheitszuständen unterscheiden. Die in Rede stehende Dame litt nach meinem Eindruck an einer Angsthysterie, und der ganze, aber auch voll zureichende Wert solcher nosographischer Unterscheidungen liegt darin, daß sie auf eine andere Ätiologie und andere Therapie hinweisen. Wer die Möglichkeit einer solchen Angsthysterie ins Auge gefaßt hätte, der wäre der Vernachlässigung der psychischen Faktoren, wie sie in den Alternativratschlägen des Arztes hervortritt, nicht verfallen.
Merkwürdig genug, in dieser therapeutischen Alternative des angeblichen Psychoanalytikers bleibt kein Raum – für die Psychoanalyse. Diese Frau soll von ihrer Angst nur genesen können, wenn sie zu ihrem Manne zurückkehrt oder sich auf dem Wege der Onanie oder bei einem Liebhaber befriedigt. Und wo hätte die analytische Behandlung einzutreten, in der wir das Hauptmittel bei Angstzuständen erblicken?
Somit wären wir zu den technischen Verfehlungen gelangt, die wir in dem Vorgehen des Arztes im angenommenen Falle erkennen. Es ist eine längst überwundene, am oberflächlichen Anschein haftende Auffassung, daß der Kranke infolge einer Art von Unwissenheit leide, und wenn man diese Unwissenheit durch Mitteilung (über die ursächlichen Zusammenhänge seiner Krankheit mit seinem Leben, über seine Kindheitserlebnisse usw.) aufhebe, müsse er gesund werden. Nicht dies Nichtwissen an sich ist das pathogene Moment, sondern die Begründung des Nichtwissens in inneren Widerständen, welche das Nichtwissen zuerst hervorgerufen haben und es jetzt noch unterhalten. In der Bekämpfung dieser Widerstände liegt die Aufgabe der Therapie. Die Mitteilung dessen, was der Kranke nicht weiß, weil er es verdrängt hat, ist nur eine der notwendigen Vorbereitungen für die Therapie. Wäre das Wissen des Unbewußten für den Kranken so wichtig, wie der in der Psychoanalyse Unerfahrene glaubt, so müßte es zur Heilung hinreichen, wenn der Kranke Vorlesungen anhört oder Bücher liest. Diese Maßnahmen haben aber ebensoviel Einfluß auf die nervösen Leidenssymptome wie die Verteilung von Menükarten zur Zeit einer Hungersnot auf den Hunger. Der Vergleich ist sogar über seine erste Verwendung hinaus brauchbar, denn die Mitteilung des Unbewußten an den Kranken hat regelmäßig die Folge, daß der Konflikt in ihm verschärft wird und die Beschwerden sich steigern.
Da die Psychoanalyse aber eine solche Mitteilung nicht entbehren kann, schreibt sie vor, daß sie nicht eher zu erfolgen habe, als bis zwei Bedingungen erfüllt sind. Erstens bis der Kranke durch Vorbereitung selbst in die Nähe des von ihm Verdrängten gekommen ist, und zweitens, bis er sich so weit an den Arzt attachiert hat ( Übertragung), daß ihm die Gefühlsbeziehung zum Arzt die neuerliche Flucht unmöglich macht.
Erst durch die Erfüllung dieser Bedingungen wird es möglich, die Widerstände, welche zur Verdrängung und zum Nichtwissen geführt haben, zu erkennen und ihrer Herr zu werden. Ein psychoanalytischer Eingriff setzt also durchaus einen längeren Kontakt mit dem Kranken voraus, und Versuche, den Kranken durch die brüske Mitteilung seiner vom Arzt erratenen Geheimnisse beim ersten Besuch in der Sprechstunde zu überrumpeln, sind technisch verwerflich und strafen sich meist dadurch, daß sie dem Arzt die herzliche Feindschaft des Kranken zuziehen und jede weitere Beeinflussung abschneiden.
Ganz abgesehen davon, daß man manchmal falsch rät und niemals imstande ist, alles zu erraten. Durch diese bestimmten technischen Vorschriften ersetzt die Psychoanalyse die Forderung des unfaßbaren »ärztlichen Taktes«, in dem eine besondere Begabung gesucht wird.
Es reicht also für den Arzt nicht hin, einige der Ergebnisse der Psychoanalyse zu kennen; man muß sich auch mit ihrer Technik vertraut gemacht haben, wenn man sein ärztliches Handeln durch die psychoanalytischen Gesichtspunkte leiten lassen will. Diese Technik ist heute noch nicht aus Büchern zu erlernen und gewiß nur mit großen Opfern an Zeit, Mühe und Erfolg selbst zu finden. Man erlernt sie wie andere ärztliche Techniken bei denen, die sie bereits beherrschen. Es ist darum gewiß für die Beurteilung des Falles, an den ich diese Bemerkungen knüpfe, nicht gleichgültig, daß ich den Arzt, der solche Ratschläge gegeben haben soll, nicht kenne und seinen Namen nie gehört habe.
Es ist weder mir noch meinen Freunden und Mitarbeitern angenehm, in solcher Weise den Anspruch auf die Ausübung einer ärztlichen Technik zu monopolisieren. Aber angesichts der Gefahren, die die vorherzusehende Übung einer »wilden« Psychoanalyse für die Kranken und für die Sache der Psychoanalyse mit sich bringt, blieb uns nichts anderes übrig. Wir haben im Frühjahr 1910 einen internationalen psychoanalytischen Verein gegründet, dessen Mitglieder sich durch Namensveröffentlichung zu ihm bekennen, um die Verantwortung für das Tun aller jener ablehnen zu können, die nicht zu uns gehören und ihr ärztliches Vorgehen »Psychoanalyse« heißen. Denn in Wahrheit schaden solche wilde Analytiker doch der Sache mehr als dem einzelnen Kranken. Ich habe es häufig erlebt, daß ein so ungeschicktes Vorgehen, wenn es zuerst eine Verschlimmerung im Befinden des Kranken machte, ihm am Ende doch zum Heile gereicht hat. Nicht immer, aber doch oftmals. Nachdem er lange genug auf den Arzt geschimpft hat und sich weit genug von seiner Beeinflussung weiß, lassen dann seine Symptome nach, oder er entschließt sich zu einem Schritt, welcher auf dem Wege zur Heilung liegt. Die endliche Besserung ist dann »von selbst« eingetreten oder wird der höchst indifferenten Behandlung eines Arztes zugeschrieben, an den sich der Kranke später gewendet hat. Für den Fall der Dame, deren Anklage gegen den Arzt wir gehört haben, möchte ich meinen, der wilde Psychoanalytiker habe doch mehr für seine Patientin getan als irgendeine hochangesehene Autorität, die ihr erzählt hätte, daß sie an einer »vasomotorischen Neurose« leide. Er hat ihren Blick auf die wirkliche Begründung ihres Leidens oder in dessen Nähe gezwungen, und dieser Eingriff wird trotz alles Sträubens der Patientin nicht ohne günstige Folgen bleiben. Aber er hat sich selbst geschädigt und die Vorurteile steigern geholfen, welche sich infolge begreiflicher Affektwiderstände bei den Kranken gegen die Tätigkeit des Psychoanalytikers erheben. Und dies kann vermieden werden.
Vergänglichkeit (1916)
Vor einiger Zeit machte ich in Gesellschaft eines schweigsamen Freundes und eines jungen, bereits rühmlich bekannten Dichters einen Spaziergang durch eine blühende Sommerlandschaft. Der Dichter bewunderte die Schönheit der Natur um uns, aber ohne sich ihrer zu erfreuen. Ihn störte der Gedanke, daß all diese Schönheit dem Vergehen geweiht war, daß sie im Winter dahingeschwunden sein werde, aber ebenso jede menschliche Schönheit und alles Schöne und Edle, was Menschen geschaffen haben und schaffen könnten. Alles, was er sonst geliebt und bewundert hätte, schien ihm entwertet durch das Schicksal der Vergänglichkeit, zu dem es bestimmt war.
Wir wissen, daß von solcher Versenkung in die Hinfälligkeit alles Schönen und Vollkommenen zwei verschiedene seelische Regungen ausgehen können. Die eine führt zu dem schmerzlichen Weltüberdruß des jungen Dichters, die andere zur Auflehnung gegen die behauptete Tatsächlichkeit. Nein, es ist unmöglich, daß all diese Herrlichkeiten der Natur und der Kunst, unserer Empfindungswelt und der Welt draußen, wirklich in Nichts zergehen sollten. Es wäre zu unsinnig und zu frevelhaft, daran zu glauben. Sie müssen in irgendeiner Weise fortbestehen können, allen zerstörenden Einflüssen entrückt.
Allein diese Ewigkeitsforderung ist zu deutlich ein Erfolg unseres Wunschlebens, als daß sie auf einen Realitätswert Anspruch erheben könnte. Auch das Schmerzliche kann wahr sein. Ich konnte mich weder entschließen, die allgemeine Vergänglichkeit zu bestreiten, noch für das Schöne und Vollkommene eine Ausnahme zu erzwingen. Aber ich bestritt dem pessimistischen Dichter, daß die Vergänglichkeit des Schönen eine Entwertung desselben mit sich bringe.
Im Gegenteil, eine Wertsteigerung! Der Vergänglichkeitswert ist ein Seltenheitswert in der Zeit. Die Beschränkung in der Möglichkeit des Genusses erhöht dessen Kostbarkeit. Ich erklärte es für unverständlich, wie der Gedanke an die Vergänglichkeit des Schönen uns die Freude an demselben trüben sollte. Was die Schönheit der Natur betrifft, so kommt sie nach jeder Zerstörung durch den Winter im nächsten Jahre wieder, und diese Wiederkehr darf im Verhältnis zu unserer Lebensdauer als eine ewige bezeichnet werden. Die Schönheit des menschlichen Körpers und Angesichts sehen wir innerhalb unseres eigenen Lebens für immer schwinden, aber diese Kurzlebigkeit fügt zu ihren Reizen einen neuen hinzu. Wenn es eine Blume gibt, welche nur eine einzige Nacht blüht, so erscheint uns ihre Blüte darum nicht minder prächtig. Wie die Schönheit und Vollkommenheit des Kunstwerks und der intellektuellen Leistung durch deren zeitliche Beschränkung entwertet werden sollte, vermochte ich ebensowenig einzusehen. Mag eine Zeit kommen, wenn die Bilder und Statuen, die wir heute bewundern, zerfallen sind, oder ein Menschengeschlecht nach uns, welches die Werke unserer Dichter und Denker nicht mehr versteht, oder selbst eine geologische Epoche, in der alles Lebende auf der Erde verstummt ist, der Wert all dieses Schönen und Vollkommenen wird nur durch seine Bedeutung für unser Empfindungsleben bestimmt, braucht dieses selbst nicht zu überdauern und ist darum von der absoluten Zeitdauer unabhängig.
Ich hielt diese Erwägungen für unanfechtbar, bemerkte aber, daß ich dem Dichter und dem Freunde keinen Eindruck gemacht hatte. Ich schloß aus diesem Mißerfolg auf die Einmengung eines starken affektiven Moments, welches ihr Urteil trübte, und glaubte dies auch später gefunden zu haben. Es muß die seelische Auflehnung gegen die Trauer gewesen sein, welche ihnen den Genuß des Schönen entwertete. Die Vorstellung, daß dieses Schöne vergänglich sei, gab den beiden Empfindsamen einen Vorgeschmack der Trauer um seinen Untergang, und da die Seele von allem Schmerzlichen instinktiv zurückweicht, fühlten sie ihren Genuß am Schönen durch den Gedanken an dessen Vergänglichkeit beeinträchtigt.
Die Trauer über den Verlust von etwas, das wir geliebt oder bewundert haben, erscheint dem Laien so natürlich, daß er sie für selbstverständlich erklärt. Dem Psychologen aber ist die Trauer ein großes Rätsel, eines jener Phänomene, die man selbst nicht klärt, auf die man aber anderes Dunkle zurückführt. Wir stellen uns vor, daß wir ein gewisses Maß von Liebesfähigkeit, genannt Libido, besitzen, welches sich in den Anfängen der Entwicklung dem eigenen Ich zugewendet hatte. Später, aber eigentlich von sehr frühe an, wendet es sich vom Ich ab und den Objekten zu, die wir solcherart gewissermaßen in unser Ich hineinnehmen. Werden die Objekte zerstört oder gehen sie uns verloren, so wird unsere Liebesfähigkeit (Libido) wieder frei. Sie kann sich andere Objekte zum Ersatz nehmen oder zeitweise zum Ich zurückkehren. Warum aber diese Ablösung der Libido von ihren Objekten ein so schmerzhafter Vorgang sein sollte, das verstehen wir nicht und können es derzeit aus keiner Annahme ableiten. Wir sehen nur, daß sich die Libido an ihre Objekte klammert und die verlorenen auch dann nicht aufgeben will, wenn der Ersatz bereitliegt. Das also ist die Trauer.
Die Unterhaltung mit dem Dichter fand im Sommer vor dem Kriege statt. Ein Jahr später brach der Krieg herein und raubte der Welt ihre Schönheiten. Er zerstörte nicht nur die Schönheit der Landschaften, die er durchzog, und die Kunstwerke, an die er auf seinem Wege streifte, er brach auch unseren Stolz auf die Errungenschaften unserer Kultur, unseren Respekt vor so vielen Denkern und Künstlern, unsere Hoffnungen auf eine endliche Überwindung der Verschiedenheiten unter Völkern und Rassen. Er beschmutzte die erhabene Unparteilichkeit unserer Wissenschaft, stellte unser Triebleben in seiner Nacktheit bloß, entfesselte die bösen Geister in uns, die wir durch die Jahrhunderte währende Erziehung von Seiten unserer Edelsten dauernd gebändigt glaubten. Er machte unser Vaterland wieder klein und die andere Erde wieder fern und weit. Er raubte uns so vieles, was wir geliebt hatten, und zeigte uns die Hinfälligkeit von manchem, was wir für beständig gehalten hatten.
Es ist nicht zu verwundern, daß unsere an Objekten so verarmte Libido mit um so größerer Intensität besetzt hat, was uns verblieben ist, daß die Liebe zum Vaterland, die Zärtlichkeit für unsere Nächsten und der Stolz auf unsere Gemeinsamkeiten jäh verstärkt worden sind. Aber jene anderen, jetzt verlorenen Güter, sind sie uns wirklich entwertet worden, weil sie sich als so hinfällig und widerstandsunfähig erwiesen haben? Vielen unter uns scheint es so, aber ich meine wiederum, mit Unrecht. Ich glaube, die so denken und zu einem dauernden Verzicht bereit scheinen, weil das Kostbare sich nicht als haltbar bewährt hat, befinden sich nur in der Trauer über den Verlust. Wir wissen, die Trauer, so schmerzhaft sie sein mag, läuft spontan ab. Wenn sie auf alles Verlorene verzichtet hat, hat sie sich auch selbst aufgezehrt, und dann wird unsere Libido wiederum frei, um sich, insofern wir noch jung und lebenskräftig sind, die verlorenen Objekte durch möglichst gleich kostbare oder kostbarere neue zu ersetzen. Es steht zu hoffen, daß es mit den Verlusten dieses Krieges nicht anders gehen wird. Wenn erst die Trauer überwunden ist, wird es sich zeigen, daß unsere Hochschätzung der Kulturgüter unter der Erfahrung von ihrer Gebrechlichkeit nicht gelitten hat. Wir werden alles wieder aufbauen, was der Krieg zerstört hat, vielleicht auf festerem Grund und dauerhafter als vorher.
Warum Krieg ? (1933)
Wien, im September 1932
Lieber Herr Einstein!
Als ich hörte, daß Sie die Absicht haben, mich zum Gedankenaustausch über ein Thema aufzufordern, dem Sie Ihr Interesse schenken und das Ihnen auch des Interesses anderer würdig erscheint, stimmte ich bereitwillig zu. Ich erwartete, Sie würden ein Problem an der Grenze des heute Wißbaren wählen, zu dem ein jeder von uns, der Physiker wie der Psycholog, sich seinen besonderen Zugang bahnen könnte, so daß sie sich von verschiedenen Seiten her auf demselben Boden träfen. Sie haben mich dann durch die Fragestellung überrascht, was man tun könne, um das Verhängnis des Krieges von den Menschen abzuwehren. Ich erschrak zunächst unter dem Eindruck meiner – fast hätte ich gesagt: unserer – Inkompetenz, denn das erschien mir als eine praktische Aufgabe, die den Staatsmännern zufällt. Ich verstand dann aber, daß Sie die Frage nicht als Naturforscher und Physiker erhoben haben, sondern als Menschenfreund, der den Anregungen des Völkerbunds gefolgt war, ähnlich wie der Polarforscher Fridtjof Nansen es auf sich genommen hatte, den Hungernden und den heimatlosen Opfern des Weltkrieges Hilfe zu bringen. Ich besann mich auch, daß mir nicht zugemutet wird, praktische Vorschläge zu machen, sondern daß ich nur angeben soll, wie sich das Problem der Kriegsverhütung einer psychologischen Betrachtung darstellt.
Aber auch hierüber haben Sie in Ihrem Schreiben das meiste gesagt. Sie haben mir gleichsam den Wind aus den Segeln genommen, aber ich fahre gern in Ihrem Kielwasser und bescheide mich damit, alles zu bestätigen, was Sie vorbringen, indem ich es nach meinem besten Wissen – oder Vermuten – breiter ausführe.
Sie beginnen mit dem Verhältnis von Recht und Macht. Das ist gewiß der richtige Ausgangspunkt für unsere Untersuchung. Darf ich das Wort »Macht« durch das grellere, härtere Wort »Gewalt« ersetzen? Recht und Gewalt sind uns heute Gegensätze. Es ist leicht zu zeigen, daß sich das eine aus dem anderen entwickelt hat, und wenn wir auf die Uranfänge zurückgehen und nachsehen, wie das zuerst geschehen ist, so fällt uns die Lösung des Problems mühelos zu. Entschuldigen Sie mich aber, wenn ich im folgenden allgemein Bekanntes und Anerkanntes erzähle, als ob es neu wäre; der Zusammenhang nötigt mich dazu.
Interessenkonflikte unter den Menschen werden also prinzipiell durch die Anwendung von Gewalt entschieden. So ist es im ganzen Tierreich, von dem der Mensch sich nicht ausschließen sollte; für den Menschen kommen allerdings noch Meinungskonflikte hinzu, die bis zu den höchsten Höhen der Abstraktion reichen und eine andere Technik der Entscheidung zu fordern scheinen. Aber das ist eine spätere Komplikation. Anfänglich, in einer kleinen Menschenhorde, entschied die stärkere Muskelkraft darüber, wem etwas gehören oder wessen Wille zur Ausführung gebracht werden sollte. Muskelkraft verstärkt und ersetzt sich bald durch den Gebrauch von Werkzeugen; es siegt, wer die besseren Waffen hat oder sie geschickter verwendet. Mit der Einführung der Waffe beginnt bereits die geistige Überlegenheit die Stelle der rohen Muskelkraft einzunehmen; die Endabsicht des Kampfes bleibt die nämliche, der eine Teil soll durch die Schädigung, die er erfährt, und durch die Lähmung seiner Kräfte gezwungen werden, seinen Anspruch oder Widerspruch aufzugeben. Dies wird am gründlichsten erreicht, wenn die Gewalt den Gegner dauernd beseitigt, also tötet. Es hat zwei Vorteile, daß er seine Gegnerschaft nicht ein andermal wiederaufnehmen kann und daß sein Schicksal andere abschreckt, seinem Beispiel zu folgen. Außerdem befriedigt die Tötung des Feindes eine triebhafte Neigung, die später erwähnt werden muß. Der Tötungsabsicht kann sich die Erwägung widersetzen, daß der Feind zu nützlichen Dienstleistungen verwendet werden kann, wenn man ihn eingeschüchtert am Leben läßt. Dann begnügt sich also die Gewalt damit, ihn zu unterwerfen, anstatt ihn zu töten. Es ist der Anfang der Schonung des Feindes, aber der Sieger hat von nun an mit der lauernden Rachsucht des Besiegten zu rechnen, gibt ein Stück seiner eigenen Sicherheit auf.
Das ist also der ursprüngliche Zustand, die Herrschaft der größeren Macht, der rohen oder intellektuell gestützten Gewalt. Wir wissen, dies Regime ist im Laufe der Entwicklung abgeändert worden, es führte ein Weg von der Gewalt zum Recht, aber welcher? Nur ein einziger, meine ich. Er führte über die Tatsache, daß die größere Stärke des einen wettgemacht werden konnte durch die Vereinigung mehrerer Schwachen. » L'union fait la force.« Gewalt wird gebrochen durch Einigung, die Macht dieser Geeinigten stellt nun das Recht dar im Gegensatz zur Gewalt des Einzelnen. Wir sehen, das Recht ist die Macht einer Gemeinschaft. Es ist noch immer Gewalt, bereit, sich gegen jeden Einzelnen zu wenden, der sich ihr widersetzt, arbeitet mit denselben Mitteln, verfolgt dieselben Zwecke; der Unterschied liegt wirklich nur darin, daß es nicht mehr die Gewalt eines Einzelnen ist, die sich durchsetzt, sondern die der Gemeinschaft. Aber damit sich dieser Übergang von der Gewalt zum neuen Recht vollziehe, muß eine psychologische Bedingung erfüllt werden. Die Einigung der mehreren muß eine beständige, dauerhafte sein. Stellte sie sich nur zum Zweck der Bekämpfung des einen Übermächtigen her und zerfiele nach seiner Überwältigung, so wäre nichts erreicht. Der nächste, der sich für stärker hält, würde wiederum eine Gewaltherrschaft anstreben, und das Spiel würde sich endlos wiederholen. Die Gemeinschaft muß permanent erhalten werden, sich organisieren, Vorschriften schaffen, die den gefürchteten Auflehnungen vorbeugen, Organe bestimmen, die über die Einhaltung der Vorschriften – Gesetze – wachen und die Ausführung der rechtmäßigen Gewaltakte besorgen. In der Anerkennung einer solchen Interessengemeinschaft stellen sich unter den Mitgliedern einer geeinigten Menschengruppe Gefühlsbindungen her, Gemeinschaftsgefühle, in denen ihre eigentliche Stärke beruht.
Damit, denke ich, ist alles Wesentliche bereits gegeben: die Überwindung der Gewalt durch Übertragung der Macht an eine größere Einheit, die durch Gefühlsbindungen ihrer Mitglieder zusammengehalten wird. Alles Weitere sind Ausführungen und Wiederholungen. Die Verhältnisse sind einfach, solange die Gemeinschaft nur aus einer Anzahl gleich starker Individuen besteht. Die Gesetze dieser Vereinigung bestimmen dann, auf welches Maß von persönlicher Freiheit, seine Kraft als Gewalt anzuwenden, der Einzelne verzichten muß, um ein gesichertes Zusammenleben zu ermöglichen. Aber ein solcher Ruhezustand ist nur theoretisch denkbar, in Wirklichkeit kompliziert sich der Sachverhalt dadurch, daß die Gemeinschaft von Anfang an ungleich mächtige Elemente umfaßt, Männer und Frauen, Eltern und Kinder, und bald infolge von Krieg und Unterwerfung Siegreiche und Besiegte, die sich in Herren und Sklaven umsetzen. Das Recht der Gemeinschaft wird dann zum Ausdruck der ungleichen Machtverhältnisse in ihrer Mitte, die Gesetze werden von und für die Herrschenden gemacht werden und den Unterworfenen wenig Rechte einräumen. Von da an gibt es in der Gemeinschaft zwei Quellen von Rechtsunruhe, aber auch von Rechtsfortbildung. Erstens die Versuche Einzelner unter den Herren, sich über die für alle gültigen Einschränkungen zu erheben, also von der Rechtsherrschaft auf die Gewaltherrschaft zurückzugreifen, zweitens die ständigen Bestrebungen der Unterdrückten, sich mehr Macht zu verschaffen und diese Änderungen im Gesetz anerkannt zu sehen, also im Gegenteil vom ungleichen Recht zum gleichen Recht für alle vorzudringen. Diese letztere Strömung wird besonders bedeutsam werden, wenn sich im Inneren des Gemeinwesens wirklich Verschiebungen der Machtverhältnisse ergeben, wie es infolge mannigfacher historischer Momente geschehen kann. Das Recht kann sich dann allmählich den neuen Machtverhältnissen anpassen, oder, was häufiger geschieht, die herrschende Klasse ist nicht bereit, dieser Änderung Rechnung zu tragen, es kommt zu Auflehnung, Bürgerkrieg, also zur zeitweiligen Aufhebung des Rechts und zu neuen Gewaltproben, nach deren Ausgang eine neue Rechtsordnung eingesetzt wird. Es gibt noch eine andere Quelle der Rechtsänderung, die sich nur in friedlicher Weise äußert, das ist die kulturelle Wandlung der Mitglieder des Gemeinwesens, aber die gehört in einen Zusammenhang, der erst später berücksichtigt werden kann.
Wir sehen also, auch innerhalb eines Gemeinwesens ist die gewaltsame Erledigung von Interessenkonflikten nicht vermieden worden. Aber die Notwendigkeiten und Gemeinsamkeiten, die sich aus dem Zusammenleben auf demselben Boden ableiten, sind einer raschen Beendigung solcher Kämpfe günstig, und die Wahrscheinlichkeit friedlicher Lösungen unter diesen Bedingungen nimmt stetig zu. Ein Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt uns aber eine unaufhörliche Reihe von Konflikten zwischen einem Gemeinwesen und einem oder mehreren anderen, zwischen größeren und kleineren Einheiten, Stadtgebieten, Landschaften, Stämmen, Völkern, Reichen, die fast immer durch die Kraftprobe des Krieges entschieden werden. Solche Kriege gehen entweder in Beraubung oder in volle Unterwerfung, Eroberung des einen Teils aus. Man kann die Eroberungskriege nicht einheitlich beurteilen. Manche, wie die der Mongolen und Türken, haben nur Unheil gebracht, andere im Gegenteil zur Umwandlung von Gewalt in Recht beigetragen, indem sie größere Einheiten herstellten, innerhalb deren nun die Möglichkeit der Gewaltanwendung aufgehört hatte und eine neue Rechtsordnung die Konflikte schlichtete. So haben die Eroberungen der Römer den Mittelmeerländern die kostbare pax romana gegeben. Die Vergrößerungslust der französischen Könige hat ein friedlich geeinigtes, blühendes Frankreich geschaffen. So paradox es klingt, man muß doch zugestehen, der Krieg wäre kein ungeeignetes Mittel zur Herstellung des ersehnten »ewigen« Friedens, weil er imstande ist, jene großen Einheiten zu schaffen, innerhalb deren eine starke Zentralgewalt weitere Kriege unmöglich macht. Aber er taugt doch nicht dazu, denn die Erfolge der Eroberung sind in der Regel nicht dauerhaft; die neu geschaffenen Einheiten zerfallen wieder, meist infolge des mangelnden Zusammenhalts der gewaltsam geeinigten Teile. Und außerdem konnte die Eroberung bisher nur partielle Einigungen, wenn auch von größerem Umfang, schaffen, deren Konflikte die gewaltsame Entscheidung erst recht herausforderten. So ergab sich als die Folge all dieser kriegerischen Anstrengungen nur, daß die Menschheit zahlreiche, ja unaufhörliche Kleinkriege gegen seltene, aber um so mehr verheerende Großkriege eintauschte.
Auf unsere Gegenwart angewendet, ergibt sich das gleiche Resultat, zu dem Sie auf kürzerem Weg gelangt sind. Eine sichere Verhütung der Kriege ist nur möglich, wenn sich die Menschen zur Einsetzung einer Zentralgewalt einigen, welcher der Richtspruch in allen Interessenkonflikten übertragen wird. Hier sind offenbar zwei Forderungen vereinigt, daß eine solche übergeordnete Instanz geschaffen und daß ihr die erforderliche Macht gegeben werde. Das eine allein würde nicht nützen. Nun ist der Völkerbund als solche Instanz gedacht, aber die andere Bedingung ist nicht erfüllt; der Völkerbund hat keine eigene Macht und kann sie nur bekommen, wenn die Mitglieder der neuen Einigung, die einzelnen Staaten, sie ihm abtreten. Dazu scheint aber derzeit wenig Aussicht vorhanden. Man stünde der Institution des Völkerbundes nun ganz ohne Verständnis gegenüber, wenn man nicht wüßte, daß hier ein Versuch vorliegt, der in der Geschichte der Menschheit nicht oft – vielleicht noch nie in diesem Maß – gewagt worden ist. Es ist der Versuch, die Autorität – d. i. den zwingenden Einfluß –, die sonst auf dem Besitz der Macht ruht, durch die Berufung auf bestimmte ideelle Einstellungen zu erwerben. Wir haben gehört, was eine Gemeinschaft zusammenhält, sind zwei Dinge: der Zwang der Gewalt und die Gefühlsbindungen – Identifizierungen heißt man sie technisch – der Mitglieder. Fällt das eine Moment weg, so kann möglicherweise das andere die Gemeinschaft aufrechthalten. Jene Ideen haben natürlich nur dann eine Bedeutung, wenn sie wichtigen Gemeinsamkeiten der Mitglieder Ausdruck geben. Es fragt sich dann, wie stark sie sind. Die Geschichte lehrt, daß sie in der Tat ihre Wirkung geübt haben. Die panhellenische Idee z. B., das Bewußtsein, daß man etwas Besseres sei als die umwohnenden Barbaren, das in den Amphiktyonien, den Orakeln und Festspielen so kräftigen Ausdruck fand, war stark genug, um die Sitten der Kriegsführung unter Griechen zu mildern, aber selbstverständlich nicht imstande, kriegerische Streitigkeiten zwischen den Partikeln des Griechenvolkes zu verhüten, ja nicht einmal, um eine Stadt oder einen Städtebund abzuhalten, sich zum Schaden eines Rivalen mit dem Perserfeind zu verbünden. Ebensowenig hat das christliche Gemeingefühl, das doch mächtig genug war, im Renaissancezeitalter christliche Klein- und Großstaaten daran gehindert, in ihren Kriegen miteinander um die Hilfe des Sultans zu werben. Auch in unserer Zeit gibt es keine Idee, der man eine solche einigende Autorität zumuten könnte. Daß die heute die Völker beherrschenden nationalen Ideale zu einer gegenteiligen Wirkung drängen, ist ja allzu deutlich. Es gibt Personen, die vorhersagen, erst das allgemeine Durchdringen der bolschewistischen Denkungsart werde den Kriegen ein Ende machen können, aber von solchem Ziel sind wir heute jedenfalls weit entfernt, und vielleicht wäre es nur nach schrecklichen Bürgerkriegen erreichbar. So scheint es also, daß der Versuch, reale Macht durch die Macht der Ideen zu ersetzen, heute noch zum Fehlschlagen verurteilt ist. Es ist ein Fehler in der Rechnung, wenn man nicht berücksichtigt, daß Recht ursprünglich rohe Gewalt war und noch heute der Stützung durch die Gewalt nicht entbehren kann.
Ich kann nun daran gehen, einen anderen Ihrer Sätze zu glossieren. Sie verwundern sich darüber, daß es so leicht ist, die Menschen für den Krieg zu begeistern, und vermuten, daß etwas in ihnen wirksam ist, ein Trieb zum Hassen und Vernichten, der solcher Verhetzung entgegenkommt. Wiederum kann ich Ihnen nur uneingeschränkt beistimmen. Wir glauben an die Existenz eines solchen Triebes und haben uns gerade in den letzten Jahren bemüht, seine Äußerungen zu studieren. Darf ich Ihnen aus diesem Anlaß ein Stück der Trieblehre vortragen, zu der wir in der Psychoanalyse nach vielem Tasten und Schwanken gekommen sind? Wir nehmen an, daß die Triebe des Menschen nur von zweierlei Art sind, entweder solche, die erhalten und vereinigen wollen – wir heißen sie erotische, ganz im Sinne des Eros im Symposion Platos, oder sexuelle mit bewußter Überdehnung des populären Begriffs von Sexualität –, und andere, die zerstören und töten wollen; wir fassen diese als Aggressionstrieb oder Destruktionstrieb zusammen. Sie sehen, das ist eigentlich nur die theoretische Verklärung des weltbekannten Gegensatzes von Lieben und Hassen, der vielleicht zu der Polarität von Anziehung und Abstoßung eine Urbeziehung unterhält, die auf Ihrem Gebiet eine Rolle spielt. Nun lassen Sie uns nicht zu rasch mit den Wertungen von Gut und Böse einsetzen. Der eine dieser Triebe ist ebenso unerläßlich wie der andere, aus dem Zusammen- und Gegeneinanderwirken der beiden gehen die Erscheinungen des Lebens hervor. Nun scheint es, daß kaum jemals ein Trieb der einen Art sich isoliert betätigen kann, er ist immer mit einem gewissen Betrag von der anderen Seite verbunden, wie wir sagen: legiert, der sein Ziel modifiziert oder ihm unter Umständen dessen Erreichung erst möglich macht. So ist z. B. der Selbsterhaltungstrieb gewiß erotischer Natur, aber gerade er bedarf der Verfügung über die Aggression, wenn er seine Absicht durchsetzen soll. Ebenso benötigt der auf Objekte gerichtete Liebestrieb eines Zusatzes vom Bemächtigungstrieb, wenn er seines Objekts überhaupt habhaft werden soll. Die Schwierigkeit, die beiden Triebarten in ihren Äußerungen zu isolieren, hat uns ja so lange in ihrer Erkenntnis behindert.
Wenn Sie mit mir ein Stück weitergehen wollen, so hören Sie, daß die menschlichen Handlungen noch eine Komplikation von anderer Art erkennen lassen. Ganz selten ist die Handlung das Werk einer einzigen Triebregung, die an und für sich bereits aus Eros und Destruktion zusammengesetzt sein muß. In der Regel müssen mehrere in der gleichen Weise aufgebaute Motive zusammentreffen, um die Handlung zu ermöglichen. Einer Ihrer Fachgenossen hat das bereits gewußt, ein Prof. G. Ch. Lichtenberg, der zur Zeit unserer Klassiker in Göttingen Physik lehrte; aber vielleicht war er als Psycholog noch bedeutender denn als Physiker. Er erfand die Motivenrose, indem er sagte: »Die Bewegungsgründe [Fußnote]Wir sagen heute: Beweggründe., woraus man etwas tut, könnten so wie die 32 Winde geordnet und ihre Namen auf eine ähnliche Art formiert werden, z. B. Brot – Brot – Ruhm oder Ruhm – Ruhm – Brot.« Wenn also die Menschen zum Krieg aufgefordert werden, so mögen eine ganze Anzahl von Motiven in ihnen zustimmend antworten, edle und gemeine, solche, von denen man laut spricht, und andere, die man beschweigt. Wir haben keinen Anlaß, sie alle bloßzulegen. Die Lust an der Aggression und Destruktion ist gewiß darunter; ungezählte Grausamkeiten der Geschichte und des Alltags bekräftigen ihre Existenz und ihre Stärke. Die Verquickung dieser destruktiven Strebungen mit anderen, erotischen und ideellen, erleichtert natürlich deren Befriedigung. Manchmal haben wir, wenn wir von den Greueltaten der Geschichte hören, den Eindruck, die ideellen Motive hätten den destruktiven Gelüsten nur als Vorwände gedient, andere Male, z. B. bei den Grausamkeiten der heiligen Inquisition, meinen wir, die ideellen Motive hätten sich im Bewußtsein vorgedrängt, die destruktiven ihnen eine unbewußte Verstärkung gebracht. Beides ist möglich.
Ich habe Bedenken, Ihr Interesse zu mißbrauchen, das ja der Kriegsverhütung gilt, nicht unseren Theorien. Doch möchte ich noch einen Augenblick bei unserem Destruktionstrieb verweilen, dessen Beliebtheit keineswegs Schritt hält mit seiner Bedeutung. Mit etwas Aufwand von Spekulation sind wir nämlich zu der Auffassung gelangt, daß dieser Trieb innerhalb jedes lebenden Wesens arbeitet und dann das Bestreben hat, es zum Zerfall zu bringen, das Leben zum Zustand der unbelebten Materie zurückzuführen. Er verdiente in allem Ernst den Namen eines Todestriebes, während die erotischen Triebe die Bestrebungen zum Leben repräsentieren. Der Todestrieb wird zum Destruktionstrieb, indem er mit Hilfe besonderer Organe nach außen, gegen die Objekte, gewendet wird. Das Lebewesen bewahrt sozusagen sein eigenes Leben dadurch, daß es fremdes zerstört. Ein Anteil des Todestriebes verbleibt aber im Innern des Lebewesens tätig, und wir haben versucht, eine ganze Anzahl von normalen und pathologischen Phänomenen von dieser Verinnerlichung des Destruktionstriebes abzuleiten. Wir haben sogar die Ketzerei begangen, die Entstehung unseres Gewissens durch eine solche Wendung der Aggression nach innen zu erklären. Sie merken, es ist gar nicht so unbedenklich, wenn sich dieser Vorgang in allzu großem Ausmaß vollzieht, es ist direkt ungesund, während die Wendung dieser Triebkräfte zur Destruktion in der Außenwelt das Lebewesen entlastet, wohltuend wirken muß. Das diene zur biologischen Entschuldigung all der häßlichen und gefährlichen Strebungen, gegen die wir ankämpfen. Man muß zugeben, sie sind der Natur näher als unser Widerstand dagegen, für den wir auch noch eine Erklärung finden müssen. Vielleicht haben Sie den Eindruck, unsere Theorien seien eine Art von Mythologie, nicht einmal eine erfreuliche in diesem Fall. Aber läuft nicht jede Naturwissenschaft auf eine solche Art von Mythologie hinaus? Geht es Ihnen heute in der Physik anders?
Aus dem Vorstehenden entnehmen wir für unsere nächsten Zwecke soviel, daß es keine Aussicht hat, die aggressiven Neigungen der Menschen abschaffen zu wollen. Es soll in glücklichen Gegenden der Erde, wo die Natur alles, was der Mensch braucht, überreichlich zur Verfügung stellt, Völkerstämme geben, deren Leben in Sanftmut verläuft, bei denen Zwang und Aggression unbekannt sind. Ich kann es kaum glauben, möchte gern mehr über diese Glücklichen erfahren. Auch die Bolschewisten hoffen, daß sie die menschliche Aggression zum Verschwinden bringen können dadurch, daß sie die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse verbürgen und sonst Gleichheit unter den Teilnehmern an der Gemeinschaft herstellen. Ich halte das für eine Illusion. Vorläufig sind sie auf das sorgfältigste bewaffnet und halten ihre Anhänger nicht zum mindesten durch den Haß gegen alle Außenstehenden zusammen. Übrigens handelt es sich, wie Sie selbst bemerken, nicht darum, die menschliche Aggressionsneigung völlig zu beseitigen; man kann versuchen, sie so weit abzulenken, daß sie nicht ihren Ausdruck im Kriege finden muß.
Von unserer mythologischen Trieblehre her finden wir leicht eine Formel für die indirekten Wege zur Bekämpfung des Krieges. Wenn die Bereitwilligkeit zum Krieg ein Ausfluß des Destruktionstriebs ist, so liegt es nahe, gegen sie den Gegenspieler dieses Triebes, den Eros, anzurufen. Alles, was Gefühlsbindungen unter den Menschen herstellt, muß dem Krieg entgegenwirken. Diese Bindungen können von zweierlei Art sein. Erstens Beziehungen wie zu einem Liebesobjekt, wenn auch ohne sexuelle Ziele. Die Psychoanalyse braucht sich nicht zu schämen, wenn sie hier von Liebe spricht, denn die Religion sagt dasselbe: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.« Das ist nun leicht gefordert, aber schwer zu erfüllen. Die andere Art von Gefühlsbindung ist die durch Identifizierung. Alles, was bedeutsame Gemeinsamkeiten unter den Menschen herstellt, ruft solche Gemeingefühle, Identifizierungen, hervor. Auf ihnen ruht zum guten Teil der Aufbau der menschlichen Gesellschaft.
Einer Klage von Ihnen über den Mißbrauch der Autorität entnehme ich einen zweiten Wink zur indirekten Bekämpfung der Kriegsneigung. Es ist ein Stück der angeborenen und nicht zu beseitigenden Ungleichheit der Menschen, daß sie in Führer und in Abhängige zerfallen. Die letzteren sind die übergroße Mehrheit, sie bedürfen einer Autorität, welche für sie Entscheidungen fällt, denen sie sich meist bedingungslos unterwerfen. Hier wäre anzuknüpfen, man müßte mehr Sorge als bisher aufwenden, um eine Oberschicht selbständig denkender, der Einschüchterung unzugänglicher, nach Wahrheit ringender Menschen zu erziehen, denen die Lenkung der unselbständigen Massen zufallen würde. Daß die Übergriffe der Staatsgewalten und das Denkverbot der Kirche einer solchen Aufzucht nicht günstig sind, bedarf keines Beweises. Der ideale Zustand wäre natürlich eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Triebleben der Diktatur der Vernunft unterworfen haben. Nichts anderes könnte eine so vollkommene und widerstandsfähige Einigung der Menschen hervorrufen, selbst unter Verzicht auf die Gefühlsbindungen zwischen ihnen. Aber das ist höchst wahrscheinlich eine utopische Hoffnung. Die anderen Wege einer indirekten Verhinderung des Krieges sind gewiß eher gangbar, aber sie versprechen keinen raschen Erfolg. Ungern denkt man an Mühlen, die so langsam mahlen, daß man verhungern könnte, ehe man das Mehl bekommt.
Sie sehen, es kommt nicht viel dabei heraus, wenn man bei dringenden praktischen Aufgaben den weltfremden Theoretiker zu Rate zieht. Besser, man bemüht sich in jedem einzelnen Fall, der Gefahr zu begegnen mit den Mitteln, die eben zur Hand sind. Ich möchte aber noch eine Frage behandeln, die Sie in Ihrem Schreiben nicht aufwerfen und die mich besonders interessiert. Warum empören wir uns so sehr gegen den Krieg, Sie und ich und so viele andere, warum nehmen wir ihn nicht hin wie eine andere der vielen peinlichen Notlagen des Lebens? Er scheint doch naturgemäß, biologisch wohlbegründet, praktisch kaum vermeidbar. Entsetzen Sie sich nicht über meine Fragestellung. Zum Zweck einer Untersuchung darf man vielleicht die Maske einer Überlegenheit vornehmen, über die man in Wirklichkeit nicht verfügt. Die Antwort wird lauten, weil jeder Mensch ein Recht auf sein eigenes Leben hat, weil der Krieg hoffnungsvolle Menschenleben vernichtet, den einzelnen Menschen in Lagen bringt, die ihn entwürdigen, ihn zwingt, andere zu morden, was er nicht will, kostbare materielle Werte, Ergebnis von Menschenarbeit, zerstört und anderes mehr. Auch daß der Krieg in seiner gegenwärtigen Gestaltung keine Gelegenheit mehr gibt, das alte heldische Ideal zu erfüllen, und daß ein zukünftiger Krieg infolge der Vervollkommnung der Zerstörungsmittel die Ausrottung eines oder vielleicht beider Gegner bedeuten würde. Das ist alles wahr und scheint so unbestreitbar, daß man sich nur verwundert, wenn das Kriegführen noch nicht durch allgemeine menschliche Übereinkunft verworfen worden ist. Man kann zwar über einzelne dieser Punkte diskutieren. Es ist fraglich, ob die Gemeinschaft nicht auch ein Recht auf das Leben des Einzelnen haben soll; man kann nicht alle Arten von Krieg in gleichem Maß verdammen; solange es Reiche und Nationen gibt, die zur rücksichtslosen Vernichtung anderer bereit sind, müssen diese anderen zum Krieg gerüstet sein. Aber wir wollen über all das rasch hinweggehen, das ist nicht die Diskussion, zu der Sie mich aufgefordert haben. Ich ziele auf etwas anderes hin; ich glaube, der Hauptgrund, weshalb wir uns gegen den Krieg empören, ist, daß wir nicht anders können. Wir sind Pazifisten, weil wir es aus organischen Gründen sein müssen. Wir haben es dann leicht, unsere Einstellung durch Argumente zu rechtfertigen.
Das ist wohl ohne Erklärung nicht zu verstehen. Ich meine das Folgende: Seit unvordenklichen Zeiten zieht sich über die Menschheit der Prozeß der Kulturentwicklung hin. (Ich weiß, andere heißen ihn lieber: Zivilisation.) Diesem Prozeß verdanken wir das Beste, was wir geworden sind, und ein gut Teil von dem, woran wir leiden. Seine Anlässe und Anfänge sind dunkel, sein Ausgang ungewiß, einige seiner Charaktere leicht ersichtlich. Vielleicht führt er zum Erlöschen der Menschenart, denn er beeinträchtigt die Sexualfunktion in mehr als einer Weise, und schon heute vermehren sich unkultivierte Rassen und zurückgebliebene Schichten der Bevölkerung stärker als hochkultivierte. Vielleicht ist dieser Prozeß mit der Domestikation gewisser Tierarten vergleichbar; ohne Zweifel bringt er körperliche Veränderungen mit sich; man hat sich noch nicht mit der Vorstellung vertraut gemacht, daß die Kulturentwicklung ein solcher organischer Prozeß sei. Die mit dem Kulturprozeß einhergehenden psychischen Veränderungen sind auffällig und unzweideutig. Sie bestehen in einer fortschreitenden Verschiebung der Triebziele und Einschränkung der Triebregungen. Sensationen, die unseren Vorahnen lustvoll waren, sind für uns indifferent oder selbst unleidlich geworden; es hat organische Begründungen, wenn unsere ethischen und ästhetischen Idealforderungen sich geändert haben. Von den psychologischen Charakteren der Kultur scheinen zwei die wichtigsten: die Erstarkung des Intellekts, der das Triebleben zu beherrschen beginnt, und die Verinnerlichung der Aggressionsneigung mit all ihren vorteilhaften und gefährlichen Folgen. Den psychischen Einstellungen, die uns der Kulturprozeß aufnötigt, widerspricht nun der Krieg in der grellsten Weise, darum müssen wir uns gegen ihn empören, wir vertragen ihn einfach nicht mehr, es ist nicht bloß eine intellektuelle und affektive Ablehnung, es ist bei uns Pazifisten eine konstitutionelle Intoleranz, eine Idiosynkrasie gleichsam in äußerster Vergrößerung. Und zwar scheint es, daß die ästhetischen Erniedrigungen des Krieges nicht viel weniger Anteil an unserer Auflehnung haben als seine Grausamkeiten.
Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die anderen Pazifisten werden? Es ist nicht zu sagen, aber vielleicht ist es keine utopische Hoffnung, daß der Einfluß dieser beiden Momente, der kulturellen Einstellung und der berechtigten Angst vor den Wirkungen eines Zukunftskrieges, dem Kriegführen in absehbarer Zeit ein Ende setzen wird. Auf welchen Wegen oder Umwegen, können wir nicht erraten. Unterdes dürfen wir uns sagen: Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg.
Ich grüße Sie herzlich und bitte Sie um Verzeihung, wenn meine Ausführungen Sie enttäuscht haben.
Ihr Sigm. Freud
Wege der psychoanalytischen Therapie (1919)
Meine Herren Kollegen!
Sie wissen, wir waren nie stolz auf die Vollständigkeit und Abgeschlossenheit unseres Wissens und Könnens; wir sind, wie früher so auch jetzt, immer bereit, die Unvollkommenheiten unserer Erkenntnis zuzugeben, Neues dazuzulernen und an unserem Vorgehen abzuändern, was sich durch Besseres ersetzen läßt.
Da wir nun nach langen, schwer durchlebten Jahren der Trennung wieder einmal zusammengetroffen sind, reizt es mich, den Stand unserer Therapie zu revidieren, der wir ja unsere Stellung in der menschlichen Gesellschaft danken, und Ausschau zu halten, nach welchen neuen Richtungen sie sich entwickeln könnte.
Wir haben als unsere ärztliche Aufgabe formuliert, den neurotisch Kranken zur Kenntnis der in ihm bestehenden unbewußten, verdrängten Regungen zu bringen und zu diesem Zwecke die Widerstände aufzudecken, die sich in ihm gegen solche Erweiterungen seines Wissens von der eigenen Person sträuben. Wird mit der Aufdeckung dieser Widerstände auch deren Überwindung gewährleistet? Gewiß nicht immer, aber wir hoffen, dieses Ziel zu erreichen, indem wir seine Übertragung auf die Person des Arztes ausnützen, um unsere Überzeugung von der Unzweckmäßigkeit der in der Kindheit vorgefallenen Verdrängungsvorgänge und von der Undurchführbarkeit eines Lebens nach dem Lustprinzip zu der seinigen werden zu lassen. Die dynamischen Verhältnisse des neuen Konflikts, durch den wir den Kranken führen, den wir an die Stelle des früheren Krankheitskonflikts bei ihm gesetzt haben, sind von mir an anderer Stelle klargelegt worden. Daran weiß ich derzeit nichts zu ändern.
Die Arbeit, durch welche wir dem Kranken das verdrängte Seelische in ihm zum Bewußtsein bringen, haben wir Psychoanalyse genannt. Warum »Analyse«, was Zerlegung, Zersetzung bedeutet und an eine Analogie mit der Arbeit des Chemikers an den Stoffen denken läßt, die er in der Natur vorfindet und in sein Laboratorium bringt? Weil eine solche Analogie in einem wichtigen Punkte wirklich besteht. Die Symptome und krankhaften Äußerungen des Patienten sind wie alle seine seelischen Tätigkeiten hochzusammengesetzter Natur; die Elemente dieser Zusammensetzung sind im letzten Grunde Motive, Triebregungen. Aber der Kranke weiß von diesen elementaren Motiven nichts oder nur sehr Ungenügendes. Wir lehren ihn nun die Zusammensetzung dieser hochkomplizierten seelischen Bildungen verstehen, führen die Symptome auf die sie motivierenden Triebregungen zurück, weisen diese dem Kranken bisher unbekannten Triebmotive in den Symptomen nach, wie der Chemiker den Grundstoff, das chemische Element, aus dem Salz ausscheidet, in dem es in Verbindung mit anderen Elementen unkenntlich geworden war. Und ebenso zeigen wir dem Kranken an seinen nicht für krankhaft gehaltenen seelischen Äußerungen, daß ihm deren Motivierung nur unvollkommen bewußt war, daß andere Triebmotive bei ihnen mitgewirkt haben, die ihm unerkannt geblieben sind.
Auch das Sexualstreben der Menschen haben wir erklärt, indem wir es in seine Komponenten zerlegten, und wenn wir einen Traum deuten, gehen wir so vor, daß wir den Traum als Ganzes vernachlässigen und die Assoziation an seine einzelnen Elemente anknüpfen.
Aus diesem berechtigten Vergleich der ärztlichen psychoanalytischen Tätigkeit mit einer chemischen Arbeit könnte sich nun eine Anregung zu einer neuen Richtung unserer Therapie ergeben. Wir haben den Kranken analysiert, das heißt seine Seelentätigkeit in ihre elementaren Bestandteile zerlegt, diese Triebelemente einzeln und isoliert in ihm aufgezeigt; was läge nun näher als zu fordern, daß wir ihm auch bei einer neuen und besseren Zusammensetzung derselben behilflich sein müssen? Sie wissen, diese Forderung ist auch wirklich erhoben worden. Wir haben gehört: Nach der Analyse des kranken Seelenlebens muß die Synthese desselben folgen! Und bald hat sich daran auch die Besorgnis geknüpft, man könnte zuviel Analyse und zuwenig Synthese geben, und das Bestreben, das Hauptgewicht der psychotherapeutischen Einwirkung auf diese Synthese, eine Art Wiederherstellung des gleichsam durch die Vivisektion Zerstörten, zu verlegen.
Ich kann aber nicht glauben, meine Herren, daß uns in dieser Psychosynthese eine neue Aufgabe zuwächst. Wollte ich mir gestatten, aufrichtig und unhöflich zu sein, so würde ich sagen, es handelt sich da um eine gedankenlose Phrase. Ich bescheide mich zu bemerken, daß nur eine inhaltsleere Überdehnung eines Vergleiches oder, wenn Sie wollen, eine unberechtigte Ausbeutung einer Namengebung vorliegt. Aber ein Name ist nur eine Etikette, zur Unterscheidung von anderem, ähnlichem, angebracht, kein Programm, keine Inhaltsangabe oder Definition. Und ein Vergleich braucht das Verglichene nur an einem Punkte zu tangieren und kann sich in allen anderen weit von ihm entfernen. Das Psychische ist etwas so einzig Besonderes, daß kein vereinzelter Vergleich seine Natur wiedergeben kann. Die psychoanalytische Arbeit bietet Analogien mit der chemischen Analyse, aber ebensolche mit dem Eingreifen des Chirurgen oder der Einwirkung des Orthopäden oder der Beeinflussung des Erziehers. Der Vergleich mit der chemischen Analyse findet seine Begrenzung darin, daß wir es im Seelenleben mit Strebungen zu tun haben, die einem Zwang zur Vereinheitlichung und Zusammenfassung unterliegen. Ist es uns gelungen, ein Symptom zu zersetzen, eine Triebregung aus einem Zusammenhange zu befreien, so bleibt sie nicht isoliert, sondern tritt sofort in einen neuen ein [Fußnote]Ereignet sich doch während der chemischen Analyse etwas ganz Ähnliches. Gleichzeitig mit den Isolierungen, die der Chemiker erzwingt, vollziehen sich von ihm ungewollte Synthesen dank der freigewordenen Affinitäten und der Wahlverwandtschaft der Stoffe..
Ja, im Gegenteil! Der neurotisch Kranke bringt uns ein zerrissenes, durch Widerstände zerklüftetes Seelenleben entgegen, und während wir daran analysieren, die Widerstände beseitigen, wächst dieses Seelenleben zusammen, fügt die große Einheit, die wir sein Ich heißen, sich alle die Triebregungen ein, die bisher von ihm abgespalten und abseits gebunden waren. So vollzieht sich bei dem analytisch Behandelten die Psychosynthese ohne unser Eingreifen, automatisch und unausweichlich. Durch die Zersetzung der Symptome und die Aufhebung der Widerstände haben wir die Bedingungen für sie geschaffen. Es ist nicht wahr, daß etwas in dem Kranken in seine Bestandteile zerlegt ist, was nun ruhig darauf wartet, bis wir es irgendwie zusammensetzen.
Die Entwicklung unserer Therapie wird also wohl andere Wege einschlagen, vor allem jenen, den kürzlich Ferenczi in seiner Arbeit über ›Technische Schwierigkeiten einer Hysterieanalyse‹ (1919) als die » Aktivität« des Analytikers gekennzeichnet hat.
Einigen wir uns rasch, was unter dieser Aktivität zu verstehen ist. Wir umschrieben unsere therapeutische Aufgabe durch die zwei Inhalte: Bewußtmachen des Verdrängten und Aufdeckung der Widerstände. Dabei sind wir allerdings aktiv genug. Aber sollen wir es dem Kranken überlassen, allein mit den ihm aufgezeigten Widerständen fertig zu werden? Können wir ihm dabei keine andere Hilfe leisten, als er durch den Antrieb der Übertragung erfährt? Liegt es nicht vielmehr sehr nahe, ihm auch dadurch zu helfen, daß wir ihn in jene psychische Situation versetzen, welche für die erwünschte Erledigung des Konflikts die günstigste ist? Seine Leistung ist doch auch abhängig von einer Anzahl von äußerlich konstellierenden Umständen. Sollen wir uns da bedenken, diese Konstellation durch unser Eingreifen in geeigneter Weise zu verändern? Ich meine, eine solche Aktivität des analytisch behandelnden Arztes ist einwandfrei und durchaus gerechtfertigt.
Sie bemerken, daß sich hier für uns ein neues Gebiet der analytischen Technik eröffnet, dessen Bearbeitung eingehende Bemühung erfordern und ganz bestimmte Vorschriften ergeben wird. Ich werde heute nicht versuchen, Sie in diese noch in Entwicklung begriffene Technik einzuführen, sondern mich damit begnügen, einen Grundsatz hervorzuheben, dem wahrscheinlich die Herrschaft auf diesem Gebiete zufallen wird. Er lautet: Die analytische Kur soll, soweit es möglich ist, in der Entbehrung – Abstinenz – durchgeführt werden.
Wieweit es möglich ist, dies festzustellen, bleibe einer detaillierten Diskussion überlassen. Unter Abstinenz ist aber nicht die Entbehrung einer jeglichen Befriedigung zu verstehen – das wäre natürlich undurchführbar –, auch nicht, was man im populären Sinne darunter versteht, die Enthaltung vom sexuellen Verkehr, sondern etwas anderes, was mit der Dynamik der Erkrankung und der Herstellung weit mehr zu tun hat.
Sie erinnern sich daran, daß es eine Versagung war, die den Patienten krank gemacht hat, daß seine Symptome ihm den Dienst von Ersatzbefriedigungen leisten. Sie können während der Kur beobachten, daß jede Besserung seines Leidenszustandes das Tempo der Herstellung verzögert und die Triebkraft verringert, die zur Heilung drängt. Auf diese Triebkraft können wir aber nicht verzichten; eine Verringerung derselben ist für unsere Heilungsabsicht gefährlich. Welche Folgerung drängt sich uns also unabweisbar auf? Wir müssen, so grausam es klingt, dafür sorgen, daß das Leiden des Kranken in irgendeinem wirksamen Maße kein vorzeitiges Ende finde. Wenn es durch die Zersetzung und Entwertung der Symptome ermäßigt worden ist, müssen wir es irgendwo anders als eine empfindliche Entbehrung wieder aufrichten, sonst laufen wir Gefahr, niemals mehr als bescheidene und nicht haltbare Besserungen zu erreichen.
Die Gefahr droht, soviel ich sehe, besonders von zwei Seiten. Einerseits ist der Patient, dessen Kranksein durch die Analyse erschüttert worden ist, aufs emsigste bemüht, sich an Stelle seiner Symptome neue Ersatzbefriedigungen zu schaffen, denen nun der Leidenscharakter abgeht. Er bedient sich der großartigen Verschiebbarkeit der zum Teil freigewordenen Libido, um die mannigfachsten Tätigkeiten, Vorlieben, Gewohnheiten, auch solche, die bereits früher bestanden haben, mit Libido zu besetzen und sie zu Ersatzbefriedigungen zu erheben. Er findet immer wieder neue solche Ablenkungen, durch welche die zum Betrieb der Kur erforderte Energie versickert, und weiß sie eine Zeitlang geheimzuhalten. Man hat die Aufgabe, alle diese Abwege aufzuspüren und jedesmal von ihm den Verzicht zu verlangen, so harmlos die zur Befriedigung führende Tätigkeit auch an sich erscheinen mag. Der Halbgeheilte kann aber auch minder harmlose Wege einschlagen, zum Beispiel indem er, wenn ein Mann, eine voreilige Bindung an ein Weib aufsucht. Nebenbei bemerkt, unglückliche Ehe und körperliches Siechtum sind die gebräuchlichsten Ablösungen der Neurose. Sie befriedigen insbesondere das Schuldbewußtsein (Strafbedürfnis), welches viele Kranke so zähe an ihrer Neurose festhalten läßt. Durch eine ungeschickte Ehewahl bestrafen sie sich selbst; langes organisches Kranksein nehmen sie als eine Strafe des Schicksals an und verzichten dann häufig auf eine Fortführung der Neurose.
Die Aktivität des Arztes muß sich in all solchen Situationen als energisches Einschreiten gegen die voreiligen Ersatzbefriedigungen äußern. Leichter wird ihm aber die Verwahrung gegen die zweite, nicht zu unterschätzende Gefahr, von der die Triebkraft der Analyse bedroht wird. Der Kranke sucht vor allem die Ersatzbefriedigung in der Kur selbst im Übertragungsverhältnis zum Arzt und kann sogar danach streben, sich auf diesem Wege für allen ihm sonst auferlegten Verzicht zu entschädigen. Einiges muß man ihm ja wohl gewähren, mehr oder weniger, je nach der Natur des Falles und der Eigenart des Kranken. Aber es ist nicht gut, wenn es zuviel wird. Wer als Analytiker etwa aus der Fülle seines hilfsbereiten Herzens dem Kranken alles spendet, was ein Mensch vom anderen erhoffen kann, der begeht denselben ökonomischen Fehler, dessen sich unsere nicht analytischen Nervenheilanstalten schuldig machen. Diese streben nichts anderes an, als es dem Kranken möglichst angenehm zu machen, damit er sich dort wohlfühle und gerne wieder aus den Schwierigkeiten des Lebens seine Zuflucht dorthin nehme. Dabei verzichten sie darauf, ihn für das Leben stärker, für seine eigentlichen Aufgaben leistungsfähiger zu machen. In der analytischen Kur muß jede solche Verwöhnung vermieden werden. Der Kranke soll, was sein Verhältnis zum Arzt betrifft, unerfüllte Wünsche reichlich übrigbehalten. Es ist zweckmäßig, ihm gerade die Befriedigungen zu versagen, die er am intensivsten wünscht und am dringendsten äußert.
Ich glaube nicht, daß ich den Umfang der erwünschten Aktivität des Arztes mit dem Satze: In der Kur sei die Entbehrung aufrechtzuhalten, erschöpft habe. Eine andere Richtung der analytischen Aktivität ist, wie Sie sich erinnern werden, bereits einmal ein Streitpunkt zwischen uns und der Schweizer Schule gewesen. Wir haben es entschieden abgelehnt, den Patienten, der sich hilfesuchend in unsere Hand begibt, zu unserem Leibgut zu machen, sein Schicksal für ihn zu formen, ihm unsere Ideale aufzudrängen und ihn im Hochmut des Schöpfers zu unserem Ebenbild, an dem wir Wohlgefallen haben sollen, zu gestalten. Ich halte an dieser Ablehnung auch heute noch fest und meine, daß hier die Stelle für die ärztliche Diskretion ist, über die wir uns in anderen Beziehungen hinwegsetzen müssen, habe auch erfahren, daß eine so weit gehende Aktivität gegen den Patienten für die therapeutische Absicht gar nicht erforderlich ist. Denn ich habe Leuten helfen können, mit denen mich keinerlei Gemeinsamkeit der Rasse, Erziehung, sozialen Stellung und Weltanschauung verband, ohne sie in ihrer Eigenart zu stören. Ich habe damals, zur Zeit jener Streitigkeiten, allerdings den Eindruck empfangen, daß der Einspruch unserer Vertreter – ich glaube, es war in erster Linie E. Jones – allzu schroff und unbedingt ausgefallen ist. Wir können es nicht vermeiden, auch Patienten anzunehmen, die so haltlos und existenzunfähig sind, daß man bei ihnen die analytische Beeinflussung mit der erzieherischen vereinigen muß, und auch bei den meisten anderen wird sich hie und da eine Gelegenheit ergeben, wo der Arzt als Erzieher und Ratgeber aufzutreten genötigt ist. Aber dies soll jedesmal mit großer Schonung geschehen, und der Kranke soll nicht zur Ähnlichkeit mit uns, sondern zur Befreiung und Vollendung seines eigenen Wesens erzogen werden.
Unser verehrter Freund J. Putnam in dem uns jetzt so feindlichen Amerika muß es uns verzeihen, wenn wir auch seine Forderung nicht annehmen können, die Psychoanalyse möge sich in den Dienst einer bestimmten philosophischen Weltanschauung stellen und diese dem Patienten zum Zwecke seiner Veredlung aufdrängen. Ich möchte sagen, dies ist doch nur Gewaltsamkeit, wenn auch durch die edelsten Absichten gedeckt.
Eine letzte, ganz anders geartete Aktivität wird uns durch die allmählich wachsende Einsicht aufgenötigt, daß die verschiedenen Krankheitsformen, die wir behandeln, nicht durch die nämliche Technik erledigt werden können. Es wäre voreilig, hierüber ausführlich zu handeln, aber an zwei Beispielen kann ich erläutern, inwiefern dabei eine neue Aktivität in Betracht kommt. Unsere Technik ist an der Behandlung der Hysterie erwachsen und noch immer auf diese Affektion eingerichtet. Aber schon die Phobien nötigen uns, über unser bisheriges Verhalten hinauszugehen. Man wird kaum einer Phobie Herr, wenn man abwartet, bis sich der Kranke durch die Analyse bewegen läßt, sie aufzugeben. Er bringt dann niemals jenes Material in die Analyse, das zur überzeugenden Lösung der Phobie unentbehrlich ist. Man muß anders vorgehen. Nehmen Sie das Beispiel eines Agoraphoben; es gibt zwei Klassen von solchen, eine leichtere und eine schwerere. Die ersteren haben zwar jedesmal unter der Angst zu leiden, wenn sie allein auf die Straße gehen, aber sie haben darum das Alleingehen noch nicht aufgegeben; die anderen schützen sich vor der Angst, indem sie auf das Alleingehen verzichten. Bei diesen letzteren hat man nur dann Erfolg, wenn man sie durch den Einfluß der Analyse bewegen kann, sich wieder wie Phobiker des ersten Grades zu benehmen, also auf die Straße zu gehen und während dieses Versuches mit der Angst zu kämpfen. Man bringt es also zunächst dahin, die Phobie so weit zu ermäßigen, und erst wenn dies durch die Forderung des Arztes erreicht ist, wird der Kranke jener Einfälle und Erinnerungen habhaft, welche die Lösung der Phobie ermöglichen.
Noch weniger angezeigt scheint ein passives Zuwarten bei den schweren Fällen von Zwangshandlungen, die ja im allgemeinen zu einem »asymptotischen« Heilungsvorgang, zu einer unendlichen Behandlungsdauer neigen, deren Analyse immer in Gefahr ist, sehr viel zutage zu fördern und nichts zu ändern. Es scheint mir wenig zweifelhaft, daß die richtige Technik hier nur darin bestehen kann abzuwarten, bis die Kur selbst zum Zwang geworden ist, und dann mit diesem Gegenzwang den Krankheitszwang gewaltsam zu unterdrücken. Sie verstehen aber, daß ich Ihnen in diesen zwei Fällen nur Proben der neuen Entwicklungen vorgelegt habe, denen unsere Therapie entgegengeht.
Und nun möchte ich zum Schlusse eine Situation ins Auge fassen, die der Zukunft angehört, die vielen von Ihnen phantastisch erscheinen wird, die aber doch verdient, sollte ich meinen, daß man sich auf sie in Gedanken vorbereitet. Sie wissen, daß unsere therapeutische Wirksamkeit keine sehr intensive ist. Wir sind nur eine Handvoll Leute, und jeder von uns kann auch bei angestrengter Arbeit sich in einem Jahr nur einer kleinen Anzahl von Kranken widmen. Gegen das Übermaß von neurotischem Elend, das es in der Welt gibt und vielleicht nicht zu geben braucht, kommt das, was wir davon wegschaffen können, quantitativ kaum in Betracht. Außerdem sind wir durch die Bedingungen unserer Existenz auf die wohlhabenden Oberschichten der Gesellschaft eingeschränkt, die ihre Ärzte selbst zu wählen pflegen und bei dieser Wahl durch alle Vorurteile von der Psychoanalyse abgelenkt werden. Für die breiten Volksschichten, die ungeheuer schwer unter den Neurosen leiden, können wir derzeit nichts tun.
Nun lassen Sie uns annehmen, durch irgendeine Organisation gelänge es uns, unsere Zahl so weit zu vermehren, daß wir zur Behandlung von größeren Menschenmassen ausreichen. Anderseits läßt sich vorhersehen: Irgendeinmal wird das Gewissen der Gesellschaft erwachen und sie mahnen, daß der Arme ein ebensolches Anrecht auf seelische Hilfeleistung hat wie bereits jetzt auf lebensrettende chirurgische. Und daß die Neurosen die Volksgesundheit nicht minder bedrohen als die Tuberkulose und ebensowenig wie diese der ohnmächtigen Fürsorge des einzelnen aus dem Volke überlassen werden können. Dann werden also Anstalten oder Ordinationsinstitute errichtet werden, an denen psychoanalytisch ausgebildete Ärzte angestellt sind, um die Männer, die sich sonst dem Trunk ergeben würden, die Frauen, die unter der Last der Entsagungen zusammenzubrechen drohen, die Kinder, denen nur die Wahl zwischen Verwilderung und Neurose bevorsteht, durch Analyse widerstands- und leistungsfähig zu erhalten. Diese Behandlungen werden unentgeltliche sein. Es mag lange dauern, bis der Staat diese Pflichten als dringende empfindet. Die gegenwärtigen Verhältnisse mögen den Termin noch länger hinausschieben, es ist wahrscheinlich, daß private Wohltätigkeit mit solchen Instituten den Anfang machen wird; aber irgendeinmal wird es dazu kommen müssen.
Dann wird sich für uns die Aufgabe ergeben, unsere Technik den neuen Bedingungen anzupassen. Ich zweifle nicht daran, daß die Triftigkeit unserer psychologischen Annahmen auch auf den Ungebildeten Eindruck machen wird, aber wir werden den einfachsten und greifbarsten Ausdruck unserer theoretischen Lehren suchen müssen. Wir werden wahrscheinlich die Erfahrung machen, daß der Arme noch weniger zum Verzicht auf seine Neurose bereit ist als der Reiche, weil das schwere Leben, das auf ihn wartet, ihn nicht lockt, und das Kranksein ihm einen Anspruch mehr auf soziale Hilfe bedeutet. Möglicherweise werden wir oft nur dann etwas leisten können, wenn wir die seelische Hilfeleistung mit materieller Unterstützung nach Art des Kaisers Josef vereinigen können. Wir werden auch sehr wahrscheinlich genötigt sein, in der Massenanwendung unserer Therapie das reine Gold der Analyse reichlich mit dem Kupfer der direkten Suggestion zu legieren, und auch die hypnotische Beeinflussung könnte dort wie bei der Behandlung der Kriegsneurotiker wieder eine Stelle finden. Aber wie immer sich auch diese Psychotherapie fürs Volk gestalten, aus welchen Elementen sie sich zusammensetzen mag, ihre wirksamsten und wichtigsten Bestandteile werden gewiß die bleiben, die von der strengen, der tendenzlosen Psychoanalyse entlehnt worden sind.
Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915)
I. Die Enttäuschung des Krieges
Von dem Wirbel dieser Kriegszeit gepackt, einseitig unterrichtet, ohne Distanz von den großen Veränderungen, die sich bereits vollzogen haben oder zu vollziehen beginnen, und ohne Witterung der sich gestaltenden Zukunft, werden wir selbst irre an der Bedeutung der Eindrücke, die sich uns aufdrängen, und an dem Werte der Urteile, die wir bilden. Es will uns scheinen, als hätte noch niemals ein Ereignis so viel kostbares Gemeingut der Menschheit zerstört, so viele der klarsten Intelligenzen verwirrt, so gründlich das Hohe erniedrigt. Selbst die Wissenschaft hat ihre leidenschaftslose Unparteilichkeit verloren; ihre aufs tiefste erbitterten Diener suchen ihr Waffen zu entnehmen, um einen Beitrag zur Bekämpfung des Feindes zu leisten. Der Anthropologe muß den Gegner für minderwertig und degeneriert erklären, der Psychiater die Diagnose seiner Geistes- oder Seelenstörung verkünden. Aber wahrscheinlich empfinden wir das Böse dieser Zeit unmäßig stark und haben kein Recht, es mit dem Bösen anderer Zeiten zu vergleichen, die wir nicht erlebt haben.
Der Einzelne, der nicht selbst ein Kämpfer und somit ein Partikelchen der riesigen Kriegsmaschinerie geworden ist, fühlt sich in seiner Orientierung verwirrt und in seiner Leistungsfähigkeit gehemmt. Ich meine, ihm wird jeder kleine Wink willkommen sein, der es ihm erleichtert, sich wenigstens in seinem eigenen Innern zurechtzufinden. Unter den Momenten, welche das seelische Elend der Daheimgebliebenen verschuldet haben und deren Bewältigung ihnen so schwierige Aufgaben stellt, möchte ich zwei hervorheben und an dieser Stelle behandeln: die Enttäuschung, die dieser Krieg hervorgerufen hat, und die veränderte Einstellung zum Tode, zu der er uns – wie alle anderen Kriege – nötigt. Wenn ich von Enttäuschung rede, weiß jedermann sofort, was damit gemeint ist. Man braucht kein Mitleidsschwärmer zu sein, man kann die biologische und psychologische Notwendigkeit des Leidens für die Ökonomie des Menschenlebens einsehen und darf doch den Krieg in seinen Mitteln und Zielen verurteilen und das Aufhören der Kriege herbeisehnen. Man sagte sich zwar, die Kriege könnten nicht aufhören, solange die Völker unter so verschiedenartigen Existenzbedingungen leben, solange die Wertungen des Einzellebens bei ihnen weit auseinandergehen und solange die Gehässigkeiten, welche sie trennen, so starke seelische Triebkräfte repräsentieren. Man war also darauf vorbereitet, daß Kriege zwischen den primitiven und den zivilisierten Völkern, zwischen den Menschenrassen, die durch die Hautfarbe voneinander geschieden werden, ja Kriege mit und unter den wenig entwickelten oder verwilderten Völkerindividuen Europas die Menschheit noch durch geraume Zeit in Anspruch nehmen werden. Aber man getraute sich etwas anderes zu hoffen. Von den großen weltbeherrschenden Nationen weißer Rasse, denen die Führung des Menschengeschlechtes zugefallen ist, die man mit der Pflege weltumspannender Interessen beschäftigt wußte, deren Schöpfungen die technischen Fortschritte in der Beherrschung der Natur wie die künstlerischen und wissenschaftlichen Kulturwerte sind, von diesen Völkern hatte man erwartet, daß sie es verstehen würden, Mißhelligkeiten und Interessenkonflikte auf anderem Wege zum Austrage zu bringen. Innerhalb jeder dieser Nationen waren hohe sittliche Normen für den Einzelnen aufgestellt worden, nach denen er seine Lebensführung einzurichten hatte, wenn er an der Kulturgemeinschaft teilnehmen wollte. Diese oft überstrengen Vorschriften forderten viel von ihm, eine ausgiebige Selbstbeschränkung, einen weitgehenden Verzicht auf Triebbefriedigung. Es war ihm vor allem versagt, sich der außerordentlichen Vorteile zu bedienen, die der Gebrauch von Lüge und Betrug im Wettkampfe mit den Nebenmenschen schafft. Der Kulturstaat hielt diese sittlichen Normen für die Grundlage seines Bestandes, er schritt ernsthaft ein, wenn man sie anzutasten wagte, erklärte es oft für untunlich, sie auch nur einer Prüfung durch den kritischen Verstand zu unterziehen. Es war also anzunehmen, daß er sie selbst respektieren wolle und nichts gegen sie zu unternehmen gedenke, wodurch er der Begründung seiner eigenen Existenz widersprochen hätte. Endlich konnte man zwar die Wahrnehmung machen, daß es innerhalb dieser Kulturnationen gewisse eingesprengte Völkerreste gäbe, die ganz allgemein unliebsam wären und darum nur widerwillig, auch nicht im vollen Umfange, zur Teilnahme an der gemeinsamen Kulturarbeit zugelassen würden, für die sie sich als genug geeignet erwiesen hatten. Aber die großen Völker selbst, konnte man meinen, hätten so viel Verständnis für ihre Gemeinsamkeiten und so viel Toleranz für ihre Verschiedenheiten erworben, daß »fremd« und »feindlich« nicht mehr wie noch im klassischen Altertume für sie zu einem Begriffe verschmelzen durften.
Vertrauend auf diese Einigung der Kulturvölker haben ungezählte Menschen ihren Wohnort in der Heimat gegen den Aufenthalt in der Fremde eingetauscht und ihre Existenz an die Verkehrsbeziehungen zwischen den befreundeten Völkern geknüpft. Wen aber die Not des Lebens nicht ständig an die nämliche Stelle bannte, der konnte sich aus allen Vorzügen und Reizen der Kulturländer ein neues, größeres Vaterland zusammensetzen, in dem er sich ungehemmt und unverdächtigt erging. Er genoß so das blaue und das graue Meer, die Schönheit der Schneeberge und die der grünen Wiesenflächen, den Zauber des nordischen Waldes und die Pracht der südlichen Vegetation, die Stimmung der Landschaften, auf denen große historische Erinnerungen ruhen, und die Stille der unberührten Natur. Dies neue Vaterland war für ihn auch ein Museum, erfüllt mit allen Schätzen, welche die Künstler der Kulturmenschheit seit vielen Jahrhunderten geschaffen und hinterlassen hatten. Während er von einem Saale dieses Museums in einen andern wanderte, konnte er in parteiloser Anerkennung feststellen, was für verschiedene Typen von Vollkommenheit Blutmischung, Geschichte und die Eigenart der Mutter Erde an seinen weiteren Kompatrioten ausgebildet hatten. Hier war die kühle unbeugsame Energie aufs höchste entwickelt, dort die graziöse Kunst, das Leben zu verschönern, anderswo der Sinn für Ordnung und Gesetz oder andere der Eigenschaften, die den Menschen zum Herrn der Erde gemacht haben.
Vergessen wir auch nicht, daß jeder Kulturweltbürger sich einen besonderen »Parnaß« und eine »Schule von Athen« geschaffen hatte. Unter den großen Denkern, Dichtern, Künstlern aller Nationen hatte er die ausgewählt, denen er das Beste zu schulden vermeinte, was ihm an Lebensgenuß und Lebensverständnis zugänglich geworden war, und sie den unsterblichen Alten in seiner Verehrung zugesellt wie den vertrauten Meistern seiner eigenen Zunge. Keiner von diesen Großen war ihm darum fremd erschienen, weil er in anderer Sprache geredet hatte, weder der unvergleichliche Ergründer der menschlichen Leidenschaften noch der schönheitstrunkene Schwärmer oder der gewaltig drohende Prophet, der feinsinnige Spötter, und niemals warf er sich dabei vor, abtrünnig geworden zu sein der eigenen Nation und der geliebten Muttersprache.
Der Genuß der Kulturgemeinschaft wurde gelegentlich durch Stimmen gestört, welche warnten, daß infolge altüberkommener Differenzen Kriege auch unter den Mitgliedern derselben unvermeidlich wären. Man wollte nicht daran glauben, aber wie stellte man sich einen solchen Krieg vor, wenn es dazu kommen sollte? Als eine Gelegenheit, die Fortschritte im Gemeingefühle der Menschen aufzuzeigen seit jener Zeit, da die griechischen Amphiktyonien verboten hatten, eine dem Bündnisse angehörige Stadt zu zerstören, ihre Ölbäume umzuhauen und ihr das Wasser abzuschneiden. Als einen ritterlichen Waffengang, der sich darauf beschränken wollte, die Überlegenheit des einen Teiles festzustellen, unter möglichster Vermeidung schwerer Leiden, die zu dieser Entscheidung nichts beitragen könnten, mit voller Schonung für den Verwundeten, der aus dem Kampfe ausscheiden muß, und für den Arzt und Pfleger, der sich seiner Herstellung widmet. Natürlich mit allen Rücksichten für den nicht kriegführenden Teil der Bevölkerung, für die Frauen, die dem Kriegshandwerk ferne bleiben, und für die Kinder, die, herangewachsen, einander von beiden Seiten Freunde und Mithelfer werden sollen. Auch mit Erhaltung all der internationalen Unternehmungen und Institutionen, in denen sich die Kulturgemeinschaft der Friedenszeit verkörpert hatte.
Ein solcher Krieg hätte immer noch genug des Schrecklichen und schwer zu Ertragenden enthalten, aber er hätte die Entwicklung ethischer Beziehungen zwischen den Großindividuen der Menschheit, den Völkern und Staaten, nicht unterbrochen.
Der Krieg, an den wir nicht glauben wollten, brach nun aus, und er brachte die – Enttäuschung. Er ist nicht nur blutiger und verlustreicher als einer der Kriege vorher, infolge der mächtig vervollkommneten Waffen des Angriffes und der Verteidigung, sondern mindestens ebenso grausam, erbittert, schonungslos wie irgendein früherer. Er setzt sich über alle Einschränkungen hinaus, zu denen man sich in friedlichen Zeiten verpflichtet, die man das Völkerrecht genannt hatte, anerkennt nicht die Vorrechte des Verwundeten und des Arztes, die Unterscheidung des friedlichen und des kämpfenden Teiles der Bevölkerung, die Ansprüche des Privateigentums. Er wirft nieder, was ihm im Wege steht, in blinder Wut, als sollte es keine Zukunft und keinen Frieden unter den Menschen nach ihm geben. Er zerreißt alle Bande der Gemeinschaft unter den miteinander ringenden Völkern und droht eine Erbitterung zu hinterlassen, welche eine Wiederanknüpfung derselben für lange Zeit unmöglich machen wird.
Er brachte auch das kaum begreifliche Phänomen zum Vorscheine, daß die Kulturvölker einander so wenig kennen und verstehen, daß sich das eine mit Haß und Abscheu gegen das andere wenden kann. Ja, daß eine der großen Kulturnationen so allgemein mißliebig ist, daß der Versuch gewagt werden kann, sie als »barbarisch« von der Kulturgemeinschaft: auszuschließen, obwohl sie ihre Eignung durch die großartigsten Beitragsleistungen längst erwiesen hat. Wir leben der Hoffnung, eine unparteiische Geschichtsschreibung werde den Nachweis erbringen, daß gerade diese Nation, die, in deren Sprache wir schreiben, für deren Sieg unsere Lieben kämpfen, sich am wenigsten gegen die Gesetze der menschlichen Gesittung vergangen habe, aber wer darf in solcher Zeit als Richter auftreten in eigener Sache?
Völker werden ungefähr durch die Staaten, die sie bilden, repräsentiert; diese Staaten durch die Regierungen, die sie leiten. Der einzelne Volksangehörige kann in diesem Kriege mit Schrecken feststellen, was sich ihm gelegentlich schon in Friedenszeiten aufdrängen wollte, daß der Staat dem Einzelnen den Gebrauch des Unrechts untersagt hat, nicht weil er es abschaffen, sondern weil er es monopolisieren will wie Salz und Tabak. Der kriegführende Staat gibt sich jedes Unrecht, jede Gewalttätigkeit frei, die den Einzelnen entehren würde. Er bedient sich nicht nur der erlaubten List, sondern auch der bewußten Lüge und des absichtlichen Betruges gegen den Feind, und dies zwar in einem Maße, welches das in früheren Kriegen Gebräuchliche zu übersteigen scheint. Der Staat fordert das Äußerste an Gehorsam und Aufopferung von seinen Bürgern, entmündigt sie aber dabei durch ein Übermaß von Verheimlichung und eine Zensur der Mitteilung und Meinungsäußerung, welche die Stimmung der so intellektuell Unterdrückten wehrlos macht gegen jede ungünstige Situation und jedes wüste Gerücht. Er löst sich los von Zusicherungen und Verträgen, durch die er sich gegen andere Staaten gebunden hatte, bekennt sich ungescheut zu seiner Habgier und seinem Machtstreben, die dann der Einzelne aus Patriotismus gutheißen soll.
Man wende nicht ein, daß der Staat auf den Gebrauch des Unrechts nicht verzichten kann, weil er sich dadurch in Nachteil setzte. Auch für den Einzelnen ist die Befolgung der sittlichen Normen, der Verzicht auf brutale Machtbetätigung in der Regel sehr unvorteilhaft, und der Staat zeigt sich nur selten dazu fähig, den Einzelnen für das Opfer zu entschädigen, das er von ihm gefordert hat. Man darf sich auch nicht darüber verwundern, daß die Lockerung aller sittlichen Beziehungen zwischen den Großindividuen der Menschheit eine Rückwirkung auf die Sittlichkeit der Einzelnen geäußert hat, denn unser Gewissen ist nicht der unbeugsame Richter, für den die Ethiker es ausgeben, es ist in seinem Ursprünge » soziale Angst« und nichts anderes. Wo die Gemeinschaft den Vorwurf aufhebt, hört auch die Unterdrückung der bösen Gelüste auf, und die Menschen begehen Taten von Grausamkeit, Tücke, Verrat und Roheit, deren Möglichkeit man mit ihrem kulturellen Niveau für unvereinbar gehalten hätte.
So mag der Kulturweltbürger, den ich vorhin eingeführt habe, ratlos dastehen in der ihm fremd gewordenen Welt, sein großes Vaterland zerfallen, die gemeinsamen Besitztümer verwüstet, die Mitbürger entzweit und erniedrigt!
Zur Kritik seiner Enttäuschung wäre einiges zu bemerken. Sie ist, strengegenommen, nicht berechtigt, denn sie besteht in der Zerstörung einer Illusion. Illusionen empfehlen sich uns dadurch, daß sie Unlustgefühle ersparen und uns an ihrer Statt Befriedigungen genießen lassen. Wir müssen es dann ohne Klage hinnehmen, daß sie irgend einmal mit einem Stücke der Wirklichkeit zusammenstoßen, an dem sie zerschellen.
Zweierlei in diesem Kriege hat unsere Enttäuschung regegemacht: die geringe Sittlichkeit der Staaten nach außen, die sich nach innen als die Wächter der sittlichen Normen gebärden, und die Brutalität im Benehmen der Einzelnen, denen man als Teilnehmer an der höchsten menschlichen Kultur ähnliches nicht zugetraut hat.
Beginnen wir mit dem zweiten Punkte und versuchen wir es, die Anschauung, die wir kritisieren wollen, in einen einzigen knappen Satz zu fassen. Wie stellt man sich denn eigentlich den Vorgang vor, durch welchen ein einzelner Mensch zu einer höheren Stufe von Sittlichkeit gelangt? Die erste Antwort wird wohl lauten: Er ist eben von Geburt und von Anfang an gut und edel. Sie soll hier weiter nicht berücksichtigt werden. Eine zweite Antwort wird auf die Anregung eingehen, daß hier ein Entwicklungsvorgang vorliegen müsse, und wird wohl annehmen, diese Entwicklung bestehe darin, daß die bösen Neigungen des Menschen in ihm ausgerottet und unter dem Einflusse von Erziehung und Kulturumgebung durch Neigungen zum Guten ersetzt werden. Dann darf man sich allerdings verwundern, daß bei dem so Erzogenen das Böse wieder so tatkräftig zum Vorschein kommt.
Aber diese Antwort enthält auch den Satz, dem wir widersprechen wollen. In Wirklichkeit gibt es keine »Ausrottung« des Bösen. Die psychologische – im strengeren Sinne die psychoanalytische – Untersuchung zeigt vielmehr, daß das tiefste Wesen des Menschen in Triebregungen besteht, die elementarer Natur, bei allen Menschen gleichartig sind und auf die Befriedigung gewisser ursprünglicher Bedürfnisse zielen. Diese Triebregungen sind an sich weder gut noch böse. Wir klassifizieren sie und ihre Äußerungen in solcher Weise, je nach ihrer Beziehung zu den Bedürfnissen und Anforderungen der menschlichen Gemeinschaft. Zuzugeben ist, daß alle die Regungen, welche von der Gesellschaft als böse verpönt werden – nehmen wir als Vertretung derselben die eigensüchtigen und die grausamen – sich unter diesen primitiven befinden.
Diese primitiven Regungen legen einen langen Entwicklungsweg zurück, bis sie zur Betätigung beim Erwachsenen zugelassen werden. Sie werden gehemmt, auf andere Ziele und Gebiete gelenkt, gehen Verschmelzungen miteinander ein, wechseln ihre Objekte, wenden sich zum Teil gegen die eigene Person. Reaktionsbildungen gegen gewisse Triebe täuschen die inhaltliche Verwandlung derselben vor, als ob aus Egoismus – Altruismus, aus Grausamkeit – Mitleid geworden wäre. Diesen Reaktionsbildungen kommt zugute, daß manche Triebregungen fast von Anfang an in Gegensatzpaaren auftreten, ein sehr merkwürdiges und der populären Kenntnis fremdes Verhältnis, das man die »Gefühlsambivalenz« benannt hat. Am leichtesten zu beobachten und vom Verständnis zu bewältigen ist die Tatsache, daß starkes Lieben und starkes Hassen so häufig miteinander bei derselben Person vereint vorkommen. Die Psychoanalyse fügt dem zu, daß die beiden entgegengesetzten Gefühlsregungen nicht selten auch die nämliche Person zum Objekte nehmen.
Erst nach Überwindung all solcher »Triebschicksale« stellt sich das heraus, was man den Charakter eines Menschen nennt und was mit »gut« oder »böse« bekanntlich nur sehr unzureichend klassifiziert werden kann. Der Mensch ist selten im ganzen gut oder böse, meist »gut« in dieser Relation, »böse« in einer anderen oder »gut« unter solchen äußeren Bedingungen, unter anderen entschieden »böse«. Interessant ist die Erfahrung, daß die kindliche Präexistenz starker »böser« Regungen oft geradezu die Bedingung wird für eine besonders deutliche Wendung des Erwachsenen zum »Guten«. Die stärksten kindlichen Egoisten können die hilfreichsten und aufopferungsfähigsten Bürger werden; die meisten Mitleidsschwärmer, Menschenfreunde, Tierschützer haben sich aus kleinen Sadisten und Tierquälern entwickelt.
Die Umbildung der »bösen« Triebe ist das Werk zweier im gleichen Sinne wirkenden Faktoren, eines inneren und eines äußeren. Der innere Faktor besteht in der Beeinflussung der bösen – sagen wir: eigensüchtigen – Triebe durch die Erotik, das Liebesbedürfnis des Menschen im weitesten Sinne genommen. Durch die Zumischung der erotischen Komponenten werden die eigensüchtigen Triebe in soziale umgewandelt. Man lernt das Geliebtwerden als einen Vorteil schätzen, wegen dessen man auf andere Vorteile verzichten darf. Der äußere Faktor ist der Zwang der Erziehung, welche die Ansprüche der kulturellen Umgebung vertritt und die dann durch die direkte Einwirkung des Kulturmilieus fortgesetzt wird. Kultur ist durch Verzicht auf Triebbefriedigung gewonnen worden und fordert von jedem neu Ankommenden, daß er denselben Triebverzicht leiste. Während des individuellen Lebens findet eine beständige Umsetzung von äußerem Zwange in inneren Zwang statt. Die Kultureinflüsse leiten dazu an, daß immer mehr von den eigensüchtigen Strebungen durch erotische Zusätze in altruistische, soziale verwandelt werden. Man darf endlich annehmen, daß aller innere Zwang, der sich in der Entwicklung des Menschen geltend macht, ursprünglich, d. h. in der Menschheitsgeschichte nur äußerer Zwang war. Die Menschen, die heute geboren werden, bringen ein Stück Neigung (Disposition) zur Umwandlung der egoistischen in soziale Triebe als ererbte Organisation mit, die auf leichte Anstöße hin diese Umwandlung durchführt. Ein anderes Stück dieser Triebumwandlung muß im Leben selbst geleistet werden. In solcher Art steht der einzelne Mensch nicht nur unter der Einwirkung seines gegenwärtigen Kulturmilieus, sondern unterliegt auch dem Einflusse der Kulturgeschichte seiner Vorfahren.
Heißen wir die einem Menschen zukommende Fähigkeit zur Umbildung der egoistischen Triebe unter dem Einflüsse der Erotik seine Kultureignung, so können wir aussagen, daß dieselbe aus zwei Anteilen besteht, einem angeborenen und einem im Leben erworbenen, und daß das Verhältnis der beiden zueinander und zu dem unverwandelt gebliebenen Anteile des Trieblebens ein sehr variables ist.
Im allgemeinen sind wir geneigt, den angeborenen Anteil zu hoch zu veranschlagen, und überdies laufen wir Gefahr, die gesamte Kultureignung in ihrem Verhältnisse zum primitiv gebliebenen Triebleben zu überschätzen, d. h. wir werden dazu verleitet, die Menschen »besser« zu beurteilen, als sie in Wirklichkeit sind. Es besteht nämlich noch ein anderes Moment, welches unser Urteil trübt und das Ergebnis im günstigen Sinne verfälscht.
Die Triebregungen eines anderen Menschen sind unserer Wahrnehmung natürlich entrückt. Wir schließen auf sie aus seinen Handlungen und seinem Benehmen, welche wir auf Motive aus seinem Triebleben zurückführen. Ein solcher Schluß geht notwendigerweise in einer Anzahl von Fällen irre. Die nämlichen, kulturell »guten« Handlungen können das einemal von »edlen« Motiven herstammen, das anderemal nicht. Die theoretischen Ethiker heißen nur solche Handlungen »gut«, welche der Ausdruck guter Triebregungen sind, den anderen versagen sie ihre Anerkennung. Die von praktischen Absichten geleitete Gesellschaft kümmert sich aber im ganzen um diese Unterscheidung nicht; sie begnügt sich damit, daß ein Mensch sein Benehmen und seine Handlungen nach den kulturellen Vorschriften richte, und fragt wenig nach seinen Motiven.
Wir haben gehört, daß der äußere Zwang, den Erziehung und Umgebung auf den Menschen üben, eine weitere Umbildung seines Trieblebens zum Guten, eine Wendung vom Egoismus zum Altruismus herbeiführt. Aber dies ist nicht die notwendige oder regelmäßige Wirkung des äußeren Zwanges. Erziehung und Umgebung haben nicht nur Liebesprämien anzubieten, sondern arbeiten auch mit Vorteilsprämien anderer Art, mit Lohn und Strafen. Sie können also die Wirkung äußern, daß der ihrem Einflüsse Unterliegende sich zum guten Handeln im kulturellen Sinne entschließt, ohne daß sich eine Triebveredlung, eine Umsetzung egoistischer in soziale Neigungen, in ihm vollzogen hat. Der Erfolg wird im groben derselbe sein; erst unter besonderen Verhältnissen wird es sich zeigen, daß der eine immer gut handelt, weil ihn seine Triebneigungen dazu nötigen, der andere nur gut ist, weil, insolange und insoweit dies kulturelle Verhalten seinen eigensüchtigen Absichten Vorteile bringt. Wir aber werden bei oberflächlicher Bekanntschaft mit den Einzelnen kein Mittel haben, die beiden Fälle zu unterscheiden, und gewiß durch unseren Optimismus verführt werden, die Anzahl der kulturell veränderten Menschen arg zu überschätzen.
Die Kulturgesellschaft, die die gute Handlung fordert und sich um die Triebbegründung derselben nicht kümmert, hat also eine große Zahl von Menschen zum Kulturgehorsam gewonnen, die dabei nicht ihrer Natur folgen. Durch diesen Erfolg ermutigt, hat sie sich verleiten lassen, die sittlichen Anforderungen möglichst hoch zu spannen, und so ihre Teilnehmer zu noch weiterer Entfernung von ihrer Triebveranlagung gezwungen. Diesen ist nun eine fortgesetzte Triebunterdrückung auferlegt, deren Spannung sich in den merkwürdigsten Reaktions- und Kompensationserscheinungen kundgibt. Auf dem Gebiete der Sexualität, wo solche Unterdrückung am wenigsten durchzuführen ist, kommt es so zu den Reaktionserscheinungen der neurotischen Erkrankungen. Der sonstige Druck der Kultur zeitigt zwar keine pathologischen Folgen, äußert sich aber in Charakterverbildungen und in der steten Bereitschaft der gehemmten Triebe, bei passender Gelegenheit zur Befriedigung durchzubrechen. Wer so genötigt wird, dauernd im Sinne von Vorschriften zu reagieren, die nicht der Ausdruck seiner Triebneigungen sind, der lebt, psychologisch verstanden, über seine Mittel und darf objektiv als Heuchler bezeichnet werden, gleichgültig ob ihm diese Differenz klar bewußt worden ist oder nicht. Es ist unleugbar, daß unsere gegenwärtige Kultur die Ausbildung dieser Art von Heuchelei in außerordentlichem Umfange begünstigt. Man könnte die Behauptung wagen, sie sei auf solcher Heuchelei aufgebaut und müßte sich tiefgreifende Abänderungen gefallen lassen, wenn es die Menschen unternehmen würden, der psychologischen Wahrheit nachzuleben. Es gibt also ungleich mehr Kulturheuchler als wirklich kulturelle Menschen, ja man kann den Standpunkt diskutieren, ob ein gewisses Maß von Kulturheuchelei nicht zur Aufrechterhaltung der Kultur unerläßlich sei, weil die bereits organisierte Kultureignung der heute lebenden Menschen vielleicht für diese Leistung nicht zureichen würde. Anderseits bietet die Aufrechterhaltung der Kultur auch auf so bedenklicher Grundlage die Aussicht, bei jeder neuen Generation eine weitergehende Triebumbildung als Trägerin einer besseren Kultur anzubahnen.
Den bisherigen Erörterungen entnehmen wir bereits den einen Trost, daß unsere Kränkung und schmerzliche Enttäuschung wegen des unkulturellen Benehmens unserer Weltmitbürger, in diesem Kriege unberechtigt waren. Sie beruhten auf einer Illusion, der wir uns gefangen gaben. In Wirklichkeit sind sie nicht so tief gesunken, wie wir fürchten, weil sie gar nicht so hoch gestiegen waren, wie wir's von ihnen glaubten. Daß die menschlichen Großindividuen, die Völker und Staaten, die sittlichen Beschränkungen gegeneinander fallenließen, wurde ihnen zur begreiflichen Anregung, sich für eine Weile dem bestehenden Drucke der Kultur zu entziehen und ihren zurückgehaltenen Trieben vorübergehend Befriedigung zu gönnen. Dabei geschah ihrer relativen Sittlichkeit innerhalb ihres Volkstumes wahrscheinlich kein Abbruch.
Wir können uns aber das Verständnis der Veränderung, die der Krieg an unseren früheren Kompatrioten zeigt, noch vertiefen und empfangen dabei eine Warnung, kein Unrecht an ihnen zu begehen. Seelische Entwicklungen besitzen nämlich eine Eigentümlichkeit, welche sich bei keinem anderen Entwicklungsvorgang mehr vorfindet. Wenn ein Dorf zur Stadt, ein Kind zum Manne heranwächst, so gehen dabei Dorf und Kind in Stadt und Mann unter. Nur die Erinnerung kann die alten Züge in das neue Bild einzeichnen; in Wirklichkeit sind die alten Materialien oder Formen beseitigt und durch neue ersetzt worden. Anders geht es bei einer seelischen Entwicklung zu. Man kann den nicht zu vergleichenden Sachverhalt nicht anders beschreiben als durch die Behauptung, daß jede frühere Entwicklungsstufe neben der späteren, die aus ihr geworden ist, erhalten bleibt; die Sukzession bedingt eine Koexistenz mit, obwohl es doch dieselben Materialien sind, an denen die ganze Reihenfolge von Veränderungen abgelaufen ist. Der frühere seelische Zustand mag sich jahrelang nicht geäußert haben, er bleibt doch so weit bestehen, daß er eines Tages wiederum die Äußerungsform der seelischen Kräfte werden kann, und zwar die einzige, als ob alle späteren Entwicklungen annulliert, rückgängig gemacht worden wären. Diese außerordentliche Plastizität der seelischen Entwicklungen ist in ihrer Richtung nicht unbeschränkt; man kann sie als eine besondere Fähigkeit zur Rückbildung – Regression – bezeichnen, denn es kommt wohl vor, daß eine spätere und höhere Entwicklungsstufe, die verlassen wurde, nicht wieder erreicht werden kann. Aber die primitiven Zustände können immer wiederhergestellt werden; das primitive Seelische ist im vollsten Sinne unvergänglich.
Die sogenannten Geisteskrankheiten müssen beim Laien den Eindruck hervorrufen, daß das Geistes- und Seelenleben der Zerstörung anheimgefallen sei. In Wirklichkeit betrifft die Zerstörung nur spätere Erwerbungen und Entwicklungen. Das Wesen der Geisteskrankheit besteht in der Rückkehr zu früheren Zuständen des Affektlebens und der Funktion. Ein ausgezeichnetes Beispiel für die Plastizität des Seelenlebens gibt der Schlafzustand, den wir allnächtlich anstreben. Seitdem wir auch tolle und verworrene Träume zu übersetzen verstehen, wissen wir, daß wir mit jedem Einschlafen unsere mühsam erworbene Sittlichkeit wie ein Gewand von uns werfen – um es am Morgen wieder anzutun. Diese Entblößung ist natürlich ungefährlich, weil wir durch den Schlafzustand gelähmt, zur Inaktivität verurteilt sind. Nur der Traum kann von der Regression unseres Gefühlslebens auf eine der frühesten Entwicklungsstufen Kunde geben. So ist es z. B. bemerkenswert, daß alle unsere Träume von rein egoistischen Motiven beherrscht werden. Einer meiner englischen Freunde vertrat diesen Satz vor einer wissenschaftlichen Versammlung in Amerika, worauf ihm eine anwesende Dame die Bemerkung machte, das möge vielleicht für Österreich richtig sein, aber sie dürfe von sich und ihren Freunden behaupten, daß sie auch noch im Traume altruistisch fühlen. Mein Freund, obwohl selbst ein Angehöriger der englischen Rasse, mußte auf Grund seiner eigenen Erfahrungen in der Traumanalyse der Dame energisch widersprechen: Im Traume sei auch die edle Amerikanerin ebenso egoistisch wie der Österreicher.
Es kann also auch die Triebumbildung, auf welcher unsere Kultureignung beruht, durch Einwirkungen des Lebens – dauernd oder zeitweilig – rückgängig gemacht werden. Ohne Zweifel gehören die Einflüsse des Krieges zu den Mächten, welche solche Rückbildung erzeugen können, und darum brauchen wir nicht allen jenen, die sich gegenwärtig unkulturell benehmen, die Kultureignung abzusprechen, und dürfen erwarten, daß sich ihre Triebveredlung in ruhigeren Zeiten wiederherstellen wird.
Vielleicht hat uns aber ein anderes Symptom bei unseren Weltmitbürgern nicht weniger überrascht und geschreckt als das so schmerzlich empfundene Herabsinken von ihrer ethischen Höhe. Ich meine die Einsichtslosigkeit, die sich bei den besten Köpfen zeigt, ihre Verstocktheit, Unzugänglichkeit gegen die eindringlichsten Argumente, ihre kritiklose Leichtgläubigkeit für die anfechtbarsten Behauptungen. Dies ergibt freilich ein trauriges Bild, und ich will ausdrücklich betonen, daß ich keineswegs als verblendeter Parteigänger alle intellektuellen Verfehlungen nur auf einer der beiden Seiten finde. Allein diese Erscheinung ist noch leichter zu erklären und weit weniger bedenklich als die vorhin gewürdigte. Menschenkenner und Philosophen haben uns längst belehrt, daß wir Unrecht daran tun, unsere Intelligenz als selbständige Macht zu schätzen und ihre Abhängigkeit vom Gefühlsleben zu übersehen. Unser Intellekt könne nur verläßlich arbeiten, wenn er den Einwirkungen starker Gefühlsregungen entrückt sei; im gegenteiligen Falle benehme er sich einfach wie ein Instrument zuhanden eines Willens und liefere das Resultat, das ihm von diesem aufgetragen sei. Logische Argumente seien also ohnmächtig gegen affektive Interessen, und darum sei das Streiten mit Gründen, die nach Falstaffs Wort so gemein sind wie Brombeeren, in der Welt der Interessen so unfruchtbar. Die psychoanalytische Erfahrung hat diese Behauptung womöglich noch unterstrichen. Sie kann alle Tage zeigen, daß sich die scharfsinnigsten Menschen plötzlich einsichtslos wie Schwachsinnige benehmen, sobald die verlangte Einsicht einem Gefühlswiderstand bei ihnen begegnet, aber auch alles Verständnis wiedererlangen, wenn dieser Widerstand überwunden ist. Die logische Verblendung, die dieser Krieg oft gerade bei den besten unserer Mitbürger hervorgezaubert hat, ist also ein sekundäres Phänomen, eine Folge der Gefühlserregung, und hoffentlich dazu bestimmt, mit ihr zu verschwinden.
Wenn wir solcher Art unsere uns entfremdeten Mitbürger wieder verstehen, werden wir die Enttäuschung, die uns die Großindividuen der Menschheit, die Völker, bereitet haben, um vieles leichter ertragen, denn an diese dürfen wir nur weit bescheidenere Ansprüche stellen. Dieselben wiederholen vielleicht die Entwicklung der Individuen und treten uns heute noch auf sehr primitiven Stufen der Organisation, der Bildung höherer Einheiten, entgegen. Dementsprechend ist das erziehliche Moment des äußeren Zwanges zur Sittlichkeit, welches wir beim Einzelnen so wirksam fanden, bei ihnen noch kaum nachweisbar. Wir hatten zwar gehofft, daß die großartige, durch Verkehr und Produktion hergestellte Interessengemeinschaft den Anfang eines solchen Zwanges ergeben werde, allein es scheint, die Völker gehorchen ihren Leidenschaften derzeit weit mehr als ihren Interessen. Sie bedienen sich höchstens der Interessen, um die Leidenschaften zu rationalisieren; sie schieben ihre Interessen vor, um die Befriedigung ihrer Leidenschaften begründen zu können. Warum die Völkerindividuen einander eigentlich geringschätzen, hassen, verabscheuen, und zwar auch in Friedenszeiten, und jede Nation die andere, das ist freilich rätselhaft. Ich weiß es nicht zu sagen. Es ist in diesem Falle geradeso, als ob sich alle sittlichen Erwerbungen der Einzelnen auslöschten, wenn man eine Mehrheit oder gar Millionen Menschen zusammennimmt, und nur die primitivsten, ältesten und rohesten seelischen Einstellungen übrigblieben. An diesen bedauerlichen Verhältnissen werden vielleicht erst späte Entwicklungen etwas ändern können. Aber etwas mehr Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit allerseits, in den Beziehungen der Menschen zueinander und zwischen ihnen und den sie Regierenden, dürfte auch für diese Umwandlung die Wege ebnen.
II. Unser Verhältnis zum Tode
Das zweite Moment, von dem ich es ableite, daß wir uns so befremdet fühlen in dieser einst so schönen und trauten Welt, ist die Störung des bisher von uns festgehaltenen Verhältnisses zum Tode. Dies Verhältnis war kein aufrichtiges. Wenn man uns anhörte, so waren wir natürlich bereit zu vertreten, daß der Tod der notwendige Ausgang alles Lebens sei, daß jeder von uns der Natur einen Tod schulde und vorbereitet sein müsse, die Schuld zu bezahlen, kurz, daß der Tod natürlich sei, unableugbar und unvermeidlich. In Wirklichkeit pflegten wir uns aber zu benehmen, als ob es anders wäre. Wir haben die unverkennbare Tendenz gezeigt, den Tod beiseite zu schieben, ihn aus dem Leben zu eliminieren. Wir haben versucht, ihn totzuschweigen; wir besitzen ja auch das Sprichwort: man denke an etwas wie an den Tod. Wie an den eigenen natürlich. Der eigene Tod ist ja auch unvorstellbar, und sooft wir den Versuch dazu machen, können wir bemerken, daß wir eigentlich als Zuschauer weiter dabeibleiben. So konnte in der psychoanalytischen Schule der Ausspruch gewagt werden: im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod oder, was dasselbe ist: im Unbewußten sei jeder von uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt. Was den Tod eines anderen betrifft, so wird der Kulturmensch es sorgfältig vermeiden, von dieser Möglichkeit zu sprechen, wenn der zum Tode Bestimmte es hören kann. Nur Kinder setzen sich über diese Beschränkung hinweg; sie drohen einander ungescheut mit den Chancen des Sterbens und bringen es auch zustande, einer geliebten Person dergleichen ins Gesicht zu sagen, wie z. B.: »Liebe Mama, wenn du leider gestorben sein wirst, werde ich dies oder jenes.« Der erwachsene Kultivierte wird den Tod eines anderen auch nicht gern in seine Gedanken einsetzen, ohne sich hart oder böse zu erscheinen; es sei denn, daß er berufsmäßig als Arzt, Advokat u. dgl. mit dem Tode zu tun habe. Am wenigsten wird er sich gestatten, an den Tod des anderen zu denken, wenn mit diesem Ereignis ein Gewinn an Freiheit, Besitz, Stellung verbunden ist. Natürlich lassen sich Todesfälle durch dies unser Zartgefühl nicht zurückhalten; wenn sie sich ereignet haben, sind wir jedesmal tief ergriffen und wie in unseren Erwartungen erschüttert. Wir betonen regelmäßig die zufällige Veranlassung des Todes, den Unfall, die Erkrankung, die Infektion, das hohe Alter, und verraten so unser Bestreben, den Tod von einer Notwendigkeit zu einer Zufälligkeit herabzudrücken. Eine Häufung von Todesfällen erscheint uns als etwas überaus Schreckliches. Dem Verstorbenen selbst bringen wir ein besonderes Verhalten entgegen, fast wie eine Bewunderung für einen, der etwas sehr Schwieriges zustande gebracht hat. Wir stellen die Kritik gegen ihn ein, sehen ihm sein etwaiges Unrecht nach, geben den Befehl aus: De mortuis nil nisi bene, und finden es gerechtfertigt, daß man ihm in der Leichenrede und auf dem Grabsteine das Vorteilhafteste nachrühmt. Die Rücksicht auf den Toten, deren er doch nicht mehr bedarf, steht uns über der Wahrheit, den meisten von uns gewiß auch über der Rücksicht für den Lebenden.
Diese kulturell-konventionelle Einstellung gegen den Tod ergänzt sich nun durch unseren völligen Zusammenbruch, wenn das Sterben eine der uns nahestehenden Personen, einen Eltern- oder Gattenteil, ein Geschwister, Kind oder teuren Freund getroffen hat. Wir begraben mit ihm unsere Hoffnungen, Ansprüche, Genüsse, lassen uns nicht trösten und weigern uns, den Verlorenen zu ersetzen. Wir benehmen uns dann wie eine Art von Asra, welche mitsterben, wenn die sterben, die sie lieben.
Dies unser Verhältnis zum Tode hat aber eine starke Wirkung auf unser Leben. Das Leben verarmt, es verliert an Interesse, wenn der höchste Einsatz in den Lebensspielen, eben das Leben selbst, nicht gewagt werden darf. Es wird so schal, gehaltlos wie etwa ein amerikanischer Flirt, bei dem es von vornherein feststeht, daß nichts vorfallen darf, zum Unterschied von einer kontinentalen Liebesbeziehung, bei welcher beide Partner stets der ernsten Konsequenzen eingedenk bleiben müssen. Unsere Gefühlsbindungen, die unerträgliche Intensität unserer Trauer, machen uns abgeneigt, für uns und die unserigen Gefahren aufzusuchen. Wir getrauen uns nicht, eine Anzahl von Unternehmungen in Betracht zu ziehen, die gefährlich, aber eigentlich unerläßlich sind wie Flugversuche, Expeditionen in ferne Länder, Experimente mit explodierbaren Substanzen. Uns lähmt dabei das Bedenken, wer der Mutter den Sohn, der Gattin den Mann, den Kindern den Vater ersetzen soll, wenn ein Unglück geschieht. Die Neigung, den Tod aus der Lebensrechnung auszuschließen, hat so viele andere Verzichte und Ausschließungen im Gefolge. Und doch hat der Wahlspruch der Hansa gelautet: Navigare necesse est, vivere non necesse! Seefahren muß man, leben muß man nicht.
Es kann dann nicht anders kommen, als daß wir in der Welt der Fiktion, in der Literatur, im Theater Ersatz suchen für die Einbuße des Lebens. Dort finden wir noch Menschen, die zu sterben verstehen, ja, die es auch zustande bringen, einen anderen zu töten. Dort allein erfüllt sich uns auch die Bedingung, unter welcher wir uns mit dem Tode versöhnen könnten, wenn wir nämlich hinter allen Wechselfällen des Lebens noch ein unantastbares Leben übrigbehielten. Es ist doch zu traurig, daß es im Leben zugehen kann wie im Schachspiel, wo ein falscher Zug uns zwingen kann, die Partie verloren zu geben, mit dem Unterschiede aber, daß wir keine zweite, keine Revanchepartie beginnen können. Auf dem Gebiete der Fiktion finden wir jene Mehrheit von Leben, deren wir bedürfen. Wir sterben in der Identifizierung mit dem einen Helden, überleben ihn aber doch und sind bereit, ebenso ungeschädigt ein zweites Mal mit einem anderen Helden zu sterben.
Es ist evident, daß der Krieg diese konventionelle Behandlung des Todes hinwegfegen muß. Der Tod läßt sich jetzt nicht mehr verleugnen; man muß an ihn glauben. Die Menschen sterben wirklich, auch nicht mehr einzeln, sondern viele, oft Zehntausende an einem Tage. Es ist auch kein Zufall mehr. Es scheint freilich noch zufällig, ob diese Kugel den einen trifft oder den anderen; aber diesen anderen mag leicht eine zweite Kugel treffen, die Häufung macht dem Eindruck des Zufälligen ein Ende. Das Leben ist freilich wieder interessant geworden, es hat seinen vollen Inhalt wiederbekommen.
Man müßte hier eine Scheidung in zwei Gruppen vornehmen, diejenigen, die selbst im Kampfe ihr Leben preisgeben, trennen von den anderen, die zu Hause geblieben sind und nur zu erwarten haben, einen ihrer Lieben an den Tod durch Verletzung, Krankheit oder Infektion zu verlieren. Es wäre gewiß sehr interessant, die Veränderungen in der Psychologie der Kämpfer zu studieren, aber ich weiß zu wenig darüber. Wir müssen uns an die zweite Gruppe halten, zu der wir selbst gehören. Ich sagte schon, daß ich meine, die Verwirrung und die Lähmung unserer Leistungsfähigkeit, unter denen wir leiden, seien wesentlich mitbestimmt durch den Umstand, daß wir unser bisheriges Verhältnis zum Tode nicht aufrechthalten können und ein neues noch nicht gefunden haben. Vielleicht hilft es uns dazu, wenn wir unsere psychologische Untersuchung auf zwei andere Beziehungen zum Tode richten, auf jene, die wir dem Urmenschen, dem Menschen der Vorzeit, zuschreiben dürfen, und jene andere, die in jedem von uns noch erhalten ist, aber sich unsichtbar für unser Bewußtsein in tieferen Schichten unseres Seelenlebens verbirgt.
Wie sich der Mensch der Vorzeit gegen den Tod verhalten, wissen wir natürlich nur durch Rückschlüsse und Konstruktionen, aber ich meine, daß diese Mittel uns ziemlich vertrauenswürdige Auskünfte ergeben haben.
Der Urmensch hat sich in sehr merkwürdiger Weise zum Tode eingestellt. Gar nicht einheitlich, vielmehr recht widerspruchsvoll. Er hat einerseits den Tod ernst genommen, ihn als Aufhebung des Lebens anerkannt und sich seiner in diesem Sinne bedient, anderseits aber auch den Tod geleugnet, ihn zu nichts herabgedrückt. Dieser Widerspruch wurde durch den Umstand ermöglicht, daß er zum Tode des anderen, des Fremden, des Feindes, eine radikal andere Stellung einnahm als zu seinem eigenen. Der Tod des anderen war ihm recht, galt ihm als Vernichtung des Verhaßten, und der Urmensch kannte kein Bedenken, ihn herbeizuführen. Er war gewiß ein sehr leidenschaftliches Wesen, grausamer und bösartiger als andere Tiere. Er mordete gerne und wie selbstverständlich. Den Instinkt, der andere Tiere davon abhalten soll, Wesen der gleichen Art zu töten und zu verzehren, brauchen wir ihm nicht zuzuschreiben.
Die Urgeschichte der Menschheit ist denn auch vom Morde erfüllt. Noch heute ist das, was unsere Kinder in der Schule als Weltgeschichte lernen, im wesentlichen eine Reihenfolge von Völkermorden. Das dunkle Schuldgefühl, unter dem die Menschheit seit Urzeiten steht, das sich in manchen Religionen zur Annahme einer Urschuld, einer Erbsünde, verdichtet hat, ist wahrscheinlich der Ausdruck einer Blutschuld, mit welcher sich die urzeitliche Menschheit beladen hat. Ich habe in meinem Buche Totem und Tabu (1912–13), den Winken von W. Robertson Smith, Atkinson und Ch. Darwin folgend, die Natur dieser alten Schuld erraten wollen und meine, daß noch die heutige christliche Lehre uns den Rückschluß auf sie ermöglicht. Wenn Gottes Sohn sein Leben opfern mußte, um die Menschheit von der Erbsünde zu erlösen, so muß nach der Regel der Talion, der Vergeltung durch Gleiches, diese Sünde eine Tötung, ein Mord gewesen sein. Nur dies konnte zu seiner Sühne das Opfer eines Lebens erfordern. Und wenn die Erbsünde ein Verschulden gegen Gott-Vater war, so muß das älteste Verbrechen der Menschheit ein Vatermord gewesen sein, die Tötung des Urvaters der primitiven Menschenhorde, dessen Erinnerungsbild später zur Gottheit verklärt wurde [Fußnote]Vgl. ›Die infantile Wiederkehr des Totemismus‹ (die letzte Abhandlung in Totem und Tabu)..
Der eigene Tod war dem Urmenschen gewiß ebenso unvorstellbar und unwirklich wie heute noch jedem von uns. Es ergab sich aber für ihn ein Fall, in dem die beiden gegensätzlichen Einstellungen zum Tode zusammenstießen und in Konflikt miteinander gerieten, und dieser Fall wurde sehr bedeutsam und reich an fernwirkenden Folgen. Er ereignete sich, wenn der Urmensch einen seiner Angehörigen sterben sah, sein Weib, sein Kind, seinen Freund, die er sicherlich ähnlich liebte wie wir die unseren, denn die Liebe kann nicht um vieles jünger sein als die Mordlust. Da mußte er in seinem Schmerz die Erfahrung machen, daß man auch selbst sterben könne, und sein ganzes Wesen empörte sich gegen dieses Zugeständnis; jeder dieser Lieben war ja doch ein Stück seines eigenen geliebten Ichs. Anderseits war ihm ein solcher Tod doch auch recht, denn in jeder der geliebten Personen stak auch ein Stück Fremdheit. Das Gesetz der Gefühlsambivalenz, das heute noch unsere Gefühlsbeziehungen zu den von uns geliebtesten Personen beherrscht, galt in Urzeiten gewiß noch uneingeschränkter. Somit waren diese geliebten Verstorbenen doch auch Fremde und Feinde gewesen, die einen Anteil von feindseligen Gefühlen bei ihm hervorgerufen hatten [Fußnote]Siehe ›Tabu und Ambivalenz‹ (die zweite Abhandlung in Totem und Tabu)..
Die Philosophen haben behauptet, das intellektuelle Rätsel, welches das Bild des Todes dem Urmenschen aufgab, habe sein Nachdenken erzwungen und sei der Ausgang jeder Spekulation geworden. Ich glaube, die Philosophen denken da zu – philosophisch, nehmen zu wenig Rücksicht auf die primär wirksamen Motive. Ich möchte darum die obige Behauptung einschränken und korrigieren: An der Leiche des erschlagenen Feindes wird der Urmensch triumphiert haben, ohne einen Anlaß zu finden, sich den Kopf über die Rätsel des Lebens und Todes zu zerbrechen. Nicht das intellektuelle Rätsel und nicht jeder Todesfall, sondern der Gefühlskonflikt beim Tode geliebter und dabei doch auch fremder und gehaßter Personen hat die Forschung der Menschen entbunden. Aus diesem Gefühlskonflikt wurde zunächst die Psychologie geboren. Der Mensch konnte den Tod nicht mehr von sich fernehalten, da er ihn in dem Schmerz um den Verstorbenen verkostet hatte, aber er wollte ihn doch nicht zugestehen, da er sich selbst nicht tot vorstellen konnte. So ließ er sich auf Kompromisse ein, gab den Tod auch für sich zu, bestritt ihm aber die Bedeutung der Lebensvernichtung, wofür ihm beim Tode des Feindes jedes Motiv gefehlt hatte. An der Leiche der geliebten Person ersann er die Geister, und sein Schuldbewußtsein ob der Befriedigung, die der Trauer beigemengt war, bewirkte, daß diese erstgeschaffenen Geister böse Dämonen wurden, vor denen man sich ängstigen mußte. Die Veränderungen des Todes legten ihm die Zerlegung des Individuums in einen Leib und in eine – ursprünglich mehrere – Seelen nahe; in solcher Weise ging sein Gedankengang dem Zersetzungsprozeß, den der Tod einleitet, parallel. Die fortdauernde Erinnerung an den Verstorbenen wurde die Grundlage der Annahme anderer Existenzformen, gab ihm die Idee eines Fortlebens nach dem anscheinenden Tode.
Diese späteren Existenzen waren anfänglich nur Anhängsel an die durch den Tod abgeschlossene, schattenhaft, inhaltsleer und bis in späte Zeiten hinauf geringgeschätzt; sie trugen noch den Charakter kümmerlicher Auskünfte. Wir erinnern, was die Seele des Achilleus dem Odysseus erwidert:
»Denn dich Lebenden einst verehrten wir, gleich den Göttern, Argos Söhn'; und jetzo gebietest du mächtig den Geistern, Wohnend allhier. Drum laß dich den Tod nicht reuen, Achilleus.« Also ich selbst; und sogleich antwortet' er, solches erwidernd: »Nicht mir rede vom Tod ein Trostwort, edler Odysseus! Lieber ja wollt' ich das Feld als Tagelöhner bestellen Einem dürftigen Mann, ohn' Erb' und eigenen Wohlstand, Als die sämtliche Schar der geschwundenen Toten beherrschen.« ( Odyssee XI, Verse 484–491.)
Oder in der kraftvollen, bitter-parodistischen Fassung von H. Heine
Der kleinste lebendige Philister Zu Stuckert am Neckar, viel glücklicher ist er, Als ich, der Pelide, der tote Held, Der Schattenfürst in der Unterwelt.
Erst später brachten es die Religionen zustande, diese Nachexistenz für die wertvollere, vollgültige auszugeben und das durch den Tod abgeschlossene Leben zu einer bloßen Vorbereitung herabzudrücken. Es war dann nur konsequent, wenn man auch das Leben in die Vergangenheit verlängerte, die früheren Existenzen, die Seelenwanderung und Wiedergeburt ersann, alles in der Absicht, dem Tode seine Bedeutung als Aufhebung des Lebens zu rauben. So frühzeitig hat die Verleugnung des Todes, die wir als konventionell-kulturell bezeichnet haben, ihren Anfang genommen.
An der Leiche der geliebten Person entstanden nicht nur die Seelenlehre, der Unsterblichkeitsglaube und eine mächtige Wurzel des menschlichen Schuldbewußtseins, sondern auch die ersten ethischen Gebote. Das erste und bedeutsamste Verbot des erwachenden Gewissens lautete: Du sollst nicht töten. Es war als Reaktion gegen die hinter der Trauer versteckte Haßbefriedigung am geliebten Toten gewonnen worden und wurde allmählich auf den ungeliebten Fremden und endlich auch auf den Feind ausgedehnt.
An letzterer Stelle wird es vom Kulturmenschen nicht mehr verspürt. Wenn das wilde Ringen dieses Krieges seine Entscheidung gefunden hat, wird jeder der siegreichen Kämpfer froh in sein Heim zurückkehren, zu seinem Weibe und Kindern, unverweilt und ungestört durch Gedanken an die Feinde, die er im Nahkampfe oder durch die fernwirkende Waffe getötet hat. Es ist bemerkenswert, daß sich die primitiven Völker, die noch auf der Erde leben und dem Urmenschen gewiß näher stehen als wir, in diesem Punkte anders verhalten – oder verhalten haben, solange sie noch nicht den Einfluß unserer Kultur erfahren hatten. Der Wilde – Australier, Buschmann, Feuerländer – ist keineswegs ein reueloser Mörder; wenn er als Sieger vom Kriegspfade heimkehrt, darf er sein Dorf nicht betreten und sein Weib nicht berühren, ehe er seine kriegerischen Mordtaten durch oft langwierige und mühselige Bußen gesühnt hat. Natürlich liegt die Erklärung aus seinem Aberglauben nahe; der Wilde fürchtet noch die Geisterrache der Erschlagenen. Aber die Geister der erschlagenen Feinde sind nichts anderes als der Ausdruck seines bösen Gewissens ob seiner Blutschuld; hinter diesem Aberglauben verbirgt sich ein Stück ethischer Feinfühligkeit, welches uns Kulturmenschen verlorengegangen ist [Fußnote]S. Totem und Tabu..
Fromme Seelen, welche unser Wesen gerne von der Berührung mit Bösem und Gemeinem ferne wissen möchten, werden gewiß nicht versäumen, aus der Frühzeitigkeit und Eindringlichkeit des Mordverbotes befriedigende Schlüsse zu ziehen auf die Stärke ethischer Regungen, welche uns eingepflanzt sein müssen. Leider beweist dieses Argument noch mehr für das Gegenteil. Ein so starkes Verbot kann sich nur gegen einen ebenso starken Impuls richten. Was keines Menschen Seele begehrt, braucht man nicht zu verbieten [Fußnote]Vgl. die glänzende Argumentation von Frazer (Freud, Totem und Tabu)., es schließt sich von selbst aus. Gerade die Betonung des Gebotes: Du sollst nicht töten, macht uns sicher, daß wir von einer unendlich langen Generationsreihe von Mördern abstammen, denen die Mordlust, wie vielleicht noch uns selbst, im Blute lag. Die ethischen Strebungen der Menschheit, an deren Stärke und Bedeutsamkeit man nicht zu nörgeln braucht, sind ein Erwerb der Menschengeschichte; in leider sehr wechselndem Ausmaße sind sie dann zum ererbten Besitze der heute lebenden Menschheit geworden.
Verlassen wir nun den Urmenschen und wenden wir uns dem Unbewußten im eigenen Seelenleben zu. Wir fußen hier ganz auf der Untersuchungsmethode der Psychoanalyse, der einzigen, die in solche Tiefen reicht. Wir fragen: Wie verhält sich unser Unbewußtes zum Problem des Todes? Die Antwort muß lauten: fast genauso wie der Urmensch. In dieser wie in vielen anderen Hinsichten lebt der Mensch der Vorzeit ungeändert in unserem Unbewußten fort. Also unser Unbewußtes glaubt nicht an den eigenen Tod, es gebärdet sich wie unsterblich. Was wir unser »Unbewußtes« heißen, die tiefsten, aus Triebregungen bestehenden Schichten unserer Seele, kennt überhaupt nichts Negatives, keine Verneinung – Gegensätze fallen in ihm zusammen – und kennt darum auch nicht den eigenen Tod, dem wir nur einen negativen Inhalt geben können. Dem Todesglauben kommt also nichts Triebhaftes in uns entgegen. Vielleicht ist dies sogar das Geheimnis des Heldentums. Die rationelle Begründung des Heldentums ruht auf dem Urteile, daß das eigene Leben nicht so wertvoll sein kann wie gewisse abstrakte und allgemeine Güter. Aber ich meine, häufiger dürfte das instinktive und impulsive Heldentum sein, welches von solcher Motivierung absieht und einfach nach der Zusicherung des Anzengruberschen Steinklopferhanns: » Es kann dir nix g'scheh'n«, den Gefahren trotzt. Oder jene Motivierung dient nur dazu, die Bedenken wegzuräumen, welche die dem Unbewußten entsprechende heldenhafte Reaktion hintanhalten können. Die Todesangst, unter deren Herrschaft wir häufiger stehen, als wir selbst wissen, ist dagegen etwas Sekundäres und meist aus Schuldbewußtsein hervorgegangen.
Anderseits anerkennen wir den Tod für Fremde und Feinde und verhängen ihn über sie ebenso bereitwillig und unbedenklich wie der Urmensch. Hier zeigt sich freilich ein Unterschied, den man in der Wirklichkeit für entscheidend erklären wird. Unser Unbewußtes führt die Tötung nicht aus, es denkt und wünscht sie bloß. Aber es wäre unrecht, diese psychische Realität im Vergleiche zur faktischen so ganz zu unterschätzen. Sie ist bedeutsam und folgenschwer genug. Wir beseitigen in unseren unbewußten Regungen täglich und stündlich alle, die uns im Wege stehen, die uns beleidigt und geschädigt haben. Das »Hol' ihn der Teufel«, das sich so häufig in scherzendem Unmute über unsere Lippen drängt und das eigentlich sagen will: »Hol' ihn der Tod«, in unserem Unbewußten ist es ernsthafter, kraftvoller Todeswunsch. Ja, unser Unbewußtes mordet selbst für Kleinigkeiten; wie die alte athenische Gesetzgebung des Drakon kennt es für Verbrechen keine andere Strafe als den Tod, und dies mit einer gewissen Konsequenz, denn jede Schädigung unseres allmächtigen und selbstherrlichen Ichs ist im Grunde ein crimen laesae majestatis.
So sind wir auch selbst, wenn man uns nach unseren unbewußten Wunschregungen beurteilt, wie die Urmenschen eine Rotte von Mördern. Es ist ein Glück, daß alle diese Wünsche nicht die Kraft besitzen, die ihnen die Menschen in Urzeiten noch zutrauten [Fußnote]Vgl. über »Allmacht der Gedanken« in Totem und Tabu.; in dem Kreuzfeuer der gegenseitigen Verwünschungen wäre die Menschheit längst zugrunde gegangen, die besten und weisesten der Männer darunter wie die schönsten und holdesten der Frauen.
Mit Aufstellungen wie diesen findet die Psychoanalyse bei den Laien meist keinen Glauben. Man weist sie als Verleumdungen zurück, welche gegen die Versicherungen des Bewußtseins nicht in Betracht kommen, und übersieht geschickt die geringen Anzeichen, durch welche sich auch das Unbewußte dem Bewußtsein zu verraten pflegt. Es ist darum am Platze, daraufhinzuweisen, daß viele Denker, die nicht von der Psychoanalyse beeinflußt sein konnten, die Bereitschaft unserer stillen Gedanken, mit Hinwegsetzung über das Mordverbot zu beseitigen, was uns im Wege steht, deutlich genug angeklagt haben. Ich wähle hiefür ein einziges berühmt gewordenes Beispiel an Stelle vieler anderer:
Im Père Goriot spielt Balzac auf eine Stelle in den Werken J. J. Rousseaus an, in welcher dieser Autor den Leser fragt, was er wohl tun würde, wenn er – ohne Paris zu verlassen und natürlich ohne entdeckt zu werden – einen alten Mandarin in Peking durch einen bloßen Willensakt töten könnte, dessen Ableben ihm einen großen Vorteil einbringen müßte. Er läßt erraten, daß er das Leben dieses Würdenträgers für nicht sehr gesichert hält. » Tuer son mandarin« ist dann sprichwörtlich geworden für diese geheime Bereitschaft auch der heutigen Menschen.
Es gibt auch eine ganze Anzahl von zynischen Witzen und Anekdoten, welche nach derselben Richtung Zeugnis ablegen, wie z. B. die dem Ehemanne zugeschriebene Äußerung: »Wenn einer von uns beiden stirbt, übersiedle ich nach Paris.« Solche zynische Witze wären nicht möglich, wenn sie nicht eine verleugnete Wahrheit mitzuteilen hätten, zu der man sich nicht bekennen darf, wenn sie ernsthaft und unverhüllt ausgesprochen wird. Im Scherz darf man bekanntlich sogar die Wahrheit sagen.
Wie für den Urmenschen, so ergibt sich auch für unser Unbewußtes ein Fall, in dem die beiden entgegengesetzten Einstellungen gegen den Tod, die eine, welche ihn als Lebensvernichtung anerkennt, und die andere, die ihn als unwirklich verleugnet, zusammenstoßen und in Konflikt geraten. Und dieser Fall ist der nämliche wie in der Urzeit, der Tod oder die Todesgefahr eines unserer Lieben, eines Eltern- oder Gattenteils, eines Geschwisters, Kindes oder lieben Freundes. Diese Lieben sind uns einerseits ein innerer Besitz, Bestandteile unseres eigenen Ichs, anderseits aber auch teilweise Fremde, ja Feinde. Den zärtlichsten und innigsten unserer Liebesbeziehungen hängt mit Ausnahme ganz weniger Situationen ein Stückchen Feindseligkeit an, welches den unbewußten Todeswunsch anregen kann. Aus diesem Ambivalenzkonflikt geht aber nicht wie dereinst die Seelenlehre und die Ethik hervor, sondern die Neurose, die uns tiefe Einblicke auch in das normale Seelenleben gestattet. Wie häufig haben die psychoanalytisch behandelnden Ärzte mit dem Symptom der überzärtlichen Sorge um das Wohl der Angehörigen oder mit völlig unbegründeten Selbstvorwürfen nach dem Tode einer geliebten Person zu tun gehabt. Das Studium dieser Vorfälle hat ihnen über die Verbreitung und Bedeutung der unbewußten Todeswünsche keinen Zweifel gelassen.
Der Laie empfindet ein außerordentliches Grauen vor dieser Gefühlsmöglichkeit und nimmt diese Abneigung als legitimen Grund zum Unglauben gegen die Behauptungen der Psychoanalyse. Ich meine mit Unrecht. Es wird keine Herabsetzung unseres Liebeslebens beabsichtigt, und es liegt auch keine solche vor. Unserem Verständnis wie unserer Empfindung liegt es freilich ferne, Liebe und Haß in solcher Weise miteinander zu verkoppeln, aber indem die Natur mit diesem Gegensatzpaar arbeitet, bringt sie es zustande, die Liebe immer wach und frisch zu erhalten, um sie gegen den hinter ihr lauernden Haß zu versichern. Man darf sagen, die schönsten Entfaltungen unseres Liebeslebens danken wir der Reaktion gegen den feindseligen Impuls, den wir in unserer Brust verspüren.
Resümieren wir nun: Unser Unbewußtes ist gegen die Vorstellung des eigenen Todes ebenso unzugänglich, gegen den Fremden ebenso mordlustig, gegen die geliebte Person ebenso zwiespältig (ambivalent) wie der Mensch der Urzeit. Wie weit haben wir uns aber in der konventionell-kulturellen Einstellung gegen den Tod von diesem Urzustände entfernt!
Es ist leicht zu sagen, wie der Krieg in diese Entzweiung eingreift. Er streift uns die späteren Kulturauflagerungen ab und läßt den Urmenschen in uns wieder zum Vorschein kommen. Er zwingt uns wieder, Helden zu sein, die an den eigenen Tod nicht glauben können; er bezeichnet uns die Fremden als Feinde, deren Tod man herbeiführen oder herbeiwünschen soll; er rät uns, uns über den Tod geliebter Personen hinwegzusetzen. Der Krieg ist aber nicht abzuschaffen; solange die Existenzbedingungen der Völker so verschieden und die Abstoßungen unter ihnen so heftig sind, wird es Kriege geben müssen. Da erhebt sich denn die Frage: Sollen wir nicht diejenigen sein, die nachgeben und sich ihm anpassen? Sollen wir nicht zugestehen, daß wir mit unserer kulturellen Einstellung zum Tode psychologisch wieder einmal über unseren Stand gelebt haben, und vielmehr umkehren und die Wahrheit fatieren? Wäre es nicht besser, dem Tode den Platz in der Wirklichkeit und in unseren Gedanken einzuräumen, der ihm gebührt, und unsere unbewußte Einstellung zum Tode, die wir bisher so sorgfältig unterdrückt haben, ein wenig mehr hervorzukehren? Es scheint das keine Höherleistung zu sein, eher ein Rückschritt in manchen Stücken, eine Regression, aber es hat den Vorteil, der Wahrhaftigkeit mehr Rechnung zu tragen und uns das Leben wieder erträglicher zu machen. Das Leben zu ertragen bleibt ja doch die erste Pflicht aller Lebenden. Die Illusion wird wertlos, wenn sie uns darin stört.
Wir erinnern uns des alten Spruches: Si vis pacem, para bellum. Wenn du den Frieden erhalten willst, so rüste zum Kriege.
Es wäre zeitgemäß, ihn abzuändern: Si vis vitam, para mortem. Wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod ein.
Zur Ätiologie der Hysterie (1896)
Meine Herren! Wenn wir daran gehen, uns eine Meinung über die Verursachung eines krankhaften Zustandes wie die Hysterie zu bilden, betreten wir zunächst den Weg der anamnestischen Forschung, indem wir den Kranken oder dessen Umgebung ins Verhör darüber nehmen, auf welche schädlichen Einflüsse sie selbst die Erkrankung an jenen neurotischen Symptomen zurückführen. Was wir so in Erfahrung bringen, ist selbstverständlich durch alle jene Momente verfälscht, die einem Kranken die Erkenntnis des eigenen Zustandes zu verhüllen pflegen, durch seinen Mangel an wissenschaftlichem Verständnis für ätiologische Wirkungen, durch den Fehlschluß des post hoc, ergo propter hoc[Fußnote]danach, folglich dadurch, durch die Unlust, gewisser Noxen und Traumen zu gedenken oder ihrer Erwähnung zu tun. Wir halten darum bei solcher anamnestischer Forschung an dem Vorsatze fest, den Glauben der Kranken nicht ohne eingehende kritische Prüfung zu dem unserigen zu machen, nicht zuzulassen, daß die Patienten uns unsere wissenschaftliche Meinung über die Ätiologie der Neurose zurechtmachen. Wenn wir einerseits gewisse konstant wiederkehrende Angaben anerkennen, wie die, daß der hysterische Zustand eine lang andauernde Nachwirkung einer einmal erfolgten Gemütsbewegung sei, so haben wir anderseits in die Ätiologie der Hysterie ein Moment eingeführt, welches der Kranke selbst niemals vorbringt und nur ungern gelten läßt, die hereditäre Veranlagung von Seiten der Erzeuger. Sie wissen, daß nach der Meinung der einflußreichen Schule Charcots die Heredität allein als wirkliche Ursache der Hysterie Anerkennung verdient, während alle anderen Schädlichkeiten verschiedenartigster Natur und Intensität nur die Rolle von Gelegenheitsursachen, von » agents provocateurs« spielen sollen.
Sie werden mir ohneweiters zugeben, daß es wünschenswert wäre, es gäbe einen zweiten Weg, zur Ätiologie der Hysterie zu gelangen, auf welchem man sich unabhängiger von den Angaben der Kranken wüßte. Der Dermatologe z. B. weiß ein Geschwür als luetisch zu erkennen nach der Beschaffenheit der Ränder, des Belags, des Umrisses, ohne daß ihn der Einspruch des Patienten, der eine Infektionsquelle leugnet, daran irremachte. Der Gerichtsarzt versteht es, die Verursachung einer Verletzung aufzuklären, selbst wenn er auf die Mitteilungen des Verletzten verzichten muß. Es besteht nun eine solche Möglichkeit, von den Symptomen aus zur Kenntnis der Ursachen vorzudringen, auch für die Hysterie. Das Verhältnis der Methode aber, deren man sich hiefür zu bedienen hat, zur älteren Methode der anamnestischen Erhebung möchte ich Ihnen in einem Gleichnisse darstellen, welches einen auf anderem Arbeitsgebiete tatsächlich erfolgten Fortschritt zum Inhalt hat.
Nehmen Sie an, ein reisender Forscher käme in eine wenig bekannte Gegend, in welcher ein Trümmerfeld mit Mauerresten, Bruchstücken von Säulen, von Tafeln mit verwischten und unlesbaren Schriftzeichen sein Interesse erweckte. Er kann sich damit begnügen zu beschauen, was frei zutage liegt, dann die in der Nähe hausenden, etwa halbbarbarischen Einwohner ausfragen, was ihnen die Tradition über die Geschichte und Bedeutung jener monumentalen Reste kundgegeben hat, ihre Auskünfte aufzeichnen und – weiterreisen. Er kann aber auch anders vorgehen; er kann Hacken, Schaufeln und Spaten mitgebracht haben, die Anwohner für die Arbeit mit diesen Werkzeugen bestimmen, mit ihnen das Trümmerfeld in Angriff nehmen, den Schutt wegschaffen und von den sichtbaren Resten aus das Vergrabene aufdecken. Lohnt der Erfolg seine Arbeit, so erläutern die Funde sich selbst; die Mauerreste gehören zur Umwallung eines Palastes oder Schatzhauses, aus den Säulentrümmern ergänzt sich ein Tempel, die zahlreich gefundenen, im glücklichen Falle bilinguen Inschriften enthüllen ein Alphabet und eine Sprache, und deren Entzifferung und Übersetzung ergibt ungeahnte Aufschlüsse über die Ereignisse der Vorzeit, zu deren Gedächtnis jene Monumente erbaut worden sind. Saxa loquuntur![Fußnote]Die Steine sprechen!
Will man in annähernd ähnlicher Weise die Symptome einer Hysterie als Zeugen für die Entstehungsgeschichte der Krankheit laut werden lassen, so muß man an die bedeutsame Entdeckung J. Breuers anknüpfen, daß die Symptome der Hysterie (die Stigmata beiseite) ihre Determinierung von gewissen traumatisch wirksamen Erlebnissen des Kranken herleiten, als deren Erinnerungssymbole sie im psychischenLeben desselben reproduziert werden. Man muß sein Verfahren – oder ein im Wesen gleichartiges – anwenden, um die Aufmerksamkeit des Kranken vom Symptom aus auf die Szene zurückzuleiten, in welcher und durch welche das Symptom entstanden ist, und man beseitigt nach seiner Anweisung dieses Symptom, indem man bei der Reproduktion der traumatischen Szene eine nachträgliche Korrektur des damaligen psychischen Ablaufes durchsetzt.
Es liegt heute meiner Absicht völlig ferne, die schwierige Technik dieses therapeutischen Verfahrens oder die dabei gewonnenen psychologischen Aufklärungen zu behandeln. Ich mußte nur an dieser Stelle anknüpfen, weil die nach Breuer vorgenommenen Analysen gleichzeitig den Zugang zu den Ursachen der Hysterie zu eröffnen scheinen. Wenn wir eine größere Reihe von Symptomen bei zahlreichen Personen dieser Analyse unterziehen, so werden wir ja zur Kenntnis einer entsprechend großen Reihe von traumatisch wirksamen Szenen geleitet werden. In diesen Erlebnissen sind die wirksamen Ursachen der Hysterie zur Geltung gekommen; wir dürfen also hoffen, aus dem Studium der traumatischen Szenen zu erfahren, welche Einflüsse hysterische Symptome erzeugen und auf welche Weise.
Diese Erwartung trifft zu, notwendigerweise, da ja die Sätze von Breuer sich bei der Prüfung an zahlreicheren Fällen als richtig erweisen. Aber der Weg von den Symptomen der Hysterie zu deren Ätiologie ist langwieriger und führt über andere Verbindungen, als man sich vorgestellt hätte.
Wir wollen uns nämlich klarmachen, daß die Zurückführung eines hysterischen Symptoms auf eine traumatische Szene nur dann einen Gewinn für unser Verständnis mit sich bringt, wenn diese Szene zwei Bedingungen genügt, wenn sie die betreffende determinierende Eignung besitzt, und wenn ihr die nötige traumatische Kraft zuerkannt werden muß. Ein Beispiel anstatt jeder Worterklärung! Es handle sich um das Symptom des hysterischen Erbrechens; dann glauben wir dessen Verursachung (bis auf einen gewissen Rest) durchschauen zu können, wenn die Analyse das Symptom auf ein Erlebnis zurückführt, welches berechtigterweise ein hohes Maß von Ekel erzeugt hat, wie etwa der Anblick eines verwesenden menschlichen Leichnams. Ergibt die Analyse anstatt dessen, daß das Erbrechen von einem großen Schreck, z. B. bei einem Eisenbahnunfall, herrührt, so wird man sich unbefriedigt fragen müssen, wieso denn der Schreck gerade zum Erbrechen geführt hat. Es fehlt dieser Ableitung an der Eignung zur Determinierung. Ein anderer Fall von ungenügender Aufklärung liegt vor, wenn das Erbrechen etwa von dem Genuß einer Frucht herrühren soll, die eine faule Stelle zeigte. Dann ist zwar das Erbrechen durch den Ekel determiniert, aber man versteht nicht, wie der Ekel in diesem Falle so mächtig werden konnte, sich durch ein hysterisches Symptom zu verewigen; es mangelt diesem Erlebnisse an traumatischer Kraft.
Sehen wir nun nach, inwieweit die durch die Analyse aufgedeckten traumatischen Szenen der Hysterie bei einer größeren Anzahl von Symptomen und Fällen den beiden erwähnten Ansprüchen genügen. Hier stoßen wir auf die erste große Enttäuschung! Es trifft zwar einige Male zu, daß die traumatische Szene, in welcher das Symptom entstanden ist, wirklich beides, die determinierende Eignung und die traumatische Kraft besitzt, deren wir zum Verständnis des Symptoms bedürfen. Aber weit häufiger, unvergleichlich häufiger, finden wir eine der drei übrigen Möglichkeiten verwirklicht, die dem Verständnisse so ungünstig sind: die Szene, auf welche wir durch die Analyse geleitet werden, in welcher das Symptom zuerst aufgetreten ist, erscheint uns entweder ungeeignet zur Determinierung des Symptoms, indem ihr Inhalt zur Beschaffenheit des Symptoms keine Beziehung zeigt; oder das angeblich traumatische Erlebnis, dem es an inhaltlicher Beziehung nicht fehlt, erweist sich als normalerweise harmloser, für gewöhnlich wirkungsunfähiger Eindruck; oder endlich die »traumatische Szene« macht uns nach beiden Richtungen irre; sie erscheint ebenso harmlos wie ohne Beziehung zur Eigenart des hysterischen Symptoms.
(Ich bemerke hier nebenbei, daß Breuers Auffassung von der Entstehung hysterischer Symptome durch die Auffindung traumatischer Szenen, die an sich bedeutungslosen Erlebnissen entsprechen, nicht gestört worden ist. Breuer nahm nämlich – im Anschlüsse an Charcot – an, daß auch ein harmloses Erlebnis zum Trauma erhoben werden und determinierende Kraft entfalten kann, wenn es die Person in einer besonderen psychischen Verfassung, im sogenannten hypnoiden Zustand, betrifft. Allein ich finde, daß zur Voraussetzung solcher hypnoider Zustände oftmals jeder Anhalt fehlt. Entscheidend bleibt, daß die Lehre von den hypnoiden Zuständen nichts zur Lösung der anderen Schwierigkeiten leistet, daß nämlich den traumatischen Szenen so häufig die determinierende Eignung abgeht.)
Fügen Sie hinzu, meine Herren, daß diese erste Enttäuschung beim Verfolg der Breuerschen Methode unmittelbar durch eine andere eingeholt wird, die man besonders als Arzt schmerzlich empfinden muß. Zurückführungen solcher Art, wie wir sie geschildert haben, die unserem Verständnis betreffs der Determinierung und der traumatischen Wirksamkeit nicht genügen, bringen auch keinen therapeutischen Gewinn; der Kranke hat seine Symptome ungeändert behalten, trotz des ersten Ergebnisses, das uns die Analyse geliefert hat. Sie mögen verstehen, wie groß dann die Versuchung wird, auf eine Fortsetzung der ohnedies mühseligen Arbeit zu verzichten.
Vielleicht aber bedarf es nur eines neuen Einfalles, um uns aus der Klemme zu helfen und zu wertvollen Resultaten zu führen! Der Einfall ist folgender: Wir wissen ja durch Breuer, daß die hysterischen Symptome zu lösen sind, wenn wir von ihnen auf den Weg zur Erinnerung eines traumatischen Erlebnisses finden können. Wenn nun die aufgefundene Erinnerung unseren Erwartungen nicht entspricht, vielleicht ist derselbe Weg ein Stück weiter zu verfolgen, vielleicht verbirgt sich hinter der ersten traumatischen Szene die Erinnerung an eine zweite, die unseren Ansprüchen besser genügt und deren Reproduktion mehr therapeutische Wirkung entfaltet, so daß die erstgefundene Szene nur die Bedeutung eines Bindegliedes in der Assoziationsverkettung hat? Und vielleicht wiederholt sich dieses Verhältnis, die Einschiebung unwirksamer Szenen als notwendiger Übergänge bei der Reproduktion mehrmals, bis man vom hysterischen Symptom aus endlich zur eigentlich traumatisch wirksamen, in jeder Hinsicht, therapeutisch wie analytisch, befriedigenden Szene gelangt? Nun, meine Herren, diese Vermutung ist richtig. Wo die erstaufgefundene Szene unbefriedigend ist, sagen wir dem Kranken, dieses Erlebnis erkläre nichts, es müsse sich aber hinter ihm ein bedeutsameres, früheres Erlebnis verbergen, und lenken seine Aufmerksamkeit nach derselben Technik auf den Assoziationsfaden, welcher beide Erinnerungen, die aufgefundene und die aufzufindende verknüpft [Fußnote]Es bleibt dabei absichtlich außer Erörterung, von welchem Rang die Assoziation der beiden Erinnerungen ist (ob durch Gleichzeitigkeit, kausaler Art, nach inhaltlicher Ähnlichkeit usw.) und auf welche psychologische Charakteristik die einzelnen »Erinnerungen« (bewußte oder unbewußte) Anspruch haben.. Die Fortsetzung der Analyse führt dann jedesmal zur Reproduktion neuer Szenen von den erwarteten Charakteren. Wenn ich z. B. den vorhin ausgewählten Fall von hysterischem Erbrechen wieder aufnehme, den die Analyse zunächst auf einen Schreck bei einem Eisenbahnunfall zurückgeführt hat, welcher der determinierenden Eignung entbehrt, so erfahre ich aus weitergehender Analyse, daß dieser Unfall die Erinnerung an einen andern, früher vorgekommenen, geweckt hat, den der Kranke zwar nicht selbst erlebte, der ihm aber Gelegenheit zu dem Grauen und Ekel erregenden Anblick eines Leichnams bot. Es ist, als ob das Zusammenwirken beider Szenen die Erfüllung unserer Postulate ermöglichte, indem das eine Erlebnis durch den Schreck die traumatische Kraft, das andere durch seinen Inhalt die determinierende Wirkung beistellt. Der andere Fall, daß das Erbrechen auf den Genuß eines Apfels zurückgeführt wird, an dem sich eine faule Stelle befindet, wird durch die Analyse etwa in folgender Weise ergänzt: Der faulende Apfel erinnert an ein früheres Erlebnis, an das Sammeln abgefallener Äpfel in einem Garten, wobei der Kranke zufällig auf einen ekelhaften Tierkadaver stieß.
Ich will auf diese Beispiele nicht mehr zurückkommen, denn ich muß das Geständnis ablegen, daß sie keinem Falle meiner Erfahrung entstammen, daß sie von mir erfunden sind; höchstwahrscheinlich sind sie auch schlecht erfunden; derartige Auflösungen hysterischer Symptome halte ich selbst für unmöglich. Aber der Zwang, Beispiele zu fingieren, erwächst mir aus mehreren Momenten, von denen ich eines unmittelbar anführen kann. Die wirklichen Beispiele sind alle unvergleichlich komplizierter; eine einzige ausführliche Mitteilung würde diese Vortragsstunde ausfüllen. Die Assoziationskette besteht immer aus mehr als zwei Gliedern, die traumatischen Szenen bilden nicht etwa einfache, perlschnurartige Reihen, sondern verzweigte, stammbaumartige Zusammenhänge, indem bei einem neuen Erlebnis zwei und mehr frühere als Erinnerungen zur Wirkung kommen; kurz, die Auflösung eines einzelnen Symptoms mitteilen, fällt eigentlich zusammen mit der Aufgabe, eine Krankengeschichte vollständig darzustellen.
Wir wollen es nun aber nicht versäumen, den einen Satz nachdrücklich hervorzuheben, den die analytische Arbeit längs dieser Erinnerungsketten unerwarteterweise gegeben hat. Wir haben erfahren, daß kein hysterisches Symptom aus einem realen Erlebnis allein hervorgehen kann, sondern daß alle Male die assoziativ geweckte Erinnerung an frühere Erlebnisse zur Verursachung des Symptoms mitwirkt. Wenn dieser Satz – wie ich meine – ohne Ausnahme richtig ist, so bezeichnet er uns aber auch das Fundament, auf dem eine psychologische Theorie der Hysterie aufzubauen ist.
Sie könnten meinen, jene seltenen Fälle, in welchen die Analyse das Symptom sofort auf eine traumatische Szene von guter determinierender Eignung und traumatischer Kraft zurückführt und es durch solche Zurückführung gleichzeitig wegschafft, wie dies in Breuers Krankengeschichte der Anna O. geschildert wird, seien doch mächtige Einwände gegen die allgemeine Geltung des eben aufgestellten Satzes. Das sieht in der Tat so aus; allein ich muß Sie versichern, ich habe die triftigsten Gründe, anzunehmen, daß selbst in diesen Fällen eine Verkettung wirksamer Erinnerungen vorliegt, die weit hinter die erste traumatische Szene zurückreicht, wenngleich die Reproduktion der letzteren allein die Aufhebung des Symptoms zur Folge haben kann.
Ich meine, es ist wirklich überraschend, daß hysterische Symptome nur unter Mitwirkung von Erinnerungen entstehen können, zumal wenn man erwägt, daß diese Erinnerungen nach allen Aussagen der Kranken ihnen im Momente, da das Symptom zuerst auftrat, nicht zum Bewußtsein gekommen waren. Hier ist Stoff für sehr viel Nachdenken gegeben, aber diese Probleme sollen uns für jetzt nicht verlocken, unsere Richtung nach der Ätiologie der Hysterie zu verlassen. Wir müssen uns vielmehr fragen: Wohin gelangen wir, wenn wir den Ketten assoziierter Erinnerungen folgen, welche die Analyse uns aufdeckt? Wie weit reichen sie? Haben sie irgendwo ein natürliches Ende? Führen sie uns etwa zu Erlebnissen, die irgendwie gleichartig sind, dem Inhalte oder der Lebenszeit nach, so daß wir in diesen überall gleichartigen Faktoren die gesuchte Ätiologie der Hysterie erblicken könnten?
Meine bisherige Erfahrung gestattet mir bereits, diese Fragen zu beantworten. Wenn man von einem Falle ausgeht, der mehrere Symptome bietet, so gelangt man mittels der Analyse von jedem Symptom aus zu einer Reihe von Erlebnissen, deren Erinnerungen in der Assoziation miteinander verkettet sind. Die einzelnen Erinnerungsketten verlaufen zunächst distinkt voneinander nach rückwärts, sind aber, wie bereits erwähnt, verzweigt; von einer Szene aus sind gleichzeitig zwei oder mehr Erinnerungen erreicht, von denen nun Seitenketten ausgehen, deren einzelne Glieder wieder mit Gliedern der Hauptkette assoziativ verknüpft sein mögen. Der Vergleich mit dem Stammbaum einer Familie, deren Mitglieder auch untereinander geheiratet haben, paßt hier wirklich nicht übel. Andere Komplikationen der Verkettung ergeben sich daraus, daß eine einzelne Szene in derselben Kette mehrmals erweckt werden kann, so daß sie zu einer späteren Szene mehrfache Beziehungen hat, eine direkte Verknüpfung mit ihr aufweist und eine durch Mittelglieder hergestellte. Kurz, der Zusammenhang ist keineswegs ein einfacher, und die Aufdeckung der Szenen in umgekehrter chronologischer Folge (die eben den Vergleich mit der Aufgrabung eines geschichteten Trümmerfeldes rechtfertigt) trägt zum rascheren Verständnis des Herganges gewiß nichts bei.
Neue Verwicklungen ergeben sich, wenn man die Analyse weiter fortsetzt. Die Assoziationsketten für die einzelnen Symptome beginnen dann in Beziehung zueinander zu treten; die Stammbäume verflechten sich. Bei einem gewissen Erlebnis der Erinnerungskette, z. B. für das Erbrechen, ist außer den rückläufigen Gliedern dieser Kette eine Erinnerung aus einer andern Kette erweckt worden, die ein anderes Symptom, etwa Kopfschmerz, begründet. Jenes Erlebnis gehört darum beiden Reihen an, es stellt also einen Knotenpunkt dar, wie deren in jeder Analyse mehrere aufzufinden sind. Sein klinisches Korrelat mag etwa sein, daß von einer gewissen Zeit an die beiden Symptome zusammen auftreten, symbiotisch, eigentlich ohne innere Abhängigkeit voneinander. Knotenpunkte anderer Art findet man noch weiter rückwärts. Dort konvergieren die einzelnen Assoziationsketten; es finden sich Erlebnisse, von denen zwei oder mehrere Symptome ausgegangen sind. An das eine Detail der Szene hat die eine Kette, an ein anderes Detail die zweite Kette angeknüpft.
Das wichtigste Ergebnis aber, auf welches man bei solcher konsequenten Verfolgung der Analyse stößt, ist dieses: Von welchem Fall und von welchem Symptom immer man seinen Ausgang genommen hat, endlich gelangt man unfehlbar auf das Gebiet des sexuellen Erlebens. Hiemit wäre also zuerst eine ätiologische Bedingung hysterischer Symptome aufgedeckt.
Ich kann nach früheren Erfahrungen voraussehen, daß gerade gegen diesen Satz oder gegen die Allgemeingültigkeit dieses Satzes Ihr Widerspruch, meine Herren, gerichtet sein wird. Ich sage vielleicht besser: Ihre Widerspruchsneigung, denn es stehen wohl noch keinem von Ihnen Untersuchungen zu Gebote, die, mit demselben Verfahren angestellt, ein anderes Resultat ergeben hätten. Zur Streitsache selbst will ich nur bemerken, daß die Auszeichnung des sexuellen Moments in der Ätiologie der Hysterie bei mir mindestens keiner vorgefaßten Meinung entstammt. Die beiden Forscher, als deren Zögling ich meine Arbeiten über Hysterie begonnen habe, Charcot wie Breuer, standen einer derartigen Voraussetzung ferne, ja sie brachten ihr eine persönliche Abneigung entgegen, von der ich anfangs meinen Anteil übernahm. Erst die mühseligsten Detailuntersuchungen haben mich, und zwar langsam genug, zu der Meinung bekehrt, die ich heute vertrete. Wenn Sie meine Behauptung, die Ätiologie auch der Hysterie läge im Sexualleben, der strengsten Prüfung unterziehen, so erweist sie sich als vertretbar durch die Angabe, daß ich in etwa achtzehn Fällen von Hysterie diesen Zusammenhang für jedes einzelne Symptom erkennen und, wo es die Verhältnisse gestatteten, durch den therapeutischen Erfolg bekräftigen konnte. Sie können mir dann freilich einwenden, die neunzehnte und die zwanzigste Analyse werden vielleicht eine Ableitung hysterischer Symptome auch aus anderen Quellen kennen lehren und damit die Gültigkeit der sexuellen Ätiologie von der Allgemeinheit auf achtzig Prozent einschränken. Wir wollen es gerne abwarten, aber da jene achtzehn Fälle gleichzeitig alle sind, an denen ich die Arbeit der Analyse unternehmen konnte, und da niemand diese Fälle mir zum Gefallen ausgesucht hat, werden Sie es begreiflich finden, daß ich jene Erwartung nicht teile, sondern bereit bin, mit meinem Glauben über die Beweiskraft meiner bisherigen Erfahrungen hinauszugehen. Dazu bewegt mich übrigens noch ein anderes Motiv von einstweilen bloß subjektiver Geltung. In dem einzigen Erklärungsversuch für den physiologischen und psychischen Mechanismus der Hysterie, den ich mir zur Zusammenfassung meiner Beobachtungen gestalten konnte, ist mir die Einmengung sexueller Triebkräfte zur unentbehrlichen Voraussetzung geworden.
Also man gelangt endlich, nachdem die Erinnerungsketten konvergiert haben, auf sexuelles Gebiet und zu einigen wenigen Erlebnissen, die zumeist in die nämliche Lebensperiode, in das Alter der Pubertät fallen. Aus diesen Erlebnissen soll man die Ätiologie der Hysterie entnehmen und durch sie die Entstehung hysterischer Symptome verstehen lernen. Hier erlebt man aber eine neue und schwerwiegende Enttäuschung! Die mit so viel Mühe aufgefundenen, aus allem Erinnerungsmaterial extrahierten, anscheinend letzten traumatischen Erlebnisse haben zwar die beiden Charaktere: Sexualität und Pubertätszeit gemein, sind aber sonst so sehr disparat und ungleichwertig. In einigen Fällen handelt es sich wohl um Erlebnisse, die wir als schwere Traumen anerkennen müssen, um einen Versuch der Vergewaltigung, der dem unreifen Mädchen mit einem Schlage die ganze Brutalität der Geschlechtslust enthüllt, um eine unfreiwillige Zeugenschaft bei sexuellen Akten der Eltern, die in einem ungeahntes Häßliches aufdeckt und das kindliche wie das moralische Gefühl verletzt u. dgl. In anderen Fällen sind diese Erlebnisse von erstaunlicher Geringfügigkeit. Eine meiner Patientinnen zeigte zugrunde ihrer Neurose das Erlebnis, daß ein ihr befreundeter Knabe zärtlich ihre Hand streichelte und ein andermal seinen Unterschenkel an ihr Kleid drängte, während sie nebeneinander bei Tische saßen, wobei noch seine Miene sie erraten ließ, es handle sich um etwas Unerlaubtes. Bei einer andern jungen Dame hatte gar das Anhören einer Scherzfrage, die eine obszöne Beantwortung ahnen ließ, hingereicht, den ersten Angstanfall hervorzurufen und damit die Erkrankung zu eröffnen. Solche Ergebnisse sind offenbar einem Verständnis für die Verursachung hysterischer Symptome nicht günstig. Wenn es ebensowohl schwere wie geringfügige Erlebnisse, ebensowohl Erfahrungen am eigenen Leib wie visuelle Eindrücke und durch das Gehör empfangene Mitteilungen sind, die sich als die letzten Traumen der Hysterie erkennen lassen, so kann man etwa die Deutung versuchen, die Hysterischen seien besonders geartete Menschenkinder – wahrscheinlich infolge erblicher Veranlagung oder degenerativer Verkümmerung – bei denen die Scheu vor der Sexualität, die im Pubertätsalter normalerweise eine gewisse Rolle spielt, ins Pathologische gesteigert und dauernd festgehalten wird; gewissermaßen Personen, die den Anforderungen der Sexualität psychisch nicht Genüge leisten können. Man vernachlässigt bei dieser Aufstellung allerdings die Hysterie der Männer; aber auch, wenn es derartige grobe Einwände nicht gäbe, wäre die Versuchung kaum sehr groß, bei dieser Lösung stehenzubleiben. Man verspürt hier nur zu deutlich die intellektuelle Empfindung des Halbverstandenen, Unklaren und Unzureichenden.
Zum Glück für unsere Aufklärung zeigen einzelne der sexuellen Pubertätserlebnisse eine weitere Unzulänglichkeit, die geeignet ist, zur Fortsetzung der analytischen Arbeit anzuregen. Es kommt nämlich vor, daß auch diese Erlebnisse der determinierenden Eignung entbehren, wenngleich dies hier viel seltener ist als bei den traumatischen Szenen aus späterer Lebenszeit. So z. B. hatten sich bei den beiden Patientinnen, die ich vorhin als Fälle mit eigentlich harmlosen Pubertätserlebnissen angeführt habe, im Gefolge dieser Erlebnisse eigentümliche schmerzhafte Empfindungen in den Genitalien eingestellt, die sich als Hauptsymptome der Neurose festgesetzt hatten, deren Determinierung weder aus den Pubertätsszenen noch aus späteren abzuleiten war, die aber sicherlich nicht zu den normalen Organenempfindungen oder zu den Zeichen sexueller Aufregung gehörten. Wie nahe lag es nun, sich hier zu sagen, man müsse die Determinierung dieser Symptome in noch anderen, noch weiter zurückreichenden Erlebnissen suchen, man müsse hier zum zweiten Male jenem rettenden Einfall folgen, der uns vorhin von den ersten traumatischen Szenen zu den Erinnerungsketten hinter ihnen geleitet? Man kommt damit freilich in die Zeit der ersten Kindheit, die Zeit vor der Entwicklung des sexuellen Lebens, womit ein Verzicht auf die sexuelle Ätiologie verbunden scheint. Aber hat man nicht ein Recht anzunehmen, daß es auch dem Kindesalter an leisen sexuellen Erregungen nicht gebricht, ja, daß vielleicht die spätere sexuelle Entwicklung durch Kindererlebnisse in entscheidender Weise beeinflußt wird? Schädigungen, die das unausgebildete Organ, die in Entwicklung begriffene Funktion treffen, verursachen ja so häufig schwerere und nachhaltigere Wirkungen, als sie im reiferen Alter entfalten könnten. Vielleicht liegen der abnormen Reaktion gegen sexuelle Eindrücke, durch welche uns die Hysterischen in der Pubertätszeit überraschen, ganz allgemein solche sexuelle Erlebnisse der Kindheit zugrunde, die dann von gleichförmiger und bedeutsamer Art sein müßten? Man gewänne so eine Aussicht, als frühzeitig erworben aufzuklären, was man bisher einer durch die Heredität doch nicht verständlichen Prädisposition zur Last legen mußte. Und da infantile Erlebnisse sexuellen Inhalts doch nur durch ihre Erinnerungsspuren eine psychische Wirkung äußern könnten, wäre dies nicht eine willkommene Ergänzung zu jenem Ergebnis der Analyse, daß hysterische Symptome immer nur unter der Mitwirkung von Erinnerungen entstehen?
II
Sie erraten es wohl, meine Herren, daß ich jenen letzten Gedankengang nicht so weit ausgesponnen hätte, wenn ich Sie nicht darauf vorbereiten wollte, daß er allein es ist, der uns nach so vielen Verzögerungen zum Ziele führen wird. Wir stehen nämlich wirklich am Ende unserer langwierigen und beschwerlichen analytischen Arbeit und finden hier alle bisher festgehaltenen Ansprüche und Erwartungen erfüllt. Wenn wir die Ausdauer haben, mit der Analyse bis in die frühe Kindheit vorzudringen, so weit zurück nur das Erinnerungsvermögen eines Menschen reichen kann, so veranlassen wir in allen Fällen den Kranken zur Reproduktion von Erlebnissen, die infolge ihrer Besonderheiten sowie ihrer Beziehungen zu den späteren Krankheitssymptomen als die gesuchte Ätiologie der Neurose betrachtet werden müssen. Diese infantilen Erlebnisse sind wiederum sexuellen Inhalts, aber weit gleichförmigerer Art als die letztgefundenen Pubertätsszenen; es handelt sich bei ihnen nicht mehr um die Erweckung des sexuellen Themas durch einen beliebigen Sinneseindruck, sondern um sexuelle Erfahrungen am eigenen Leib, um geschlechtlichen Verkehr (im weiteren Sinne). Sie gestehen mir zu, daß die Bedeutsamkeit solcher Szenen keiner weiteren Begründung bedarf; fügen Sie nun noch hinzu, daß Sie in den Details derselben jedesmal die determinierenden Momente auffinden können, die Sie etwa in den anderen, später erfolgten und früher reproduzierten Szenen noch vermißt hätten.
Ich stelle also die Behauptung auf, zugrunde jedes Falles von Hysterie befinden sich – durch die analytische Arbeit reproduzierbar, trotz des Dezennien umfassenden Zeitintervalles – ein oder mehrere Erlebnisse von vorzeitiger sexueller Erfahrung, die der frühesten Jugend angehören [Fußnote]Siehe die Bemerkung [Nr. 3] auf S. 65.. Ich halte dies für eine wichtige Enthüllung, für die Auffindung eines caput Nili[Fußnote]Nilquelle. Die Lage der Nilquellen war lange Zeit ein Rätsel. der Neuropathologie, aber ich weiß kaum, wo anzuknüpfen, um die Erörterung dieser Verhältnisse fortzuführen. Soll ich mein aus den Analysen gewonnenes tatsächliches Material vor Ihnen ausbreiten, oder soll ich nicht lieber vorerst der Masse von Einwänden und Zweifeln zu begegnen suchen, die jetzt von Ihrer Aufmerksamkeit Besitz ergriffen haben, wie ich wohl mit Recht vermuten darf? Ich wähle das letztere; vielleicht können wir dann um so ruhiger beim Tatsächlichen verweilen:
a) Wer der psychologischen Auffassung der Hysterie überhaupt feindlich entgegensteht, die Hoffnung nicht aufgeben möchte, daß es einst gelingen wird, ihre Symptome auf »feinere anatomische Veränderungen« zurückzuführen, und die Einsicht abgewiesen hat, daß die materiellen Grundlagen der hysterischen Veränderungen nicht anders als gleichartig sein können mit jenen unserer normalen Seelenvorgänge, der wird selbstverständlich für die Ergebnisse unserer Analysen kein Vertrauen übrig haben; die prinzipielle Verschiedenheit seiner Voraussetzungen von den unserigen entbindet uns aber auch der Verpflichtung, ihn in einer Einzelfrage zu überzeugen.
Aber auch ein anderer, der sich minder abweisend gegen die psychologischen Theorien der Hysterie verhält, wird angesichts unserer analytischen Ergebnisse die Frage aufzuwerfen versucht sein, welche Sicherheit die Anwendung der Psychoanalyse mit sich bringt, ob es denn nicht sehr wohl möglich sei, daß entweder der Arzt solche Szenen als angebliche Erinnerung dem gefälligen Kranken aufdrängt oder daß der Kranke ihm absichtliche Erfindungen und freie Phantasien vorträgt, die jener für echt annimmt. Nun, ich habe darauf zu erwidern, die allgemeinen Bedenken gegen die Verläßlichkeit der psychoanalytischen Methode können erst gewürdigt und beseitigt werden, wenn eine vollständige Darstellung ihrer Technik und ihrer Resultate vorliegen wird; die Bedenken gegen die Echtheit der infantilen Sexualszenen aber kann man bereits heute durch mehr als ein Argument entkräften. Zunächst ist das Benehmen der Kranken, während sie diese infantilen Erlebnisse reproduzieren, nach allen Richtungen hin unvereinbar mit der Annahme, die Szenen seien etwas anderes als peinlich empfundene und höchst ungern erinnerte Realität. Die Kranken wissen vor Anwendung der Analyse nichts von diesen Szenen, sie pflegen sich zu empören, wenn man ihnen etwa das Auftauchen derselben ankündigt; sie können nur durch den stärksten Zwang der Behandlung bewogen werden, sich in deren Reproduktion einzulassen, sie leiden unter den heftigsten Sensationen, deren sie sich schämen und die sie zu verbergen trachten, während sie sich diese infantilen Erlebnisse ins Bewußtsein rufen, und noch, nachdem sie dieselben in so überzeugender Weise wieder durchgemacht haben, versuchen sie es, ihnen den Glauben zu versagen, indem sie betonen, daß sich hiefür nicht wie bei anderem Vergessenen ein Erinnerungsgefühl eingestellt hat [Fußnote]All dies ist richtig, aber es ist zu bedenken, daß ich mich damals von der Überschätzung der Realität und der Geringschätzung der Phantasie noch nicht frei gemacht hatte..
Letzteres Verhalten scheint nun absolut beweiskräftig zu sein. Wozu sollten die Kranken mich so entschieden ihres Unglaubens versichern, wenn sie aus irgendeinem Motiv die Dinge, die sie entwerten wollen, selbst erfunden haben?
Daß der Arzt dem Kranken derartige Reminiszenzen aufdränge, ihn zu ihrer Vorstellung und Wiedergabe suggeriere, ist weniger bequem zu widerlegen, erscheint mir aber ebenso unhaltbar. Mir ist es noch nie gelungen, einem Kranken eine Szene, die ich erwartete, derart aufzudrängen, daß er sie mit allen zu ihr gehörigen Empfindungen zu durchleben schien; vielleicht treffen es andere besser.
Es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Bürgschaften für die Realität der infantilen Sexualszenen. Zunächst deren Uniformität in gewissen Einzelheiten, wie sie sich aus den gleichartig wiederkehrenden Voraussetzungen dieser Erlebnisse ergeben muß, während man sonst geheime Verabredungen zwischen den einzelnen Kranken für glaubhaft halten müßte. Sodann, daß die Kranken gelegentlich wie harmlos Vorgänge beschreiben, deren Bedeutung sie offenbar nicht verstehen, weil sie sonst entsetzt sein müßten, oder daß sie, ohne Wert darauf zu legen, Einzelheiten berühren, die nur ein Lebenserfahrener kennt und als feine Charakterzüge des Realen zu schätzen versteht.
Verstärken solche Vorkommnisse den Eindruck, daß die Kranken wirklich erlebt haben müssen, was sie unter dem Zwang der Analyse als Szene aus der Kindheit reproduzieren, so entspringt ein anderer und mächtigerer Beweis hiefür aus der Beziehung der Infantilszenen zum Inhalt der ganzen übrigen Krankengeschichte. Wie bei den Zusammenlegbildern der Kinder sich nach mancherlei Probieren schließlich eine absolute Sicherheit herausstellt, welches Stück in die freigelassene Lücke gehört – weil nur dieses eine gleichzeitig das Bild ergänzt und sich mit seinen unregelmäßigen Zacken zwischen die Zacken der anderen so einpassen läßt, daß kein freier Raum bleibt und kein Übereinanderschieben notwendig wird –, so erweisen sich die Infantilszenen inhaltlich als unabweisbare Ergänzungen für das assoziative und logische Gefüge der Neurose, nach deren Einfügung erst der Hergang verständlich – man möchte oftmals sagen: selbstverständlich – wird.
Daß auch der therapeutische Beweis für die Echtheit der Infantilszenen in einer Reihe von Fällen zu erbringen ist, füge ich hinzu, ohne diesen in den Vordergrund drängen zu wollen. Es gibt Fälle, in denen ein vollständiger oder partieller Heilerfolg zu erreichen ist, ohne daß man bis zu den Infantilerlebnissen herabsteigen muß; andere, in welchen jeder Erfolg ausbleibt, ehe die Analyse ihr natürliches Ende mit der Aufdeckung der frühesten Traumen gefunden hat. Ich meine, im ersteren Falle sei man vor Rezidiven nicht gesichert; ich erwarte, daß eine vollständige Psychoanalyse die radikale Heilung einer Hysterie bedeutet. Indes, greifen wir hier den Lehren der Erfahrung nicht vor!
Es gäbe noch einen, einen wirklich unantastbaren Beweis für die Echtheit der sexuellen Kindererlebnisse, wenn nämlich die Angaben der einen Person in der Analyse durch die Mitteilung einer anderen Person in oder außerhalb einer Behandlung bestätigt würden. Diese beiden Personen müßten in ihrer Kindheit an demselben Erlebnis Anteil genommen haben, etwa in einem sexuellen Verhältnis zueinander gestanden sein. Solche Kinderverhältnisse sind, wie Sie gleich hören werden, gar nicht selten; es kommt auch häufig genug vor, daß beide Beteiligte später an Neurosen erkranken, und doch, meine ich, ist es ein Glücksfall, daß mir eine solche objektive Bestätigung unter achtzehn Fällen zweimal gelungen ist. Einmal war es der gesund gebliebene Bruder, der mir unaufgefordert zwar nicht die frühesten Sexualerlebnisse mit seiner kranken Schwester, aber wenigstens solche Szenen aus ihrer späteren Kindheit und die Tatsache von weiter zurückreichenden sexuellen Beziehungen bekräftigte. Ein andermal traf es sich, daß zwei in Behandlung stehende Frauen als Kinder mit der nämlichen männlichen Person sexuell verkehrt hatten, wobei einzelne Szenen à trois[Fußnote]zu dritt zustande gekommen waren. Ein gewisses Symptom, das sich von diesen Kindererlebnissen ableitete, war, als Zeuge dieser Gemeinschaft, in beiden Fällen zur Ausbildung gelangt.
b) Sexuelle Erfahrungen der Kindheit, die in Reizungen der Genitalien, koitusähnlichen Handlungen usw. bestehen, sollen also in letzter Analyse als jene Traumen anerkannt werden, von denen die hysterische Reaktion gegen Pubertätserlebnisse und die Entwicklung hysterischer Symptome ausgeht. Gegen diesen Ausspruch werden sicherlich von verschiedenen Seiten zwei zueinander gegensätzliche Einwendungen erhoben werden. Die einen werden sagen, derartige sexuelle Mißbräuche, an Kindern verübt oder von Kindern untereinander, kämen zu selten vor, als daß man mit ihnen die Bedingtheit einer so häufigen Neurose wie der Hysterie decken könnte; andere werden vielleicht geltend machen, dergleichen Erlebnisse seien im Gegenteil sehr häufig, allzu häufig, als daß man ihrer Feststellung eine ätiologische Bedeutung zusprechen könnte. Sie werden ferner anführen, daß es bei einiger Umfrage leicht fällt, Personen aufzufinden, die sich an Szenen von sexueller Verführung und sexuellem Mißbrauche in ihren Kinderjahren erinnern, und die doch niemals hysterisch gewesen sind. Endlich werden wir als schwerwiegendes Argument zu hören bekommen, daß in den niederen Schichten der Bevölkerung die Hysterie gewiß nicht häufiger vorkommt als in den höchsten, während doch alles dafür spricht, daß das Gebot der sexuellen Schonung des Kindesalters an den Proletarierkindern ungleich häufiger übertreten wird.
Beginnen wir unsere Verteidigung mit dem leichteren Teil der Aufgabe. Es scheint mir sicher, daß unsere Kinder weit häufiger sexuellen Angriffen ausgesetzt sind, als man nach der geringen, von den Eltern hierauf verwendeten Fürsorge erwarten sollte. Bei den ersten Erkundigungen, was über dieses Thema bekannt sei, erfuhr ich von Kollegen, daß mehrere Publikationen von Kinderärzten vorliegen, welche die Häufigkeit sexueller Praktiken selbst an Säuglingen von Seiten der Ammen und Kinderfrauen anklagen, und aus den letzten Wochen ist mir eine von Dr. Stekel in Wien herrührende Studie in die Hand geraten, die sich mit dem ›Koitus im Kindesalter‹ beschäftigt (1895). Ich habe nicht Zeit gehabt, andere literarische Zeugnisse zu sammeln, aber selbst, wenn diese sich nur vereinzelt fänden, dürfte man erwarten, daß mit der Steigerung der Aufmerksamkeit für dieses Thema sehr bald die große Häufigkeit von sexuellen Erlebnissen und sexueller Betätigung im Kindesalter bestätigt werden wird.
Schließlich sind die Ergebnisse meiner Analyse imstande, für sich selbst zu sprechen. In sämtlichen achtzehn Fällen (von reiner Hysterie und Hysterie mit Zwangsvorstellungen kombiniert, sechs Männer und zwölf Frauen) bin ich, wie erwähnt, zur Kenntnis solcher sexueller Erlebnisse des Kindesalters gelangt. Ich kann meine Fälle in drei Gruppen bringen, je nach der Herkunft der sexuellen Reizung. In der ersten Gruppe handelt es sich um Attentate, einmaligen oder doch vereinzelten Mißbrauch meist weiblicher Kinder von Seiten erwachsener, fremder Individuen (die dabei groben, mechanischen Insult zu vermeiden verstanden), wobei die Einwilligung der Kinder nicht in Frage kam und als nächste Folge des Erlebnisses der Schreck überwog. Eine zweite Gruppe bilden jene weit zahlreicheren Fälle, in denen eine das Kind wartende erwachsene Person – Kindermädchen, Kindsfrau, Gouvernante, Lehrer, leider auch allzuhäufig ein naher Verwandter – das Kind in den sexuellen Verkehr einführte und ein – auch nach der seelischen Richtung ausgebildetes – förmliches Liebesverhältnis, oft durch Jahre, mit ihm unterhielt. In die dritte Gruppe endlich gehören die eigentlichen Kinderverhältnisse, sexuelle Beziehungen zwischen zwei Kindern verschiedenen Geschlechtes, zumeist zwischen Geschwistern, die oft über die Pubertät hinaus fortgesetzt werden und die nachhaltigsten Folgen für das betreffende Paar mit sich bringen. In den meisten meiner Fälle ergab sich kombinierte Wirkung von zwei oder mehreren solcher Ätiologien; in einzelnen war die Häufung der sexuellen Erlebnisse von verschiedenen Seiten her geradezu erstaunlich. Sie verstehen aber diese Eigentümlichkeit meiner Beobachtungen leicht, wenn Sie in Betracht ziehen, daß ich durchweg Fälle von schwerer neurotischer Erkrankung, die mit Existenzunfähigkeit drohte, zu behandeln hatte.
Wo ein Verhältnis zwischen zwei Kindern vorlag, gelang nun einige Male der Nachweis, daß der Knabe – der auch hier die aggressive Rolle spielt – vorher von einer erwachsenen weiblichen Person verführt worden war und daß er dann unter dem Drucke seiner vorzeitig geweckten Libido und infolge des Erinnerungszwanges an dem kleinen Mädchen genau die nämlichen Praktiken zu wiederholen suchte, die er bei den Erwachsenen erlernt hatte, ohne daß er selbständig eine Modifikation in der Art der sexuellen Betätigung vorgenommen hätte.
Ich bin daher geneigt anzunehmen, daß ohne vorherige Verführung Kinder den Weg zu Akten sexueller Aggression nicht zu finden vermögen. Der Grund zur Neurose würde demnach im Kindesalter immer von Seiten Erwachsener gelegt, und die Kinder selbst übertragen einander die Disposition, später an Hysterie zu erkranken. Ich bitte, verweilen Sie noch einen Moment bei der besonderen Häufigkeit sexueller Beziehungen im Kindesalter gerade zwischen Geschwistern und Vettern infolge der Gelegenheit zu häufigem Beisammensein, stellen Sie sich vor, daß zehn oder fünfzehn Jahre später in dieser Familie mehrere Individuen der jungen Generation krank gefunden werden, und fragen Sie sich, ob dieses familiäre Auftreten der Neurose nicht geeignet ist, zur Annahme einer erblichen Disposition zu verleiten, wo doch nur eine Pseudoheredität vorliegt und in Wirklichkeit eine Übertragung, eine Infektion in der Kindheit stattgefunden hat.
Nun wenden wir uns zu dem andern Einwand, welcher gerade auf der zugestandenen Häufigkeit infantiler Sexualerlebnisse und auf der Erfahrung fußt, daß viele Personen sich an solche Szenen erinnern, die nicht hysterisch geworden sind. Dagegen sagen wir zunächst, daß die übergroße Häufigkeit eines ätiologischen Moments unmöglich zum Vorwurf gegen dessen ätiologische Bedeutung verwendet werden kann. Ist der Tuberkelbazillus nicht allgegenwärtig und wird von weit mehr Menschen eingeatmet, als sich an Tuberkulose erkrankt zeigen? Und wird seine ätiologische Bedeutung durch die Tatsache geschädigt, daß er offenbar der Mitwirkung anderer Faktoren bedarf, um die Tuberkulose, seinen spezifischen Effekt, hervorzurufen? Es reicht für seine Würdigung als spezifische Ätiologie aus, daß Tuberkulose nicht möglich ist ohne seine Mitwirkung. Das gleiche gilt wohl auch für unser Problem. Es stört nicht, wenn viele Menschen infantile Sexualszenen erleben, ohne hysterisch zu werden; wenn nur alle, die hysterisch werden, solche Szenen erlebt haben. Der Kreis des Vorkommens eines ätiologischen Faktors darf gerne ausgedehnter sein als der seines Effekts, nur nicht enger. Es erkranken nicht alle an Blattern, die einen Blatternkranken berühren oder ihm nahe kommen, und doch ist Übertragung von einem Blatternkranken fast die einzige uns bekannte Ätiologie der Erkrankung.
Freilich, wenn infantile Betätigung der Sexualität ein fast allgemeines Vorkommnis wäre, dann fiele auf deren Nachweis in allen Fällen kein Gewicht. Aber erstens wäre eine derartige Behauptung sicherlich eine arge Übertreibung, und zweitens ruht der ätiologische Anspruch der infantilen Szenen nicht allein auf der Beständigkeit ihres Vorkommens in der Anamnese der Hysterischen, sondern vor allem auf dem Nachweis der assoziativen und logischen Bande zwischen ihnen und den hysterischen Symptomen, der Ihnen aus einer vollständig mitgeteilten Krankengeschichte sonnenklar einleuchten würde.
Welches mögen die anderen Momente sein, deren die »spezifische Ätiologie« der Hysterie noch bedarf, um die Neurose wirklich zu produzieren? Dies, meine Herren, ist eigentlich ein Thema für sich, das ich zu behandeln nicht vorhabe; ich brauche heute bloß die Kontaktstelle aufzuzeigen, an welcher die beiden Teilstücke des Themas – spezifische und Hilfsätiologie – ineinander greifen. Es wird wohl eine ziemliche Anzahl von Faktoren in Betracht kommen, die erbliche und persönliche Konstitution, die innere Bedeutsamkeit der infantilen Sexualerlebnisse, vor allem deren Häufung; ein kurzes Verhältnis mit einem fremden, später gleichgültigen Knaben wird an Wirksamkeit zurückstehen gegen mehrjährige, innige, sexuelle Beziehungen zum eigenen Bruder. Es sind in der Ätiologie der Neurosen quantitative Bedingungen ebensowohl bedeutsam wie qualitative; es sind Schwellenwerte zu überschreiten, wenn die Krankheit manifest werden soll. Ich halte die obige ätiologische Reihe übrigens selbst nicht für vollzählig und das Rätsel, warum die Hysterie in den niederen Ständen nicht häufiger ist, durch sie noch nicht erledigt. (Erinnern Sie sich übrigens, welche überraschend große Verbreitung Charcot für die männliche Hysterie des Arbeiterstandes behauptete.) Ich darf Sie aber auch daran mahnen, daß ich selbst vor wenigen Jahren auf ein bisher wenig gewürdigtes Moment hingewiesen habe, für welches ich die Hauptrolle in der Hervorrufung der Hysterie nach der Pubertät in Anspruch nehme. Ich habe damals ausgeführt, daß sich der Ausbruch der Hysterie fast regelmäßig auf einen psychischen Konflikt zurückführen läßt, indem eine unverträgliche Vorstellung die Abwehr des Ichs rege mache und zur Verdrängung auffordere. Unter welchen Verhältnissen dieses Abwehrbestreben den pathologischen Effekt hat, die dem Ich peinliche Erinnerung wirklich ins Unbewußte zu drängen und an ihrer Statt ein hysterisches Symptom zu schaffen, das konnte ich damals nicht angeben. Ich ergänze es heute: Die Abwehr erreicht dann ihre Absicht, die unverträgliche Vorstellung aus dem Bewußtsein zu drängen, wenn bei der betreffenden, bis dahin gesunden Person infantile Sexualszenen als unbewußte Erinnerungen vorhanden sind und wenn die zu verdrängende Vorstellung in logischen oder assoziativen Zusammenhang mit einem solchen infantilen Erlebnis gebracht werden kann.
Da das Abwehrbestreben des Ichs von der gesamten moralischen und intellektuellen Ausbildung der Person abhängt, sind wir nun nicht mehr ohne jedes Verständnis für die Tatsache, daß die Hysterie beim niederen Volk so viel seltener ist, als ihre spezifische Ätiologie gestatten würde.
Meine Herren, kehren wir noch einmal zurück zu jener letzten Gruppe von Einwänden, deren Beantwortung uns so weit geführt hat. Wir haben gehört und anerkannt, daß es zahlreiche Personen gibt, die infantile Sexualerlebnisse sehr deutlich erinnern und die doch nicht hysterisch sind. Dieser Einwand ist ganz ohne Gewicht, er wird uns aber Anlaß zu einer wertvollen Bemerkung bieten. Personen dieser Art dürfen nach unserem Verständnis der Neurose gar nicht hysterisch sein oder wenigstens nicht hysterisch infolge der Szenen, die sie bewußt erinnern. Bei unseren Kranken sind diese Erinnerungen niemals bewußt; wir heilen sie aber von ihrer Hysterie, indem wir ihnen die unbewußten Erinnerungen der Infantilszenen in bewußte verwandeln. An der Tatsache, daß sie solche Erlebnisse gehabt haben, konnten und brauchten wir nichts zu ändern. Sie ersehen daraus, daß es auf die Existenz der infantilen Sexualerlebnisse allein nicht ankommt, sondern daß eine psychologische Bedingung noch dabei ist. Diese Szenen müssen als unbewußte Erinnerungen vorhanden sein; nur solange und insofern sie unbewußt sind, können sie hysterische Symptome erzeugen und unterhalten. Wovon es aber abhängt, ob diese Erlebnisse bewußte oder unbewußte Erinnerungen ergeben, ob die Bedingung hiefür im Inhalt der Erlebnisse, in der Zeit, zu der sie vorfallen, oder in späteren Einflüssen liegt, dies ist ein neues Problem, dem wir behutsam aus dem Wege gehen wollen. Lassen Sie sich bloß daran mahnen, daß uns die Analyse als erstes Resultat den Satz gebracht hat: Die hysterischen Symptome sind Abkömmlinge unbewußt wirkender Erinnerungen.
c) Wenn wir daran festhalten, infantile Sexualerlebnisse seien die Grundbedingung, sozusagen die Disposition der Hysterie, sie erzeugen die hysterischen Symptome aber nicht unmittelbar, sondern bleiben zunächst wirkungslos und wirken pathogen erst später, wenn sie im Alter nach der Pubertät als unbewußte Erinnerungen geweckt werden, so haben wir uns mit den zahlreichen Beobachtungen auseinanderzusetzen, welche das Auftreten hysterischer Erkrankung bereits im Kindesalter und vor der Pubertät erweisen. Indes löst sich die Schwierigkeit wieder, wenn wir die aus den Analysen gewonnenen Daten über die zeitlichen Umstände der infantilen Sexualerlebnisse näher betrachten. Man erfährt dann, daß in unseren schweren Fällen die Bildung hysterischer Symptome nicht etwa ausnahmsweise, sondern eher regelmäßig mit dem achten Jahr beginnt und daß die Sexualerlebnisse, die keine unmittelbare Wirkung äußern, jedesmal weiter zurückreichen, ins dritte, vierte, selbst ins zweite Lebensjahr. Da in keinem einzigen Fall die Kette der wirksamen Erlebnisse mit dem achten Jahr abbricht, muß ich annehmen, daß diese Lebensperiode, in welcher der Wachstumsschub der zweiten Dentition erfolgt, für die Hysterie eine Grenze bildet, von welcher an ihre Verursachung unmöglich wird. Wer nicht frühere Sexualerlebnisse hat, kann von da an nicht mehr zur Hysterie disponiert werden; wer solche hat, kann nun bereits hysterische Symptome entwickeln. Das vereinzelte Vorkommen von Hysterie auch jenseits dieser Altersgrenze (vor acht Jahren) ließe sich noch als Erscheinung der Frühreife deuten. Die Existenz dieser Grenze hängt sehr wahrscheinlich mit Entwicklungsvorgängen im Sexualsystem zusammen. Verfrühung der somatischen Sexualentwicklung kommt häufig zur Beobachtung, und es ist selbst denkbar, daß sie durch vorzeitige sexuelle Reizung befördert werden kann.
Man gewinnt so einen Hinweis darauf, daß ein gewisser infantiler Zustand der psychischen Funktionen wie des Sexualsystems erforderlich ist, damit eine in diese Periode fallende sexuelle Erfahrung später als Erinnerung pathogene Wirkung entfalte. Ich getraue mich indes noch nicht, über die Natur dieses psychischen Infantilismus und über seine zeitliche Begrenzung Näheres auszusagen.
d) Eine weitere Einwendung könnte etwa daran Anstoß nehmen, daß die Erinnerung der infantilen Sexualerlebnisse so großartige pathogene Wirkung äußern soll, während das Erleben derselben selbst wirkungslos geblieben ist. Wir sind ja in der Tat nicht daran gewöhnt, daß von einem Erinnerungsbild Kräfte ausgehen, welche dem realen Eindruck gefehlt haben. Sie bemerken hier übrigens, mit welcher Konsequenz bei der Hysterie der Satz durchgeführt ist, daß Symptome nur aus Erinnerungen hervorgehen können. Alle die späteren Szenen, bei denen die Symptome entstehen, sind nicht die wirksamen, und die eigentlich wirksamen Erlebnisse erzeugen zunächst keinen Effekt. Wir stehen aber hier vor einem Problem, welches wir mit gutem Recht von unserem Thema sondern können. Man fühlt sich freilich zu einer Synthese aufgefordert, wenn man die Reihe von auffälligen Bedingungen überdenkt, zu deren Kenntnis wir gelangt sind: daß, um ein hysterisches Symptom zu bilden, ein Abwehrbestreben gegen eine peinliche Vorstellung vorhanden sein muß; daß diese eine logische oder assoziative Verknüpfung aufweisen muß mit einer unbewußten Erinnerung durch wenige oder zahlreiche Mittelglieder, die in diesem Moment gleichfalls unbewußt bleiben; daß jene unbewußte Erinnerung nur sexuellen Inhalts sein kann; daß sie ein Erlebnis zum Inhalt hat, welches sich in einer gewissen infantilen Lebensperiode zugetragen hat; und man kann nicht umhin, sich zu fragen, wie es zugeht, daß diese Erinnerung an ein seinerzeit harmloses Erlebnis posthum die abnorme Wirkung äußert, einen psychischen Vorgang wie das Abwehren zu einem pathologischen Resultat zu leiten, während sie selbst dabei unbewußt bleibt?
Man wird sich aber sagen müssen, dies sei ein rein psychologisches Problem, dessen Lösung vielleicht bestimmte Annahmen über die normalen psychischen Vorgänge und über die Rolle des Bewußtseins dabei notwendig macht, das aber einstweilen ungelöst bleiben kann, ohne unsere bisher gewonnene Einsicht in die Ätiologie der hysterischen Phänomene zu entwerten.
III
Meine Herren, das Problem, dessen Ansätze ich soeben formuliert habe, betrifft den Mechanismus der hysterischen Symptombildung. Wir sind aber genötigt, die Verursachung dieser Symptome darzustellen, ohne diesen Mechanismus in Betracht zu ziehen, was eine unvermeidliche Einbuße an Abrundung und Durchsichtigkeit unserer Erörterung mit sich bringt. Kehren wir zur Rolle der infantilen Sexualszenen zurück. Ich fürchte, ich könnte Sie zur Überschätzung von deren symptombildender Kraft verleitet haben. Ich betone darum nochmals, daß jeder Fall von Hysterie Symptome aufweist, deren Determinierung nicht aus infantilen, sondern aus späteren, oft aus rezenten Erlebnissen herstammt. Ein anderer Anteil der Symptome geht freilich auf die allerfrühesten Erlebnisse zurück, ist gleichsam von ältestem Adel. Dahin gehören vor allem die so zahlreichen und mannigfaltigen Sensationen und Parästhesien an den Genitalien und anderen Körperstellen, die einfach dem Empfindungsinhalt der Infantilszenen in halluzinatorischer Reproduktion, oft auch in schmerzhafter Verstärkung, entsprechen.
Eine andere Reihe überaus gemeiner hysterischer Phänomene, der schmerzhafte Harndrang, die Sensation bei der Defäkation, Störungen der Darmtätigkeit, das Würgen und Erbrechen, Magenbeschwerden und Speiseekel, gab sich in meinen Analysen gleichfalls – und zwar mit überraschender Regelmäßigkeit – als Derivat derselben Kindererlebnisse zu erkennen und erklärte sich mühelos aus konstanten Eigentümlichkeiten derselben. Die infantilen Sexualszenen sind nämlich arge Zumutungen für das Gefühl eines sexuell normalen Menschen; sie enthalten alle Ausschreitungen, die von Wüstlingen und Impotenten bekannt sind, bei denen Mundhöhle und Darmausgang mißbräuchlich zu sexueller Verwendung gelangen. Die Verwunderung hierüber weicht beim Arzte alsbald einem völligen Verständnis. Von Personen, die kein Bedenken tragen, ihre sexuellen Bedürfnisse an Kindern zu befriedigen, kann man nicht erwarten, daß sie an Nuancen in der Weise dieser Befriedigung Anstoß nehmen, und die dem Kindesalter anhaftende sexuelle Impotenz drängt unausbleiblich zu denselben Surrogathandlungen, zu denen sich der Erwachsene im Falle erworbener Impotenz erniedrigt. Alle die seltsamen Bedingungen, unter denen das ungleiche Paar sein Liebesverhältnis fortführt: der Erwachsene, der sich seinem Anteil an der gegenseitigen Abhängigkeit nicht entziehen kann, wie sie aus einer sexuellen Beziehung notwendig hervorgeht, der dabei doch mit aller Autorität und dem Rechte der Züchtigung ausgerüstet ist und zur ungehemmten Befriedigung seiner Launen die eine Rolle mit der anderen vertauscht; das Kind, dieser Willkür in seiner Hilflosigkeit preisgegeben, vorzeitig zu allen Empfindlichkeiten erweckt und allen Enttäuschungen ausgesetzt, häufig in der Ausübung der ihm zugewiesenen sexuellen Leistungen durch seine unvollkommene Beherrschung der natürlichen Bedürfnisse unterbrochen – alle diese grotesken und doch tragischen Mißverhältnisse prägen sich in der ferneren Entwicklung des Individuums und seiner Neurose in einer Unzahl von Dauereffekten aus, die der eingehendsten Verfolgung würdig wären. Wo sich das Verhältnis zwischen zwei Kindern abspielt, bleibt der Charakter der Sexualszenen doch der nämliche abstoßende, da ja jedes Kinderverhältnis eine vorausgegangene Verführung des einen Kindes durch einen Erwachsenen postuliert. Die psychischen Folgen eines solchen Kinderverhältnisses sind ganz außerordentlich tiefgreifende; die beiden Personen bleiben für ihre ganze Lebenszeit durch ein unsichtbares Band miteinander verknüpft.
Gelegentlich sind es Nebenumstände dieser infantilen Sexualszenen, welche in späteren Jahren zu determinierender Macht für die Symptome der Neurose gelangen. So hat in einem meiner Fälle der Umstand, daß das Kind abgerichtet wurde, mit seinem Fuß die Genitalien der Erwachsenen zu erregen, hingereicht, um Jahre hindurch die neurotische Aufmerksamkeit auf die Beine und deren Funktion zu fixieren und schließlich eine hysterische Paraplegie zu erzeugen. In einem andern Falle wäre es rätselhaft geblieben, warum die Kranke in ihren Angstanfällen, die gewisse Tagesstunden bevorzugten, gerade eine einzige von ihren zahlreichen Schwestern zu ihrer Beruhigung nicht von ihrer Seite lassen wollte, wenn die Analyse nicht ergeben hätte, daß der Attentäter sich seinerzeit bei jedem seiner Besuche erkundigt hatte, ob diese Schwester zu Hause sei, von der er eine Störung befürchten mußte.
Es kommt vor, daß die determinierende Kraft der Infantilszenen sich so sehr verbirgt, daß sie bei oberflächlicher Analyse übersehen werden muß. Man vermeint dann, man habe die Erklärung eines gewissen Symptoms im Inhalt einer der späteren Szenen gefunden, und stößt im Verlaufe der Arbeit auf denselben Inhalt in einer der Infantilszenen, so daß man sich schließlich sagen muß, die spätere Szene verdanke ihre Kraft, Symptome zu determinieren, doch nur ihrer Übereinstimmung mit der früheren. Ich will darum die spätere Szene nicht als bedeutungslos hinstellen; wenn ich die Aufgabe hätte, die Regeln der hysterischen Symptombildung vor Ihnen zu erörtern, würde ich als eine dieser Regeln anerkennen müssen, daß zum Symptom jene Vorstellung auserwählt wird, zu deren Hebung mehrere Momente zusammenwirken, die von verschiedenen Seiten her gleichzeitig geweckt wird, was ich an anderer Stelle durch den Satz auszudrücken versucht habe: Die hysterischen Symptome seien überdeterminiert.
Noch eines, meine Herren; ich habe zwar vorhin das Verhältnis der rezenten Ätiologie zur infantilen als ein besonderes Thema beiseite gerückt; aber ich kann doch den Gegenstand nicht verlassen, ohne diesen Vorsatz wenigstens durch eine Bemerkung zu übertreten. Sie gestehen mir zu, es ist vor allem eine Tatsache, die uns am psychologischen Verständnis der hysterischen Phänomene irre werden läßt, die uns zu warnen scheint, psychische Akte bei Hysterischen und bei Normalen mit gleichem Maß zu messen. Es ist dies das Mißverhältnis zwischen psychisch erregendem Reiz und psychischer Reaktion, das wir bei den Hysterischen antreffen, welches wir durch die Annahme einer allgemeinen abnormen Reizbarkeit zu decken suchen und häufig physiologisch zu erklären bemüht sind, als ob gewisse, der Übertragung dienende Hirnorgane sich bei den Kranken in einem besonderen chemischen Zustand befänden, etwa wie die Spinalzentren des Strychninfrosches, oder sich dem Einflüsse höherer hemmender Zentren entzogen hätten, wie im vivisektorischen Tierexperiment. Beide Auffassungen mögen hie und da zur Erklärung der hysterischen Phänomene vollberechtigt sein; das stelle ich nicht in Abrede. Aber der Hauptanteil des Phänomens, der abnormen, übergroßen, hysterischen Reaktion auf psychische Reize, läßt eine andere Erklärung zu, die durch zahllose Beispiele aus den Analysen gestützt wird. Und diese Erklärung lautet: Die Reaktion der Hysterischen ist eine nur scheinbar übertriebene; sie muß uns so erscheinen, weil wir nur einen kleinen Teil der Motive kennen, aus denen sie erfolgt.
In Wirklichkeit ist diese Reaktion proportional dem erregenden Reiz, also normal und psychologisch verständlich. Wir sehen dies sofort ein, wenn die Analyse zu den manifesten, dem Kranken bewußten Motiven jene anderen Motive hinzugefügt hat, die gewirkt haben, ohne daß der Kranke um sie wußte, die er uns also nicht mitteilen konnte.
Ich könnte Stunden damit ausfüllen, Ihnen diesen wichtigen Satz für den ganzen Umfang der psychischen Tätigkeit bei Hysterischen zu erweisen, muß mich aber hier auf wenige Beispiele beschränken. Sie erinnern sich an die so häufige seelische »Empfindlichkeit« der Hysterischen, die sie auf die leiseste Andeutung einer Geringschätzung reagieren läßt, als seien sie tödlich beleidigt worden. Was würden Sie nun denken, wenn Sie eine solche hochgradige Verletzbarkeit bei geringfügigen Anlässen zwischen zwei gesunden Menschen, etwa Ehegatten, beobachten würden? Sie würden gewiß den Schluß ziehen, die eheliche Szene, der Sie beigewohnt, sei nicht allein das Ergebnis des letzten kleinlichen Anlasses, sondern da habe sich durch lange Zeit Zündstoff angehäuft, der nun in seiner ganzen Masse durch den letzten Anstoß zur Explosion gebracht worden sei.
Bitte, übertragen Sie denselben Gedankengang auf die Hysterischen. Nicht die letzte, an sich minimale Kränkung ist es, die den Weinkrampf, den Ausbruch von Verzweiflung, den Selbstmordversuch erzeugt, mit Mißachtung des Satzes von der Proportionalität des Effekts und der Ursache, sondern diese kleine aktuelle Kränkung hat die Erinnerungen so vieler und intensiverer früherer Kränkungen geweckt und zur Wirkung gebracht, hinter denen allen noch die Erinnerung an eine schwere, nie verwundene Kränkung im Kindesalter steckt. Oder: wenn ein junges Mädchen sich die entsetzlichsten Vorwürfe macht, weil sie geduldet, daß ein Knabe zärtlich im geheimen über ihre Hand gestrichen, und von da ab der Neurose verfällt, so können Sie zwar dem Rätsel mit dem Urteil begegnen, das sei eine abnorme, exzentrisch angelegte, hypersensitive Person; aber Sie werden anders denken, wenn Ihnen die Analyse zeigt, daß jene Berührung an eine andere, ähnliche, erinnerte, die in sehr früher Jugend vorfiel und die ein Stück aus einem minder harmlosen Ganzen war, so daß eigentlich die Vorwürfe jenem alten Anlaß gelten. Schließlich ist das Rätsel der hysterogenen Punkte auch kein anderes; wenn Sie die eine ausgezeichnete Stelle berühren, tun Sie etwas, was Sie nicht beabsichtigt haben; Sie wecken eine Erinnerung auf, die einen Krampfanfall auszulösen vermag, und da Sie von diesem psychischen Mittelglied nichts wissen, beziehen Sie den Anfall als Wirkung direkt auf Ihre Berührung als Ursache. Die Kranken befinden sich in derselben Unwissenheit und verfallen darum in ähnliche Irrtümer, sie stellen beständig »falsche Verknüpfungen« her zwischen dem letztbewußten Anlaß und dem von so viel Mittelgliedern abhängigen Effekt. Ist es dem Arzte aber möglich geworden, zur Erklärung einer hysterischen Reaktion die bewußten und die unbewußten Motive zusammenzufassen, so muß er diese scheinbar übermäßige Reaktion fast immer als eine angemessene, nur in der Form abnorme anerkennen.
Sie werden nun gegen diese Rechtfertigung der hysterischen Reaktion auf psychische Reize mit Recht einwenden, sie sei doch keine normale, denn warum benehmen die Gesunden sich anders; warum wirken bei ihnen nicht alle längst verflossenen Erregungen neuerdings mit, wenn eine neue Erregung aktuell ist? Es macht ja den Eindruck, als blieben bei den Hysterischen alle alten Erlebnisse wirkungskräftig, auf die schon so oft, und zwar in stürmischer Weise reagiert wurde, als seien diese Personen unfähig, psychische Reize zu erledigen. Richtig, meine Herren, etwas Derartiges muß man tatsächlich als wahr annehmen. Vergessen Sie nicht, daß die alten Erlebnisse der Hysterischen bei einem aktuellen Anlasse als unbewußte Erinnerungen ihre Wirkung äußern. Es scheint, als ob die Schwierigkeit der Erledigung, die Unmöglichkeit, einen aktuellen Eindruck in eine machtlose Erinnerung zu verwandeln, gerade an dem Charakter des psychisch Unbewußten hinge. Sie sehen, der Rest des Problems ist wiederum Psychologie, und zwar Psychologie von einer Art, für welche uns die Philosophen wenig Vorarbeit geleistet haben.
Auf diese Psychologie, die für unsere Bedürfnisse erst zu erschaffen ist – auf die zukünftige Neurosenpsychologie –, muß ich Sie auch verweisen, wenn ich Ihnen zum Schluß eine Mitteilung mache, von der Sie zunächst eine Störung unseres beginnenden Verständnisses für die Ätiologie der Hysterie besorgen werden. Ich muß es nämlich aussprechen, daß die ätiologische Rolle der infantilen Sexualerlebnisse nicht auf das Gebiet der Hysterie eingeschränkt ist, sondern in gleicher Weise für die merkwürdige Neurose der Zwangsvorstellungen, ja vielleicht auch für die Formen der chronischen Paranoia und andere funktionelle Psychosen Geltung hat. Ich drücke mich hiebei minder bestimmt aus, weil die Anzahl meiner Analysen von Zwangsneurosen noch weit hinter der von Hysterien zurücksteht; von Paranoia habe ich gar nur eine einzige ausreichende und einige fragmentarische Analysen zur Verfügung. Aber was ich da gefunden, schien mir verläßlich und hat mich mit sicheren Erwartungen für andere Fälle erfüllt. Sie erinnern sich vielleicht, daß ich für die Zusammenfassung von Hysterie und Zwangsvorstellungen unter dem Titel » Abwehrneurosen« bereits früher eingetreten bin, ehe mir noch die Gemeinsamkeit der infantilen Ätiologie bekannt war. Nun muß ich hinzufügen – was man freilich nicht allgemein zu erwarten braucht –, daß meine Fälle von Zwangsvorstellungen sämtlich einen Untergrund von hysterischen Symptomen, meist Sensationen und Schmerzen, erkennen ließen, die sich gerade auf die ältesten Kindererlebnisse zurückleiteten. Worin liegt nun die Entscheidung, ob aus den unbewußt gebliebenen infantilen Sexualszenen später Hysterie oder Zwangsneurose oder gar Paranoia hervorgehen soll, wenn sich die anderen pathogenen Momente hinzugesellt haben? Diese Vermehrung unserer Erkenntnisse scheint ja dem ätiologischen Wert dieser Szenen Eintrag zu tun, indem sie die Spezifität der ätiologischen Relation aufhebt.
Ich bin noch nicht in der Lage, meine Herren, eine verläßliche Antwort auf diese Frage zu geben. Die Anzahl meiner analysierten Fälle, die Mannigfaltigkeit der Bedingungen in ihnen, ist nicht groß genug hiefür. Ich merke bis jetzt, daß die Zwangsvorstellungen bei der Analyse regelmäßig als verkappte und verwandelte Vorwürfe wegen sexuellerAggressionen im Kindesalter zu entlarven sind, daß sie darum bei Männern häufiger gefunden werden als bei Frauen und häufiger bei ihnen sich entwickeln als Hysterie. Ich könnte daraus schließen, daß der Charakter der Infantilszenen, ob sie mit Lust oder nur passiv erlebt werden, einen bestimmenden Einfluß auf die Auswahl der späteren Neurose hat, aber ich möchte auch den Einfluß des Alters, in dem diese Kinderaktionen vorfallen, und anderer Momente nicht unterschätzen. Hierüber muß erst die Diskussion weiterer Analysen Aufschluß geben; wenn es aber klar sein wird, welche Momente die Entscheidung zwischen den möglichen Formen der Abwehr-Neuropsychosen beherrschen, wird es wiederum ein rein psychologisches Problem sein, kraft welches Mechanismus die einzelne Form gestaltet wird.
Ich bin nun zum Ende meiner heutigen Erörterungen gelangt. Auf Widerspruch und Unglauben gefaßt, möchte ich meiner Sache nur noch eine Befürwortung mit auf den Weg geben. Wie immer Sie meine Resultate aufnehmen mögen, ich darf Sie bitten, dieselben nicht für die Frucht wohlfeiler Spekulation zu halten. Sie ruhen auf mühseliger Einzelerforschung der Kranken, die bei den meisten Fällen hundert Arbeitsstunden und darüber verweilt hat. Wichtiger noch als Ihre Würdigung der Ergebnisse ist mir Ihre Aufmerksamkeit für das Verfahren, dessen ich mich bedient habe, das neuartig, schwierig zu handhaben und doch unersetzlich für wissenschaftliche und therapeutische Zwecke ist. Sie sehen wohl ein, man kann den Ergebnissen, zu denen diese modifizierte Breuersche Methode führt, nicht gut widersprechen, wenn man die Methode beiseite läßt und sich nur der gewohnten Methode des Krankenexamens bedient. Es wäre ähnlich, als wollte man die Funde der histologischen Technik mit der Berufung auf die makroskopische Untersuchung widerlegen. Indem die neue Forschungsmethode den Zugang zu einem neuen Element des psychischen Geschehens, zu den unbewußt gebliebenen, nach Breuers Ausdruck » bewußtseinsunfähigen« Denkvorgängen breit eröffnet, winkt sie uns mit der Hoffnung eines neuen, besseren Verständnisses aller funktionellen psychischen Störungen. Ich kann es nicht glauben, daß die Psychiatrie es noch lange aufschieben wird, sich dieses neuen Weges zur Erkenntnis zu bedienen.
Zur Dynamik der Übertragung (1912)
Das schwer zu erschöpfende Thema der »Übertragung« ist kürzlich in diesem Zentralblatt von W. Stekel [Fußnote]›Die verschiedenen Formen der Übertragung‹, Zentbl. Psychoanal., Bd. 2, 2. 27. in deskriptiver Weise behandelt worden. Ich möchte nun hier einige Bemerkungen anfügen, die verstehen lassen sollen, wie die Übertragung während einer psychoanalytischen Kur notwendig zustande kommt und wie sie zu der bekannten Rolle während der Behandlung gelangt.
Machen wir uns klar, daß jeder Mensch durch das Zusammenwirken von mitgebrachter Anlage und von Einwirkungen auf ihn während seiner Kinderjahre eine bestimmte Eigenart erworben hat, wie er das Liebesleben ausübt, also welche Liebesbedingungen er stellt, welche Triebe er dabei befriedigt und welche Ziele er sich setzt [Fußnote]Verwahren wir uns an dieser Stelle gegen den mißverständlichen Vorwurf, als hätten wir die Bedeutung der angeborenen (konstitutionellen) Momente geleugnet, weil wir die der infantilen Eindrücke hervorgehoben haben. Ein solcher Vorwurf stammt aus der Enge des Kausalbedürfnisses der Menschen, welches sich im Gegensatz zur gewöhnlichen Gestaltung der Realität mit einem einzigen verursachenden Moment zufriedengeben will. Die Psychoanalyse hat über die akzidentellen Faktoren der Ätiologie viel, über die konstitutionellen wenig geäußert, aber nur darum, weil sie zu den ersteren etwas Neues beibringen konnte, über die letzteren hingegen zunächst nicht mehr wußte, als man sonst weiß. Wir lehnen es ab, einen prinzipiellen Gegensatz zwischen beiden Reihen von ätiologischen Momenten zu statuieren; wir nehmen vielmehr ein regelmäßiges Zusammenwirken beider zur Hervorbringung des beobachteten Effekts an. Δαίμων καὶ Τύχη [Begabung und Zufall] bestimmen das Schicksal eines Menschen; selten, vielleicht niemals, eine dieser Mächte allein. Die Aufteilung der ätiologischen Wirksamkeit zwischen den beiden wird sich nur individuell und im einzelnen vollziehen lassen. Die Reihe, in welcher sich wechselnde Größen der beiden Faktoren zusammensetzen, wird gewiß auch ihre extremen Fälle haben. Je nach dem Stande unserer Erkenntnis werden wir den Anteil der Konstitution oder des Erlebens im Einzelfalle anders einschätzen und das Recht behalten, mit der Veränderung unserer Einsichten unser Urteil zu modifizieren. Übrigens könnte man es wagen, die Konstitution selbst aufzufassen als den Niederschlag aus den akzidentellen Einwirkungen auf die unendlich große Reihe der Ahnen.. Das ergibt sozusagen ein Klischee (oder auch mehrere), welches im Laufe des Lebens regelmäßig wiederholt, neu abgedruckt wird, insoweit die äußeren Umstände und die Natur der zugänglichen Liebesobjekte es gestatten, welches gewiß auch gegen rezente Eindrücke nicht völlig unveränderlich ist. Unsere Erfahrungen haben nun ergeben, daß von diesen das Liebesleben bestimmenden Regungen nur ein Anteil die volle psychische Entwicklung durchgemacht hat; dieser Anteil ist der Realität zugewendet, steht der bewußten Persönlichkeit zur Verfügung und macht ein Stück von ihr aus. Ein anderer Teil dieser libidinösen Regungen ist in der Entwicklung aufgehalten worden, er ist von der bewußten Persönlichkeit wie von der Realität abgehalten, durfte sich entweder nur in der Phantasie ausbreiten oder ist gänzlich im Unbewußten verblieben, so daß er dem Bewußtsein der Persönlichkeit unbekannt ist. Wessen Liebesbedürftigkeit nun von der Realität nicht restlos befriedigt wird, der muß sich mit libidinösen Erwartungsvorstellungen jeder neu auftretenden Person zuwenden, und es ist durchaus wahrscheinlich, daß beide Portionen seiner Libido, die bewußtseinsfähige wie die unbewußte, an dieser Einstellung Anteil haben.
Es ist also völlig normal und verständlich, wenn die erwartungsvoll bereitgehaltene Libidobesetzung des teilweise Unbefriedigten sich auch der Person des Arztes zuwendet. Unserer Voraussetzung gemäß wird sich diese Besetzung an Vorbilder halten, an eines der Klischees anknüpfen, die bei der betreffenden Person vorhanden sind, oder, wie wir auch sagen können, sie wird den Arzt in eine der psychischen »Reihen« einfügen, die der Leidende bisher gebildet hat. Es entspricht den realen Beziehungen zum Arzte, wenn für diese Einreihung die Vater-Imago (nach Jungs glücklichem Ausdruck) [Fußnote]›Wandlungen und Symbole der Libido‹ (1911, 164). maßgebend wird. Aber die Übertragung ist an dieses Vorbild nicht gebunden, sie kann auch nach der Mutter- oder Bruder-Imago usw. erfolgen. Die Besonderheiten der Übertragung auf den Arzt, durch welche sie über Maß und Art dessen hinausgeht, was sich nüchtern und rationell rechtfertigen läßt, werden durch die Erwägung verständlich, daß eben nicht nur die bewußten Erwartungsvorstellungen, sondern auch die zurückgehaltenen oder unbewußten diese Übertragung hergestellt haben.
Über dieses Verhalten der Übertragung wäre weiter nichts zu sagen oder zu grübeln, wenn nicht dabei zwei Punkte unerklärt blieben, die für den Psychoanalytiker von besonderem Interesse sind. Erstens verstehen wir nicht, daß die Übertragung bei neurotischen Personen in der Analyse soviel intensiver ausfällt als bei anderen, nicht analysierten, und zweitens bleibt es rätselhaft, weshalb uns bei der Analyse die Übertragung als der stärkste Widerstand gegen die Behandlung entgegentritt, während wir sie außerhalb der Analyse als Trägerin der Heilwirkung, als Bedingung des guten Erfolges anerkennen müssen. Es ist doch eine beliebig oft zu bestätigende Erfahrung, daß, wenn die freien Assoziationen eines Patienten versagen [Fußnote]Ich meine, wenn sie wirklich ausbleiben und nicht etwa infolge eines banalen Unlustgefühles von ihm verschwiegen werden., jedesmal die Stockung beseitigt werden kann durch die Versicherung, er stehe jetzt unter der Herrschaft eines Einfalles, der sich mit der Person des Arztes oder mit etwas zu ihm Gehörigen beschäftigt. Sobald man diese Aufklärung gegeben hat, ist die Stockung beseitigt, oder man hat die Situation des Versagens in die des Verschweigens der Einfälle verwandelt.
Es scheint auf den ersten Blick ein riesiger methodischer Nachteil der Psychoanalyse zu sein, daß sich in ihr die Übertragung, sonst der mächtigste Hebel des Erfolgs, in das stärkste Mittel des Widerstandes verwandelt. Bei näherem Zusehen wird aber wenigstens das erste der beiden Probleme weggeräumt. Es ist nicht richtig, daß die Übertragung während der Psychoanalyse intensiver und ungezügelter auftritt als außerhalb derselben. Man beobachtet in Anstalten, in denen Nervöse nicht analytisch behandelt werden, die höchsten Intensitäten und die unwürdigsten Formen einer bis zur Hörigkeit gehenden Übertragung, auch die unzweideutigste erotische Färbung derselben. Eine feinsinnige Beobachterin wie die Gabriele Reuter hat dies zur Zeit, als es noch kaum eine Psychoanalyse gab, in einem merkwürdigen Buche geschildert, welches überhaupt die besten Einsichten in das Wesen und die Entstehung der Neurosen verrät [Fußnote]Aus guter Familie, 1895.. Diese Charaktere der Übertragung sind also nicht auf Rechnung der Psychoanalyse zu setzen, sondern der Neurose selbst zuzuschreiben. Das zweite Problem bleibt vorläufig unangetastet.
Diesem Problem, der Frage, warum die Übertragung uns in der Psychoanalyse als Widerstand entgegentritt, müssen wir nun näherrücken. Vergegenwärtigen wir uns die psychologische Situation der Behandlung: Eine regelmäßige und unentbehrliche Vorbedingung jeder Erkrankung an einer Psychoneurose ist der Vorgang, den Jung treffend als Introversion der Libido bezeichnet hat [Fußnote]Wenngleich manche Äußerungen Jungs den Eindruck machen, als sehe er in dieser Introversion etwas für die Dementia praecox Charakteristisches, was bei anderen Neurosen nicht ebenso in Betracht käme.. Das heißt: Der Anteil der bewußtseinsfähigen, der Realität zugewendeten Libido wird verringert, der Anteil der von der Realität abgewendeten, unbewußten, welche etwa noch die Phantasien der Person speisen darf, aber dem Unbewußten angehört, um so viel vermehrt. Die Libido hat sich (ganz oder teilweise) in die Regression begeben und die infantilen Imagines wiederbelebt [Fußnote]Es wäre bequem zu sagen: Sie hat die infantilen »Komplexe« wiederbesetzt. Aber das wäre unrichtig; einzig zu rechtfertigen wäre die Aussage: Die unbewußten Anteile dieser Komplexe. – Die außerordentliche Verschlungenheit des in dieser Arbeit behandelten Themas legt die Versuchung nahe, auf eine Anzahl von anstoßenden Problemen einzugehen, deren Klärung eigentlich erforderlich wäre, ehe man von den hier zu beschreibenden psychischen Vorgängen in unzweideutigen Worten reden könnte. Solche Probleme sind: die Abgrenzung der Introversion und der Regression gegeneinander, die Einfügung der Komplexlehre in die Libidotheorie, die Beziehungen des Phantasierens zum Bewußten und Unbewußten wie zur Realität u. a. Es bedarf keiner Entschuldigung, wenn ich an dieser Stelle diesen Versuchungen widerstanden habe.. Dorthin folgt ihr nun die analytische Kur nach, welche die Libido aufsuchen, wieder dem Bewußtsein zugänglich und endlich der Realität dienstbar machen will. Wo die analytische Forschung auf die in ihre Verstecke zurückgezogene Libido stößt, muß ein Kampf ausbrechen; alle die Kräfte, welche die Regression der Libido verursacht haben, werden sich als »Widerstände« gegen die Arbeit erheben, um diesen neuen Zustand zu konservieren. Wenn nämlich die Introversion oder Regression der Libido nicht durch eine bestimmte Relation zur Außenwelt (im allgemeinsten: durch die Versagung der Befriedigung) berechtigt und selbst für den Augenblick zweckmäßig gewesen wäre, hätte sie überhaupt nicht zustande kommen können. Die Widerstände dieser Herkunft sind aber nicht die einzigen, nicht einmal die stärksten. Die der Persönlichkeit verfügbare Libido hatte immer unter der Anziehung der unbewußten Komplexe (richtiger der dem Unbewußten angehörenden Anteile dieser Komplexe) gestanden und war in die Regression geraten, weil die Anziehung der Realität nachgelassen hatte. Um sie frei zu machen, muß nun diese Anziehung des Unbewußten überwunden, also die seither in dem Individuum konstituierte Verdrängung der unbewußten Triebe und ihrer Produktionen aufgehoben werden. Dies ergibt den bei weitem großartigeren Anteil des Widerstandes, der ja so häufig die Krankheit fortbestehen läßt, auch wenn die Abwendung von der Realität die zeitweilige Begründung wieder verloren hat. Mit den Widerständen aus beiden Quellen hat die Analyse zu kämpfen. Der Widerstand begleitet die Behandlung auf jedem Schritt; jeder einzelne Einfall, jeder Akt des Behandelten muß dem Widerstande Rechnung tragen, stellt sich als ein Kompromiß aus den zur Genesung zielenden Kräften und den angeführten, ihr widerstrebenden, dar.
Verfolgt man nun einen pathogenen Komplex von seiner (entweder als Symptom auffälligen oder auch ganz unscheinbaren) Vertretung im Bewußten gegen seine Wurzel im Unbewußten hin, so wird man bald in eine Region kommen, wo der Widerstand sich so deutlich geltend macht, daß der nächste Einfall ihm Rechnung tragen und als Kompromiß zwischen seinen Anforderungen und denen der Forschungsarbeit erscheinen muß. Hier tritt nun nach dem Zeugnisse der Erfahrung die Übertragung ein. Wenn irgend etwas aus dem Komplexstoff (dem Inhalt des Komplexes) sich dazu eignet, auf die Person des Arztes übertragen zu werden, so stellt sich diese Übertragung her, ergibt den nächsten Einfall und kündigt sich durch die Anzeichen eines Widerstandes, etwa durch eine Stockung, an. Wir schließen aus dieser Erfahrung, daß diese Übertragungsidee darum vor allen anderen Einfallsmöglichkeiten zum Bewußtsein durchgedrungen ist, weil sie auch dem Widerstande Genüge tut. Ein solcher Vorgang wiederholt sich im Verlaufe einer Analyse ungezählte Male. Immer wieder wird, wenn man sich einem pathogenen Komplexe annähert, zuerst der zur Übertragung befähigte Anteil des Komplexes ins Bewußtsein vorgeschoben und mit der größten Hartnäckigkeit verteidigt [Fußnote]Woraus man aber nicht allgemein auf eine besondere pathogene Bedeutsamkeit des zum Übertragungswiderstand gewählten Elementes schließen darf. Wenn in einer Schlacht um den Besitz eines gewissen Kirchleins oder eines einzelnen Gehöfts mit besonderer Erbitterung gestritten wird, braucht man nicht anzunehmen, daß die Kirche etwa ein Nationalheiligtum sei oder daß das Haus den Armeeschatz berge. Der Wert der Objekte kann ein bloß taktischer sein, vielleicht nur in dieser einen Schlacht zur Geltung kommen..
Nach seiner Überwindung macht die der anderen Komplexbestandteile wenig Schwierigkeiten mehr. Je länger eine analytische Kur dauert und je deutlicher der Kranke erkannt hat, daß Entstellungen des pathogenen Materials allein keinen Schutz gegen die Aufdeckung bieten, desto konsequenter bedient er sich der einen Art von Entstellung, die ihm offenbar die größten Vorteile bringt, der Entstellung durch Übertragung. Diese Verhältnisse nehmen die Richtung nach einer Situation, in welcher schließlich alle Konflikte auf dem Gebiete der Übertragung ausgefochten werden müssen.
So erscheint uns die Übertragung in der analytischen Kur zunächst immer nur als die stärkste Waffe des Widerstandes, und wir dürfen den Schluß ziehen, daß die Intensität und Ausdauer der Übertragung eine Wirkung und ein Ausdruck des Widerstandes seien. Der Mechanismus der Übertragung ist zwar durch ihre Zurückführung auf die Bereitschaft der Libido erledigt, die im Besitze infantiler Imagines geblieben ist; die Aufklärung ihrer Rolle in der Kur gelingt aber nur, wenn man auf ihre Beziehungen zum Widerstände eingeht.
Woher kommt es, daß sich die Übertragung so vorzüglich zum Mittel des Widerstandes eignet? Man sollte meinen, diese Antwort wäre nicht schwer zu geben. Es ist ja klar, daß das Geständnis einer jeden verpönten Wunschregung besonders erschwert wird, wenn es vor jener Person abgelegt werden soll, der die Regung selbst gilt. Diese Nötigung ergibt Situationen, die in der Wirklichkeit als kaum durchführbar erscheinen. Gerade das will nun der Analysierte erzielen, wenn er das Objekt seiner Gefühlsregungen mit dem Arzte zusammenfallen läßt. Eine nähere Überlegung zeigt aber, daß dieser scheinbare Gewinn nicht die Lösung des Problems ergeben kann. Eine Beziehung von zärtlicher, hingebungsvoller Anhänglichkeit kann ja anderseits über alle Schwierigkeiten des Geständnisses hinweghelfen. Man pflegt ja unter analogen realen Verhältnissen zu sagen: »Vor dir schäme ich mich nicht, dir kann ich alles sagen.« Die Übertragung auf den Arzt könnte also ebensowohl zur Erleichterung des Geständnisses dienen, und man verstünde nicht, warum sie eine Erschwerung hervorruft.
Die Antwort auf diese hier wiederholt gestellte Frage wird nicht durch weitere Überlegung gewonnen, sondern durch die Erfahrung gegeben, die man bei der Untersuchung der einzelnen Übertragungswiderstände in der Kur macht. Man merkt endlich, daß man die Verwendung der Übertragung zum Widerstande nicht verstehen kann, solange man an »Übertragung« schlechtweg denkt. Man muß sich entschließen, eine »positive« Übertragung von einer »negativen« zu sondern, die Übertragung zärtlicher Gefühle von der feindseliger, und beide Arten der Übertragung auf den Arzt gesondert zu behandeln. Die positive Übertragung zerlegt sich dann noch in die solcher freundlicher oder zärtlicher Gefühle, welche bewußtseinsfähig sind, und in die ihrer Fortsetzungen ins Unbewußte. Von den letzteren weist die Analyse nach, daß sie regelmäßig auf erotische Quellen zurückgehen, so daß wir zur Einsicht gelangen müssen, alle unsere im Leben verwertbaren Gefühlsbeziehungen von Sympathie, Freundschaft, Zutrauen und dergleichen seien genetisch mit der Sexualität verknüpft und haben sich durch Abschwächung des Sexualzieles aus rein sexuellen Begehrungen entwickelt, so rein und unsinnlich sie sich auch unserer bewußten Selbstwahrnehmung darstellen mögen. Ursprünglich haben wir nur Sexualobjekte gekannt; die Psychoanalyse zeigt uns, daß die bloß geschätzten oder verehrten Personen unserer Realität für das Unbewußte in uns immer noch Sexualobjekte sein können.
Die Lösung des Rätsels ist also, daß die Übertragung auf den Arzt sich nur insofern zum Widerstande in der Kur eignet, als sie negative Übertragung oder positive von verdrängten erotischen Regungen ist. Wenn wir durch Bewußtmachen die Übertragung »aufheben«, so lösen wir nur diese beiden Komponenten des Gefühlsaktes von der Person des Arztes ab; die andere, bewußtseinsfähige und unanstößige Komponente bleibt bestehen und ist in der Psychoanalyse genau ebenso die Trägerin des Erfolges wie bei anderen Behandlungsmethoden. Insofern gestehen wir gerne zu, die Resultate der Psychoanalyse beruhten auf Suggestion; nur muß man unter Suggestion das verstehen, was wir mit Ferenczi (1909) darin finden: die Beeinflussung eines Menschen vermittels der bei ihm möglichen Übertragungsphänomene. Für die endliche Selbständigkeit des Kranken sorgen wir, indem wir die Suggestion dazu benützen, ihn eine psychische Arbeit vollziehen zu lassen, die eine dauernde Verbesserung seiner psychischen Situation zur notwendigen Folge hat.
Es kann noch gefragt werden, warum die Widerstandsphänomene der Übertragung nur in der Psychoanalyse, nicht auch bei indifferenter Behandlung, z. B. in Anstalten, zum Vorschein kommen. Die Antwort lautet: sie zeigen sich auch dort, nur müssen sie als solche gewürdigt werden. Das Hervorbrechen der negativen Übertragung ist in Anstalten sogar recht häufig. Der Kranke verläßt eben die Anstalt ungeändert oder rückfällig, sobald er unter die Herrschaft der negativen Übertragung gerät. Die erotische Übertragung wirkt in Anstalten nicht so hemmend, da sie dort wie im Leben beschönigt, anstatt aufgedeckt wird; sie äußert sich aber ganz deutlich als Widerstand gegen die Genesung, zwar nicht, indem sie den Kranken aus der Anstalt treibt – sie hält ihn im Gegenteil in der Anstalt zurück –, wohl aber dadurch, daß sie ihn vom Leben fernehält. Für die Genesung ist es nämlich recht gleichgültig, ob der Kranke in der Anstalt diese oder jene Angst oder Hemmung überwindet; es kommt vielmehr darauf an, daß er auch in der Realität seines Lebens davon frei wird.
Die negative Übertragung verdiente eine eingehende Würdigung, die ihr im Rahmen dieser Ausführungen nicht zuteil werden kann. Bei den heilbaren Formen von Psychoneurosen findet sie sich neben der zärtlichen Übertragung, oft gleichzeitig auf die nämliche Person gerichtet, für welchen Sachverhalt Bleuler den guten Ausdruck Ambivalenz geprägt hat [Fußnote]E. Bleuler (1911). – Vortrag über Ambivalenz in Bern 1910, referiert im Zentralblatt für Psychoanalyse, 1, S. 266. – Für die gleichen Phänomene hatte W. Stekel die Bezeichnung » Bipolarität« vorgeschlagen.. Eine solche Ambivalenz der Gefühle scheint bis zu einem gewissen Maße normal zu sein, aber ein hoher Grad von Ambivalenz der Gefühle ist gewiß eine besondere Auszeichnung neurotischer Personen. Bei der Zwangsneurose scheint eine frühzeitige »Trennung der Gegensatzpaare« für das Triebleben charakteristisch zu sein und eine ihrer konstitutionellen Bedingungen darzustellen. Die Ambivalenz der Gefühlsrichtungen erklärt uns am besten die Fähigkeit der Neurotiker, ihre Übertragungen in den Dienst des Widerstandes zu stellen. Wo die Übertragungsfähigkeit im wesentlichen negativ geworden ist, wie bei den Paranoiden, da hört die Möglichkeit der Beeinflussung und der Heilung auf.
Mit alten diesen Erörterungen haben wir aber bisher nur eine Seite des Übertragungsphänomens gewürdigt; es wird erfordert, unsere Aufmerksamkeit einem anderen Aspekt derselben Sache zuzuwenden. Wer sich den richtigen Eindruck davon geholt hat, wie der Analysierte aus seinen realen Beziehungen zum Arzte herausgeschleudert wird, sobald er unter die Herrschaft eines ausgiebigen Übertragungswiderstandes gerät, wie er sich dann die Freiheit herausnimmt, die psychoanalytische Grundregel zu vernachlässigen, daß man ohne Kritik alles mitteilen solle, was einem in den Sinn kommt, wie er die Vorsätze vergißt, mit denen er in die Behandlung getreten war, und wie ihm logische Zusammenhänge und Schlüsse nun gleichgültig werden, die ihm kurz vorher den größten Eindruck gemacht hatten, der wird das Bedürfnis haben, sich diesen Eindruck noch aus anderen als den bisher angeführten Momenten zu erklären, und solche liegen in der Tat nicht ferne; sie ergeben sich wiederum aus der psychologischen Situation, in welche die Kur den Analysierten versetzt hat.
In der Aufspürung der dem Bewußten abhanden gekommenen Libido ist man in den Bereich des Unbewußten eingedrungen. Die Reaktionen, die man erzielt, bringen nun manches von den Charakteren unbewußter Vorgänge mit ans Licht, wie wir sie durch das Studium der Träume kennengelernt haben. Die unbewußten Regungen wollen nicht erinnert werden, wie die Kur es wünscht, sondern sie streben danach, sich zu reproduzieren, entsprechend der Zeitlosigkeit und der Halluzinationsfähigkeit des Unbewußten. Der Kranke spricht ähnlich wie im Traume den Ergebnissen der Erweckung seiner unbewußten Regungen Gegenwärtigkeit und Realität zu; er will seine Leidenschaften agieren, ohne auf die reale Situation Rücksicht zu nehmen. Der Arzt will ihn dazu nötigen, diese Gefühlsregungen in den Zusammenhang der Behandlung und in den seiner Lebensgeschichte einzureihen, sie der denkenden Betrachtung unterzuordnen und nach ihrem psychischen Werte zu erkennen. Dieser Kampf zwischen Arzt und Patienten, zwischen Intellekt und Triebleben, zwischen Erkennen und Agierenwollen spielt sich fast ausschließlich an den Übertragungsphänomenen ab. Auf diesem Felde muß der Sieg gewonnen werden, dessen Ausdruck die dauernde Genesung von der Neurose ist. Es ist unleugbar, daß die Bezwingung der Übertragungsphänomene dem Psychoanalytiker die größten Schwierigkeiten bereitet, aber man darf nicht vergessen, daß gerade sie uns den unschätzbaren Dienst erweisen, die verborgenen und vergessenen Liebesregungen der Kranken aktuell und manifest zu machen, denn schließlich kann niemand in absentia oder in effigie erschlagen werden.
Zur Einführung des Narzißmus (1914)
I
Der Terminus Narzißmus entstammt der klinischen Deskription und ist von P. Näcke 1899 zur Bezeichnung jenes Verhaltens gewählt worden, bei welchem ein Individuum den eigenen Leib in ähnlicher Weise behandelt wie sonst den eines Sexualobjekts, ihn also mit sexuellem Wohlgefallen beschaut, streichelt, liebkost, bis es durch diese Vornahmen zur vollen Befriedigung gelangt. In dieser Ausbildung hat der Narzißmus die Bedeutung einer Perversion, welche das gesamte Sexualleben der Person aufgesogen hat, und unterliegt darum auch den Erwartungen, mit denen wir an das Studium aller Perversionen herantreten. Es ist dann der psychoanalytischen Beobachtung aufgefallen, daß einzelne Züge des narzißtischen Verhaltens bei vielen mit anderen Störungen behafteten Personen gefunden werden, so nach Sadger bei Homosexuellen, und endlich lag die Vermutung nahe, daß eine als Narzißmus zu bezeichnende Unterbringung der Libido in viel weiterem Umfang in Betracht kommen und eine Stelle in der regulären Sexualentwicklung des Menschen beanspruchen könnte [Fußnote]O. Rank (1911).. Auf die nämliche Vermutung kam man von den Schwierigkeiten der psychoanalytischen Arbeit an Neurotikern her, denn es schien, als ob ein solches narzißtisches Verhalten derselben eine der Grenzen ihrer Beeinflußbarkeit herstellte. Narzißmus in diesem Sinne wäre keine Perversion, sondern die libidinöse Ergänzung zum Egoismus des Selbsterhaltungstriebes, von dem jedem Lebewesen mit Recht ein Stück zugeschrieben wird. Ein dringendes Motiv, sich mit der Vorstellung eines primären und normalen Narzißmus zu beschäftigen, ergab sich, als der Versuch unternommen wurde, das Verständnis der Dementia praecox (Kraepelin) oder Schizophrenie (Bleuler) unter die Voraussetzung der Libidotheorie zu bringen. Zwei fundamentale Charakterzüge zeigen solche Kranke, die ich vorgeschlagen habe, als Paraphreniker zu bezeichnen: den Größenwahn und die Abwendung ihres Interesses von der Außenwelt (Personen und Dingen). Infolge der letzteren Veränderung entziehen sie sich der Beeinflussung durch die Psychoanalyse, werden sie für unsere Bemühungen unheilbar. Die Abwendung des Paraphrenikers von der Außenwelt bedarf aber einer genaueren Kennzeichnung. Auch der Hysteriker und Zwangsneurotiker hat, soweit seine Krankheit reicht, die Beziehung zur Realität aufgegeben. Die Analyse zeigt aber, daß er die erotische Beziehung zu Personen und Dingen keineswegs aufgehoben hat. Er hält sie noch in der Phantasie fest, das heißt, er hat einerseits die realen Objekte durch imaginäre seiner Erinnerung ersetzt oder sie mit ihnen vermengt, anderseits darauf verzichtet, die motorischen Aktionen zur Erreichung seiner Ziele an diesen Objekten einzuleiten. Für diesen Zustand der Libido sollte man allein den von Jung ohne Unterscheidung gebrauchten Ausdruck: Introversion der Libido gelten lassen. Anders der Paraphreniker. Dieser scheint seine Libido von den Personen und Dingen der Außenwelt wirklich zurückgezogen zu haben, ohne diese durch andere in seiner Phantasie zu ersetzen. Wo dies dann geschieht, scheint es sekundär zu sein und einem Heilungsversuch anzugehören, welcher die Libido zum Objekt zurückführen will [Fußnote]Vgl. für diese Aufstellungen die Diskussion des »Weltunterganges« in der Analyse des Senatspräsidenten Schreber (1911). Ferner: Abraham (1908)..
Es entsteht die Frage: Welches ist das Schicksal der den Objekten entzogenen Libido bei der Schizophrenie? Der Größenwahn dieser Zustände weist hier den Weg. Er ist wohl auf Kosten der Objektlibido entstanden. Die der Außenwelt entzogene Libido ist dem Ich zugeführt worden, so daß ein Verhalten entstand, welches wir Narzißmus heißen können. Der Größenwahn selbst ist aber keine Neuschöpfung, sondern, wie wir wissen, die Vergrößerung und Verdeutlichung eines Zustandes, der schon vorher bestanden hatte. Somit werden wir dazu geführt, den Narzißmus, der durch Einbeziehung der Objektbesetzungen entsteht, als einen sekundären aufzufassen, welcher sich über einen primären, durch mannigfache Einflüsse verdunkelten aufbaut.
Ich bemerke nochmals, daß ich hier keine Klärung oder Vertiefung des Schizophrenieproblems geben will, sondern nur zusammentrage, was bereits an anderen Stellen gesagt worden ist, um eine Einführung des Narzißmus zu rechtfertigen.
Ein dritter Zufluß zu dieser, wie ich meine, legitimen Weiterbildung der Libidotheorie ergibt sich aus unseren Beobachtungen und Auffassungen des Seelenlebens von Kindern und von primitiven Völkern. Wir finden bei diesen letzteren Züge, welche, wenn sie vereinzelt wären, dem Größenwahn zugerechnet werden könnten, eine Überschätzung der Macht ihrer Wünsche und psychischen Akte, die »Allmacht der Gedanken«, einen Glauben an die Zauberkraft der Worte, eine Technik gegen die Außenwelt, die »Magie«, welche als konsequente Anwendung dieser größensüchtigen Voraussetzungen erscheint [Fußnote]S. die entsprechenden Abschnitte in meinem Buch Totem und Tabu (1912–13).. Wir erwarten eine ganz analoge Einstellung zur Außenwelt beim Kinde unserer Zeit, dessen Entwicklung für uns weit undurchsichtiger ist [Fußnote]S. Ferenczi (1913 a).. Wir bilden so die Vorstellung einer ursprünglichen Libidobesetzung des Ichs, von der später an die Objekte abgegeben wird, die aber, im Grunde genommen, verbleibt und sich zu den Objektbesetzungen verhält wie der Körper eines Protoplasmatierchens zu den von ihm ausgeschickten Pseudopodien. Dieses Stück der Libidounterbringung mußte für unsere von den neurotischen Symptomen ausgehende Forschung zunächst verdeckt bleiben. Die Emanationen dieser Libido, die Objektbesetzungen, die ausgeschickt und wieder zurückgezogen werden können, wurden uns allein auffällig. Wir sehen auch im groben einen Gegensatz zwischen der Ichlibido und der Objektlibido. Je mehr die eine verbraucht, desto mehr verarmt die andere. Als die höchste Entwicklungsphase, zu der es die letztere bringt, erscheint uns der Zustand der Verliebtheit, der sich uns wie ein Aufgeben der eigenen Persönlichkeit gegen die Objektbesetzung darstellt und seinen Gegensatz in der Phantasie (oder Selbstwahrnehmung) der Paranoiker vom Weltuntergang findet. Endlich folgern wir für die Unterscheidung der psychischen Energien, daß sie zunächst im Zustande des Narzißmus beisammen und für unsere grobe Analyse ununterscheidbar sind und daß es erst mit der Objektbesetzung möglich wird, eine Sexualenergie, die Libido, von einer Energie der Ichtriebe zu unterscheiden.
Ehe ich weitergehe, muß ich zwei Fragen berühren, welche mitten in die Schwierigkeiten des Themas leiten. Erstens: Wie verhält sich der Narzißmus, von dem wir jetzt handeln, zum Autoerotismus, den wir als einen Frühzustand der Libido beschrieben haben? Zweitens: Wenn wir dem Ich eine primäre Besetzung mit Libido zuerkennen, wozu ist es überhaupt noch nötig, eine sexuelle Libido von einer nicht sexuellen Energie der Ichtriebe zu trennen? Würde die Zugrundelegung einer einheitlichen psychischen Energie nicht alle Schwierigkeiten der Sonderung von Ichtriebenergie und Ichlibido, Ichlibido und Objektlibido ersparen? Zur ersten Frage bemerke ich: Es ist eine notwendige Annahme, daß eine dem Ich vergleichbare Einheit nicht von Anfang an im Individuum vorhanden ist; das Ich muß entwickelt werden. Die autoerotischen Triebe sind aber uranfänglich; es muß also irgend etwas zum Autoerotismus hinzukommen, eine neue psychische Aktion, um den Narzißmus zu gestalten.
Die Aufforderung, die zweite Frage in entschiedener Weise zu beantworten, muß bei jedem Psychoanalytiker ein merkliches Unbehagen erwecken. Man wehrt sich gegen das Gefühl, die Beobachtung für sterile theoretische Streitigkeiten zu verlassen, darf sich dem Versuch einer Klärung aber doch nicht entziehen. Gewiß sind Vorstellungen wie die einer Ichlibido, Ichtriebenergie und so weiter weder besonders klar faßbar noch inhaltsreich genug; eine spekulative Theorie der betreffenden Beziehungen würde vor allem einen scharf umschriebenen Begriff zur Grundlage gewinnen wollen. Allein ich meine, das ist eben der Unterschied zwischen einer spekulativen Theorie und einer auf Deutung der Empirie gebauten Wissenschaft. Die letztere wird der Spekulation das Vorrecht einer glatten, logisch unantastbaren Fundamentierung nicht neiden, sondern sich mit nebelhaft verschwindenden, kaum vorstellbaren Grundgedanken gerne begnügen, die sie im Laufe ihrer Entwicklung klarer zu erfassen hofft, eventuell auch gegen andere einzutauschen bereit ist. Diese Ideen sind nämlich nicht das Fundament der Wissenschaft, auf dem alles ruht; dies ist vielmehr allein die Beobachtung. Sie sind nicht das Unterste, sondern das Oberste des ganzen Baues und können ohne Schaden ersetzt und abgetragen werden. Wir erleben dergleichen in unseren Tagen wiederum an der Physik, deren Grundanschauungen über Materie, Kraftzentren, Anziehung und dergleichen kaum weniger bedenklich sind als die entsprechenden der Psychoanalyse.
Der Wert der Begriffe: Ichlibido, Objektlibido liegt darin, daß sie aus der Verarbeitung der intimen Charaktere neurotischer und psychotischer Vorgänge stammen. Die Sonderung der Libido in eine solche, die dem Ich eigen ist, und eine, die den Objekten angehängt wird, ist eine unerläßliche Fortführung einer ersten Annahme, welche Sexualtriebe und Ichtriebe voneinander schied. Dazu nötigte mich wenigstens die Analyse der reinen Übertragungsneurosen (Hysterie und Zwang), und ich weiß nur, daß alle Versuche, von diesen Phänomenen mit anderen Mitteln Rechenschaft zu geben, gründlich mißlungen sind.
Bei dem völligen Mangel einer irgendwie orientierenden Trieblehre ist es gestattet oder besser geboten, zunächst irgendeine Annahme in konsequenter Durchführung zu erproben, bis sie versagt oder sich bewährt. Für die Annahme einer ursprünglichen Sonderung von Sexualtrieben und anderen, Ichtrieben, spricht nun mancherlei nebst ihrer Brauchbarkeit für die Analyse der Übertragungsneurosen. Ich gebe zu, daß dieses Moment allein nicht unzweideutig wäre, denn es könnte sich um indifferente psychische Energie handeln, die erst durch den Akt der Objektbesetzung zur Libido wird. Aber diese begriffliche Scheidung entspricht erstens der populär so geläufigen Trennung von Hunger und Liebe. Zweitens machen sich biologische Rücksichten zu ihren Gunsten geltend. Das Individuum führt wirklich eine Doppelexistenz als sein Selbstzweck und als Glied in einer Kette, der es gegen, jedenfalls ohne seinen Willen dienstbar ist. Es hält selbst die Sexualität für eine seiner Absichten, während eine andere Betrachtung zeigt, daß es nur ein Anhängsel an sein Keimplasma ist, dem es seine Kräfte gegen eine Lustprämie zur Verfügung stellt, der sterbliche Träger einer – vielleicht – unsterblichen Substanz, wie ein Majoratsherr nur der jeweilige Inhaber einer ihn überdauernden Institution. Die Sonderung der Sexualtriebe von den Ichtrieben würde nur diese doppelte Funktion des Individuums spiegeln. Drittens muß man sich daran erinnern, daß all unsere psychologischen Vorläufigkeiten einmal auf den Boden organischer Träger gestellt werden sollen. Es wird dann wahrscheinlich, daß es besondere Stoffe und chemische Prozesse sind, welche die Wirkungen der Sexualität ausüben und die Fortsetzung des individuellen Lebens in das der Art vermitteln. Dieser Wahrscheinlichkeit tragen wir Rechnung, indem wir die besonderen chemischen Stoffe durch besondere psychische Kräfte substituieren.
Gerade weil ich sonst bemüht bin, alles andersartige, auch das biologische Denken, von der Psychologie fernezuhalten, will ich an dieser Stelle ausdrücklich zugestehen, daß die Annahme gesonderter Ich- und Sexualtriebe, also die Libidotheorie, zum wenigsten auf psychologischem Grunde ruht, wesentlich biologisch gestützt ist. Ich werde also auch konsequent genug sein, diese Annahme fallenzulassen, wenn sich aus der psychoanalytischen Arbeit selbst eine andere Voraussetzung über die Triebe als die besser verwertbare erheben würde. Dies ist bisher nicht der Fall gewesen. Es mag dann sein, daß die Sexualenergie, die Libido – im tiefsten Grund und in letzter Ferne –, nur ein Differenzierungsprodukt der sonst in der Psyche wirkenden Energie ist. Aber eine solche Behauptung ist nicht belangreich. Sie bezieht sich auf Dinge, die bereits so weit weg sind von den Problemen unserer Beobachtung und so wenig Kenntnisinhalt haben, daß es ebenso müßig ist, sie zu bestreiten, wie sie zu verwerten; möglicherweise hat diese Uridentität mit unseren analytischen Interessen sowenig zu tun wie die Urverwandtschaft aller Menschenrassen mit dem Nachweis der von der Erbschaftsbehörde geforderten Verwandtschaft mit dem Erblasser. Wir kommen mit all diesen Spekulationen zu nichts; da wir nicht warten können, bis uns die Entscheidungen der Trieblehre von einer anderen Wissenschaft geschenkt werden, ist es weit zweckmäßiger zu versuchen, welches Licht durch eine Synthese der psychologischen Phänomene auf jene biologischen Grundrätsel geworfen werden kann. Machen wir uns mit der Möglichkeit des Irrtums vertraut, aber lassen wir uns nicht abhalten, die ersterwählte Annahme eines Gegensatzes von Ich- und Sexualtrieben, die sich uns durch die Analyse der Übertragungsneurosen aufgedrängt hat, konsequent fortzuführen, ob sie sich widerspruchsfrei und fruchtbringend entwickeln und auch auf andere Affektionen, z. B. die Schizophrenie, anwenden läßt.
Anders stünde es natürlich, wenn der Beweis erbracht wäre, daß die Libidotheorie an der Erklärung der letztgenannten Krankheit bereits gescheitert ist. C. G. Jung hat diese Behauptung aufgestellt (1912) und mich dadurch zu den letzten Ausführungen, die ich mir gern erspart hätte, genötigt. Ich hätte es vorgezogen, den in der Analyse des Falles Schreber betretenen Weg unter Stillschweigen über dessen Voraussetzungen bis zum Ende zu gehen. Die Behauptung von Jung ist aber zum mindesten eine Voreiligkeit. Seine Begründungen sind spärlich. Er beruft sich zunächst auf mein eigenes Zeugnis, daß ich selbst mich genötigt gesehen habe, angesichts der Schwierigkeiten der Schreber-Analyse den Begriff der Libido zu erweitern, das heißt seinen sexuellen Inhalt aufzugeben, Libido mit psychischem Interesse überhaupt zusammenfallen zu lassen. Was zur Richtigstellung dieser Fehldeutung zu sagen ist, hat Ferenczi in einer gründlichen Kritik der Jungschen Arbeit bereits vorgebracht (1913 b). Ich kann dem Kritiker nur beipflichten und wiederholen, daß ich keinen derartigen Verzicht auf die Libidotheorie ausgesprochen habe. Ein weiteres Argument von Jung, es sei nicht anzunehmen, daß der Verlust der normalen Realfunktion allein durch die Zurückziehung der Libido verursacht werden könne, ist kein Argument, sondern ein Dekret; it begs the question, es nimmt die Entscheidung vorweg und erspart die Diskussion, denn ob und wie das möglich ist, sollte eben untersucht werden. In seiner nächsten großen Arbeit (1913) ist Jung an der von mir längst angedeuteten Lösung knapp vorbeigekommen: »Dabei ist nun allerdings noch in Betracht zu ziehen – worauf übrigens Freud in seiner Arbeit in dem Schreberschen Falle Bezug nimmt –, daß die Introversion der Libido sexualis zu einer Besetzung des ›Ich‹ führt, wodurch möglicherweise jener Effekt des Realitätsverlustes herausgebracht wird. Es ist in der Tat eine verlockende Möglichkeit, die Psychologie des Realitätsverlustes in dieser Art zu erklären.« Allein Jung läßt sich mit dieser Möglichkeit nicht viel weiter ein. Wenige Zeilen später tut er sie mit der Bemerkung ab, daß aus dieser Bedingung »die Psychologie eines asketischen Anachoreten hervorgehen würde, nicht aber eine Dementia praecox«. Wie wenig dieser ungeeignete Vergleich eine Entscheidung bringen kann, mag die Bemerkung lehren, daß ein solcher Anachoret, der »jede Spur von Sexualinteresse auszurotten bestrebt ist« (doch nur im populären Sinne des Wortes »sexual«), nicht einmal eine pathogene Unterbringung der Libido aufzuweisen braucht. Er mag sein sexuelles Interesse von den Menschen gänzlich abgewendet und kann es doch zum gesteigerten Interesse für Göttliches, Natürliches, Tierisches sublimiert haben, ohne einer Introversion seiner Libido auf seine Phantasien oder einer Rückkehr derselben zu seinem Ich verfallen zu sein. Es scheint, daß dieser Vergleich die mögliche Unterscheidung vom Interesse aus erotischen Quellen und anderen von vornherein vernachlässigt. Erinnern wir uns ferner daran, daß die Untersuchungen der Schweizer Schule trotz all ihrer Verdienstlichkeit doch nur über zwei Punkte im Bilde der Dementia praecox Aufklärung gebracht haben, über die Existenz der von Gesunden wie von Neurotikern bekannten Komplexe und über die Ähnlichkeit ihrer Phantasiebildungen mit den Völkermythen, auf den Mechanismus der Erkrankung aber sonst kein Licht werfen konnten, so werden wir die Behauptung Jungs zurückweisen können, daß die Libidotheorie an der Bewältigung der Dementia praecox gescheitert und damit auch für die anderen Neurosen erledigt sei.
II
Ein direktes Studium des Narzißmus scheint mir durch besondere Schwierigkeiten verwehrt zu sein. Der Hauptzugang dazu wird wohl die Analyse der Paraphrenien bleiben. Wie die Übertragungsneurosen uns die Verfolgung der libidinösen Triebregungen ermöglicht haben, so werden uns die Dementia praecox und Paranoia die Einsicht in die Ichpsychologie gestatten. Wiederum werden wir das anscheinend Einfache des Normalen aus den Verzerrungen und Vergröberungen des Pathologischen erraten müssen. Immerhin bleiben uns einige andere Wege offen, um uns der Kenntnis des Narzißmus anzunähern, die ich nun der Reihe nach beschreiben will: die Betrachtung der organischen Krankheit, der Hypochondrie und des Liebeslebens der Geschlechter.
Mit der Würdigung des Einflusses organischer Krankheit auf die Libidoverteilung folge ich einer mündlichen Anregung von S. Ferenczi. Es ist allgemein bekannt und erscheint uns selbstverständlich, daß der von organischem Schmerz und Mißempfindungen Gepeinigte das Interesse an den Dingen der Außenwelt, soweit sie nicht sein Leiden betreffen, aufgibt. Genauere Beobachtung lehrt, daß er auch das libidinöse Interesse von seinen Liebesobjekten zurückzieht, aufhört zu lieben, solange er leidet. Die Banalität dieser Tatsache braucht uns nicht abzuhalten, ihr eine Übersetzung in die Ausdrucksweise der Libidotheorie zu geben. Wir würden dann sagen: Der Kranke zieht seine Libidobesetzungen auf sein Ich zurück, um sie nach der Genesung wieder auszusenden. »Einzig in der engen Höhle«, sagt W. Busch vom zahnschmerzkranken Dichter, »des Backenzahnes weilt die Seele.« Libido und Ichinteresse haben dabei das gleiche Schicksal und sind wiederum voneinander nicht unterscheidbar. Der bekannte Egoismus der Kranken deckt beides. Wir finden ihn so selbstverständlich, weil wir gewiß sind, uns im gleichen Falle ebenso zu verhalten. Das Verscheuchen noch so intensiver Liebesbereitschaft durch körperliche Störungen, der plötzliche Ersatz derselben durch völlige Gleichgültigkeit, findet in der Komik entsprechende Ausnützung.
Ähnlich wie die Krankheit bedeutet auch der Schlafzustand ein narzißtisches Zurückziehen der Libidopositionen auf die eigene Person, des genaueren, auf den einen Wunsch zu schlafen. Der Egoismus der Träume fügt sich wohl in diesen Zusammenhang ein. In beiden Fällen sehen wir, wenn auch nichts anderes, Beispiele von Veränderungen der Libidoverteilung infolge von Ichveränderung.
Die Hypochondrie äußert sich wie das organische Kranksein in peinlichen und schmerzhaften Körperempfindungen und trifft auch in der Wirkung auf die Libidoverteilung mit ihm zusammen. Der Hypochondrische zieht Interesse wie Libido – die letztere besonders deutlich – von den Objekten der Außenwelt zurück und konzentriert beides auf das ihn beschäftigende Organ. Ein Unterschied zwischen Hypochondrie und organischer Krankheit drängt sich nun vor: im letzteren Falle sind die peinlichen Sensationen durch nachweisbare Veränderungen begründet, im ersteren Falle nicht. Es würde aber ganz in den Rahmen unserer sonstigen Auffassung der Neurosenvorgänge passen, wenn wir uns entschließen würden zu sagen: Die Hypochondrie muß recht haben, die Organveränderungen dürfen auch bei ihr nicht fehlen. Worin bestünden sie nun?
Wir wollen uns hier durch die Erfahrung bestimmen lassen, daß Körpersensationen unlustiger Art, den hypochondrischen vergleichbar, auch bei den anderen Neurosen nicht fehlen. Ich habe schon früher einmal die Neigung ausgesprochen, die Hypochondrie als dritte Aktualneurose neben die Neurasthenie und die Angstneurose hinzustellen. Man geht wahrscheinlich nicht zu weit, wenn man es so darstellt, als wäre regelmäßig bei den anderen Neurosen auch ein Stückchen Hypochondrie mitausgebildet. Am schönsten sieht man dies wohl bei der Angstneurose und der sie überbauenden Hysterie. Nun ist das uns bekannte Vorbild des schmerzhaft empfindlichen, irgendwie veränderten und doch nicht im gewöhnlichen Sinne kranken Organs das Genitale in seinen Erregungszuständen. Es wird dann blutdurchströmt, geschwellt, durchfeuchtet und der Sitz mannigfaltiger Sensationen. Nennen wir die Tätigkeit einer Körperstelle, sexuell erregende Reize ins Seelenleben zu schicken, ihre Erogeneität und denken daran, daß wir durch die Erwägungen der Sexualtheorie längst an die Auffassung gewöhnt sind, gewisse andere Körperstellen – die exogenen Zonen – könnten die Genitalien vertreten und sich ihnen analog verhalten, so haben wir hier nur einen Schritt weiter zu wagen. Wir können uns entschließen, die Erogeneität als allgemeine Eigenschaft aller Organe anzusehen, und dürfen dann von der Steigerung oder Herabsetzung derselben an einem bestimmten Körperteile sprechen. Jeder solchen Veränderung der Erogeneität in den Organen könnte eine Veränderung der Libidobesetzung im Ich parallel gehen. In solchen Momenten hätten wir das zu suchen, was wir der Hypochondrie zugrunde legen und was die nämliche Einwirkung auf die Libidoverteilung haben kann wie die materielle Erkrankung der Organe.
Wir merken, wenn wir diesen Gedankengang fortsetzen, stoßen wir auf das Problem nicht nur der Hypochondrie, sondern auch der anderen Aktualneurosen, der Neurasthenie und der Angstneurose. Wir wollen darum an dieser Stelle haltmachen; es liegt nicht in der Absicht einer rein psychologischen Untersuchung, die Grenze so weit ins Gebiet der physiologischen Forschung zu überschreiten. Es sei nur erwähnt, daß sich von hier aus vermuten läßt, die Hypochondrie stehe in einem ähnlichen Verhältnis zur Paraphrenie wie die anderen Aktualneurosen zur Hysterie und Zwangsneurose, hänge also von der Ichlibido ab, wie die anderen von der Objektlibido; die hypochondrische Angst sei das Gegenstück von der Ichlibido her zur neurotischen Angst. Ferner: Wenn wir mit der Vorstellung bereits vertraut sind, den Mechanismus der Erkrankung und Symptombildung bei den Übertragungsneurosen, den Fortschritt von der Introversion zur Regression, an eine Stauung der Objektlibido zu knüpfen [Fußnote]Vgl. ›Über neurotische Erkrankungstypen‹ (1912 c), so dürfen wir auch der Vorstellung einer Stauung der Ichlibido nähertreten und sie in Beziehung zu den Phänomenen der Hypochondrie und der Paraphrenie bringen.
Natürlich wird unsere Wißbegierde hier die Frage aufwerfen, warum eine solche Libidostauung im Ich als unlustvoll empfunden werden muß. Ich möchte mich da mit der Antwort begnügen, daß Unlust überhaupt der Ausdruck der höheren Spannung ist, daß es also eine Quantität des materiellen Geschehens ist, die sich hier wie anderwärts in die psychische Qualität der Unlust umsetzt; für die Unlustentwicklung mag dann immerhin nicht die absolute Größe jenes materiellen Vorganges entscheidend sein, sondern eher eine gewisse Funktion dieser absoluten Größe. Von hier aus mag man es selbst wagen, an die Frage heranzutreten, woher denn überhaupt die Nötigung für das Seelenleben rührt, über die Grenzen des Narzißmus hinauszugehen und die Libido auf Objekte zu setzen. Die aus unserem Gedankengang abfolgende Antwort würde wiederum sagen, diese Nötigung trete ein, wenn die Ichbesetzung mit Libido ein gewisses Maß überschritten habe. Ein starker Egoismus schützt vor Erkrankung, aber endlich muß man beginnen zu lieben, um nicht krank zu werden, und muß erkranken, wenn man infolge von Versagung nicht lieben kann. Etwa nach dem Vorbild, wie sich H. Heine die Psychogenese der Weltschöpfung vorstellt:
»Krankheit ist wohl der letzte Grund Des ganzen Schöpferdrangs gewesen; Erschaffend konnte ich genesen, Erschaffend wurde ich gesund.«
Wir haben in unserem seelischen Apparat vor allem ein Mittel erkannt, welchem die Bewältigung von Erregungen übertragen ist, die sonst peinlich empfunden oder pathogen wirksam würden. Die psychische Bearbeitung leistet Außerordentliches für die innere Ableitung von Erregungen, die einer unmittelbaren äußeren Abfuhr nicht fähig sind oder für die eine solche nicht augenblicklich wünschenswert wäre. Für eine solche innere Verarbeitung ist es aber zunächst gleichgültig, ob sie an realen oder an imaginierten Objekten geschieht. Der Unterschied zeigt sich erst später, wenn die Wendung der Libido auf die irrealen Objekte (Introversion) zu einer Libidostauung geführt hat. Eine ähnliche innere Verarbeitung der ins Ich zurückgekehrten Libido gestattet bei den Paraphrenien der Größenwahn; vielleicht wird erst nach seinem Versagen die Libidostauung im Ich pathogen und regt den Heilungsprozeß an, der uns als Krankheit imponiert.
Ich versuche an dieser Stelle, einige kleine Schritte weit in den Mechanismus der Paraphrenie einzudringen, und stelle die Auffassungen zusammen, welche mir schon heute beachtenswert erscheinen. Den Unterschied dieser Affektionen von den Übertragungsneurosen verlege ich in den Umstand, daß die durch Versagung frei gewordene Libido nicht bei Objekten in der Phantasie bleibt, sondern sich aufs Ich zurückzieht; der Größenwahn entspricht dann der psychischen Bewältigung dieser Libidomenge, also der Introversion auf die Phantasiebildungen bei den Übertragungsneurosen; dem Versagen dieser psychischen Leistung entspringt die Hypochondrie der Paraphrenie, welche der Angst der Übertragungsneurosen homolog ist. Wir wissen, daß diese Angst durch weitere psychische Bearbeitung ablösbar ist, also durch Konversion, Reaktionsbildung, Schutzbildung (Phobie). Diese Stellung nimmt bei den Paraphrenien der Restitutionsversuch ein, dem wir die auffälligen Krankheitserscheinungen danken. Da die Paraphrenie häufig – wenn nicht zumeist – eine bloß partielle Ablösung der Libido von den Objekten mit sich bringt, so ließen sich in ihrem Bilde drei Gruppen von Erscheinungen sondern: 1) die der erhaltenen Normalität oder Neurose (Resterscheinungen), 2) die des Krankheitsprozesses (der Ablösung der Libido von den Objekten, dazu der Größenwahn, die Hypochondrie, die Affektstörung, alle Regressionen), 3) die der Restitution, welche nach Art einer Hysterie (Dementia praecox, eigentliche Paraphrenie) oder einer Zwangsneurose (Paranoia) die Libido wieder an die Objekte heftet. Diese neuerliche Libidobesetzung geschieht von einem anderen Niveau her, unter anderen Bedingungen als die primäre. Die Differenz der bei ihr geschaffenen Übertragungsneurosen von den entsprechenden Bildungen des normalen Ichs müßte die tiefste Einsicht in die Struktur unseres seelischen Apparates vermitteln können.
Einen dritten Zugang zum Studium des Narzißmus gestattet das Liebesleben der Menschen in seiner verschiedenartigen Differenzierung bei Mann und Weib. Ähnlich, wie die Objektlibido unserer Beobachtung zuerst die Ichlibido verdeckt hat, so haben wir auch bei der Objektwahl des Kindes (und Heranwachsenden) zuerst gemerkt, daß es seine Sexualobjekte seinen Befriedigungserlebnissen entnimmt. Die ersten autoerotischen sexuellen Befriedigungen werden im Anschluß an lebenswichtige, der Selbsterhaltung dienende Funktionen erlebt. Die Sexualtriebe lehnen sich zunächst an die Befriedigung der Ichtriebe an, machen sich erst später von den letzteren selbständig; die Anlehnung zeigt sich aber noch darin, daß die Personen, welche mit der Ernährung, Pflege, dem Schutz des Kindes zu tun haben, zu den ersten Sexualobjekten werden, also zunächst die Mutter oder ihr Ersatz. Neben diesem Typus und dieser Quelle der Objektwahl, den man den Anlehnungstypus heißen kann, hat uns aber die analytische Forschung einen zweiten kennen gelehrt, den zu finden wir nicht vorbereitet waren. Wir haben, besonders deutlich bei Personen, deren Libidoentwicklung eine Störung erfahren hat, wie bei Perversen und Homosexuellen, gefunden, daß sie ihr späteres Liebesobjekt nicht nach dem Vorbild der Mutter wählen, sondern nach dem ihrer eigenen Person. Sie suchen offenkundigerweise sich selbst als Liebesobjekt, zeigen den narzißtisch zu nennenden Typus der Objektwahl. In dieser Beobachtung ist das stärkste Motiv zu erkennen, welches uns zur Annahme des Narzißmus genötigt hat.
Wir haben nun nicht geschlossen, daß die Menschen in zwei scharf geschiedene Gruppen zerfallen, je nachdem sie den Anlehnungs- oder den narzißtischen Typus der Objektwahl haben, sondern ziehen die Annahme vor, daß jedem Menschen beide Wege zur Objektwahl offenstehen, wobei der eine oder der andere bevorzugt werden kann. Wir sagen, der Mensch habe zwei ursprüngliche Sexualobjekte: sich selbst und das pflegende Weib, und setzen dabei den primären Narzißmus jedes Menschen voraus, der eventuell in seiner Objektwahl dominierend zum Ausdruck kommen kann.
Die Vergleichung von Mann und Weib zeigt dann, daß sich in deren Verhältnis zum Typus der Objektwahl fundamentale, wenn auch natürlich nicht regelmäßige, Unterschiede ergeben. Die volle Objektliebe nach dem Anlehnungstypus ist eigentlich für den Mann charakteristisch. Sie zeigt die auffällige Sexualüberschätzung, welche wohl dem ursprünglichen Narzißmus des Kindes entstammt und somit einer Übertragung desselben auf das Sexualobjekt entspricht. Diese Sexualüberschätzung gestattet die Entstehung des eigentümlichen, an neurotischen Zwang mahnenden Zustandes der Verliebtheit, der sich so auf eine Verarmung des Ichs an Libido zugunsten des Objektes zurückführt. Anders gestaltet sich die Entwicklung bei dem häufigsten, wahrscheinlich reinsten und echtesten Typus des Weibes. Hier scheint mit der Pubertätsentwicklung durch die Ausbildung der bis dahin latenten weiblichen Sexualorgane eine Steigerung des ursprünglichen Narzißmus aufzutreten, welche der Gestaltung einer ordentlichen, mit Sexualüberschätzung ausgestatteten Objektliebe ungünstig ist. Es stellt sich besonders im Falle der Entwicklung zur Schönheit eine Selbstgenügsamkeit des Weibes her, welche das Weib für die ihm sozial verkümmerte Freiheit der Objektwahl entschädigt. Solche Frauen lieben, strenggenommen, nur sich selbst mit ähnlicher Intensität, wie der Mann sie liebt. Ihr Bedürfnis geht auch nicht dahin zu lieben, sondern geliebt zu werden, und sie lassen sich den Mann gefallen, welcher diese Bedingung erfüllt. Die Bedeutung dieses Frauentypus für das Liebesleben der Menschen ist sehr hoch einzuschätzen. Solche Frauen üben den größten Reiz auf die Männer aus, nicht nur aus ästhetischen Gründen, weil sie gewöhnlich die schönsten sind, sondern auch infolge interessanter psychologischer Konstellationen. Es erscheint nämlich deutlich erkennbar, daß der Narzißmus einer Person eine große Anziehung auf diejenigen anderen entfaltet, welche sich des vollen Ausmaßes ihres eigenen Narzißmus begeben haben und sich in der Werbung um die Objektliebe befinden; der Reiz des Kindes beruht zum guten Teil auf dessen Narzißmus, seiner Selbstgenügsamkeit und Unzugänglichkeit, ebenso der Reiz gewisser Tiere, die sich um uns nicht zu kümmern scheinen, wie der Katzen und großen Raubtiere, ja selbst der große Verbrecher und der Humorist zwingen in der poetischen Darstellung unser Interesse durch die narzißtische Konsequenz, mit welcher sie alles ihr Ich Verkleinernde von ihm fernzuhalten wissen. Es ist so, als beneideten wir sie um die Erhaltung eines seligen psychischen Zustandes, einer unangreifbaren Libidoposition, die wir selbst seither aufgegeben haben. Dem großen Reiz des narzißtischen Weibes fehlt aber die Kehrseite nicht; ein guter Teil der Unbefriedigung des verliebten Mannes, der Zweifel an der Liebe des Weibes, der Klagen über die Rätsel im Wesen desselben hat in dieser Inkongruenz der Objektwahltypen seine Wurzel.
Vielleicht ist es nicht überflüssig zu versichern, daß mir bei dieser Schilderung des weiblichen Liebeslebens jede Tendenz zur Herabsetzung des Weibes fernliegt. Abgesehen davon, daß mir Tendenzen überhaupt fernliegen, ich weiß auch, daß diese Ausbildungen nach verschiedenen Richtungen der Differenzierung von Funktionen in einem höchst komplizierten biologischen Zusammenhang entsprechen; ich bin ferner bereit zuzugestehen, daß es unbestimmt viele Frauen gibt, die nach dem männlichen Typus lieben und auch die dazugehörige Sexualüberschätzung entfalten.
Auch für die narzißtisch und gegen den Mann kühl gebliebenen Frauen gibt es einen Weg, der sie zur vollen Objektliebe führt. In dem Kinde, das sie gebären, tritt ihnen ein Teil des eigenen Körpers wie ein fremdes Objekt gegenüber, dem sie nun vom Narzißmus aus die volle Objektliebe schenken können. Noch andere Frauen brauchen nicht auf das Kind zu warten, um den Schritt in der Entwicklung vom (sekundären) Narzißmus zur Objektliebe zu machen. Sie haben sich selbst vor der Pubertät männlich gefühlt und ein Stück weit männlich entwickelt; nachdem diese Strebung mit dem Auftreten der weiblichen Reife abgebrochen wurde, bleibt ihnen die Fähigkeit, sich nach einem männlichen Ideal zu sehnen, welches eigentlich die Fortsetzung des knabenhaften Wesens ist, das sie selbst einmal waren.
Eine kurze Übersicht der Wege zur Objektwahl mag diese andeutenden Bemerkungen beschließen. Man liebt:
1) Nach dem narzißtischen Typus:
a) was man selbst ist (sich selbst),
b) was man selbst war,
c) was man selbst sein möchte,
d) die Person, die ein Teil des eigenen Selbst war.
2) Nachdem Anlehnungstypus:
a) die nährende Frau,
b) den schützenden Mann
und die in Reihen von ihnen ausgehenden Ersatzpersonen. Der Fall c) des ersten Typus kann erst durch später folgende Ausführungen gerechtfertigt werden.
Die Bedeutung der narzißtischen Objektwahl für die Homosexualität des Mannes bleibt in anderem Zusammenhange zu würdigen.
Der von uns supponierte primäre Narzißmus des Kindes, der eine der Voraussetzungen unserer Libidotheorien enthält, ist weniger leicht durch direkte Beobachtung zu erfassen als durch Rückschluß von einem anderen Punkte her zu bestätigen. Wenn man die Einstellung zärtlicher Eltern gegen ihre Kinder ins Auge faßt, muß man sie als Wiederaufleben und Reproduktion des eigenen, längst aufgegebenen Narzißmus erkennen. Das gute Kennzeichen der Überschätzung, welches wir als narzißtisches Stigma schon bei der Objektwahl gewürdigt haben, beherrscht, wie allbekannt, diese Gefühlsbeziehung. So besteht ein Zwang, dem Kinde alle Vollkommenheiten zuzusprechen, wozu nüchterne Beobachtung keinen Anlaß fände, und alle seine Mängel zu verdecken und zu vergessen, womit ja die Verleugnung der kindlichen Sexualität im Zusammenhange steht. Es besteht aber auch die Neigung, alle kulturellen Erwerbungen, deren Anerkennung man seinem Narzißmus abgezwungen hat, vor dem Kinde zu suspendieren und die Ansprüche auf längst aufgegebene Vorrechte bei ihm zu erneuern. Das Kind soll es besser haben als seine Eltern, es soll den Notwendigkeiten, die man als im Leben herrschend erkannt hat, nicht unterworfen sein. Krankheit, Tod, Verzicht auf Genuß, Einschränkung des eigenen Willens sollen für das Kind nicht gelten, die Gesetze der Natur wie der Gesellschaft vor ihm haltmachen, es soll wirklich wieder Mittelpunkt und Kern der Schöpfung sein. His Majesty the Baby, wie man sich einst selbst dünkte. Es soll die unausgeführten Wunschträume der Eltern erfüllen, ein großer Mann und Held werden an Stelle des Vaters, einen Prinzen zum Gemahl bekommen zur späten Entschädigung der Mutter. Der heikelste Punkt des narzißtischen Systems, die von der Realität hart bedrängte Unsterblichkeit des Ichs, hat ihre Sicherung in der Zuflucht zum Kinde gewonnen. Die rührende, im Grunde so kindliche Elternliebe ist nichts anderes als der wiedergeborene Narzißmus der Eltern, der in seiner Umwandlung zur Objektliebe sein einstiges Wesen unverkennbar offenbart.
III
Welchen Störungen der ursprüngliche Narzißmus des Kindes ausgesetzt ist und mit welchen Reaktionen er sich derselben erwehrt, auch auf welche Bahnen er dabei gedrängt wird, das möchte ich als einen wichtigen Arbeitsstoff, welcher noch der Erledigung harrt, beiseite stellen; das bedeutsamste Stück desselben kann man als »Kastrationskomplex« (Penisangst beim Knaben, Penisneid beim Mädchen) herausheben und im Zusammenhange mit dem Einfluß der frühzeitigen Sexualeinschüchterung behandeln. Die psychoanalytische Untersuchung, welche uns sonst die Schicksale der libidinösen Triebe verfolgen läßt, wenn diese, von den Ichtrieben isoliert, sich in Opposition zu denselben befinden, gestattet uns auf diesem Gebiete Rückschlüsse auf eine Epoche und eine psychische Situation, in welcher beiderlei Triebe noch einhellig wirksam in untrennbarer Vermengung als narzißtische Interessen auftreten. A. Adler hat aus diesem Zusammenhange seinen »männlichen Protest« geschöpft, den er zur fast alleinigen Triebkraft der Charakter- wie der Neurosenbildung erhebt, während er ihn nicht auf eine narzißtische, also immer noch libidinöse Strebung, sondern auf eine soziale Wertung begründet. Vom Standpunkte der psychoanalytischen Forschung ist Existenz und Bedeutung des »männlichen Protestes« von allem Anfang an anerkannt, seine narzißtische Natur und Herkunft aus dem Kastrationskomplex aber gegen Adler vertreten worden. Er gehört der Charakterbildung an, in deren Genese er nebst vielen anderen Faktoren eingeht, und ist zur Aufklärung der Neurosenprobleme, an denen Adler nichts beachten will als die Art, wie sie dem Ichinteresse dienen, völlig ungeeignet. Ich finde es ganz unmöglich, die Genese der Neurose auf die schmale Basis des Kastrationskomplexes zu stellen, so mächtig dieser auch bei Männern unter den Widerständen gegen die Heilung der Neurose hervortreten mag. Ich kenne endlich auch Fälle von Neurosen, in denen der »männliche Protest« oder in unserem Sinne der Kastrationskomplex keine pathogene Rolle spielt oder überhaupt nicht vorkommt.
Die Beobachtung des normalen Erwachsenen zeigt dessen einstigen Größenwahn gedämpft und die psychischen Charaktere, aus denen wir seinen infantilen Narzißmus erschlossen haben, verwischt. Was ist aus seiner Ichlibido geworden? Sollen wir annehmen, daß ihr ganzer Betrag in Objektbesetzungen aufgegangen ist? Diese Möglichkeit widerspricht offenbar dem ganzen Zuge unserer Erörterungen; wir können aber auch aus der Psychologie der Verdrängung einen Hinweis auf eine andere Beantwortung der Frage entnehmen.
Wir haben gelernt, daß libidinöse Triebregungen dem Schicksal der pathogenen Verdrängung unterliegen, wenn sie in Konflikt mit den kulturellen und ethischen Vorstellungen des Individuums geraten. Unter dieser Bedingung wird niemals verstanden, daß die Person von der Existenz dieser Vorstellungen eine bloß intellektuelle Kenntnis habe, sondern stets, daß sie dieselben als maßgebend für sich anerkenne, sich den aus ihnen hervorgehenden Anforderungen unterwerfe. Die Verdrängung, haben wir gesagt, geht vom Ich aus; wir könnten präzisieren: von der Selbstachtung des Ichs. Dieselben Eindrücke, Erlebnisse, Impulse, Wunschregungen, welche der eine Mensch in sich gewähren läßt oder wenigstens bewußt verarbeitet, werden vom anderen in voller Empörung zurückgewiesen oder bereits vor ihrem Bewußtwerden erstickt. Der Unterschied der beiden aber, welcher die Bedingung der Verdrängung enthält, läßt sich leicht in Ausdrücke fassen, welche eine Bewältigung durch die Libidotheorie ermöglichen. Wir können sagen, der eine habe ein Ideal in sich aufgerichtet, an welchem er sein aktuelles Ich mißt, während dem anderen eine solche Idealbildung abgehe. Die Idealbildung wäre von Seiten des Ichs die Bedingung der Verdrängung.
Diesem Idealich gilt nun die Selbstliebe, welche in der Kindheit das wirkliche Ich genoß. Der Narzißmus erscheint auf dieses neue ideale Ich verschoben, welches sich wie das infantile im Besitz aller wertvollen Vollkommenheiten befindet. Der Mensch hat sich hier, wie jedesmal auf dem Gebiete der Libido, unfähig erwiesen, auf die einmal genossene Befriedigung zu verzichten. Er will die narzißtische Vollkommenheit seiner Kindheit nicht entbehren, und wenn er diese nicht festhalten konnte, durch die Mahnungen während seiner Entwicklungszeit gestört und in seinem Urteil geweckt, sucht er sie in der neuen Form des Ichideals wiederzugewinnen. Was er als sein Ideal vor sich hin projiziert, ist der Ersatz für den verlorenen Narzißmus seiner Kindheit, in der er sein eigenes Ideal war.
Es liegt nahe, die Beziehungen dieser Idealbildung zur Sublimierung zu untersuchen. Die Sublimierung ist ein Prozeß an der Objektlibido und besteht darin, daß sich der Trieb auf ein anderes, von der sexuellen Befriedigung entferntes Ziel wirft; der Akzent ruht dabei auf der Ablenkung vom Sexuellen. Die Idealisierung ist ein Vorgang mit dem Objekt, durch welchen dieses ohne Änderung seiner Natur vergrößert und psychisch erhöht wird. Die Idealisierung ist sowohl auf dem Gebiete der Ichlibido wie auch der Objektlibido möglich. So ist zum Beispiel die Sexualüberschätzung des Objektes eine Idealisierung desselben. Insofern also Sublimierung etwas beschreibt, was mit dem Trieb, Idealisierung etwas, was am Objekt vorgeht, sind die beiden begrifflich auseinanderzuhalten.
Die Ichidealbildung wird oft zum Schaden des Verständnisses mit der Triebsublimierung verwechselt. Wer seinen Narzißmus gegen die Verehrung eines hohen Ichideals eingetauscht hat, dem braucht darum die Sublimierung seiner libidinösen Triebe nicht gelungen zu sein. Das Ichideal fordert zwar solche Sublimierung, aber es kann sie nicht erzwingen; die Sublimierung bleibt ein besonderer Prozeß, dessen Einleitung vom Ideal angeregt werden mag, dessen Durchführung durchaus unabhängig von solcher Anregung bleibt. Man findet gerade bei den Neurotikern die höchsten Spannungsdifferenzen zwischen der Ausbildung des Ichideals und dem Maß von Sublimierung ihrer primitiven libidinösen Triebe, und es fällt im allgemeinen viel schwerer, den Idealisten von dem unzweckmäßigen Verbleib seiner Libido zu überzeugen, als den simplen, in seinen Ansprüchen genügsam gebliebenen Menschen. Das Verhältnis von Idealbildung und Sublimierung zur Verursachung der Neurose ist auch ein ganz verschiedenes. Die Idealbildung steigert, wie wir gehört haben, die Anforderungen des Ichs und ist die stärkste Begünstigung der Verdrängung; die Sublimierung stellt den Ausweg dar, wie die Anforderung erfüllt werden kann, ohne die Verdrängung herbeizuführen.
Es wäre nicht zu verwundern, wenn wir eine besondere psychische Instanz auffinden sollten, welche die Aufgabe erfüllt, über die Sicherung der narzißtischen Befriedigung aus dem Ichideal zu wachen, und in dieser Absicht das aktuelle Ich unausgesetzt beobachtet und am Ideal mißt. Wenn eine solche Instanz existiert, so kann es uns unmöglich zustoßen, sie zu entdecken; wir können sie nur als solche agnoszieren und dürfen uns sagen, daß das, was wir unser Gewissen heißen, diese Charakteristik erfüllt. Die Anerkennung dieser Instanz ermöglicht uns das Verständnis des sogenannten Beachtungs- oder richtiger Beobachtungswahnes, welcher in der Symptomatologie der paranoiden Erkrankungen so deutlich hervortritt, vielleicht auch als isolierte Erkrankung oder in eine Übertragungsneurose eingesprengt vorkommen kann. Die Kranken klagen dann darüber, daß man alle ihre Gedanken kennt, ihre Handlungen beobachtet und beaufsichtigt; sie werden von dem Walten dieser Instanz durch Stimmen informiert, welche charakteristischerweise in der dritten Person zu ihnen sprechen. (»Jetzt denkt sie wieder daran«; »jetzt geht er fort«.) Diese Klage hat recht, sie beschreibt die Wahrheit; eine solche Macht, die alle unsere Absichten beobachtet, erfährt und kritisiert, besteht wirklich, und zwar bei uns allen im normalen Leben. Der Beobachtungswahn stellt sie in regressiver Form dar, enthüllt dabei ihre Genese und den Grund, weshalb sich der Erkrankte gegen sie auflehnt.
Die Anregung zur Bildung des Ichideals, als dessen Wächter das Gewissen bestellt ist, war nämlich von dem durch die Stimme vermittelten kritischen Einfluß der Eltern ausgegangen, an welche sich im Laufe der Zeiten die Erzieher, Lehrer und als unübersehbarer, unbestimmbarer Schwarm alle anderen Personen des Milieus angeschlossen hatten. (Die Mitmenschen, die öffentliche Meinung.)
Große Beträge von wesentlich homosexueller Libido würden so zur Bildung des narzißtischen Ichideals herangezogen und finden in der Erhaltung desselben Ableitung und Befriedigung. Die Institution des Gewissens war im Grunde eine Verkörperung zunächst der elterlichen Kritik, in weiterer Folge der Kritik der Gesellschaft, ein Vorgang, wie er sich bei der Entstehung einer Verdrängungsneigung aus einem zuerst äußerlichen Verbot oder Hindernis wiederholt. Die Stimmen sowie die unbestimmt gelassene Menge werden nun von der Krankheit zum Vorschein gebracht, damit die Entwicklungsgeschichte des Gewissens regressiv reproduziert. Das Sträuben gegen diese zensorische Instanz rührt aber daher, daß die Person, dem Grundcharakter der Krankheit entsprechend, sich von all diesen Einflüssen, vom elterlichen angefangen, ablösen will, die homosexuelle Libido von ihnen zurückzieht. Ihr Gewissen tritt ihr dann in regressiver Darstellung als Einwirkung von außen feindselig entgegen.
Die Klage der Paranoia zeigt auch, daß die Selbstkritik des Gewissens im Grunde mit der Selbstbeobachtung, auf die sie gebaut ist, zusammenfällt. Dieselbe psychische Tätigkeit, welche die Funktion des Gewissens übernommen hat, hat sich also auch in den Dienst der Innenforschung gestellt, welche der Philosophie das Material für ihre Gedankenoperationen liefert. Das mag für den Antrieb zur spekulativen Systembildung, welcher die Paranoia auszeichnet, nicht gleichgültig sein [Fußnote]Nur als Vermutung füge ich an, daß die Ausbildung und Erstarkung dieser beobachtenden Instanz auch die späte Entstehung des (subjektiven) Gedächtnisses und des für unbewußte Vorgänge nicht geltenden Zeitmoments in sich fassen könnte..
Es wird uns gewiß bedeutsam sein, wenn wir die Anzeichen von der Tätigkeit dieser kritisch beobachtenden – zum Gewissen und zur philosophischen Introspektion gesteigerten – Instanz noch auf anderen Gebieten zu erkennen vermögen. Ich ziehe hier heran, was H. Silberer als das »funktionelle Phänomen« beschrieben hat, eine der wenigen Ergänzungen zur Traumlehre, deren Wert unbestreitbar ist. Silberer hat bekanntlich gezeigt, daß man in Zuständen zwischen Schlafen und Wachen die Umsetzung von Gedanken in visuelle Bilder direkt beobachten kann, daß aber unter solchen Verhältnissen häufig nicht eine Darstellung des Gedankeninhalts auftritt, sondern des Zustandes (von Bereitwilligkeit, Ermüdung usw.), in welchem sich die mit dem Schlaf kämpfende Person befindet. Ebenso hat er gezeigt, daß manche Schlüsse von Träumen und Absätze innerhalb des Trauminhaltes nichts anderes bedeuten als die Selbstwahrnehmung des Schlafens und Erwachens. Er hat also den Anteil der Selbstbeobachtung – im Sinne des paranoischen Beobachtungswahnes – an der Traumbildung nachgewiesen. Dieser Anteil ist ein inkonstanter; ich habe ihn wahrscheinlich darum übersehen, weil er in meinen eigenen Träumen keine große Rolle spielt; bei philosophisch begabten, an Introspektion gewöhnten Personen mag er sehr deutlich werden.
Wir erinnern uns, daß wir gefunden haben, die Traumbildung entstehe unter der Herrschaft einer Zensur, welche die Traumgedanken zur Entstellung nötigt. Unter dieser Zensur stellten wir uns aber keine besondere Macht vor, sondern wählten diesen Ausdruck für die den Traumgedanken zugewandte Seite der das Ich beherrschenden, verdrängenden Tendenzen. Gehen wir in die Struktur des Ichs weiter ein, so dürfen wir im Ichideal und den dynamischen Äußerungen des Gewissens auch den Traumzensor erkennen. Merkt dieser Zensor ein wenig auch während des Schlafes auf, so werden wir verstehen, daß die Voraussetzung seiner Tätigkeit, die Selbstbeobachtung und Selbstkritik, mit Inhalten, wie »jetzt ist er zu schläfrig, um zu denken« – »jetzt wacht er auf«, einen Beitrag zum Trauminhalt leistet [Fußnote]Ob die Sonderung dieser zensorischen Instanz vom anderen Ich imstande ist, die philosophische Scheidung eines Bewußtseins von einem Selbstbewußtsein psychologisch zu fundieren, kann ich hier nicht entscheiden..
Von hier aus dürfen wir die Diskussion des Selbstgefühls beim Normalen und beim Neurotischen versuchen.
Das Selbstgefühl erscheint uns zunächst als Ausdruck der Ichgröße, deren Zusammengesetztheit nicht weiter in Betracht kommt. Alles, was man besitzt oder erreicht hat, jeder durch die Erfahrung bestätigte Rest des primitiven Allmachtgefühls hilft das Selbstgefühl steigern.
Wenn wir unsere Unterscheidung von Sexual- und Ichtrieben einführen, müssen wir dem Selbstgefühl eine besonders innige Abhängigkeit von der narzißtischen Libido zuerkennen. Wir lehnen uns dabei an die zwei Grundtatsachen an, daß bei den Paraphrenien das Selbstgefühl gesteigert, bei den Übertragungsneurosen herabgesetzt ist und daß im Liebesleben das Nichtgeliebtwerden das Selbstgefühl erniedrigt, das Geliebtwerden dasselbe erhöht. Wir haben angegeben, daß Geliebtwerden das Ziel und die Befriedigung bei narzißtischer Objektwahl darstellt. Es ist ferner leicht zu beobachten, daß die Libidobesetzung der Objekte das Selbstgefühl nicht erhöht. Die Abhängigkeit vom geliebten Objekt wirkt herabsetzend; wer verliebt ist, ist demütig. Wer liebt, hat sozusagen ein Stück seines Narzißmus eingebüßt und kann es erst durch das Geliebtwerden ersetzt erhalten. In all diesen Beziehungen scheint das Selbstgefühl in Relation mit dem narzißtischen Anteil am Liebesleben zu bleiben.
Die Wahrnehmung der Impotenz, des eigenen Unvermögens zu lieben, infolge seelischer oder körperlicher Störungen, wirkt im hohen Grade herabsetzend auf das Selbstgefühl ein. Hier ist nach meinem Ermessen eine der Quellen für die so bereitwillig kundgegebenen Minderwertigkeitsgefühle der Übertragungsneurotiker zu suchen. Die Hauptquelle dieser Gefühle ist aber die Ichverarmung, welche sich aus den außerordentlich großen, dem Ich entzogenen Libidobesetzungen ergibt, also die Schädigung des Ichs durch die der Kontrolle nicht mehr unterworfenen Sexualstrebungen.
A. Adler hat mit Recht geltend gemacht, daß die Wahrnehmung eigener Organminderwertigkeiten anspornend auf ein leistungsfähiges Seelenleben wirkt und auf dem Wege der Überkompensation eine Mehrleistung hervorruft. Es wäre aber eine volle Übertreibung, wenn man jede gute Leistung nach seinem Vorgang auf diese Bedingung der ursprünglichen Organminderwertigkeit zurückführen wollte. Nicht alle Maler sind mit Augenfehlern behaftet, nicht alle Redner ursprünglich Stotterer gewesen. Es gibt auch reichlich vortreffliche Leistung auf Grund vorzüglicher Organbegabung. Für die Ätiologie der Neurose spielt organische Minderwertigkeit und Verkümmerung eine geringfügige Rolle, etwa die nämliche wie das aktuelle Wahrnehmungsmaterial für die Traumbildung. Die Neurose bedient sich desselben als Vorwand wie aller anderen tauglichen Momente. Hat man eben einer neurotischen Patientin den Glauben geschenkt, daß sie krank werden mußte, weil sie unschön, mißgebildet, reizlos sei, so daß niemand sie lieben könne, so wird man durch die nächste Neurotika eines Besseren belehrt, die in Neurose und Sexualablehnung verharrt, obwohl sie über das Durchschnittsmaß begehrenswert erscheint und begehrt wird. Die hysterischen Frauen gehören in ihrer Mehrzahl zu den anziehenden und selbst schönen Vertreterinnen ihres Geschlechts, und anderseits leistet die Häufung von Häßlichkeiten, Organverkümmerungen und Gebrechen bei den niederen Ständen unserer Gesellschaft nichts für die Frequenz neurotischer Erkrankungen in ihrer Mitte.
Die Beziehungen des Selbstgefühls zur Erotik (zu den libidinösen Objektbesetzungen) lassen sich formelhaft in folgender Weise darstellen: Man hat die beiden Fälle zu unterscheiden, ob die Liebesbesetzungen ichgerecht sind oder im Gegenteil eine Verdrängung erfahren haben. Im ersteren Falle (bei ichgerechter Verwendung der Libido) wird das Lieben wie jede andere Betätigung des Ichs gewertet. Das Lieben an sich, als Sehnen, Entbehren, setzt das Selbstgefühl herab, das Geliebtwerden, Gegenliebe finden, Besitzen des geliebten Objekts hebt es wieder. Bei verdrängter Libido wird die Liebesbesetzung als arge Verringerung des Ichs empfunden, Liebesbefriedigung ist unmöglich, die Wiederbereicherung des Ichs wird nur durch die Zurückziehung der Libido von den Objekten möglich. Die Rückkehr der Objektlibido zum Ich, deren Verwandlung in Narzißmus, stellt gleichsam wieder eine glückliche Liebe dar, und anderseits entspricht auch eine reale glückliche Liebe dem Urzustand, in welchem Objekt- und Ichlibido voneinander nicht zu unterscheiden sind.
Die Wichtigkeit und Unübersichtlichkeit des Gegenstandes möge nun die Anfügung von einigen anderen Sätzen in loserer Anordnung rechtfertigen:
Die Entwicklung des Ichs besteht in einer Entfernung vom primären Narzißmus und erzeugt ein intensives Streben, diesen wiederzugewinnen. Diese Entfernung geschieht vermittels der Libidoverschiebung auf ein von außen aufgenötigtes Ichideal, die Befriedigung durch die Erfüllung dieses Ideals.
Gleichzeitig hat das Ich die libidinösen Objektbesetzungen ausgeschickt. Es ist zugunsten dieser Besetzungen wie des Ichideals verarmt und bereichert sich wieder durch die Objektbefriedigungen wie durch die Idealerfüllung.
Ein Anteil des Selbstgefühls ist primär, der Rest des kindlichen Narzißmus, ein anderer Teil stammt aus der durch Erfahrung bestätigten Allmacht (der Erfüllung des Ichideals), ein dritter aus der Befriedigung der Objektlibido.
Das Ichideal hat die Libidobefriedigung an den Objekten unter schwierige Bedingungen gebracht, indem es einen Teil derselben durch seinen Zensor als unverträglich abweisen läßt. Wo sich ein solches Ideal nicht entwickelt hat, da tritt die betreffende sexuelle Strebung unverändert als Perversion in die Persönlichkeit ein. Wiederum ihr eigenes Ideal sein, auch in betreff der Sexualstrebungen, wie in der Kindheit, das wollen die Menschen als ihr Glück erreichen.
Die Verliebtheit besteht in einem Überströmen der Ichlibido auf das Objekt. Sie hat die Kraft, Verdrängungen aufzuheben und Perversionen wiederherzustellen. Sie erhebt das Sexualobjekt zum Sexualideal. Da sie bei dem Objekt- oder Anlehnungstypus auf Grund der Erfüllung infantiler Liebesbedingungen erfolgt, kann man sagen: Was diese Liebesbedingung erfüllt, wird idealisiert.
Das Sexualideal kann in eine interessante Hilfsbeziehung zum Ichideal treten. Wo die narzißtische Befriedigung auf reale Hindernisse stößt, kann das Sexualideal zur Ersatzbefriedigung verwendet werden. Man liebt dann nach dem Typus der narzißtischen Objektwahl das, was man war und eingebüßt hat oder was die Vorzüge besitzt, die man überhaupt nicht hat (vergleiche oben unter c). Die der obigen parallele Formel lautet: Was den dem Ich zum Ideal fehlenden Vorzug besitzt, wird geliebt. Dieser Fall der Aushilfe hat eine besondere Bedeutung für den Neurotiker, der durch seine übermäßigen Objektbesetzungen im Ich verarmt und außerstande ist, sein Ichideal zu erfüllen. Er sucht dann von seiner Libidoverschwendung an die Objekte den Rückweg zum Narzißmus, indem er sich ein Sexualideal nach dem narzißtischen Typus wählt, welches die von ihm nicht zu erreichenden Vorzüge besitzt. Dies ist die Heilung durch Liebe, welche er in der Regel der analytischen vorzieht. Ja, er kann an einen anderen Mechanismus der Heilung nicht glauben, bringt meist die Erwartung desselben in die Kur mit und richtet sie auf die Person des ihn behandelnden Arztes. Diesem Heilungsplan steht natürlich die Liebesunfähigkeit des Kranken infolge seiner ausgedehnten Verdrängungen im Wege. Hat man dieser durch die Behandlung bis zu einem gewissen Grade abgeholfen, so erlebt man häufig den unbeabsichtigten Erfolg, daß der Kranke sich nun der weiteren Behandlung entzieht, um eine Liebeswahl zu treffen und die weitere Herstellung dem Zusammenleben mit der geliebten Person zu überlassen. Man könnte mit diesem Ausgang zufrieden sein, wenn er nicht alle Gefahren der drückenden Abhängigkeit von diesem Nothelfer mit sich brächte.
Vom Ichideal aus führt ein bedeutsamer Weg zum Verständnis der Massenpsychologie. Dies Ideal hat außer seinem individuellen einen sozialen Anteil, es ist auch das gemeinsame Ideal einer Familie, eines Standes, einer Nation. Es hat außer der narzißtischen Libido einen großen Betrag der homosexuellen Libido einer Person gebunden, welcher auf diesem Wege ins Ich zurückgekehrt ist. Die Unbefriedigung durch Nichterfüllung dieses Ideals macht homosexuelle Libido frei, welche sich in Schuldbewußtsein (soziale Angst) verwandelt. Das Schuldbewußtsein war ursprünglich Angst vor der Strafe der Eltern, richtiger gesagt: vor dem Liebesverlust bei ihnen; an Stelle der Eltern ist später die unbestimmte Menge der Genossen getreten. Die häufige Verursachung der Paranoia durch Kränkung des Ichs, Versagung der Befriedigung im Bereiche des Ichideals, wird so verständlicher, auch das Zusammentreffen von Idealbildung und Sublimierung im Ichideal, die Rückbildung der Sublimierungen und eventuelle Umbildung der Ideale bei den paraphrenischen Erkrankungen.
Zur Einleitung der Behandlung (1913)
Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse I
Wer das edle Schachspiel aus Büchern erlernen will, der wird bald erfahren, daß nur die Eröffnungen und Endspiele eine erschöpfende systematische Darstellung gestatten, während die unübersehbare Mannigfaltigkeit der nach der Eröffnung beginnenden Spiele sich einer solchen versagt. Eifriges Studium von Partien, in denen Meister miteinander gekämpft haben, kann allein die Lücke in der Unterweisung ausfüllen. Ähnlichen Einschränkungen unterliegen wohl die Regeln, die man für die Ausübung der psychoanalytischen Behandlung geben kann.
Ich werde im folgenden versuchen, einige dieser Regeln für die Einleitung der Kur zum Gebrauche des praktischen Analytikers zusammenzustellen. Es sind Bestimmungen darunter, die kleinlich erscheinen mögen und es wohl auch sind. Zu ihrer Entschuldigung diene, daß es eben Spielregeln sind, die ihre Bedeutung aus dem Zusammenhange des Spielplanes schöpfen müssen. Ich tue aber gut daran, diese Regeln als »Ratschläge« auszugeben und keine unbedingte Verbindlichkeit für sie zu beanspruchen. Die außerordentliche Verschiedenheit der in Betracht kommenden psychischen Konstellationen, die Plastizität aller seelischen Vorgänge und der Reichtum an determinierenden Faktoren widersetzen sich auch einer Mechanisierung der Technik und gestatten es, daß ein sonst berechtigtes Vorgehen gelegentlich wirkungslos bleibt und ein für gewöhnlich fehlerhaftes einmal zum Ziele führt. Diese Verhältnisse hindern indes nicht, ein durchschnittlich zweckmäßiges Verhalten des Arztes festzustellen.
Die wichtigsten Indikationen für die Auswahl der Kranken habe ich bereits vor Jahren an anderer Stelle angegeben [Fußnote]›Über Psychotherapie‹, 1905.. Ich wiederhole sie darum hier nicht; sie haben unterdes die Zustimmung anderer Psychoanalytiker gefunden. Ich füge aber hinzu, daß ich mich seither gewöhnt habe, Kranke, von denen ich wenig weiß, vorerst nur provisorisch, für die Dauer von einer bis zwei Wochen, anzunehmen. Bricht man innerhalb dieser Zeit ab, so erspart man dem Kranken den peinlichen Eindruck eines verunglückten Heilungsversuches. Man hat eben nur eine Sondierung vorgenommen, um den Fall kennenzulernen und um zu entscheiden, ob er für die Psychoanalyse geeignet ist. Eine andere Art der Erprobung als einen solchen Versuch hat man nicht zur Verfügung; noch solange fortgesetzte Unterhaltungen und Ausfragungen in der Sprechstunde würden keinen Ersatz bieten. Dieser Vorversuch aber ist bereits der Beginn der Psychoanalyse und soll den Regeln derselben folgen. Man kann ihn etwa dadurch gesondert halten, daß man hauptsächlich den Patienten reden läßt und ihm von Aufklärungen nicht mehr mitteilt, als zur Fortführung seiner Erzählung durchaus unerläßlich ist.
Die Einleitung der Behandlung mit einer solchen für einige Wochen angesetzten Probezeit hat übrigens auch eine diagnostische Motivierung. Oft genug, wenn man eine Neurose mit hysterischen oder Zwangssymptomen vor sich hat, von nicht exzessiver Ausprägung und von kürzerem Bestande, also gerade solche Formen, die man als günstig für die Behandlung ansehen wollte, muß man dem Zweifel Raum geben, ob der Fall nicht einem Vorstadium einer sogenannten Dementia praecox (Schizophrenie nach Bleuler, Paraphrenie nach meinem Vorschlage) entspricht und nach kürzerer oder längerer Zeit ein ausgesprochenes Bild dieser Affektion zeigen wird. Ich bestreite es, daß es immer so leicht möglich ist, die Unterscheidung zu treffen. Ich weiß, daß es Psychiater gibt, die in der Differentialdiagnose seltener schwanken, aber ich habe mich überzeugt, daß sie ebenso häufig irren. Der Irrtum ist nur für den Psychoanalytiker verhängnisvoller als für den sogenannten klinischen Psychiater. Denn der letztere unternimmt in dem einen Falle sowenig wie in dem anderen etwas Ersprießliches; er läuft nur die Gefahr eines theoretischen Irrtums, und seine Diagnose hat nur akademisches Interesse. Der Psychoanalytiker hat aber im ungünstigen Falle einen praktischen Mißgriff begangen, er hat einen vergeblichen Aufwand verschuldet und sein Heilverfahren diskreditiert. Er kann sein Heilungsversprechen nicht halten, wenn der Kranke nicht an Hysterie oder Zwangsneurose, sondern an Paraphrenie leidet, und hat darum besonders starke Motive, den diagnostischen Irrtum zu vermeiden. In einer Probebehandlung von einigen Wochen wird er oft verdächtige Wahrnehmungen machen, die ihn bestimmen können, den Versuch nicht weiter fortzusetzen. Ich kann leider nicht behaupten, daß ein solcher Versuch regelmäßig eine sichere Entscheidung ermöglicht; es ist nur eine gute Vorsicht mehr [Fußnote]Über das Thema dieser diagnostischen Unsicherheit, über die Chancen der Analyse bei leichten Formen von Paraphrenie und über die Begründung der Ähnlichkeit beider Affektionen wäre sehr viel zu sagen, was ich in diesem Zusammenhange nicht ausführen kann. Gern würde ich nach Jungs Vorgang Hysterie und Zwangsneurose als » Übertragungsneurosen« den paraphrenischen Affektionen als » Introversionsneurosen« gegenüberstellen, wenn bei diesem Gebrauch der Begriff der »Introversion« (der Libido) nicht seinem einzig berechtigten Sinne entfremdet würde..
Lange Vorbesprechungen vor Beginn der analytischen Behandlung, eine andersartige Therapie vorher sowie frühere Bekanntschaft zwischen dem Arzte und dem zu Analysierenden haben bestimmte ungünstige Folgen, auf die man vorbereitet sein muß. Sie machen nämlich, daß der Patient dem Arzte in einer fertigen Übertragungseinstellung gegenübertritt, die der Arzt erst langsam aufdecken muß, anstatt daß er die Gelegenheit hat, das Wachsen und Werden der Übertragung von Anfang an zu beobachten. Der Patient hat so eine Zeitlang einen Vorsprung, den man ihm in der Kur nur ungern gönnt.
Gegen alle die, welche die Kur mit einem Aufschube beginnen wollen, sei man mißtrauisch. Die Erfahrung zeigt, daß sie nach Ablauf der vereinbarten Frist nicht eintreffen, auch wenn die Motivierung dieses Aufschubes, also die Rationalisierung des Vorsatzes, dem Uneingeweihten tadellos erscheint.
Besondere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn zwischen dem Arzte und dem in die Analyse eintretenden Patienten oder deren Familien freundschaftliche oder gesellschaftliche Beziehungen bestanden haben. Der Psychoanalytiker, von dem verlangt wird, daß er die Ehefrau oder das Kind eines Freundes in Behandlung nehme, darf sich darauf vorbereiten, daß ihn das Unternehmen, wie immer es ausgehe, die Freundschaft kosten wird. Er muß doch das Opfer bringen, wenn er nicht einen vertrauenswürdigen Vertreter stellen kann.
Laien wie Ärzte, welche die Psychoanalyse immer noch gern mit einer Suggestivbehandlung verwechseln, pflegen hohen Wert auf die Erwartung zu legen, welche der Patient der neuen Behandlung entgegenbringt. Sie meinen oft, mit dem einen Kranken werde man nicht viel Mühe haben, denn er habe ein großes Zutrauen zur Psychoanalyse und sei von ihrer Wahrheit und ihrer Leistungsfähigkeit voll überzeugt. Bei einem anderen werde es wohl schwerer gehen, denn er verhalte sich skeptisch und wolle nichts glauben, ehe er nicht den Erfolg an seiner eigenen Person gesehen habe. In Wirklichkeit hat aber diese Einstellung der Kranken eine recht geringe Bedeutung; sein vorläufiges Zutrauen oder Mißtrauen kommt gegen die inneren Widerstände, welche die Neurose verankern, kaum in Betracht. Die Vertrauensseligkeit des Patienten macht ja den ersten Verkehr mit ihm recht angenehm; man dankt ihm für sie, bereitet ihn aber darauf vor, daß seine günstige Voreingenommenheit an der ersten in der Behandlung auftauchenden Schwierigkeit zerschellen wird. Dem Skeptiker sagt man, daß die Analyse kein Vertrauen braucht, daß er so kritisch und mißtrauisch sein dürfe, als ihm beliebt, daß man seine Einstellung gar nicht auf die Rechnung seines Urteiles setzen wolle, denn er sei ja nicht in der Lage, sich ein verläßliches Urteil über diese Punkte zu bilden; sein Mißtrauen sei eben ein Symptom wie seine anderen Symptome, und es werde sich nicht störend erweisen, wenn er nur gewissenhaft befolgen wolle, was die Regel der Behandlung von ihm fordere.
Wer mit dem Wesen der Neurose vertraut ist, wird nicht erstaunt sein zu hören, daß auch derjenige, der sehr wohl befähigt ist, die Psychoanalyse an anderen auszuüben, sich benehmen kann wie ein anderer Sterblicher und die intensivsten Widerstände zu produzieren imstande ist, sobald er selbst zum Objekte der Psychoanalyse gemacht wird. Man bekommt dann wieder einmal den Eindruck der psychischen Tiefendimension und findet nichts Überraschendes daran, daß die Neurose in psychischen Schichten wurzelt, bis zu denen die analytische Bildung nicht hinabgedrungen ist.
Wichtige Punkte zu Beginn der analytischen Kur sind die Bestimmungen über Zeit und Geld.
In betreff der Zeit befolge ich ausschließlich das Prinzip des Vermietens einer bestimmten Stunde. Jeder Patient erhält eine gewisse Stunde meines verfügbaren Arbeitstages zugewiesen; sie ist die seine, und er bleibt für sie haftbar, auch wenn er sie nicht benützt. Diese Bestimmung, die für den Musik- oder Sprachlehrer in unserer guten Gesellschaft als selbstverständlich gilt, erscheint beim Arzte vielleicht hart oder selbst standesunwürdig. Man wird geneigt sein, auf die vielen Zufälligkeiten hinzuweisen, die den Patienten hindern mögen, jedesmal zu derselben Stunde beim Arzte zu erscheinen, und wird verlangen, daß den zahlreichen interkurrenten Erkrankungen Rechnung getragen werde, die im Verlaufe einer längeren analytischen Behandlung vorfallen können. Allein meine Antwort ist: es geht nicht anders. Bei milderer Praxis häufen sich die »gelegentlichen« Absagen so sehr, daß der Arzt seine materielle Existenz gefährdet findet. Bei strenger Einhaltung dieser Bestimmung stellt sich dagegen heraus, daß hinderliche Zufälligkeiten überhaupt nicht vorkommen und interkurrente Erkrankungen nur sehr selten. Man kommt kaum je in die Lage, eine Muße zu genießen, deren man sich als Erwerbender zu schämen hätte; man kann die Arbeit ungestört fortsetzen und entgeht der peinlichen, verwirrenden Erfahrung, daß gerade dann immer eine unverschuldete Pause in der Arbeit eintreten muß, wenn sie besonders wichtig und inhaltsreich zu werden versprach. Von der Bedeutung der Psychogenie im täglichen Leben der Menschen, von der Häufigkeit der »Schulkrankheiten« und der Nichtigkeit des Zufalls gewinnt man erst eine ordentliche Überzeugung, wenn man einige Jahre hindurch Psychoanalyse betrieben hat unter strenger Befolgung des Prinzips der Stundenmiete. Bei unzweifelhaften organischen Affektionen, die durch das psychische Interesse doch nicht ausgeschlossen werden können, unterbreche ich die Behandlung, halte mich für berechtigt, die freigewordene Stunde anders zu vergeben, und nehme den Patienten wieder auf, sobald er hergestellt ist und ich eine andere Stunde freibekommen habe.
Ich arbeite mit meinen Patienten täglich mit Ausnahme der Sonntage und der großen Festtage, also für gewöhnlich sechsmal in der Woche. Für leichte Fälle oder Fortsetzungen von weit gediehenen Behandlungen reichen auch drei Stunden wöchentlich aus. Sonst bringen Einschränkungen an Zeit weder dem Arzte noch dem Patienten Vorteil; für den Anfang sind sie ganz zu verwerfen. Schon durch kurze Unterbrechungen wird die Arbeit immer ein wenig verschüttet; wir pflegten scherzhaft von einer »Montagskruste« zu sprechen, wenn wir nach der Sonntagsruhe von neuem begannen; bei seltener Arbeit besteht die Gefahr, daß man mit dem realen Erleben des Patienten nicht Schritt halten kann, daß die Kur den Kontakt mit der Gegenwart verliert und auf Seitenwege gedrängt wird. Gelegentlich trifft man auch auf Kranke, denen man mehr Zeit als das mittlere Maß von einer Stunde widmen muß, weil sie den größeren Teil einer Stunde verbrauchen, um aufzutauen, überhaupt mitteilsam zu werden.
Eine dem Arzte unliebsame Frage, die der Kranke zu allem Anfange an ihn richtet, lautet: »Wie lange Zeit wird die Behandlung dauern? Welche Zeit brauchen Sie, um mich von meinem Leiden zu befreien?« Wenn man eine Probebehandlung von einigen Wochen vorgeschlagen hat, entzieht man sich der direkten Beantwortung dieser Frage, indem man verspricht, nach Ablauf der Probezeit eine zuverlässigere Aussage abgeben zu können. Man antwortet gleichsam wie der Äsop der Fabel dem Wanderer, der nach der Länge des Weges fragt, mit der Aufforderung: »Geh«, und erläutert den Bescheid durch die Begründung, man müsse zuerst den Schritt des Wanderers kennenlernen, ehe man die Dauer seiner Wanderung berechnen könne. Mit dieser Auskunft hilft man sich über die ersten Schwierigkeiten hinweg, aber der Vergleich ist nicht gut, denn der Neurotiker kann leicht sein Tempo verändern und zuzeiten nur sehr langsame Fortschritte machen. Die Frage nach der voraussichtlichen Dauer der Behandlung ist in Wahrheit kaum zu beantworten.
Die Einsichtslosigkeit der Kranken und die Unaufrichtigkeit der Ärzte vereinigen sich zu dem Effekt, an die Analyse die maßlosesten Ansprüche zu stellen und ihr dabei die knappste Zeit einzuräumen. Ich teile zum Beispiel aus dem Briefe einer Dame in Rußland, der vor wenigen Tagen an mich gekommen ist, folgende Daten mit. Sie ist 53 Jahre alt, seit 23 Jahren leidend, seit zehn Jahren keiner anhaltenden Arbeit mehr fähig. »Behandlung in mehreren Nervenheilanstalten« hat es nicht vermocht, ihr ein »aktives Leben« zu ermöglichen. Sie hofft durch die Psychoanalyse, über die sie gelesen hat, ganz geheilt zu werden. Aber ihre Behandlung hat ihre Familie schon so viel gekostet, daß sie keinen längeren Aufenthalt in Wien nehmen kann als sechs Wochen oder zwei Monate. Dazu kommt die Erschwerung, daß sie sich von Anfang an nur schriftlich »deutlich machen« will, denn Antasten ihrer Komplexe würde bei ihr eine Explosion hervorrufen oder sie »zeitlich verstummen lassen«. – Niemand würde sonst erwarten, daß man einen schweren Tisch mit zwei Fingern heben werde wie einen leichten Schemel oder daß man ein großes Haus in derselben Zeit bauen könne wie ein Holzhüttchen, doch sowie es sich um die Neurosen handelt, die in den Zusammenhang des menschlichen Denkens derzeit noch nicht eingereiht scheinen, vergessen selbst intelligente Personen an die notwendige Proportionalität zwischen Zeit, Arbeit und Erfolg. Übrigens eine begreifliche Folge der tiefen Unwissenheit über die Ätiologie der Neurosen. Dank dieser Ignoranz ist ihnen die Neurose eine Art »Mädchen aus der Fremde«. Man wußte nicht, woher sie kam, und darum erwartet man, daß sie eines Tages entschwunden sein wird.
Die Ärzte unterstützen diese Vertrauensseligkeit; auch wissende unter ihnen schätzen häufig die Schwere der neurotischen Erkrankungen nicht ordentlich ein. Ein befreundeter Kollege, dem ich es hoch anrechne, daß er sich nach mehreren Dezennien wissenschaftlicher Arbeit auf anderen Voraussetzungen zur Würdigung der Psychoanalyse bekehrt hat, schrieb mir einmal: »Was uns not tut, ist eine kurze, bequeme ambulatorische Behandlung der Zwangsneurosen.« Ich konnte damit nicht dienen, schämte mich und suchte mich mit der Bemerkung zu entschuldigen, daß wahrscheinlich auch die Internisten mit einer Therapie der Tuberkulose oder des Karzinoms, welche diese Vorzüge vereinte, sehr zufrieden sein würden.
Um es direkter zu sagen, es handelt sich bei der Psychoanalyse immer um lange Zeiträume, halbe oder ganze Jahre, um längere, als der Erwartung des Kranken entspricht. Man hat daher die Verpflichtung, dem Kranken diesen Sachverhalt zu eröffnen, ehe er sich endgültig für die Behandlung entschließt. Ich halte es überhaupt für würdiger, aber auch für zweckmäßiger, wenn man ihn, ohne gerade auf seine Abschreckung hinzuarbeiten, doch von vornherein auf die Schwierigkeiten und Opfer der analytischen Therapie aufmerksam macht und ihm so jede Berechtigung nimmt, später einmal zu behaupten, man habe ihn in die Behandlung, deren Umfang und Bedeutung er nicht gekannt habe, gelockt. Wer sich durch solche Mitteilungen abhalten läßt, der hätte sich später doch als unbrauchbar erwiesen. Es ist gut, eine derartige Auslese vor dem Beginne der Behandlung vorzunehmen. Mit dem Fortschritte der Aufklärung unter den Kranken wächst doch die Zahl derjenigen, welche diese erste Probe bestehen.
Ich lehne es ab, die Patienten auf eine gewisse Dauer des Ausharrens in der Behandlung zu verpflichten, gestatte jedem, die Kur abzubrechen, wann es ihm beliebt, verhehle ihm aber nicht, daß ein Abbruch nach kurzer Arbeit keinen Erfolg zurücklassen wird und ihn leicht wie eine unvollendete Operation in einen unbefriedigenden Zustand versetzen kann. In den ersten Jahren meiner psychoanalytischen Tätigkeit fand ich die größte Schwierigkeit, die Kranken zum Verbleiben zu bewegen; diese Schwierigkeit hat sich längst verschoben, ich muß jetzt ängstlich bemüht sein, sie auch zum Aufhören zu nötigen.
Die Abkürzung der analytischen Kur bleibt ein berechtigter Wunsch, dessen Erfüllung, wie wir hören werden, auf verschiedenen Wegen angestrebt wird. Es steht ihr leider ein sehr bedeutsames Moment entgegen, die Langsamkeit, mit der sich tiefgreifende seelische Veränderungen vollziehen, in letzter Linie wohl die »Zeitlosigkeit« unserer unbewußten Vorgänge. Wenn die Kranken vor die Schwierigkeit des großen Zeitaufwandes für die Analyse gestellt werden, so wissen sie nicht selten ein gewisses Auskunftsmittel vorzuschlagen. Sie teilen ihre Beschwerden in solche ein, die sie als unerträglich, und andere, die sie als nebensächlich beschreiben, und sagen: »Wenn Sie mich nur von dem einen (zum Beispiel dem Kopfschmerz, der bestimmten Angst) befreien, mit dem anderen will ich schon selbst im Leben fertig werden.« Sie überschätzen dabei aber die elektive Macht der Analyse. Gewiß vermag der analytische Arzt viel, aber er kann nicht genau bestimmen, was er zustande bringen wird. Er leitet einen Prozeß ein, den der Auflösung der bestehenden Verdrängungen, er kann ihn überwachen, fördern, Hindernisse aus dem Wege räumen, gewiß auch viel an ihm verderben. Im ganzen aber geht der einmal eingeleitete Prozeß seinen eigenen Weg und läßt sich weder seine Richtung noch die Reihenfolge der Punkte, die er angreift, vorschreiben. Mit der Macht des Analytikers über die Krankheitserscheinungen steht es also ungefähr so wie mit der männlichen Potenz. Der kräftigste Mann kann zwar ein ganzes Kind zeugen, aber nicht im weiblichen Organismus einen Kopf allein, einen Arm oder ein Bein entstehen lassen; er kann nicht einmal über das Geschlecht des Kindes bestimmen. Er leitet eben auch nur einen höchst verwickelten und durch alte Geschehnisse determinierten Prozeß ein, der mit der Lösung des Kindes von der Mutter endet. Auch die Neurose eines Menschen besitzt die Charaktere eines Organismus, ihre Teilerscheinungen sind nicht unabhängig voneinander, sie bedingen einander, pflegen sich gegenseitig zu stützen; man leidet immer nur an einer Neurose, nicht an mehreren, die zufällig in einem Individuum zusammengetroffen sind. Der Kranke, den man nach seinem Wunsche von dem einen unerträglichen Symptome befreit hat, könnte leicht die Erfahrung machen, daß nun ein bisher mildes Symptom sich zur Unerträglichkeit steigert. Wer überhaupt den Erfolg von seinen suggestiven (das heißt Übertragungs-) Bedingungen möglichst ablösen will, der tut gut daran, auch auf die Spuren elektiver Beeinflussung des Heilerfolges, die dem Arzte etwa zustehen, zu verzichten. Dem Psychoanalytiker müssen diejenigen Patienten am liebsten sein, welche die volle Gesundheit, soweit sie zu haben ist, von ihm fordern und ihm so viel Zeit zur Verfügung stellen, als der Prozeß der Herstellung verbraucht. Natürlich sind so günstige Bedingungen nur in wenig Fällen zu erwarten.
Der nächste Punkt, über den zu Beginn einer Kur entschieden werden soll, ist das Geld, das Honorar des Arztes. Der Analytiker stellt nicht in Abrede, daß Geld in erster Linie als Mittel zur Selbsterhaltung und Machtgewinnung zu betrachten ist, aber er behauptet, daß mächtige sexuelle Faktoren an der Schätzung des Geldes mitbeteiligt sind. Er kann sich dann darauf berufen, daß Geldangelegenheiten von den Kulturmenschen in ganz ähnlicher Weise behandelt werden wie sexuelle Dinge, mit derselben Zwiespältigkeit, Prüderie und Heuchelei. Er ist also von vornherein entschlossen, dabei nicht mitzutun, sondern Geldbeziehungen mit der nämlichen selbstverständlichen Aufrichtigkeit vor dem Patienten zu behandeln, zu der er ihn in Sachen des Sexuallebens erziehen will. Er beweist ihm, daß er selbst eine falsche Scham abgelegt hat, indem er unaufgefordert mitteilt, wie er seine Zeit einschätzt. Menschliche Klugheit gebietet dann, nicht große Summen zusammenkommen zu lassen, sondern nach kürzeren regelmäßigen Zeiträumen (etwa monatlich) Zahlung zu nehmen. (Man erhöht, wie bekannt, die Schätzung der Behandlung beim Patienten nicht, wenn man sie sehr wohlfeil gibt.) Das ist, wie man weiß, nicht die gewöhnliche Praxis des Nervenarztes oder des Internisten in unserer europäischen Gesellschaft. Aber der Psychoanalytiker darf sich in die Lage des Chirurgen versetzen, der aufrichtig und kostspielig ist, weil er über Behandlungen verfügt, welche helfen können. Ich meine, es ist doch würdiger und ethisch unbedenklicher, sich zu seinen wirklichen Ansprüchen und Bedürfnissen zu bekennen, als, wie es jetzt noch unter Ärzten gebräuchlich ist, den uneigennützigen Menschenfreund zu agieren, dessen Situation einem doch versagt ist, und sich dafür im stillen über die Rücksichtslosigkeit und die Ausbeutungssucht der Patienten zu grämen oder laut darüber zu schimpfen. Der Analytiker wird für seinen Anspruch auf Bezahlung noch geltend machen, daß er bei schwerer Arbeit nie so viel erwerben kann wie andere medizinische Spezialisten.
Aus denselben Gründen wird er es auch ablehnen dürfen, ohne Honorar zu behandeln, und auch zugunsten der Kollegen oder ihrer Angehörigen keine Ausnahme machen. Die letzte Forderung scheint gegen die ärztliche Kollegialität zu verstoßen; man halte sich aber vor, daß eine Gratisbehandlung für den Psychoanalytiker weit mehr bedeutet als für jeden anderen, nämlich die Entziehung eines ansehnlichen Bruchteiles seiner für den Erwerb verfügbaren Arbeitszeit (eines Achtels, Siebentels u. dgl.) auf die Dauer von vielen Monaten. Eine gleichzeitige zweite Gratisbehandlung raubt ihm bereits ein Viertel oder Drittel seiner Erwerbsfähigkeit, was der Wirkung eines schweren traumatischen Unfalles gleichzusetzen wäre.
Es fragt sich dann, ob der Vorteil für den Kranken das Opfer des Arztes einigermaßen aufwiegt. Ich darf mir wohl ein Urteil darüber zutrauen, denn ich habe durch etwa zehn Jahre täglich eine Stunde, zeitweise auch zwei, Gratisbehandlungen gewidmet, weil ich zum Zwecke der Orientierung in der Neurose möglichst widerstandsfrei arbeiten wollte. Ich fand dabei die Vorteile nicht, die ich suchte. Manche der Widerstände des Neurotikers werden durch die Gratisbehandlung enorm gesteigert, so beim jungen Weibe die Versuchung, die in der Übertragungsbeziehung enthalten ist, beim jungen Manne das aus dem Vaterkomplex stammende Sträuben gegen die Verpflichtung der Dankbarkeit, das zu den widrigsten Erschwerungen der ärztlichen Hilfeleistung gehört. Der Wegfall der Regulierung, die doch durch die Bezahlung an den Arzt gegeben ist, macht sich sehr peinlich fühlbar; das ganze Verhältnis rückt aus der realen Welt heraus; ein gutes Motiv, die Beendigung der Kur anzustreben, wird dem Patienten entzogen.
Man kann der asketischen Verdammung des Geldes ganz fernestehen und darf es doch bedauern, daß die analytische Therapie aus äußeren wie aus inneren Gründen den Armen fast unzugänglich ist. Es ist wenig dagegen zu tun. Vielleicht hat die viel verbreitete Behauptung recht, daß der weniger leicht der Neurose verfällt, wer durch die Not des Lebens zu harter Arbeit gezwungen ist. Aber ganz unbestreitbar steht die andere Erfahrung da, daß der Arme, der einmal eine Neurose zustande gebracht hat, sich dieselbe nur sehr schwer entreißen läßt. Sie leistet ihm zu gute Dienste im Kampfe um die Selbstbehauptung; der sekundäre Krankheitsgewinn, den sie ihm bringt, ist allzu bedeutend. Das Erbarmen, das die Menschen seiner materiellen Not versagt haben, beansprucht er jetzt unter dem Titel seiner Neurose und kann sich von der Forderung, seine Armut durch Arbeit zu bekämpfen, selbst freisprechen. Wer die Neurose eines Armen mit den Mitteln der Psychotherapie angreift, macht also in der Regel die Erfahrung, daß in diesem Falle eigentlich eine Aktualtherapie ganz anderer Art von ihm gefordert wird, eine Therapie, wie sie nach der bei uns heimischen Sage Kaiser Josef II. zu üben pflegte. Natürlich findet man doch gelegentlich wertvolle und ohne ihre Schuld hilflose Menschen, bei denen die unentgeltliche Behandlung nicht auf die angeführten Hindernisse stößt und schöne Erfolge erzielt.
Für den Mittelstand ist der für die Psychoanalyse benötigte Geldaufwand nur scheinbar ein übermäßiger. Ganz abgesehen davon, daß Gesundheit und Leistungsfähigkeit einerseits, ein mäßiger Geldaufwand anderseits überhaupt inkommensurabel sind: wenn man die nie aufhörenden Ausgaben für Sanatorien und ärztliche Behandlung zusammenrechnet und ihnen die Steigerung der Leistungs- und Erwerbsfähigkeit nach glücklich beendeter analytischer Kur gegenüberstellt, darf man sagen, daß die Kranken einen guten Handel gemacht haben. Es ist nichts Kostspieligeres im Leben als die Krankheit und – die Dummheit.
Ehe ich diese Bemerkungen zur Einleitung der analytischen Behandlung beschließe, noch ein Wort über ein gewisses Zeremoniell der Situation, in welcher die Kur ausgeführt wird. Ich halte an dem Rate fest, den Kranken auf einem Ruhebett lagern zu lassen, während man hinter ihm, von ihm ungesehen, Platz nimmt. Diese Veranstaltung hat einen historischen Sinn, sie ist der Rest der hypnotischen Behandlung, aus welcher sich die Psychoanalyse entwickelt hat. Sie verdient aber aus mehrfachen Gründen festgehalten zu werden. Zunächst wegen eines persönlichen Motivs, das aber andere mit mir teilen mögen. Ich vertrage es nicht, acht Stunden täglich (oder länger) von anderen angestarrt zu werden. Da ich mich während des Zuhörens selbst dem Ablauf meiner unbewußten Gedanken überlasse, will ich nicht, daß meine Mienen dem Patienten Stoff zu Deutungen geben oder ihn in seinen Mitteilungen beeinflussen. Der Patient faßt die ihm aufgezwungene Situation gewöhnlich als Entbehrung auf und sträubt sich gegen sie, besonders wenn der Schautrieb (das Voyeurtum) in seiner Neurose eine bedeutende Rolle spielt. Ich beharre aber auf dieser Maßregel, welche die Absicht und den Erfolg hat, die unmerkliche Vermengung der Übertragung mit den Einfällen des Patienten zu verhüten, die Übertragung zu isolieren und sie zur Zeit als Widerstand scharf umschrieben hervortreten zu lassen. Ich weiß, daß viele Analytiker es anders machen, aber ich weiß nicht, ob die Sucht, es anders zu machen, oder ob ein Vorteil, den sie dabei gefunden haben, mehr Anteil an ihrer Abweichung hat.
Wenn nun die Bedingungen der Kur in solcher Weise geregelt sind, erhebt sich die Frage, an welchem Punkte und mit welchem Materiale soll man die Behandlung beginnen?
Es ist im ganzen gleichgültig, mit welchem Stoffe man die Behandlung beginnt, ob mit der Lebensgeschichte, der Krankengeschichte oder den Kindheitserinnerungen des Patienten. Jedenfalls aber so, daß man den Patienten erzählen läßt und ihm die Wahl des Anfangspunktes freistellt. Man sagt ihm also: »Ehe ich Ihnen etwas sagen kann, muß ich viel über Sie erfahren haben; bitte, teilen Sie mir mit, was Sie von sich wissen.«
Nur für die Grundregel der psychoanalytischen Technik, die der Patient zu beobachten hat, macht man eine Ausnahme. Mit dieser macht man ihn von allem Anfang an bekannt: »Noch eines, ehe Sie beginnen. Ihre Erzählung soll sich doch in einem Punkte von einer gewöhnlichen Konversation unterscheiden. Während Sie sonst mit Recht versuchen, in Ihrer Darstellung den Faden des Zusammenhanges festzuhalten, und alle störenden Einfälle und Nebengedanken abweisen, um nicht, wie man sagt, aus dem Hundertsten ins Tausendste zu kommen, sollen Sie hier anders vorgehen. Sie werden beobachten, daß Ihnen während Ihrer Erzählung verschiedene Gedanken kommen, welche Sie mit gewissen kritischen Einwendungen zurückweisen möchten. Sie werden versucht sein, sich zu sagen: Dies oder jenes gehört nicht hieher, oder es ist ganz unwichtig, oder es ist unsinnig, man braucht es darum nicht zu sagen. Geben Sie dieser Kritik niemals nach und sagen Sie es trotzdem, ja gerade darum, weil Sie eine Abneigung dagegen verspüren. Den Grund für diese Vorschrift – eigentlich die einzige, die Sie befolgen sollen – werden Sie später erfahren und einsehen lernen: Sagen Sie also alles, was Ihnen durch den Sinn geht. Benehmen Sie sich so, wie zum Beispiel ein Reisender, der am Fensterplatze des Eisenbahnwagens sitzt und dem im Inneren Untergebrachten beschreibt, wie sich vor seinen Blicken die Aussicht verändert. Endlich vergessen Sie nie daran, daß Sie volle Aufrichtigkeit versprochen haben, und gehen [Fußnote]Über die Erfahrungen mit der ψα Grundregel wäre viel zu sagen. Man trifft gelegentlich auf Personen, die sich benehmen, als ob sie sich diese Regel selbst gegeben hätten. Andere sündigen gegen sie von allem Anfang an. Ihre Mitteilung ist in den ersten Stadien der Behandlung unerläßlich, auch nutzbringend; später unter der Herrschaft der Widerstände versagt der Gehorsam gegen sie, und für jeden kommt irgend einmal die Zeit, sich über sie hinauszusetzen. Man muß sich aus seiner Selbstanalyse daran erinnern, wie unwiderstehlich die Versuchung auftritt, jenen kritischen Vorwänden zur Abweisung von Einfällen nachzugeben. Von der geringen Wirksamkeit solcher Verträge, wie man sie durch die Aufstellung der ψα Grundregel mit dem Patienten schließt, kann man sich regelmäßig überzeugen, wenn sich zum erstenmal etwas Intimes über dritte Personen zur Mitteilung einstellt. Der Patient weiß, daß er alles sagen soll, aber er macht aus der Diskretion gegen andere eine neue Abhaltung. »Soll ich wirklich alles sagen? Ich habe geglaubt, das gilt nur für Dinge, die mich selbst betreffen.« Es ist natürlich unmöglich, eine analytische Behandlung durchzuführen, bei der die Beziehungen des Patienten zu anderen Personen und seine Gedanken über sie von der Mitteilung ausgenommen sind. Pour faire une omelette il faut casser des œufs (Wer ein Omelette machen will, muß Eier zerschlagen). Ein anständiger Mensch vergißt bereitwillig, was ihm von solchen Geheimnissen fremder Leute nicht wissenswert erscheint. Auch auf die Mitteilung von Namen kann man nicht verzichten; die Erzählungen des Patienten bekommen sonst etwas Schattenhaftes wie die Szenen der Natürlichen Tochter Goethes, was im Gedächtnis des Arztes nicht haften will; auch decken die zurückgehaltenen Namen den Zugang zu allerlei wichtigen Beziehungen. Man kann Namen etwa reservieren lassen, bis der Analysierte mit dem Arzt und dem Verfahren vertrauter geworden ist. Es ist sehr merkwürdig, daß die ganze Aufgabe unlösbar wird, sowie man die Reserve an einer einzigen Stelle gestattet hat. Aber man bedenke, wenn bei uns ein Asylrecht, zum Beispiel für einen einzigen Platz in der Stadt, bestände, wie lange es brauchen würde, bis alles Gesindel der Stadt auf diesem einen Platze zusammenträfe. Ich behandelte einmal einen hohen Funktionär, der durch seinen Diensteid genötigt war, gewisse Dinge als Staatsgeheimnisse vor der Mitteilung zu bewahren, und scheiterte bei ihm an dieser Einschränkung. Die psychoanalytische Behandlung muß sich über alle Rücksichten hinaussetzen, weil die Neurose und ihre Widerstände rücksichtslos sind. Sie nie über etwas hinweg, weil Ihnen dessen Mitteilung aus irgendeinem Grunde unangenehm ist.«
Patienten, die ihr Kranksein von einem bestimmten Momente an rechnen, stellen sich gewöhnlich auf die Krankheitsveranlassung ein; andere, die den Zusammenhang ihrer Neurose mit ihrer Kindheit selbst nicht verkennen, beginnen oft mit der Darstellung ihrer ganzen Lebensgeschichte. Eine systematische Erzählung erwarte man auf keinen Fall und tue nichts dazu, sie zu fördern. Jedes Stückchen der Geschichte wird später von neuem erzählt werden müssen, und erst bei diesen Wiederholungen werden die Zusätze erscheinen, welche die wichtigen, dem Kranken unbekannten Zusammenhänge vermitteln.
Es gibt Patienten, die sich von den ersten Stunden an sorgfältig auf ihre Erzählung vorbereiten, angeblich um so die bessere Ausnützung der Behandlungszeit zu sichern. Was sich so als Eifer drapiert, ist Widerstand. Man widerrate solche Vorbereitung, die nur zum Schutze gegen das Auftauchen unerwünschter Einfälle geübt wird [Fußnote]Ausnahmen lasse man nur zu für Daten wie: Familientafel, Aufenthalte, Operationen u. dgl.. Mag der Kranke noch so aufrichtig an seine löbliche Absicht glauben, der Widerstand wird seinen Anteil an der absichtlichen Vorbereitungsart fordern und es durchsetzen, daß das wertvollste Material der Mitteilung entschlüpft. Man wird bald merken, daß der Patient noch andere Methoden erfindet, um der Behandlung das Verlangte zu entziehen. Er wird sich etwa täglich mit einem intimen Freunde über die Kur besprechen und in dieser Unterhaltung alle die Gedanken unterbringen, die sich ihm im Beisein des Arztes aufdrängen sollten. Die Kur hat dann ein Leck, durch das gerade das Beste verrinnt. Es wird dann bald an der Zeit sein, dem Patienten anzuraten, daß er seine analytische Kur als eine Angelegenheit zwischen seinem Arzte und ihm selbst behandle und alle anderen Personen, mögen sie noch so nahestehend oder noch so neugierig sein, von der Mitwisserschaft ausschließe. In späteren Stadien der Behandlung ist der Patient in der Regel solchen Versuchungen nicht unterworfen.
Kranken, die ihre Behandlung geheimhalten wollen, oft darum, weil sie auch ihre Neurose geheimgehalten haben, lege ich keine Schwierigkeiten in den Weg. Es kommt natürlich nicht in Betracht, wenn infolge dieser Reservation einige der schönsten Heilerfolge ihre Wirkung auf die Mitwelt verfehlen. Die Entscheidung der Patienten für das Geheimnis bringt selbstverständlich bereits einen Zug ihrer Geheimgeschichte ans Licht.
Wenn man den Kranken einschärft, zu Beginn ihrer Behandlung möglichst wenig Personen zu Mitwissern zu machen, so schützt man sie dadurch auch einigermaßen vor den vielen feindseligen Einflüssen, die es versuchen werden, sie der Analyse abspenstig zu machen. Solche Beeinflussungen können zu Anfang der Kur verderblich werden. Späterhin sind sie meist gleichgültig oder selbst nützlich, um Widerstände, die sich verbergen wollen, zum Vorscheine zu bringen.
Bedarf der Patient während der analytischen Behandlung vorübergehend einer anderen, internen oder spezialistischen Therapie, so ist es weit zweckmäßiger, einen nicht analytischen Kollegen in Anspruch zu nehmen, als diese andere Hilfeleistung selbst zu besorgen. Kombinierte Behandlungen wegen neurotischer Leiden mit starker organischer Anlehnung sind meist undurchführbar. Die Patienten lenken ihr Interesse von der Analyse ab, sowie man ihnen mehr als einen Weg zeigt, der zur Heilung führen soll. Am besten schiebt man die organische Behandlung bis nach Abschluß der psychischen auf; würde man die erstere voranschicken, so bliebe sie in den meisten Fällen erfolglos.
Kehren wir zur Einleitung der Behandlung zurück. Man wird gelegentlich Patienten begegnen, die ihre Kur mit der ablehnenden Versicherung beginnen, daß ihnen nichts einfalle, was sie erzählen könnten, obwohl das ganze Gebiet der Lebens- und Krankheitsgeschichte unberührt vor ihnen liegt. Auf die Bitte, ihnen doch anzugeben, wovon sie sprechen sollen, gehe man nicht ein, dieses erste Mal sowenig wie spätere Male. Man halte sich vor, womit man es in solchen Fällen zu tun hat. Ein starker Widerstand ist da in die Front gerückt, um die Neurose zu verteidigen; man nehme die Herausforderung sofort an und rücke ihm an den Leib. Die energisch wiederholte Versicherung, daß es solches Ausbleiben aller Einfälle zu Anfang nicht gibt und daß es sich um einen Widerstand gegen die Analyse handle, nötigt den Patienten bald zu den vermuteten Geständnissen oder deckt ein erstes Stück seiner Komplexe auf. Es ist böse, wenn er gestehen muß, daß er sich während des Anhörens der Grundregel die Reservation geschaffen hat, dies oder jenes werde er doch für sich behalten. Minder arg, wenn er nur mitzuteilen braucht, welches Mißtrauen er der Analyse entgegenbringt oder was für abschreckende Dinge er über sie gehört habe. Stellt er diese und ähnliche Möglichkeiten, die man ihm vorhält, in Abrede, so kann man ihn durch Drängen zum Eingeständnis nötigen, daß er doch gewisse Gedanken, die ihn beschäftigen, vernachlässigt hat. Er hat an die Kur selbst gedacht, aber an nichts Bestimmtes, oder das Bild des Zimmers, in dem er sich befindet, hat ihn beschäftigt, oder er muß an die Gegenstände im Behandlungsraum denken und daß er hier auf einem Diwan liegt, was er alles durch die Auskunft »Nichts« ersetzt hat. Diese Andeutungen sind wohl verständlich; alles was an die gegenwärtige Situation anknüpft, entspricht einer Übertragung auf den Arzt, die sich zu einem Widerstande geeignet erweist. Man ist so genötigt, mit der Aufdeckung dieser Übertragung zu beginnen; von ihr aus findet sich rasch der Weg zum Eingange in das pathogene Material des Kranken. Frauen, die nach dem Inhalte ihrer Lebensgeschichte auf eine sexuelle Aggression vorbereitet sind, Männer mit überstarker verdrängter Homosexualität werden am ehesten der Analyse eine solche Verweigerung der Einfälle vorausschicken.
Wie der erste Widerstand, so können auch die ersten Symptome oder Zufallshandlungen der Patienten ein besonderes Interesse beanspruchen und einen ihre Neurose beherrschenden Komplex verraten. Ein geistreicher junger Philosoph, mit exquisiten ästhetischen Einstellungen, beeilt sich, den Hosenstreif zurechtzuzupfen, ehe er sich zur ersten Behandlung niederlegt; er erweist sich als dereinstiger Koprophile von höchstem Raffinement, wie es für den späteren Ästheten zu erwarten stand. Ein junges Mädchen zieht in der gleichen Situation hastig den Saum ihres Rockes über den vorschauenden Knöchel; sie hat damit das Beste verraten, was die spätere Analyse aufdecken wird, ihren narzißtischen Stolz auf ihre Körperschönheit und ihre Exhibitionsneigungen.
Besonders viele Patienten sträuben sich gegen die ihnen vorgeschlagene Lagerung, während der Arzt ungesehen hinter ihnen sitzt, und bitten um die Erlaubnis, die Behandlung in anderer Position durchzumachen, zumeist, weil sie den Anblick des Arztes nicht entbehren wollen. Es wird ihnen regelmäßig verweigert; man kann sie aber nicht daran hindern, daß sie sich's einrichten, einige Sätze vor Beginn der »Sitzung« zu sprechen oder nach der angekündigten Beendigung derselben, wenn sie sich vom Lager erhoben haben. Sie teilen sich so die Behandlung in einen offiziellen Abschnitt, während dessen sie sich meist sehr gehemmt benehmen, und in einen »gemütlichen«, in dem sie wirklich frei sprechen und allerlei mitteilen, was sie selbst nicht zur Behandlung rechnen. Der Arzt läßt sich diese Scheidung nicht lange gefallen, er merkt auf das vor oder nach der Sitzung Gesprochene, und indem er es bei nächster Gelegenheit verwertet, reißt er die Scheidewand nieder, die der Patient aufrichten wollte. Dieselbe wird wiederum aus dem Material eines Übertragungswiderstandes gezimmert sein.
Solange nun die Mitteilungen und Einfälle des Patienten ohne Stockung erfolgen, lasse man das Thema der Übertragung unberührt. Man warte mit dieser heikelsten aller Prozeduren, bis die Übertragung zum Widerstande geworden ist.
Die nächste Frage, vor die wir uns gestellt finden, ist eine prinzipielle. Sie lautet: Wann sollen wir mit den Mitteilungen an den Analysierten beginnen? Wann ist es Zeit, ihm die geheime Bedeutung seiner Einfälle zu enthüllen, ihn in die Voraussetzungen und technischen Prozeduren der Analyse einzuweihen?
Die Antwort hierauf kann nur lauten: Nicht eher, als bis sich eine leistungsfähige Übertragung, ein ordentlicher Rapport, bei dem Patienten hergestellt hat. Das erste Ziel der Behandlung bleibt, ihn an die Kur und an die Person des Arztes zu attachieren. Man braucht nichts anderes dazu zu tun, als ihm Zeit zu lassen. Wenn man ihm ernstes Interesse bezeugt, die anfangs auftauchenden Widerstände sorgfältig beseitigt und gewisse Mißgriffe vermeidet, stellt der Patient ein solches Attachement von selbst her und reiht den Arzt an eine der Imagines jener Personen an, von denen er Liebes zu empfangen gewohnt war. Man kann sich diesen ersten Erfolg allerdings verscherzen, wenn man von Anfang an einen anderen Standpunkt einnimmt als den der Einfühlung, etwa einen moralisierenden, oder wenn man sich als Vertreter oder Mandatar einer Partei gebärdet, des anderen Eheteiles etwa usw.
Diese Antwort schließt natürlich die Verurteilung eines Verfahrens ein, welches dem Patienten die Übersetzungen seiner Symptome mitteilen wollte, sobald man sie selbst erraten hat, oder gar einen besonderen Triumph darin erblicken würde, ihm diese »Lösungen« in der ersten Zusammenkunft ins Gesicht zu schleudern. Es wird einem geübteren Analytiker nicht schwer, die verhaltenen Wünsche eines Kranken schon aus seinen Klagen und seinem Krankenberichte deutlich vernehmbar herauszuhören; aber welches Maß von Selbstgefälligkeit und von Unbesonnenheit gehört dazu, um einem Fremden, mit allen analytischen Voraussetzungen Unvertrauten nach der kürzesten Bekanntschaft zu eröffnen, er hänge inzestuös an seiner Mutter, er hege Todeswünsche gegen seine angeblich geliebte Frau, er trage sich mit der Absicht, seinen Chef zu betrügen u. dgl.! Ich habe gehört, daß es Analytiker gibt, die sich mit solchen Augenblicksdiagnosen und Schnellbehandlungen brüsten, aber ich warne jedermann davor, solchen Beispielen zu folgen. Man wird dadurch sich und seine Sache um jeden Kredit bringen und die heftigsten Widersprüche hervorrufen, ob man nun richtig geraten hat oder nicht, ja, eigentlich um so heftigeren Widerstand, je eher man richtig geraten hat. Der therapeutische Effekt wird in der Regel zunächst gleich Null sein, die Abschreckung von der Analyse aber eine endgültige. Noch in späteren Stadien der Behandlung wird man Vorsicht üben müssen, um eine Symptomlösung und Wunschübersetzung nicht eher mitzuteilen, als bis der Patient knapp davorsteht, so daß er nur noch einen kurzen Schritt zu machen hat, um sich dieser Lösung selbst zu bemächtigen. In früheren Jahren hatte ich häufig Gelegenheit zu erfahren, daß die vorzeitige Mitteilung einer Lösung der Kur ein vorzeitiges Ende bereitete, sowohl infolge der Widerstände, die so plötzlich geweckt wurden, als auch auf Grund der Erleichterung, die mit der Lösung gegeben war.
Man wird hier die Einwendung machen: Ist es denn unsere Aufgabe, die Behandlung zu verlängern, und nicht vielmehr, sie so rasch wie möglich zu Ende zu führen? Leidet der Kranke nicht infolge seines Nichtwissens und Nichtverstehens und ist es nicht Pflicht, ihn so bald als möglich wissend zu machen, also sobald der Arzt selbst wissend geworden ist?
Die Beantwortung dieser Frage fordert zu einem kleinen Exkurs auf über die Bedeutung des Wissens und über den Mechanismus der Heilung in der Psychoanalyse.
In den frühesten Zeiten der analytischen Technik haben wir allerdings in intellektualistischer Denkeinstellung das Wissen des Kranken um das von ihm Vergessene hoch eingeschätzt und dabei kaum zwischen unserem Wissen und dem seinigen unterschieden. Wir hielten es für einen besonderen Glücksfall, wenn es gelang, Kunde von dem vergessenen Kindheitstrauma von anderer Seite her zu bekommen, zum Beispiel von Eltern, Pflegepersonen oder dem Verführer selbst, wie es in einzelnen Fällen möglich wurde, und beeilten uns, dem Kranken die Nachricht und die Beweise für ihre Richtigkeit zur Kenntnis zu bringen in der sicheren Erwartung, so Neurose und Behandlung zu einem schnellen Ende zu führen. Es war eine schwere Enttäuschung, als der erwartete Erfolg ausblieb. Wie konnte es nur zugehen, daß der Kranke, der jetzt von seinem traumatischen Erlebnis wußte, sich doch benahm, als wisse er nicht mehr davon als früher? Nicht einmal die Erinnerung an das verdrängte Trauma wollte infolge der Mitteilung und Beschreibung desselben auftauchen.
In einem bestimmten Falle hatte mir die Mutter eines hysterischen Mädchens das homosexuelle Erlebnis verraten, dem auf die Fixierung der Anfälle des Mädchens ein großer Einfluß zukam. Die Mutter hatte die Szene selbst überrascht, die Kranke aber dieselbe völlig vergessen, obwohl sie bereits den Jahren der Vorpubertät angehörte. Ich konnte nun eine lehrreiche Erfahrung machen. Jedesmal, wenn ich die Erzählung der Mutter vor dem Mädchen wiederholte, reagierte dieses mit einem hysterischen Anfalle, und nach diesem war die Mitteilung wieder vergessen. Es war kein Zweifel, daß die Kranke den heftigsten Widerstand gegen ein ihr aufgedrängtes Wissen äußerte; sie simulierte endlich Schwachsinn und vollen Gedächtnisverlust, um sich gegen meine Mitteilungen zu schützen. So mußte man sich denn entschließen, dem Wissen an sich die ihm vorgeschriebene Bedeutung zu entziehen und den Akzent auf die Widerstände zu legen, welche das Nichtwissen seinerzeit verursacht hatten und jetzt noch bereit waren, es zu verteidigen. Das bewußte Wissen aber war gegen diese Widerstände, auch wenn es nicht wieder ausgestoßen wurde, ohnmächtig.
Das befremdende Verhalten der Kranken, die ein bewußtes Wissen mit dem Nichtwissen zu vereinigen verstehen, bleibt für die sogenannte Normalpsychologie unerklärlich. Der Psychoanalyse bereitet es auf Grund ihrer Anerkennung des Unbewußten keine Schwierigkeit; das beschriebene Phänomen gehört aber zu den besten Stützen einer Auffassung, welche sich die seelischen Vorgänge topisch differenziert näherbringt. Die Kranken wissen nun von dem verdrängten Erlebnis in ihrem Denken, aber diesem fehlt die Verbindung mit jener Stelle, an welcher die verdrängte Erinnerung in irgendeiner Art enthalten ist. Eine Veränderung kann erst eintreten, wenn der bewußte Denkprozeß bis zu dieser Stelle vorgedrungen ist und dort die Verdrängungswiderstände überwunden hat. Es ist geradeso, als ob im Justizministerium ein Erlaß verlautbart worden wäre, daß man jugendliche Vergehen in einer gewissen milden Weise richten solle. Solange dieser Erlaß nicht zur Kenntnis der einzelnen Bezirksgerichte gelangt ist, oder für den Fall, daß die Bezirksrichter nicht die Absicht haben, diesen Erlaß zu befolgen, vielmehr auf eigene Hand judizieren, kann an der Behandlung der einzelnen jugendlichen Delinquenten nichts geändert sein. Fügen wir noch zur Korrektur hinzu, daß die bewußte Mitteilung des Verdrängten an den Kranken doch nicht wirkungslos bleibt. Sie wird nicht die gewünschte Wirkung äußern, den Symptomen ein Ende zu machen, sondern andere Folgen haben. Sie wird zunächst Widerstände, dann aber, wenn deren Überwindung erfolgt ist, einen Denkprozeß anregen, in dessen Ablauf sich endlich die erwartete Beeinflussung der unbewußten Erinnerung herstellt.
Es ist jetzt an der Zeit, eine Übersicht des Kräftespieles zu gewinnen, welches wir durch die Behandlung in Gang bringen. Der nächste Motor der Therapie ist das Leiden des Patienten und sein daraus entspringender Heilungswunsch. Von der Größe dieser Triebkraft zieht sich mancherlei ab, was erst im Laufe der Analyse aufgedeckt wird, vor allem der sekundäre Krankheitsgewinn, aber die Triebkraft selbst muß bis zum Ende der Behandlung erhalten bleiben; jede Besserung ruft eine Verringerung derselben hervor. Für sich allein ist sie aber unfähig, die Krankheit zu beseitigen; es fehlt ihr zweierlei dazu: Sie kennt die Wege nicht, die zu diesem Ende einzuschlagen sind, und sie bringt die notwendigen Energiebeträge gegen die Widerstände nicht auf. Beiden Mängeln hilft die analytische Behandlung ab. Die zur Überwindung der Widerstände erforderten Affektgrößen stellt sie durch die Mobilmachung der Energien bei, welche für die Übertragung bereitliegen; durch die rechtzeitigen Mitteilungen zeigt sie dem Kranken die Wege, auf welche er diese Energien leiten soll. Die Übertragung kann häufig genug die Leidenssymptome allein beseitigen, aber dann nur vorübergehend, solange sie eben selbst Bestand hat. Das ist dann eine Suggestivbehandlung, keine Psychoanalyse. Den letzteren Namen verdient die Behandlung nur dann, wenn die Übertragung ihre Intensität zur Überwindung der Widerstände verwendet hat. Dann allein ist das Kranksein unmöglich geworden, auch wenn die Übertragung wieder aufgelöst worden ist, wie ihre Bestimmung es verlangt.
Im Laufe der Behandlung wird noch ein anderes förderndes Moment wachgerufen, das intellektuelle Interesse und Verständnis des Kranken. Allein dies kommt gegen die anderen miteinander ringenden Kräfte kaum in Betracht; es droht ihm beständig die Entwertung infolge der Urteilstrübung, welche von den Widerständen ausgeht. Somit erübrigen Übertragung und Unterweisung (durch Mitteilung) als die neuen Kraftquellen, welche der Kranke dem Analytiker verdankt. Der Unterweisung bedient er sich aber nur, insofern er durch die Übertragung dazu bewogen wird, und darum soll die erste Mitteilung abwarten, bis sich eine starke Übertragung hergestellt hat, und fügen wir hinzu, jede spätere, bis die Störung der Übertragung durch die der Reihe nach auftauchenden Übertragungswiderstände beseitigt ist.
Zur Gewinnung des Feuers (1932)
In einer Anmerkung meiner Schrift Das Unbehagen in der Kultur habe ich – eher beiläufig – erwähnt, welche Vermutung über die Gewinnung des Feuers durch den Urmenschen man sich auf Grund des psychoanalytischen Materials bilden könnte. Der Widerspruch von Albrecht Schaeffer (1930) und der überraschende Hinweis in vorstehender Mitteilung von Erlenmeyer [Fußnote]E. H. Erlenmeyer (1932). [Erlenmeyers Aufsatz stand in der Nummer der Imago, in der Freuds Artikel erstmals abgedruckt war, unmittelbar vor diesem.] über das mongolische Verbot, auf Asche zu pissen [Fußnote]Wohl auf heiße Asche, aus der man noch Feuer gewinnen kann, nicht auf erloschene., veranlassen mich, das Thema wiederaufzunehmen [Fußnote]Der Widerspruch von Lorenz in ›Chaos und Ritus‹ (1931) geht von der Voraussetzung aus, daß die Zähmung des Feuers überhaupt erst mit der Entdeckung begonnen habe, man sei imstande, es durch irgendeine Manipulation willkürlich hervorzurufen. – Dagegen verweist mich Dr. J. Hárnik auf eine Äußerung von Dr. Richard Lasch (in Georg Buschans Sammelwerk Illustrierte Völkerkunde, 1922, Bd. I, 24): »Vermutlich ist die Kunst der Feuererhaltung der Feuererzeugung lange vorausgegangen; einen entsprechenden Beweis hiefür liefert die Tatsache, daß die heutigen pygmäenartigen Urbewohner der Andamanen wohl das Feuer besitzen und bewahren, eine autochthone Methode der Feuererzeugung aber nicht kennen.«.
Ich meine nämlich, daß meine Annahme, die Vorbedingung der Bemächtigung des Feuers sei der Verzicht auf die homosexuellbetonte Lust gewesen, es durch den Harnstrahl zu löschen, lasse sich durch die Deutung der griechischen Prometheussage bestätigen, wenn man die zu erwartenden Entstellungen von der Tatsache bis zum Inhalt des Mythus in Betracht zieht. Diese Entstellungen sind von derselben Art und nicht ärger als jene, die wir alltäglich anerkennen, wenn wir aus den Träumen von Patienten ihre verdrängten, doch so überaus bedeutsamen Kindheitserlebnisse rekonstruieren. Die dabei verwendeten Mechanismen sind die Darstellung durch Symbole und die Verwandlung ins Gegenteil. Ich kann es nicht wagen, alle Züge des Mythus in solcher Art zu erklären; außer dem ursprünglichen Sachverhalt mögen andere und spätere Vorgänge zu seinem Inhalt beigetragen haben. Aber die Elemente, die eine analytische Deutung zulassen, sind doch die auffälligsten und wichtigsten, nämlich die Art, wie Prometheus das Feuer transportiert, der Charakter der Tat (Frevel, Diebstahl, Betrug an den Göttern) und der Sinn seiner Bestrafung.
Der Titane Prometheus, ein noch göttlicher Kulturheros [Fußnote]Herakles ist dann halbgöttlich, Theseus ganz menschlich., vielleicht selbst ursprünglich ein Demiurg und Menschenschöpfer, bringt also den Menschen das Feuer, das er den Göttern entwendet hat, versteckt in einem hohlen Stock, Fenchelrohr. Einen solchen Gegenstand würden wir in einer Traumdeutung gern als Penissymbol verstehen wollen, wenngleich die nicht gewöhnliche Betonung der Höhlung uns dabei stört. Aber wie bringen wir dieses Penisrohr mit der Aufbewahrung des Feuers zusammen? Das scheint aussichtslos, bis wir uns an den im Traum so häufigen Vorgang der Verkehrung, Verwandlung ins Gegenteil, Umkehrung der Beziehungen erinnern, der uns so oft den Sinn des Traumes verbirgt. Nicht das Feuer beherbergt der Mensch in seinem Penisrohr, sondern im Gegenteil das Mittel, um das Feuer zu löschen, das Wasser seines Harnstrahls. An diese Beziehung zwischen Feuer und Wasser knüpft dann reiches, wohlbekanntes analytisches Material an.
Zweitens, der Erwerb des Feuers ist ein Frevel, es wird durch Raub oder Diebstahl gewonnen. Dies ist ein konstanter Zug aller Sagen über die Gewinnung des Feuers, er findet sich bei den verschiedensten und entlegensten Völkern, nicht nur in der griechischen Sage vom Feuerbringer Prometheus. Hier muß also der wesentliche Inhalt der entstellten Menschheitsreminiszenz enthalten sein. Aber warum ist die Feuergewinnung untrennbar mit der Vorstellung eines Frevels verknüpft? Wer ist dabei der Geschädigte, Betrogene? Die Sage bei Hesiod gibt eine direkte Antwort, indem sie in einer anderen Erzählung, die nicht direkt mit dem Feuer zusammenhängt, Prometheus bei der Einrichtung der Opfer Zeus zugunsten der Menschen übervorteilen läßt. Also die Götter sind die Betrogenen! Den Göttern teilt der Mythus bekanntlich die Befriedigung aller Gelüste zu, auf die das Menschenkind verzichten muß, wie wir es vom Inzest her kennen. Wir würden in analytischer Ausdrucksweise sagen, das Triebleben, das Es, sei der durch die Feuerlöschentsagung betrogene Gott, ein menschliches Gelüste ist in der Sage in ein göttliches Vorrecht umgewandelt. Aber die Gottheit hat in der Sage nichts vom Charakter eines Über-Ichs, sie ist noch Repräsentant des übermächtigen Trieblebens.
Die Umwandlung ins Gegenteil ist am gründlichsten in einem dritten Zug der Sage, in der Bestrafung des Feuerbringers. Prometheus wird an einen Felsen geschmiedet, ein Geier frißt täglich an seiner Leber. Auch in den Feuersagen anderer Völker spielt ein Vogel eine Rolle, er muß etwas mit der Sache zu tun haben, ich enthalte mich zunächst der Deutung. Dagegen fühlen wir uns auf sicherem Boden, wenn es sich um die Erklärung handelt, warum die Leber zum Ort der Bestrafung gewählt ist. Die Leber galt den Alten als der Sitz aller Leidenschaften und Begierden; eine Strafe wie die des Prometheus war also das Richtige für einen triebhaften Verbrecher, der gefrevelt hatte unter dem Antrieb böser Gelüste. Das genaue Gegenteil trifft aber für den Feuerbringer zu; er hatte Triebverzicht geübt und gezeigt, wie wohltätig, aber auch wie unerläßlich ein solcher Triebverzicht in kultureller Absicht ist. Und warum mußte eine solche kulturelle Wohltat überhaupt von der Sage als strafwürdiges Verbrechen behandelt werden? Nun, wenn sie durch alle Entstellungen durchschimmern läßt, daß die Gewinnung des Feuers einen Triebverzicht zur Voraussetzung hatte, so drückt sie doch unverhohlen den Groll aus, den die triebhafte Menschheit gegen den Kulturheros verspüren mußte. Und das stimmt zu unseren Einsichten und Erwartungen. Wir wissen, daß die Aufforderung zum Triebverzicht und die Durchsetzung desselben Feindseligkeit und Aggressionslust hervorruft, die sich erst in einer späteren Phase der psychischen Entwicklung in Schuldgefühl umsetzt. Die Undurchsichtigkeit der Prometheussage wie anderer Feuermythen wird durch den Umstand gesteigert, daß das Feuer dem Primitiven als etwas der verliebten Leidenschaft Analoges – wir würden sagen: als Symbol der Libido – erscheinen mußte. Die Wärme, die das Feuer ausstrahlt, ruft dieselbe Empfindung hervor, die den Zustand sexueller Erregtheit begleitet, und die Flamme mahnt in Form und Bewegungen an den tätigen Phallus. Daß die Flamme dem mythischen Sinn als Phallus erschien, kann nicht zweifelhaft sein, noch die Abkunftsage des römischen Königs Servius Tullius zeugt dafür. Wenn wir selbst von dem zehrenden Feuer der Leidenschaft und von den züngelnden Flammen reden, also die Flamme einer Zunge vergleichen, haben wir uns vom Denken unserer primitiven Ahnen nicht so sehr weit entfernt. In unserer Herleitung der Feuergewinnung war ja auch die Voraussetzung enthalten, daß dem Urmenschen der Versuch, das Feuer durch sein eigenes Wasser zu löschen, ein lustvolles Ringen mit einem anderen Phallus bedeutete.
Auf dem Wege dieser symbolischen Angleichung mögen also auch andere, rein phantastische Elemente in den Mythus eingedrungen und in ihm mit den historischen verwebt worden sein. Man kann sich ja kaum der Idee erwehren, daß, wenn die Leber der Sitz der Leidenschaft ist, sie symbolisch dasselbe bedeutet wie das Feuer selbst und daß dann ihre tägliche Aufzehrung und Erneuerung eine zutreffende Schilderung von dem Verhalten der Liebesgelüste ist, die, täglich befriedigt, sich täglich wiederherstellen. Dem Vogel, der sich an der Leber sättigt, fiele dabei die Bedeutung des Penis zu, die ihm auch sonst nicht fremd ist, wie Sagen, Träume, Sprachgebrauch und plastische Darstellungen aus dem Altertum erkennen lassen. Ein kleiner Schritt weiter führt zum Vogel Phönix, der aus jedem seiner Feuertode neu verjüngt hervorgeht und der wahrscheinlich eher und früher den nach seiner Erschlaffung neu belebten Phallus gemeint hat als die im Abendrot untergehende und dann wieder aufgehende Sonne.
Man darf die Frage aufwerfen, ob man es der mythenbildenden Tätigkeit zumuten darf, sich – gleichsam spielerisch – in der verkleideten Darstellung allgemein bekannter, wenn auch höchst interessanter seelischer Vorgänge mit körperlicher Äußerung zu versuchen ohne anderes Motiv als bloße Darstellungslust. Darauf kann man gewiß keine sichere Antwort geben, ohne das Wesen des Mythus verstanden zu haben, aber für unsere beiden Fälle ist es leicht, den nämlichen Inhalt und damit eine bestimmte Tendenz zu erkennen. Sie beschreiben die Wiederherstellung der libidinösen Gelüste nach ihrem Erlöschen durch eine Sättigung, also ihre Unzerstörbarkeit, und diese Hervorhebung ist als Trost durchaus an ihrem Platz, wenn der historische Kern des Mythus eine Niederlage des Trieblebens, einen notwendig gewordenen Triebverzicht behandelt. Es ist wie das zweite Stück der begreiflichen Reaktion des in seinem Triebleben gekränkten Urmenschen; nach der Bestrafung des Frevlers die Versicherung, daß er im Grunde doch nichts ausgerichtet hat.
An unerwarteter Stelle begegnen wir der Verkehrung ins Gegenteil in einem anderen Mythus, der anscheinend sehr wenig mit dem Feuermythus zu tun hat. Die lernäische Hydra mit ihren zahllosen züngelnden Schlangenköpfen – unter ihnen ein unsterblicher – ist nach dem Zeugnis ihres Namens ein Wasserdrache. Der Kulturheros Herakles bekämpft sie, indem er ihre Köpfe abhaut, aber die wachsen immer nach, und er wird des Untiers erst Herr, nachdem er den unsterblichen Kopf mit Feuer ausgebrannt hat. Ein Wasserdrache, der durch das Feuer gebändigt wird – das ergibt doch keinen Sinn. Wohl aber, wie in so vielen Träumen, die Umkehrung des manifesten Inhalts. Dann ist die Hydra ein Brand, die züngelnden Schlangenköpfe sind die Flammen des Brandes, und als Beweis ihrer libidinösen Natur zeigen sie wie die Leber des Prometheus wieder das Phänomen des Nachwachsens, der Erneuerung nach der versuchten Zerstörung. Herakles löscht nun diesen Brand durch – Wasser. (Der unsterbliche Kopf ist wohl der Phallus selbst, seine Vernichtung die Kastration.) Herakles ist aber auch der Befreier des Prometheus, der den an der Leber fressenden Vogel tötet. Sollte man nicht einen tieferen Zusammenhang zwischen beiden Mythen erraten? Es ist ja so, als ob die Tat des einen Heros durch den anderen gutgemacht würde. Prometheus hatte die Löschung des Feuers verboten – wie das Gesetz des Mongolen –, Herakles sie für den Fall des Unheil drohenden Brandes freigegeben. Der zweite Mythus scheint der Reaktion einer späteren Kulturzeit auf den Anlaß der Feuergewinnung zu entsprechen. Man gewinnt den Eindruck, daß man von hier aus ein ganzes Stück weit in die Geheimnisse des Mythus eindringen könnte, aber freilich wird man nur für eine kurze Strecke vom Gefühl der Sicherheit begleitet.
Für den Gegensatz von Feuer und Wasser, der das ganze Gebiet dieser Mythen beherrscht, ist außer dem historischen und dem symbolisch-phantastischen noch ein drittes Moment aufzeigbar, eine physiologische Tatsache, die der Dichter in den Zeilen beschreibt:
»Was dem Menschen dient zum Seichen, Damit schafft er Seinesgleichen.« (Heine.)
Das Glied des Mannes hat zwei Funktionen, deren Beisammensein manchem ein Ärgernis ist. Es besorgt die Entleerung des Harnes, und es führt den Liebesakt aus, der das Sehnen der genitalen Libido stillt. Das Kind glaubt noch, die beiden Funktionen vereinen zu können; nach seiner Theorie kommen die Kinder dadurch zustande, daß der Mann in den Leib des Weibes uriniert. Aber der Erwachsene weiß, daß die beiden Akte in Wirklichkeit unverträglich miteinander sind – so unverträglich wie Feuer und Wasser. Wenn das Glied in jenen Zustand von Erregung gerät, der ihm die Gleichstellung mit dem Vogel eingetragen hat, und während jene Empfindungen verspürt werden, die an die Wärme des Feuers mahnen, ist das Urinieren unmöglich; und umgekehrt, wenn das Glied der Entleerung des Körperwassers dient, scheinen alle seine Beziehungen zur Genitalfunktion erloschen. Der Gegensatz der beiden Funktionen könnte uns veranlassen zu sagen, daß der Mensch sein eigenes Feuer durch sein eigenes Wasser löscht. Und der Urmensch, der darauf angewiesen war, die Außenwelt mit Hilfe seiner eigenen Körperempfindungen und Körperverhältnisse zu begreifen, dürfte die Analogien, die ihm das Verhalten des Feuers zeigte, nicht unbemerkt und ungenützt gelassen haben.
Zur Psychologie des Gymnasiasten (1914)
Man hat ein sonderbares Gefühl, wenn man in so vorgerückten Jahren noch einmal den Auftrag erhält, einen »deutschen Aufsatz« für das Gymnasium zu schreiben. Man gehorcht aber automatisch wie jener ausgediente Soldat, der auf das Kommando »Habt acht!« die Hände an die Hosennaht anlegen und seine Päckchen zu Boden fallen lassen muß. Es ist merkwürdig, wie bereitwillig man zugesagt hat, als ob sich in dem letzten Halbjahrhundert nichts Besonderes geändert hätte. Man ist doch alt geworden seither, steht knapp vor dem sechzigsten Lebensjahr, und Körpergefühl wie Spiegel zeigen unzweideutig an, wieviel man von seinem Lebenslicht bereits heruntergebrannt hat.
Noch vor zehn Jahren etwa konnte man Momente haben, in denen man sich plötzlich wieder ganz jung fühlte. Wenn man, bereits graubärtig und mit allen Lasten einer bürgerlichen Existenz beladen, durch die Straßen der Heimatstadt ging, begegnete man unversehens dem einen oder anderen wohlerhaltenen älteren Herrn, den man fast demütig begrüßte, weil man einen seiner Gymnasiallehrer in ihm erkannt hatte. Dann aber blieb man stehen und sah ihm versonnen nach: Ist er das wirklich oder nur jemand, der ihm so täuschend ähnlich ist? Wie jugendlich sieht er doch aus, und du bist selbst so alt geworden! Wie alt mag er heute wohl sein? Ist es möglich, daß diese Männer, die uns damals die Erwachsenen repräsentierten, um so weniges älter waren als wir?
Die Gegenwart war dann wie verdunkelt und die Lebensjahre von zehn bis achtzehn stiegen aus den Winkeln des Gedächtnisses empor mit ihren Ahnungen und Irrungen, ihren schmerzhaften Umbildungen und beseligenden Erfolgen, die ersten Einblicke in eine untergegangene Kulturwelt, die wenigstens mir später ein unübertroffener Trost in den Kämpfen des Lebens werden sollte, die ersten Berührungen mit den Wissenschaften, unter denen man glaubte wählen zu können, welcher man seine – sicherlich unschätzbaren – Dienste weihen würde. Und ich glaubte mich zu erinnern, daß die ganze Zeit von der Ahnung einer Aufgabe durchzogen war, die sich zuerst nur leise andeutete, bis ich sie in dem Maturitätsaufsatze in die lauten Worte kleiden konnte, ich wollte in meinem Leben zu unserem menschlichen Wissen einen Beitrag leisten.
Ich bin dann Arzt geworden, aber eigentlich doch eher Psychologe, und konnte eine neue psychologische Disziplin schaffen, die sogenannte »Psychoanalyse«, welche gegenwärtig Ärzte und Forscher in nahen wie in fernen fremdsprachigen Ländern in Atem hält und zu Lob und Tadel aufregt, die des eigenen Vaterlandes natürlich am geringsten.
Als Psychoanalytiker muß ich mich mehr für affektive als für intellektuelle Vorgänge, mehr für das unbewußte als für das bewußte Seelenleben interessieren. Meine Ergriffenheit bei der Begegnung mit meinem früheren Gymnasialprofessor mahnt mich, ein erstes Bekenntnis abzulegen: Ich weiß nicht, was uns stärker in Anspruch nahm und bedeutsamer für uns wurde, die Beschäftigung mit den uns vorgetragenen Wissenschaften oder die mit den Persönlichkeiten unserer Lehrer. Jedenfalls galt den letzteren bei uns allen eine niemals aussetzende Unterströmung, und bei vielen führte der Weg zu den Wissenschaften nur über die Personen der Lehrer; manche blieben auf diesem Weg stecken, und einigen ward er auf solche Weise – warum sollen wir es nicht eingestehen? – dauernd verlegt.
Wir warben um sie oder wandten uns von ihnen ab, imaginierten bei ihnen Sympathien oder Antipathien, die wahrscheinlich nicht bestanden, studierten ihre Charaktere und bildeten oder verbildeten an ihnen unsere eigenen. Sie riefen unsere stärksten Auflehnungen hervor und zwangen uns zur vollständigen Unterwerfung; wir spähten nach ihren kleinen Schwächen und waren stolz auf ihre großen Vorzüge, ihr Wissen und ihre Gerechtigkeit. Im Grunde liebten wir sie sehr, wenn sie uns irgendeine Begründung dazu gaben; ich weiß nicht, ob alle unsere Lehrer dies bemerkt haben. Aber es ist nicht zu leugnen, wir waren in einer ganz besonderen Weise gegen sie eingestellt, in einer Weise, die ihre Unbequemlichkeiten für die Betroffenen haben mochte. Wir waren von vornherein gleich geneigt zur Liebe wie zum Haß, zur Kritik wie zur Verehrung gegen sie. Die Psychoanalyse nennt eine solche Bereitschaft zu gegensätzlichem Verhalten eine ambivalente; sie ist auch nicht verlegen, die Quelle einer solchen Gefühlsambivalenz nachzuweisen.
Sie hat uns nämlich gelehrt, daß die für das spätere Verhalten des Individuums so überaus wichtigen Affekteinstellungen gegen andere Personen in ungeahnt früher Zeit fertig gemacht werden. Schon in den ersten sechs Jahren der Kindheit hat der kleine Mensch die Art und den Affektton seiner Beziehungen zu Personen des nämlichen und des anderen Geschlechts festgelegt, er kann sie von da an entwickeln und nach bestimmten Richtungen umwandeln, aber nicht mehr aufheben. Die Personen, an welche er sich in solcher Weise fixiert, sind seine Eltern und Geschwister. Alle Menschen, die er später kennenlernt, werden ihm zu Ersatzpersonen dieser ersten Gefühlsobjekte (etwa noch der Pflegepersonen neben den Eltern) und ordnen sich für ihn in Reihen an, die von den »Imagines«, wie wir sagen, des Vaters, der Mutter, der Geschwister usw. ausgehen. Diese späteren Bekanntschaften haben also eine Art von Gefühlserbschaft zu übernehmen, sie stoßen auf Sympathien und Antipathien, zu deren Erwerbung sie selbst nur wenig beigetragen haben; alle spätere Freundschafts- und Liebeswahl erfolgt auf Grund von Erinnerungsspuren, welche jene ersten Vorbilder hinterlassen haben.
Von den Imagines einer gewöhnlich nicht mehr im Gedächtnis bewahrten Kindheit ist aber keine für den Jüngling und Mann bedeutungsvoller als die seines Vaters. Organische Notwendigkeit hat in dies Verhältnis eine Gefühlsambivalenz eingeführt, als deren ergreifendsten Ausdruck wir den griechischen Mythus vom König Ödipus erfassen können. Der kleine Knabe muß seinen Vater lieben und bewundern, er scheint ihm das stärkste, gütigste und weiseste aller Geschöpfe; ist doch Gott selbst nur eine Erhöhung dieses Vaterbildes, wie es sich dem frühkindlichen Seelenleben darstellt. Aber sehr bald tritt die andere Seite dieser Gefühlsrelation hervor. Der Vater wird auch als der übermächtige Störer des eigenen Trieblebens erkannt, er wird zum Vorbild, das man nicht nur nachahmen, sondern auch beseitigen will, um seine Stelle selbst einzunehmen. Die zärtliche und die feindselige Regung gegen den Vater bestehen nun nebeneinander fort, oft durch das ganze Leben hindurch, ohne daß die eine die andere aufheben könnte. In einem solchen Nebeneinander der Gegensätze liegt der Charakter dessen, was wir eine Gefühlsambivalenz heißen.
In der zweiten Hälfte der Kindheit bereitet sich eine Veränderung dieses Verhältnisses zum Vater vor, deren Bedeutung man sich nicht großartig genug vorstellen kann. Der Knabe beginnt aus seiner Kinderstube in die reale Welt draußen zu schauen, und nun muß er die Entdeckungen machen, welche seine ursprüngliche Hochschätzung des Vaters untergraben und seine Ablösung von diesem ersten Ideal befördern. Er findet, daß der Vater nicht mehr der Mächtigste, Weiseste, Reichste ist, er wird mit ihm unzufrieden, lernt ihn kritisieren und sozial einordnen und läßt ihn dann gewöhnlich schwer für die Enttäuschung büßen, die jener ihm bereitet hat. Alles Hoffnungsvolle, aber auch alles Anstößige, was die neue Generation auszeichnet, hat diese Ablösung vom Vater zur Bedingung.
In diese Phase der Entwicklung des jungen Menschen fällt sein Zusammentreffen mit den Lehrern. Wir verstehen jetzt unser Verhältnis zu unseren Gymnasialprofessoren. Diese Männer, die nicht einmal alle selbst Väter waren, wurden uns zum Vaterersatz. Darum kamen sie uns, auch wenn sie noch sehr jung waren, so gereift, so unerreichbar erwachsen vor. Wir übertrugen auf sie den Respekt und die Erwartungen von dem allwissenden Vater unserer Kindheitsjahre, und dann begannen wir, sie zu behandeln wie unsere Väter zu Hause. Wir brachten ihnen die Ambivalenz entgegen, die wir in der Familie erworben hatten, und mit Hilfe dieser Einstellung rangen wir mit ihnen, wie wir mit unseren leiblichen Vätern zu ringen gewohnt waren. Ohne Rücksicht auf die Kinderstube und das Familienhaus wäre unser Benehmen gegen unsere Lehrer nicht zu verstehen, aber auch nicht zu entschuldigen.
Noch andere und kaum weniger wichtige Erlebnisse hatten wir als Gymnasiasten mit den Nachfahren unserer Geschwister, mit unseren Kameraden, aber diese sollen auf einem anderen Blatt beschrieben werden. Das Jubiläum der Schule hält unsere Gedanken bei den Lehrern fest.
Zur sexuellen Aufklärung der Kinder (1907)
(Offener Brief an Dr. M. Fürst)
Geehrter Herr Kollege!
Wenn Sie von mir eine Äußerung über die »sexuelle Aufklärung der Kinder« verlangen, so nehme ich an, daß Sie keine regelrechte und förmliche Abhandlung mit Berücksichtigung der ganzen, über Gebühr angewachsenen Literatur erwarten, sondern das selbständige Urteil eines einzelnen Arztes hören wollen, dem seine Berufstätigkeit besondere Anregung geboten hat, sich mit den sexuellen Problemen zu beschäftigen. Ich weiß, daß Sie meine wissenschaftlichen Bemühungen mit Interesse verfolgt haben und mich nicht wie viele andere Kollegen darum ohne Prüfung abweisen, weil ich in der psychosexuellen Konstitution und in Schädlichkeiten des Sexuallebens die wichtigsten Ursachen der so häufigen neurotischen Erkrankungen erblicke; auch meine Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, in denen ich die Zusammensetzung des Geschlechtstriebes und die Störungen in der Entwicklung des Geschlechtstriebes zur Sexualfunktion darlege, haben kürzlich eine freundliche Erwähnung in Ihrer Zeitschrift gefunden.
Ich soll Ihnen also die Fragen beantworten, ob man den Kindern überhaupt Aufklärungen über die Tatsachen des Geschlechtslebens geben darf, in welchem Alter dies geschehen kann und in welcher Weise. Nehmen Sie nun gleich zu Anfang mein Geständnis entgegen, daß ich eine Diskussion über den zweiten und dritten Punkt ganz begreiflich finde, daß es aber für meine Einsicht völlig unfaßbar ist, wie der erste dieser Fragepunkte ein Gegenstand von Meinungsverschiedenheit werden konnte. Was will man denn erreichen, wenn man den Kindern – oder sagen wir der Jugend – solche Aufklärungen über das menschliche Geschlechtsleben vorenthält? Fürchtet man, ihr Interesse für diese Dinge vorzeitig zu wecken, ehe es sich in ihnen selbst regt? Hofft man, durch solche Verhehlung den Geschlechtstrieb überhaupt zurückzuhalten bis zur Zeit, da er in die ihm von der bürgerlichen Gesellschaftsordnung allein geöffneten Bahnen einlenken kann? Meint man, daß die Kinder für die Tatsachen und Rätsel des Geschlechtslebens kein Interesse oder kein Verständnis zeigten, wenn sie nicht von fremder Seite darauf hingewiesen würden? Hält man es für möglich, daß ihnen die Kenntnis, welche man ihnen versagt, nicht auf anderen Wegen zugeführt wird? Oder verfolgt man wirklich und ernsthaft die Absicht, daß sie späterhin alles Geschlechtliche als etwas Niedriges und Verabscheuenswertes beurteilen mögen, von dem ihre Eltern und Erzieher sie so lange als möglich fernhalten wollten?
Ich weiß wirklich nicht, in welcher dieser Absichten ich das Motiv für das tatsächlich geübte Verstecken des Sexuellen vor den Kindern erblicken soll; ich weiß nur, daß sie alle gleich töricht sind und daß es mir schwerfällt, sie durch ernsthafte Widerlegungen auszuzeichnen. Ich erinnere mich aber, daß ich in den Familienbriefen des großen Denkers und Menschenfreundes Multatuli einige Zeilen gefunden habe, die als Antwort mehr als bloß genügen können [Fußnote]Multatuli-Briefe, 1906, Bd. 1, S. 26..
»Im allgemeinen werden einzelne Dinge nach meinem Gefühl zu sehr umschleiert. Man tut recht, die Phantasie der Kinder reinzuhalten, aber diese Reinheit wird nicht bewahrt durch Unwissenheit. Ich glaube eher, daß das Verdecken von etwas den Knaben und das Mädchen um so mehr die Wahrheit argwöhnen läßt. Man spürt aus Neugierde Dingen nach, die uns, wenn sie uns ohne viel Umstände mitgeteilt würden, wenig oder kein Interesse einflößen würden. Wäre diese Unwissenheit noch zu bewahren, so könnte ich mich damit versöhnen, aber das ist nicht möglich; das Kind kommt in Berührung mit anderen Kindern, es bekommt Bücher in die Hände, die es zum Nachdenken bringen; gerade die Geheimtuerei, womit das dennoch Begriffene von den Eltern behandelt wird, erhöht das Verlangen, mehr zu wissen. Dieses Verlangen, nur zum Teil, nur heimlich befriedigt, erhitzt das Herz und verdirbt die Phantasie, das Kind sündigt bereits, und die Eltern meinen noch, daß es nicht weiß, was Sünde ist.«
Ich weiß nicht, was man hierüber Besseres sagen könnte, aber vielleicht läßt sich einiges hinzufügen. Es ist gewiß nichts anderes als die gewohnte Prüderie und das eigene schlechte Gewissen in Sachen der Sexualität, was die Erwachsenen zur »Geheimtuerei« vor den Kindern veranlaßt; aber möglicherweise wirkt da auch ein Stück theoretischer Unwissenheit mit, dem man durch die Aufklärung der Erwachsenen entgegentreten kann. Man meint nämlich, daß den Kindern der Geschlechtstrieb fehle und sich erst zur Pubertätszeit mit der Reife der Geschlechtsorgane bei ihnen einstelle. Das ist ein grober, für die Kenntnis wie für die Praxis folgenschwerer Irrtum. Es ist so leicht, ihn durch die Beobachtung zu korrigieren, daß man sich verwundern muß, wie er überhaupt entstehen konnte. In Wahrheit bringt das Neugeborene Sexualität mit auf die Welt, gewisse Sexualempfindungen begleiten seine Entwicklung durch die Säuglings- und Kinderzeiten, und die wenigsten Kinder dürften sexuellen Betätigungen und Empfindungen vor ihrer Pubertät entgehen. Wer die ausführliche Darlegung dieser Behauptungen kennenlernen will, möge sie in meinen erwähnten Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie aufsuchen. Er wird dort erfahren, daß die eigentlichen Reproduktionsorgane nicht die einzigen Körperteile sind, welche sexuelle Lustempfindungen vermitteln, und daß die Natur es recht zwingend so eingerichtet hat, daß selbst Reizungen der Genitalien während der Kinderzeit unvermeidlich sind. Man bezeichnet diese Lebenszeit, in welcher durch die Erregung verschiedener Hautstellen ( erogener Zonen), durch die Betätigung gewisser biologischer Triebe und als Miterregung bei vielen affektiven Zuständen ein gewisser Betrag von sicher sexueller Lust erzeugt wird, mit einem von Havelock Ellis eingeführten Ausdrucke als die Periode des Autoerotismus. Die Pubertät leistet nichts anderes, als daß sie unter allen lusterzeugenden Zonen und Quellen den Genitalien das Primat verschafft und dadurch die Erotik in den Dienst der Fortpflanzungsfunktion zwingt, ein Prozeß, der natürlich gewissen Hemmungen unterliegen kann und sich bei vielen Personen, den späteren Perversen und Neurotikern, nur in unvollkommener Weise vollzieht. Anderseits ist das Kind der meisten psychischen Leistungen des Liebeslebens (der Zärtlichkeit, der Hingebung, der Eifersucht) lange vor erreichter Pubertät fähig, und oft genug stellt sich auch der Durchbruch dieser seelischen Zustände zu den körperlichen Empfindungen der Sexualerregung her, so daß das Kind über die Zusammengehörigkeit der beiden nicht im Zweifel bleiben kann. Kurz gesagt, das Kind ist lange vor der Pubertät ein bis auf die Fortpflanzungsfähigkeit fertiges Liebeswesen, und man darf es aussprechen, daß man ihm mit jener »Geheimtuerei« nur die Fähigkeit zur intellektuellen Bewältigung solcher Leistungen vorenthält, für die es psychisch vorbereitet und somatisch eingestellt ist.
Das intellektuelle Interesse des Kindes für die Rätsel des Geschlechtslebens, seine sexuelle Wißbegierde äußert sich denn auch zu einer unvermutet frühen Lebenszeit. Es muß wohl so zugehen, daß die Eltern für dieses Interesse des Kindes wie mit Blindheit geschlagen sind oder sich sofort bemühen, es zu ersticken, falls sie es nicht übersehen können, wenn Beobachtungen wie die nun mitzuteilende nicht häufiger gemacht werden können. Ich kenne da einen prächtigen Jungen von jetzt vier Jahren, dessen verständige Eltern darauf verzichten, ein Stück der Entwicklung des Kindes gewaltsam zu unterdrücken. Der kleine Hans, der sicherlich keinem verführenden Einflüsse von seiten einer Warteperson unterlegen ist, zeigt schon seit einiger Zeit das lebhafteste Interesse für jenes Stück seines Körpers, das er als »Wiwimacher« zu bezeichnen pflegt. Schon mit drei Jahren hat er die Mutter gefragt: »Mama, hast du auch einen Wiwimacher?« Worauf die Mama geantwortet: »Natürlich, was hast du denn gedacht?« Dieselbe Frage hat er zu wiederholten Malen an den Vater gerichtet. Im selben Alter zuerst in einen Stall geführt, hat er beim Melken einer Kuh zugeschaut und dann verwundert ausgerufen: »Schau, aus dem Wiwimacher kommt Milch.« Mit dreidreiviertel Jahren ist er auf dem Wege, durch seine Beobachtungen selbständig richtige Kategorien zu entdecken. Er sieht, wie aus einer Lokomotive Wasser ausgelassen wird, und sagt: »Schau, die Lokomotive macht Wiwi; wo hat sie denn den Wiwimacher?« Später setzt er nachdenklich hinzu: »Ein Hund und ein Pferd hat einen Wiwimacher; ein Tisch und ein Sessel nicht.« Vor kurzem hat er zugesehen, wie man sein einwöchiges Schwesterchen badet, und dabei bemerkt: »Aber ihr Wiwimacher ist noch klein. Wenn sie wächst, wird er schon größer werden.« (Dieselbe Stellung zum Problem der Geschlechtsunterschiede ist mir auch von anderen Knaben gleichen Alters berichtet worden.) Ich möchte ausdrücklich bestreiten, daß der kleine Hans ein sinnliches oder gar ein pathologisch veranlagtes Kind sei; ich meine nur, er ist nicht eingeschüchtert worden, wird nicht vom Schuldbewußtsein geplagt und gibt darum arglos von seinen Denkvorgängen Kunde [Fußnote]Über die spätere neurotische Erkrankung und Herstellung dieses »kleinen Hans« siehe ›Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben‹..
Das zweite große Problem, welches dem Denken der Kinder – wohl erst in etwas späteren Jahren – Aufgaben stellt, ist die Frage nach der Herkunft der Kinder, die zumeist an die unerwünschte Erscheinung eines neuen kleinen Bruders oder Schwesterchens anknüpft. Es ist dies die älteste und die brennendste Frage der jungen Menschheit; wer Mythen und Überlieferungen zu deuten versteht, kann sie aus dem Rätsel heraushören, welches die thebaische Sphinx dem Ödipus aufgibt. Durch die in der Kinderstube gebräuchlichen Antworten wird der ehrliche Forschertrieb des Kindes verletzt, meist auch dessen Vertrauen zu seinen Eltern zum erstenmal erschüttert; von da an beginnt es zumeist den Erwachsenen zu mißtrauen und seine intimsten Interessen vor ihnen geheimzuhalten. Ein kleines Dokument mag zeigen, wie quälend sich gerade diese Wißbegierde oft bei älteren Kindern gestaltet, der Brief eines mutterlosen, elfeinhalbjährigen Mädchens, welches über das Problem mit seiner jüngeren Schwester spekuliert hat:
»Liebe Tante Mali!
Ich bitte Dich, sei so gut und schreibe mir, wie Du die Christel oder den Paul bekommen hast. Du mußt es ja wissen, da Du verheiratet bist. Wir haben uns nämlich gestern abend darüber gestritten und wünschen die Wahrheit zu wissen. Wir haben ja sonst niemanden, den wir fragen könnten. Wann kommt Ihr denn nach Salzburg? Weißt Du, liebe Tante Mali, wir können halt nicht begreifen, wie der Storch die Kinder bringt. Trudel hat geglaubt, der Storch bringt sie im Hemde. Dann möchten wir auch wissen, ob er sie aus dem Teiche nimmt und warum man die Kinder nie im Teich sieht. Ich bitte Dich, sag' mir auch, wieso man vorher weiß, wann man sie bekommt. Schreibe mir darüber ausführlich Antwort.
Mit tausend Grüßen und Küssen von uns allen
Deine neugierige Lilli.«
Ich glaube nicht, daß dieser rührende Brief den beiden Schwestern die geforderte Aufklärung brachte. Die Schreiberin ist später an jener Neurose erkrankt, die sich von unbeantworteten unbewußten Fragen ableitet, an Zwangsgrübelsucht [Fußnote]Die Grübelsucht machte aber nach Jahren einer Dementia praecox Platz..
Ich glaube nicht, daß nur ein einziger Grund vorliegt, um Kindern die Aufklärung, nach der ihre Wißbegierde verlangt, zu verweigern. Freilich, wenn es die Absicht der Erzieher ist, die Fähigkeit der Kinder zum selbständigen Denken möglichst frühzeitig zugunsten der so hochgeschätzten »Bravheit« zu ersticken, so kann dies nicht besser als durch Irreführung auf sexuellem und durch Einschüchterung auf religiösem Gebiete versucht werden. Die stärkeren Naturen widerstehen allerdings diesen Beeinflussungen und werden zu Rebellen gegen die elterliche und später gegen jede andere Autorität. Erhalten die Kinder jene Aufklärungen nicht, um die sie sich an Ältere gewendet haben, so quälen sie sich im geheimen mit dem Problem weiter und bringen Lösungsversuche zustande, in denen das geahnte Richtige auf die merkwürdigste Weise mit grotesk Unrichtigem vermengt ist, oder sie flüstern einander Mitteilungen zu, in welchen zufolge des Schuldbewußtseins der jugendlichen Forscher dem Sexualleben das Gepräge des Gräßlichen und Ekelhaften aufgedrückt wird. Diese kindlichen Sexualtheorien wären wohl einer Sammlung und Würdigung wert. Meist haben die Kinder von diesem Zeitpunkte an die einzig richtige Stellung zu den Fragen des Geschlechts verloren, und viele unter ihnen finden sie überhaupt nicht wieder.
Es scheint, daß die überwiegende Mehrheit männlicher und weiblicher Autoren, welche über die sexuelle Aufklärung der Jugend geschrieben haben, sich im bejahenden Sinn entscheiden. Aber aus dem Ungeschick der meisten Vorschläge, wann und wie dies zu geschehen hat, ist man versucht zu schließen, daß dies Zugeständnis den Betreffenden nicht leicht geworden ist. Ganz vereinzelt steht nach meiner Literaturkenntnis jener reizende Aufklärungsbrief da, den eine Frau Emma Eckstein an ihren etwa zehnjährigen Sohn zu schreiben vorgibt [Fußnote]E. Eckstein (1904).. Wie man es sonst macht, daß man den Kindern die längste Zeit jede Kenntnis des Sexuellen vorenthält, um ihnen dann einmal in schwülstig-feierlichen Worten eine auch nur halb aufrichtige Eröffnung zu schenken, die überdies meist zu spät kommt, das ist offenbar nicht ganz das Richtige. Die meisten Beantwortungen der Frage »Wie sag's ich meinem Kinde?« machen mir wenigstens einen so kläglichen Eindruck, daß ich vorziehen würde, wenn die Eltern sich überhaupt nicht um die Aufklärung bekümmern würden. Es kommt vielmehr darauf an, daß die Kinder niemals auf die Idee geraten, man wolle ihnen aus den Tatsachen des Geschlechtslebens eher ein Geheimnis machen als aus anderem, was ihrem Verständnisse noch nicht zugänglich ist. Und um dies zu erzielen, ist es erforderlich, daß das Geschlechtliche von allem Anfange an gleich wie anderes Wissenswerte behandelt werde. Vor allem ist es Aufgabe der Schule, der Erwähnung des Geschlechtlichen nicht auszuweichen, die großen Tatsachen der Fortpflanzung beim Unterrichte über die Tierwelt in ihre Bedeutung einzusetzen und sogleich zu betonen, daß der Mensch alles Wesentliche seiner Organisation mit den höheren Tieren teilt. Wenn dann das Haus nicht auf Denkabschreckung hinarbeitet, wird es sich wohl öfter ereignen, was ich einmal in einer Kinderstube belauscht habe, daß ein Knabe seinem jüngeren Schwesterchen vorhält: »Aber wie kannst du denken, daß der Storch die kleinen Kinder bringt. Du weißt ja, daß der Mensch ein Säugetier ist, und glaubst du denn, daß der Storch den anderen Säugetieren die Jungen bringt?« Die Neugierde des Kindes wird dann nie einen hohen Grad erreichen, wenn sie auf jeder Stufe des Lernens die entsprechende Befriedigung findet. Die Aufklärung über die spezifisch menschlichen Verhältnisse des Geschlechtslebens und der Hinweis auf die soziale Bedeutung desselben hätte sich dann am Schlusse des Volksschulunterrichtes (und vor Eintritt in die Mittelschule), also nicht nach dem Alter von zehn Jahren, anzuschließen. Endlich würde sich der Zeitpunkt der Konfirmation wie kein anderer dazu eignen, dem bereits über alles Körperliche aufgeklärten Kinde die sittlichen Verpflichtungen, welche an die Ausübung des Triebes geknüpft sind, darzulegen. Eine solche stufenweise fortschreitende und eigentlich zu keiner Zeit unterbrochene Aufklärung über das Geschlechtsleben, zu welcher die Schule die Initiative ergreift, erscheint mir als die einzige, welche der Entwicklung des Kindes Rechnung trägt und darum die vorhandene Gefahr glücklich vermeidet.
Ich halte es für den bedeutsamsten Fortschritt in der Kindererziehung, daß der französische Staat an Stelle des Katechismus ein Elementarbuch eingeführt hat, welches dem Kinde die ersten Kenntnisse seiner staatsbürgerlichen Stellung und der ihm dereinst zufallenden ethischen Pflichten vermittelt. Aber dieser Elementarunterricht ist in arger Weise unvollständig, wenn er nicht das Gebiet des Geschlechtslebens mit umschließt. Hier ist die Lücke, deren Ausfüllung Erzieher und Reformer in Angriff nehmen sollten! In Staaten, welche die Kindererziehung ganz oder teilweise in den Händen der Geistlichkeit belassen haben, darf man allerdings solche Forderung nicht erheben. Der Geistliche wird die Wesensgleichheit von Mensch und Tier nie zugeben, da er auf die unsterbliche Seele nicht verzichten kann, die er braucht, um die Moralforderung zu begründen. So bewährt es sich denn wieder einmal, wie unklug es ist, einem zerlumpten Rock einen einzigen seidenen Lappen aufzunähen, wie unmöglich es ist, eine vereinzelte Reform durchzuführen, ohne an den Grundlagen des Systems zu ändern!
Zur Vorgeschichte der analytischen Technik (1920)
In einem neuen Buche von Havelock Ellis, dem hochverdienten Sexualforscher und vornehmen Kritiker der Psychoanalyse, betitelt The Philosophy of Conflict and Other Essays in Wartime, Second Series, London 1919, ist ein Aufsatz: ›Psycho-Analysis in relation to sex‹ enthalten, der sich nachzuweisen bemüht, daß das Werk des Schöpfers der Analyse nicht als ein Stück wissenschaftlicher Arbeit, sondern als eine künstlerische Leistung gewertet werden sollte. Es liegt uns nahe, in dieser Auffassung eine neue Wendung des Widerstandes und eine Ablehnung der Analyse zu sehen, wenngleich sie in liebenswürdiger, ja in allzu schmeichelhafter Weise verkleidet ist. Wir sind geneigt, ihr aufs entschiedenste zu widersprechen.
Doch nicht solcher Widerspruch ist das Motiv unserer Beschäftigung mit dem Essay von Havelock Ellis, sondern die Tatsache, daß er durch seine große Belesenheit in die Lage gekommen ist, einen Autor anzuführen, der die freie Assoziation als Technik geübt und empfohlen hat, wenngleich zu anderen Zwecken, und somit ein Recht hat, in dieser Hinsicht als Vorläufer der Psychoanalytiker genannt zu werden. »Im Jahre 1857«, schreibt Havelock Ellis, »veröffentlichte Dr. J. J. Garth Wilkinson, besser bekannt als Dichter und Mystiker von der Richtung Swedenborgs denn als Arzt, einen Band mystischer Gedichte in Knüttelversen, durch eine angeblich neue Methode, die er ›Impression‹ nennt, hervorgebracht. ›Man wählt ein Thema‹, sagt er, ›oder schreibt es nieder; sobald dies geschehen ist, darf man den ersten Einfall ( impression upon the mind), der sich nach der Niederschrift des Titels ergibt, als den Beginn der Ausarbeitung des Themas betrachten, gleichgültig wie sonderbar oder nicht dazugehörig das betreffende Wort oder der Satz erscheinen mag.‹ ›Die erste Regung des Geistes, das erste Wort, das sich einstellt, ist der Erfolg des Bestrebens, sich in das gegebene Thema zu vertiefen.‹ Man setzt das Verfahren in konsequenter Weise fort, und Garth Wilkinson sagt: ›Ich habe immer gefunden, daß es wie infolge eines untrüglichen Instinkts ins Innere der Sache führt.‹ Diese Technik entsprach nach Wilkinsons Ansicht einem aufs höchste gesteigerten Sichgehenlassen, einer Aufforderung an die tiefstliegenden, unbewußten Regungen, sich zur Äußerung zu bringen. Wille und Überlegung, mahnte er, sind beiseite zu lassen; man vertraut sich der Eingebung ( influx) an und kann dabei finden, daß sich die geistigen Fähigkeiten auf unbekannte Ziele einstellen.«
»Man darf nicht außer acht lassen, daß Wilkinson, obwohl er Arzt war, diese Technik zu religiösen und literarischen, niemals zu ärztlichen oder wissenschaftlichen Zwecken in Anwendung zog, aber es ist leicht einzusehen, daß es im wesentlichen die psychoanalytische Technik ist, die hier die eigene Person zum Objekt nimmt, ein Beweis mehr dafür, daß das Verfahren Freuds das eines Künstlers ( artist) ist.«
Kenner der psychoanalytischen Literatur werden sich hier jener schönen Stelle im Briefwechsel Schillers mit Körner erinnern [Fußnote]Entdeckt von O. Rank und zitiert in der Traumdeutung (1900 a)., in welcher der große Dichter und Denker (1788) demjenigen, der produktiv sein möchte, die Beachtung des freien Einfalles empfiehlt. Es ist zu vermuten, daß die angeblich neue Wilkinsonsche Technik bereits vielen anderen vorgeschwebt hat, und ihre systematische Anwendung in der Psychoanalyse wird uns nicht so sehr als Beweis für die künstlerische Artung Freuds erscheinen, wie als Konsequenz seiner nach Art eines Vorurteils festgehaltenen Überzeugung von der durchgängigen Determinierung alles seelischen Geschehens. Die Zugehörigkeit des freien Einfalles zum fixierten Thema ergab sich dann als die nächste und wahrscheinlichste Möglichkeit, welche auch durch die Erfahrung in der Analyse bestätigt wird, insofern nicht übergroße Widerstände den vermuteten Zusammenhang unkenntlich machen.
Indes darf man es als sicher annehmen, daß weder Schiller noch Garth Wilkinson auf die Wahl der psychoanalytischen Technik Einfluß geübt haben. Mehr persönliche Beziehung scheint sich von einer anderen Seite her anzudeuten.
Vor kurzem machte Dr. Hugo Dubowitz in Budapest Dr. Ferenczi auf einen kleinen, nur 4½ Seiten umfassenden Aufsatz von Ludwig Börne aufmerksam, der, 1823 verfaßt, im ersten Band seiner Gesammelten Schriften (Ausgabe von 1862) abgedruckt ist. Er ist betitelt: ›Die Kunst, in drei Tagen ein Originalschriftsteller zu werden‹ und trägt die bekannten Eigentümlichkeiten des Jean Paulschen Stils, dem Börne damals huldigte, an sich. Er schließt mit den Sätzen: »Und hier folgt die versprochene Nutzanwendung. Nehmt einige Bogen Papier und schreibt drei Tage hintereinander, ohne Falsch und Heuchelei, alles nieder, was euch durch den Kopf geht. Schreibt, was ihr denkt von euch selbst, von euren Weibern, von dem Türkenkrieg, von Goethe, von Fonks Kriminalprozeß, vom jüngsten Gericht, von euren Vorgesetzten – und nach Verlauf der drei Tage werdet ihr vor Verwunderung, was ihr für neue, unerhörte Gedanken gehabt, ganz außer euch kommen. Das ist die Kunst, in drei Tagen ein Originalschriftsteller zu werden!«
Als Prof. Freud veranlaßt wurde, diesen Börneschen Aufsatz zu lesen, machte er eine Reihe von Angaben, die für die hier berührte Frage nach der Vorgeschichte der psychoanalytischen Einfallsverwertung bedeutungsvoll sein können. Er erzählte, daß er Börnes Werke im vierzehnten Jahr zum Geschenk bekommen habe und dieses Buch heute, fünfzig Jahre später, noch immer als das einzige aus seiner Jugendzeit besitze. Dieser Schriftsteller sei der erste gewesen, in dessen Schriften er sich vertieft habe. An den in Rede stehenden Aufsatz könne er sich nicht erinnern, aber andere, in denselben Band aufgenommene, wie die ›Denkrede auf Jean Paul‹, ›Der Eßkünstler‹, ›Der Narr im weißen Schwan‹, seien durch lange Jahre ohne ersichtlichen Grund immer wieder in seiner Erinnerung aufgetaucht. Er war besonders erstaunt, in der Anweisung zum Originalschriftsteller einige Gedanken ausgesprochen zu finden, die er selbst immer gehegt und vertreten habe, zum Beispiel: »Eine schimpfliche Feigheit zu denken, hält uns alle zurück. Drückender als die Zensur der Regierungen ist die Zensur, welche die öffentliche Meinung über unsere Geisteswerke ausübt.« (Hier findet sich übrigens die »Zensur« erwähnt, die in der Psychoanalyse als Traumzensur wiedergekommen ist ...) »Nicht an Geist, an Charakter mangelt es den meisten Schriftstellern, um besser zu sein, als sie sind ... Aufrichtigkeit ist die Quelle aller Genialität, und die Menschen wären geistreicher, wenn sie sittlicher wären ...«
Es scheint uns also nicht ausgeschlossen, daß dieser Hinweis vielleicht jenes Stück Kryptomnesie aufgedeckt hat, das in so vielen Fällen hinter einer anscheinenden Originalität vermutet werden darf.
Zwangshandlungen und Religionsübungen (1907)
Ich bin gewiß nicht der erste, dem die Ähnlichkeit der sogenannten Zwangshandlungen Nervöser mit den Verrichtungen aufgefallen ist, durch welche der Gläubige seine Frömmigkeit bezeugt. Der Name »Zeremoniell« bürgt mir dafür, mit dem man gewisse dieser Zwangshandlungen belegt hat. Doch scheint mir diese Ähnlichkeit eine mehr als oberflächliche zu sein, so daß man aus einer Einsicht in die Entstehung des neurotischen Zeremoniells Analogieschlüsse auf die seelischen Vorgänge des religiösen Lebens wagen dürfte.
Die Leute, die Zwangshandlungen oder Zeremoniell ausüben, gehören nebst jenen, die an Zwangsdenken, Zwangsvorstellungen, Zwangsimpulsen u. dgl. leiden, zu einer besonderen klinischen Einheit, für deren Affektion der Name »Zwangsneurose« gebräuchlich ist [Fußnote]Vgl. Löwenfeld (1904).. Man möge aber nicht versuchen, die Eigenart dieses Leidens aus seinem Namen abzuleiten, denn strenggenommen haben andersartige krankhafte Seelenerscheinungen den gleichen Anspruch auf den sogenannten »Zwangscharakter«. An Stelle einer Definition muß derzeit noch die Detailkenntnis dieser Zustände treten, da es bisher nicht gelungen ist, das wahrscheinlich tiefliegende Kriterium der Zwangsneurose aufzuzeigen, dessen Vorhandensein man doch in ihren Äußerungen allenthalben zu spüren vermeint.
Das neurotische Zeremoniell besteht in kleinen Verrichtungen, Zutaten, Einschränkungen, Anordnungen, die bei gewissen Handlungen des täglichen Lebens in immer gleicher oder gesetzmäßig abgeänderter Weise vollzogen werden. Diese Tätigkeiten machen uns den Eindruck von bloßen »Formalitäten«; sie erscheinen uns völlig bedeutungslos. Nicht anders erscheinen sie dem Kranken selbst, und doch ist er unfähig, sie zu unterlassen, denn jede Abweichung von dem Zeremoniell straft sich durch unerträgliche Angst, die sofort die Nachholung des Unterlassenen erzwingt. Ebenso kleinlich wie die Zeremoniellhandlungen selbst sind die Anlässe und Tätigkeiten, welche durch das Zeremoniell verziert, erschwert und jedenfalls auch verzögert werden, z. B. das Ankleiden und Auskleiden, das Zubettegehen, die Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse. Man kann die Ausübung eines Zeremoniells beschreiben, indem man es gleichsam durch eine Reihe ungeschriebener Gesetze ersetzt, also z. B. für das Bettzeremoniell: der Sessel muß in solcher, bestimmter Stellung vor dem Bette stehen, auf ihm die Kleider in gewisser Ordnung gefaltet liegen; die Bettdecke muß am Fußende eingesteckt sein, das Bettuch glatt gestrichen; die Polster müssen so und so verteilt liegen, der Körper selbst in einer genau bestimmten Lage sein; dann erst darf man einschlafen. In leichten Fällen sieht das Zeremoniell so der Übertreibung einer gewohnten und berechtigten Ordnung gleich. Aber die besondere Gewissenhaftigkeit der Ausführung und die Angst bei der Unterlassung kennzeichnen das Zeremoniell als »heilige Handlung«. Störungen derselben werden meist schlecht vertragen; die Öffentlichkeit, die Gegenwart anderer Personen während der Vollziehung ist fast immer ausgeschlossen.
Zu Zwangshandlungen im weiteren Sinne können alle beliebigen Tätigkeiten werden, wenn sie durch kleine Zutaten verziert, durch Pausen und Wiederholungen rhythmiert werden. Eine scharfe Abgrenzung des »Zeremoniells« von den »Zwangshandlungen« wird man zu finden nicht erwarten. Meist sind die Zwangshandlungen aus Zeremoniell hervorgegangen. Neben diesen beiden bilden den Inhalt des Leidens Verbote und Verhinderungen (Abulien), die ja eigentlich das Werk der Zwangshandlungen nur fortsetzen, indem dem Kranken einiges überhaupt nicht erlaubt ist, anderes nur unter Befolgung eines vorgeschriebenen Zeremoniells.
Merkwürdig ist, daß Zwang wie Verbote (das eine tun müssen, das andere nicht tun dürfen) anfänglich nur die einsamen Tätigkeiten der Menschen betreffen und deren soziales Verhalten lange Zeit unbeeinträchtigt lassen; daher können solche Kranke ihr Leiden durch viele Jahre als ihre Privatsache behandeln und verbergen. Auch leiden viel mehr Personen an solchen Formen der Zwangsneurose, als den Ärzten bekannt wird. Das Verbergen wird ferner vielen Kranken durch den Umstand erleichtert, daß sie sehr wohl imstande sind, über einen Teil des Tages ihre sozialen Pflichten zu erfüllen, nachdem sie eine Anzahl von Stunden in melusinenhafter Abgeschiedenheit ihrem geheimnisvollen Tun gewidmet haben.
Es ist leicht einzusehen, worin die Ähnlichkeit des neurotischen Zeremoniells mit den heiligen Handlungen des religiösen Ritus gelegen ist, in der Gewissensangst bei der Unterlassung, in der vollen Isolierung von allem anderen Tun (Verbot der Störung) und in der Gewissenhaftigkeit der Ausführung im kleinen. Aber ebenso augenfällig sind die Unterscheidungen, von denen einige so grell sind, daß sie den Vergleich zu einem sakrilegischen werden lassen. Die größere individuelle Mannigfaltigkeit der Zeremoniellhandlungen im Gegensatze zur Stereotypie des Ritus (Gebet, Proskynesis usw.), der Privatcharakter derselben im Gegensatze zur Öffentlichkeit und Gemeinsamkeit der Religionsübung; vor allem aber der eine Unterschied, daß die kleinen Zutaten des religiösen Zeremoniells sinnvoll und symbolisch gemeint sind, während die des neurotischen läppisch und sinnlos erscheinen. Die Zwangsneurose liefert hier ein halb komisches, halb trauriges Zerrbild einer Privatreligion. Indes wird gerade dieser einschneidendste Unterschied zwischen neurotischem und religiösem Zeremoniell beseitigt, wenn man mit Hilfe der psychoanalytischen Untersuchungstechnik zum Verständnis der Zwangshandlungen durchdringt. Bei dieser Untersuchung wird der Anschein, als ob Zwangshandlungen läppisch und sinnlos wären, gründlich zerstört und die Begründung dieses Scheines aufgedeckt. Man erfährt, daß die Zwangshandlungen durchwegs und in all ihren Einzelheiten sinnvoll sind, im Dienste von bedeutsamen Interessen der Persönlichkeit stehen und fortwirkende Erlebnisse sowie affektbesetzte Gedanken derselben zum Ausdrucke bringen. Sie tun dies in zweierlei Art, entweder als direkte oder als symbolische Darstellungen; sie sind demnach entweder historisch oder symbolisch zu deuten.
Einige Beispiele, die diese Behauptung erläutern sollen, darf ich mir hier wohl nicht ersparen. Wer mit den Ergebnissen der psychoanalytischen Forschung bei den Psychoneurosen vertraut ist, wird nicht überrascht sein zu hören, daß das durch die Zwangshandlungen oder das Zeremoniell Dargestellte sich aus dem intimsten, meist aus dem sexuellen Erleben der Betroffenen ableitet:
a) Ein Mädchen meiner Beobachtung stand unter dem Zwange, nach dem Waschen die Waschschüssel mehrmals herumzuschwenken. Die Bedeutung dieser Zeremoniellhandlung lag in dem sprichwörtlichen Satze: Man soll schmutziges Wasser nicht ausgießen, ehe man reines hat. Die Handlung war dazu bestimmt, ihre geliebte Schwester zu mahnen und zurückzuhalten, daß sie sich von ihrem unerfreulichen Manne nicht eher scheiden lasse, als bis sie eine Beziehung zu einem besseren angeknüpft habe.
b) Eine von ihrem Manne getrennt lebende Frau folgte beim Essen dem Zwange, das Beste stehenzulassen, z. B. von einem Stück gebratenen Fleisch nur die Ränder zu genießen. Dieser Verzicht erklärte sich durch das Datum seiner Entstehung. Er war am Tage aufgetreten, nachdem sie ihrem Manne den ehelichen Verkehr gekündigt, d. h. aufs Beste verzichtet hatte.
c) Dieselbe Patientin konnte eigentlich nur auf einem einzigen Sessel sitzen und konnte sich nur mit Schwierigkeit von ihm erheben. Der Sessel symbolisierte ihr mit Beziehung auf bestimmte Details ihres Ehelebens den Mann, dem sie die Treue hielt. Sie fand zur Aufklärung ihres Zwanges den Satz: »Man trennt sich so schwer von einem (Manne, Sessel), auf dem man einmal gesessen ist.«
d) Sie pflegte eine Zeit hindurch eine besonders auffällige und sinnlose Zwangshandlung zu wiederholen. Sie lief dann aus ihrem Zimmer in ein anderes, in dessen Mitte ein Tisch stand, rückte die auf ihm liegende Tischdecke in gewisser Art zurecht, schellte dem Stubenmädchen, das an den Tisch herantreten mußte, und entließ sie wieder mit einem gleichgültigen Auftrag. Bei den Bemühungen, diesen Zwang aufzuklären, fiel ihr ein, daß die betreffende Tischdecke an einer Stelle einen mißfarbigen Fleck hatte und daß sie jedesmal die Decke so legte, daß der Fleck dem Stubenmädchen in die Augen fallen mußte. Das Ganze war dann eine Reproduktion eines Erlebnisses aus ihrer Ehe, welches ihren Gedanken später ein Problem zu lösen gegeben hatte. Ihr Mann war in der Brautnacht von einem nicht ungewöhnlichen Mißgeschick befallen worden. Er fand sich impotent und »kam viele Male im Laufe der Nacht aus seinem Zimmer in ihres gerannt«, um den Versuch, ob es nicht doch gelänge, zu wiederholen. Am Morgen äußerte er, er müsse sich ja vor dem Hotelstubenmädchen schämen, welches die Betten in Ordnung bringen werde, ergriff darum ein Fläschchen mit roter Tinte und goß dessen Inhalt über das Bettuch aus, aber so ungeschickt, daß der rote Fleck an einer für seine Absicht sehr ungeeigneten Stelle zustande kam. Sie spielte also Brautnacht mit jener Zwangshandlung. »Tisch und Bett« machen zusammen die Ehe aus.
e) Wenn sie den Zwang angenommen hatte, die Nummer jeder Geldnote zu notieren, ehe sie dieselbe aus ihren Händen gab, so war dies gleichfalls historisch aufzuklären. Zur Zeit, als sie sich noch mit der Absicht trug, ihren Mann zu verlassen, wenn sie einen anderen, vertrauenswürdigeren fände, ließ sie sich in einem Badeorte die höflichen Bemühungen eines Herrn gefallen, über dessen Bereitschaft, Ernst zu machen, sie doch im Zweifel blieb. Eines Tages um Kleingeld verlegen, bat sie ihn, ihr ein Fünfkronenstück zu wechseln. Er tat es, steckte das große Geldstück ein und äußerte galant, er gedenke sich von diesem nie wieder zu trennen, da es durch ihre Hand gegangen sei. Bei späterem Beisammensein war sie nun oft in Versuchung, ihn aufzufordern, er möge ihr das Fünfkronenstück vorzeigen, gleichsam um sich so zu überzeugen, ob sie seinen Huldigungen Glauben schenken dürfe. Sie unterließ es aber mit der guten Begründung, daß man gleichwertige Münzen nicht voneinander unterscheiden könne. Der Zweifel blieb also ungelöst; er hinterließ ihr den Zwang, die Nummern der Geldnoten, durch welche jede einzelne von allen ihr gleichwertigen individuell unterschieden ist, zu notieren.
Diese wenigen Beispiele, aus der Fülle meiner Erfahrung herausgehoben, sollen nur den Satz, daß alles an den Zwangshandlungen sinnvoll und deutbar ist, erläutern. Das gleiche gilt für das eigentliche Zeremoniell, nur daß hier der Beweis umständlichere Mitteilung erfordern würde. Ich verkenne es keineswegs, wie sehr wir uns bei den Aufklärungen der Zwangshandlungen vom Gedankenkreise der Religion zu entfernen scheinen.
Es gehört zu den Bedingungen des Krankseins, daß die dem Zwange folgende Person ihn ausübe, ohne seine Bedeutung – wenigstens seine Hauptbedeutung – zu kennen. Erst durch die Bemühung der psychoanalytischen Therapie wird ihr der Sinn der Zwangshandlung und damit die zu ihr treibenden Motive bewußtgemacht. Wir sprechen diesen bedeutsamen Sachverhalt in den Worten aus, daß die Zwangshandlung unbewußten Motiven und Vorstellungen zum Ausdruck diene. Darin scheint nun ein neuerlicher Unterschied gegen die Religionsübung zu liegen; aber man muß daran denken, daß auch der einzelne Fromme in der Regel das religiöse Zeremoniell ausübt, ohne nach dessen Bedeutung zu fragen, während allerdings der Priester und der Forscher mit dem meist symbolischen Sinn des Ritus bekannt sein mögen. Die Motive, die zur Religionsübung drängen, sind aber allen Gläubigen unbekannt oder werden in ihrem Bewußtsein durch vorgeschobene Motive vertreten.
Die Analyse der Zwangshandlungen hat uns bereits eine Art von Einsicht in die Verursachung derselben und in die Verkettung der für sie maßgebenden Motive ermöglicht. Man kann sagen, der an Zwang und Verboten Leidende benimmt sich so, als stehe er unter der Herrschaft eines Schuldbewußtseins, von dem er allerdings nichts weiß, eines unbewußten Schuldbewußtseins also, wie man es ausdrücken muß mit Hinwegsetzung über das Sträuben der hier zusammentreffenden Worte. Dies Schuldbewußtsein hat seine Quelle in gewissen frühzeitigen Seelenvorgängen, findet aber eine beständige Auffrischung in der bei jedem rezenten Anlaß erneuerten Versuchung und läßt anderseits eine immer lauernde Erwartungsangst, Unheilserwartung, entstehen, die durch den Begriff der Bestrafung an die innere Wahrnehmung der Versuchung geknüpft ist. Zu Beginn der Zeremoniellbildung wird dem Kranken noch bewußt, daß er dies oder jenes tun müsse, sonst werde Unheil geschehen, und in der Regel wird die Art des zu erwartenden Unheils noch seinem Bewußtsein genannt. Der jedesmal nachweisbare Zusammenhang zwischen dem Anlasse, bei dem die Erwartungsangst auftritt, und dem Inhalte, mit dem sie droht, ist dem Kranken bereits verhüllt. Das Zeremoniell beginnt so als Abwehr- oder Versicherungshandlung, Schutzmaßregel.
Dem Schuldbewußtsein der Zwangsneurotiker entspricht die Beteuerung der Frommen, sie wüßten, daß sie im Herzen arge Sünder seien; den Wert von Abwehr- und Schutzmaßregeln scheinen die frommen Übungen (Gebete, Anrufungen usw.) zu haben, mit denen sie jede Tätigkeit des Tages und zumal jede außergewöhnliche Unternehmung einleiten.
Einen tieferen Einblick in den Mechanismus der Zwangsneurose gewinnt man, wenn man die ihr zugrunde liegende erste Tatsache in Würdigung zieht: diese ist allemal die Verdrängung einer Triebregung (einer Komponente des Sexualtriebes), welche in der Konstitution der Person enthalten war, im kindlichen Leben derselben sich eine Weile äußern durfte und darauf der Unterdrückung verfiel. Eine spezielle, auf die Ziele dieses Triebes gerichtete Gewissenhaftigkeit wird bei der Verdrängung desselben geschaffen, aber diese psychische Reaktionsbildung fühlt sich nicht sicher, sondern von dem im Unbewußten lauernden Triebe beständig bedroht. Der Einfluß des verdrängten Triebes wird als Versuchung empfunden, beim Prozeß der Verdrängung selbst entsteht die Angst, die sich als Erwartungsangst der Zukunft bemächtigt. Der Verdrängungsprozeß, der zur Zwangsneurose führt, ist als ein unvollkommen gelungener zu bezeichnen, der immer mehr zu mißlingen droht. Er ist daher einem nicht abzuschließenden Konflikt zu vergleichen; es werden immer neue psychische Anstrengungen erfordert, um dem konstanten Andrängen des Triebes das Gleichgewicht zu halten. Die Zeremoniell- und Zwangshandlungen entstehen so teils zur Abwehr der Versuchung, teils zum Schutze gegen das erwartete Unheil. Gegen die Versuchung scheinen die Schutzhandlungen bald nicht auszureichen; es treten dann die Verbote auf, welche die Situation der Versuchung fernelegen sollen. Verbote ersetzen Zwangshandlungen, wie man sieht, ebenso wie eine Phobie den hysterischen Anfall zu ersparen bestimmt ist. Anderseits stellt das Zeremoniell die Summe der Bedingungen dar, unter denen anderes, noch nicht absolut Verbotenes erlaubt ist, ganz ähnlich wie das kirchliche Ehezeremoniell dem Frommen die Gestattung des sonst sündhaften Sexualgenusses bedeutet. Zum Charakter der Zwangsneurose wie aller ähnlichen Affektionen gehört noch, daß ihre Äußerungen (Symptome, darunter auch die Zwangshandlungen) die Bedingung eines Kompromisses zwischen den streitenden seelischen Mächten erfüllen. Sie bringen also auch immer etwas von der Lust wieder, die sie zu verhüten bestimmt sind, dienen dem verdrängten Triebe nicht minder als den ihn verdrängenden Instanzen. Ja, mit dem Fortschritte der Krankheit nähern sich die ursprünglich eher die Abwehr besorgenden Handlungen immer mehr den verpönten Aktionen an, durch welche sich der Trieb in der Kindheit äußern durfte.
Von diesen Verhältnissen wäre etwa folgendes auch auf dem Gebiete des religiösen Lebens wiederzufinden: Auch der Religionsbildung scheint die Unterdrückung, der Verzicht auf gewisse Triebregungen zugrunde zu liegen; es sind aber nicht wie bei der Neurose ausschließlich sexuelle Komponenten, sondern eigensüchtige, sozialschädliche Triebe, denen übrigens ein sexueller Beitrag meist nicht versagt ist. Das Schuldbewußtsein in der Folge der nicht erlöschenden Versuchung, die Erwartungsangst als Angst vor göttlichen Strafen sind uns ja auf religiösem Gebiete früher bekannt geworden als auf dem der Neurose. Vielleicht wegen der beigemengten sexuellen Komponenten, vielleicht infolge allgemeiner Eigenschaften der Triebe erweist sich die Triebunterdrückung auch im religiösen Leben als eine unzureichende und nicht abschließbare. Volle Rückfälle in die Sünde sind beim Frommen sogar häufiger als beim Neurotiker und begründen eine neue Art von religiösen Betätigungen, die Bußhandlungen, zu denen man in der Zwangsneurose die Gegenstücke findet.
Einen eigentümlichen und entwürdigenden Charakter der Zwangsneurose sahen wir darin, daß das Zeremoniell sich an kleine Handlungen des täglichen Lebens anschließt und sich in läppischen Vorschriften und Einschränkungen derselben äußert. Man versteht diesen auffälligen Zug in der Gestaltung des Krankheitsbildes erst, wenn man erfährt, daß der Mechanismus der psychischen Verschiebung, den ich zuerst bei der Traumbildung [Fußnote]Vgl. Freud: Die Traumdeutung (1900 a). aufgefunden, die seelischen Vorgänge der Zwangsneurose beherrscht. In den wenigen Beispielen von Zwangshandlungen ist bereits ersichtlich, wie durch eine Verschiebung vom Eigentlichen, Bedeutsamen, auf ein ersetzendes Kleines, z. B. vom Mann auf den Sessel, die Symbolik und das Detail der Ausführung zustande kommen. Diese Neigung zur Verschiebung ist es, die das Bild der Krankheitserscheinungen immer weiter abändert und es endlich dahin bringt, das scheinbar Geringfügigste zum Wichtigsten und Dringendsten zu machen. Es ist nicht zu verkennen, daß auf dem religiösen Gebiete eine ähnliche Neigung zur Verschiebung des psychischen Wertes, und zwar in gleichem Sinne, besteht, so daß allmählich das kleinliche Zeremoniell der Religionsübung zum Wesentlichen wird, welches deren Gedankeninhalt beiseite gedrängt hat. Darum unterliegen die Religionen auch ruckweise einsetzenden Reformen, welche das ursprüngliche Wertverhältnis herzustellen bemüht sind.
Der Kompromißcharakter der Zwangshandlungen als neurotischer Symptome wird an dem entsprechenden religiösen Tun am wenigsten deutlich zu erkennen sein. Und doch wird man auch an diesen Zug der Neurose gemahnt, wenn man erinnert, wie häufig alle Handlungen, welche die Religion verpönt – Äußerungen der von der Religion unterdrückten Triebe –, gerade im Namen und angeblich zugunsten der Religion vollführt werden.
Nach diesen Übereinstimmungen und Analogien könnte man sich getrauen, die Zwangsneurose als pathologisches Gegenstück zur Religionsbildung aufzufassen, die Neurose als eine individuelle Religiosität, die Religion als eine universelle Zwangsneurose zu bezeichnen. Die wesentlichste Übereinstimmung läge in dem zugrunde liegenden Verzicht auf die Betätigung von konstitutionell gegebenen Trieben; der entscheidendste Unterschied in der Natur dieser Triebe, die bei der Neurose ausschließlich sexueller, bei der Religion egoistischer Herkunft sind.
Ein fortschreitender Verzicht auf konstitutionelle Triebe, deren Betätigung dem Ich primäre Lust gewähren könnte, scheint eine der Grundlagen der menschlichen Kulturentwicklung zu sein. Ein Stück dieser Triebverdrängung wird von den Religionen geleistet, indem sie den einzelnen seine Trieblust der Gottheit zum Opfer bringen lassen. »Die Rache ist mein«, spricht der Herr. An der Entwicklung der alten Religionen glaubt man zu erkennen, daß vieles, worauf der Mensch als »Frevel« verzichtet hatte, dem Gotte abgetreten und noch im Namen des Gottes erlaubt war, so daß die Überlassung an die Gottheit der Weg war, auf welchem sich der Mensch von der Herrschaft böser, sozialschädlicher Triebe befreite. Es ist darum wohl kein Zufall, daß den alten Göttern alle menschlichen Eigenschaften – mit den aus ihnen folgenden Missetaten – in uneingeschränktem Maße zugeschrieben wurden, und kein Widerspruch, daß es doch nicht erlaubt war, die eigenen Frevel durch das göttliche Beispiel zu rechtfertigen.
Zwei Kinderlügen (1913)
Es ist begreiflich, daß Kinder lügen, wenn sie damit die Lügen der Erwachsenen nachahmen. Aber eine Anzahl von Lügen von gut geratenen Kindern haben eine besondere Bedeutung und sollten die Erzieher nachdenklich machen, anstatt sie zu erbittern. Sie erfolgen unter dem Einfluß überstarker Liebesmotive und werden verhängnisvoll, wenn sie ein Mißverständnis zwischen dem Kinde und der von ihm geliebten Person herbeiführen.
I
Das siebenjährige Mädchen (im zweiten Schuljahr) hat vom Vater Geld verlangt, um Farben zum Bemalen von Ostereiern zu kaufen. Der Vater hat es abgeschlagen mit der Begründung, er habe kein Geld. Kurz darauf verlangt es vom Vater Geld, um zu einem Kranz für die verstorbene Landesfürstin beizusteuern. Jedes der Schulkinder soll fünfzig Pfennige bringen. Der Vater gibt ihr zehn Mark; sie bezahlt ihren Beitrag, legt dem Vater neun Mark auf den Schreibtisch und hat für die übrigen fünfzig Pfennige Farben gekauft, die sie im Spielschrank verbirgt. Bei Tisch fragt der Vater argwöhnisch, was sie mit den fehlenden fünfzig Pfennigen gemacht und ob sie dafür nicht doch Farben gekauft hat. Sie leugnet es, aber der um zwei Jahre ältere Bruder, mit dem gemeinsam sie die Eier bemalen wollte, verrät sie; die Farben werden im Schrank gefunden. Der erzürnte Vater überläßt die Missetäterin der Mutter zur Züchtigung, die sehr energisch ausfällt. Die Mutter ist nachher selbst erschüttert, als sie merkt, wie sehr das Kind verzweifelt ist. Sie liebkost es nach der Züchtigung, geht mit ihm spazieren, um es zu trösten. Aber die Wirkungen dieses Erlebnisses, von der Patientin selbst als »Wendepunkt« ihrer Jugend bezeichnet, erweisen sich als unaufhebbar. Sie war bis dahin ein wildes, zuversichtliches Kind, sie wird von da an scheu und zaghaft. In ihrer Brautzeit gerät sie in eine ihr unverständliche Wut, als die Mutter ihr die Möbel und Aussteuer besorgt. Es schwebt ihr vor, es ist doch ihr Geld, dafür darf kein anderer etwas kaufen. Als junge Frau scheut sie sich, von ihrem Manne Ausgaben für ihren persönlichen Bedarf zu verlangen, und scheidet in überflüssiger Weise »ihr« Geld von seinem Geld. Während der Zeit der Behandlung trifft es sich einige Male, daß die Geldzusendungen ihres Mannes sich verspäten, so daß sie in der fremden Stadt mittellos bleibt. Nachdem sie mir dies einmal erzählt hat, will ich ihr das Versprechen abnehmen, in der Wiederholung dieser Situation die kleine Summe, die sie unterdes braucht, von mir zu entlehnen. Sie gibt dieses Versprechen, hält es aber bei der nächsten Geldverlegenheit nicht ein und zieht es vor, ihre Schmuckstücke zu verpfänden. Sie erklärt, sie kann kein Geld von mir nehmen.
Die Aneignung der fünfzig Pfennige in der Kindheit hatte eine Bedeutung, die der Vater nicht ahnen konnte. Einige Zeit vor der Schule hatte sie ein merkwürdiges Stückchen mit Geld aufgeführt. Eine befreundete Nachbarin hatte sie mit einem kleinen Geldbetrag als Begleiterin ihres noch jüngeren Söhnchens in einen Laden geschickt, um irgend etwas einzukaufen. Den Rest des Geldes nach dem Einkaufe trug sie als die ältere nach Hause. Als sie aber auf der Straße dem Dienstmädchen der Nachbarin begegnete, warf sie das Geld auf das Straßenpflaster hin. Zur Analyse dieser ihr selbst unerklärlichen Handlung fiel ihr Judas ein, der die Silberlinge hinwarf, die er für den Verrat am Herrn bekommen. Sie erklärt es für sicher, daß sie mit der Passionsgeschichte schon vor dem Schulbesuch bekannt wurde. Aber inwiefern durfte sie sich mit Judas identifizieren?
Im Alter von dreieinhalb Jahren hatte sie ein Kindermädchen, dem sie sich sehr innig anschloß. Dieses Mädchen geriet in erotische Beziehungen zu einem Arzt, dessen Ordination sie mit dem Kinde besuchte. Es scheint, daß das Kind damals Zeuge verschiedener sexueller Vorgänge wurde. Ob sie sah, daß der Arzt dem Mädchen Geld gab, ist nicht sichergestellt; unzweifelhaft aber, daß das Mädchen dem Kinde kleine Münzen schenkte, um sich seiner Verschwiegenheit zu versichern, für welche auf dem Heimwege Einkäufe (wohl an Süßigkeiten) gemacht wurden. Es ist auch möglich, daß der Arzt selbst dem Kinde gelegentlich Geld schenkte. Dennoch verriet das Kind sein Mädchen an die Mutter, aus Eifersucht. Es spielte so auffällig mit den heimgebrachten Groschen, daß die Mutter fragen mußte: Woher hast du das Geld? Das Mädchen wurde weggeschickt.
Geld von jemandem nehmen hatte also für sie frühzeitig die Bedeutung der körperlichen Hingebung, der Liebesbeziehung, bekommen. Vom Vater Geld nehmen hatte den Wert einer Liebeserklärung. Die Phantasie, daß der Vater ihr Geliebter sei, war so verführerisch, daß der Kinderwunsch nach den Farben für die Ostereier sich mit ihrer Hilfe gegen das Verbot leicht durchsetzte. Eingestehen konnte sie aber die Aneignung des Geldes nicht, sie mußte leugnen, weil das Motiv der Tat, ihr selbst unbewußt, nicht einzugestehen war. Die Züchtigung des Vaters war also eine Abweisung der ihm angebotenen Zärtlichkeit, eine Verschmähung, und brach darum ihren Mut. In der Behandlung brach ein schwerer Verstimmungszustand los, dessen Auflösung zu der Erinnerung des hier Mitgeteilten führte, als ich einmal genötigt war, die Verschmähung zu kopieren, indem ich sie bat, keine Blumen mehr zu bringen.
Für den Psychoanalytiker bedarf es kaum der Hervorhebung, daß in dem kleinen Erlebnis des Kindes einer jener so überaus häufigen Fälle von Fortsetzung der früheren Analerotik in das spätere Liebesleben vorliegt. Auch die Lust, die Eier farbig zu bemalen, entstammt derselben Quelle.
II
Eine heute infolge einer Versagung im Leben schwerkranke Frau war früher einmal ein besonders tüchtiges, wahrheitsliebendes, ernsthaftes und gutes Mädchen gewesen und dann eine zärtliche Frau geworden. Noch früher aber, in den ersten Lebensjahren, war sie ein eigensinniges und unzufriedenes Kind gewesen, und während sie sich ziemlich rasch zur Übergüte und Übergewissenhaftigkeit wandelte, ereigneten sich noch in ihrer Schulzeit Dinge, die ihr in den Zeiten der Krankheit schwere Vorwürfe einbrachten und von ihr als Beweise gründlicher Verworfenheit beurteilt wurden. Ihre Erinnerung sagte ihr, daß sie damals oft geprahlt und gelogen hatte. Einmal rühmte sich auf dem Schulweg eine Kollegin: Gestern haben wir zu Mittag Eis gehabt. Sie erwiderte: Oh, Eis haben wir alle Tage. In Wirklichkeit verstand sie nicht, was Eis zur Mittagsmahlzeit bedeuten sollte; sie kannte das Eis nur in den langen Blöcken, wie es auf Wagen verführt wird, aber sie nahm an, es müsse etwas Vornehmes damit gemeint sein, und darum wollte sie hinter der Kollegin nicht zurückbleiben.
Als sie zehn Jahre alt war, wurde in der Zeichenstunde einmal die Aufgabe gegeben, aus freier Hand einen Kreis zu ziehen. Sie bediente sich dabei aber des Zirkels, brachte so leicht einen vollkommenen Kreis zustande und zeigte ihre Leistung triumphierend ihrer Nachbarin. Der Lehrer kam hinzu, hörte die Prahlerin, entdeckte die Zirkelspuren in der Kreislinie und stellte das Mädchen zur Rede. Dieses aber leugnete hartnäckig, ließ sich durch keine Beweise überführen und half sich durch trotziges Verstummen. Der Lehrer konferierte darüber mit dem Vater; beide ließen sich durch die sonstige Bravheit des Mädchens bestimmen, dem Vergehen keine weitere Folge zu geben.
Beide Lügen des Kindes waren durch den nämlichen Komplex motiviert. Als älteste von fünf Geschwistern entwickelte die Kleine frühzeitig eine ungewöhnlich intensive Anhänglichkeit an den Vater, an welcher dann in reifen Jahren ihr Lebensglück scheitern sollte. Sie mußte aber bald die Entdeckung machen, daß dem geliebten Vater nicht die Größe zukomme, die sie ihm zuzuschreiben bereit war. Er hatte mit Geldschwierigkeiten zu kämpfen, er war nicht so mächtig oder so vornehm, wie sie gemeint hatte. Diesen Abzug von ihrem Ideal konnte sie sich aber nicht gefallen lassen. Indem sie nach Art des Weibes ihren ganzen Ehrgeiz auf den geliebten Mann verlegte, wurde es zum überstarken Motiv für sie, den Vater gegen die Welt zu stützen. Sie prahlte also vor den Kolleginnen, um den Vater nicht verkleinern zu müssen. Als sie später das Eis beim Mittagessen mit » glace« übersetzen lernte, war der Weg gebahnt, auf welchem dann der Vorwurf wegen dieser Reminiszenz in eine Angst vor Glasscherben und Splittern einmünden konnte.
Der Vater war ein vorzüglicher Zeichner und hatte durch die Proben seines Talents oft genug das Entzücken und die Bewunderung der Kinder hervorgerufen. In der Identifizierung mit dem Vater zeichnete sie in der Schule jenen Kreis, der ihr nur durch betrügerische Mittel gelingen konnte. Es war, als ob sie sich rühmen wollte: Schau her, was mein Vater kann! Das Schuldbewußtsein, das der überstarken Neigung zum Vater anhaftete, fand in dem versuchten Betrug seinen Ausdruck; ein Geständnis war aus demselben Grunde unmöglich wie in der vorstehenden Beobachtung, es hätte das Geständnis der verborgenen inzestuösen Liebe sein müssen.
Man möge nicht gering denken von solchen Episoden des Kinderlebens. Es wäre eine arge Verfehlung, wenn man aus solchen kindlichen Vergehen die Prognose auf Entwicklung eines unmoralischen Charakters stellen würde. Wohl aber hängen sie mit den stärksten Motiven der kindlichen Seele zusammen und künden die Dispositionen zu späteren Schicksalen oder künftigen Neurosen an.
