
- •Thema 1: Lexikologie: der Gegenstand, der Problembereich, die Aufgabe, die Aufteilung und die Methoden der Untersuchung
- •Lexikologie
- •II. Problembereich und Aufgaben
- •III. Aufteilung der Lexikologie
- •Thema 2: Sprache (Langage: langue - parole):
- •Das Wort: Doppelkonstellationen der Inhaltsseite
- •3.3. Bedeutungsauffasungen
- •Bedeutungsauffasungen
- •3.4. Das vorstrukturalistische/ semiotische Dreieck
- •3.5. Die Komplexität der Wortbedeutung: drei Komponenten
- •3.7. Typen der Wortbedeutung
- •Aspekt der Nominationstechnik
- •Thema 4. Die Bedeutung des Wortes und seine Paradigmatik (4.1.); die paradigmatikbezogenen Probleme (4.2.)
- •4.0.„Stammbaum“ der Paradigmatik:
- •4.1.Die Bedeutung des Wortes und seine Paradigmatik
- •4.1.1. Typen der paradigmatischen Beziehungen → Wechselbeziehungen bei der Einnahme der bestimmten Stelle bzw. Position
- •4.1.2. Haupttypen der paradigmatischen Gruppierungen → sind nach ihrem Verhalten zur Wirklichkeit / Sprache zu strukturieren:
- •4.1.3. Innersprachliche paradigmatische Gruppierungen: Typen
- •4.1.3. Die so genannten Synonyme I (nach k. Adamzik, s.72-77):
- •4 .1.4. Typen der Antonyme
- •4 .1.5. Wortfeld (1) und Sachgruppe (2)
- •4.1.6. Die lexikalisch-semantischen Gruppen (lsGs): Tabelle 4.1.6.
- •4.2. Die logisch-rhetorische Klassifikation des bWs:
- •4.2.1.1. Die Bedeutungsübertragung: die Metapher und ihre Arten
- •4.2.1.2. Die Bedeutungsübertragung: die Metonymie und ihre Arten
- •4 .2.2. Die Bedeutungserweiterung: (be) (2.1.) - und Verengung (bv) (2.2.): Veränderung im Bedeutungsumfang
- •4 .2.3. Die Bedeutungsverschiebungen
- •4. 3. Entlehnungsprozesse: Ursachen (1), Wege (2), Formen (3)
- •4. 3. 1. Entlehnungen: Ursachen
- •4. 3.2. Entlehnungen: Wege
- •4.4. Paradigmatikbezogene Probleme: Wortbildungsprozess
- •4 .4.0. Der „Stammbaum“ der Bedeutung des Wortes und der Wortbildungsprozesse
- •4 . 4.1. Typen elementarer Sprachzeichen:
- •4 . 4.1.1A Die paradigmatische und syntagmatische Achse:
- •4. 4.1.1B Wortfamilien:
- •4. 4.2. Typen von Wortschatzelementen:
- •4.4.3. Die Wortkreation (wk) / Wortschöpfungen:
- •4 .4.3.2. Die Möglichkeiten der Wortkreationen (wk) / w.-Schöpfungen :
- •4 .4.3.3. Die Kriterien der Aufnahme von Wortkreationen in Wörterbücher (wb) :
- •4 .4.4. Wortbildungen (wbd) zwischen Lexikon (lk) und Grammatik (gr):
- •4.4.4.1. Produktive Wortbildungsschemata:
- •Deutschstunde
- •4 .4.4.3. Die Struktur komplexer Wörter
- •Ddr: Mauer und Grenze offen
- •Die Wörter, die für die Frage der wb relevant s. ® 43%:
- •4.4.4.3.2. Derivation (dv):
- •4.4.4.3.4. Konversation:
- •4.4.4.3.5. Kombination der wbd-Verfahren:
- •Thema 5. Die Bedeutung des Wortes und seine Syntagmatik (5.1.); die syntagmatikbezogenen Probleme (5.2., 5.3.)
- •5.0. „Stammbaum“ der Syntagmatik (die Schwerpunkte): Tabelle 5.0.
- •5.1.7. Wortverbindungen im Bestande der Phraseologie Wortverbindungen (wv)
- •5 .1.8. Phraseologie: ihr Gegenstand und Problembereich
- •5.1.10. Phraseologische Einheiten
- •5.1.11. Phraseologische Verbindungen (1) und Ausdrücke (2):
- •5.2.1. Zum Problem der Satzdefinition (sd): Langue- und Parole-Sätze:
- •5.2.2. Isomorphismus zwischen dem Wort(1) und dem Satz(2):
- •5.3.1. Der Sprechakt (SpA) als Grundlage für Textbildung (tb):
- •5.3.1.2. Gemeintes und Mitgemeintes
- •5.3.2. Wortverbindungen als Thema und Rhema(1) und Text(2)
- •5.3.3. Der Text als Ausschnitt aus einem Diskurs
- •5.3.4. Kriterien der Definition der Texte (dt)
- •5 .3.5. Text: eine linguistische Definition
- •5.3.6. Der Text als mehrdimensionale Grösse
- •5.3.6.1. Die thematische Dimension
- •5 .3.6.2. Die funktionale Dimension der Text(sorten)
- •5 .3.6.3. Die situatuve Dimension:
- •5.3.6.4. Die diskursive oder intertextuelle Dimension:
- •5.3.6.5. Die sprachliche Dimension:
- •Glossar
- •Grundlegende Literatur
- •Literaturquelle
3.7. Typen der Wortbedeutung
-
1.
2.
3.
→ denotative
→ referentielle
→ konnotative

nach Bezeichnungs- und Inhaltsfunktion
Aspekt der Nominationstechnik
|
|
|
|
konkrete sinnliche Beobachtung: |
|
qualitativ höherer Abstraktionsvorgang: |
|
|
|
|
|
→ |
|
→übertragene/uneigentliche |
|
|
|
|
|
→primäre Nomination: |
|
→sekundäre Nomination |
|
|
|
|
|
→Merkmal der Gegenstände; |
|
→neue Bezeichnungsfunktion |
|
|
|
|
|
|
|
→Q uelle der Mehrdeutigkeit oder Polysemie |
|
Kern des polysemen Wortes |
|
|
|
|
|
Nebenbedeutung |
|
Hauptbedeutung |
|
|
|
|
|
|
|
Aspekt der Zugehörigkeit des Wortes
|
|||
→System/langue: |
zum |
→Text/Rede/parole: |
|
→lexikalische; |
|
→aktuelle (W.Schmidt); |
|
→potentielle; |
|
→aktualisierte (J.Erben). |
|
Thema 4. Die Bedeutung des Wortes und seine Paradigmatik (4.1.); die paradigmatikbezogenen Probleme (4.2.)
4.0.„Stammbaum“ der Paradigmatik:
T abelle 4.0.
1 . → die Bedeutung des Wortes und seine Paradigmatik (4.1.): |
2 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
→Paradigmatische Gruppierungen: |
1. |
2. |
3. |
4. |
|
||||||||||||
|
|
|
→ Prozess des Bedeutungswandels (BWs) (4.2.): |
→ landschaftliche Gliederung des Wortschatzes (4.5.); |
→ historische Gliederung des Wortschatzes (4.6.); |
→ soziale Gliederung des Wortschatzes (4.7); |
|
||||||||||
→ Typen der paradigmatischen Beziehungen (4.1.1.); |
→ Haupttypen der paradigmatischen Gruppierungen (4.1.2.): |
|
|
|
für die Referate |
|
|
||||||||||
|
|
|
→ Definition des BWS; |
|
|
|
|
||||||||||
→ innersprachliche paradigmatische Gruppierungen |
|
→Typen des BWs (4.2.): |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|
→Bedeutungsübertragung: Metapher, Metonymie (4.2.1.1. – 4.2.1.2. ); |
|
|
||||||||||
→Synonyme (4.1.3.); |
→Antonymie (4.1.4.); |
→Wortfeld und Sachgruppe (4.1.5.); |
→ die lexisch-semantischen Gruppen (LSGs) 4.1.6.): |
|
→Hypero-, Hyponymie (4.2.2.); →Bedeutungsverschiebungen (4.2.3.); |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
→ Entlehnungen (4.3.); |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
→ Strukturelle Organisation; |
|
→ Wortbildung (4.4.); |
|
|
|
||||||||||



 Direkte/wörtliche,
eigentliche, nominative
Direkte/wörtliche,
eigentliche, nominative



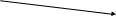
 .
→ Paradigmatikbezogene Probleme: Fließstand und Ausbau des
Wortschatzes:
.
→ Paradigmatikbezogene Probleme: Fließstand und Ausbau des
Wortschatzes:
