
- •Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Практика устной и письменной речи
- •Предисловие
- •Теоретический раздел
- •Практический раздел
- •Контрольный раздел
- •Пояснительная записка
- •Актуальность изучения дисциплины
- •1.2 Цели и задачи учебной дисциплины
- •1.3 Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
- •1.4 Структура содержания учебной дисциплины
- •Методы (технологии) обучения
- •Организация самостоятельной работы студентов
- •Диагностика компетенций студентов
- •Примерный тематический план
- •Содержание учебного материала
- •Тема 1. Все начинается в семье
- •Тема 2. В человеке все должно быть прекрасно
- •Тема 3. Свободное время и хобби
- •Тема 4. Жилье
- •Тема 15. Молодёжь и ее проблемы
- •Тема 16. Компьютер и интернет как инструмент досуга и самообразования
- •Тема 17. Беларусь
- •Тема 18. Германия
- •Тема 19. Австрия. Швейцария. Лихтенштейн и Люксембург
- •Тема 20. Личность и общество
- •Тема 21. Средства массовой информации в современном мире
- •Требования к уровню владения речью по видам речевой деятельности к концу первого года обучения
- •Рекомендуемые приемы проверки уровня подготовки студентов в конце первого года обучения
- •Требования к уровню владения речью по видам речевой деятельности к концу второго года обучения
- •Рекомендуемые приемы проверки уровня подготовки студентов в конце второго года обучения
- •Требования к уровню владения речью по видам речевой деятельности к концу третьего года обучения
- •Рекомендуемые приемы проверки уровня подготовки студентов в конце третьего года обучения
- •Информационная часть Основная литература:
- •Дополнительная литература:
- •Список использованных источников
- •Оглавление
- •Молодежь Учебно-методический комплекс для студентов специальности
- •1‒ 02 03 06 Иностранные языки (с указанием языков)
- •225404, Г. Барановичи, ул. Войкова, 21.
Практический раздел
LEXIKALISCH-GRAMMATISCHE ÜBUNGEN
Übung 1. Wer liest am besten und am schnellsten?
An
Der
Wert
Gefahr
Vertrauen
Ratschlag
Kettenraucher
Zigarettenschachtel
Lebensschwierigkeit
Rücksichtslosigkeit
Wertorientierung
Missverständnis
Drogensüchtige
Gewohnheit
Generation
akzeptieren
verbieten
Genuss
Droge
Dieb
Das
Übung 2. Bestimmen Sie das Geschlecht der Substantive.
Vorbild, Droge, Generation, Gift, Drohung, Konsum, Verhalten, Verhaltensform, Verbrecher, Gewohnheit, Feuerzeug, Diebstahl, Gewalt, Anspannung, Wert, Drogensüchtige, Wasserpfeife, Ratschlag, Vertrauen, Mindestalter, Alkoholsucht, Wille.
Übung 3. Teilen Sie alle Substantive aus der Aufgabe 2 in einige Gruppen ihrer Deklinationsart nach. Tragen Sie sie in folgende Tabelle ein.
Starke Deklination |
Schwache Deklination |
Gemischte Deklination |
Weibliche Deklination |
der Ratschlag … |
der Drogensüchtige … |
der Wille … |
die Gewohnheit … |
Übung 4. Nennen Sie 3 Grundformen folgender Verben.
Geraten, greifen, verbieten, klauen, bewältigen, sein, leiden, verspotten, lösen, sich kümmern, aufhören, erziehen, gefährden, kommen, haben, behandeln.
Übung 5. Welches Wort passt nicht? Streichen Sie es durch.
1. Die Sucht, die Droge, der Drogensüchtige, der Wert. 2. Die Gewohnheit, das Mindestalter, der Kettenraucher, empfehlen. 3. lösen, gefährden, geraten, sorgen. 4. Das Gift, die Gesellschaft, die Spritze, AIDS. 5. Aufmerksam, flexibel, ernst, gewalttätig.
Übung 6. Nennen Sie die passenden Objekte zu den Verben.
Greifen, begehen, schaden, sich abgewöhnen, bewältigen, sich verlassen, bevorzugen, verfolgen, sich kümmern, erleben, leiden, klauen, aufhören, sich gewöhnen.
Übung 7. Schreiben Sie an die Tafel das deutsche ABC und finden Sie dann zu jedem Buchstaben mindestens 1 Wort zum Thema «Die Jugend», wo dieser Buchstabe am Anfang ist.
Muster
A – arbeitsam, Abhängigkeit…
B – Beruf…
C – charmant…
Übung 8. Kombinieren Sie richtig und bilden Sie Sätze.
die Sucht a) gehen
Neugierde b) sein
auf die Nerven c) erhalten
Angst vor D. d) stehen
auf dem Laufenden e) haben
auf eigenen Füssen f) zugeben
Respekt vor D. g) erregen
eigene Fehler h) schaden
der Gesundheit i) haben
j) bewältigen
k) halten
Übung 9. Finden Sie Antonyme.
aufhören mit D. |
etwas berücksichtigen |
etwas vernachlässigen |
erlauben |
schaden D. |
ahnungslos sein |
verbieten |
unberücksichtigt lassen |
auf dem Laufenden sein |
beginnen mit D. |
Rücksicht auf A. nehmen |
abraten |
Misserfolge erleben |
sich leichtsinnig verhalten zu D. |
empfehlen |
Nutzen bringen |
etwas ernst nehmen |
erfolgreich sein |
Übung 10. Finden Sie Synonyme.
bewältigen |
rechnen auf A. |
lückenhaft |
die Sucht |
akzeptieren |
realisieren |
die Abhängigkeit |
fit sein |
sich verlassen auf A. |
überwinden |
verwirklichen |
beachten |
gut drauf sein |
mangelhaft |
Übung 11. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern.
1. Respekt haben vor D., die Jugend, und, die alten Menschen, die Erwachsenen. 2. Schlecht, die Gewohnheit, er, haben? 3. Das Wichtigste, sie, den Boden unter den Füssen verlieren, sein, es, dass, nicht. 4. Ich, greifen zu D., Konflikte austragen können, sie, glauben, nicht, dass, viele, Jugendliche, deshalb, die Drogen. 5. Einen Fehler begehen, wenn, die Ratschläge, sie, viele Jugendliche, ihre Eltern und Lehrer, etw. Akk. nicht ernst nehmen. 6. Sie, wenn, anwenden, mit ihren Kindern, überholte Erziehungsprinzipien, die Eltern, haben, viele Missverständnisse. 7. Auf die Nerven gehen, sich in auffallender Weise benehmen, die alten Menschen, oft, die Jugendlichen, denn, sie. 8. Einige Jugendliche, sich kümmern um Akk., nicht, die gesundheitsfördernden Veranstaltungen, andere junge Menschen, teilnehmen an D., ihre Gesundheit. 9. Das Wichtigste, es, für einen Süchtigen, jemand, sein, dass, ihm, bewältigen, seine Sucht, zu, helfen.
Übung 12. Formulieren Sie Fragen zu den unterstrichenen Wörtern.
1. Der Student gewöhnt sich an das Rauchen. 2. Verspotten die Jungen immer dieses Mädchen? 3. Die Eltern haben oft Angst vor der Zukunft ihrer Kinder. 4. Nicht alle Jugendlichen sind unerzogen, viele sind rücksichtsvoll, aufmerksam und zurückhaltend. 5. Die jungen Menschen folgen in den meisten Fällen den Ratschlägen ihrer Freunde. 6. Leider ist es nicht leicht in unserer Gesellschaft zu leben, deshalb leiden viele an verschiedenen schlechten Gewohnheiten.
Übung 13. Bilden Sie irreale Wunschsätze. Beachten Sie die Zeitformen des Konjunktivs.
1. Der Jugendliche nahm seine Probleme im Studium nicht ernst. 2. Sie ist in die schlechte Gesellschaft geraten. 3. Das Rauchen schadet der Gesundheit. 4. Er hat mit den Drogen nicht aufgehört. 5. Diese Studentin ist nicht flexibel. 6. Der Junge war schlecht drauf.7. Die Jugendliche nahm dem Lektor seine Worte übel, ohne Gründe solcher Worte zu klären.
Übung 14. Setzen Sie die eingeklammerten Verben im Präsens ein.
1. Der junge Mann (zugeben) seinen Fehler. 2. Mit seiner Musik (gehen) der Sohn der Mutter auf die Nerven. 3. Das Neue (erregen) immer Neugierde. 4. Infolge ihrer Leichtsinnigkeit (geraten) Vera immer in die schweren Situationen. 5. Um seines lieben Mädchens willen (aufhören) er mit der Alkoholsucht. 6. Die Studentin (sich verlassen) auf ihren Glücksstern. 7. Der Jugendliche (nehmen) Rücksicht auf die Worte seines Professors.
Übung 15. Vervollständigen Sie die Sätze.
1. Zu den schweren Krankheiten des Menschen gehören … (алкоголизм, наркомания, табакокурение). 2. Viele Drogensüchtige leiden oft an … (СПИД). 3. Die jungen Menschen interessieren sich für alles und … (всегда в курсе дел). 4. Aus jeder kompliziertesten Situation gibt es immer … (разумный выход). 5. Die Jugendlichen machen oft das, was ihnen die Erwachsenen … (запрещать).6. Nicht allen Jugendlichen gelingt es, die Träume zu … (осуществить), denn dazu braucht man sich viel Mühe zu geben. 7. Die ältere … (поколение) versteht die jüngere schlecht, denn sie haben verschiedene … (жизненные ценности и примеры для подражания). 8. Es ist nicht leicht, … (прекратить курить). 9. Gewaltbereite Jugendliche werden oft … (преступники). 10. Alles Verbotene…(вызывать любопытство) bei den jungen Menschen und sie … (попадать) oft in die Klemme.
Übung 16. Gebrauchen Sie die angegebenen Wörter in den passenden Situationen.
1. Es mit D. ernst nehmen, der Diebstahl, die Drohung, j-n verspotten, einstehen für Akk., einen Fehler begehen, gewalttätig, Angst haben vor D., klauen. 2. Die Gewohnheit, sich (D.) das Rauchen abgewöhnen, die Gefahr, schaden D., Misserfolge erleben, der Kettenraucher, harmlos. 3. Der Ratschlag, das Vertrauen, auf die Nerven gehen, drogensüchtig, schlecht drauf sein, den Boden unter den Füßen verlieren, zu Drogen greifen, Rücksicht auf Akk. nehmen. 4. Der Wert, das Verhalten gegen Akk., zu D., akzeptieren, die Gesellschaft, das Vorbild, die Wertorientierung, sich verlassen auf Akk., die Generation. 5. Die Opfergabe, die Verhaltensform, die Rücksichtslosigkeit, gewaltbereite Jugendliche, der Genuss, sich kümmern um Akk., geraten, schuld sein an D. 6. Neugierde erregen, lückenhaft, die Wasserpfeife, sich gewöhnen an Akk., gefährlich, etw. vernachlässigen, die Faszination, ernst nehmen etw. Akk., das Gift. 7. Konflikte austragen können, auf eigenen Füßen stehen, die Anspannung, auf dem Laufenden sein, die Sucht, auf sich selbst gestellt sein, viel Spaß machen, gesundheitsfördernde Sportmaßnahmen. 8. Lösen, der Ausweg, mit den Lebensschwierigkeiten fertig werden, empfehlen, greifen zu D., verbieten, gefährden, die Gründe klären, sich verändern. 9. Das Missverständnis, unter Minderwertigkeitskomplexen leiden, überholte Erziehungsprinzipien, sich einstellen auf Akk., die Nötigung, verfolgen Akk., der Verbrecher, auf die schiefe Bahn kommen. 10. Die Abhängigkeit, die Spritze, AIDS, degenerieren, eine intakte Familie, der Drogensüchtige, bewirken Akk., überfordert sein, aufhören mit D.
Übung 17. Gebrauchen Sie die angegebenen Wörter in den passenden Situationen.
1. Опасный, вредить, быть в плохой форме, совет, пренебрегать чём-л., привыкать к чему-л., зажигалка, справиться с зависимостью. 2. Совершать ошибку, безобидный, страдать от комплексов неполноценности, желающий привлечь к себе внимание, доверие, выяснять причины, быть загруженным чем-л., бросить курить. 3. Наркоман, дегенерировать, преступник, жертвоприношение, не придавать большого значения чему-л. опасность, грубость, чары / ослепление, ценностная ориентация. 4. Отношение к чему-л., кому-л., насильственный, напряжение / нагрузка, страдать от зависимости, действовать на нервы, рассчитывающий на себя, терпеть неудачи, недостаточный, точка зрения. 5. Заядлый курильщик, пачка сигарет, закуривать, привычка, образец поведения, спортивно-оздоровительные мероприятия, любопытство, прекращать/ бросать. 6. Развивать чувство значимости, принимать во внимание, рассчитывать на кого-л., принимать всерьез, воровство, нести ответственность, угроза, признавать, насмехаться над кем-л.
Übung18. Wie verstehen Sie folgende Sprichwörter? Gebrauchen Sie diese Sprichwörter in den passenden Situationen.
1. Anderer Fehler sind gute Lehrer. 2. Begangene Tat leidet keinen Rat. 3. Besser zweimal messen, als einmal vergessen. 4. Der Hehler ist so gut wie der Stehler. 5. Die Alten zum Rat, die Jungen zur Tat. 6. Ein reines Gewissen, ein gutes Ruhekissen. 7. Ende gut, alles gut. 8. Lieben und Singen lässt sich nicht zwingen. 9. Schweigen und denken kann niemand kränken. 10. Schönheit vergeht, Tugend besteht.
JUGEND UND IHRE WERTESYSTEME
Übung 1. Welche Jugendszenen sind da dargestellt? Welche Themen würden Sie als Jugendliche besonders interessieren? Bilden Sie ein Assoziogramm.

Jugendliche







Übung 2. Lesen Sie die Aussage von K. Marx über das Benehmen des Menschen. Wie finden Sie diese Ratschläge?
Achtet stets auf eure Gedanken, sie werden zu Worten.
Achtet auf eure Worte, sie werden zu Handlungen.
Achtet auf eure Handlungen, sie werden zu Gewohnheiten.
Achtet auf eure Gewohnheiten, sie werden zu Charaktereigenschaften.
Achtet auf euren Charakter, er wird euer Schicksal.
Übung 3. Lesen Sie die Aussage des großen Denkers Sokrates über die Jugend seiner Zeit. Die Jahrhunderte sind vergangen, hat sich etwas im Charakter der heutigen Jugendlichen verändert?
Unsere Jugend liebt den Luxus, hat schlechte Manieren, hat überhaupt keinen Respekt vor dem Alter. Unsere Kinder sind Tyrannen. Sie erheben sich vor den Erwachsenen, sie sind unmöglich.
Übung 4. Welche Endungen fehlen?
Ein Jugendlich..., der / die Jugendlich…, viele Jugendlich..., die Jugendlich…, zwei Jugendlich..., meine Jugendlich..., alle Jugendlich..., keine Jugendlich…, einige Jugendlich…, Jugendlich…, diese Jugendlich...; ein Erwachsen..., der / die Erwachsen..., viele Erwachsen..., die Erwachsen…, keine Erwachsen..., alle Erwachsen…, eine Erwachsen..., drei Erwachsen…, Erwachsen…, als Erwachsen…
Übung 5. Lesen Sie den Text durch. Was ist das Thema des Textes? Suchen Sie im Text die Antwort auf die Frage: Wodurch unterscheidet sich eine biologische, juristische und soziologische Betrachtung der Jugendzeit? Füllen Sie diese Tabelle aus.
Jugendzeit |
||
juristisch betrachtet
|
soziologisch betrachtet |
biologisch betrachtet |
In der Jugendphase wird der Übergang vom Kind zum Erwachsenen vollzogen. Je nach der Betrachtungsweise können der Beginn und das Ende der Jugendphase sehr unterschiedlich festgelegt werden.
Juristisch betrachtet liegen Beginn und Ende zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr. Die meisten Jugendlichen sehen die Jugendphase als Lern- oder Ausbildungszeit. Soziologisch betrachtet endet die Jugendzeit für viele mit der festen Integration in einen Beruf und oft mit der Gründung einer eigenen Familie. Nach dieser Betrachtungsweise spielt der Mensch in seinem Leben verschiedene soziale Rollen. Jugendliche sind Lernende und Auszubildende, die privat oder beruflich den Übergang in die Welt der Erwachsenen vollziehen. So gesehen kann ein Student im Alter von 29 Jahren noch als ein Jugendlicher angesehen werden. Nach einer biologischen oder entwicklungspsychologischen Betrachtungsweise ist Jugend ein Prozess körperlicher und seelischer Umwandlung. Dieser mehrjährige Prozess der Geschlechtsreife wird mit dem Begriff «Pubertät» bezeichnet. Die Pubertät kann für Mädchen im Alter von 10 Jahren beginnen und mit 16 abgeschlossen sein. Für Jungen liegt diese Zeit zwischen dem zwölften und achtzehnten Lebensjahr.
Die Jugendphase ist die Zeit der Veränderungen in der Psyche. Jugendliche lösen sich allmählich innerlich und äußerlich von der eigenen Familie los und suchen ihre eigene Identität. In dieser Zeit sind Jugendliche besonders sensibel und besonders beeinflussbar. Sie wollen mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Sie wollen von den Erwachsenen oft keine Vorschriften mehr machen lassen. Deshalb ist diese Zeit in der eigenen Familie oft mit Konflikten verbunden. Jugendliche fühlen sich leicht unverstanden, sind verletzlich und ziehen sich bei den Konflikten mit Erwachsenen oft in eine eigene Welt zurück. Sie ziehen sich anders an, haben andere Frisuren, hören laute Musik ‒ diese und andere Dinge sind typisch für die Entwicklung der Jugendlichen in der Pubertät.
Übung 6. Finden Sie die deutschen Äquivalente für folgende Begriffe:
Период молодости / юности, время обучения, взрослый (человек), считать (кем-л.), преобразование, половая зрелость, обозначать (называть), психика, отделяться от семьи, искать себя как личность, впечатлительный, подверженный влиянию, давать предписания, легко уязвимый, уединяться (удаляться), прическа.
Übung 7. Sehen Sie den Text in der Übung 5 durch und nennen Sie alle Sätze, in denen Passivformen gebraucht werden.
Übung 8. Füllen Sie die Lücken dem Inhalt des Textes entsprechend aus. Gebrauchen Sie die unten gegebenen Wörter in der richtigen Form.
1. Der Beginn und das Ende der Jugendphase … man sehr unterschiedlich ... 2. Viele Jugendliche verbinden das Ende der Jugendphase mit der festen Integration in … und oft mit der Gründung... 3. Jugend ist ein Prozess … und … Umwandlung. 4. Unter dem Begriff «Pubertät» versteht man den mehrjährigen Prozess ... 5. In … verändert auch die Psyche. 6. Es ist wichtig für jeden Jugendlichen … zu finden. 7. Die Jugendlichen sind besonders … und besonders ... 8. Wegen verschiedener Konflikte mit den Eltern … … junge Menschen oft in eine eigene Welt ... 9. Typische Merkmale … sind bunte Kleidung, ungewöhnliche Frisuren und laute Gespräche.
Die Wörter für die Auskünfte: körperlich, sensibel, festlegen, die Jugendphase, sich zurückziehen, beeinflussbar, ein Beruf, die Geschlechtsreife, eigene Identität, ein Jugendlicher, seelisch, eine eigene Familie
Übung 9. Beantworten Sie die Fragen zum Text.
1. Warum ist die Jugendphase von so großer Bedeutung im Leben jedes Menschen? 2. Welche Lebensjahre umfasst die Jugendphase aus der Sicht der Juristen? 3. Was behaupten die Soziologen in Bezug auf die Jugend? 4. Mit welchem Begriff bezeichnen die Biologen diesen mehrjährigen Prozess und was verstehen sie darunter? 5. Warum ist diese Zeit in vielen Familien oft mit Konflikten verbunden? 6. Und aus Ihrer Sicht, wie lange dauert die Jugendphase? Fühlen Sie sich noch jung?
Übung 10. Arbeiten Sie zu zweit. Versetzen Sie sich in die folgende Situation und führen Sie einen Dialog.
In ein paar Jahren werden Sie nicht nur als Lehrer, aber auch als Klassenleiter tätig sein. Stellen Sie sich eine solche Situation vor: zu Ihnen ist die Mutter Ihres 15-jährigen Schülers gekommen. Die Frau klagt darüber, dass sie keine gemeinsame Sprache mit ihrem Kind findet. Leisten Sie der Frau Hilfe. Erklären Sie, wie sich ein Jugendlicher in der Pubertätsperiode fühlt, und geben Sie praktische Ratschläge mit dem Ziel, Wechselbeziehungen in der Familie zu verbessern.
Ü bung
11. Kein
Kind mehr und noch nicht erwachsen? Willkommen in der Jugend – eine
aufregende Zeit! Das Jugendmagazin JUMA hat mit Schülern der
Waldorfschule Köln- Chorweiler darüber diskutiert. Lesen Sie das
Interview durch. Wie würden Sie die Fragen des Reporters
beantworten?
bung
11. Kein
Kind mehr und noch nicht erwachsen? Willkommen in der Jugend – eine
aufregende Zeit! Das Jugendmagazin JUMA hat mit Schülern der
Waldorfschule Köln- Chorweiler darüber diskutiert. Lesen Sie das
Interview durch. Wie würden Sie die Fragen des Reporters
beantworten?
JUMA: Was unterscheidet Jugend von Kindheit?
Wanda, 16: Man hat als Kind keine Probleme oder andere Leute lösen die Probleme für einen. Das ändert sich, wenn man Jugendlicher ist. Ich muss mich selbst um meine Probleme kümmern. So werde ich selbstständiger und unabhängiger.
Lisa, 17: Als Kind ist man einfach behüteter. Ich habe früher nicht überlegt, was für Folgen mein Handeln hatte. Als Jugendlicher muss ich lernen, Verantwortung für mich und andere zu übernehmen.
JUMA: Gab es für euch ein Erlebnis, dass euch zeigte: Jetzt seid Ihr kein Kind mehr?
Viva, 17: Als ich das erste Mal im Praktikum gesiezt wurde. Das war für mich ein total komisches Gefühl, weil ich mich noch nicht so erwachsen gefühlt habe.
Sophia. 17: Als ich das erste Mal allein verreist bin, habe ich auf einmal gemerkt: es gibt jetzt keinen, der mir sagt, was ich machen muss und was nicht.
Angela, 17: Für mich war es der Schüleraustausch. Da war ich 15. Ich bin für drei Monate nach England gegangen und habe alles hinter mir gelassen, was mir bekannt war. Ich konnte machen, was ich wollte und musste auf mich selbst aufpassen. Da habe ich ganz viele neue Erfahrungen gesammelt und bin erwachsener geworden.
Angela, 17: Man geht anders mit seinen Freunden um. Als Kind habe ich mit Jungen zusammen gespielt und mir darüber keine Gedanken gemacht. Plötzlich, so mit 12 oder 13, ändert sich Altes. Man interessiert sich für Jungs und macht sich mehr Gedanken über sein Äußeres.
Weronika, 18: Als ich das erste Mal mit meinen vier Freundinnen allein nach Holland gefahren bin. Wir haben uns das spontan überlegt und waren nicht mehr zu bremsen.
Magda, 18: Wir wollten die Reise auf alle Fälle alleine machen. Zuerst waren die Eltern dagegen. Wir mussten mit Gesprächen und Überzeugungsarbeit dafür kämpfen. Nachher war es ein sehr gutes Gefühl, das durchgesetzt zu haben.
JUMA: Das klingt nach einem Befreiungsschlag!
Weronika, 18: Ja, das haben unsere Eltern auch gesagt. Für sie war es ein Zeichen, dass wir unser Ding machen und dass wir das auch schaffen können. Dass wir jetzt selbstständiger werden und auch Verantwortung übernehmen können.
JUMA: Was waren ihre Befürchtungen?
Magda, 18: Dass wir machen, was wir wollen. Dass sie nicht die Kontrolle über uns haben und nicht eingreifen können.
JUMA: Konfirmation oder Jugendweihe sind Feste, bei denen man sich von der Kindheit verabschiedet. Welche Rolle haben solche Feste für euch?
Magda, 18: Als ich mich konfirmieren ließ, habe ich in der Zeit sehr viel über die Religion nachgedacht. Die Konfirmation war der Abschluss. Seitdem bin ich nicht mehr in die Kirche gegangen.
Angela, 17: Ich habe mich nur konfirmieren lassen, weil meine Familie in der Kirche ist. Alle sagten: Nun mach doch mal! Danach hieß es: Na, fühlst du dich jetzt reifer? Ehrlich gesagt, habe ich keinen Unterschied gespürt.
Mauritz, 18: Ich glaube, die Konfirmation ist kein Schritt zum Erwachsenwerden. Ein viel wichtigerer Schritt ist der Führerschein.
Daniel, 18: Ich habe an einer freichristlichen Jugendfeier teilgenommen. Wir haben mit anderen Jugendlichen Vertrauensübungen gemacht. Zum Abschluss gab es einen Feuerlauf. Das war ein ziemlich geiles Erlebnis. Wir haben was gemacht, was wir vorher noch nie gemacht hatten.
JUMA: Was hat sich in den letzten Jahren bei euch geändert, zum Beispiel in eurem Zimmer?
Daniel, 18: Ich habe angefangen, Zigarettenwerbung aufzuhängen. Das hat meiner Mutter nicht gefallen.
JUMA: Was wolltest du den Eltern damit zeigen?
Daniel, 18: Das weiß ich nicht. Vielleicht, dass ich schon etwas älter geworden bin und mich für solche Sachen interessiere.
JUMA: Wussten sie, dass du rauchst?
Daniel, 18: Ich glaube schon, dass sie es ahnten. Aber sie wussten es erst, als sie mich das erste Mal mit einer Zigarette gesehen haben.
J UMA:
Wie hat sich euer Musikgeschmack verändert?
UMA:
Wie hat sich euer Musikgeschmack verändert?
Angela, 17: Ich war mit 12 Fan von Britney Spears. Zusammen mit meiner besten Freundin habe ich alle Bilder von Britney ausgeschnitten, die wir gefunden haben. Unsere Zimmer haben wir mit Postern tapeziert. Wir fanden das toll. Später fanden wir es nur noch albern. Wenn ich heute Britney Spears höre, dann denke ich: ich fand sie nur toll, weil sie hübsch war. Sie war so eine Art Vorbild.
Lisa, 17: In der 4. Klasse war ich Fan von der Kelly Family. Danach kamen die Backstreet Boys. Ich habe die Musik nicht gehört, weil ich die Lieder schön fand, sondern weil es alle gehört haben.
Angela, 17: Ich hatte eine vier Jahre ältere Freundin, als ich 10 war. Ich habe ihren Musikgeschmack übernommen, obwohl sie noch nicht einmal meine beste Freundin war.
JUMA: Wie war es mit der Mode?
Angela, 17: Bei uns waren früher Schlaghosen. Ich musste auch welche haben. Ich habe mich an den anderen orientiert.
Sophia, 17: Bei mir fing es mit 13 an. Man war nicht irgendjemand, sondern man musste zur Gruppe gehören. Alle aus der Gruppe mussten Eastpaks und Schlaghosen haben. Später wurden wir individueller. Man guckte, dass nicht jeder das gleiche trug.
Angela, 17: Ab einem gewissen Alter wird das eher belächelt, wenn man Leute in ihrer Kleidung nachahmt. Vorher war das vielleicht cool, so rumzulaufen wie alle anderen. Ab einem gewissen Alter aber heißt es dann: Die hat ja überhaupt keinen eigenen Stil.
JUMA: Gab es mit euren Eltern Diskussionen über euren Modegeschmack?
Angela, 17: Bei mir war die Mode nie so ein Thema. Bis auf die Sachen, die gesundheitsschädlich sind. Meine Mutter regt sich immer auf, wenn ich zu kurze Tops trage. Sie sagt, das schadet den Nieren.
Katharina, 16: Bei mir war Mode nie ein Problem. Ich bezahle meine Sachen von meinem eigenen Taschengeld.
Angela, 17: Meine Mutter hatte nie einen Grund, sich aufzuregen. Ich hab' mich nie so extrem angezogen.
JUMA: Wie kommt Ihr mit den Lehrern klar?
Sophia, 17: In der 7. Klasse fanden wir alle Lehrer doof. Wir haben alles in Frage gestellt: Warum lerne ich das überhaupt? Das ist doch total unsinnig, das brauche ich später nie. Eigentlich interessiert es mich auch überhaupt nicht.
Angela, 17: Ab der 8. Klasse haben wir versucht, ernsthaft Kritik zu üben.
JUMA: Warum ist es wichtig, zu rebellieren?
Angela, 17: Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht, um sich bemerkbar zu machen, um zu zeigen: ich sitze hier nicht nur und lerne, sondern ich bin auch als Mensch wichtig.
JUMA: Welche Vor-und Nachteile haben Kindheit und Jugend?
Lea, 16: Als Kind weiß man, es wird für einen gesorgt, es wird deine Wäsche gewaschen, es wird für dich gekocht. Du kannst frei den Tag hineinleben.
Katharina, 16: Als Kind haben die Eltern auf mich aufgepasst, dass mir nichts Schlimmes passiert. Wenn heute alles schief geht, möchte ich manchmal sagen: Mama, mach mal!
Angela, 17: Ich gehe sehr viel babysitten. Wenn ich die Kinder beobachte, denke ich, dass sie ein sorgloses Leben haben. Ich spiele mit ihnen, dann mache ich ihnen etwas zu essen. Wenn ihnen das nicht gefällt, fangen sie an zu weinen. Irgendwann ist alles wieder geklärt.
JUMA: Wie sieht es mit Regeln bei euch zu Hause aus?
Wanda, 16: Ich darf nicht allein zu Hause schlafen. Wenn meine Eltern verreist sind, muss ich bei einer Freundin übernachten.
Viva, 17: Ich durfte am Anfang nur bis 10 Uhr abends raus. Das hat sich in den letzten zwei Jahren geändert. Meine Eltern haben viel mehr Vertrauen zu mir und merken auch, dass ich jetzt vernünftiger geworden bin.
Lea, 17: Bei mir hat sich ziemlich viel geändert, als ich meinen ersten Freund hatte. Als der 18 war, habe ich gesagt: «Wenn ich mit ihm weggehe, ist eine Aufsichtsperson dabei. Dann darf ich länger raus». Da wussten meine Eltern nicht mehr, was sie dagegen sagen sollten.
JUMA: Sie hatten nichts gegen deinen Freund?
Lea, 17: Nein.
JUMA: Wir haben über Schule, Musik und Mode geredet. Wie sieht es beim Essen aus?
Lisa, 17: Ich konnte früher alles essen, was ich wollte und wann ich wollte. Es gab Schokolade und massenweise Chips, wenn wir einen Videoabend gemacht haben. Ich bin nicht dicker geworden. Heute verkneife ich es mir manchmal, runter zum Kühlschrank zu gehen.
Angela, 17: In der 8. Klasse meinten die ersten: «Ach, ich bin so dick». Ich dachte: «Wie könnt ihr bloß so etwas sagen? Ihr seid so dünn». Irgendwann habe ich bemerkt, dass ich selbst zunehme. Wir haben mit einer Diät angefangen und haben es manchmal ganz schön übertrieben. Heute merke ich, es ist unnötig: ich habe einen Freund, der mich liebt, wie ich bin.
Katharina, 16: Ich mache viel Sport. Anstatt Schokolade esse ich Müsli, anstatt Chips Äpfel. Und ich gucke, welche Vitamine oder Zusatzstoffe ich brauche.
JUMA: Seid Ihr jetzt schon erwachsen oder immer noch Kind?
Viva, 17: So richtig erwachsen fühle ich mich nicht, jugendlich passt besser.
Lea, 17: Wenn ich babysitte und mit dem Kind auf dem Spielplatz bin, denken viele, ich wäre die Mutter. Das erschreckt mich schon. Weil ich mich noch nicht so fühle, als könnte ich Mutter sein. Ich weiß, dann wird es ernst. Ich will lieber noch Spaß haben.
Sophia, 17: Ich würde mich nicht als erwachsen bezeichnen. Aber ich merke, dass ich erwachsener geworden bin. Auch, weil es Sachen gibt, die keiner mehr für mich macht.
Lisa, 17: Ich fühle mich oft noch jugendlich und mache das, wozu ich gerade Lust habe. Andererseits fühle ich mich schon erwachsen, weil ich für meine jüngeren Geschwister Verantwortung übernehmen muss. Es gibt aber auch Situationen, wo ich noch Kind bin. Absichtlich. Ich lese dann Kinderbücher von Astrid Lindgren. Dabei kann ich mich gut entspannen. Man darf es nicht übertreiben, aber ein bisschen Kindsein finde ich immer noch wichtig [11].
Übung 12. Lesen Sie die Aussagen der Jugendlichen über die Jugend. Mit wem von den Jugendlichen sind Sie derselben Meinung? Mit wem sind Sie nicht einverstanden? Warum?
Ich möchte nicht erwachsen sein. Mein Alter ist das beste Alter. Ich kann machen, was ich will. Für mich sind Freunde wichtig, ich mag Partys feiern. All das kann man als Jugendlicher genießen. Man hat mehr Zeit als Erwachsene. (Julia, 17 Jahre)
Jugendliche machen alles, was verboten ist. Sie machen verrückte Sachen. Mädchen lachen und schreien laut. Oder sie hängen einen ganzen Tag irgendwo herum und machen gar nichts. Das ist das Beste am Jungsein. (Laura, 13 Jahre)
Als Jugendlicher hat man nicht so viele Sorgen wie die Erwachsenen. Und das Leben der Jugendlichen ist nicht so langweilig wie das von den Erwachsenen. (Christian, 14 Jahre)
Jugendliche sind tolerant. Je älter man wird, desto intoleranter wird man. Die Erwachsenen sprechen mehr von Moral, Ehre und Ehrlichkeit. Das ist für Jugendliche nicht wichtig. Jugendliche sind noch frei und tolerant. Das Beste finde ich an der Jugend, dass die Mädchen so schön sind. (Simon, 17 Jahre)
Mich stört, dass man als Jugendlicher nie seine Meinung sagen darf. In meiner Familie ist es so. Nicht alles, was Erwachsene sagen, ist immer richtig. Vielleicht haben Jugendliche bessere Ideen. Die Erwachsenen sollten mehr auf uns hören. (Ruth, 15 Jahre) [11]
Übung 13. Setzen Sie die passenden Modalverben ein.
1. Viele Jugendliche … nicht erwachsen sein, weil sie in der Jugendphase es machen …, was sie …. 2. Junge Menschen … Partys, weil sie Tanzen toll finden. 3. Jugendliche machen oft verrückte Sachen, die man manchmal auch gesetzlich nicht machen … 4. Jugendliche …, dass die Erwachsenen mehr auf sie hören. 5. Einige Eltern sind so streng in den Erziehungsfragen ihrer Kinder, dass die Jugendlichen eigene Meinung überhaupt nicht sagen …6. In der Jugend … sich die meisten über ihre Zukunft keine Gedanken machen. 7. Jüngere und ältere Generationen … gemeinsame Sprache finden, weil es leichter ist, zusammen verschiedene Lebensschwierigkeiten zu überwinden.
Übung 14. Welche sind die Schlüsselwörter in den Aussagen von den deutschen Jugendlichen? Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Entscheidung.
|
|
|
|
|
|
|
|
Übung 15. Ergänzen Sie die Sätze, indem Sie Ihre eigene Meinung äußern.
1. Das Beste an der Jugend ist... 2. Das Leben der Jugendlichen ist... 3. Man kann als Jugendlicher... genießen. 4. Jugendliche machen alles, was... 5. Je älter man ist, desto... 6. Vielleicht haben Jugendliche...
Übung 16. Lesen Sie den Text und bemerken Sie, wodurch sich einige junge Menschen von den anderen unterscheiden?
JUGEND VON HEUTE
Es ist nicht leicht, die Jugend zu charakterisieren. Junge Leute sind unterschiedlich. Es gibt faule, gleichgültige Jugendliche, die an nichts interessiert sind. Es gibt aber auch aktive, begabte junge Leute, die ihr Leben noch besser, noch interessanter machen möchten.
E s
ist schade, wenn Jugendliche die Zeit ziellos verschwenden. Besonders
gefährlich ist es, wenn sie keine Bestrebungen, keine Interessen
haben. Eine andere Gefahr ist die Jugendjahre als endloses Fest zu
betrachten. Einige junge Leute denken nur an Vergnügungen, Discos,
lustige Gesellschaft, schöne Musik und viel Unterhaltung. Dabei
vergessen viele, dass
man sich Mühe geben muss, um ihre Hoffnungen und Träume in
Erfüllung zu bringen. Nicht alle akzeptieren das, und als Folge
werden sie auch später unzufrieden. Manche können sogar
alkoholsüchtig werden und haben keinen Willen, um etwas zu
verändern. Immer öfter hören wir von Drogensüchtigen, die kein
Ziel im Leben gefunden haben.
s
ist schade, wenn Jugendliche die Zeit ziellos verschwenden. Besonders
gefährlich ist es, wenn sie keine Bestrebungen, keine Interessen
haben. Eine andere Gefahr ist die Jugendjahre als endloses Fest zu
betrachten. Einige junge Leute denken nur an Vergnügungen, Discos,
lustige Gesellschaft, schöne Musik und viel Unterhaltung. Dabei
vergessen viele, dass
man sich Mühe geben muss, um ihre Hoffnungen und Träume in
Erfüllung zu bringen. Nicht alle akzeptieren das, und als Folge
werden sie auch später unzufrieden. Manche können sogar
alkoholsüchtig werden und haben keinen Willen, um etwas zu
verändern. Immer öfter hören wir von Drogensüchtigen, die kein
Ziel im Leben gefunden haben.
Die meisten Jugendlichen sind aber anders: strebsam, aktiv, kreativ, lebensfroh. Sie lernen fleißig und wollen nach der Schulabsolvierung weiter studieren. Viele streben nach einem guten Beruf und verstehen, dass sie sich Mühe geben müssen, um ihr Lebensziel zu erreichen. Solche Jugendlichen haben vielseitige Interessen. Einige interessieren sich für Fremdsprachen, andere für Kunst, Geschichte, Literatur, Theater, viele besuchen noch in ihrer Schulzeit die Musik-, Kunst- oder Tanzschule. Manche treiben Sport in ihrer Freizeit. Andere wandern, machen interessante Ausflüge. Hobbys der Jugendlichen sind unterschiedlich und sie hängen von ihren Interessen und Neigungen ab.
In der Jugendzeit gibt es natürlich viele Probleme. Die meisten Probleme betreffen die Mode, die Familienverhältnisse, die Freundschaften. Sie können als Altersprobleme bezeichnet werden, denn in der Jugend entwickelt sich der Mensch sehr rasch und sucht nach seinen Idealen, neuem Denken, nach seiner Lebensweise. Solche Jugendlichen sind kreativ und erfinderisch, aktiv und optimistisch. Jede junge Generation ist fortschrittlicher als die ältere, und alle Hoffnungen sind in der Gesellschaft immer auf die Jugend gerichtet [5].
Übung 17. Versuchen Sie die folgenden Ausdrücke aus dem Text auf Deutsch zu erklären. Benutzen Sie bei ggf. Langenscheidts Großwörterbuch.
Die Jugend, die Freundschaft, das Lebensziel, die Freizeit, die Lebensweise, die Mode, das Hobby, die Altersprobleme, die Neigung.
Übung 18. Bestimmen Sie das Thema und die Hauptidee des Textes, indem Sie die oben genannten Schlüsselwörter gebrauchen.
Übung 19. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Text.
1. Warum ist es so schwer, die heutige Jugend zu charakterisieren? 2. Was ist in der Jugendphase besonders gefährlich? 3. Muss man sich Mühe geben, um eigene Hoffnungen und Träume in Erfüllung zu bringen? 4. Welche Gefahren entstehen für die jungen Menschen, die kein Ziel im Leben gefunden haben? 5. Sind im Text irgendwelche Hobbys oder Interessen genannt, mit denen sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit beschäftigen? 6. Gibt es in der Jugendphase Altersprobleme? 7. Können Sie eindeutig behaupten, dass jede junge Generation fortschrittlicher als die ältere ist?
Übung 20. Nennen Sie alle Satzgefüge im Text und bestimmen Sie die Art der Nebensätze.
Übung 21. Setzen Sie nötige Endungen ein. Begründen Sie Ihre Entscheidung.
1. Viele aktiv_, begabt_ jung_ Leute möchten ihr Leben noch besser_, noch interessanter_ machen. 2. Eine groß_ Gefahr besteht darin, dass einige jung_ Leute die Jugendjahre als endlos_ Fest betrachten. 3. Jugendlich_ haben gern laut_ Discos, lustig_ Gesellschaft, schön_ Musik und viel_ Unterhaltung. 4. Leider werden manche jung_ Leute wegen vieler schwer_ Konflikte in ihrem Leben alkoholsüchtig_. 5. Immer öfter spricht man von Drogensüchtig_ 6. Man muss aber immer strebsam_, aktiv_, kreativ_ und lebensfroh_ sein. 7. Die Jugend strebt nach einem gut_ Beruf, um später einen gut_ hochbezahlt_ Arbeitsplatz zu finden.
Übung 22. In einer Umfrage wurden deutsche Jugendliche befragt, welche der folgenden Eigenschaften und Verhaltensweisen sie für besonders wichtig halten. Verstehen Sie die Bedeutung dieser Wörter? Sprechen Sie über diese Eigenschaften. Benutzen Sie bei ggf. Langenscheidts Großwörterbuch.
Pflichtbewusst sein; unabhängig sein; Verantwortung für andere übernehmen; ehrgeizig sein; das Leben genießen; kritisch sein; auf Sicherheit bedacht sein; sich selbst verwirklichen; sich anpassen; anderen Menschen helfen; etwas leisten; tun und lassen, was man will; durchsetzungsfähig sein; eigene Fähigkeiten entfalten; Rücksicht auf andere nehmen; ein aufregendes, spannendes Leben führen; sich gegen Bevormundung wehren; ein hohes Einkommen anstreben.
Übung 23. Sehen Sie die genauen Daten durch und informieren Sie sich über die Ergebnisse der Befragung deutscher Jugendlicher. Analysieren Sie die Liste. Wovon zeugen solche Resultate?
Eigenschaft / Verhaltensweise |
|
Eigenschaft / Verhaltensweise |
|
eigene Fähigkeiten entfalten |
68,8% |
ein hohes Einkommen anstreben |
52,1% |
das Leben genießen |
65,4% |
Rücksicht auf andere nehmen |
51,7% |
unabhängig sein |
62% |
auf Sicherheit bedacht sein |
46,7% |
durchsetzungsfähig sein |
61,9% |
kritisch sein |
45,3% |
sich selbst verwirklichen |
60,9% |
ein aufregendes, spannendes Leben führen |
43,8% |
etwas leisten |
56,3% |
ehrgeizig sein |
41,2% |
pflichtbewusst sein |
55,6% |
Verantwortung für andere übernehmen |
36,1% |
sich gegen Bevormundung wehren |
54,5 % |
tun und lassen, was man will |
35% |
anderen Menschen helfen |
54,2 % |
sich anpassen |
22,8% |
Übung 24. Lesen Sie eine andere Umfrage durch. Auf welche Weise können Sie diese jungen Leute charakterisieren? Beachten Sie folgende Vokabeln:
Der Bund: die Bundeswehr, die deutsche Armee; unter Stress stehen: viel Stress haben, einer Belastung ausgesetzt sein, überlastet sein; ein gesunder Druck: Stress, der bewirkt, dass man fleißig ist oder sich anstrengt; die Stelle (hier): die Arbeitsstelle, der Job; die Erwartungen hoch schrauben: sehr hohe Erwartungen / Ansprüche haben.
UMFRAGE: WAS IST JUGENDLICHEN IN IHREM LEBEN WICHTIG?
Erst einmal Abi und dann zwei Jahre Bund. Anschließend will ich Wirtschaftswissenschaften in Österreich studieren. Unter Schulstress stehe ich eigentlich nicht. Ein gesunder Druck ist absolut okay. Der absolute Schwachpunkt in unserer Generation liegt wohl im emotionalen Bereich. Liebeskummer ist zehn Mal schlimmer, als Probleme mit Eltern oder Schule. (Marc-Uwe, 19 Jahre)
In der Schule werden deine wirklichen Stärken nicht gefördert. Das, was wir lernen, ist zwar von Nutzen, aber gezielt vorbereitet werden wir nicht. Trotzdem bin ich optimistisch. Ich denke, dass ich erreiche, was ich will. (Martin, 19 Jahre)
Ich bin eher dieser Typ Familienmensch. Mit meinen vier Geschwistern verstehe ich mich super, natürlich auch mit meinen Eltern. Die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich mit meinen Geschwistern, wir unternehmen viel am Wochenende und haben zum größten Teil auch denselben Freundeskreis. Dennoch möchte ich bald ausziehen, um unabhängiger zu werden und mein Leben selber in die Hand zu nehmen. (Inga, 18 Jahre)
Zu allererst will ich meine Ausbildung zur Optikerin beenden. Danach ein Studium in Design, das werde ich auch schaffen. Für mich kommt eine eigene Familie nicht in Frage, meine Karriere hat die höchste Priorität. Aber natürlich besteht das Risiko, dass ich in der Designbranche keine Stelle finde. Dann kann ich als Optikerin weiter arbeiten. Alles in allem bin ich recht optimistisch. Obwohl die Erwartungen von der Gesellschaft zu hoch geschraubt werden. Meiner Meinung nach werden die «kreativen Köpfe» zu wenig gefördert und bleiben gegenüber den «intelligenten» auf der Strecke. (Judith, 20 Jahre)
Wichtig ist mir meine Rente! Ich möchte Karriere machen und viel verdienen. Am liebsten würde ich noch heute von zu Hause ausziehen. Eine Frau will ich später auch haben, und mindestens drei Kinder. Politik finde ich nicht so interessant. Das ist im Unterricht so langweilig. (Mario, 19 Jahre)
Ich will unbedingt eine Familie gründen, weil ich selbst nie eine hatte. Heiraten muss ich meine Freundin, nicht Erfolg im Beruf. Mein Traum ist es, die ganze Welt zu sehen. Politik interessiert mich – das hat doch was mit meiner Zukunft zu tun. (Philipp, 16 Jahre)
Am wichtigsten in meinem Leben sind meine Freunde. Ohne sie wäre ich einsam. Zu meinen Eltern habe ich einen guten Kontakt. Ich will später eine eigene Familie haben. Natürlich auch Kinder, aber höchstens zwei. Mein Mann sollte mir im Haushalt helfen, denn ich möchte berufstätig sein. Am liebsten als Polizistin. (Svenja, 13 Jahre)
Karriere will ich nicht machen, aber schon einen guten Beruf haben. Etwas mit Computern finde ich gut. Wichtig ist mir die Freundschaft mit meiner Familie. Heiraten möchte ich später auch. Jetzt will ich Spaß haben. (Ester, 12 Jahre)
Ehrgeiz ist wichtig im Leben, aber eine Karriere muss ich später nicht machen. Ich will Zeit für Familie und Freunde haben. Und für mich selbst. Mich interessieren die Menschenrechte und alles, was mit Kindern und Afrika zu tun hat. Außerdem bin ich gegen die Atomkraft. (Simona, 14 Jahre)
Zwei Kinder will ich später haben: einen Jungen und ein Mädchen. Meine Freunde und meine Familie sind mir wichtiger als mein zukünftiger Beruf. Meine Mutter ist wie meine Freundin, ich mag sie mehr als meinen Vater. Aber ein bisschen Karriere will ich schon machen. Tierärztin ist mein Traumberuf. (Bahar, 13 Jahre)
Die Frau seines Lebens sollte man heiraten, nicht nur einfach so mit ihr zusammenleben. Karriere will ich auch machen, weil es mir und meiner Familie gut gehen soll. Was politisch in Deutschland passiert, interessiert mich nicht. (Julian, 15, Jahre)
Geld ist mir am wichtigsten im Leben, meine Freunde aber auch. Im Beruf will ich später gut sein. Ich möchte nämlich nicht als Hausfrau ohne eigenes Geld enden. Kinder will ich auch haben. Aber es ist wichtig, an sich selbst zu denken. Politik? Die interessiert mich nicht ‒ ich muss ja noch nicht wählen. (Sarah, 17 Jahre) [11].
Übung 25. Schreiben Sie aus der Übung 24 alle Adjektive, die Steigerungsstufen bilden können, in die folgende Tabelle heraus. Füllen Sie alle Spalten der Tabelle aus.
-
Positiv
Komparativ
Superlativ
gesund
…
…
…
schlimmer
…
…
…
am größten
…
…
…
Übung 26. Setzen Sie eine der Infinitivgruppen ein.
1. Marc-Uwe will nach Österreich fahren, … dort Wirtschaftswissenschaften … studieren. 2. Martin wird alles tun, … das … erreichen, was er will. 3. … mit ihren Eltern zusammen … wohnen, möchte Inga bald ausziehen. 4. Judith will ihre Karriere in erster Linie bauen, … an die eigene Familie … denken. 5. Philipp möchte viel reisen, … die ganze Welt … sehen. 6. Simona ist bereit, auf ihre Karriere zu verzichten, … Zeit für Familie und Freunde … haben. 7. … Hausfrau … sein, möchte Sarah eine gute Arbeitsstelle bekommen.
Übung 27. Stellen Sie sich die Situation vor: Ihr Freund hat einige Doppelstunden in Deutsch versäumt. Aber er will gern erfahren, was den deutschen Jugendlichen in ihrem Leben wichtig ist. Berichten Sie bitte ihm darüber, indem Sie indirekte Rede (Konjunktiv I) gebrauchen.
Übung 28. Die einzelnen Interviews zeigen unterschiedliche Meinungen der Jugendlichen. Mit welcher Aussage stimmen Ihre persönlichen Ansichten im Hinblick auf den Lebensstil / den Karrierewunsch / optimistische oder pessimistische Ansichten am meisten überein, mit welcher am wenigsten?
Übung 29. Suchen Sie in Ihrem Kurs nach einem Partner, der in möglichst vielen Punkten andere Ansichten hat als Sie selbst. Führen Sie mit ihm einen Dialog und versuchen Sie Ihren Partner von Ihrem Standpunkt zu überzeugen.
Übung 30. Machen Sie selbst eine Umfrage zum Thema: Was ist Ihnen in Ihrem Leben wichtig? Stellen Sie diese Frage a) an den Studenten des ersten Studienjahres, b) an Ihre Mitstudenten, c) an Ihre Freunde, die schon arbeitstätig sind. Arbeiten Sie in Kleingruppen. Sammeln Sie Stichpunkte und präsentieren Sie die Information in Ihrer Untergruppe.
Übung 31. Wenn wir über Lebensziele sprechen, dann gibt es viel zum Nachdenken. Lesen Sie die Meinungen von einigen deutschen Jugendlichen und bemühen Sie sich die Fragen zum Text zu beatworten.
Debora: Ich denke oft an meine Zukunft, ich habe viele Träume und ich möchte sie verwirklichen, aber ich weiß, dass das Leben sehr schwer ist: man braucht Mut, Entschlossenheit und Demut. Manchmal habe ich Angst, denn die Welt ist voll von Gefahren und die Jugendlichen sind hilflos und naiv. Aber ich glaube, dass ich alle Hindernisse mit der Hilfe meiner Eltern überwinden kann.
I ch
möchte mein Studium mit Auszeichnung abschließen, dann möchte ich
eine gute Arbeit finden, mit der ich viel Geld verdienen kann. Ich
will mich mit einem wunderbaren Mann verheiraten und zwei oder drei
Kinder bekommen. Ich meine, dass die Mutterschaft eine riesige Freude
ist. Es gibt nichts Schöneres: ein Kind ist das schönste Geschenk
für eine Frau.
ch
möchte mein Studium mit Auszeichnung abschließen, dann möchte ich
eine gute Arbeit finden, mit der ich viel Geld verdienen kann. Ich
will mich mit einem wunderbaren Mann verheiraten und zwei oder drei
Kinder bekommen. Ich meine, dass die Mutterschaft eine riesige Freude
ist. Es gibt nichts Schöneres: ein Kind ist das schönste Geschenk
für eine Frau.
Es ist klar, dass ich ein ehrgeiziges Mädchen bin und niemand kann meine Pläne ändern. Ich träume davon, reich und beneidet zu werden. Meiner Meinung nach ist Geld sehr wichtig und ich kann nicht ertragen, wer es zum Fenster hinauswirft. Ich bin sehr sparsam, ich denke an meine Zukunft und will meine Ersparnisse zinsbringend anlegen. Ich will eine glänzende Laufbahn einschlagen.
Aber vor allem hoffe ich darauf, immer gesund zu sein, denn die Gesundheit ist der wichtige Wert und man muss sie respektieren, weil unsere Pläne sich ohne sie in Rauch auflösen. Ich weiß nicht, was mir das Schicksal beschert, aber mein Lebensmotto ist: «Der Mensch hofft, solange er lebt!» Warum sollten wir auf unsere Träume verzichten? Niemand kann uns dazu verpflichten.
Peter: In diesem Alter hat man noch keine reifen Ideen über die eigenen Zukunftsperspektiven. Nur wenigen Personen ist schon klar, was sie werden wollen. Die Wahl ist schwierig, weil das Leben von dieser Entscheidung abhängt. Unsere Lebenspläne und Berufswünsche ändern sich, weil wir immer etwas Neues erleben. Die Schule bereitet die Schüler wenig auf das Leben und auf die Arbeitswelt vor. Die Suche ist persönlich, so halte ich die Schule für nicht schuldig. Wir müssen unseren eigenen Weg zur Zukunft mit Selbstbewusstsein wählen. Die Schule kann nur unsere Meinung bilden, damit wir der Welt entgegen treten. Unsere Erlebnisse sind die einzigen, die uns helfen können. In dieser wichtigen Phase kann das Elternhaus eine große Stütze sein, aber nicht immer klappt es gut. Das Alter trennt Eltern und Kinder, die verschiedene Ansichten haben. In dieser Situation wird der Gedankenaustausch mit Freunden das wichtigste Gespräch .
Übung 32. Beantworten Sie die Fragen zum Text.
1. Warum ist es nicht so leicht eigene Träume zu verwirklichen? 2. Wer kann bei den Schwierigkeiten Jugendlichen Hilfe leisten? 3. Ist es sehr wichtig, gute Leistungen in der Schule zu haben? Warum? 4. Werfen Sie manchmal Geld zum Fenster hinaus? 5. Was ist der wichtigste Wert für Sie? 6. Verlassen Sie sich oft auf Ihr Schicksal? 7. Haben Sie ein eigenes Lebensmotto? 8. Warum ist die Wahl der Lebensziele so schwierig? 9. Wählen Sie selbst Ihren eigenen Weg zur Zukunft oder hilft Ihnen jemand? 10. Ist es nötig, die Meinung der Freunde bei der Zielsetzung zu beachten?
Übung 33. Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema «Was will ich in meinem Leben erreichen?». Beachten Sie die Gliederung:
1. Wie schätzen Sie sich selbst ein? Welche Eigenschaften Ihrer Person sind stark und welche schwach? 2. Was ist für Sie im Leben wichtig? 3. Familie / Freunde / Ehe / Kinder / soziale Kontakte. 4. Schule / Ausbildung / Beruf / Karriere. 5. Landesspezifische Themen. 6. Globale Themen (z. B. Weltfrieden etc.). 7. Anderes.
Übung 34. Was denken die Erwachsenen über die heutige Jugend? Lesen Sie und informieren Sie sich. Womit sind Sie einverstanden, womit nicht? Was sind Ihrer Meinung nach die besonderen Eigenschaften der heutigen Jugend?
1. Die Jugendlichen sind undankbar. 2. Viele Jugendliche drücken sich von schweren Aufgaben. 3. Viele Jugendliche sind verantwortungslos. 4. Die heutige Jugend ist tolerant und hilfsbereit. 5. Die Jugendlichen werden heutzutage verwöhnt. 6. Die Jugendlichen genießen zu viel Zeit. 7. Die Jugendlichen haben keinen Respekt vor Erwachsenen. 8. In der Jugend weiß man nicht, was man will. 9. Die Jugend ist neugierig. Sie will alles probieren und alles wissen.
Übung 35. Der Volksmund hat immer Recht, denn die Sprichwörter werden im Laufe von vielen Jahrhunderten geprüft. Welche Sprichwörter sind in der folgenden Tabelle versteckt? Wie verstehen Sie den Sinn dieser Sprichwörter?
Jugend weiß |
als Gold. |
Wie die Eltern, |
vom Himmel gefallen. |
Ein guter Name ist besser |
wird man klug. |
Das Ei will klüger sein |
so die Kinder. |
Es ist noch kein Meister |
alt getan. |
Durch den Schaden |
das verschiebe nicht auf morgen. |
Jung gelernt, |
keine Tugend. |
Was du heute kannst besorgen, |
als die Henne. |
Übung 36. Sie sind etwa 20 - 21 Jahre alt und haben bestimmt einige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Lebens gesammelt. Führen Sie irgendwelche Beispiele aus Ihrem persönlichen Leben an, zu denen eines der obengenannten Sprichwörter genau passt.
Übung 37. Was fällt Ihnen zum Thema «Jugend auf dem Lande» ein? Notieren Sie Ihre Ideen und besprechen Sie sie dann mit den anderen in der Gruppe.



Jugend
auf dem Lande

Übung 38. Informieren Sie sich aus dem folgenden Text und beantworten Sie die Frage: Welche Probleme hat die Jugend auf dem Lande?
KEINE LANGEWEILE: JUGEND AUF DEM LANDE
Eine tausendjährige Eiche, die Schützengilde und die Feuerwehr sind die Highlights von Gnewitz. 230 Einwohner hat das Örtchen, darunter 16 Jugendliche. Ihnen fällt nach der Schule häufig die Decke auf den Kopf, denn der einzige örtliche Clubraum ist für die Kids nur im Winter geöffnet.
Gnewitz ist kein Einzelfall. In vielen ostdeutschen Landstrichen ist abends tote Hose. Eineinhalb Millionen Menschen haben nach dem Mauerfall 1989 den Osten verlassen. Viele Kneipen, Kinos und Jugendclubs gingen nach und nach zugrunde. Zudem fehlt vielen Gemeinden das Geld, um ihren Jugendlichen Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Folge ist, dass sich die Jugendlichen notgedrungen an der Tankstelle oder an der überdachten Bushaltestelle treffen. Dort herrscht zumeist Langeweile. Die Bierflasche macht die Runde und der Zigarettenkonsum steigt.
Doch die Langeweile ist nicht das einzige Problem. Auch die beruflichen Perspektiven fehlen. Obwohl die Arbeitslosigkeit dank des wirtschaftlichen Aufschwungs seit einem Jahr kontinuierlich abnimmt, waren im Sommer in Ostdeutschland immer noch fast 130000 Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos, bei den unter 20-Jährigen sind es 20000. Vor allem gut ausgebildete Frauen verlassen ihre ostdeutsche Heimat und suchen ihr Glück im Westen. Das ergab jüngst eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Zurück bleiben junge Männer zwischen 18 und 29 Jahren – häufig schlecht ausgebildet und ohne Job.
Die Jugendsozialarbeiterin Ute Hasselberg sagt aber: «Die Jugendlichen wissen nun, dass sie etwas erreichen können, wenn sie sich engagieren». Zudem taten sie auch etwas Gutes für das Dorfleben. Der Bürgermeister jedenfalls zeigte sich sichtlich stolz: «Sie haben es geschafft, durch den neuen Treffpunkt am Dorfplatz alle Generationen in Gnewitz zusammenzubringen» [7].
Übung 39. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?
1. In vielen ostdeutschen Dörfern ist abends viel los. 2. Jugendliche verbringen ihre Freizeit in Jugendclubs und Kinos. 3. Wegen herrschender Langeweile trinkt man Bier und raucht. 4. Die Arbeitslosigkeit nimmt ständig ab. 5. Männer unter 29 Jahren gehen in den Westen um ihr Glück zu suchen. 6. Politiker initiierten ein Projekt, um die Situation auf dem Lande zu ändern. 7. Der Dorfplatz ist nun ein kultureller Veranstaltungsort. 8. Der Bürgermeister ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Übung 40. Vervollständigen Sie die Fragmente mit den angegebenen Verben. Vergleichen Sie sie dann mit dem Text.
Zur Verfügung …, die Arbeitslosigkeit …, die Heimat …, die Kneipen, Kinos und Jugendclubs …, der Zigarettenkonsum …, die Perspektiven …, Männer zwischen 18 und 29 Jahren …, das Staatliche Bundesamt …, sich mehr …, eine Studie …
_____________________________________________________
Ergeben, fehlen, zugrunde gehen, stellen, zurückbleiben, abnehmen, warnen, zusammenbringen, verlassen, engagieren, steigen
Übung 41. Welche Wörter im Text haben dieselbe Bedeutung?
ununterbrochen – …, gezwungen – …, keine Zukunft haben, hier: schließen – …, rasche positive Entwicklung – …, hier: verbessern, ändern – …, einige, manche – …, aktiv teilnehmen – …, die Tendenz – …, aus Langeweile schlechte Laune bekommen – …
Übung 42. Wie sieht es in Belarus aus? Formulieren Sie Ihre Erfahrungen in einigen Sätzen schriftlich, indem Sie die unten gegebenen Ausdrücke gebrauchen. Vergleichen Sie schließlich Ihre Beobachtungen in der Gruppe.
im Gegensatz zu / im Vergleich zu / anders als / ebenso wie...sind / sind unglaublich verschieden / eigentlich gleich / weniger als / nicht halb so...wie / tausendmal so...wie / genauso … wie / kann man (nicht) vergleichen mit... / gleicht/ ähnelt + D.
Übung 43. Lesen Sie die Aussagen. Notieren Sie Ihre Meinung in ein bis zwei Sätzen. Diskutieren Sie Ihre Ansichten zu zweit oder in der Gruppe. Verwenden Sie dabei die angegebenen Redemittel:
Ich bin der Meinung, dass ... / Ich bin (nicht) der Auffassung, dass …/ Das sehe ich ganz anders. / Das halte ich für falsch. / Ich stimme da (nicht) zu. / Ich stimme dem nur teilweise zu. / Das überzeugt mich nicht (ganz). / Es kommt darauf an, wer.../ ob... / Das lehne ich ab.
1. «Auf dem Land ist nichts los!» 2. «In der Stadt ist's auch nur dann interessant, wenn du genug Geld hast!» 3. «Es ist wahnsinnig schwer neue Leute kennen zu lernen, wenn du irgendwo im Dorf wohnst!» 4. «Das Stadtleben macht die Leute nervös!» 5. «Wenn du auf dem Lande wohnst und keinen Arbeitsplatz hast, dann nutzt dir die ganze herrliche Natur auch nichts!» 6. «Auf dem Lande fehlen sowieso die beruflichen Perspektiven!» 7. «Wer eine gute Ausbildung hat, bleibt nie in der Provinz!»
Übung 44. Das ist ein Steckbrief von Antje. Lesen Sie ihn und erzählen Sie über Antje.
Name: Antje Krusel
Alter: 16 Jahre
Sternzeichen: Schütze
Lieblingsblumen: rote Rosen, wunderschöne gelbe Sonnenblumen
Lieblingsessen: Nudeln mit Tomatensoße und Fleisch
Was ich nicht mag: Eier, Tomaten
Musik: morgens etwas Schnelleres, um wach zu werden und abends etwas Entspannendes zum Einschlafen. Zwischendurch mal so und mal so.
Reisen (Wozu?): viel reisen, um die Welt zu sehen; andere Kulturen, andere Menschen kennen zu lernen; fremde Sprachen zu lernen; Freunde zu finden; mich selbst zu entwickeln
Lieblingsbeschäftigung: Fotografie (Ich bekomme irgendwann die Chance, das zu lernen, was ich möchte.)
Schönstes Erlebnis: mein letzter Geburtstag
Unterrichtsbeginn: 7.45 Uhr
Unterrichtsschluss: 13.05 oder 13.45 Uhr
Fernsehen: abends eine Stunde, am Wochenende länger
Zeit für Hausaufgaben: bis 2 Stunden
Übung 45. Lesen Sie die Texte durch und machen Sie einen Steckbrief für Lena oder Lars.
DAS SIND SIE
Lena: Ab 15 darf man in Deutschland arbeiten. Lena ist 17 und nutzt das, um ihr Taschengeld aufzubessern. In den Sommerferien hat sie bei dem Bäcker aus dem Nachbardorf gearbeitet. Lena musste um kurz vor 6 Uhr aufstehen und mit dem Bus zur Arbeit fahren. Das verdiente Geld spart Lena für ihre Amerikareise. Per Schüleraustausch fährt sie in den nächsten Osterferien nach Florida. Aber die Ferien endeten für Lena mit einer bösen Überraschung. Lena wurde krank, mit einer Blinddarmentzündung musste sie ins Krankenhaus und operiert werden. Das ging sehr schnell, aber die Krankheit brachte Lenas Tagesablauf durcheinander: eine Woche keine Schule und mehrere Wochen kein Saxophonunterricht, kein Orchester, kein Judotraining. Vor allem der Sport fehlt ihr sehr. Lena ist seit Anfang des Jahres in einem neuen Judo-Verein. Sie hat jetzt den Blaugurt und trainiert normalerweise dreimal in der Woche. Seit den Sommerferien geht Lena in die 11. Klasse. Ihre Unterrichtszeit dauert 32 Stunden wöchentlich (jede Stunde 45 Minuten), von montags bis freitags. Der Unterricht beginnt um 7. 45 Uhr und ist um 13.45 Uhr zu Ende. Zur Schule geht Lena fünf Minuten zu Fuß. Die Hausaufgaben sind größer geworden, Lena macht sie 2-3 Stunden. Es gibt mehr mündliche und schriftliche Tests, deshalb hat Lena nicht so viel Freizeit. Einen großen Wunsch hat sich Lena im Frühling erfüllt: Sie hat sich von ihren Ersparnissen einen eigenen Computer gekauft. Jetzt kann sie ihre E-Mails schreiben und im Internet surfen. Computerspiele findet sie nicht mehr so interessant. Modisch hat Lena ihren Stil gefunden. Sie ist nicht für teure Klamotten. Aber sie ist sportlich schick.
Lars: Lars geht jetzt in die 10. Klasse, ist 16 Jahre alt. Im neuen Schuljahr hat er einige andere Lehrer bekommen. Manche Lehrer arbeiten nicht mehr in der Schule, aber seine Lieblingslehrer sind zum Glück geblieben. Das sind Lehrer in Deutsch, in Englisch, in Biologie. Seit einem 3/4 Jahr geht Lars montags und freitags eine Stunde zum Wing Tsun, einer chinesischen Kampfsportart. Man muss 12 Schülergrade schaffen, um Meister zu werden. Die erste Prüfung nach einem halben Jahr hat er geschafft. «Kampfsport ist mein Ding», meint Lars. Seit einiger Zeit gehört ein Tier zur Familie: ein Hund. Lars kümmert sich um ihn. Seit kurzem hat Lars einen Plan: Er will den Führerschein machen. Den Führerschein bezahlt Lars von seinen Ersparnissen, aber er muss nicht rauchen, nicht so oft in die Disko gehen und noch ein bisschen arbeiten.
Lars wünscht sich ein sportliches Motorrad, das man auch schneller fahren kann. Aber er kann das nur fahren, wenn er 18 ist. Außerdem gibt es noch viele Bedingungen der Eltern: Die schulischen Leistungen müssen gut sein. Er muss seine Leistungen in Mathematik bessern. Deutsch und andere Fächer fallen ihm nicht schwer und er hat keine Probleme damit [11].
Übung 46. Überlegen Sie eigene Fragen oder Satzanfänge für einen Steckbrief zum Thema «Die heutige Jugend». Arbeiten Sie in Kleingruppen. Tauschen Sie Fragebogen um und stellen Sie Steckbriefe auf.
Übung 47 Die deutsche Zeitschrift hat eine Umfrage unter 1000 15-21jährigen Deutschen veranstaltet. Die Befragten hatten vier unten genannte Fragen zu beantworten. Sehen Sie die Ergebnisse durch und stellen Sie an einander diese Fragen.
1. Wogegen lohnt es sich zu kämpfen? 2. Wovor haben Sie am meisten Angst? 3. Zu wem haben Sie Vertrauen? 4. Was ist für Sie das Wichtigste im Leben?
Die Ergebnisse:
1. Wogegen lohnt es sich zu kämpfen? Umweltzerstörung Soziale Ungerechtigkeit Diktatoren Spaßfeindlichkeit der Gesellschaft Politiker Autoritäten wie Lehrer oder Eltern
|
95 90 83 56 44 26 |
3. Zu wem haben Sie Vertrauen? Eltern Freunde Geschwister Ärzte Lehrer Politiker |
95 91 83 72 49 12 |
2. Wovor haben Sie am meisten Angst? Krieg Einsamkeit Arbeitslosigkeit Umweltkatastrophen Kriminalität Scheidung der Eltern |
53 13 13 10 6 5 |
4. Was ist für Sie das Wichtigste im Leben? Familie Freundschaft Gesundheit Liebe Karriere Gerechtigkeit |
62 51 46 44 21 20 |
Übung 48. Glauben Sie an Horoskope? Lesen Sie Ihre Horoskope und sagen Sie: stimmt es oder stimmt es nicht?
Steinbock (22.12 – 20.01) Organisator, Stratege; trocken, nicht emotional, manchmal lustig, zuverlässig und verantwortungsbewusst, unflexibel.
Schütze (23.11 – 21.12) Reiselustig; interessiert sich für fremde Länder, Sprachen, Kulturen; tolerant, flexibel, offen.
Skorpion (24.10 – 22.11) Praktisch, zielstrebig, zurückhaltend, macht alles sehr schnell; ist ein guter Psychologe; hat ein Organisationstalent.
Waage (24.09 – 23.10) Harmonie zu allen und allem im Leben ist für ihn wichtig.
Jungfrau (24.08 – 23.09) Hat analytische Fähigkeiten, intellektuell, spontan, korrekt, ordentlich; liebt Unerwartetes.
Löwe (23.07 – 23.08) Weiß alles besser als die anderen; egoistisch; will als Erster überall sein; mag Vergnügungen.
Krebs (22.06 – 22.07) Ordentlich, zuverlässig, sehr intelligent; eine große Rolle spielen für ihn Haus, Familie.
Zwillinge (21.05 – 21.06) Unruhig, lustig, neugierig, energisch; macht viele Sachen gleichzeitig; eine starke Persönlichkeit.
Stier (21.04 – 20.05) Flexibel, zuverlässig, unabhängig, eigensinnig; mag physische Arbeit, konkrete Aufgaben; liebt Harmonie, Schönheit.
Widder (21.03 – 20.04) Selbstsicher, zuverlässig, dynamisch.
Fische (20.02 – 20.03) Sehr zuverlässig, immer hilfsbereit, romantisch, aber passiv; mag Musik und Literatur.
Wassermann (21.01 – 19.02) Sehr begabt, fleißig, hilfsbereit, ordentlich, offen, talentiert; ein guter Freund.
Übung 49. Spielen Sie «Personen erfinden».
Jeder schneidet aus einer Zeitschrift ein kleines Bild einer Person aus und klebt es auf ein Blatt Papier auf. Die Blätter werden eingesammelt und jeder bekommt ein neues Blatt mit dem Bild. Spielerin / Spieler A gibt der Person auf dem Blatt einen Namen und gibt das Blatt weiter. Spielerin / Spieler B beschreibt zum Beispiel das Alter und gibt das Blatt weiter. (Das Blatt gibt man immer weiter, aber jedes Mal wird die Information ergänzt: Familie, Kinder, Eltern, Adresse, Hobbys, Interessen, Eigenschaften der Person, was die Person (nicht) mag, was die Person (nicht) gut kann ...). Wenn alle Informationen ergänzt sind, werden die Blätter vorgelesen.
Übung 50. Stellen Sie sich die Situation vor: Sie stehen im Briefwechsel mit einem deutschen Jugendlichen. Er interessiert sich dafür, was laut der belarussischen Gesetze und Vorschriften den Jugendlichen erlaubt und verboten ist? Worüber würden Sie ihm erzählen?
Übung 51. Führen Sie eine Umfrage unter Ihren Freunden. Fragen Sie, ob die Jugendlichen Gesetze und Vorschriften im Bereich der Jugendpolitik kennen und ob sie ihnen folgen? Präsentieren Sie die Ergebnisse in ihrer Studiengruppe.
Übung 52. Teilen Sie sich in drei Gruppen: «Jugendliche», «Eltern» und «Juristen». Besprechen Sie zusammen die Vorschriften aus der Sicht Ihrer Rolle: die «Jugendlichen» verteidigen sich, die «Eltern» beklagen sich und die «Juristen» beraten beide. Dann formulieren Sie bitte wünschenswerte Vorschriften aus Ihrer Sicht und begründen Sie diese. Die Vorschriften, die besonders überzeugen, werden als neues «Jugendschutzgesetz» an die Tafel geschrieben.
Übung 53. 1914 hat der Dichter Jürgen Brand ein schönes Gedicht gereimt. Lesen Sie dieses Gedicht und formulieren Sie den Hauptgedanken.
WIR SIND JUNG UND DAS IST SCHÖN
Wir sind jung, die Welt ist offen,
o, du schöne, weite Welt!
Unser Sehnen, unser Hoffen
Zieht hinaus in Wald und Feld.
Bruder, lass den Kopf nicht hängen,
kannst ja nicht die Sterne sehen;
aufwärts blicken, vorwärts drängen!
Wir sind jung, und das ist schön.
Liegt dort hinter jenem Walde
Nicht ein schönes, fernes Land,
blüht auf jenes Berges Halde
nicht ein Blümlein unbekannt?
Lasst uns wandern ins Gelände
Über Berge, über Höhn!
Wo sich auch der Weg hinwende,
wir sind jung, und das ist schön.
Auf denn, auf die Sonne zeigte
Uns den Weg durch Feld und Hain.
Geht darauf der Tag zur Neige,
leuchtet uns der Sternenschein.
Bruder, schnall den Rucksack über,
heute soll's ins Weite geh ‘n.
Regen, Wind, wir lachen drüber!
Wir sind jung, und das ist schön.
Übung 54. Beantworten Sie die Fragen zum Text des Gedichtes.
1. Wie beschreibt der Dichter die Welt um uns herum? 2. Welche Vorschläge macht er seinem Freund? 3. Wie finden Sie solche Art der Freizeitgestaltung? 4. Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit? 5. Unternehmen Sie auch etwas (eine Reise, eine Wanderung etc.) zusammen mit Ihren Freunden?
Übung 55. Suchen Sie im Text des Gedichtes eine feste Wortverbindung. Wie würden Sie die Bedeutung dieser Wortverbindung erklären? Kennen Sie andere ähnliche Wortverbindungen? Beispiele können Sie unten finden.
1. Unter die Räder kommen. 2. Mit dem Kopf durch die Wand wollen. 3. Ins Schwarze treffen. 4. Mit der Tür ins Haus fallen. 5. Auf großem Fuße leben. 6. Fest auf den Beinen stehen. 7. Zu tief ins Glas schauen. 8. Etwas unter den Teppich kehren. 9. Das Kind mit dem Bade ausschütten.
Übung 56. Erklären Sie, in welchen Situationen wir diese oder jene Wortverbindung gebrauchen können?
Übung 57. Viele Jugendliche möchten etwas in ihrem Äußeren verändern. Und Sandra ist keine Ausnahme. Lesen Sie den Text darüber und sagen Sie: Sind Sie mit Ihrem Äußeren ganz zufrieden?
JUNG, SCHÖN UND TROTZDEM UNZUFRIEDEN
Sandra kann sich ohne Sport nicht vorstellen. Sie jobbt und trainiert im Hamburger Bodylife – Fitnessstudio. Wenn sie von ihren Freundinnen wegen ihrer schlanken Figur bewundert wird, lächelt sie stolz. Zufrieden ist sie aber nicht. Sandra möchte so eine Traumfigur haben wie ihre Cheftrainerin.
So wie Sandra gehen viele Jugendliche ins Fitnessstudio, um anderen zu gefallen. Nach Meinung der Sozialwissenschaftler sind die Ursachen für den Körperkult die Verbreitung der idealen Maße durch die Medien. Dabei gibt es nur ein Problem. Nur etwa fünf Prozent entsprechen diesen Maßen wirklich. Weil aber diese Idealpersonen wirklich leben, glauben besonders Jugendliche so zu werden wie ihre Vorbilder, wollen ihnen ähnlich sein. Aber das führt manchmal zu den krankhaften Essstörungen oder übertriebenem Training oder Herzkrankheiten. Sandra arbeitet noch in einem Solarium und erzählt, dass sich manche Kunden dreimal in der Woche von der künstlichen Sonne bräunen lassen. Die Gefahr an Hautkrebs zu erkranken ist sehr groß. Aber gebräunte straffe Haut und eine schlanke Traumfigur - das ist für viele Jugendliche das gewünschte Ziel [13].
Übung 58. Beantworten Sie die Fragen zum Text.
1. Was sind die Ursachen des übertriebenen Trainings? 2. Was sind die Folgen des übertriebenen Trainings? 3. Gibt es andere verrückte Sachen, die die jungen Menschen gebrauchen, um schöner auszusehen? 4. Welche Möglichkeiten kann man benutzen, um nicht nur schlank und schön, aber auch gesund zu bleiben? 5. Welche von diesen Maßnahmen ergreifen Sie? 6. Welche Bestandteile gehören zu der «inneren» und «äußeren» Schönheit? Welche Seite der Schönheit ist wichtiger für Sie?
Übung 59. Stellen Sie sich vor: Sie haben in einem Lotto viel Geld gewonnen und möchten ein eigenes Business im Bereich der Freizeitgestaltung eröffnen. Entwerfen Sie das Projekt einer Unterhaltungsgaststätte extra für Jugendliche. Es könnte ein Kaffeehaus, ein Nachtbar etc. sein. Präsentieren Sie Ihre Ideen in x-beliebiger Form in Ihrer Untergruppe.
PROBLEME ZWISCHEN DEN GENERATIONEN
Übung 1. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den Begriff «Probleme zwischen den Generationen» hören?
Übung 2. Da ist die Definition des Begriffes «Generationenkonflikt». Formulieren Sie Ihre eigene Definition dieses Begriffes.
Unter dem Begriff «Generationenkonflikt» wird häufig ein kultureller, sozialer oder wirtschaftlicher Gegensatz zwischen den Generationen verstanden, der aufgrund von Wertunterschieden oder aufgrund von Interessengegensätzen zwischen der jüngeren und der älteren Generation entstehen kann. Generationenkonflikte treten in der Regel innerhalb der Familie auf, zwischen Eltern und Jugendlichen in der Ablösungsphase. Oft beschreibt der Begriff aber die auf die Zukunft gerichtete Verantwortung einer Generation für die nächste und die damit verbundenen Probleme.
Übung 3. Lesen Sie das Gedicht von Kurt Tucholsky durch. Welche Wörter zeugen von Meinungen der Jugendlichen und Erwachsenen voneinander? Könnten Sie ein Gedicht zum Thema schaffen?
Die Jugend hat das Wort
Ihr seid die Ält'ren. Wir sind jünger.
Ihr steht am Weg mit gutem Rat.
Mit scharfgespritztem Zeigefinger
Weist ihr uns auf den neuen Pfad.
Wir sind die Jüngeren. Ihr seid älter.
Doch das sieht auch das kleinste Kind:
Ihr sprecht von Zukunft, mein Gehälter
Und hängt die Bärte nach dem Wind!
Ihr wollt erklären und bekehren.
Wir aber denken ungefähr:
«Wenn wir doch nie geboren wären!»
Es heißt: Das Alter soll man ehren...
Das ist mitunter, das ist mitunter,
das ist mitunter furchtbar schwer.
Übung 4. Laut der Meinung vieler Menschen entstehen ständig Probleme zwischen den Generationen. Sind Sie derselben Meinung? Begründen Sie Ihre Position.
Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen: Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind, und junge begreifen nie, dass sie alt werden können.
Übung 5. Sehr oft klagen die älteren Menschen über die Jugendlichen. Wie finden Sie diese Klagen? Nehmen Sie Stellung zu folgenden Worten der älteren Menschen.
«Wir Alten hatten es früher schwerer und doch leichter; die Jungen haben es heute leichter und doch schwerer. Früher hieß es von alt zu jung: Euch geht’s doch viel zu gut. Heute heißt es: Uns ist heute klar, dass Ihr es nicht so leicht habt, wie wir es hatten».
Übung 6. Viele Probleme haben die jungen Leute und viele Probleme entstehen in der Familie durch Verständigungsmangel. Nicht immer können/wollen junge Leute und ihre Eltern einander verstehen. Zählen Sie Eigenschaften oder Gewohnheiten auf, die für Jugendliche und Erwachsene typisch sind und die zu manchen Konflikten führen können!
Jugendliche |
Erwachsene |
wollen sich modegerecht kleiden wollen ihr eigenes Leben führen
|
kommandieren rum bitten nicht, sie befehlen
|
Übung 7. Jugendliche und Erwachsene. Was denken die Erwachsenen über die heutige Jugend? Lesen Sie die Aussagen. Überlegen Sie einen Augenblick und notieren Sie Ihre Meinungen zu jeder Aussage (1-2 Sätze). Womit sind Sie einverstanden, womit nicht? Was sind Ihrer Meinung nach die besonderen Eigenschaften der heutigen Jugend?
1. Die Jugendlichen sind undankbar. 2. Viele Jugendliche drücken sich von schweren Aufgaben. 3. Viele Jugendliche sind verantwortungslos. 4. Die heutige Jugend ist tolerant und hilfsbereit. 5. Die Jugendlichen werden heutzutage verwöhnt. 6. Die Jugendlichen genießen zu viel Zeit. 7. Die Jugendlichen sind tolerant und frei. 8. Die Jugendlichen sind unerzogen. Sie machen alles, was sie wollen, ohne bestraft zu werden. 9. In der Jugend weiß man nicht, was man will. 10. Die Jugend ist sorglos. 11. Die Jugend ist neugierig. Sie will alles probieren und alles wissen. 12. Die Jugendlichen haben keinen Respekt vor den Erwachsenen.
Übung 8. Wann geht es Kindern gut? Beantworten Sie die Frage, gebrauchen Sie dabei die Konditionalsätze.
z. B.: Die Kinder fühlen sich wohl, wenn Eltern Vertrauen zu ihnen haben. Unter der Bedingung (gesetzt den Fall, unter der Voraussetzung, im Falle), dass Eltern Vertrauen zu den Kindern haben, fühlen sich die Kinder wohl.
1. Eltern haben Vertrauen zu ihren Kindern. 2. In der Familie herrscht Demokratie, die Kinder dürfen mitbestimmen. 3. Eltern kümmern sich um die Kinder. 4. Eltern nehmen Rücksicht auf die Wünsche ihrer Kinder. 5. Eltern haben immer ein offenes Ohr für ihre Kinder. 6. Kinder und Erwachsene haben gemeinsame Interessen. 7. Eltern und Kinder respektieren einander. 8. Alle Familienmitglieder gehen liebevoll miteinander um. 9. Eltern sehen über kleine Fehler der Kinder hinweg. 10. Alle Familienmitglieder können sich aufeinander verlassen.
Übung 9. Sehr viele Jugendliche möchten mehr als ihre Eltern erreichen, sie möchten anders sein. Wie finden Sie diese Wünsche der Jugendlichen? Lesen Sie die Aussage von den jungen Menschen und äußern Sie sich dazu.
«Wir wollen aber nicht so sein wie unsere Eltern oder unsere Großeltern» – so oder ähnlich hört man es heute und hörte man es in früheren Zeiten von vielen Jugendlichen. Jugendliche wollen vieles anders machen als ihre Eltern. Sie wollen nicht, dass ihnen alles vorgeschrieben wird. Sie wollen sich von der älteren Generation abgrenzen und suchen eigene Wege im Leben. Das zeigt sich zum Beispiel in einer besonderen Jugendkultur mit eigener Musik, anderer Kleidung, anderen Vorstellungen von der Gestaltung des Lebens. Oft erkennen die Jüngeren nicht an, was für die Älteren selbstverständlich war und ist. Sie widersprechen den Eltern und Lehrerinnen. Manchmal kommt es zum Streit und dann ist der Konflikt zwischen den Generationen da.
Heute spielt dabei auch noch der Kampf um Arbeitsplätze und die beruflichen Chancen eine Rolle. So kritisieren junge Menschen beispielsweise, dass in vielen Berufsfeldern das Lebensalter oder die Dauer der Berufstätigkeit (man nennt das «Dienstalter») für den Aufstieg und die bessere Bezahlung oft wichtiger sind als die Leistung im Beruf. Dieses sogenannte «Senioritätsprinzip» kann ein Grund für einen Konflikt zwischen den Generationen sein [3].
Übung 10. Die Eltern und die Kinder machen einander Vorwürfe. Sehen Sie die Tabelle durch und nehmen Sie Stellung zu diesen Aussagen.
|
Eltern |
Kinder |
Schule
|
dauernd kritisieren; sich für schulische Probleme interessieren |
nichts über die Schule erzählen; erzählen, was in der Schule los war |
Freizeit
|
Vorwurf, Kinder treiben sich herum; finden meist gut, was ihre Kinder tun |
sagen nicht genau, wohin sie gehen; sagen, was sie machen und mit wem |
Liebe, Freundschaft
|
sich einmischen; haben Verständnis für die Wahl der Kinder |
erzählen den Eltern nichts über ihre Freunde; bringen ihren Freund/ Freundin mit nach Hause |
Hausarbeit
|
vorwerfen, dass Kinder sie ausnutzen; verlangen nicht sehr viel |
rühren zu Hause keinen Finger; machen bei der Hausarbeit mit |
Übung 11. Welche Schwierigkeiten haben die Jugendlichen mit den Eltern, mit den Erwachsenen? Was könnten Sie noch hinzufügen?
wir Jungen sind nicht freiwillig in dieser Welt;
ihr habt vor allem selber diese Welt verhunzt; im Namen von Fortschritt, wirtschaftlichem Wachstum, Sicherheit, Chancengleichheit, Entlastung habt ihr unser Leben einer Herrschaft der Apparate und Automatismen ausgeliefert, die euren Beteuerungen von Freiheit und Würde spotten;
ihr habt ein Subsystem von Prüfungen, Manipulationsmechanismen, Ausscheidungsverfahren eingeführt, mit denen ihr Selbstentfaltung, Kreativität verhindert;
ihr seid mit euren Problemen nicht fertig geworden und wollt uns nun auch den Spaß an der unseren nicht gönnen;
wenn ihr schlechte Nerven habt – okay; wir machen unseren Lärm und unser Action woanders; aber tut nicht so, als gehörte euch die Welt und als sei dies alles unmoralisch und unverantwortlich;
ihr wisst immer alles besser, ihr pocht auf eure Erfahrung, die aber für die neue Welt nicht gilt;
wir lassen uns nicht ein auf eure hilflose Mächtigkeit, auf die Entfremdung, Versachlichung, Verzweckung des Lebens;
neurotisch? Ja, das sind wir auch; aber was können wir dafür?
Übung 12. Welche Probleme haben die Eltern, die Erwachsenen mit den Jugendlichen? Was könnten Sie noch hinzufügen?
wir haben Verständnis für die Jugend, weil wir auch jung gewesen sind und auch unter unseren Eltern gelitten haben;
dabei bezahlen wir ihnen nicht nur ihre Existenz, sondern ihre ganze Subkultur, ihre Jugendhäuser, ihre Freizeitanlagen;
wir gönnen der Jugend ihren Spaß, aber erstens ist dieser Spaß kein Spaß, sondern entweder Schwachsinn oder kalkulierte Herausforderung, und zweitens ist er rücksichtslos: er geht auf Kosten anderer.
Übung 13. Welche dieser Aussagen können Sie verstehen, welchen würden Sie zustimmen, welche lehnen Sie ab? Gibt es Aussagen, die mittlerweise überholt oder nicht mehr so wichtig sind?
Übung 14. Auf beiden Seiten spricht der Autor von «wir» bzw. «ihr». Tatsächlich gehört er aber allenfalls einer Gruppe an. Weshalb hat er wohl diese sprachliche Form gewählt?
Übung 15. Schreiben Sie anonym auf einem Zettel, welche Probleme Sie mit Ihren Eltern haben. Sammeln Sie die Zettel in der Gruppe ein. Haben Ihre Studienkollegen dieselben Probleme?
Übung 16. Machen Sie sich mit dem Inhalt des Textes bekannt. Welche Aussagen des Textes könnten Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung bestätigen?
DAS EWIGE THEMA: ELTERN UND KINDER
Missverständnisse zwischen Eltern und Kindern gehören heute zu Tagesordnung. Wie kommt es dazu? Die Ausgangssituation ist meist harmlos. Eine Äußerung des Kindes wird von den Eltern falsch verstanden: es kommt zum Streit. Im Nu wird aus kleinen Schwierigkeiten eine Nervenzerreißprobe.
Kinder und Eltern leben in zwei verschiedenen Welten, die Großen haben längst vergessen, was Kind sein bedeutet. Welche Grundeinstellungen haben die Eltern gegenüber ihren Kindern? In der Regel gehen sie davon aus, dass Kinder Chaoten sind und ihnen auf die Nerven gehen wollen. Das führt natürlich zu einer unbewussten Abwehrhaltung und zu einem falschen Verhalten. Viele Bitten oder Forderungen der Eltern kommen, z. B. im Befehlston. Sie geben damit den Kindern gar keine Möglichkeit, auf diese Bitte oder Forderung zu reagieren und so engen sie den Spielraum des Kindes ein.
Es ist wichtig, dass Eltern auch Lehrer intensiver nach Gründen für dieses «bockige» Verhalten des Kindes suchen und natürlich nicht gleich mit Strafen reagieren. Strafen verschlimmern die ganze Sache, denn sie zeigen dem Kind, dass es missverstanden wurde. Strafen demütigen das Kind, so dass diese Kinder später nicht selten unter Minderwertigkeitskomplexen leiden.
Schlechte Noten im Zeugnis sind ein Alarmsignal für die Eltern wie auch für die Kinder, die sich in solch einer Situation natürlich sehr unglücklich fühlen, dass sie erst einmal getröstet werden sollten. Um dem Kind zu helfen, müssen die Eltern zusammen mit den Lehrern die Gründe für den Leistungsabfall klären. Die Ursachen können verschiedene Krankheiten sein, oder das Kind ist überfordert, weil es die falsche Schule besucht. Häufig sind es aber auch Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule. Dahinter stehen oft seelische Konflikte des Kindes, ausgelöst durch Spannungen zu Hause, oft durch die Scheidung der Eltern.
Lernprobleme können auch dadurch entstehen, dass ein Kind mehr «Misserfolge» erlebt hat und sich nun keinen Forderungen mehr stellen mag nach dem Motto: Es hat doch alles keinen Sinn.
Zu den größten Problemen zählt die Lenkung der jugendlichen Kraft und Vitalität in richtige Bahnen. Das «normale» Kind ist ein Bündel aufgestauter, tatendurstiger Energie. Und die muss freigesetzt werden! Je länger die Kraft wie in einer Flasche «eingekorbt» bleibt, desto stärker ist der Frust. Die Eltern unterschätzen diese kindliche Energie, dabei ist es ein Naturgesetz: Vorhandene Energie muss sich entladen. Ein solches «sich selbst überlassenes» Kind ist sehr gefährlich. Ohne Anleitung und Orientierung geht die kindliche Kraft leicht ins Zerstörerische. Das führt dazu, dass besonders Großstadtkinder gewalttätig und vandalistisch werden. Von der Wärme, Geborgenheit und Kreativität einer liebevollen, intakten Familie abgeschnitten, wird das Kind häufig zum Vagabunden auf der Suche nach Abenteuern. Die Vernachlässigung durch die Eltern zählt zu den Hauptgründen dafür, dass sich Kinder- und Jugendbanden bilden.
Ein Kind darf niemals ganz von der Familie «wegdriften», sondern sollte innerhalb der Familie Möglichkeiten finden, sich zu entfalten. Niemals sollte es in den prägenden Jahren völlig auf sich selbst gestellt sein. Das heißt nicht, dass man dem Kind nicht Selbständigkeit, Selbstvertrauen und Selbstverantwortung beibringen sollte. Die Eltern müssen für den ständigen Betätigungsdrang des Kindes Verständnis zeigen und ihm entsprechende Betätigungsfelder bieten: Gemeinsame Familienausflüge, Sport, Wandern, Camping, Musizieren, Joggen, Basteln, Hobbys usw. ‒ das sind viele Möglichkeiten, sich sinnvoll zu betätigen und dabei die aufgestaute Energie loszuwerden. Im Grunde sollte es den Kindern im Familienkreis am besten gefallen.
Das Kind, das in der Familie keine Befriedigung und Geborgenheit findet, wird das anderswo suchen. Verantwortungsbewusste Eltern erkennen dieses Bedürfnis und bemühen sich darum, ein gutes Zuhause für das Kind zu schaffen, natürlich ist das nicht so einfach, es kostet Phantasie, Zeit und Mühe [3].
Übung 17. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text.
1. Was fällt Ihnen zum Begriff «älter werden» ein? 2. Welche Erfahrungen haben Sie schon in Ihrem Leben gemacht? 3. Was gefällt Ihnen im heutigen Lebensstil? Was möchten Sie ändern? 4. Wovon träumen Sie? 5. Was erwarten Sie vom Leben? 6. Auf wen können Sie sich in allen schwierigen Situationen verlassen? 7. Wie verstehen Sie sich mit den Eltern? 8. Ihre Eltern sind für Sie Berater; Freunde …? 9. Wo fühlen Sie sich heimisch und verstanden? 10. Wie wichtig ist für Sie das Geld? 11. Was halten Sie von anderen Lebenswerten, die man nicht kaufen kann? 12. Was schätzen Sie an anderen Menschen? 13. Sind Sie mit sich im Reinen?
Übung 18. Vieles wird in einer Person von den Eltern anerzogen. Sehen Sie den Text durch und stellen Sie fest, von welcher Familie Sie gerade träumen?
VERBINDUNGEN MIT ELTERN
Die meisten Leute sagen, dass die Familie für sie sehr wichtig ist. Sie wiederholen gern, dass Familien ihnen den Sinn von Tradition, Stärke und Zweck in ihren Leben geben. «Unsere Familien zeigen, was wir sind», sagen sie. Die meisten Eltern unterrichten ihren Kindern, ältere Leute zu respektieren und Feiertage zu beobachten. Aber die wichtigste Sache für die Familie besteht, um eine emotionale Unterstützung und eine Sicherheit zu geben. Die richtigen Familien helfen den Jungen und Mädchen Zuversicht gewinnen und dem Einfluss schlechter Freunde widersetzen.
Jungen halten ihre Eltern oft für altmodisch, ahnungslos vom spätesten Stil. Als für ihre Eltern machen sie ihr Bestes, um ihren Kindern die bessere Chance zu geben, als sie hatten. Nach der Beendigung der Schule versuchen oft die Kinder vollständige Unabhängigkeit zu bekommen, sie verlassen ihre Familien und manchmal ihre Heimatstädte. Das Bleiben bei Eltern hat seine negativen und positiven Aspekte, aber Kinder müssen verstehen, dass die Eltern ihnen keine Verletzung machen wollen. Darum müssen junge Leute manchmal Kritik von ihren Eltern zuhören.
Einige Leute sprechen oft von der so genannten «Generationslücke», der Lücke in Sichten zwischen Eltern und Jungen, aber die meisten Leute glauben, dass diese Generationslücke manchmal übertrieben wird. Sehr oft fühlen sich die Kinder vernachlässigt in ihren Familien. Wenn sie Grausamkeit, Gleichgültigkeit und Missverständnis in ihren Familien finden, werden sie klüftig und herzlos. Als Ergebnis fühlen sich die Kinder verletzt, und einige von ihnen versuchen der Wirklichkeit durch das Stimmen zu Alkohol und Drogen zu entkommen. Wir alle sollen mehr Aufmerksamkeit deshalb zu Familienproblemen schenken, wir müssen Streit vermeiden und müssen Zustimmung suchen. Wir müssen uns an geistige Werte allen Leuten erinnern, wir müssen in Frieden und Harmonie leben [3].
Übung 19. Wann kann man die Erziehung als zu autoritär oder zu liberal bezeichnen? Führen Sie einige Beispiele an.
Übung 20. Da sind die Meinungen einiger Kinder, die Probleme mit ihren Eltern haben. Haben Sie dieselben Probleme? Äußern Sie sich dazu.
ICH HAB' PROBLEME MIT DEN ELTERN ….
‒ weil ich meistens nicht gleicher Meinung bin wie die Eltern;
‒ wenn ich später komme, als ich gesagt habe;
‒ weil die Eltern kein Verständnis für meine Probleme haben;
‒ wenn ich zu frech bin;
‒ die Eltern gehen mit mir wie mit einem Kind um;
‒ die Eltern sind sehr streng und deswegen traue ich mich nicht;
‒ wenn ich keinen Bock habe, die Wohnung sauber zu machen.
Übung 21. Da ist das Gedicht «An die Eltern» von Klaus Konjetzky.
Ihr kennt das Leben,
also lasst mich es kennen lernen.
Ihr sprecht
von der Verantwortung, die ihr für mich habt –
aber ihr wollt nur, dass ich so werde wie ihr.
Hier ist die Fortsetzung von Konjetzkys Text. Was gehört zusammen?
1. Ihr sagt, ich solle mich mehr für Kultur interessieren 2. Ihr behauptet, Fernsehen macht träge – 3. Ihr sagt, es komme auf den Menschen an 4. Ihr sprecht von den Erfahrungen, die ihr gemacht habt 5. Ihr fordert Vertrauen und Offenheit – 6. Ihr sagt, es sei nicht alles in Ordnung im Lande – 7. Ihr beklagt die Gleichgültigkeit der Jugend – 8.Ihr verurteilt die Gewalttätigkeit vieler Jugendlicher – 9. Ihr wünscht mir eine bessere Zukunft. |
i. aber über Kriegsdienstverweigerung lasst ihr nicht mit euch reden. |
Übung 22. Schreiben Sie eine Antwort an Stelle der Eltern!
Übung 23. Ein Streit kann durch viele Sachen ausgelöst werden. Kann man dem Streit aus dem Weg gehen? Wie ? Was können Sie raten?
Übung 24. Formulieren Sie Tipps für Eltern. Gebrauchen Sie dabei die Imperativform in der 2. Person Plural.
1. Problem: das Kind hält sich nicht an Regeln. 2. Problem: das Kind ist aggressiv. 3. Problem: das Kind ist überängstlich. 4. Problem: das Kind kann sich nicht allein beschäftigen.
Sich mehr Zeit für das Kind nehmen. 2. Öfter mit dem Kind zusammen spielen. 3. Etwas gemeinsam unternehmen. 4. Das Kind beruhigen. 5. Mit dem Kind reden. 6. Dem Kind etwas Nettes sagen. 7. Sein Selbstbewusstsein stärken. 8. Das Kind öfter loben. 9. Das Kind öfter motivieren. 10. Kontakte des Kindes zu anderen Kindern fördern. 11. Ruhig bleiben. Tolerant sein, zu ihren Kindern. 12. Gewalt, gebrauchen. Sie, keine. 13. Hart, bleiben, ihr Kind, ausprobieren, zum ersten Mal, Alkohol, wenn. 14. Sich aufregen, wenn, zu spät, heimkommen, ihr Kind. 15. Monatlich, eine bestimmte Geldsumme, geben, ihm. 16. Aufhören, ihre Tochter, wie ein kleines Kind, behandeln. 17. Enttäuscht sein, wenn, ihre Kinder, gehen, eigene Wege. 18. Sich klar machen, dass, kein Besitz, ihr Sohn, sein. Haben, Sie, ein Recht, ihr eigenes Leben, auf. 19. Sein, ihrer Tochter, Gesprächspartner, zu Hause.
Übung 25. Drei Viertel der Jugendlichen denken, dass nur wenige Erwachsene Verständnis für Jugendliche haben. «Man lernt mehr von Freunden und Freundinnen», sagen sie. Sind Sie damit einverstanden? Begründen Sie Ihre Meinung.
Übung 26. Mädchen und Jungen entwickeln früh ihren eigenen Kopf – und stimmen in ihrem Willen nicht immer mit den Eltern überein. Da sind 10 typische Konfliktsituationen und 10 konkrete Lösungen. Wie schätzen Sie diese? Was würden Sie in jeder Situation unternehmen?
WANN ELTERN GRENZEN SETZEN MÜSSEN
Mit jedem Zentimeter, den ein Kind wächst, entdeckt es mehr und mehr seinen eigenen Willen. Bereits mit einem halben Jahr beginnt Ihr Baby zu ahnen, dass es Sie um den kleinen Finger wickeln kann, wenn es nur durchdringend genug schreit. Es macht dabei eine wichtige Erfahrung: Wie reagiert Mama, wenn ich abends nach dem Zu-Bett-Bringen weine? Nimmt sie mich auf und schaukelt sie mich in den Schlaf? Oder sagt sie mir, dass ich jetzt schlafen muss, und geht wieder aus dem Zimmer? Großwerden ist nicht immer einfach. Alles ist neu, spannend, aber auch manchmal beängstigend. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern ihrem Kind Rückhalt geben und in bestimmten Situationen Grenzen ziehen. Grenzen sind nötig, wenn es um die Sicherheit oder Gesundheit des Kindes und um die Rechte und Bedürfnisse anderer geht.
Je konsequenter Sie auf Regeln bestehen, desto eher lernt Ihr Kind, sie zu akzeptieren. Mädchen und Jungen sehen Regeln eher ein, wenn die Mutter oder der Vater ihnen ruhig und geduldig den Grund dafür erklärt. Dabei ist es wichtig, dass beide Elternteile an einem Strang ziehen und sich nicht gegeneinander ausspielen lassen.
1. Lukas protestiert abends, wenn seine Mama ihn ins Bettchen legt. Dann nimmt sie ihr Kind hoch und trägt es herum. Oft dauert es über eine Stunde, bis sie den Kleinen in den Schlaf geschaukelt hat.
Wie sie das Zu-Bett-Bringen hinauszögern können, finden kleine Kinder schnell heraus. Doch wenn Eltern immer wieder nachgeben, wird sich nichts ändern. Schenken Sie Ihrem Kind abends vor dem Zu-Bett-Gehen besonders viel Zeit. Ein liebevolles Einschlafritual hilft ihm, sanft vom Tag Abschied zu nehmen. Achten Sie darauf, dass dieses Ritual immer gleich bleibt. Wenn Ihr Kind schließlich im Bett liegt, der Teddy zugedeckt und die Spieluhr aufgezogen ist, besteht kein Grund, den kleinen Quälgeist beim ersten Mucks hochzunehmen. Sie können ruhig, aber bestimmt sagen: «Jetzt ist Schlafenszeit. Ich werde dich nicht wieder aus dem Bett nehmen. Ich bleibe aber noch eine Weile bei dir sitzen». Das kann zwei, drei Minuten dauern. Wenn sich Ihr Kind nach kurzer Zeit nicht beruhigt hat, schauen Sie noch einmal nach. Aber das Baby sollte nicht mehr auf den Arm genommen werden.
2. Auf dem Weg zur Spielgruppe möchte Natalie allein laufen. Doch wenn die Mutter sie aus dem Buggy nimmt, reißt das Kind sich von ihrer Hand los und läuft auf die Straße.
Hier wird es gefährlich. Deshalb sollten Sie in Situationen wie dieser konsequent bleiben. Nehmen Sie Ihr Kind fest an die Hand. Erklären Sie ihm: «Es ist zu gefährlich, über die Straße zu laufen. Deshalb bleibst du an der Hand». Wenn Ihr Kind sich auf den Boden wirft und zu schreien beginnt, können Sie es in den Buggy setzen und es anschnallen. Gut ist es, wenn sich die Eltern von dem Geschrei nicht beeindrucken lassen, sondern ruhig und gelassen bleiben.
3. Marie trödelt jeden Morgen, wenn die Mama sie zur Tagesmutter bringen will. Die Mutter gerät jedes Mal unter Druck. Denn sie muss pünktlich im Büro sein.
Das Trödeln am Morgen kennen alle Eltern. Und auch in diesem Fall hilft nur Konsequenz. Stellen Sie einen großen, bunten Wecker und sagen Sie Ihrem Kind: «Wenn der Wecker klingelt, ist es Zeit loszufahren». Falls es trotzdem trödelt, dürfen Sie es auch gegen seinen Willen anziehen – mit der Erklärung: «Der Wecker hat geklingelt. Nun haben wir keine Zeit mehr. Ich muss nämlich pünktlich im Büro sein». Zudem sollten sich Eltern immer dann, wenn sie es eilig haben, Zeit für ihr Kind nehmen. Denn es spürt die Nervosität der Großen. Das Kind wird unsicher und trödelt dann erst recht. Es hilft auch, schon abends das Wichtigste bereitzulegen.
4. Patrick möchte keine Mütze anziehen, obwohl draußen Minustemperaturen herrschen. Er hat gerade eine Mittelohrentzündung überstanden und seine Mutter hat Angst, dass er wieder krank wird.
Da Sie Ihr Kind vor Krankheiten schützen müssen, dürfen Sie ihm die Mütze ruhig aufsetzen. Wenn es sie immer wieder vom Kopf reißt, ziehen Sie ihm die Kapuze des Anoraks über und binden sie gut zu. Vermutlich gilt es jetzt, das Geschrei Ihres Kindes auszuhalten. Doch nach einer Weile wird es sich von selbst wieder beruhigen.
5. Lena ist eine kleine Entdeckerin. Besonders verbotene Dinge haben es ihr angetan, etwa Mamas Schreibtisch.
Kinder sollten Schränke oder Schubladen haben, in denen sie nach Herzenslust kramen dürfen. Doch Ihr Kind muss auch lernen, dass es Dinge gibt, mit denen es auf keinen Fall spielen darf. Wenn es an Ihrem Computer hantiert oder Papiere von unten nach oben kramt, sollten Sie eine Grenze ziehen: «Stopp. Das ist mein Arbeitsplatz und ich möchte nicht, dass du hier spielst». Befördern Sie Ihr Kind mit sanftem Druck aus dem Zimmer, wenn es auf die Ermahnung nicht reagiert.
6. Bekommen Ninas Eltern Besuch, ist eine normale Unterhaltung kaum möglich. Das Mädchen plappert ständig dazwischen. Alles dreht sich um die Kleine.
Wenn sich Besuch angemeldet hat, zeigen sich Kinder häufig nicht gerade von ihrer Schokoladenseite. Bei Änderungen im gewohnten Tagesablauf reagieren sie nämlich oft unsicher. Das gilt vor allem, wenn ihnen plötzlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird als sonst. Beziehen Sie Ihr Kind deshalb in die Vorbereitungen auf den Besuch mit ein. Es kann beim Einkaufen, Kochen und Tischdecken helfen. Vielleicht darf es sich für den Gast eine Überraschung ausdenken – ein selbst gemaltes Bild etwa. Nach einer kurzen Phase der Begrüßung und des Kennenlernens sollte Ihr Kind wissen: «Jetzt wollen sich meine Eltern in Ruhe mit dem Besuch unterhalten. Ich darf zwar dabei sein, aber nicht ständig dazwischen plappern». Die Eltern können ihr Kind auf den Schoß nehmen, ihm den Rücken kraulen, damit es merkt: Ich bekomme genügend Aufmerksamkeit. Aber Mütter und Väter sollten sich weiter in Ruhe mit dem Besuch unterhalten. Die Kleinen müssen akzeptieren lernen, dass die Eltern jetzt vorrangig für den Besuch da sind. Ab drei, vier Jahren können sich Kinder für eine Weile allein beschäftigen.
7. Peter geht mit seinen Eltern essen. Im Restaurant zappelt der Kleine auf seinem Stuhl hin und her. Dann ist er nicht mehr zu bremsen. Er spielt Flugzeug und düst mit ausgebreiteten Armen und läuft lärmend durchs Lokal.
Bereits kleine Kinder sollten lernen, dass sie andere nicht in ihrer Arbeit behindern dürfen. Wenn Sie Ihr Kind im Lokal herumlaufen lassen, riskieren Sie zu Recht schiefe Blicke des Personals. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es am Tisch sitzen bleiben soll – auch wenn es ihm schwer fällt. Kleine Spiele am Tisch lenken bis zum Essen ab.
8. Imke verlangt am Mittagstisch Pudding. Das Gemüse und die Kartoffeln mag sie nicht. Nach langem Hin und Her erreicht sie ihr Ziel. Sie bekommt Pudding.
Bei den Mahlzeiten sollten von Anfang an Regeln gelten. Wer nichts mag, muss auch nichts essen. Pudding bekommt nur derjenige, der auch Gesundes verspeist. Die Großen dürfen entscheiden, was es zu essen gibt. Die Kleinen dürfen sagen, wie viel sie wovon mögen.
9. Wenn Paul beim Einkaufen nicht den begehrten Schokoriegel bekommt, wird er richtig wütend. Durch sein Geschrei erreicht er, dass Mama irgendwann nachgibt und die Süßigkeit kauft.
Machtkämpfe im Supermarkt gehören zum Alltag. Die Kleinen möchten alles haben, und zwar sofort. Erklären Sie Ihrem Kind vor dem Einkaufen, dass Sie keine Süßigkeiten kaufen werden. Sie können ihm auch zeigen, dass im Schrank noch genug Süßes ist. Gerade jetzt ist es wichtig, konsequent zu bleiben. Wenn das Kind zu schreien beginnt, nehmen Sie es fest an die Hand und verlassen notfalls den Laden. Wenn es sich beruhigt hat, können Sie wieder hinein gehen.
10. Wenn Anna wütend ist, schlägt sie ihre Mutter. Die versucht, die Aggression ihres Kindes zu ignorieren. Mittlerweile schlägt Anna auch andere Kinder.
Annas Mutter hat versäumt, ihrem Kind frühzeitig Grenzen zu setzen. Halten Sie Ihr Kind, wenn es in der Wut nach Ihnen schlägt, fest an der Hand. Sagen Sie: «Stopp! So geht das nicht. Das tut weh» [11].
Übung 27. Da sind die Ratschläge der Psychologen den Eltern und Kindern. Wie finden Sie diese? Welche Ratschläge könnten Sie geben, um Konflikte zu vermeiden?
Manchen Eltern fällt es schwer, konsequent zu bleiben. Sie bringen es kaum übers Herz, Grenzen zu ziehen. Oft steckt die Angst dahinter, die Zuneigung des Kindes zu verlieren. Keine Sorge: Niemand nimmt Schaden, wenn ihm frühzeitig Grenzen gesetzt werden. Im Gegenteil. Kinder, die nie in ihre Schranken verwiesen wurden, entwickeln sich zu kleinen Tyrannen und Nervensägen. Ihr ständiges Quengeln ist ein Hilferuf. Denn sie suchen dringend nach Halt und Orientierung.
Umgekehrt sollten sich die Eltern aber auch selbstkritisch fragen: Welche Regeln sind unbedingt notwendig und wo kann ich meinem Kind etwas mehr Freiraum lassen?
Übung 28. Lesen Sie den Text durch und erzählen Sie über die Probleme von Karin. Was würden Sie an Karins Stelle machen? Und an der Stelle der Eltern?
AUS DEM ELTERNHAUS AUSZIEHEN?
Paul: Da bist du ja endlich! — Was ist denn los mit dir? Du machst ja ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter!
Karin: Ach, lass mich in Ruhe!
Paul: Na, sag schon! Was ist denn los?
Karin: Zu Hause hat's Ärger gegeben.
Paul: So? Mit deinem Bruder?
Karin: Nein, mit meinen Eltern, wegen gestrigen Abends. Nur, weil ich erst um ein Uhr nach Hause gekommen bin.
Paul: Deswegen? Na hör mal, mit 19 kannst du doch tun und lassen, was du willst! Du bist doch kein kleines Kind mehr!
Karin: Das finde ich auch. Aber gestern Abend bin ich heimgekommen, da stand schon mein Vater da und regte sich furchtbar auf: «Was fällt dir eigentlich ein? Wo kommst du denn her? Du weißt doch, dass du nicht so spät nach Hause kommen sollst!»
Paul: Und dann habt ihr euch kräftig gestritten?
Karin: Gar nicht. Heute am Morgen habe ich gleich Christa angerufen und ihr alles erzählt. Sie meinte, ich solle doch einfach zu ihr ziehen, sie habe genug Platz. Was hältst du denn davon?
Paul: Also, bei mir ist das sowieso anders. Ich verstehe mich ja mit meinen Eltern gut, wir haben ein prima Verhältnis. Und da muss ich mich auch um nichts kümmern, habe mein Essen, die Wäsche wird mir gewaschen. Ich könnte mir gar keine eigene Wohnung leisten.
Karin: Natürlich, bequemer habe ich es auch bei meinen Eltern. Aber ich verzichte gern auf den vollen Kühlschrank und auf die Familie, die sich dauernd um mich Sorgen macht. Ich will meine Freiheit.
Paul: Und Miete musst du bei Christa doch auch zahlen? Oder kannst du dort umsonst wohnen?
Karin: Nein, so 200 Mark müsste ich zahlen. Das geht schon. Wenn's mit dem Geld knapp wird, verdiene ich mir eben am Wochenende was dazu – in dem Cafe um die Ecke, die brauchen immer eine Bedienung... [11]
Übung 29. Wie verstehen Sie folgende Aussage?
Die häusliche Erziehung darf nicht zu streng werden. Sonst gibt es noch einen zusätzlichen Grund, um das Haus zu verlassen und eine «feine» Gesellschaft zu suchen.
Übung 30. Hören Sie sich das Lied «Junge» von der deutschen Gruppe «Die Ärzte» an und ordnen Sie die Textstücke in der richtigen Reihenfolge an. Füllen Sie die Lücken aus.
Junge, warum hast du nichts ___?
Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein ___.
Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Wertstatt?
Der gibt dir ne Festanstellung – wenn du ihn ___ bittest
Junge ….
Und wie du wieder ___– Löcher in der Hose, und ständig dieser ___
(Was sollen die Nachbarn sagen?)
Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die ___ – musst du die denn färben?
(Was sollen die Nachbarn sagen?)
Nie kommst du nach ____, wir wissen nicht mehr weiter ….
Junge, brich deiner Mutter nicht das Herz
Er ist noch nicht zu spät, dich ___.
Du hast noch früher so für Tiere interessiert, wäre das nichts für dich
Eine eigene Praxis?
Junge ….
Und wie du wieder aussiehst – Löcher in der Nase, ___
(Was sollen die Nachbarn sagen?)
Elektrische Gitarren, und immer diese Texte – ___
(Was sollen die Nachbarn sagen?)
Nie kommst du nach Hause, so viel schlechter Umgang – wir werden dich enterben
(Was soll das Finanzamt sagen?)
Was soll das alles enden? ___
Und du warst so ein süßes Kind − 3 x
Du warst so süß
Und immer deine Freunde, ihr nehmt doch alle Drogen – und ständig dieser Lärm
(Was sollen die Nachbarn sagen?)
Denk an deine Zukunft, denk an deine Eltern – willst du, dass wir sterben?
Übung 31. Hören Sie sich das Lied in der Gruppe ein zweites Mal an und kontrollieren Sie gemeinsam, ob Sie die Textstücke in der richtigen Reihenfolge angeordnet haben.
Übung 32. Was kritisieren die Eltern an ihrem Sohn?
a) der Junge hört Musik zu laut; b) die Eltern mögen die Klaviermusik nicht, die der Junge oft hört; c) der Junge sitzt immer nur zu Hause in seinem Zimmer; d) die Musik gefällt den Eltern nicht; e) seine Kleidung ist kaputt; f) die Freunde helfen dem Sohn bei den Hausaufgaben nicht; g) der Junge hat ein Piercing in der Nase.
Übung 33. Die Eltern machen sich Sorgen um …..
a) die Noten des Sohnes; b) die Meinung der Nachbarn; c) die Zukunft ihrs Sohnes; d) die Ohren des Sohnes; e) die Gewohnheiten des Sohnes.
Übung 34. Der Junge interessiert sich für ... .
a) Musik; b) Tiere; c) Autos ; d) Kunst, e) Politik.
Übung 35. Welche Probleme haben der Sohn und die Eltern miteinander? Was möchte der Junge? Was wollen die Eltern? Bilden Sie zwei Gruppen (Eltern, Sohn) und erzählen Sie in der «Ich» oder «Wir»- Form: der Sohn: «Ich möchte gern ….» − die Eltern: «Wir wollen ….»
Übung 36. Welche Probleme hatten (haben) Sie mit Ihren Eltern?
Übung 37. Man kann folgendes hören:
Eltern und Kinder
ist das nicht ein Unterschied
wie Wasser und Feuer
wie Tag und Nacht
wie Ruhe und Bewegung
wie
???
Was können Sie noch hier hinzufügen? ( z. B. Himmel und Erde)
Übung 38. Man sagt, dass die Eltern und die Kinder in zwei verschiedenen Welten leben. Ist es so? Äußern Sie sich dazu!
Übung 39. Was denken Sie, gibt es Gründe dafür, dass Eltern und Kinder meist Probleme miteinander haben? Lassen sich Probleme zwischen Eltern und Kindern ganz vermeiden?
Übung 40. Lesen Sie den Text «Der kleine Erziehungsberater» durch. Analysieren Sie die Auswege aus jeder Situation. Wie finden Sie diese? Was würden Sie in solchen Situationen unternehmen? Gebrauchen Sie dabei die entsprechenden Konjunktivformen.
DER KLEINE ERZIEHUNGSBERATER
WIE ERKLÄRE ICH IHNEN, …
dass sie mir keine Unterhosen mehr kaufen?
Sag ihnen, dass du vor dem Sportunterricht in der Umkleidekabine wegen deiner Unterhosen beschimpft wurdest. Eine drastische Lüge ist nötig, denn die meisten Mütter wollen einfach nicht einsehen, dass man spätestens mit 13 keine bunten Tierfiguren mehr auf seiner Unterwäsche haben will.
dass es unmöglich ist, meine Freunde zu bitten, bei mir zu Hause die Schuhe auszuziehen?
Erkläre ihnen, dass Schuheausziehen auf jeden Fall unangenehm ist: Für deine Freunde, denn die haben immer Löcher in den Socken. Und für deine Eltern: Denn die müssen deine Freunde den ganzen Abend lang riechen.
dass ein Telefon zum Telefonieren da ist?
Was die Telefon-Gesellschaften mit ihrer Werbung nicht schaffen, musst du deinen Eltern selbst erklären: Viel telefonieren ist keine
Zeitverschwendung, sondern ein gutes Zeichen. Eltern wünschen sich immer, dass du viele Freunde hast. Häufiges Telefonieren ist nun mal der Preis dafür – noch nicht mal ein besonders höher. Jeden Abend ausgehen wäre viel teurer.
dass Musikvideos keine bleibenden Hirnschäden hinterlassen?
Sag deinen Eltern folgendes: «Wir leben in einer Welt, die über Bilder funktioniert. Wer Musikvideos schaut, kann schnellere Bilderfolgen sofort begreifen. Mein visuelles Verständnis wird trainiert. Und ich sehe Dinge, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt». Den letzten Satz weglassen, wenn du gerade mit ihnen über Drogen gesprochen hast.
dass ich auch mal die ganze Nacht lang ausgehen darf?
Gutes Argument für besorgte Eltern: Nachts um eins ist es in der Stadt viel gefährlicher als um halb fünf. Dann sind all die fiesen Schläger, Jackenklauer und U-Bahn-Randalierer nämlich schon längst im Bett.
dass sie mich laute Musik hören lassen?
Nichts fürchten Eltern mehr als die Beschwerden anderer Hausbewohner. Und weil dein Geschmack nie ihr Geschmack ist, fällt ihnen der Befehl zum Leisestellen leicht. Ein Ausweg: den technikbegeisterten Vater zum Boxenkaufen mitnehmen. Begriffe wie «Hochtöner» und «Subwoofer» beeindrucken ihn. Und er bekommt eine Ahnung davon, was Sound bedeutet.
dass sie vor meinen Freunden nicht meine Kindheitsgeschichten erzählen?
Verbünde dich mit den Großeltern. Lass dir von ihnen peinliche Geschichten aus der Kindheit deiner Eltern erzählen: Wie sie mit 17 noch Angst vor Schildkröten hatten und mit 15 keine Klassenarbeit ohne ihr Kuscheltier Willi schreiben wollten. Wenn deine Eltern merken, was du weißt, werdet ihr euch schnell über Diskretion einig sein.
dass sie nicht mein Zimmer aufräumen?
So tun, als würdest du dich nach der elterlichen Putzaktion überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Frage: «Wo ist nur mein Deutschaufsatz, der lag doch zwischen dem Playstation-Karton und den T-Shirts?» Eltern können zwar mit dem Chaos im Kinderzimmer kaum leben. Doch der Verdacht, sie hätten in ihrem Aufräumwahn etwas Wichtiges verschlampt, hemmt ihren Ordnungsfimmel.
dass ihr Essen auch dann gut schmeckt, wenn ich nur wenig mag?
«Du bleibst sitzen, bis aufgegessen ist». Den Satz kennt fast jeder. Gefährlich wird es, wenn auch Kinder Essen als Machtinstrument nutzen. Das kann zu Magersucht oder zu Bulimie führen. Es ist schwer, den Eltern klar zu machen, dass Essen dazu da ist, satt zu machen, und nichts mit Liebe oder Liebesentzug zu tun hat.
dass ich selbst sehr gut mit Geld umgehen kann?
Rede beim Abendessen über Zinsen, das schafft Vertrauen. Die erste größere Ausgabe sollte auch deine Eltern überzeugen. Lexika und Winterjacken werden schnell akzeptiert, Laptop und Flugreise nur dann, wenn auch die Oma hinter dieser Idee steht.
dass sie nicht meine Freunde sind, sondern meine Eltern?
Eltern wollen mit ihren Kindern befreundet sein. Kinder wollen, dass Eltern einfach Eltern sind. Nichts ist schlimmer als der Vater, der auch Kumpel sein will, oder die Mutter, die sich wie eine große Schwester aufführt. Sag deinen Eltern, dass du sie liebst und respektierst, aber viel eher Vorbilder brauchst als noch mehr Freunde.
dass eine Vier im Zeugnis noch lange keine Katastrophe ist?
Nutze die Autorität des Synonymwörterbuchs. Denn eine Vier ist immer noch «Ausreichend». Und das heißt schließlich «reichen, hinreichen, genügen, mit etwas auskommen, etwas zur Genüge haben, der Bedarf ist gedeckt, der Sättigungsgrad ist erreicht, langen, nicht hapern, ausreichend».
dass sie in politischen Fragen nicht automatisch Recht haben?
Versuche erst gar nicht, deine Eltern ganz auf deine Seite zu ziehen. Auch wenn du mehr Zeitung liest als deine Eltern und in Sozialkunde die Beste bist, solltest du wissen: Gegen Sätze, die mit «Früher war alles...» oder «Jeder vernünftige Mensch weiß, dass...» beginnen, lässt sich nur ein Unentschieden erreichen. Sieh es als Sieg.
dass sie nicht alles falsch gemacht haben?
Schlechte Noten, tätowierte Freunde: Oft glauben Eltern, dass sie bei deiner Erziehung versagt haben. Sage ihnen die Wahrheit: dass du sie liebst und ihr Sohn/ihre Tochter bleibst, egal was passiert, dass sie die besten Eltern der Welt sind, und dass du froh darüber bist, was sie aus dir gemacht haben. Wenn das nichts hilft, fang an, den Müll runterzubringen [11].
Übung 41. Im Artikel «Der kleine Erziehungsberater» haben Sie Tipps erhalten, wie man die Eltern von etwas überzeugen kann. Sicherlich haben Sie auch selbst schon Erfahrungen gesammelt, wie Sie am besten mit Ihren Eltern umgehen, wenn Sie etwas Bestimmtes erreichen möchten... Teilen Sie den anderen Lernenden Ihre Erfahrungen mit und lesen Sie, was sie Ihnen raten möchten.
Übung 42. Wählen Sie zwei der folgenden Themen aus und schreiben Sie Ihre Tipps als einen kurzen Beitrag in das jetzt-Aufgabenforum. Lesen und kommentieren Sie auch die Beiträge der anderen Lernenden.
Wie würden Sie Ihren Eltern erklären, dass …
– sie Ihr Zimmer nicht aufräumen sollen?
– sie nicht Ihre Freunde sind, sondern Ihre Eltern?
– Sie gut mit Geld umgehen können?
– Sie auch mal die ganze Nacht lang ausgehen dürfen?
– sie Sie laute Musik hören lassen sollen?
– sie in politischen Fragen nicht automatisch Recht haben?
– sie vor Ihren Freunden Ihre Kindheitsgeschichten nicht erzählen sollen?
Übung 43. Unterstreichen Sie in jedem der Beiträge jene Wörter und Wortgruppen, mit denen verdeutlicht wird, worum es beim «Generationenkonflikt» geht. Fassen Sie nun unter dem Titel «Generationenkonflikt» in Stichwörtern Ihre Ergebnisse zusammen und präsentieren Sie sie vor der Gruppe. Ordnen Sie Ihre Ergebnisse nun in einer Tabelle:
Persönliche Auswirkungen des Generationenkonflikts |
Gesellschaftliche Auswirkungen des Generationenkonflikts |
|
|
Übung 44. Sprechen Sie zum folgenden Thema «Kleine Kinder, kleine Sorgen; große Kinder, große Sorgen». Schreiben Sie einen Aufsatz dazu.
Übung 45. Nehmen Sie Stellung zu der folgenden Aussage: «Erwachsene beschäftigen sich zu wenig mit den Problemen von Jugendlichen, sondern viel mehr mit den Problemen, die ihnen Jugendliche machen».
JUGENDPROBLEME
Übung 1. Man sagt: «Wo Jugend ist, da gibt es Jugendprobleme». Sind Sie damit einverstanden?
Übung 2. Was fällt Ihnen zum Thema «Jugendprobleme» ein? Wie sind die Probleme der Jugendlichen? Sammeln Sie sie zu einem Assoziogramm.

Übung 3. Seit vielen Jahren schreiben die Jugendlichen an die Sorgenbrief-Redaktion von «Treff». Täglich kommen neue Briefe mit großen und kleinen Sorgen dazu. Lesen Sie die Probleme von Mädchen und Jungen. Stellen Sie fest, welche Probleme am häufigsten sind.
PROBLEME DER JUGENDLICHEN:
zu dick oder zu dünn sein; die Freunde interessieren sich nicht mehr für einen; die Geschwister werden von den Eltern besser behandelt; man wird von den anderen ausgelacht, weil man verliebt ist; man macht sich um die Geschwister Sorgen; schüchtern sein und schnell rot werden; die Eltern verbieten einem zu viel; keine Freunde haben; Angst haben, den Freund oder die Freundin zu verlieren; nicht erwachsen genug aussehen; man streitet sich oft mit dem Freund oder der Freundin; nicht wissen, wie man einen Freund oder eine Freundin finden kann; den Freund oder die Freundin verloren haben; Probleme in der Schule haben; schlechte Noten bekommen; Pickel im Gesicht haben.
Übung 4. Was meinen Sie zu den Problemen aus den Sorgenbriefen? Über welche Probleme würden Sie an die Sorgenbrief-Redaktion von «Treff» schreiben?
Übung 5. Besprechen Sie in kleinen Gruppen «Was ist die Sucht?». Vergleichen Sie Ihre Definitionen mit denen unten.
Die Sucht ist:
‒ der Zustand, in dem man bestimmte schädliche Gewohnheiten nicht mehr ändern kann;
‒ die Abhängigkeit von z. B. Alkohol, Rauchen und anderen schlechten Gewohnheiten.
Übung 6. Beantworten Sie folgende Fragen.
1. Haben Sie Probleme in Ihrem Leben? Wenn ja, dann womit sind diese Probleme verbunden? 2. Schimpfen Ihre Eltern wegen etwas? 3. Loben Ihre Eltern Sie oft? 4. Erlauben Ihnen Ihre Eltern alles? 5. Gehorchen Sie Ihren Eltern immer? 6. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, mit wem sprechen Sie (mit den Freunden, mit den Eltern, mit den Verwandten, mit den Lektoren)? 7. Könnten Sie sagen, dass Ihre Eltern Ihre Freunde sind? 8. Es gibt noch eine Möglichkeit, Probleme zu lösen. Das ist das Sorgentelefon. Warum rufen Kinder und Jugendliche beim Sorgentelefon an?
Übung 7. Lesen Sie die Textе und stellen Sie fest, womit oder mit wem die Jugendprobleme verbunden sind. Erlernen Sie vor dem Lesen den folgenden Wortschatz zu den Texten:
der Alltag; auf seine eigene Art und Weise; aufhören; fliehen (o, o) vor D.; gegenseitig; greifen (i, i); locker; rasch; sich auseinander setzen mit D.; das Verhältnis; etw. Akk. gestalten; j-m D. beistehen (a, a); j-n unterstützen; der Mangel an D.; widersprüchlich; gleichgültig; die Resignation; ewig
TEXT 1. DIE JUGENDPROBLEME
Viele junge Leute haben Probleme in der Schule und zu Hause. Sie haben oft das Gefühl, dass sie allein gelassen, nicht verstanden werden.
Die Erwachsenen haben immer weniger Zeit für ihre Kinder. Sie können nicht zuhören, sind nervös und denken, sie wissen alles besser. Die Kinder-Eltern-Beziehung wird immer lockerer und es gibt kein gegenseitiges Vertrauen. Die Jugendlichen müssen sich mit allen Problemen alleine auseinander setzen und sie alleine lösen. Sie versuchen auf ihre eigene Art und Weise vor der Realität zu fliehen und greifen zu Drogen, mit denen sie sich glücklich fühlen. Die Sucht beginnt mit weichen Drogen, dann steigt man auf harte Drogen um. Dann beginnen die Probleme mit dem Geld für die Drogen und niemand hilft ihnen, weil die Erwachsenen ihre Probleme haben.
Wegen schlechter Familienverhältnisse und Probleme in der Schule, in der Gesellschaft greifen die Jugendlichen zur Flasche und zur Zigarette. Jugendliche, die rauchen, gehören heute zum Alltag. Fast alle Probleme sind lösbar, wenn sie rechtzeitig erkannt werden. Deshalb ist es eine große Kunst, miteinander zu reden. Man muss lernen, sich gegenseitig zuzuhören und sich gegenseitig zu verstehen.
TEXT 2. DIE JUGENDPROBLEME
Wo Jugend ist, da gibt es Jugendprobleme. Die jungen Menschen sollen ihr Leben selbst gestalten lernen. Sie sollen ihren Platz in Beruf und in Gesellschaft finden und ihre Persönlichkeit entwickeln können. In diesem Sinne muss die Stadt jungen Menschen beistehen und sie unterstützen.
Es gibt hier aber viele Probleme. Es ist für Jugendliche heute nicht leicht, ihren Weg in unserer Gesellschaft zu finden. Dazu gehört vor allem solches Problem, wie der Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.
Die Reaktion der jungen Generation auf diese Probleme ist widersprüchlich. Einerseits wächst die Bereitschaft zur Arbeit und erhöht sich die Aktivität der jungen Menschen. Andererseits gibt es auch sehr viele Jugendliche, die gleichgültig sind. Oft gewinnen Resignation, Desinteresse an alles. Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl jener Jugendlichen, die im Alkohol, in Drogen und in kriminellen Taten einen Ausweg suchen.
Das sind so zu sagen Globalprobleme. Und wie viele gibt es Sonderfälle. Z. B. die erste Liebe, manchmal wird das zu einer Tragödie. Oder Konflikte zwischen Generationen. Einige haben Probleme mit dem Erwachsenwerden. Erwachsen werden ist für sie nicht mehr abhängig zu sein, sich von Eltern zu lösen. Also, wieder das ewige Problem [5].
Übung 8. Verbinden Sie die Satzteile.
1 |
Viele Jugendliche … |
Ё |
haben Sorgen |
2 |
Die Erwachsenen … |
b |
weil es kein gegenseitiges Vertrauen gibt |
3 |
Es ist schwer, … |
c |
nehmen sie Tabletten und greifen zur Spritze |
4 |
Es gibt Probleme in den Familien … |
d |
haben viel zu tun |
5 |
Zuerst kiffen die Jugendlichen, dann … |
e |
andere Leute zu verstehen |
Übung 9. Beantworten Sie folgende Fragen.
1. Haben die Eltern genug Zeit für ihre Kinder? 2. Warum greifen die Kinder zu Drogen? 3. Hilft die Kontrolle in der Schule, in der Gesellschaft und zu Hause? 4. Wie meinen Sie, gibt es unlösbare Probleme? 5. Was ist eine große Kunst?
Übung 10. Drücken Sie den Inhalt folgender Sätze anders aus.
1. Einige Kinder sind einsam. 2. Die Erwachsenen haben viel zu tun. 3. Einige Jugendliche rauchen und trinken Alkohol. 4. Es ist schwer einander zu verstehen. 5. Die Kinder werden drogensüchtig.
Übung 11. Vollenden Sie folgende Sätze.
1. Jugendliche fühlen sich einsam, weil … . 2. Viele Erwachsene kümmern sich nicht um ihre Kinder, weil … . 3. Einige Jugendliche werden drogensüchtig, weil … . 4. Die meisten Jugendlichen rauchen und trinken Alkohol, weil … .
Übung 12. Stellen Sie sich vor: Ihr Freund ist drogensüchtig. Geben Sie ihm 10 Ratschläge. Gebrauchen Sie dabei das Modalverb müssen oder Imperativform (2 P. Sing.).
Übung 13. Drei Viertel der Jugendlichen denken, dass nur wenige Erwachsenen Verständnis für Jugendliche haben. Man lernt mehr von Freunden und Freundinnen, sagen sie. Sind Sie damit einverstanden? Begründen Sie Ihre Meinung.
Übung 14. Drücken Sie Ihre Meinung zu den Problemen unten aus.
1. Erwachsene können viel dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche keine Drogen gebrauchen. 2. Über Sucht und Drogen muss man offen sprechen. 3. Man muss den Drogenverkauf legalisieren, das führt zum Zusammenbruch des Schwarzmarkts und Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten wie AIDS.
Übung 15. Lesen Sie die Ratschläge von den Jugendlichen an die Jugendlichen. Welchen Ratschlägen können Sie zustimmen, welchen nicht? Warum? Welche Ratschläge würden Sie den anderen Jugendlichen geben?
1. Wenn du selbst im Leben nichts unternimmst, helfen dir keine Drogen. 2. Drogen verstärken nur die positiven und negativen Stimmungen, die du schon in dir hast. 3. Jede Droge ändert nur deine Psyche. 4. Jeden Tag oder jedes Wochenende Drogen zu nehmen, ist keine gute Idee. 5. Schütze dich vor Gift! 6. Das Trinken von Alkohol erhöht die Gefahr des Austrocknens. 7. Jede Droge hat ihren Preis. 8. Achte darauf, dass sie nicht dein Leben kostet. Es ist zu teuer.
Übung 16. «Was soll ich machen?» Versetzen Sie sich in die Rollen der Psychologen und geben Sie den Jugendlichen bestimmte Ratschläge.
Die Mitschülerinnen und Mitschüler lachen mich sehr oft aus, wenn ich an der Tafel stehe und nicht antworten kann. Ich schwänze oft den Unterricht, um mich mit meinen Schulkameraden nicht zu treffen. (Sabine)
Mein Banknachbar verlangt immer von mir in der Pause Taschengeld. Ich habe aber keins. Ich habe schon Geld zu Hause gestohlen. Weiter will ich das nicht machen. (Volker)
Keiner mag mich. Vielleicht, weil ich vielseitig talentiert bin. Ich kann gut malen, tanzen. Ich beherrsche gut Mathematik und Fremdsprachen. Das alles führt zu Konflikten, obwohl ich den anderen gegenüber lustig und nett bin. Wenn die Lehrer mich loben, ist das am schlechtesten. Meine Mitschüler lachen mich aber aus. Ich habe Angst, dass mich jemand lobt. Was soll ich machen? (Ines)
Übung 17. Sorgentelefon «Rat und Tat für junge Leute». Versuchen Sie den Jugendlichen zu helfen.
Marianne, 13 Jahre: Ich habe jetzt schon seit etwa 3 Wochen einen Freund, mit dem ich mich gut verstehe. Aber ich weiß nicht, wie ich meinen Eltern sagen soll. Es ist mein erster Freund und ich habe Angst, dass sie was dagegen haben. Können Sie mir helfen, wie ich das meinen Eltern sagen soll?
Tobias, 15 Jahre: Ich habe ein richtiges Problem. Ich habe mich in ein Mädchen verliebt. Aber wenn ich verliebt bin, werde ich total schüchtern. Ich traue mich sogar nicht sie zu Eis einzuladen. Was kann ich dagegen tun?
Tina, 6 Jahre: Meine Freundin und ich, wir sind beide in einen Jungen aus unserer Klasse verliebt. Ich habe ihm schon zweimal geschrieben und er hat mir auch geantwortet. Doch, dann hat er nicht mehr mit mir geredet, weil ich das Versprechen, meiner Freundin nichts zu erzählen, nicht gehalten habe. Er hat kein Vertrauen zu mir. Was soll ich nun machen? [9]
Übung 18. Lesen Sie das chinesische Sprichwort. Welche Einstellung zur Arbeit drückt es aus?
Wenn du eine Stunde glücklich sein willst, schlafe. Wenn du einen Tag glücklich sein willst, gehe fischen. Wenn du eine Woche glücklich sein willst, schlachte ein Schwein und erzähle es. Wenn du ein Jahr glücklich sein willst, habe ein Vermögen. Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, liebe deine Arbeit.
Übung 19. Überlegen Sie sich, wie ein Jugendlicher sein soll. Denken Sie dabei an die Probleme wie:
die Schule; b) zu Hause; c) die Freunde; d) das Geld
Übung 20. Lesen Sie den Text, um mehr Informationen über die Probleme der Jugendlichen zu erhalten.
PROBLEME DER JUGENDLICHEN
Die jungen Menschen leben heute in einer Welt, die sich in einem vorher nie gekannten Tempo verändert. Die Jugendlichen müssen sich darauf einstellen. Die Menschen des 21. Jahrhunderts werden anders sein, andere Ziele verfolgen, andere Werte entwickeln. Was die Medien, die Computer und «Kommunikationstechnologien» bewirken, kann man heute nicht absehen. Wenn Jugendliche dafür Faszinationen und Interessen entwickeln, sollten die Erwachsenen das akzeptieren. Die jungen Menschen haben aber oft das Gefühl, dass man sie nicht versteht. Sie möchten z. B. viel fern sehen, aber die Eltern setzen beim Fernsehen die Grenzen. Sie suchen die Gesprächspartner zuerst zu Hause, und fühlen sich nicht ernst genommen, wenn die Eltern ihnen sofort «sehr gute» Ratschläge geben.
Sie haben vor den Eltern Angst, wenn sie schlechte Noten in der Schule bekommen haben. Für einige sind das mindestens drei Wochen Hausarrest. Eltern hören nicht auf, Sohn oder Tochter wie kleine Kinder zu behandeln, wollen sie erziehen, ihnen den richtigen Weg weisen. Die Eltern fühlen sich auch beunruhigt, wenn ihr Kind ein ganz anderes Leben führt, als sie es selber gewohnt sind. Oft sollen die Kinder das verwirklichen, was den Eltern nicht gelungen ist. Sie sollen in der Schule besser lernen, um später der bedeutende Ingenieur oder die bekannte Ärztin zu werden. Die Eltern betrachten ihr Kind als «Fortsetzung» ihrer eigenen Person. Es fällt den Eltern schwer, sich von solchen Erwartungen frei zu machen. Die Kinder hören oft: «Du sollst es mal besser haben als wir! Ich konnte nicht studieren, also tu du es jetzt!» Selbstverständlich gefällt das den Kindern nicht. Sie haben oft Angst vor diesen Worten.
Wenn das Vertrauen in der Familie fehlt, versuchen Jugendliche auf ihre eigene Art und Weise ihre Probleme zu lösen. Es beginnt oft mit der Droge Haschisch. Die wird von Bekannten empfohlen. Diese Droge bewirkt psychische Abhängigkeit. Manchmal greifen die Jugendlichen zum Heroin. Heroin macht sie seelisch und körperlich absolut abhängig. Solches Gift macht den Jugendlichen arbeitsunfähig. Der junge Mensch spritzt oft Heroin mit verschmutzten Spritzen. Die Folgen sind schwere Krankheiten, zu denen auch AIDS gehört.
Der Alkoholgenuss unter der Jugend steigt. Zehn Prozent aller Kinder unter 15 Jahren nehmen täglich Bier, Wein oder Schnaps zu sich. Einige sind schon alkoholkrank.
Viele Menschen sind der Meinung, dass die Familie wirklich schuld ist, wenn ein junger Mensch auf die schiefe Bahn kommt. In manchen Familien haben die Kinder kein richtiges Vorbild, weil ihre Eltern trinken. In solchen Familien werden die Kinder oft den ganzen Tag sich selbst überlassen. Es gibt aber auch Jugendliche, die aus guten Familien stammen und auf die schiefe Bahn kommen. Ihre Eltern kümmern sich nur um Essen und Kleidung der Kinder. Sie nehmen sich keine Zeit, um sich mit den Problemen ihrer Tochter oder ihres Sohnes auseinander zu setzen. Oft fliehen die Jugendlichen von zu Hause, weil sie satt von der häuslichen Erziehung sind.
Mit 16 Jahren sind einige Kinder verliebt. Flirten macht ihnen viel Spaß. Erste Liebe – wunderbar! Aber erster Sex? Da kommt bei allen Eltern Panik auf. Was darf man erlauben? Was soll man verbieten? Und was ist, wenn der erste Freund der Tochter (die erste Freundin des Sohnes) den Eltern absolut überhaupt nicht gefällt? Na, ja. Im Regelfall ist die erste Liebe etwas sehr Schönes, und das sollten die Eltern dem Kind keinesfalls kaputtmachen.
Jugendliche wollen etwas jobben, um ihr Taschengeld zu haben. Zurzeit ist es keine Seltenheit. Einige Eltern freuen sich über die Initiative ihrer Kinder. Andere sind damit nicht einverstanden. Sie haben Angst, dass ihr Kind in schlechte Gesellschaft gerät und die Leistungen der Schüler darunter leiden werden.
Solche Probleme haben unsere Jugendlichen. Alle Probleme sind aber lösbar, wenn das Vertrauensverhältnis stimmt. Man muss diese Probleme zeitig erkennen und sofort erklären versuchen. Es gibt auch für die Jugendlichen einen Ausweg. Das ist das Sorgentelefon. Wenn sie Probleme haben, können sie die «Telefonnummer des Vertrauens» wählen [2].
Übung 21. Im Text kommen folgende Komposita vor. Klären Sie die Bedeutung dieser Begriffe.
Das Vertrauensverhältnis, das Zeitungsaustragen, das Sorgentelefon, die Werktage, das Taschengeld, der Alkoholgenuss, der Gesprächspartner, die Kommunikationstechnologien.
Übung 22. Sagen Sie, ob folgende Aussagen dem Inhalt des Textes entsprechen.
1. Die Jugendlichen leben in einer Welt, die sich in einem vorher nie gekannten Tempo verändert. 2. Die jungen Menschen sind mit den «sehr guten» Ratschlägen ihrer Eltern zufrieden. 3. Die Eltern befürchten, dass sich ihr Kind von ihnen entfernen wird und dass sie es schließlich verlieren können. 4. Bestimmte Probleme gibt es auch, wenn die Eltern ihr Kind als «Fortsetzung» ihrer Person betrachten. 5. Die Eltern wollen ihre eigenen, aber nicht erfüllten Lebensideale durch ihre Kinder verwirklicht sehen. 6. Einige Eltern kümmern sich sehr wenig um ihre Kinder. Deshalb bemühen sich die Kinder, selbst etwas zu «erledigen». Sie kommen oft in eine schlechte Gesellschaft. 7. Oft fliehen die jungen Menschen von zu Hause, denn sie haben satt von den ständigen Belehrungen. 8. Einige Eltern können ihren Kindern das Jobben verbieten, denn sie haben Angst, dass ihr Kind in schlechte Gesellschaft gerät.
Übung 23. Beantworten Sie folgende Fragen.
1. Welchen Einfluss hat die Entwicklung der Technik auf die neuen Generationen? 2. Welche Faktoren wirken sich negativ auf die Jugendlichen aus? 3. Was wissen Sie vom Alkoholmissbrauch bei den Jugendlichen und dessen Folgen? 4. Wie sieht das Problem der Drogensucht in Ihrem Land aus? 5. Auf welche Art und Weise versucht die heutige Jugend Ihre Probleme zu lösen? 6. Was erwarten die Eltern von ihren Kindern? 7. Wie wurden Sie erzogen? Wie waren Ihre Eltern zu Ihnen? 8. Warum sollten die Kinder ihre eigenen Wege gehen? 9. Was tut man oder möchte man tun, wenn man Probleme hat und keinen Ausweg findet? Äußern Sie Ihre Meinung dazu.
Übung 24. Schreiben Sie die Ratschläge Ihren Eltern, gebrauchen Sie dabei die angegebenen Wörter und Wortverbindungen. Gebrauchen Sie dabei Imperativ.
1. Tolerant sein, zu ihren Kindern. 2. Gewalt, gebrauchen, Sie, keine. 3. Hart, bleiben, ihr Kind, ausprobieren, zum ersten Mal, Alkohol, wenn. 4. Sich aufregen, wenn, zu spät, heimkommen, ihr Kind. 5. Monatlich, eine bestimmte Geldsumme, geben, ihm. 6. Aufhören, ihre Tochter, wie ein kleines Kind, behandeln. 7. Enttäuscht sein, wenn, ihre Kinder, gehen, eigene Wege. 8. Sich klar machen, dass, kein Besitz, ihr Sohn, sein. Haben, Sie, ein Recht, ihr eigenes Leben, auf. 9. Sein, ihrer Tochter, Gesprächspartner, zu Hause.
Übung 25. Stellen Sie sich vor, dass Sie Regisseur sind und einen Film über die moderne Jugend drehen. Worüber wird dieser Film?
Übung 26. Stellen Sie sich vor, dass Sie Polizisten sind. Wie werden Sie mit den problematischen Jugendlichen sprechen?
Übung 27. Ergänzen und erklären Sie die Ausdrücke und Sprichwörter.
1. Anderer Fehler sind … . 2. Den Kopf halt kühl, die Füße warm, das macht den besten … . 3. Erst denken, dann … . 4. Zu wenig und zu viel verdirbt alles … . 5. Führe Jugend mit der … .
RAUCHEN
Übung 1. Rauchen ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Woraus es entsteht, erklären Ihnen die Fachmänner. Lesen Sie den Text und schreiben Sie die unbekannten Wörter heraus.
M
 IT
ZEHN DIE ERSTE ZIGARETTE
IT
ZEHN DIE ERSTE ZIGARETTE
Niemand kommt als Raucher auf die Welt. Jeder fängt einmal mit dem Rauchen an, die meisten mit 10, 11 oder 12 Jahren. Manche sogar noch früher. Geraucht wird heimlich im Kreis von Spielkameraden, aus Neugier, um die Erwachsenen zu imitieren. Aber auch, um von den anderen in der Gruppe akzeptiert zu werden.
Normalerweise endet dieser erste Kontakt mit der Zigarette jedoch nach kurzer Zeit. Die nächsten Raucherfahrungen werden im Allgemeinen zwischen 14 und 16 gesammelt. Viele rauchen in diesem Alter, ohne darüber nachzudenken, bloß weil es die anderen auch tun und weil Arbeitskollegen, Mitschüler und ältere Bekannte jetzt großzügig Zigaretten anbieten. «Zug um Zug» schlittern sie so in den regelmäßigen Zigarettenkonsum hinein. Andere rauchen ganz bewusst und konsequent, um ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren oder aus Imponiergehabe gegenüber dem anderen Geschlecht.
DREI TYPEN VON RAUCHERN
Der Genussraucher raucht, weil ihm seine Zigarettensorte schmeckt. Er steckt sich zum Beispiel beim Kaffeetrinken, beim Zeitunglesen oder wenn er mit guten Freunden zusammen ist, eine Zigarette an. Auch wenn er sich entspannt oder einen persönlichen Erfolg «feiern» möchte. Es macht ihm Spaß, den Rauch auszublasen und den Rauchkringeln nachzusehen. Da er nur gelegentlich zur Genusssteigerung raucht, ist die Abhängigkeit von der Zigarette bei diesem Rauchertyp nicht sehr stark ausgeprägt.
Der Gewohnheitsraucher raucht regelmäßig in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Tätigkeiten. Zum Beispiel immer nach dem Essen und beim Fernsehen. Oder jedes Mal während der Fahrt zur Arbeitsstelle. Andere typische Rauchsituationen: geschäftliche Besprechungen, Wartepausen usw. Viele tägliche Gewohnheiten werden so eng mit dem Rauchen verknüpft, dass sie das Anzünden einer Zigarette zu einer ganz automatischen Handlung werden lassen.
Der Erleichterungsraucher raucht, um besser mit negativen Stimmungen fertig zu werden. Er raucht vor allem, wenn er nervös, gereizt oder niedergeschlagen ist. Ebenso, wenn er in Schwierigkeiten gerät und Sorgen ihn belasten. Das Rauchen verschafft ihm einen Moment lang ein Gefühl der Erleichterung. Der Druck, die Anspannung lassen nach, wenn auch nur für einen Augenblick. Dieses Erlebnis führt zu einer starken psychischen Abhängigkeit [14].
Übung 2. Erklären Sie folgende Ausdrücke aus dem Text und führen Sie dann Beispiele damit an.
a) von den anderen akzeptiert werden; b) negative Stimmung; c) das Gefühl der Erleichterung; d) starke psychische Abhängigkeit; e) die Unabhängigkeit demonstrieren; f) die Abhängigkeit ausprägen.
Übung 3. Prüfen Sie Ihr Textverständnis. Beantworten Sie die Fragen zum Text.
1. Wann und aus welchem Grund beginnt man zu rauchen? 2. Wie lange dauert der erste Kontakt mit der Zigarette? 3. Warum rauchen die Jugendlichen im Alter von 14-15 Jahren? 4. Wozu führen die positiven Erfahrungen mit dem Rauchen? 5. Welche 3 Typen der Raucher nennen die Fachmänner? 6. Kennen Sie solche Menschen in Ihrer Umgebung? Bestimmen Sie, zu welchem Typ der Raucher diese Menschen gehören, und erklären Sie warum?
Übung 4. Schreiben Sie aus den Texten die Verben mit den trennbaren und untrennbaren Präfixen in zwei Spalten heraus. Bilden Sie Grundformen von diesen Verben.
Übung 5. Im Text gibt es einige Nebensätze. Nennen Sie solche Sätze und bestimmen Sie die Art der Nebensätze.
Übung 6. Bilden Sie aus zwei einfachen Sätzen ein Satzgefüge der angegebenen Art. Achten Sie auf die Wortfolge.
1. Schon Zwölfjährige beginnen zu rauchen. Sie wollen die Erwachsenen imitieren. (Kausalsatz) 2. Die nächsten Raucherfahrungen werden später gesammelt. Die Jugendlichen sind 14-16 Jahre alt. (Temporalsatz) 3. Viele rauchen in diesem Alter. Sie denken über die Gefahr nicht nach. (Modalsatz) 4. Das Rauchen wird besonders leicht zur Gewohnheit. Die Jugendlichen überwinden immer mit einer Zigarette Unsicherheit und nervöse Spannungen. (Bedingungssatz) 5. Es gibt mehrere Motivgruppen für das Rauchverhalten. Der Abhängigkeitsgrad von einer Zigarette wird immer höher. (Vergleichssatz) 6. Viele Jugendlichen und Erwachsenen rauchen. Sie verstehen, dass diese Gewohnheit schädlich ist. (Konzessivsatz)
Übung 7. Im Text werden einige Verben in verschiedenen Passivformen gebraucht. Schreiben Sie diese heraus und bilden Sie weitere mögliche Passivformen.
Präsens |
Präteritum |
Perfekt |
Plusquamperfekt |
Futur I |
wird geraucht
… |
wurde geraucht
… |
ist geraucht worden
… |
war geraucht worden
… |
wird geraucht werden … |
Übung 8. Stellen Sie die Gliederung zum Text zusammen und erzählen Sie ihn nach.
Übung 9. Es gibt 3 drei Typen von Rauchern. Wie meinen Sie, welchem Typ ist es leichter mit dem Rauchen aufzuhören?
Übung 10. Lesen Sie die Meinungen der Jugendlichen über das Rauchen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Ist das Rauchen wirklich eine Sucht? Begründen Sie Ihre Meinung.
RAUCHEN IST EINE SUCHT
Der Raucher ist physisch und psychisch von Zigaretten abhängig. Die meisten Raucher wollen nicht zugeben, dass sie süchtig oder abhängig sind. Sie behaupten, sie können jeden Tag das Rauchen aufhören.
In Deutschland dürfen Jugendliche unter 16 Jahren in der Öffentlichkeit nicht rauchen. Aber wir rauchen heimlich hinter dem Schulgebäude. Wer denkt an die Gesundheit? Die Krankheiten kommen erst später. Es interessiert mich nicht, was morgen kommt. Ich will mein Leben heute genießen (Sarah, 15 Jahre).
Ich habe Angst zu rauchen. Ich weiß, Nikotin stört Wachstum und zerstört das Gedächtnis. Ich möchte im Leben meine Karriere machen und gut lernen (Frank, 12 Jahre).
R
 auchen
gehört bei mir zum Alltag. Morgens rauche ich eine Zigarette. Heute
ist das meistens eine Schachtel am Tag. Die Zigaretten kosten teuer
und ich gehe deshalb putzen. Ich habe Angst. Ich riskiere meine
Gesundheit und rauche, weil ich schlank sein will. Aber wenn ich
nicht rauche, bin ich nervös und aggressiv. Ich weiß, dass ich
schon rauchsüchtig bin
(Tina,
16
Jahre).
auchen
gehört bei mir zum Alltag. Morgens rauche ich eine Zigarette. Heute
ist das meistens eine Schachtel am Tag. Die Zigaretten kosten teuer
und ich gehe deshalb putzen. Ich habe Angst. Ich riskiere meine
Gesundheit und rauche, weil ich schlank sein will. Aber wenn ich
nicht rauche, bin ich nervös und aggressiv. Ich weiß, dass ich
schon rauchsüchtig bin
(Tina,
16
Jahre).
Wir rauchen in der Schule. Viele Schulen haben Raucherecken oder Raucherzimmer für ihre älteren Schüler. Rauchen beruhigt mich. Ich rauche in der Schule mehr als zu Hause. Meine Eltern sind gegen das Rauchen. Aber ich bin dick (Kirsten, 18 Jahre).
Meine Familie weiß nicht, dass ich geraucht habe. In meiner Familie sind alle Nichtraucher. Ich habe nur kurze Zeit geraucht, aber viel. Da habe ich mir gesagt: Jetzt ist Schluss. Und seit dieser Zeit rauche ich nicht mehr. Es fiel mir nicht schwer aufzuhören. Ich habe mich von einer Sucht befreit und bin jetzt glücklich. Meine Haut ist besser geworden, nicht so grau (Claudia, 19 Jahre).
In Deutschland rauchen mehr Mädchen als Jungen. Das ist nur eine Frage der Emanzipation. Die Industrie darf im Fernsehen und im Radio nicht für Zigaretten werben. Viele Menschen fordern ein strenges Werbeverbot der Zigaretten und einen besseren Nichtraucherschutz. Nichtraucherzonen gibt es in Restaurants. Rauchverbot ist in Straßenbahnen, Bussen, U-Bahnen, in öffentlichen Gebäuden, Banken, bei der Post (Hans-Günter, 16 Jahre) [7].
Übung 11. Steht das im Text oder nicht?
1. Rauchen ist eine Sucht. 2. Wenn man raucht, wird man schlank und schön. 3. Wenn man raucht, genießt man das Leben. 4. Nikotin zerstört die Gesundheit. 5. In Deutschland rauchen mehr Jungen als Mädchen. 6. Nichtraucher müssen besser geschützt werden.
Übung 12. Schreiben Sie aus dem Text heraus: a) Gründe für das Rauchen und für das Nichtrauchen; b) Stellen Sie sich vor: Sie haben einen Freund aus Deutschland, mit dem Sie im Briefwechsel stehen. Er hat Ihnen im letzten Brief mitgeteilt, dass er heimlich raucht. Schreiben Sie an ihn auch einen Brief zu den folgenden Punkten:
a) wie Sie diese Gewohnheit finden; b) ob Sie schon Erfahrungen damit gemacht haben; c) welche Ratschläge Sie Ihrem Freund geben können?
Übung 13. Im Text ist ein Bild dargestellt. Sehen Sie sich dieses an. Wofür wird hier Werbung gemacht? Sind Sie persönlich für oder gegen das Rauchen? Präsentieren Sie Ihre Meinung auch in Form eines Plakats. Arbeiten Sie in kleinen Untergruppen.
Übung 14. Warum sind einige Jugendliche rauchsüchtig? Das sind einige Gründe. Ergänzen Sie diese.
Langweile im Alltag – fehlendes Vertrauen – unerfüllte Wünsche – keine gute Atmosphäre in der Familie ...
Übung 15. Viele Menschen verstehen nicht, dass Rauchen sehr gefährlich, unschön, schlimm, falsch usw. ist. Warum? Lesen Sie und informieren Sie sich. Sagen Sie, ob Sie es gewusst haben oder ob Sie darüber zum ersten Mal gelesen haben. Gebrauchen Sie in den Antworten folgende Kommunikationsformeln:
Es ist allgemein bekannt, dass …; ich wusste ganz genau, dass …; es war für mich keine Neuigkeit, dass …; unbestreitbar ist, dass …; aus meinem persönlichen Erlebnis (aus meiner Erfahrung) weiß ich, das …; es steht außer Zweifel, dass …; für mich gibt es keinen Zweifel, dass …
Ich habe erfahren, dass …; ganz neu für mich war es, dass …; ich konnte mir sogar nicht vorstellen, dass …; es ist kaum zu glauben, warum …
Rauchen wird trotz intensiver Warnungen in seiner Wirkung von vielen unterschätzt oder verharmlost. Dabei entstehen beim Verbrennen einer Zigarette über 4.800 chemische Stoffe, die teilweise als extrem giftig und Krebs erregend gelten. Sie verursachen nicht nur Krankheiten, sondern sind auch Auslöser vieler Todesfälle.
Schlimm ist, dass 90 Prozent aller Todesfälle durch Lungenkrebs auf das Rauchen zurückzuführen sind. Alle acht Sekunden stirbt auf der Welt ein Mensch als Folge des Rauchens.
Gefährlich ist, dass Zigaretten einen starken Einfluss auf die Knochendichte haben! Bereits bei 18- bis 20-jährigen Raucherinnen und Rauchern ist eine Schwächung der Knochen durch Nikotin festzustellen. Auch Passivrauchen vermindert die Knochendichte. Vermehrte Knochenbrüche können die Folge sein.
Schlecht ist, dass für Raucherinnen und Raucher das Risiko, an Diabetes (Zuckerkrankheit) zu erkranken, bis zu 70 Prozent höher ist als für Nichtraucher.
Falsch ist, dass Rauchen dem Körper als Entspannung dient. Wenn man raucht, reagiert der Körper sofort! Der Puls steigt, der Atem wird schneller und flacher und der Kreislauf wird schwächer. Der Körper wird also zusätzlich gestresst!
Unwahr ist, dass leichtere Zigaretten den Körper weniger schädigen als andere Zigaretten. Bei so genannten leichteren Zigaretten wird im Allgemeinen mehr und stärker gezogen und der Rauch tiefer inhaliert. Krebs erregende Nitrosamine sind in hohen Konzentrationen auch in leichteren Zigaretten enthalten.
Unschön ist, dass Rauchen häufig fahle Haut und gelbe Zähne verursacht. Die Haut von Rauchern ist schlechter durchblutet. Dadurch bekommt die Haut früher Falten und sieht blass und gräulich aus. Außerdem führt Rauchen nicht nur zu sichtbaren Zahnverfärbungen, sondern verursacht den Verlust von Zahnfleisch und Knochensubstanz.
Wissenswert ist, dass der Körper Jugendlicher für Raucherschäden anfälliger ist als der von Erwachsenen. Jugendliche Raucher leiden häufiger unter erhöhten Pulsraten, geringem Durchhaltevermögen bei sportlichen Leistungen, niedrigerer Lungenkapazität und Kurzatmigkeit [13].
Übung 16. Welche konkreten Gefahren bringt das Rauchen mit sich? Schreiben Sie diese aus dem Text heraus.
Aufgabe 17. Gibt es Raucher in Ihrer Familie? Warum rauchen sie? Sind Sie auch Raucher? Wann haben Sie angefangen zu rauchen? Haben sie schon mal versucht, das Rauchen aufzugeben? Ist der Versuch gelungen oder misslungen? Erzählen Sie Ihre «Rauchergeschichte».
Übung 18. Das Rauchen von Wasserpfeifen ist heute «in». Viele meinen auch, dass solche Art des Rauchens nicht so schädlich ist. Meinen Sie auch so? Lesen und informieren Sie sich.
 Viele
Menschen glauben immer noch, dass das Rauchen von Wasserpfeifen
(Shishas) harmloser sei als Zigaretten- oder Pfeifen-Rauchen und
außerdem nicht süchtig mache. Das stimmt aber ganz und gar nicht:
Tabakrauch bleibt ein Giftgemisch, auch wenn er aus einer
Wasserpfeife kommt. Durch das üblicherweise lange Rauchen einer
Wasserpfeife nimmt der Körper sogar mehr Nikotin auf als durch das
Rauchen einer Zigarette. Das regelmäßige Rauchen der Pfeife kann
also sehr wohl süchtig machen.
Viele
Menschen glauben immer noch, dass das Rauchen von Wasserpfeifen
(Shishas) harmloser sei als Zigaretten- oder Pfeifen-Rauchen und
außerdem nicht süchtig mache. Das stimmt aber ganz und gar nicht:
Tabakrauch bleibt ein Giftgemisch, auch wenn er aus einer
Wasserpfeife kommt. Durch das üblicherweise lange Rauchen einer
Wasserpfeife nimmt der Körper sogar mehr Nikotin auf als durch das
Rauchen einer Zigarette. Das regelmäßige Rauchen der Pfeife kann
also sehr wohl süchtig machen.
Die weiteren Inhaltsstoffe im Rauch von Zigaretten und Wasserpfeifen sind zwar praktisch gleich, aber der Gehalt der Substanzen ist teilweise unterschiedlich. So ist der Rauch von Wasserpfeifen zum Teil giftiger als der von filterlosen Zigaretten. Der Tabak in der Wasserpfeife verbrennt nicht, sondern er verschwelt bei niedrigen Temperaturen. Das Wasser in der Pfeife kühlt dabei nur den Qualm, filtert aber keineswegs giftige und krebserzeugende Stoffe heraus. Davon gibt es im Rauch giftige Schwermetalle Chrom, Nickel, Kobalt und Blei.
Insgesamt ist also die Gesundheitsgefährdung durch das Rauchen von Wasserpfeifen und Zigaretten ähnlich hoch. Typische Folgen sind gehäuftes Auftreten von Herzerkrankungen, ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko sowie negative Auswirkungen auf das ungeborene Kind bei Schwangeren. Darüber hinaus besteht speziell beim Wasserpfeife-Rauchen die Gefahr einer Übertragung von Lippenbläschen (Herpes), Gelbsucht (Hepatitis) und der Lungenkrankheit Tuberkulose, wenn das Mundstück nicht vor jedem Zug einer anderen Person gewechselt wird [14].
Übung 19. Bestimmen Sie, ob die Aussagen richtig oder falsch sind.
1. Tabakrauch aus einer Wasserpfeife ist nützlich für die Gesundheit. 2. Das Rauchen von Wasserpfeifen ist schädlicher als Zigarettenrauchen. 3. Wenn der Jugendliche regelmäßig Wasserpfeife raucht, kann er süchtig werden. 4. Das Wasser in der Pfeife filtert giftige und krebserzeugende Stoffe heraus. 5. Teer gelangt in die Lunge und verklebt die lebenswichtigen Lungenbläschen. 6. Typische Folgen des Rauchens von Wasserpfeife sind gesundes Herz und schöne Haut.
Übung 20. Schreiben Sie alle Partizipien heraus. Bestimmen Sie, von welchen Verben sie gebildet sind.
Übung 21. Auf welche Maßnahme zur Prävention (auch: Vorsorge) spielt die Karikatur an? Diskutieren Sie über die Wirksamkeit dieser Maßnahme. Wo sehen Sie weitere Möglichkeiten für eine effektive Prävention?


Übung 22. Lesen Sie das Gespräch zwischen einem Raucher und einem Nichtraucher. Wie finden Sie die Aussagen der Sprechenden? Versetzen Sie sich in die Situation und gestalten Sie ein kurzes Gespräch.
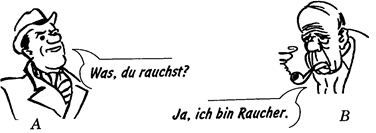 A:
Willst du denn nicht lange leben?
A:
Willst du denn nicht lange leben?
B: Doch, jeder will möglichst lange leben.
A: Aber durch das Rauchen stirbst du einen langsamen Tod.
B: Hm, aber ich brauche keinen schnellen. Die Raucher sind geduldig.
A: Schon möglich. Weil sie faul sind. Sie brauchen viele Rauchpausen beim Arbeiten.
B: Sie haben Zeit. Und die Nichtraucher haben es immer eilig.
A: Das stimmt. Weil sie zu tun haben und keine Zigarettenpausen machen.
B: Aber Rauchen ist doch auch eine Beschäftigung.
A: Ja, aber eine sinnlose.
B: Gar nicht. Stell dir eine Situation vor, wo ein verliebter Junge vor seinem Mädchen steht und vor Aufregung nicht weiß, wohin mit den Händen. Da holt er eine Zigarette heraus, steckt sie sich an und die Situation ist gerettet.
A: Gerettet? Völlig verpfuscht! Mit dem Zigarettenqualm ist das Mädchen in einer Minute verjagt.
Übung 23. Spielen Sie die Gruppenkonferenz zum Thema «Rauchen ist eine Sucht».
Z
 iel
der Konferenz: die Uni zu einer rauchfreien Zone zu machen.
iel
der Konferenz: die Uni zu einer rauchfreien Zone zu machen.
Teilnehmer: Universitätsleiter, Arzt, Psychologe, Eltern (Herr Schmidt und Frau Linden), Lektoren, Studenten.
Inhalt der Rollen:
Der Universitätsleiter begrüßt alle Teilnehmer der Konferenz, stellt sie vor und erteilt das Wort.
Der Arzt ist als Experte eingeladen, ist immer gegen das Rauchen in so frühen Jahren. Er redet über verschiedene Krankheiten und gesunde Lebensweise.
Der Psychologe spricht darüber, dass alles, was verboten ist, ist interessant. Eine verbotene Frucht ist süß.
Herr Schmidt ist gegen das Rauchen, spricht darüber. Aber er hat Verständnis für Studenten, die auf dem Hof rauchen.
Frau Linden hat die Meinung, dass die Uni keine Party ist und dass die Studenten auf die Uni gehen, um zu lernen, nicht um sich zu amüsieren. Sie ist dagegen, dass auch die Lektoren rauchen.
Der Deutschlehrer raucht selbst, aber er ist dagegen, dass die Studenten auf dem Hof rauchen. Er meint, was im Lektorenzimmer passiert, geht die Studenten und Eltern nicht an.
Der Sportlehrer raucht nicht und ist gegen das Rauchen. Auch gegen das Rauchen der Lektoren im Lektorenzimmer. Er ist mit der Meinung des Arztes einverstanden [10].
Übung 24. Man sagt, die meisten Mädchen möchten einen Mann ohne gefährliche und unangenehme Gewohnheiten heiraten. Welche Meinung haben Sie? Welche Forderungen könnten Sie in erster Linie nennen? Setzen Sie die Aussage fort: Ein guter Mann sollte …

nicht rauchen; Alkohol vermeiden; seine Essgewohnheiten kontrollieren; auf Kalorien achten; Sport regelmäßig treiben usw.
Übung 25. Bereiten Sie eine Werbung gegen Rauchen vor.
ALKOHOLKONSUM
Übung 1. Lesen Sie über die Gesetze in Deutschland. Funktionieren solche Gesetze in der Republik Belarus?
§ AUFENTHALT IN GASTSTÄTTEN
1. Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, wenn ein Erziehungsberechtigter sie begleitet. Dies gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen; wenn sie sich auf Reisen befinden und wenn sie eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen.
2. Jugendlichen ab 16 Jahren ist der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten bis 24 Uhr gestattet.
3. Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtklub geführt werden, und in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden.
Übung 2. Ausdrücke aus der Umgangssprache. Was bedeuten die Ausdrücke? Definieren Sie diese.
Besoffen, Bock haben, da läuft eine Party, härtere Sachen.
Übung 3. Hören Sie sich den Text «Jugendliche und Alkohol» an und beantworten Sie folgende Fragen.
1. Wie alt sind die Schüler, die hier ihre Meinung äußern? 2. Wo haben die Schüler zum ersten Mal Alkohol getrunken? 3. Ein Schüler erzählt über seine ersten Erfahrungen mit dem Alkohol. Warum hat er Alkohol getrunken? [12]
Übung 4. Hören Sie sich den Text an, was die Meinungen der Studierenden anbetrifft. Wie äußert sich die Studentin zum Thema «Alkohol»? Fassen Sie die Meinung der Studentin mit Hilfe der folgenden Fragen zusammen.
1. Was ist das gefährlichste? 2. Warum ist es gefährlich? 3. Was ist Ihrer Meinung nach das zweite Extrem im Verhalten der Eltern? 4. Wie sollten sich die Eltern dazu verhalten?
Übung 5. Hören Sie sich den Text über die Meinung der Eltern zu dem Problem an und beantworten Sie die folgenden Fragen.
1. Warum meinen Jugendliche − nach Aussage der Eltern −, dass bei Festen selbstverständlich Alkohol getrunken wird? 2. Was versteht der Vater unter «falscher Moral»? 3. Wie reagiert die Mutter, wenn der Sohn mal von ihrem Glas probieren möchte? 4. Was hält die Mutter von ihrer eigenen Reaktion?
Übung 6. Äußern Sie Ihre Meinungen zum Problem. Was halten Sie davon, dass Eltern ihre Kinder mal etwas Alkoholisches zu Hause probieren lassen? Nennen Sie Gründe dafür und dagegen.
Übung 7. Lesen Sie den Text des Liedes «Alkohol» von Herbert Grönemeyer.
ALKOHOL
Wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht,
ich nehm' mein Frühstück abends um acht.
Gedanken fließen zäh wie Kaugummi,
mein Kopf ist schwer wie Blei,
mir zittern die Knie,
gelallte Schwüre in rotblauem Licht,
vierzigprozentiges Gleichgewicht,
graue Zellen in weicher Explosion,
Sonnenaufgangs- und Untergangsvision.
Was ist los, was ist passiert?
Ich hab' bloß meine Nerven massiert.
Alkohol ist dein Sanitäter in der Not,
Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot,
Alkohol ist das Drahtseil,
auf dem du stehst.
Alkohol, Alkohol …
Die Nobelscen träumt vom Kokain
und auf dem Schulklo riecht's nach Gras,
der Apotheker nimmt Valium und Speed,
und wenn es dunkel wird,
greifen sie zum Glas.
Was ist los, was ist passiert?
Ich hab' bloß meine Nerven massiert.
Alkohol ist dein Sanitäter in der Not,
Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot,
Alkohol ist das Drahtseil,
auf dem du stehst,
Alkohol ist das Schiff mit dem du untergehst,
Alkohol ist dein Sanitäter in der Not,
Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot,
Alkohol ist das Dressing für deinen Kopfsalat.
Alkohol, Alkohol, Alkohol …
Übung 8. Was wird über die körperlichen und die seelischen Wirkungen des Alkohols gesagt? Füllen Sie die Tabelle aus.
-
körperliche Wirkungen
seelische Wirkungen
....
....
....
....
Übung 9. Was und wie «heilt» Alkohol?
Übung 10. Welche Personen kommen im Song-Text vor?
Übung 11. Die Schäden vom Alkohol lassen sich in 3 Schadensbereiche einteilen: körperliche (physische) Schäden (Schäden am Herz-Kreislauf-System, Schäden am Verdauungssystem, Schäden am Nervensystem, Sonstige Schäden); geistig-seelische (psychische) Schäden; soziale Schäden (familiäre Schäden, berufliche Schäden, soziale Schäden). Ordnen Sie die unten aufgeführten Schäden den drei Schadensbereichen zu.
Nervenentzündungen – Magenprobleme – Impotenz / Ausbleiben der Monatsblutung – Aggressionen – Streitlust – Arbeitslosigkeit – Darmentzündung – Veränderungen im Gehirn – Säuferherz – Geldprobleme – Depressionen – hoher Blutdruck – Familiäre Probleme – Blauer Montag – Leberkrebs – Führerschein abgenommen – Selbstmordgefahr – Leberschädigungen – Wahnvorstellungen – offene Beine – Angstzustände – Ausstoß aus der Gesellschaft – Zittern der Hände – Wesensveränderung – Arbeitslosigkeit – Entzündung der Blutgefäße – «Murksen», macht viele Fehler – Leberentzündung - Scheidung – abgleiten zu den Obdachlosen und Pennern – Angstzustände – ständig Streit in der Familie – man hat tischtennisballgroße Löcher im Gehirn = Verblödung – keine Freunde mehr – Verwahrlosung – Schlaganfall – Gedächtnisschwund – Gelenkprobleme – man hat sich sichtbar «dumm gesoffen»
Übung 12. Lesen Sie die Sätze und bestimmen Sie, ob der Mensch alkoholkrank oder alkoholgefährdet ist. Gruppieren Sie die Informationen in zwei Spalten unten.
 1. Wenn
der Mensch nach seelischen Spannungen zum Alkohol greift,
so ist er alkoholgefährdet. 2. Wenn
er morgens Alkohol trinkt, ist er in der chronischen Phase der
Alkoholkrankheit. 3. Wenn
er zunehmend von schwachen auf stärkere alkoholhaltige Getränke
übergeht, so ist er sicher auf dem Weg zur Alkoholabhängigkeit.
4. Wenn
der Mensch nach wenig Alkohol ein unzähmbares Verlangen nach mehr
Alkohol verspürt, ist er stark alkoholgefährdet. 5. Wenn
er innerhalb eines Tages ohne Alkohol nicht auskommen kann, ist er
alkoholkrank. 6. Wenn
er durch das Trinken sich selbst und seine Umwelt schädigt, ist er
alkoholkrank und braucht dringende Behandlung. 7. Wenn
der Mensch durch sein gewohnheitsmäßiges Trinken sein Wesen
verändert, so ist er in der kritischen Phase der Alkoholkrankheit.
8. Falls
der Mensch gewaltige Belastungen im privaten und beruflichen Bereich
hat, kann er alkoholkrank werden.
1. Wenn
der Mensch nach seelischen Spannungen zum Alkohol greift,
so ist er alkoholgefährdet. 2. Wenn
er morgens Alkohol trinkt, ist er in der chronischen Phase der
Alkoholkrankheit. 3. Wenn
er zunehmend von schwachen auf stärkere alkoholhaltige Getränke
übergeht, so ist er sicher auf dem Weg zur Alkoholabhängigkeit.
4. Wenn
der Mensch nach wenig Alkohol ein unzähmbares Verlangen nach mehr
Alkohol verspürt, ist er stark alkoholgefährdet. 5. Wenn
er innerhalb eines Tages ohne Alkohol nicht auskommen kann, ist er
alkoholkrank. 6. Wenn
er durch das Trinken sich selbst und seine Umwelt schädigt, ist er
alkoholkrank und braucht dringende Behandlung. 7. Wenn
der Mensch durch sein gewohnheitsmäßiges Trinken sein Wesen
verändert, so ist er in der kritischen Phase der Alkoholkrankheit.
8. Falls
der Mensch gewaltige Belastungen im privaten und beruflichen Bereich
hat, kann er alkoholkrank werden.
Übung 13. Bereiten Sie eine Werbung gegen Alkoholkonsum vor.
Übung 14. Sprechen Sie zu folgenden Bildern.


Übung 15. Nehmen Sie an der Diskussion «Pro und Contra - Alkoholverbot» teil (Diskussionsrunde ( nach dem fish-bowl – Prinzip: d.h. kleiner 4- er Kreis – großer Außenkreis). Jeder Student erhält ein Kärtchen, liest dieses vor (im Innenkreis) und versucht in der Diskussion mit der Gruppe seine Pro- bzw. Contra-Meinung zu bekräftigen. Wer eine Pro- bzw. Contra-Meinung dazu hat, geht in den Innenkreis). Kommt es zum Stillstand, wechselt ein neuer «Kartenträger» in den Innenkreis. (Es ist auch möglich, jede Kartendiskussion zu begrenzen z. B. 3 Minuten pro Karte).
PRO-Argumente |
CONTRA-Argumente |
Die Tatsache, dass Alkohol nicht die Gesundheit fördert, kann niemand abstreiten. |
Ein geringer Teil aller Alkoholkonsumenten missbraucht den Alkohol, die meisten trinken kontrolliert. |
Unsere Umwelt bietet schon so viele schädliche Einflüsse, dass an irgendeiner Stelle einfach Einhalt geboten werden muss. |
Gegen mäßigen Alkoholkonsum bestehen keine medizinischen Bedenken.
|
Es gibt keinen vernünftigen Grund für den Alkoholkonsum. Den meisten schmeckt Alkohol überhaupt nicht, viele sind „Mittrinker“. Alkohol trübt das Bewusstsein und führt oft zu unüberlegten Handlungen. |
Der Staat braucht die Einnahmen durch die Alkoholsteuer.
|
1998 lag der Verbrauch an reinem Alkohol bei 12,3 l pro Einwohner, d.h. jeder über 14 Jahre verbraucht 30 g (= 1l Bier, 3 Glas Weißwein) reinen Alkohol pro Tag. |
In der Alkoholindustrie sind ungefähr 100 000 Menschen beschäftigt. Ein Alkoholverbot würde ihnen die Arbeitsplätze nehmen
|
Die «sozialen» Kosten durch Alkoholmissbrauch sind verheerend hoch. 2,5 Mio Menschen (davon 200 000 Jugendliche) sind so alkoholkrank, dass die Hilfe und Betreuung brauchen. Für Krankenhausbehandlung, Therapie-einrichtungen werden mehr als 5 Mio Euro pro Jahr ausgegeben). |
Durch ein Alkoholverbot wären auch die 142 000 Gaststätten in ihrer Existenz bedroht.
|
Der Bürger muss mit seinen Steuergeldern dafür aufkommen. So etwas darf man nicht billigen. Es gibt wichtigere Dinge: z. B. Kindergärten, Schulen etc. |
Das Alkoholverbot, das von 1920 – 29 in den USA bestand, erwies sich als wirkungslos .Bei einem Verbot blüht nur der Schwarzhandel, der viele Menschen zu kriminellen Handlungen verführt. |
50 % aller Unfälle mit Todesfolge passieren unter Alkoholeinfluss. In über 80 % aller Fälle, in denen der Führerschein eingezogen wurde, ist Alkohol die Ursache. |
Die Konsumgewohnheiten der Bevölkerung können nicht von heute auf morgen gewaltsam verändert werden. Alkohol gehört für viele Menschen zum normalen Tagesablauf. |
Nur ein striktes Alkoholverbot kann helfen. Schließlich hat sich oft gezeigt, dass man Menschen vor sich selbst schützen muss. Mit Appellen an die Vernunft wird nie etwas erreicht. |
Gegen einen vernünftigen Konsum lässt sich auch gar nichts einwenden.
|
Die Zahl der Alkoholtoten liegt in Deutschland bei etwa 50 000 jährlich. |
Ein Alkoholverbot würde auf starke Ablehnung bei dem größten Teil der Bevölkerung stoßen und mit Sicherheit nicht eingehalten werden. Das ganze Problem würde nur in den Bereich der Illegalität verschoben werden. |
DROGENKONSUM VON DEN JUGENDLICHEN
Übung 1. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den Begriff «Drogen» hören?
Übung 2. Was meinen Sie? Warum konsumieren Jugendliche Drogen? Besprechen Sie Ihre Meinungen in der Gruppe.
z. B. Jugendliche nehmen Drogen, um leichter Freunde zu finden, um Probleme zu vergessen, um Abenteuer zu erleben, um etwas Neues zu erleben, um cool, locker und gut drauf zu sein, um Angst, Einsamkeit und Zweifel zu überwinden, um leichter Konflikte zu bewältigen.
Übung 3. Wen würden Sie dafür verantwortlich machen, dass Jugendliche Drogen einnehmen? Die Eltern? Den Staat? Die Polizei? Die Freunde? Die Medizin? Drogen-Dealer? Die Schule? Hersteller der Drogen? Begründen Sie Ihre Meinungen.
Übung 4. Was verhindert die Lust auf Drogen? Ergänzen Sie die Liste.
Interessante Beschäftigung; eigene Persönlichkeit erleben; Ehrlichkeit; Offenheit; harmonisches Familienleben; ...
Übung 5. Lesen Sie den Text. Suchen Sie die anderen Gründe heraus, warum die Jugendlichen die Drogen konsumieren.
JUGENDLICHE UND DROGEN
Bei Schulstress greifen deutsche Schüler immer häufiger zu legalen Drogen wie Zigaretten, Alkohol oder Medikamente. Zu diesem Ergebnis kommen die Wissenschaftler der Universität Bielefeld. Ein Viertel aller 15- bis 16-Jährigen raucht regelmäßig. 80 % der täglichen Raucher haben ernste Probleme: sie haben schlechte Leistungen in der Schule oder sie finden keine Anerkennung unter Gleichaltrigen. Die Schulform und ihr Prestige spielen dabei eine entscheidende Rolle: 38 Prozent der Raucherinnen und Raucher besuchen eine Hauptschule, 20 Prozent eine Real- oder Gesamtschule und 9 Prozent ein Gymnasium. 2 Prozent der 12-Jährigen und 17 Prozent der 16-Jährigen trinken täglich Alkohol. Das sind auch Jugendliche, die Probleme in der Schule haben. Auch Arzneimittel sind bei solchen Jugendlichen beliebt, die schulische oder persönliche Probleme haben. Nikotin, Alkohol, Arzneimittel sind oftmals Einstiegsdrogen für andere Drogen wie Haschisch, Marihuana, Kokain oder Heroin, die in Deutschland verboten sind. Die Experten schätzen, dass die Zahl der Drogentoten und Drogenabhängigen steigt [6].
Übung 6. Was haben Sie aus dem Text erfahren?
1. Welche Schule besuchen die meisten Raucherinnen und Raucher? Warum? 2. In welchem Alter greifen Jugendliche zu Drogen, Alkohol, Rauchen? 3. Welche Drogen sind in Deutschland verboten?
Übung 7. Lesen Sie den Text durch. Wovon ist hier die Rede?
MEINE ÄLTERE SCHWESTER
Ich habe mich oft gefragt, warum sich Inge so verändert hat. Ich habe mich in der Familie wohl gefühlt. Es gab natürlich Streit. Inge und die Mutter kamen oft gar nicht miteinander klar. Der Vater verdiente viel Geld und die Familie konnte zusammen viel unternehmen: Ausflüge oder Radfahren. Aber einmal war dieses friedliche Familienleben zu Ende. Inge sonderte sich immer häufiger von den anderen ab. Sie wurde verschlossen und aggressiv. Die Mutter hat gesagt: «Etwas stimmt nicht mit Inge. Ich mache mir Sorgen um sie». Inge blieb länger in der Diskothek oder bei ihren Freunden. Der Vater hat die Mutter beruhigt und gesagt: «Deine Tochter wird erwachsen. Sie sucht sich langsam ihren eigenen Lebensstil». «Aber wir wissen nicht, in welcher Gesellschaft Inge ist. Man hört doch so viele schlimme Dinge darüber, was die jungen Leute heute machen!», meint die Mutter.
Mit ihren 17 lebte Inge praktisch nicht in der Familie, sondern neben der Familie. Sie kam nicht zu den Mahlzeiten und niemand konnte mit ihr sprechen. Wenn sie zu Hause war, schloss sie sich in ihrem Zimmer und machte die Musik sehr laut. Aber meistens war sie nicht zu Hause. Erst spät in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden kam sie nach Hause, trank einen sehr starken Kaffee und ging, ohne ein einziges Wort zu sagen, in die Schule.
Ich habe meine Schwester immer bewundert. Inge war ein wunderschönes Mädchen, mittelgroß mit dunkelblonden Haaren und großen hellblauen Augen. Inge war für mich eine ältere Freundin, mit der ich über alles reden konnte. Aber alles war vorbei. Inge wurde kälter, aggressiv. Inges freundliches Lächeln war auch vorbei. Ihre großen Augen blickten kalt und gefühllos. Ich habe gespürt, dass etwas Schlimmes, etwas Schreckliches passiert. Jetzt war alles klar. ...
Übung 8. Äußern Sie Ihre Vermutungen. Was passiert Inge weiter? Besprechen Sie diese Frage in Gruppen.
Übung 9. Lesen Sie den Text weiter. Stellen Sie fest, wer von Ihnen Recht hatte.
Es wurde einmal Inge schlecht. Sie hatte schwere Entzugserscheinungen. Der Arzt sagte, dass es von Drogen ist. Alles war klar. Inge hatte Heroin im Blut. Ich war schockiert.
Entzugserscheinungen – das sind schmerzhafte körperliche Reaktionen, die ein Süchtiger hat, wenn er keine Drogen mehr bekommt.
Übung 10. Nehmen Sie Ihre Stellung zu der folgenden Aussage. Führen Sie Beispiele aus Ihrer Lebenserfahrung an.
Die Jugend ist im Vergleich zu den Erwachsenen gestört und degeneriert.
Übung 11. Machen Sie sich mit dem Inhalt des Textes bekannt.
WAS SIND EIGENTLICH DROGEN?
Ursprünglich verstand man unter Drogen alle Stoffe, die eine Wirkung auf den Menschen haben, wie etwa Heilkräuter. Daher der Ausdruck «Drogerie». Heute versteht man darunter Stoffe, die das Erleben, die Befindlichkeit und Wahrnehmung beeinflussen, also munter machen oder beruhigen, die Angst nehmen, den Schlaf fördern, das Wohlbefinden steigern, Schmerzen betäuben, die Leistungsfähigkeit steigern: dazu gehören etwa Alkohol, Opiate, Kokain, Kaffee, Tabak und verschiedene Gruppen von Medikamenten. In nahezu jeder Kultur, in jeder Epoche wurden solche Substanzen konsumiert, wenn auch die Einnahme und Verwendung oft strengen Ritualen unterworfen war.
Amphetamine sind illegale Drogen. Amphetamine sind synthetische Stoffe, die in privaten Labors zusammengemischt werden. Diese Stoffe können geschluckt, gesnifft oder gespritzt werden. Es wird bei einer Einnahme die Müdigkeit reduziert und die Leistungsfähigkeit erhöht. Die Wirkungen und Nebenwirkungen sind denen von Ecstasy ähnlich, z. B. Ritalin, Speed. Die Langzeitschäden sind: Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit, Bluthochdruck durch Schädigung der Lunge, Herz und Nieren, Schädigung des Kreislaufes.
Anabolika sind verschreibungspflichtige, sonst illegale Drogen. Anabolika werden gespritzt oder in Tablettenform zu sich genommen. Die Wirkungen sind Kraftschübe, Euphorie und Überschätzung der Kräfte. Aber die Liste der Nebenwirkungen ist lang, so erhöhen sich männliche Eigenschaften, wie Aggressivität, Selbstbewusstsein und der Sexualtrieb. Es entsteht Akne (meist auf dem Rücken), man leidet an Kurzatmigkeit, erhöhter Schweißproduktion und Hunger. Außerdem leidet man an Antriebslosigkeit, Bluthochdruck, Augendruck, Blutwertveränderung, Depressionen, Gewaltausbrüche, weibliche Brustbildung bei Männern, Haarausfall, Herzwachstum, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Unfruchtbarkeit und «Vermännlichung» der Frau. Es besteht ein höheres Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall, Leberschäden und Krebs.
Cannabis ist eine illegale Naturdroge. Cannabis (lat. für Hanf) ist den Menschen schon seit mehreren Jahrhunderten bekannt. Meist wird es geraucht (Joint), aber es kann auch getrunken (Tee), gegessen (Space Cookies) und inhaliert (Bong) werden.
Cannabis erzeugt Euphorie, Heiterkeit, Störungen des Denkens und der Konzentration, Illusionen, Erinnerungsstörungen und Gedächtnisstörungen. Die Langzeitwirkungen sind: Erkrankungen am Lungensystem, sexuelle Störungen (Impotenz), müde und schläfrig, Schädigung der Milz und des Fettgewebes, ständiges Hunger- und Durstgefühl, Steigerung der Herzfrequenz, Pupillenerweiterung, Blutdruckschwankungen, Angstzustände, Flashbacks, Depressionen und Verwirrtheit, schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Cannabis macht seelisch abhängig, aber es kommt oft auch zum sozialen Drop-Out.
Crack ist eine illegale Droge. Crack ist eine Mischung aus Kokain und Backpulver, es wird meistens geraucht, selten auch geschnupft und gespritzt. Die Wirkung dauert ca. 5 - 15 Minuten an. Der Konsument fühlt sich zunächst beängstigt, kontaktfreudig, euphorisch, voller Energie, Hebung des Sexualtriebes, akustische und optische Täuschungen, gedämpftes Hungergefühl, Gewaltbereit, Verfolgungswahn oder Angstzustände, das ändert sich aber schnell in Niedergeschlagenheit, Depressivität, Suizidgedanken und Entzugs ähnliche Erscheinungen. Auf längere Zeit magert man ab, verzweifelt und man hat Leberschäden. Das Herz- und Hirninfarkt Risiko ist ziemlich hoch. Weitere Schäden und Merkmale sind: Psychosen, Herzrasen, Pupillenerweiterung, Blässe, Krampfanfälle, Koordinationsstörungen, Blutdruckerhöhung, Erhöhung der Körpertemperatur, Störungen der Herzfunktion bis hin zu Herz- versagen, Hirnödeme und Schlaganfälle mit Lähmungen. Crack macht sehr stark seelisch und körperlich abhängig.
Crystal Speed ist eine illegale synthetisch hergestellte Droge. Crystal Speed wird als Pulver gesnifft, seltener in Tablettenform geschluckt oder in Wasser aufgelöst injiziert. Die Wirkung dauert ca. 4- 20 Stunden an (einige Konsumenten reden von bis zu 70 Stunden), der Rausch äußert sich in gesteigertem Selbstbewusstsein, verringertem Schmerzempfinden, fast kein Hunger- und Durstgefühl, stark erhöhten Blutdruck, Aktivitätendrang und erhöhten Rededrang. Risiken und Langzeitschäden sind: Herzrasen, rasender Puls, Störungen des Herzrhythmus, Überhitzung (Fieber), Aggressivität, Gewichtsverlust, Hautentzündungen, Magenschmerzen und Durchbruch. Bei Überdosierung sind Zuckungen, Brechreiz, Hirnblutungen mit plötzlichen Lähmungen, starke Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit und Herzstillstand zu erkennen. Crystal Speed macht seelisch abhängig.
Ecstasy ist eine illegale künstlich hergestellte Droge. XTC ist eine Pille. Hinter dem Namen Ecstasy verstecken sich verschiedene chemische Verbindungen, wie z. B.: MDA, MDMA, MDEA, MBDB. Die Wirkung dauert ca. 2 – 5 Stunden an und äußert sich in Bewusstseinsstörungen, Ruhe, Ausgeglichenheit, Verminderung der Angst und der Hemmungen, Aktivierung des Langzeitgedächtnisses, Erweiterung der Pupillen und Bronchien, man fühlt sich bärenstark, es prickelt und kribbelt überall, man hat eine tiefe Atmung und keinen Hunger. Doch wie alle anderen Drogen auch, hat Ecstasy eine lange Liste von Nebenwirkungen. Die Austrocknung des Mundes, extremes Schwitzen und Zittern, Verkrampfung der Gesichtsmuskeln, Schlaflosigkeit, Orientierungs- und Koordinationsschwierigkeiten, Übelkeit, Schwindel und Verfolgungswahn sind Langzeitschäden.
Halluzinogene sind illegal. Oral eingenommen, als sogenannte Micros, Papers Trips oder Pappen beginnt LSD nach ca. 45 Minuten zu wirken, und führt zu einem heftigen Rausch, der mehrere Stunden andauern kann.
Die Pupillen weiten sich stark, mit der Folge, dass helles Licht als unerträglich empfunden wird. Im Stammhirn kommt es zu einer Reizung des Brechzentrums, was zu Übelkeit und Erbrechen führen kann. Es kommt zu starken Wahrnehmungsveränderungen und einer Intensivierung der Sinne (z. B. gesteigerte Brillanz von Farben, Sinnestäuschungen, Lichtblitze, Entfremdungserleben, verändertes Farb- und Formsehen).
Heroin ist illegal und ein Opiat. Heroin wird geraucht, gesnifft oder gespritzt. Die Wirkung dauert ca. 3 – 5 Stunden. In geringen Mengen äußert sich die Droge in Unternehmungslust, Verminderung des Hungergefühls und der Müdigkeit. Die größte Gefahr besteht in Atemstillstand und Muskellähmung. Die Langzeitschäden sind: Abmagerung, Menstruationsaussetzung und Gedächtnislücken. Heroin schafft besonders am Anfang ein besonderes Hochgefühl, den so genannten Kick. Es hat eine Halbwertszeit von vier Stunden, das bedeutet: Nach vier Stunden wirkt nur noch die Hälfte der Substanz. Das heißt, ein Heroinkonsument, der körperlich abhängig ist (wenn bei einem Absetzen Entzugserscheinungen auftreten: muss mehrmals am Tag Heroin konsumieren.
Koffein ist eine legale Droge. Koffein ist in Tee, Kaffee, Energy Drinks und Cola enthalten. Es gibt auch Koffeintabletten. Die Wirkungsdauer beträgt zwischen 2 und 3 Stunden. Die Wirkung zeigt sich in Milderung von Kopfschmerzen, muntert und putscht auf, hält wach. Nikotin fördert den schnellen Abbau von Koffein. Die Langzeitschäden sind Herzschäden und Nervosität. Entzugserscheinungen sind: Kopfschmerzen, Nervosität, Konzentrationsstörungen und Reizbarkeit. Die psychische Abhängigkeit ist höher als die körperliche.
Kokain ist illegal. Andere Bezeichnungen sind Koks oder Schnee. Kokain wird in verschiedenen chemischen Formen (Hydrochlorid, Freebase und Crack) und auf unterschiedliche Art und Weise (inhalieren, rauchen und injizieren) angewendet.
Die Wirkung beinhaltet Konzentrationssteigerungen mit einer gleichzeitigen Entstehung eines Hochgefühls, manchmal Wärme- oder Schwindelgefühle. Die Langzeitschäden sind körperliche und geistige Verfallserscheinungen (Sinnesverwirrungen, Rausch und Krämpfe) durch Funktionsstörungen im Gehirn. Stark ausgeprägt ist die psychische Abhängigkeit. Hochgefährlich ist die Kombination mit Heroin (Psychosen, Wahnvorstellungen, Sehstörungen).
Medikamente sind legal. Es gibt 22.000 verschiedene Medikamente, die unterteilt werden können in Aufputsch-, Schmerz- und Schlaf- und Beruhigungsmittel.
Aufputschmittel steigern den Blutdruck, lassen das Herz schneller schlagen und wirken bei zu hohen Mengen auch auf das Gehirn. Man stellt außerdem eine Steigerung der Aufmerksamkeit, ein vermindertes Schlafbedürfnis, eine Hemmung des Appetits und eine Steigerung des Selbstwertgefühls fest.
Ritalin ist ein Medikament, das man kleinen Kindern gibt, die unter einem «krankhaftem Bewegungsdrang» leiden. Appetitzügler und Ritalin sind verschreibungspflichtige Medikamente, die man nur mit einem Rezept von einem Arzt erhält. Nimmt man zu viel von den Aufputschmitteln und bekommt einen Rausch, ist man am Anfang besser gelaunt – man spricht dann von einer sogenannten «Stimmungsaufhellung». Anschließend bekommt man jedoch Blutdruckkrisen und Herzrasen. Außerdem wird man sehr traurig (tiefe Depression) und bekommt Wahnzustände.
Schmerzmittel sind Medikamente, die Schmerzen und Fieber senken. Sie werden auch gegen rheumatische Erkrankungen eingesetzt. Viele Schmerzmittel sind jedoch rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Nimmt man Schmerzmitteln nur manchmal, ist das ungefährlich. Nimmt man sie jedoch regelmäßig, kann man davon süchtig werden. Nach längerem, regelmäßigem Gebrauch entsteht einen seelische Abhängigkeit.
Schlaf- und Beruhigungsmittel nennt man auch «Tranquilizer» oder «Benzodiazepine». Wenn jemand innerlich sehr unruhig ist oder unter «krankhaften Erregungszuständen» leidet, bekommt er solche Medikamente vom Arzt verschrieben. Sie wirken angstlösend und bei manchen Menschen kommt es zur «Aufhellung einer depressiven Verstimmung», das bedeutet, es hilft Menschen nicht immer traurig zu sein. Doch man muss bei diesen Medikamenten vorsichtig sein. Die Medikamente können einen leichtsinnig werden lassen, da man denkt, dass einem nichts passieren kann. Schon nach kurzer Zeit kann sich einen seelische Abhängigkeit entwickeln. Versucht der süchtige Mensch das Medikament nicht mehr zu nehmen, bekommt er Kopfschmerzen, Unruhe, Angst und ist gereizt.
Opiate sind illegale Drogen. Opium ist ein Produkt aus dem getrockneten Saft der Schlafmohnkapsel. Zu der Opiaten-Gruppe gehören Opium, Morphium, Heroin, Codein und Methadon. Opium ist der Ausgangsstoff für eine Reihe von Substanzen, von denen Morphium und Heroin am bekanntesten sind, zu denen aber auch das Codein zählt, welches in vielen Husten- und Schmerzmitteln enthalten ist.
Opiate haben eine schmerzdämpfende und stark euphorisierende Wirkung. Infolge schneller Abhängigkeit und Toleranzentwicklung ist eine ständige Dosissteigerung nötig. Der chronische Gebrauch von Opiaten verursacht Antriebslosigkeit und Wesensänderung, Depressionen, Einengung der Interessen, Abnahme des Pflichtgefühls, Verwahrlosung und soziale Desintegration. Bei Patienten mit Krebsschmerzen oder ungeklärtem Dauerschmerz ist der Einsatz von Opiaten häufig die letzte Möglichkeit zur Verbesserung der Lebensqualität.
Speed. Unter Speed (Pep) versteht man vollsynthetisches Amphetamin. Meistens wird Speed als weißes (manchmal rosa oder oranges) Pulver, selten in Tablettenform angeboten. Die Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken sind wie bei allen potenten Wirkstoffen abhängig von der Dosis, der Dauer der Anwendung und der Verabreichungsform. Die Wirkungen zeigen sich im erhöhten Blutdruck, beschleunigte Atmung, Verlust des Hungergefühls und der Schmerzempfindung, erhöhte Leistungsbereitschaft, Gefühl der Stärke, Euphorie, gesteigerter Rededrang. Extreme Nebenwirkungen sind: starker Gewichtsverlust, Hautentzündungen, Magenschmerzen (im Extremfall Magendurchbruch), Herzrhythmusstörungen [14].
Übung 12. Brainstorming. Wie beeinflussen die Drogen den Körper des Menschen?
Übung 13. Lesen Sie den Text noch einmal durch und schreiben Sie die Krankheiten heraus, die den Genuss von Rauschgift verursacht.
Übung 14. Füllen Sie die Tabelle aus, gebrauchen Sie dabei die Information aus dem Text.
Droge |
Beschreibung |
Schäden |
Wirkungen |
|
|
|
|
Übung 15. Bereiten Sie die Werbung gegen die Drogeneinnahme vor.
Übung 16. Hören Sie den Text «Martin über Drogen». Martin nennt einige Begriffe. Streichen Sie alle Dinge, die keine Drogen sind.
Bonbons, Zigaretten, Kaffee, Bier, Schokolade, Tee, Heroin, Kaugummi, Marihuana, LSD, Whisky, Haschisch, Wodka.
Übung 17. Bringen Sie die Drogen in eine Hitliste. Welche ist die gefährlichste, warum?
1. … ist am gefährlichsten, weil … . 2. … ist auch gefährlich, weil … . 3. … ist gefährlich, weil … .
Übung 18. Hören Sie sich den ersten Teil des Interviews an. Beantworten Sie dann folgende Fragen.
1. Was berichtet Martin über Lindau? 2. Glauben Sie, dass Lindau ein Drogenbrennpunkt ist? 3. Was spricht dafür? 4. Was spricht dagegen? [12]
Übung 19. Hören Sie das Interview bis zum Ende und beantworten Sie folgende Fragen.
1. Wie viele Schüler gibt es in der Klasse? 2. Wie viele Schüler rauchen? 3. Wie viele trinken Alkohol? 4. Was wird getrunken? 5. Warum wird getrunken?
Übung 20. Hören Sie sich den dritten Teil des Interviews noch einmal an. Bestimmen Sie, ob folgende Aussagen von Martin dem Inhalt des Textes entsprechen.
|
ja |
nein |
a) Ticker sind Leute, die immer mehrere Kilo Haschisch besitzen. |
|
|
b) Wer arbeiten geht, bekommt Drogen billiger. |
|
|
c) An der Schule gibt es einen Lehrer, der für Drogen zuständig ist. |
|
|
d) Manche Jugendliche klauen die Drogen. |
|
|
e) Jugendliche wollen in gute Stimmung kommen, deshalb nehmen sie Drogen. |
|
|
f) Drogen sollten wie in Holland verkauft werden. |
|
|
Übung 21. Martin verwendet die folgenden Begriffe. Was bedeuten sie? Finden Sie andere Adjektive, die das Gleiche ausdrücken. Der Schüttelkasten hilft Ihnen dabei.
1. Seelische Tiefpunkte. 2. Härtere (alkoholische) Sachen. 3. Weiche Gesetze. 4. Schwere Drogen. 5. Leicht, körperlich, hochprozentig, psychisch, abhängig machend, hochkarätig, liberal.
Übung 22. Äußern Sie sich argumentierend zu folgenden Fragen?
1. Was glauben Sie, hat Martin schon einmal Drogen probiert? Begründen Sie Ihre Hypothese. 2. Warum nehmen Jugendliche Ihrer Meinung nach Drogen? 3. Wenn Lehrer schon Drogen genommen haben, sollten sie das vor den Schülern zugeben oder verschweigen? 4. In Deutschland werden Jugendliche auch bestraft, wenn sie kleine Mengen, z. B. mehr als 10-15 Gramm Haschisch, bei sich haben. In Holland ist der Besitz von kleinen Mengen Haschisch nicht strafbar. Haschisch wird dort in kleinen Mengen in speziellen Läden verkauft. Was ist Ihrer Meinung nach besser?
Übung 23. Stellen Sie sich vor: Sie sind schon als Lehrer/in tätig und erfüllen somit auch die erzieherische Tätigkeit des/der Klassenleiters / Klassenleiterin in der 11. Klasse. Sie müssen irgendwelche Maßnahmen treffen, um die Drogeneinnehmen von Ihren Schülern zu verhindern. Was würden Sie tun?
KRIMINALITÄT UNTER DEN JUGENDLICHEN
 Übung
1. Sehen
Sie sich das Bild an. Das ist Tracy Weber aus Berlin. Was meinen Sie,
was für ein Mädchen das ist? Welchen Charakter hat es? Wie alt ist
es? Welche Hobbys hat es? Welche Lebensweise führt es?
Übung
1. Sehen
Sie sich das Bild an. Das ist Tracy Weber aus Berlin. Was meinen Sie,
was für ein Mädchen das ist? Welchen Charakter hat es? Wie alt ist
es? Welche Hobbys hat es? Welche Lebensweise führt es?
Übung 2. Was meinen Sie, welche Probleme dieses Mädchen haben könnte?
Übung 3. Die Eltern von Tracy kennen das Problem der Tochter und schreiben einen Brief an die Psychologen, um sie um einen Rat zu bitten. Überfliegen Sie den Brief und fassen Sie die Information über Tracy in 5 Sätzen zusammen. Womit sind die Probleme des Mädchens verbunden?
Berlin, 23. September 2012
Sehr geehrte Frau Stock und Herr Meier,
unsere Tochter Tracy, 14 Jahre, hat mit ihrer Freundin in einem Kaufhaus Klamotten geklaut. Zum Glück gab es keine Anzeige. Durch einen Zufall erfuhren wir erst jetzt davon. Nachdem wir mit unserer Tochter ein langes Gespräch geführt hatten, kamen wir zu der Überzeugung, dass sie es nicht besonders ernst mit ihrer Reue nimmt. Was wäre die richtige Strafe für ein Kind in diesem Alter? Sie bekommt jeden Monat 35 Euro Taschengeld und verdient sich selbst durch Kinderbetreuung nochmals 75 Euro. Also Geldmangel kann nicht dahinter stecken. Für einen Rat wären wir sehr dankbar. Wie können wir wieder Vertrauen zu ihr bekommen?
Mit freundlichen Grüßen,
Familie Weber.
Übung 4. Welche Wörter passen zusammen? Manchmal sind mehrere Zuordnungen möglich.
Klamotten a) kommen
ein Gespräch b) bekommen
zur Überzeugung c) ernst nehmen
Taschengeld d) klauen
Vertrauen e) führen
es mit der Reue f) bekommen
Übung 5. Richtig oder falsch?
|
R |
F |
1. Das Mädchen hat im Kaufhaus Kleidung gestohlen. |
□ |
□ |
2. Die Täterin wurde zur Polizei gebracht. |
□ |
□ |
3. Sie bereut ihre Tat. |
□ |
□ |
4. Jeden Monat hat sie 200 Euro zur Verfügung. |
□ |
□ |
Übung 6. Schreiben Sie die Antwort an Stelle der Psychologen. Wie könnten Sie den Eltern von Tracy Hilfe leisten? Formulieren Sie konkrete Ratschläge für sie. Nehmen Sie folgendes Schema zu Hilfe.
Ort, Datum Anrede
Was du berichten willst
Grüße Unterschrift |
Übung 7. Was meinen Sie, warum junge Menschen stehlen? Welche Gründe gibt es?
Übung 8. Weitere Gründe erklärt ein Psychologe. Lesen Sie seine Antwort und sagen Sie, ob Sie in Ihrem Leben ähnliche Situationen erlebt haben.
Jugendliche stehlen immer häufiger, und selten passiert es aus Geldmangel. Die meisten Jugendlichen haben es eigentlich nicht nötig. Wenn aber keine materiellen Gründe erkennbar sind, muss man nach seelischen Gründen suchen. Warum stehlen junge Menschen? Es gibt viele Gründe: Jemand macht eine Mutprobe, um nicht aus der Jugendgruppe ausgestoßen zu werden. Heute gibt es mehr Konsumartikel als früher und die Schule ist nicht so streng wie früher. Deshalb lernen die Schüler weniger aus eigenem Interesse und wissen nicht, was gut und was schlecht ist und was richtig und was falsch ist.
Auch die Eltern sind heutzutage manchmal unsicher und wissen nicht, was für ihre Kinder gut und wichtig ist, zum Beispiel der Verzicht auf viele Konsumartikel. Einige Kinder und Jugendliche haben dann im Laufe ihrer Kinderzeit nicht ausreichend gelernt, dass sie auch bei einem scheinbaren Überfluss sich beschränken und selber Nein sagen müssen. Wenn dann nach einem Diebstahl Reue da ist, haben Jugendliche eine größere Chance, ein Verantwortungsgefühl dafür zu entwickeln, dass sie als Täter für ihre Tat auch einstehen müssen.
Manche Jugendliche haben aber keinen ausgeprägten Sinn dafür, dass fremdes Eigentum eben anderen Menschen gehört und selbst der größte Überfluss in einem Kaufhaus von anderen Menschen bezahlt werden muss. Es sieht alles reich aus, und wen kümmert schon, wenn das eine oder andere fehlt, mag mancher Jugendliche argumentieren. Zur Einsicht finden diese Jugendlichen dann nicht, so dass auch das Moralisieren und Belehren nicht dazu führt, dass die Jugendlichen Gewissensbisse bekommen. Das Wegschauen nützt auch nichts, weil die Jugendlichen dann die Illusion haben, dass Stehlen nicht falsch ist. Und sie haben keinen Grund, mit dem Stehlen aufzuhören. Das Stehlen kann dann fast zur Sucht werden.
Übung 9. Welche Definition passt zu welchem Begriff?
1. der Geldmangel a) zeigen, dass man keine Angst hat
2. die Mutprobe b) etwas verstehen
3. der Überfluss c) es gibt zu wenig Geld
4. die Einsicht d) es gibt von einer Sache zu viel
Übung 10. Verbinden Sie die Satzteile.
|
g) auf Konsum zu verzichten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Übung 11. Setzen Sie die Wörter aus dem Kasten in der richtigen Form in den Lückentext ein.
Überfluss, stehlen, Mutprobe, Illusion, eigen, verzichten, aufhören, Verantwortungsgefühl, seelisch, Eigentum, nötig, Konsumartikel |
Jugendliche … immer häufiger. Die meisten Jugendlichen haben es eigentlich nicht ….Wenn aber keine materiellen Gründe da sind, gibt es … Gründe. Man macht eine …, um in der Clique zu bleiben. Heute gibt es mehr … als früher und die Schule ist nicht so streng wie früher. Deshalb lernen die Schüler weniger aus … Interesse. Man muss lernen, auf Konsumartikel zu …, obwohl es einen … an Konsumartikeln gibt. Auch Jugendliche müssen ein … entwickeln.
Manche Jugendliche verstehen nicht, dass fremdes … eben anderen Menschen gehört. Die Erwachsenen dürfen nicht wegschauen, weil die Jugendlichen sonst die … haben, dass ihre Tat erlaubt ist. Dann haben sie keinen Grund, um mit dem Stehlen ….
Übung 12. Im Text werden keine konkreten Gründe genannt, warum dieses Mädchen gestohlen hat. Was meinen Sie, warum hat es gestohlen? Bilden Sie weil-Sätze.
z. B. Das Mädchen hat gestohlen, weil es das Geld brauchte.
Übung 13. Welche Folgen wird die Tat fürs Mädchen haben? Wird es bestraft oder nicht? Warum?
Übung 14. Stellen Sie sich vor, es ist zur Anzeige gekommen. Übernehmen Sie die unten angegebenen Rollen und führen Sie die Dialoge.
1. Der Polizeibeamte kommt ins Geschäft und stellt Fragen an den Verkäufer/die Verkäuferin. 2. Der Polizist spricht mit dem Mädchen. 3. Die Eltern sprechen mit ihrer Tochter ganz offen über das Geschehene.
Übung 15. Wenn Sie solches Problem hätten, mit wem würden Sie darüber eher sprechen: mit den Eltern, mit Freundin/Freund/Freunden, mit der Deutschlehrerin, mit dem Sorgentelefonkrisenberater? Warum?
Übung 16. Welche Tipps könnten Sie den Eltern geben? Was würden Sie an der Stelle der Eltern tun? Wie würden Sie auf solche Tat reagieren? Gebrauchen Sie dabei die irrealen Konditionalsätze.
− Wenn ich Mutter/Vater wäre, würde ich...
− Wäre ich Mutter/Vater, würde ich...
− Wenn meine Tochter etwas gestohlen hätte, würde ich...
− Hätte meine Tochter etwas gestohlen, würde ich...
Übung 17. Wie verstehen Sie folgende Sprichwörter. Gebrauchen Sie einige von diesen in den passenden Situationen.
1. Auch ein kluger Dieb wird einmal gefangen. 2. Der Dieb lässt das Stehlen nicht. 3. Der Dieb meint, sie stehlen alle. 4. Gelegenheit macht Diebe. 5. Offene Tür lockt den Dieb. 6. Schlechte Wacht macht viele Diebe. 7. Wer ablernt, ist ein ehrlicher Dieb. 8. Wer einmal stiehlt, heißt allezeit ein Dieb. 9. Wer Liebe stiehlt, ist kein Dieb. 10. Wo Schätze sind, sind auch Diebe. 11. Wer mit Dieben stiehlt, muss mit Dieben laufen.
Übung 18. Es gibt noch ein anderes Problem, mit dem die Jugendlichen zu tun haben. Das ist die Gewalt. Es gibt folgende Meinungen darüber, was der obengenannte Begriff bedeutet. Lesen Sie diese durch und erklären Sie, was Sie unter dem Begriff «die Gewalt» verstehen.
Die Gewalt ist…
1) aggressive Jugendliche, die Geld verlangen, die andere schlagen; 2) grobe, autoritäre Menschen, die körperlich Kraft, Macht, Drohungen benutzen, um jemanden zu verletzen; 3) grobe Menschen, die körperliche Kraft benutzen, um etwas zu erreichen; 4) wenn man jemandem etwas mit Kraft, Drohung wegnimmt; 5) autoritäre Eltern, Lehrer, Chefs, die kein Vertrauen zu den Kindern/ Schülern / Arbeitern haben, die nur Druck, Streit, Strafen benutzen.
Übung 19. Jede Erscheinung in unserem Leben hat ihre Ursachen und Folgen. Wie meinen Sie, welche Ursachen und Folgen die Gewalttaten haben. Interviewen Sie Ihre Studienkollegen und erzählen Sie darüber, warum viele junge Menschen oft gewalttätig sind und zu welchen Auswirkungen es führen könnte.
Übung 20. Lesen Sie das Gespräch durch, analysieren Sie die Situation und bestimmen Sie, wer Recht hat und wer schuldig ist? Wessen Ausweg aus der Situation (von Stefanie oder von Michael) finden Sie besser? Haben Sie persönlich etwas Ähnliches erlebt? Welche Lösung haben Sie gefunden?
In der Schule bemerkt Tamers Freund Philipp, dass Tamer (ein ausländischer Junge) ohne Jacke bei der Kälte in die Schule kommt. Tamer erzählt, welche Probleme er täglich hat.
Tamer: Täglich verstecken sich drei große Jungen an der Ecke zur Hauptstraße und warten auf mich. Sie wollen Geld von mir. Mein Taschengeld ist schon alle und heute hatte ich besonders Angst.
Philipp: Hast du deinen Eltern davon erzählt?
Tamer: Nein, ich hatte Angst. Sie haben bedroht, dass ich keinem erzähle.
Stefanie: Und was ist heute passiert?
Tamer: Meine Mutter hatte mir gestern eine neue Jacke gekauft. Heute hatte ich kein Geld und sie haben meine neue Jacke weggenommen.
Alida: Wer macht mit? Heute nach der Schule suchen wir diese Gewalttäter.
Jens: Warum regt ihr euch bloß so auf? So etwas passiert doch oft.
Michael: Ich schlage vor, wir reden zuerst mit den dreien. Kannst du uns die Jungen beschreiben?
Stefanie: Reden, was soll denn das? Da hilft nur die Faust ins Gesicht. Warum hast du dich nicht gewehrt, Tamer?
Tamer: Die sind doch viel größer und stärker als ich. Außerdem sind sie zu dritt [11].
Übung 21. Übernehmen Sie die Rollen von Stefanie, Philipp, Jens, Alida und Tamer, die dank Tamers Beschreibung drei Gewalttäter gefunden haben. Sie heißen Sven, Klaus und Tim. Spielen Sie in kleinen Gruppen Gespräche weiter, und bemühen Sie sich im Gespräch mit drei Jungen gute Argumente zu finden und ein sachliches Gesprächsklima zu schaffen. Wie können Sie das erreichen? Gebrauchen Sie folgende Redeklischees:
So sehe ich das auch; Ich bin der gleichen Meinung ...; Dagegen spricht aber, dass ...; Einerseits ... andererseits; ...überzeugt mich, dass ...; Wenn ..., dann ...; Ich stimme zu; Was mich traurig / wütend ... macht, dass ...; Ich möchte unterstützen, was ... gesagt haben / hat.
 Übung
22. Sehr
oft lauern die Gewalttäter ihrem Opfer in den menschenleeren Orten
auf. Aber es gibt auch zahlreiche Fälle, wenn der eine den anderen
verprügelt, und die anderen Augenzeugen es ganz kaltblütig zusehen.
Die Rede in der nächsten Situation ist gerade davon. Analysieren Sie
die Umstände des Geschehenen und das Benehmen der handelnden
Personen.
Übung
22. Sehr
oft lauern die Gewalttäter ihrem Opfer in den menschenleeren Orten
auf. Aber es gibt auch zahlreiche Fälle, wenn der eine den anderen
verprügelt, und die anderen Augenzeugen es ganz kaltblütig zusehen.
Die Rede in der nächsten Situation ist gerade davon. Analysieren Sie
die Umstände des Geschehenen und das Benehmen der handelnden
Personen.
Die Situation: Fünf Minuten Pause in der Klasse 8a. Kaum hat die Lehrerin den Raum verlassen, beginnt ein ungleicher Kampf. Matthias stürzt sich auf den 14-jährigen Tim. Er drückt ihn auf einen Stuhl und beginnt ihn zu fesseln. Tim lacht gequält. Einige Mitschüler feuern an, reichen ihre Gürtel, kneifen und hänseln ihn. Die Übrigen scheinen nichts zu bemerken. Tim wird verspottet und bespuckt. Dann drückt ihm jemand eine alte Unterhose aus einer Sporttasche ins Gesicht.
Übung 23. Lesen Sie die Aussagen von den Beteiligten und sagen Sie, wem Sie zustimmen und mit wem Sie nicht einverstanden sind? Begründen Sie Ihre Meinung.
Der Klassenlehrer: «Was mich am meisten schockiert hat, war das Schweigen der Klasse. Niemand wollte etwas gesehen haben. Keiner verriet den Namen des Schülers. Einige gaben einen falschen Namen an. Wohlweislich von einen Mitschüler unter 14, damit da strafrechtlich nichts passiert».
Die Schüler: «Das ist doch alles nicht so schlimm. Das ist doch nur Spaß. Der Tim soll sich nicht so anstellen. Jeder ist mal dran. Und außerdem verpetzen wir keinen. Das wäre ja noch schöner».
Übung 23. Was Tim passiert, ist kein Einzelfall. Verspottet, geprügelt und gequält wird an vielen Schulen. Betroffen von dieser Gewalt sind alle: Täter, Opfer und scheinbar unbeteiligte Zuschauer. Was können wir dagegen tun? Macht sich nicht genauso schuldig, wer einfach nur zusieht?
Übung 24. In Konflikt- und Gefahrensituationen ist es wichtig, die Gefühle von allen Beteiligten deuten zu können. Sehen Sie sich folgende Bilder an und vermuten Sie, was los ist. Welchen Ausweg gibt es aus dieser Situation? Gebrauchen Sie bei der Antwort Objekt- und Kausalsätze!


Übung 25. Stellen Sie sich vor: In der Klasse, wo Sie Deutsch unterrichten, lernt ein Waisenkind. Es wird verspottet, gekniffen und geprügelt. Sie möchten diesem Schüler helfen. Welche Maßnahmen würden Sie treffen? Gebrauchen Sie bei der Antwort verschiedene Formen des Konjunktivs!
Übung 26. Schreiben Sie bitte einen Zeitungsartikel zum Thema: «Gewalt ruhig zusehen heißt dazugehören?» für Vitamin. de.
Übung 27. Spielen Sie Gruppenkonferenz zum Thema «Gewaltfreie Schule».
Ziel der Konferenz: die Schule zu einer gewaltfreien Zone zu machen.
Teilnehmer: Schulleiter, Arzt, Psychologe, Eltern (Herr Weber und Frau Siebert), Pädagogen, Schüler.
Inhalt der Rollen:
Schulleiter begrüßt alle Teilnehmer der Konferenz, stellt sie vor und erteilt das Wort.
Der Arzt ist als Experte eingeladen, ist immer gegen die Gewalt. Er redet über verschiedene Krankheiten, die sogar kleine Gewaltakte hervorrufen können.
Der Psychologe spricht darüber, dass die Pubertätsperiode sehr kompliziert ist. Man darf nicht einfach wegschauen. Verächtliches Benehmen der Erwachsenen verursacht spätere psychologische Krankheiten der Schüler.
Herr Weber ist gegen die «echte» Gewalt, spricht darüber. Aber er hat Verständnis für Schüler, die manchmal auf dem Hof einen Dummkopf kneifen. Es ist nur ein «harmloser» Streich.
Frau Siebert hat die Meinung, dass die Gewalt immer Gewalt bleibt, ungeachtet dessen, ob der Gewaltakt «groß» oder «klein» ist. Die Schüler gehen in die Schule, um zu lernen, nicht um sich zu amüsieren oder jemanden zu entwürdigen. Sie ist auch dagegen, dass die Lehrer ihre Schüler anschreien.
Der Deutschlehrer versteht, dass es solches Problem gibt, ist gegen Gewalt unter den Schülern. Er meint aber, dass während der Stunde eine Ohrfeige oft das beste Mittel ist, ungehorsame Schüler zu disziplinieren.
Der Kunstlehrer meint, dass böse Beispiele gute Sitten verderben. Wenn die Lehrer sich Ohrfeige oder etwas Ähnliches erlauben werden, dann werden die Jugendlichen auch so etwas tun. Nur Einbeziehung in die Kunst kann die Situation verbessern [10].
Übung 28. Wenn sich Schülerinnen / Studentinnen und Schüler / Studenten ihre eigenen Regeln geben, werden die eher befolgt, als wenn die Schulleitung / Universitätsleitung sie aufstellt. Schreiben Sie eine Liste mit Regeln, die Sie wichtig für den Schulalltag / Universitätsalltag finden. Aber: Für jede Regel und jedes Verbot muss man einen Grund geben. Formulieren Sie Ihr eigenes Klassengesetz / Gruppengesetz.
Übung 29. Testen Sie sich selbst.
1. Dein Schulfreund Christoph hat einem jüngeren Schüler unbemerkt einen Zettel auf den Rücken geklebt. Darauf steht: «Ich piss mir in die Hosen». Wie verhältst du dich am ehesten?
Ich verpasse Christoph einen Schlag. Der muss begreifen, dass man sich nicht an Schwächeren vergreift!
Ich sage Christoph, dass ich seine Aktion nicht so toll finde und zupfe dem Schüler den Zettel vom Rücken.
Ich mag den Kerl nicht besonders, deshalb mische ich mich da nicht ein.
2. In deiner Fußballmannschaft ist seit kurzem ein afrobelorussischer Spieler aktiv. Immer wenn ihr ein Spiel habt und Anthony am Ball ist, buht das gegnerische Publikum. Was könnt ihr dagegen unternehmen?
A) Wir versuchen, die Buhrufe zu ignorieren. Wenn wir nicht reagieren, werden die Leute die Aktion irgendwann langweilig finden und aufhören.
B) Für das nächste Spiel überlegen wir uns zusammen mit dem Trainer und den Fans eine Aktion, um zu zeigen, dass wir voll hinter Anthony stehen.
C) Wir bitten unser Publikum, in Zukunft immer Daniel auszubuhen, wenn er am Ball ist. Er ist nämlich der einzige Spieler in der gegnerischen Mannschaft, der rote Haare hat.
3. Auf einer Party fangen zwei ziemlich besoffene Jungs an sich zu prügeln. Erst sieht es aus wie Spaßkloppe, doch dann fällt einer von ihnen gegen die Kante eines Tisches. Es fließt Blut. Was unternimmst du?
A) Ich bitte zwei kräftige Jungs, mir zu helfen, die beiden zu trennen.
B) Da mache ich mir keinen Stress. Das ist definitiv Sache des Gastgebers.
C) Ich stelle mich schützend vor den Verletzten. Wir werden sehen, ob der andere es wagt, mich anzugreifen.
DIE AUFLÖSUNG
Der A-Typ: Wenn etwas passiert, machst du den Mund auf und handelst. Das ist gut. Du solltest dir aber überlegen, welche Folgen dein Handeln für dich selbst haben könnte, und ob du mit deinen Aktionen die Situation nicht noch verschärfst.
Der B-Typ: Du bist ein Vorbild. Mach weiter so!
Der C-Typ: Stell dir vor: du bist das Opfer und keiner hilft. Würdest du dich dann nicht freuen, wenn jemand eingreift?
Übung 30. Nehmen Sie Stellung zu der Meinung der Psychologen.
Die Psychologen meinen,
1) dass man sich vor Gewalttätern wehren muss; 2) dass man den Gewalttätern nicht zeigen darf, dass man vor ihnen Angst hat; 3) dass man aus der Schule nicht allein nach Hause gehen muss, wenn man weiß, dass die Gewalttäter um die Ecke warten; 4) dass man von Gewalttätern nicht weglaufen, sondern schnell wie möglich nach Hilfe suchen muss.
Übung 31. Drücken Sie Ihre Meinung zu den folgenden Problemen aus.
1. Gewalt in der Schule ist eine wachsende Gefahr. 2. Unter Gewalt leiden viele Kinder, Jugendliche, Frauen. 3. Um sich vor den Gewalttätern zu wehren, muss man stark und tapfer sein. Karate und Judo und andere Sportarten helfen allen stärker werden.
LIEBE UND EHE
Übung 1. Familie… Was bedeutet es für Sie?
Geborgenheit, Liebe, Gutenachtkuss, Wärme, Konflikte, Ärger und manchmal Stress, ab und zu Streit und manchmal Belastung, Zuhause, Lächeln am Morgen, Unterstützung, Verständnis füreinander ….
Übung 2. Informieren Sie sich im Internet oder in anderen Nachschlagewerken, was man heutzutage unter dem Begriff «Familie» versteht. Berichten Sie auch darüber, was die Familie in verschiedenen Epochen war.
Übung 3. Ergänzen Sie den nötigen Artikel. Wessen Meinungen stimmen Sie zu?
Iris, 26: Familie ist ____ Stress. Ich will lieber ____ Single bleiben.
Christof, 38: Klar brauche ich ___ Familie. Ich bin ___ Familienmensch, das ist ____ Wichtigste im Leben. Natürlich gibt es manchmal ___ Streit, aber das ist überall so.
Stephanie, 31: Ich bin noch ___ Sigle, doch wichtig ist mir ___ Familie schon. Nervig sind allerdings ___ Familienfeste. Da trifft man ___ Verwandten, die man ewig nicht gesehen hat. Und das finde ich nicht immer lustig.
Sebastian, 16: Meine Eltern sind wie ___ Freunde für mich. Ab und zu gibt es ____ Konflikte und Probleme, aber das ist doch normal, oder? ____ Probleme lösen wir gemeinsam. Später werde ich selbst ___ Familie gründen. ____ Geborgenheit in ___ Familie ist mir sehr wichtig.
Alexander, 23: Mein Traum ist ___ Karriere als ___ Journalist. ____ Frau und ___ Kind sind mir im Moment nicht wichtig. Was ich will, ist ___ Geld, ___ Freiheit und ____ Anerkennung.
Übung 4. Was bringt eine Familie Ihrer Meinung nach zum Glücklichsein?
Unterstützung vom Staat, Haus, Familienauto, Aufmerksamkeit und Rücksicht, Tagesmutter, Schule in der Nähe, Kindergarten, Hund oder Katze, Kühlschrank mit Tiefkühltruhe, Geld …
Übung 5. Was wünschen sich diese Menschen? Und was wünschen Sie sich? Was ist Ihnen wichtig? Wovon träumen Sie?
Familie Siebert, Eltern mit 4 Kindern (16, 14, 8, 5): In unserer Familie ist immer etwas los. Wir sind immer in Bewegung: wandern, campen, Picknick im Grünen. Die Kinder bringen Freunde mit. Das hält uns jung und fit.
Susanne, 33, und Bernd, 35: Wir arbeiten an unserer Karriere. Für Kinder haben wir im Moment keine Zeit. Vielleicht später. Wir wollen das Leben genießen. Wir sind noch jung.
Christina, 41, und Sohn Patrik, 5: Ich bin allein erziehend. Das ist zwar nicht einfach, aber ich komme gut klar. Und Urlaub machen kann man auch zu Hause.
Das Wohnmobil, das Ferienhaus, die Digitalkamera, der Job mit mehr Geld, der Sportwagen, die Tagesmutter, das Gästebett, das Surfbrett, der Computer, der Fernseher, der Videorecorder, die Markenkleidung, der MP3-Player …
Übung 6. Beschreiben Sie die Beziehung zu (einigen) Mitgliedern Ihrer Familie. Benutzen Sie dabei auch die angegebenen Adjektive.
Einträchtig, gestört, kühl, höflich, vertrauensvoll, anstrengend, freundschaftlich, wechselhaft, liebevoll, eng, intim, katastrofall, distanziert, persönlich.
Übung 7. Liebe auf den ersten Blick und dann eine glückliche Beziehung auf immer und ewig − das klingt unglaublich romantisch. Aber wenn zwei wirklich länger zusammen bleiben und sich sogar das Jawort geben wollen, müssen sie einander auch besser kennen lernen und vielleicht auch die eine oder andere Krise gemeinsam durchstehen.
Wann ist es besser zu heiraten? Nehmen Sie Ihre Stellung zu dem Problem. Gebrauchen Sie dabei folgende Redewendungen und Temporalsätze. Beachten Sie die Zeitformen der Verben.
1. Meiner Ansicht nach soll man (nicht) heiraten, bevor / nachdem man ... . 2. Auch wenn zwei Menschen sich kennen gelernt / gefunden haben / vieles gemeinsam unternommen / gemacht haben, ist es eine Garantie dafür, dass … . 3. Ich bezweifle, dass man ... kann / soll, bevor / nachdem man / zwei Menschen ... . 4. Viele Menschen / Psychologen / ich befürchte(n), dass (nicht) ... bevor ... . 5. Das mag schon stimmen, nur frage mich, ob es möglich / sinnvoll / notwendig ist,... zu ..., nachdem / bevor ...
Ich finde, dass man nicht heiraten soll, bevor...
Ich finde es völlig о. к. zu heiraten, bevor...
Viele Leute geben sich das Jawort, nachdem...
z. B. Ich finde, dass man nicht heiraten soll, bevor man einander näher kennen gelernt hat.
a) einander näher kennen lernen; b) die Eltern des Partners kennen lernen; c) sich einander ein wenig angleichen; d) viel zusammen unternehmen; e) den Partner einer gründlichen Prüfung unterziehen; f) den richtigen Mix aus fester Beziehung und persönlicher Freiheit finden; g) das wahre «Innere» des Partners finden; h) intensive Gespräche über die Zukunft führen; i) dem Partner absolute Treue schwören; j) die eine oder andere Krise zusammen durchstehen; k) sich mindestens einmal streiten und es noch einmal miteinander versuchen; l) andere Erfahrungen machen.
Übung 8. Finden Sie im Internet, wie noch das aktuelle Heiratsalter der Frauen und Männer in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Belarus ist. Vergleichen Sie diese Zahlen. Wie sieht die Tendenz heutzutage aus?
Übung 9. Lesen Sie den Text und äußern Sie sich dazu. Wie finden Sie, wenn sich die Jugendlichen im Alter von 16 – 18 Jahren verheiraten?
MINDERJÄHRIGE MÜTTER UND VÄTER
Für viele junge Belarussen ist es wichtig, so früh wie möglich eine eigene Familie zu gründen. Viele glauben, dass ihre erste Liebe die ewige und wahre Liebe ist. Für einige ist die Ehe eine Möglichkeit, das Elternhaus zu verlassen und unabhängig zu sein. Oft dauern solche Beziehungen nur ein paar Monate, max. ein Jahr. Die gewonnene Selbstständigkeit platzt schnell wie eine Seifenblase. Die ungewollten Schwangerschaften bei den Minderjährigen lösen sehr viele Probleme aus, z.B. gesundheitliche, soziale, finanzielle. Die jungen Mütter haben Schwierigkeiten mit dem Lernen in der Schule, sie bekommen oft keinen Schulabschluss und müssen ihn dann später nachholen, sonst bekommen sie keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Viele von den Mädchen entscheiden sich für Abtreibung, was auch zu verschiedenen gesundheitlichen und physischen Problemen führen kann. Einige werden von den Eltern unterstützt, die Mädchen selbst sind aber nicht reif genug, um die Verantwortung für ein Kind zu tragen. Nur sehr wenige der jungen Väter zeigen sich verantwortlich und bereit, zusammen mit dem Mädchen das Kind zu erziehen und eine richtige Familie zu gründen. Deshalb muss man lieber «Zweimal messen als einmal schneiden». Zuerst muss man bestimmt einen Beruf erlernen, um wirklich selbstständig sein zu können, man muss auch den Menschen, den man liebt, gut kennen lernen, und gut überlegen, ob man in alltäglichen Situationen gut zurecht kommt, ob die Lebensvorstellungen ähnlich sind. Auf jeden Fall halten die früheren Ehen laut der Statistik nicht besonders lange [4].
Übung 10. Tauschen Sie Ihre Meinungen zum Thema «Auf immer und ewig − gibt es eine Garantie?» aus. Präsentieren Sie die Ergebnisse in Form von fiktiven Geschichten und stellen Sie die Geschichten im Plenum vor. Diskutieren Sie im Plenum.
Übung 11. «Heiraten: früher und heute» − hat sich die Einstellung zu dem Thema in den letzten 20 Jahren in der Gesellschaft verändert? Äußern Sie Ihre Meinung, insbesondere zu folgenden Punkten:
a) Anzahl der Ehen, früher und heute; b) das durchschnittliche Heiratsalter, früher und heute.
Übung 12. Hören sie die Einstellung zum Text (statistische Angaben) und vergleichen Sie ihre geäußerte Meinung aus der Übung 1 mit den im Text gehörten Angaben zur Situation in Deutschland.
Übung 13. Hören Sie den nächsten Abschnitt «Zusammenleben, ohne zu heiraten» und beantworten Sie die Fragen:
1. Was ist der Grund für die Veränderungen in der Ehe in den letzten 20 Jahren? 2. Wie war das Verhältnis zwischen dem Ehemann und der Ehefrau früher? 3. Was ist heute anders? 4. Welcher bekannte Deutsche hat mit seiner Frau lange zusammen gelebt, bevor er sie heiratete?
Übung 14. Hören Sie den Text bis zum Ende und bestimmen Sie, welche der folgenden Aussagen richtig und welche falsch sind.
a) manche junge Menschen heiraten spät, weil sie einige Zeit unabhängig sein wollen; b) viele Jugendliche möchten erst heiraten und dann zusammen mit dem Ehepartner Geld verdienen; c) in Deutschland studiert man lange, deswegen heiratet man später; d) man muss nicht unbedingt heiraten, um Steuern zu sparen; e) der Glaube an die lebenslange Liebe ist der häufigste Grund, warum junge Deutsche heiraten; f) viele junge Menschen ziehen heutzutage oft in eine andere Stadt um und wollen deswegen einen festen Partner haben; g) in Deutschland werden 50 % aller Ehen geschieden; h) viele Deutsche heiraten noch einmal; i) «Patchwork-Familien» sind Familien, die keine Kinder aus früheren Beziehungen haben.
Übung 15. Lesen sie den Text und versuchen Sie danach die fehlenden Präpositionen einzusetzen.
Das Heiratsalter ist … über 5 Jahre gestiegen. 1970 haben Männer … Durchschnitt … 25 Jahren und Frauen … 23 Jahren geheiratet. Heute sind die meisten Deutschen bei ihrer Hochzeit schon … 30 Jahre alt.
Früher kümmerte sich die Ehefrau … die Kinder und den Haushalt. Der Ehemann verdiente das Geld … die Familie.
Manche heiraten … rein wirtschaftlichen Gründen. Andere heiraten, weil sie … das romantische Ideal der lebenslangen Liebe glauben.
Übung 16. Bilden Sie aus 2 einfachen Sätzen ein Satzgefüge, benutzen Sie dabei die in den Klammern stehenden Konjunktionen.
1. Früher konnten junge Liebespaare erst zusammen wohnen; sie waren verheiratet (wenn). 2. Die meisten Paare leben bereits lange zusammen; sie entscheiden sich zu heiraten (bevor). 3. Es gibt viele Gründe; junge Leute heiraten in Deutschland erst so spät (warum). 4. Viele Studenten möchten erst heiraten; sie verdienen selbst Geld (wenn). 5. Andere wollen das Zusammenleben mit dem Partner erst ausprobieren; sie schließen den Bund fürs Leben (bevor). 6. Manche heiraten; sie glauben an das romantische Ideal der lebenslangen Liebe (weil). 7. Sie wollen der Familie und den Freunden zeigen; sie haben den Partner fürs Leben gefunden (dass).
Übung 17. Welche Rolle spielt das Heiraten Ihrer Meinung nach in unserem Land? Diskutieren Sie darüber.
Übung 18. Äußern Sie Ihre Meinung zu den folgenden Stichpunkten.
1. Was stellen Sie sich unter einem «ungleichen Paar» vor? 2. Kennen Sie in Ihrer Umgebung ungleiche Paare? Inwieweit sind sie ungleich? 3. Wie groß ist die Altersdifferenz zwischen den Partnern? 4. Wie sind ihre Beziehungen? 5. Wie werden die Paare von der Gesellschaft akzeptiert?
Übung 19. Lesen Sie die Aussagen. Lesen Sie dann den Text und markieren Sie die zutreffenden.
1. Ältere Frauen heiraten gern jüngere Männer. 2. Der durchschnittliche Altersunterschied beträgt 3 Jahre. 3. Ungleiche Paare werden von der Gesellschaft sehr gut akzeptiert. 4. Reifere Frauen haben es schwerer neue Partner zu finden als reifere Männer. 5. Junge Frauen, die ältere Männer heiraten, haben mehr Möglichkeiten sich persönlich zu entwickeln. 6. Es ist besser für die ungleichen Paare, Kinder zu adoptieren. 7. Partner mit einem hohen Altersunterschied ergänzen einander in der Beziehung.
Übung 20. Ergänzen Sie die folgenden Sätze anhand des Textes.
1. Wenn eine betagte Frau … . 2. Paare mit einem hohen Altersunterschied … . 3. Je höher das Alter zum Zeitpunkt der Partnerwahl … . 4. Wenn der Mann älter ist, … . 5. Der Kinderwunsch … . 6. Wenn die Liebesbeziehung aufrichtig ist, … .
Übung 21. Ein großer Altersunterschied in der Beziehung: Welche Vor- und Nachteile hat das für beide Partner? Ergänzen Sie das Raster.
Vorteile |
Nachteile |
||
Mann |
Frau |
Mann |
Frau |
|
|
||
|
|
||
Übung 22. Kombinieren Sie die Substantive aus dem Text mit den Adjektiven. Mehrere Kombinationen sind möglich. Erklären Sie, was Sie unter einem (einer) … verstehen. Gebrauchen Sie dabei die Relativsätze: z. B. eine langjährige Ehe ist eine Ehe, die mehrere Jahre dauert.
-
Altersunterschied
aufrichtig
Ehe
langjährig
Partnerschaft
beziehungsstörend
Akzeptanz
glücklich
Beziehungen
Gesellschaftlich
Partner
Groß
Gleichgewicht
Reif
Kinderwunsch
Jung
Generation
(un)gleich
Frau
erfahren
emotional
eifersüchtig
tolerant
Übung 23. Das Rollenspiel. Entscheiden Sie sich für eine der Situationen und übernehmen Sie eine Rolle.
Situation 1. Ralf (54) möchte zum 2. Mal heiraten. Seine neue Frau ist nur ein Jahr älter als seine Tochter. Maria (23), Tochter von Ralf, ist gegen seine Heirat.
Situation 2. Johannes (25) ist Student, hat aber eine Beziehung mit der Frau, die 15 Jahre älter als er. Anne (23), Schwester von Johannes, rät ihm davon ab.
Übung 24. Hören Sie die Kurzbeschreibungen der Paare. Machen Sie Notizen zu jedem Paar.
-
Namen
Namen
Alter
Alter
Berufe
Berufe
Übung 25. Lesen Sie zuerst die Fragen, die an beide Partner gestellt wurden. Hören Sie dann die Interviews. Notieren Sie stichwortartig ihre Antworten. Ergänzen Sie beim zweiten Hören Ihre Notizen.
Günter ∞ Jekaterina
1. Wo habt ihr euch kennen gelernt? 2. Muss man denn für diese Beziehung bestimmet Charakterzüge haben? 3. Gibt es bestimmte «Spielregeln» in eurer Beziehung? 4. Bei euch ist nicht nur Alter sehr unterschiedlich, ihr habt auch verschiedene Nationalitäten. War das wichtig? 5. Jekaterina, wie hat deine Familie Günter empfangen? 6. Habt ihr etwas Lustiges erlebt, was mit eurem Alter zu tun hat?
Franz ∞ Irena
1. Wo habt ihr euch kennen gelernt? 2. Muss man denn für diese Beziehung bestimmet Charakterzüge haben? 3. Gibt es Unterschiede in einer Beziehung, in der einer der Partner älter ist? 4. Gibt es etwas, was man bei eurer Beziehung besonders bedenken soll? 5. Habt ihr etwas Lustiges erlebt, was mit eurem Alter zu tun hat?
Übung 26. Machen Sie anhand Ihrer Notizen eine kurze Zusammenfassung der Interviews.
Übung 27. Lesen Sie den Text durch. Nehmen Sie Stellung zu den bikulturellen Ehen. Was finden Sie positiv dabei? Auf welche Schwierigkeiten können solche Ehen stoßen? Haben Sie was über die Situation mit den bikulturellen Ehen in unserer Republik gehört?
BIKULTURELLE EHEN UND BEZIEHUNGEN
Mit der Globalisierung und der Migration nimmt die Zahl bikultureller Partnerschaften ständig zu. In Deutschland sind 4 % der Einheimischen mit Ausländern verheiratet. In Frankreich ist jede fünfte Ehe bikulturell, das sind 20 %, und in der Schweiz sind es etwa 35 %. Fast jeder dritte Schweizer heiratet eine Ausländerin, fast jede vierte Schweizerin einen Ausländer. 65 % der ausländischen Partner bzw. Partnerinnen von Schweizern stammen aus europäischen Ländern, 35 % sind aus nicht-europäischen Ländern.
Interessant ist auch die Tatsache, dass bikulturelle Beziehungen etwas stabiler sind als andere: 45 % der Ehen zwischen Schweizerinnen und Schweizern werden wieder geschieden, aber nur 39 % der Ehen, bei denen einer der Partner aus dem Ausland kommt.
Was ist bei bikulturellen Paaren anders? In diesen Beziehungen verlässt oft eine Person ihr Heimatland und damit auch ihre Familie und die Freunde und lebt dann mit dem neuen Partner oder der Partnerin zusammen. Nach dem ersten Stadium der Verliebtheit können daher schnell Probleme auftauchen, mit denen die beiden nicht gerechnet haben. Gründe für Probleme sind vor allem Geld und Arbeit, Sprache und Kommunikation, Heimweh und psychisches Wohlbefinden, aber auch die Religion. Dazu kommen oft Probleme mit den Behörden, z. B. wegen der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Wenn ein Ausländer oder eine Ausländerin am neuen Ort keine Arbeit findet, kann dies das Gleichgewicht in der Beziehung schnell stören. Vor allem Männer haben oft Probleme, wenn sie von ihrer Partnerin finanziell abhängig sind. Daher kann eine gute Arbeit und ein offenes Klima am Arbeitsplatz die Integration in einer neuen Umgebung sehr positiv beeinflussen.
Eine wichtige Rolle spielt auch die Sprache. Es entstehen schnell Konflikte, wenn die Partner einander sprachlich nicht verstehen, wenn einer der beiden die Sprache der anderen Person bzw. die Sprache der Umgebung nicht so gut beherrscht. Für die Kinder dagegen kann eine bikulturelle Ehe, in der die Eltern verschiedene Sprachen sprechen, eine Chance sein. Sie lernen meist ohne Probleme mehrere Sprachen.
Viele Menschen, die in eine neue Welt auswandern, denken oft an ihre Heimat und werden dabei traurig. Sie haben ihre alte Welt im Kopf noch nicht verlassen. Gegen Heimweh hilft ein soziales Netz mit neuen Freunden und Freundinnen. Auch die Integration in einen Sportverein, wo meist ein offenes Klima herrscht, kann helfen. Wichtige Faktoren für die Integration sind auch religiöse Werte und Vorstellungen.
Insgesamt kann man sagen, dass für viele bikulturelle Paare das Zusammenleben in einem neuen Land eine große Chance sein kann. Vor allem dann, wenn beide bereit sind, offen auf die Probleme der neuen Umgebung und die Probleme des Partners oder der Partnerin einzugehen [4].
Übung 28. Persönliche Stellungnahme: Welche Familienformen würden Sie «bevorzugen»? Begründen Sie Ihre Entscheidung.
Übung 29. Reif für das Kind? Bilden Sie die Satzgefüge mit dem Temporalsatz.
z. B. Als ich mit meinem Studium fertig war, bekam ich mein erstes Kind.
Als ich mit meinem Studium fertig war,... |
wird die Geburtenrate weiter sinken. |
Erst wenn man sich im Beruf etabliert hat,... |
bis man wirklich reif dafür ist.
|
Bevor die jungen Menschen nicht finanziell unabhängig sind,... |
sind viele Männer richtige Kindermuffel. |
Seitdem ich Mutter zweier Kinder bin,... |
bekam ich mein erstes Kind. |
Man sollte am besten mit dem Kinderkriegen warten,... |
führe ich ein ruhigeres und verantwortungsbewusstes Leben. |
Solange der Staat Familien mit Kinder nicht genügend unterstützt,... |
soll man Kinder kriegen. |
Während Frauen ab 25 Kinder wollen,... |
sollten sie mit den Kindern warten.
|
Übung 30. Kinder oder Karriere? Welcher Meinung sind Sie? Gebrauchen Sie dabei die Temporalsätze.
z. B. Ich finde, dass man keine Kinder kriegen soll, bevor man fertig studiert hat.
Fertig studieren, eine Ausbildung machen, einen guten Job finden, heiraten, sich an den Partnergewöhnen, alles im Leben ausprobieren, ausreichend Spaß im Leben haben, viel herumkommen, das Leben auf die Reihe kriegen, viele Erfahrungen machen, genügend Geld sparen, eine eigene Wohnung finden.
Übung 31. Setzen Sie die passenden Konjunktionen ein. Äußern Sie sich zum Problem der Schwangerschaft.
Annika, 44: Ich glaube, man sollte Kinder bekommen, … man sie wirtschaftlich versorgen kann. Meine Karriere war immer sehr wichtig für mich. … aber vor einem Jahr meine beste Freundin schwanger wurde, wollte ich auch ein Kind. Mein Sohn ist jetzt zwei. Ich sehe keine Probleme, … Frauen mit 40 oder auch später Kinder bekommen. … mein Sohn groß ist, kann ich ihm etwas bieten. Und das ist es, was zählt, und nicht das Alter.
Christian, 48: Ich bin stolzer Vater von 5 Kindern, habe mein erstes mit 21 bekommen, … ich noch lange nicht reif dazu war. … ich heute daran denke, bin ich nicht sicher, ob das richtig war.
Sven, 28: Ich glaube, man sollte Kinder kriegen, … man sich darüber im Klaren ist, warum man Kinder will und wie man sie erziehen will. Vielleicht liegt das richtige Alter zwischen 30 und 35. Aber nicht später. … Mann und Frau über 45 sind, sollten sie dran denken, Opa und Oma zu werden. Außerdem wird das Kind es nicht leicht im Leben haben, es alte Eltern hat.
Christiane, 21: Ich bekam meine Tochter, … ich noch zur Schule ging. Ich war 16 und hatte keine feste Beziehung, … das passierte. Meine Eltern waren geschockt, … ich ihnen von meiner Schwangerschaft erzählte. Mein Vater meinte: … ich ein Kind mit 16 kriege, ruiniere ich meine Zukunft. Natürlich ist es nicht einfach, sich um das Baby zu kümmern, … man selbst noch so jung ist. Aber ich habe es geschafft. … ich heute mit meiner Tochter spazieren gehe, halten mich viele für das Au-pair-Mädchen.
Übung 32. Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Kind? Verbinden Sie Sätze mit den on den Klammern angegebenen Konjunktionen. Machen Sie sich mit den Aussagen der deutschen Jugendlichen bekannt. In wessen Meinungen willigen Sie ein? Gebrauchen Sie bei den Antworten verschiedene Kommunikationsformeln.
z. B. Christoph möchte Kinder haben, wenn er mit dem Studium fertig ist.
Christoph, 19: Kinder? Toll! Aber nicht jetzt. Vielleicht nach dem Studium. (wenn)
Anna, 28: Für Kinder habe ich momentan keine Zeit. Das Thema Nummer eins ist für mich eine Karriere. Und das bedeutet, Vollzeit zu arbeiten, mit vielen Überstunden. (solange)
Sabine, 35: Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Kinder...? Nein, dazu bin ich noch nicht bereit. (wenn)
Andreas, 26: Ich will Kinder. Zwei oder drei sogar. Aber meine Zukunft ist noch unklar. Da wäre es unverantwortlich, Kinder zu kriegen. (solange)
Miriam, 22: Mein Freund und ich sind erst seit sechs Monaten zusammen. Wir wollen schon ein Baby. Aber wir sollten warten und uns zuerst besser kennen lernen. (bis)
Übung 33. Eltern mit 16 oder mit 40 - wie ist Ihre Meinung dazu? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie?
Übung 34. Teilen Sie sich in 2 Gruppen mit polaren Positionen. Diskutierten Sie das Thema und notieren Sie dabei die Argumente jeder der Gruppen in die Tabelle.
Übung 35. Familie Behrens hat fünf Kinder. Lesen Sie den Text durch. Was, glauben Sie, bedeutet für diese Familie Glück?
MAN MUSS ETWAS TUN FÜR SEIN GLÜCK
Familie Behrens berichtet:
Wir haben 5 Kinder. Drei davon kamen auf einen Streich. Als wir erfuhren, dass wir Drillinge bekommen würden, waren wir überglücklich. Von Anfang an haben wir positiv gedacht. „Ach du lieber Gott, wie soll das werden“ – solche Gedanken kamen uns nicht in den Sinn. Gespannt und erwartungsvoll waren wir, haben viel überlegt und geplant, auch alles dafür getan, dass die Schwangerschaft gut verlief. Als die drei dann gesund und munter auf die Welt kamen, waren wir überglücklich.
Doch man muss sich nichts vormachen: Das Leben mit 5 kleinen Kindern ist enorm anstrengend. Wir schlafen nur selten einen Nacht durch. Morgens um 6 beginnt der Stress uns abends um 8 endet er. Die drei Kleinen sind jetzt fast 3 Jahre alt und sehr mobil. Man muss ständig alle im Blick haben. Dazwischen Anna, unsere fünfjährige Tochter und Hannes, unser achtjähriger Sohn. Beide wollen auch zu ihrem Recht kommen. Es war sehr schwierig, Hilfe von außen zu erhalten. Als Familie mit 5 Kindern haben wir schon jede Menge Absagen von Haushaltshilfe und AU-pair-Mädchen bekommen. Wir sind sozusagen unvermittelbar. Zum Glück greifen uns beide Großmütter kräftig unter die Arme.
Das Glück fällt nicht vom Himmel. Man muss schon einiges dafür tun. Für uns heißt das auch, die eigenen Wünsche eine Zeit lang zurückzustellen. So ist es für uns zurzeit kaum möglich, abends zusammen wegzugehen. Nur weil wir das akzeptiert haben und dem Vergnügen nicht hinterher weinen, geht es uns gut. Wenn uns aber doch mal eine kurze Auszeit gegönnt wird, können wir sie umso mehr genießen. Neulich sind wir nach Berlin gefahren. Ganz ohne Kinder, nur zu zweit. Dort waren wir in einem Musical und haben Freunde besucht. Es war fast so wie früher. Nein, besser. Weil es etwas Besonderes war. Man muss solche Glücksmomente genießen. Die gibt es natürlich auch mit Kindern. Wenn die Kleinen zufrieden vor sich hin spielen oder im Rudel spazieren gehen, dann sich wir Eltern besonders stolz [13].
Übung 36. Sehen Sie den Text noch einmal durch. Unterstreichen Sie die Ausdrücke 1-5 im Text und ordnen Sie die passenden Erklärungen a-e zu.
1 |
jemandem/ sich eine Auszeit gönnen |
a |
sich Freizeit nehmen, Pause machen |
2 |
auf eine Streich |
b |
gleichzeitig, auf einmal |
3 |
unvermittelbar sein |
c |
etwas ist nicht ohne Mühe zu erreichen |
4 |
jemandem unter die Arme greifen |
d |
keine Zusage bekommen können |
5 |
etwas fällt nicht vom Himmel |
e |
jemandem behilflich sein, helfen |
Übung 37. In welcher Reihenfolge werden im Text die Hauptinformationen genannt?
a) anstrengendes Leben, kein Schlaf; b) Hilfe der Großmütter; c) alle Babys gesund und munter; d) nur manchmal eine Auszeit; e) große Vorfreude: Drillinge; f) keine Haushaltshilfe und kein Au-pair-Mädchen.
Übung 38. Arbeiten Sie zu zweit. Ihr Partner gibt Ihnen einen Satz mit Konnektor vor. Vervollständigen Sie den Satz. Dann tauschen Sie. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.
z. B. Mein Traumhaus ist ein altes Schloss, deshalb … .
Übung 39. Schwangerschaft hat alle Pläne durchkreuzt. Selten gab es so viele Diskussionen über Mutter-Sein und Kinder-Kriegen wie in diesem Jahr. Aber wie verändert ein Kind das Leben? jetzt.de hat mit Sarah, 18, Franzi, 19, Claudia, 22, und Angie, 22, darüber gesprochen, wie sie schwanger wurden und was danach passierte. Die Frauen treffen sich regelmäßig bei pro familia in Augsburg. Dort betreut die Sozialpädagogin Elke Gropper «Mama Mia», eine Gruppe, in der sich minderjährige und jugendliche Schwangere und Mütter austauschen und voneinander lernen. Lesen Sie die Aussagen der jungen Eltern und nehmen Sie Ihre Stellung dazu.
Wie war der Moment, in dem ihr erfahren habt, dass ihr schwanger seid?
Franzi: Scheiße.
Claudia: Ich dachte: «Oh Gott, ich will eine rauchen».
Angie: Wenn es nicht geplant war, denkt man tatsächlich nur: Scheiße!
Kennt ihr Leute, die in eurem Alter geplant ein Kind bekommen?
Sarah: Von meinem Cousin die Freundin. Sie ist 17, war schwanger und hatte ihr Kind verloren. Danach wollte sie wieder eines – und hat es jetzt.
Claudia: In der Krabbelgruppe habe ich eine 26-Jährige getroffen. Die hat erzählt, dass ihr erstes Kind geplant war. «Was?», haben die anderen entgegnet. «Mit 26 ein Kind? Boah, wie früh!» Darauf habe ich gesagt: «Entschuldigung, das ist doch ein super Alter!»
Wie haben eure Eltern reagiert?
Angie: Meinem Papa ist es nicht so geheuer, wenn er als Opa angesprochen wird. Er ist erst 40.
Elke Gropper: Das heißt, er ist auch mit 18 Vater geworden.
Angie: Deswegen haben mir meine Eltern auch keine Vorwürfe gemacht.
Sarah: Der Freund meiner Mutter ist 19 Jahre älter als sie. Er sagte, das könne er nicht mitmachen. Er fühle sich zu alt für Baby-Geschrei. Wir sind ausgezogen.
Du und dein Kind?
Sarah: Ich war noch schwanger und bin mit meiner Mutter und meinen Geschwistern ausgezogen. Jetzt aber wohne ich mit meinem Freund zusammen.
Fühlt man sich anders, wenn es jemanden gibt, der nur wegen einem selbst auf der Welt ist?
Claudia: Im Volleyball oder im Studium reden alle über die Schulzeit und übers Weggehen. Es ist ja eigentlich nicht lange her, aber mir kommt es so vor, als wäre das in einem anderen Leben passiert. Ich fühle mich steinalt.
Sarah: Wenn ich mir meine alten Freunde anschaue, denke ich: «Mann, sind die alle doof im Kopf. Die sind nicht reifer geworden».
Claudia: Aber für die ist das, was wir jetzt erzählen, auch sterbenslangweilig.
Vermisst ihr eure Vergangenheit?
Franzi (nickt): Es ist dieses Flexibel-Sein, das ich vermisse. Einfach nur shoppen und durch die Stadt laufen ohne zu fragen: «Luca, magst was trinken, Luca, magst was essen?» Ich kann mich nicht einfach mal gehen lassen. Mindestens einmal am Tag muss er raus, sonst kriegt der 'ne Krise. Ob es regnet, stürmt oder schneit: Raus! Und … (Luca taucht in dem Moment hinter Franzis Stuhl auf) Luca, magst Du was trinken?
Wolltet ihr abtreiben?
Sarah: Ja. Aber ich habe erst Ende des dritten Monats erfahren, dass ich schwanger bin. Gleich auf dem ersten Ultraschallbild habe ich die Hände und Füße gesehen. Sonst hätte ich’s abtreiben lassen. Aber … zu spät!
Franzi: Ich habe schon nachgedacht.
Hast du mit deinem Freund darüber geredet?
Franzi: Wir haben zusammen in einem Heim für Jugendliche gewohnt. Er ist in mein Zimmer gekommen und meinte: «Und?» Und ich: «Verdammte Scheiße, ich bin schwanger!» Er darauf: «Boah, toll!» Und ich habe nur gesagt: «Halt's Maul!» und habe die Tür zugemacht. Ich war da schon ziemlich entschlossen, abzutreiben. Dann hat meine Mama gesagt, ich müsse erst zu pro familia. Als ich hier war, habe ich über alles nochmal nachgedacht.
Wenn ich es sofort, nachdem ich es erfahren hatte, im nächsten Zimmer hätte wegmachen können, dann hätte ich es bestimmt gemacht. Ich war ja auch zufrieden mit meinem Leben. Ich habe Freunde gehabt, ich war nächtelang weg. Und dann auf einmal: DU BIST SCHWANGER! Das ist wie ein Schlag ins Gesicht.
Habt ihr den Eindruck, dass immer mehr Teenager, gerade an der Hauptschule schwanger werden? Es heißt sogar, dass ein Kind für manche der Ersatz für eine fehlende berufliche Perspektive ist.
Claudia: Ich denke, dass das stimmt.
Franzi: Immer mehr junge Mütter denken: Ich habe keinen Bock, was zu tun. Schule ist eh scheiße, Abschluss schaffe ich eh nicht – mach’ ich halt ein Kind.
Elke Gropper: Gut, wir hatten hier auch 15-Jährige von der Hauptschule. Und sicher gibt es Studien, die Tendenzen aufzeigen. Aber ich arbeite nun seit drei Jahren mit jugendlichen Müttern und jede Einzelne hat eine ganz eigene Geschichte. Daraus einen allgemeingültigen Schluss zu ziehen, ist schwierig.
Was ist das Schöne am Mutter-Sein?
Claudia: Dass ich jetzt schon weiß, dass mein Leben nicht ganz umsonst gewesen sein wird. Und dass ich die Entscheidung jetzt nicht mehr treffen muss, wann ich ein Kind kriege! Eine Freundin meinte, als sie von der Schwangerschaft erfuhr: «Aber du weißt doch gar nicht, ob du den Mann für immer liebst!» Ich glaube, die Frage kann man nie beantworten.
Franzi, was ist für dich das Schöne?
Franzi (überlegt lange): Jaaa … zu sehen, wie er aufwächst, wenn er sagt «Mama» und – ich bin nicht so allein.
Du klingst mitgenommen.
Franzi (leise): Ja.
Elke Gropper: Man muss aber sagen, dass du gerade aus einer Phase kommst, in der dir drei Tage kotze-elend war und du mit Luca alleine warst. An anderen Tagen kommst du hier rein und strahlst und findest es toll, Mutter zu sein.
Franzi: Ja, aber manchmal gibt es Tage, da schmeißt er die Zahnbürste ins Klo, dann geht er wieder raus und räumt den kompletten Kühlschrank aus und schüttet die Sahne im ganzen Zimmer rum. Und wenn das dann mehrmals am Tag passiert, wird man echt … aargh!
Wie wohnst du im Moment?
Franzi: Allein. Mit ihm.
Angie: Das ist aber auch sauschwierig Es ist schon echt gut, wenn man seine Eltern in der Nähe hat.
Franzi: Ja, dass sie nur einen Moment aufpassen, nur fünf Minuten!
Ist Mutter-Sein ein Beruf?
Claudia: Hm. Ja und Nein. Ich finde es körperlich nicht so anstrengend. Es geht halt nur auf die Nerven.
Franzi: Es wird erst schlimm, wenn ich keinen Schlaf mehr bekomme oder wenn ich, was selten vorkommt, lange weggehen kann. Dann komme ich heim und denke: «Oh scheiße, Franzi: Zwei Stunden hast Du noch! (Gelächter) Dann wacht er wieder auf. (Pause) Und das ist schon auch sehr schön».
Übung 40. Wem könnten Sie über Ihre Schwangerschaft im jungen Alter mitteilen und warum?
Übung 41. Vermuten Sie, wie Ihre Eltern auf die Nachricht über die Schwangerschaft im jungen Alter reagieren würden?
JUGENDLICHE SUBKULTUREN
Übung 1. Man sagt: «Jede Generation hat ihre eigene Kultur. Ältere Leute können es nicht verstehen: sie glauben, dass die Röcke von Mädchen zu kurz oder zu lang sind». Sind Sie damit einverstanden?
Übung 2. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den Begriff «Jugendliche Subkulturen» hören?
Übung 3. Da sind die Definitionen des Begriffes «Subkultur». Formulieren Sie Ihre eigene Definition dieses Begriffes.
Der Begriff der Subkultur («Unterkultur») ist ein seit den 1940er Jahren in der Soziologie verwendeter Terminus, mit dem eine bestimmte Untergruppe der sozialen Akteure einer Kultur beschrieben wird, die sich im Hinblick auf zentrale Normen deutlich von der „herrschenden“ Kultur abgrenzen. Eine völlige Abgrenzung, also eine den herrschenden Normen diametral gegenübergestellte soziale Gruppe wurde von Soziologen (vor allem seit den Protestbewegungen der 1960er Jahre) häufig als «Gegenkultur» (counterculture) bezeichnet. Umgangssprachlich werden beide Begriffe häufig synonym verwendet.
In der Soziologie dient das Konzept der Subkulturen zur Beschreibung und Erklärung folgender Phänomene:
a) abweichendes Verhalten vom «mainstream»; b) charakteristische Eigenschaften und Verhaltensformen gesellschaftlicher Gruppen; c) zeitgenössische Wertorientierungen und Lebensstile; d) Definitionen von Subkulturen; e) die Rückschlüsse über die Intensität der Bindung der Mitglieder sowie die Position zu den herrschenden Wertmaßstäben zulassen: Image: äußeres Erscheinungsbild, Musik, Kleidung; Haltung: körperlicher Ausdruck, Körpersprache; Jargon: spezielles Vokabular oder Slang («Codes»).
Übung 4. Warum identifizieren sich Jugendliche mit Subkulturen?



Übung 5. Sind Subkulturen wirklich etwas «anderes» oder sind sie völlig normal?
Übung 6. Machen Sie sich mit den Texten bekannt! Welche Aussagen des Textes könnten Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung bestätigen?
JUGENDLICHE SUBKULTUREN IN DER BUNDESREPUBLIK
Die folgende Darstellung ist natürlich sehr grob und lückenhaft; es fehlen z.B. Autonome und Skinheads. Allerdings geht es nicht um eine Auflistung von Moden und Freizeit-Stilen (Biker, Skater, Emos ...), sondern um einige Wendepunkte im Verhältnis von Jugendlichen zu Erwachsenen und Staat. Kommerzialisiert wird seit spätestens den 50er Jahres jede jugendliche Subkultur, seit spätestens 1990 auch nicht mehr mit Verspätung, sondern bei Techno sofort, bei Hip-Hop in Deutschland sofort. Man sollte also die Unterscheidung in «nur / schon kommerzialisiert», «Möchte gern-...» und «echt» aufgeben.
HALBSTARKE
 1948
- 1960
1948
- 1960
Wirtschaft, Politik: Wiederaufbau, Regierung Adenauer (CDU) von 1954-1963, «Wirtschaftswunder»: sinkende Arbeitslosigkeit (bis 1970 auf 0,7%), Wachstumsraten zwischen 5% und 12%, Integration der BRD in die NATO öffentliche Ausdrucksformen, Gruppenstile: Jeans, Lederjacke, Nieten, Ketten, Plaketten, Mopeds («Kreidler Florett»); Elvis Presley: Jail-House-Rock; Bill Haley: Rock around the Clock; männlich orientiert Grundpositionen; Verhältnis zu früheren Subkulturen, zu Erwachsenen und Staat: Abgrenzung von den Ausdrucksformen der Erwachsenen (Musik, Kleidung...). Dass man ausgerechnet durch brave Pflichterfüllung Erfolg haben sollte, hatte sich bei der Generation der Eltern gründlich blamiert; daher die Halbstarkenkrawalle (siehe dazu auch mannigfaltige Details in einem Buch von Sebastian Kurme: Halbstarke ..., Seite 206 ff); Kampf um die Anerkennung der Jugend als eigener Gruppe und Phase; «Wir wollen unser eigenes Leben haben!» Dabei aber keine Ablehnung eines künftigen Lebens als normale Erwachsene, z.B. noch keine Mädchen- und Frauenemanzipation.
HIPPIES,
ALTERNATIVE  1965
– 1975
1965
– 1975
Wirtschaft, Politik: erste Wirtschaftskrisen (Kohle): Einbruch der Wachstumsrate 1967 auf -0,1%, aber 1968 wieder bei +7,5%, Anstieg der Preise im 1. Ölpreisschock auf 7% (1973) und 7% (1974), Anstieg von Löhnen und Gehältern um 11% (1974); Regierungskoalition aus SPD und CDU 1966 - 1969, Regierung Brandt (SPD) 1969 - 74, Wahlrecht von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt (1970), Notstandsgesetze, Studentenunruhen; Vietnamkrieg öffentliche Ausdrucksformen, Gruppenstile: feminin, indisch, indianisch; langes unfixiertes Haar auch für Jungen; Wohngemeinschaften, Haschisch, LSD. Die ersten: The Pranksters («Witzbolde») 1964/65 in den USA, Jimi Hendrix: Hey Joe, The Beatles: Magical Mystery Tour; The Grateful Dead, frühe Live-Mitschnitte. Grundpositionen; Verhältnis zu früheren Subkulturen, zu Erwachsenen und Staat: «Make Love not War», «Flower-Power»: Ablehnung des Lebens der Erwachsenen; z.T. Widerstand gegen Politik und Staat; positive Utopien; «Durch unsere Lebensweise würde die Welt besser werden».
PUNKS
 1976
– 1983
1976
– 1983
Wirtschaft, Politik: 2. Ölpreisschock 1980, Rezession: Wachstumsraten zwischen plus-minus 1 Prozent 1980, '81, '82, seitdem (bis heute, 2003) steigende oder hohe Arbeitslosigkeit: 7% - 12%, Jugendarbeitslosigkeit, Preisentwicklung 1981 = 6,3%; Regierung Schmidt SPD/FDP, Regierung Kohl CDU/SPD ab 1982.
Herbst 1977: Ermordung des Bankiers Jürgen Ponto durch die RAF, Hanns-Martin Schleyer (Präsident der deutschen Arbeitgeberverbände und Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie) wird von der RAF entführt), Entführung einer Lufthansa-Maschine durch arabische Terroristen, Befreiung der Geiseln (Urlauber) durch deutsches Sonderkommando (GSG 9), als Folge werden drei führenden deutschen RAF-Leute (Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl-Raspe) tot in ihren Gefängniszellen aufgefunden, Schleyer von der RAF ermordet, «Rasterfahndung».
Öffentliche Ausdrucksformen, Gruppenstile: Sex Pistols: Anarchy in the UK, DAF, Einstürzende Neubauten, KFC, Mittagspause, Liebesgier, Mania D., Fehlfarben, Der Plan, Abwärts, Die Krupps. Scharf davon zu trennen ist die Neue-Deutsche-Welle: Ideal, Extrabreit, Trio, Nena ... Diese Bands und diese Musik wurde von den Punks der ersten Generation wegen ihres Bezuges auf Spaß, Harmlosigkeit und Einverständnis mit dem Lauf der Dinge heftig abgelehnt.
Grundpositionen; Verhältnis zu früheren Subkulturen, zu Erwachsenen und Staat: «No future», «Null Bock»; Das Beharren auf unbedingter Geltung der eigenen Autonomie - auch gegen sich selbst, gegen alle Tabus: Schulabbruch, Wohnung im Keller, Verweigerung der üblichen Vorgaben für Rockmusik (Melodie) und Instrumente, Ablehnung von «Verschnörkelung», Ablehung von konventioneller (auch Hippie-) Kleidung und Schmuck, Äußerung eigener Wut und Kraft (Buttons), Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst (Sicherheitsnadeln und Rasierklingen als Schmuck, Selbstverletzung), gegenüber anderen Subkulturen, gegenüber «falschen» Punks oder «falschem» Punkrock (Bandauftritte als Schlägerei); Emanzipation der Mädchen; auch sprachliche Autonomie (deutsche Texte wegen Verständlichkeit). Aus dem Kult der Tat («straight» satt «lasch») teilweise Übergang zu Rechtsradikalismus als Pose (DAF) oder im Ernst (Skinheads); meist aber links-anarchistisch orientiert.
TECHNO
UND HIP HOP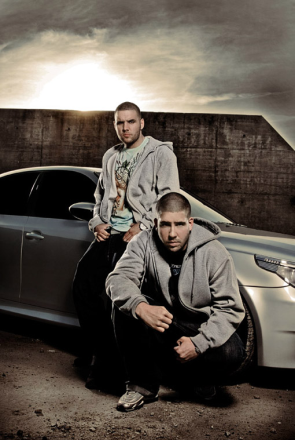
SEIT ETWA 1990
Wirtschaft, Politik: Auflösung der UdSSR, 1990 Anschluss der DDR an die BRD, anhaltende Massenarbeitslosigkeit in Deutschland um oder über 10%, 1993 Einbruch der Wachstumsrate auf -2,4%, 1998 Etablierung der Grünen als Regierungspartei.
Deutschland und Frankreich sind die führenden EU-Staaten und entwickeln zugweise eine antiamerikanische Politik.
Techno und Hip Hop stehen ziemlich konträr zueinander und haben eigentlich nur die Zeit gemeinsam.
Öffentliche Ausdrucksformen, Gruppenstile: Hip Hop entstand in den 70er Jahren in den Ghettos der US-Metropolen als Straßenkultur. Elemente des Drogenhändler-, Banden- und Gefängnislebens werden zitiert und fantasievoll verwendet in Kleidung (zerrissene, übergroße Kleidung, keine Schuhbänder, Kapuzen), Tanz (Breakdance), Musik (Rap: rhythmischer, gereimter Sprechgesang; Stimme als Geräuschimitation; scratchen: enorme Präzision und Geschicklichkeit im Umgang mit (zunächst) Analogplattenspielern als neuartigen Musikinstrumenten) und sonstiger Kunst (Graffiti). Hip Hop war zunächst der Lebensstil der Aussortierten, die aufsteigen wollten (siehe unten der Brief). Der Wille zum Aufstieg per Kunst äußerte sich im Hereintragen von Konkurrenz - als Spaß («Battle») oder aggressiv (man könnte einmal dem Streit von 2004 zwischen Bushido und Fler nachsteigen). Das Aufsteigermotiv hat sich schon seit einigen Jahren verselbständigt zur Demonstration, dass man diesen Aufstieg geschafft habe: Vorführung von Reichtum ("bling", teure Autos), jedenfalls in der «Gangsta-«oder» «Aggro»-Variante Verachtung für alle, die den Sieg in der Konkurrenz angeblich nicht schaffen: Frauen, Ausländer, «Neger» - oder ihn nicht verdienen: «Gymnasiasten». Diese Verachtung äußert sich in Texten, die Schmerz und Gewalt genussvoll in derber und obszöner Sprache vorführen. Hip Hop ist in diesem Segment männlich, sexistisch, chauvinistisch orientiert. Wer diesen Link für einen krassen Ausreißer hält, der liest eben diesen hier: ein schönes Beispiel, wie Aggressivität einerseits zur Pose wird, andererseits ab und zu auch durchaus praktiziert wird (man muss nur nach dem ersten Angeklagten googlen).
Techno: Mit seiner Glück- und Tanzseligkeit, auch in der bunten Kleidung, deutliche Anklänge an die Hippiekultur; Techno demonstriert(e) mit der «Loveparade» und den entsprechenden Parolen (z.B. «One world, one future») den Willen zum Genuss, zu Hedonismus (auch durch Drogen wie Extasy, eine Musikrichtung heißt z.B. Trance). Techno ist eher weiblich orientiert, der Gestus der aggressiven Konkurrenz ist Techno fremd.
Grundpositionen; Verhältnis zu früheren Subkulturen, zu Erwachsenen und Staat: Hip Hop: Ich (nicht: wir!) habe Erfolg, und zwar auf meine Weise, nach meinen Regeln (d.h. «cool»). Techno: Gemeinsam die Freizeit genießen. Beide Subkulturen grenzen sich nicht von den Normen und Werten der Gesellschaft ab (anders als Hippies und Punks), Hip Hopper führen z.B. ein erstaunlich spießiges Privatleben (wohnen bei Muttern, Kinder; siehe auch unten den zweiten Brief), insofern sind sie in einigen Elementen mit den Halbstarken vergleichbar.
Analytisches Material zum Hip Hop: ein Artikel aus der «Zeit» von 2005 zur Aggressivität von Aggro etc. - der «Spiegel» über Rechtsnationalismus bei Fler – zur Indizierung (BPjM) von Bushido- und Sido-Songs – die Bundesprüfstelle für jugendgefährende Medien (BPjM) über den Umgang mit jugendgefährdenden Hip-Hop-Texten.
G OTHS
OTHS
Sie sind keine Ankömmlinge…
Große geschminkte Augen auf weißem vom Puder Gesicht, schwarzes zerrauftes Haar und schwarze Kleidung. Ein normaler Mensch nennt sie Satanisten, aber für sich selbst haben sie einen anderen Name gewählt…
Die Gothic-Kultur ist eine vielseitige Subkultur, die ab Anfang der 1980er Jahre stufenweise aus dem Punk- und New-Wave-Umfeld hervorging und sich aus mehreren Splitterkulturen zusammensetzt.
Sie existierte in den 1980er und 1990er Jahren im Rahmen der Dark-Wave-Bewegung und bildete bis zur Jahrtausendwende den Knotenpunkt der sogenannten Schwarzen Szene.
Die Anhänger der Gothic-Kultur werden länderübergreifend als Goths bezeichnet, obgleich diese Bezeichnung innerhalb der Szene eher selten Anwendung findet. Die Zugehörigkeit einer Person zur Gothic-Kultur ist unabhängig von Glauben, Konfession und Religionszugehörigkeit. Goths beschäftigen sich in Grundzügen mit dem Thema Religion und ziehen individuelle Schlüsse, wodurch eine nähere Bestimmung nicht möglich ist. Bei manchen Goths herrscht eine Sehnsucht nach den Ursprüngen des Glaubens und dem Heidentum vor.
Einerseits werden diese Symbole als Provokationsmittel verwendet und andererseits- als Ausdruck von Kirchen- und Religionskritik. Ein weiterer bedeutsamer Treffpunkt und Aufenthaltsort für Goths ist der Friedhof.
Im 19. Jahrhundert waren Friedhöfe nicht nur Begräbnisstätten und Sammelstellen, sondern öffentlich und gern besuchte Plätze, die von ihren Besuchern als Orte der Meditation und mentalen Sammlung aufgesucht wurden. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Friedhof zu einem tabuisierten Ort.
PARKOUR



Parkour ist eine Sportart, bei der die effiziente, schnelle und elegante Fortbewegung durch den urbanen und natürlichen Raum ohne Zuhilfenahme von Hilfsmitteln im Mittelpunkt steht.
Das Ziel von Traceuren, wie die Aktiven in der Parkour-Szene genannt werden, besteht darin, gebaute und/oder natürliche Hindernisse zu überwinden. Die Ursprünge von Parkour sind in einer alten Ausbildungsmethode des französischen Militärs zu finden, nämlich in der «méthode naturelle». Diese bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts von George Hébert entwickelte Methode, sollte der effizienten und schnellen Überwindung von Hindernissen in unwegsamen Geländen dienen.
Raymond Belle, ein Veteran der französischen Armee in Vietnam entwickelte «méthode naturelle» und gab seine Kenntnisse an seinen Sohn David Belle weiter. Parkour entstand schließlich, als der Jugendliche David Belle mit seiner Familie Ende der 1980er Jahre in einen Vorort von Paris zog.
Anfang der 1990er Jahre schloss sich David Belle mit einigen Gleichgesinnten zusammen und gründete die Gruppe «Yamakasi».
Weit gefasst reicht die Altersspanne der in der Parkourszene Aktiven von etwa 11 bis 40 Jahren. Die Altersgruppe zwischen 15 bis 25 Jahren bildet den zahlenmäßig größten und lebhaftesten Anteil an der Szene.
Wie in den meisten urbanen Bewegungssportarten mit erhöhtem Verletzungsrisiko (wie z.B. dem Skateboarding oder Inlineskaten) ist der Anteil der Mädchen und jungen Frauen in der Parkourszene sehr gering. Im Parkour sind Ausrüstungsgegenstände und Hilfsmittel (abgesehen von gut sicherem Schuhwerk) nicht notwendig. Somit sind kaum finanzielle Aufwendungen notwendig, um sich in der Szene zu engagieren, so dass prinzipiell.
Für die Parkourszene lassen sich (aktuell noch) kaum eine Handvoll Symbole benennen. Zwar bringen sportliche Notwendigkeiten eine gewisse Kleiderordnung mit sich, die sich durch Ansprüche an eine ausreichende körperliche Bewegungsfreiheit erklären lässt. Zum Standard-Sportdress der Traceure gehören (deshalb) gut sitzende stoßabsorbierende Schuhe mit einer griffigen Sohle, meist lange Trainingshosen und locker sitzende Shirts. In Einzelfällen werden zur Vermeidung von Abschürfungen Handschuhe getragen – und auch Schweißbänder sind ein verbreitetes sportmodisches Accessoire: Beide Kleidungsstücke gehen jedoch wohl kaum als szenespezifische Symbole oder gar als Indikatoren für eine Szenezugehörigkeit durch.
Man transportiert verschiedene Bewegungsabläufe noch aus dem klassischen (Geräte)Turnen, so wurden nun zunehmend Formen aus der Akrobatik, dem Bodenturnen, verschiedenen Kampfsportarten und sogar Tanzformen integriert. Auf diese Weise entwickelten sich verschiedene Richtungen im Parkour, so dass sich verschiedene Strömungen etablierten.
Parkour ist ein Lebensstill und eine Philosophie. Parkour stellt in diesem Sinne eine Projektionsfläche dar, auf die Akteure ihre eigenen Vorstellungen, Haltungen und Präferenzen vor dem Hintergrund eines grundlegenden Wertekanons projizieren können.
DIE MODS
« In
the early sixties a lifestyle evolved for young people that was
mysterious, exciting and fast-moving. It was directed from within and
needed no justification from without. Kids were clothes-obsessed,
cool, dedicated to R&B and their own dances. They
called themselves «Mods»
(Richard
Barnes, 1979).
In
the early sixties a lifestyle evolved for young people that was
mysterious, exciting and fast-moving. It was directed from within and
needed no justification from without. Kids were clothes-obsessed,
cool, dedicated to R&B and their own dances. They
called themselves «Mods»
(Richard
Barnes, 1979).
Die ersten Mods kamen aus sicheren Mittelklassefamilien. Die Anfänge der Bewegung sind auf 1959 zu datieren. Anfangs gab es keinen speziellen Look oder eine Gruppierung, die Mods genannt wurden, lediglich eine geringe Anzahl von Leuten, die gerade zu «Kleidungs-Besessen» waren.
England war zu jener Zeit in der Blüte der Traditional Jazz (Trad) Begeisterung. Jene modebewussten jungen Männer interessierte dieser aber nicht. Sie identifizierten sich mit Modern Jazz und seinem neuen, sauberen und weichem Image. Es war ihre Modern Jazz Neigung und das Interesse an «schwarzer Musik» (Rhythm & Blues), nach der sie sich selbst benannten – «Modernists». Nach und nach wurden die Modernists zu einem kleinen Kult – Mods. Die Mods trugen Italien Look Anzüge, Strickjacken, «Fred Perry» Shirts (Tennis Shirts). Darüber, über dem Anzug, trug man häufig einen Parka. Die Frisuren waren kurz, ordentlich und glatt.
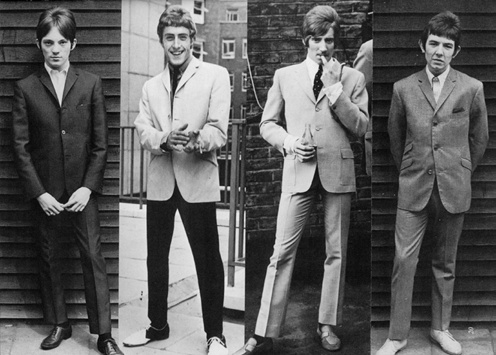
Die Mode der Mädchen war für den Mod Look ebenso wichtig. Aber diese Mode war ziemlich unattraktiv. Das Gesicht musste makellos aussehen. Die Modernist-Mädchen trugen Männerhosen, flache Schuhe, kurze Haare und formlose Kleider und Pullover. Die Mädchen wurden maskuliner.
EMO



Emo bezeichnet ursprünglich ein Subgenre des Hardcore-Punk, auch Emocore genannt, das sich durch das stärkere Betonen von Gefühlen wie Verzweiflung und Trauer sowie durch die Beschäftigung mit gesellschaftlichen, politischen und zwischenmenschlichen Themen auszeichnet. Ungefähr seit dem Jahr 2000 wird mit Emo auch ein jugendkulturelles Modephänomen bezeichnet, das mit dem gleichnamigen Musikstil nur mittelbar in Verbindung steht.
Die Definition gestaltet sich von Emo schwierig, weil die Genre-Bestimmung und die daraus resultierende musikalische Einteilung innerhalb der Hardcore/Punk-Szene – zumindest in den Anfangstagen – nicht in diesem Maße vorhanden war. Viele sehen den Begriff gleichnamigen Musikgenre angehören als einen von außen hineingetragenen Musikbegriff für eine Art von Musik, die so gar nicht abgrenzbar ist. Ein zusätzliches Problem der Abgrenzung ist das seit Beginn der 2000er Jahre entstandene Modephänomen. Dieses bezieht sich auf bestimmte Haarschnitte und Kleidungsstücke, die ursprünglich von bestimmten, dem Genre assoziierten Bands getragen wurden. Mit diesem Stil werden heute allerdings zumeist Bands in Verbindung gebracht, die zumindest im engeren Sinne nicht dem gleichnamigen Musikgenre angehören.
Als Ursprung von Emo gilt die sogenannte Washington D.C.-Hardcore-Punk-«Schule», die neben den Westcoast-Gruppen und später dem New York Hardcore als die wichtigste und stilbildendste in der Hardcore-Bewegung gilt. Bands wie Minor Threat, Government Issue oder auch die frühen Bad Brains prägten den Hardcore-Punk aus Washington.
Auch in Deutschland taten sich zunehmende inhaltliche Zweifel an gängigen subversiven Politstrukturen auf, die dann auch ihr kulturell-musikalisches und identitäres Ventil suchten und in Emo als Ausdrucksweise fanden. Charakteristisch sind: ein schwarz (vereinzelt auch platinblond) gefärbter, meist gescheitelter Pony, Röhrenjeans, enge T-Shirts, Arm- oder Schweißbänder, Buttons, Sportschuhe, dunkel geschminkte Augen (bei beiden Geschlechtern) sowie Nietengürtel und Hornbrillen, enge Pullover, Westen, Cordhosen, Hemden, Worker-Jackets und Lederschuhe die vorherrschenden Kleidungsstücke [13].
Übung 7. Lesen Sie das Interview mit einer Anhängerin der Gothic-Szene. Warum Kat eine Vorliebe für die so genannte schwarze Szene hat, wollte Vitamin. de genauer wissen.
AM ANFANG WAR ES NUR PROVOKATION
Katharina Dobrodonova ist eine Anhängerin der Gothic-Szene. Die 21-Jährige kommt ursprünglich aus der sibirischen Stadt Kemerowo und lebt seit sieben Jahren in Deutschland.
WER SIND DEINER MEINUNG NACH GOTHS?
Goths? Es sind Menschen, die ihre Unzufriedenheit mit der Gesellschaft nach außen zeigen, und zwar mit dem Mittel der Provokation. Meiner Meinung nach hat jeder von uns einen gewissen Dachschaden und ist etwas «aufmerksamkeitsgeil», sonst würde ich ja nicht mit meinem extremen Outfit durch die Straßen laufen. Die inneren Werte der Goths sind kaum zu beschreiben und bei jedem anders. Ich glaube, dass jeder von uns einen ausgeprägten Hang zur düsteren Seite des Lebens hat.
Seit wann bist du auch Goths? Warum hast du dich dafür entschieden?
So klischeehaft es auch sein mag: Ich habe damals, mit 15 Jahren, angefangen schwarz zu tragen, weil ich wegen eines Erlebnisses in tiefe Depressionen gefallen bin. Gleichzeitig interessierte ich mich damals für Esoterik und Religion. Ich hörte Musik von Aphex Twin, Massive Attack oder Dolphin. Ich trug Schwarz, ohne mich jemals als Goth zu bezeichnen, weil das Wort in meinem Wortschatz noch nicht vorhanden war. Die «schwarzen Menschen» gehörten für mich einer Sekte an, mit denen ich keinen Kontakt hatte. Doch sie weckten mein Interesse und später habe ich mich mit ihnen identifizieren können.
Welche Vorurteile gegenüber Goths kennst du?
Oh, da gibt es mehr als genug! Wie zum Beispiel, dass wir in Särgen schlafen und Blut trinken würden, und wir hätten einen Hang zum Sadismus. Das ist natürlich Quatsch. Viele Goths ihrereseits versuchen solche Klischees zu entkräften. Mir ist es egal, was irgendwelche «Normalos» über mich denken.
Ist es wahr, dass Goths sich nach dem Tod sehnen?
Kat lacht. Klar, viele sehen Friedhöfe als etwas Romantisches an und sind vom Tod fasziniert. Ich gehöre sicherlich auch dazu. Aber ich kenne noch keinen einzigen Selbstmörder aus der Szene.
Was willst du mit deinem auffallenden Aussehen zeigen?
Am Anfang war es Provokation. Nun ist es mein Lifestyle. Natürlich zeige ich damit auch meine Zugehörigkeit zur Szene und auch meine linke politische Einstellung.
Was macht man auf Gothic-Partys?
Man macht da absolut normale Sachen wie Bluttrinken und Opfergaben. Nein, Quatsch! Genau das Gleiche wie auf jeder Party: tanzen, trinken, Leute treffen.
Wie soll sich der echte Goth kleiden?
Was man trägt, ist jedem selbst überlassen. Ich finde nur, es sollte schon etwas von Gothic-Ästhetik haben. Es reicht nicht, sich die Lippen schwarz anzumalen oder einen schwarzen Ledermantel zu kaufen. Es muss immer Geschmack haben und eine morbide Ästhetik vorhanden sein [13].
Übung 8. Machen Sie ein Projekt zum Thema «Jugendliche Subkulturen» und präsentieren Sie es in der Gruppe.
AUFGABEN ZU DEN TEXTEN ZUM HÖRVERSTEHEN
Aufgaben zum Text «Laura über Mode und Schönheit»
Übung 1. Was fällt Ihnen spontan zum Begriff «Mode» ein?
Übung 2. Was passt zusammen?
a) Stil |
1. Markt, wo man gebrauchte Sachen verkaufen und kaufen kann |
b) Spitzen/Rüschen |
2. Sachen von einer bekannten Firma |
c) Klamotten |
3. wie man sich anzieht |
d) Markenartikel |
4. Sachen zum Anziehen |
e) Flohmarkt |
5. Dekoration/Schmuck an Kleidern |
Übung 3. Sehen Sie sich die Wortliste an. Schreiben Sie dann in den Kasten 6 Wörter aus dieser Wortliste auf.
Mode, Thema, Schmuck, leuchtend, Farben, Stil, knallig, Zeitung, Straße, Jeans, bummeln, Herbst, Rüschen, Kaufhaus, Werbung, gewaschen, Kleider, Regal, Klamotten, Geschäft, bunt, Markenartikel, Vater, Flohmarkt.
|
|
|
|
|
|
Übung 4. Hören Sie danach das Interview mit Laura. Kreuzen Sie in Ihrem Kasten die Wörter an, die Sie hören.
Übung 5. Lesen Sie nun die folgenden Sätze. Hören Sie dann das Interview noch einmal. Entscheiden Sie: Habe ich das im Text gehört oder nicht? Markieren Sie ja oder nein.
|
ja |
nein |
Laura geht gerne einkaufen. |
|
|
Sie macht jede Mode mit. |
|
|
Momentan ist schwarz modern. |
|
|
Laura mag leuchtende Farben. |
|
|
Ihr Stil sind Jeans und T-Shirts. |
|
|
Kleider trägt sie bei Familienfeiern. |
|
|
Sie kauft immer Markenartikel. |
|
|
Ihre Freundinnen und sie sprechen über Mode. |
|
|
Sie tauscht mit ihrer Schwester Klamotten. |
|
|
Sie geht nicht oft auf den Flohmarkt. |
|
|
Übung 6. Beantworten Sie die folgenden Fragen.
1. Was findet Laura am Thema Mode interessant? 2. Welche Farben sind momentan «in»? 3. Welche Farben trägt Laura gerne? 4. Wie ist Lauras Stil? 5. Wann trägt sie Kleider? 6. Mit wem spricht Laura über Mode? 7. Wer bezahlt, wenn Laura etwas Neues kauft? 8. Wohin geht sie nicht so oft?
Aufgaben zum Text «Amelie, Christoph und Christine über Taschengeld»
Übung 1. Hören Sie die drei Interviews und beantworten Sie die folgenden Fragen.
|
Amelie |
Christoph |
Christine |
Wie viel Taschengeld bekommt sie/er und ist sie/er damit zufrieden? |
|
|
|
Was bezahlt sie/er davon? |
|
|
|
Wie verdient sie/er sich noch Geld dazu? |
|
|
|
Wie verdienen ihre Freunde sich Geld? |
|
|
|
Von wem bekommt sie/er Geld geschenkt und wann? |
|
|
|
Bekommen ihre Geschwister mehr oder weniger Taschengeld als sie? |
|
|
|
Übung 2. Was ist der Unterschied zwischen geschenktem und selbst verdientem Geld? Wer sagt was?
1. Man ist stolz auf das selbst verdiente Geld. 2. Es gibt keinen Unterschied. 3. Das selbst verdiente Geld macht selbstständiger. 4. Selbst verdientes Geld gibt man schneller aus.
Übung 3. Nehmen Sie Stellung zu den folgenden Fragen. Diskutieren Sie in den Gruppen. Gebrauchen Sie dabei verschiedene Kommunikationsformeln.
1. Worin sehen Sie die Vorteile eines regelmäßigen Taschengeldes? 2. Halten Sie es für gut, dass sich Jugendliche noch Geld dazu verdienen?
Übung 4. Möchten Sie wissen, wie viel Taschengeld Ihre Kommilitonen bekommen. Interviewen Sie doch Ihren Nachbarn zu diesem Thema. Teilen Sie allen über das Erfahrene mit.
Aufgaben zum Text «Wie verdienen sich Jugendliche in Deutschland Geld?»
Übung 1. Wie verdienen sich Jugendliche zusätzliches Geld? Hören Sie, was sieben Jugendliche auf diese Frage antworten, und kreuzen Sie alles an, was sie nennen.
In einer Fabrik arbeiten, der Mutter im Haushalt helfen, in Hotels arbeiten, Babysitten, Nachhilfe geben, Zeitungen austragen, Autos waschen, Tiere betreuen, im Altenheim helfen, Brötchen austragen, der Oma helfen, Häuser ausräumen, für ältere Leute einkaufen, Arbeit in der Landwirtschaft.
Übung 2. Hören Sie jetzt die Jugendlichen noch einmal und achten Sie darauf, welche Tätigkeit öfter genannt werden.
Übung 3. Welche Arbeiten würden Sie auch machen? Welche auf gar keinen Fall? Warum? Äußern Sie sich dazu.
Übung 4. Suchen Sie in Ihrem Kurs nach einem Partner, der in möglichst vielen Punkten andere Ansichten hat als Sie selbst. Führen Sie mit ihm einen Dialog und versuchen Sie Ihren Partner von Ihrem Standpunkt zu überzeugen.
Übung 5. Vergleichen Sie die Situation mit dem geldverdienen bei den Jugendlichen in Ihrem Land mit der in Deutschland.
Aufgaben zum Text «Danilo über Musik»
Übung 1. Jugend und Musik in meinem Land. Formulieren Sie zu diesem Thema einige Sätze.
Übung 2. Was passt zusammen?
a) Friedrich Nietzsche |
1. Musikwerk für Chor, Solisten und Orchester |
b) Hiphop |
2. Fähigkeit, Tonhöhen in der Musik genau zu hören |
c) Livemusik |
3. deutscher Philosoph |
d) Stereoanlage |
4. Musikrichtung aus den USA |
e) Oratorium |
5. vor Publikum direkt gespielte Musik |
f) Gehör |
6.Hi-Fi-Anlage |
Übung 3. Bitte hören Sie das Interview und beantworten Sie die folgenden Fragen.
1. Wie würde Danilo das Leben ohne Musik finden? 2. Welche Musik hört er gern? 3. Welche Instrumente spielt er? 4. Wie stellt er sich seine berufliche Zukunft vor? 5. Wie ist er zu seiner Liebe zur Musik gekommen? 6. Warum musiziert er mit anderen zusammen in Chören und Orchestern?
Übung 4. Definieren Sie folgende Begriffe mit einem Relativsatz.
z. B. Kroate: Ein Mann, der aus Kroatien kommt.
1. Barockmusik; 2. Schulmusiker; 3. Chor; 4. Oratoriensänger; 5. Walkman.
Aufgaben zum Text «Kristina über Cliquen »
Übung 1. Was ist typisch für eine Clique? Diskutieren Sie über die folgenden Aussagen.
1. Die Clique ist fast so wichtig wie die Familie. 2. Man darf keine Freunde außerhalb der Clique haben. 3. Alle tragen die gleichen Klamotten. 4. Es gibt oft Aufnahmebedingungen. 5. Alle gehen auf dieselbe Schule oder machen dieselbe Ausbildung. 6. Viele Cliquen verlangen Mutproben. 7. Die Mitglieder verbringen die Freizeit gemeinsam.
Übung 2. Welche Wörter passen zu einem Friedhof? Streichen Sie alle nicht passenden Wörter weg.
Tunnel, Gebüsch, lachen, Grab, Tote, Schaukel, Blumen, Kreuze, Musik, Vampire, tanzen, Gespenst.
Übung 3. Haben Sie Angst, nachts allein auf einen Friedhof zu gehen?
Übung 4. Kristina aus Schwerin stellt sich zuerst vor. Sie hat viele Hobbys. Kreuzen Sie an, was Sie gehört haben.
|
ja |
nein |
a) Sie spielt Tennis. |
|
|
b) Sie geht zum Schwimmen. |
|
|
c) Sie fährt Rad. |
|
|
d) Sie verbringt die Zeit mit ihren Freunden – ohne besonderes Programm. |
|
|
e) Sie geht oft ins Kino. |
|
|
f) Sie liest gern. |
|
|
g) Sie macht mit ihren Freunden Musik. |
|
|
h) Sie malt gern. |
|
|
i) Sie interessiert sich für Fußball. |
|
|
Übung 5. Hören Sie jetzt den ersten Teil des Interviews und beantworten Sie folgende Fragen.
1. Warum geht Kristinas Clique abends auf den Friedhof? 2. Wovor haben die Jugendlichen Angst? Vor den Toten? Davor, dass jemand aus dem Gebüsch oder aus einem Grab kommt? Vor einer anderen Clique? 3. Warum ist die andere Clique auf dem Friedhof?
Übung 6. Hören Sie jetzt den zweiten Teil des Interviews. Was haben Sie über Kristinas Clique gehört? Sind Sie mit folgenden Aussagen einverstanden?
1. In der Clique gibt es mehr Jungen als Mädchen. 2. Die Clique hat strenge Aufnahmebedingungen. 3. Schlägereien sind verboten. 4. Kristinas Eltern finden die Clique gut. 5. Kristina findet gut, dass sie in der Clique Freunde hat.
Übung 7. Was halten Sie von Mutproben?
Aufgaben zum Text «Carolin über Adoption»
Übung 1. Was ist Ihre Meinung zu den folgenden Behauptungen?
Ein guter Vater, eine gute Mutter kann nur sein, wer sein Kind selbst gezeugt oder geboren hat, wer seinem Kind jeden Wunsch erfüllt, wer sein Kind selbst erzieht, wem sein Kind das Wichtigste auf der Welt ist, wem das Wohl seines Kindes am Herzen liegt.
Übung 2. Ordnen Sie die folgenden Wörter einander zu.
a) adoptieren |
1. es passiert viel/es gibt viel Leben |
b) leibliche Familie |
2. ohne dass jemand es sieht oder bemerkt |
c) Schimpfwörter |
3. die Familie, in der ich geboren bin, mit der ich blutverwandt bin |
d) mit Herzklopfen |
4. unter Stress stehen, viel Stress haben |
e) unauffällig |
5. aufgeregt sein, ängstlich sein |
f) in Druck sein |
6. ein fremdes Kind als eigenes annehmen |
g) stammen aus |
7. kommen aus, geboren sein in |
h) viel los sein |
8. schlimme Wörter, die andere beleidigen |
Übung 3. Hören Sie jetzt das Gespräch. Stimmen die folgenden Behauptungen?
1. Carolin fühlt sich in ihrer Adoptivfamilie sehr wohl. 2. Obwohl sie eine dunklere Hautfarbe hat, hat sie in Deutschland noch nie Probleme gehabt.
Übung 4. Hören Sie jetzt das Gespräch noch einmal und stellen Sie fest, ob Sie das gehört haben.
1. Carolin weiß noch nicht lange, dass sie ein adoptiertes Kind ist. 2. Sie ist das jüngste von vier Kindern in der Familie. 3. Als Kind hatte sie wegen ihrer Hautfarbe mehr Probleme als heute. 4. Wenn sie sich angegriffen fühlt, entfernt sie sich möglichst schnell. 5. Carolin hat sich schon öfters gewünscht, nicht adoptiert worden zu sein. 6. Sie hat keine Lust, nach Indien zu fahren. 7. Früher interessierte sie sich mehr für Indien als heute. 8. Sie würde gern ihre leibliche Mutter kennen lernen. 9. Sie fühlt sich manchmal einsam, da sie keine anderen adoptierten Kinder in Münster kennt. 10. Sie glaubt, dass adoptierte Kinder immer mehr Probleme haben als nicht adoptierte.
Übung 5. Arbeiten Sie in kleinen Gruppen. Besprechen Sie folgende Fragen. Präsentieren Sie die Ergebnisse der Diskussion im Plenum.
1. Was denken Sie über Adoption? 2. Wie stehen Sie zu internationalen Adoptionen? 3. An Carolins Stelle, welche Fragen würden Sie Ihrer leiblichen Mutter stellen?
Übung 6. Lesen Sie zusätzliche landeskundliche Informationen. Äußern Sie Ihre Meinung dazu.
DAS ADOPTIONSRECHT
Grundvoraussetzung für eine Adoption (juristischer Begriff «Annahme als Kind») ist das Wohl des Kindes. Ein adoptiertes Kind wird wie ein eheliches in die Familie eingegliedert. Das bedeutet, dass alle verwandtschaftlichen und rechtlichen Beziehungen zur leiblichen Familie erlöschen. Die Einwilligung zur Adoption kann erst gegeben werden, wenn das Kind acht Wochen alt ist. Ausländische Kinder erwerben durch die Adoption die deutsche Staatsangehörigkeit. Eine Adoption kann nur in ganz eng begrenzten Ausnahmefällen wieder aufgehoben werden.
Adoptieren heißt: für immer. Wie das auf Geburt beruhende Eltern-Kind-Verhältnis ist auch das Adoptionsverhältnis praktisch nicht mehr auflösbar. Adoptiveltern sollen sich bewusst sein, dass sie ein adoptiertes Kind nicht nur bei «Sonnenschein» haben können. Sie müssen auch bereit sein, Schwierigkeiten mit ihm durchzustehen. Wenn man ein Kind adoptiert, ist das «für immer». Man kann das Kind nicht zurückgeben, wenn Konflikte auftreten oder wenn es sich anders entwickelt, als man es sich vorgestellt hat.
Da der Wunsch nach einem deutschen Adoptivkind im Säuglingsalter von den Vermittlungsstellen oft nicht erfüllt werden kann, versuchen Adoptionsbewerber immer häufiger, ein ausländisches Kind zu adoptieren. Die Probleme, die sich daraus ergeben, werden oft übersehen oder zu leicht genommen. Adoptionen von Kindern aus der Dritten Welt müssen aber im Interesse von Eltern und Kind besonders sorgfältig überlegt sein – im Allgemeinen sollte notleidenden Kindern aus Entwicklungsländern bevorzugt in ihrer Heimat geholfen werden.
Im Jahre 1991 wurden in Deutschland 7142 Kinder und Jugendliche adoptiert, davon 6835 im alten Bundesgebiet und 307 in den neuen Bundesländern. Diese Zahl wäre sehr viel höher, wenn alle Adoptionswünsche erfüllt werden könnten. Tatsächlich gibt es aber seit Jahren weit mehr adoptionswillige Eltern als Kinder, die adoptiert werden können, zumal im bevorzugten Säuglings- und Kleinkindalter. Ende 1991 standen 21826 Bewerbern nur 1285 zur Adoption vorgemerkte Kinder gegenüber. Fast die Hälfte der Adoptivkinder war unter sechs Jahre alt, etwa jedes fünfte stammte aus dem Ausland: aus Indien, aus Polen, aus Rumänien usw.
Übung 7. Recherchieren Sie über das Problem der Adaption in Ihrer Republik. Gibt es viele adoptierte Kinder? Weh darf ein Kind adoptieren? Wie ist Ihre Einstellung zur Adoption?
Übung 8. Schreiben Sie einen Zeitungsartikel zum Thema «Adoption im 21. Jahrhundert: pro und contra».
Aufgaben zum Text « Andreas, Maja, Nathalie über Schüleraustausch»
Übung 1. Würden Sie gern an einem Schüleraustausch teilnehmen? Wenn ja, in welches Land möchten Sie gerne? Warum? Könnten Sie sich vorstellen, an einem Austausch mit Brasilien teilzunehmen? Was würde Sie an diesem Land interessieren?
Übung 2. Drei junge Deutsche haben in unterschiedlichen Ländern an einem Schüleraustausch teilgenommen. Jetzt stellen sich die drei Schüler vor. (Erster Teil des Interviews) Tragen Sie die Informationen in die Liste ein.
Name |
Alter |
Stadt |
Schule |
Gastland |
Andreas |
|
|
|
USA |
Maja |
|
|
|
Frankreich |
Nathalie |
|
|
|
Polen |
Übung 3. Was glauben Sie, was die drei über ihr Gastland berichten? Spekulieren Sie ein bisschen. Denken Sie einmal an das Essen, die Schule oder die Gasteltern.
Andreas (die USA) |
Maja (Frankreich) |
Nathalie (Polen) |
|||
positiv |
negativ |
positiv |
negativ |
positiv |
negativ |
|
|
|
|
|
|
Übung 4. Hören Sie jetzt die Antworten auf die Frage, wie die drei jungen Leute zu ihrem Gastland gekommen sind: durch eine Städtepartnerschaft; durch einen Freund; durch die Kirchengemeinde; durch einen Austausch oder über Bekannte?
Übung 5. Hören Sie jetzt die Antworten auf die Frage, was sie in den Familien erlebt haben. Welche Aussage passt zu wem?
1. Ich bin unheimlich gut aufgenommen worden. 2. Die Mahlzeiten haben einen höheren Stellenwert als in Deutschland. 3. Ich bin liebevoll behandelt worden. 4. Das Essen hat immer den gleichen Ablauf. 5. Es gibt für jedes Familienmitglied einen eigenen Fernseher. 6. Die Familie hat nicht gefragt, wie wir in Deutschland leben. 7. Ich hatte ein Einzelzimmer. 8. Ich wurde immer gefragt, was gekocht werden sollte. 9. Die ganze Familie ist zum Essen anwesend. 10. Es wird oft Essen außer Haus bestellt. 11. Ich habe versucht, Sachen abzulehnen. 12. Den Eindruck, das Essen ist das Wichtigste, fand ich nervig. 13. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nicht über Sex sprechen darf. 14. Abendessen im familiären Kreis gibt es kaum.
Übung 6. Hören Sie jetzt die Antworten auf die Frage, was sie in der Schule des Gastlandes erlebt haben. Machen Sie Notizen, was Andreas, Maja und Nathalie berichten. Gebrauchen Sie bei der Interpretation die indirekte Rede.
Übung 7. Möchten Sie gern einen Schüleraustausch mit Deutschland machen? Wenn ja, in welche Stadt, an welche Schule / Hochschule, wie sollte Ihre Gastfamilie sein? (Kinder, Wohnung, Tiere, Berufe…). Stellen Sie sich Ihre fiktive Gastfamilie vor.
Übung 8. Wie stellen Sie sich einen Tag in einer deutschen Familie vor? Beschreiben Sie einen Tag vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, diesen Tagesablauf einer deutschen Schulklasse zu schicken und von ihr kommentieren zu lassen. Oder haben Sie vielleicht einen Internet-Anschluss?
Übung 9. Schüleraustausch zwischen 2 weit entfernten Regionen ist ja sehr teuer. Wie kann man so einen Austausch finanzieren?
Aufgaben zum Text «Sechs Jugendliche über Drogen»
Übung 1. Lesen Sie die beiden Gesetze. Was ist verboten? Was ist ab welchem Alter erlaubt? Wie ist das in eurem Land?
Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit.
§4 Alkoholische Getränke. In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter sechzehn Jahren weder abgegeben noch darf ihr Verzehr gestatten werden.
§9 Rauchen in der Öffentlichkeit. Das Rauchen in der Öffentlichkeit darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht gestattet werden.
Betäubungsmittelgesetz.
§29 Straftaten. Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer Betäubungsmittel ohne Erlaubnis nach § 3 Abs.1 Nr.1 anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder in sonstiger Weise verschafft.
Übung 2. Hören Sie jetzt die Vorstellung der Interviewpartner. Tragen Sie das Entsprechende in die Liste ein.
Name |
Alter |
Wohnort |
Schule |
Malte |
|
|
|
Britta |
|
|
|
Philipp |
|
|
|
Markus |
|
|
|
Oliver |
|
|
|
Martin |
|
|
|
Übung 3. Was schätzen Sie, rauchen an deutschen Schulen keine – wenige – einige – relativ viele – sehr viele – alle Schüler? Hört jetzt die Antworten auf die Frage: «Rauchen in deiner Klasse schon viele?» Tragen Sie die Antworten unten ein.
1. Malte … . 2. Philipp … . 3. Markus … . 4. Martin … .
Übung 4. Hören Sie jetzt die Antworten auf die Frage: «Warum greifen die jungen Leute überhaupt zu Drogen, Alkohol oder Zigaretten?» Gibt es einen Unterschied in den Aussagen zwischen Britta und den Jungen? Welchen?
Übung 5. Hört den Abschnitt: «Warum greifen junge Leute …» noch einmal. Tragen Sie die Aussagen der Jugendlichen in Stichpunkten unten ein.
Übung 6. Hört die letzte Frage: «Sollten die Drogengesetze gegen Haschisch zum Beispiel in Deutschland verschärft werden? Oder sollten sie liberalisiert werden?» Wer sagt was? Bitte ordnen Sie zu.
– Martin – Philipp – Oliver – Malte
1. Ich bin dagegen, Drogen wie in Holland zu verkaufen, das ist zu gefährlich. 2. Ich bin für die Legalisierung von Drogen wie Haschisch, die Jugendliche irgendwann sowieso ausprobieren. 3. Die Gesetze sollten nicht strenger gemacht werden. 4. Die Gesetze sollten liberalisiert werden, weil Jugendliche sonst sehr schnell kriminalisiert werden. 5. Haschisch ist genauso gefährlich wie Alkohol und Zigaretten. 6. Schärfere Gesetze würden vielleicht helfen, den Drogenkonsum zu verringern.
Übung 7. Warum rauchen, trinken oder nehmen Ihrer Meinung nach Jugendliche Drogen? Überlegen Sie, mit welchen Maßnahmen Eltern, Freunde, die Schule oder der Gesetzgeber gegen einen sich ausdehnenden Konsum von Alltagsdrogen wie Alkohol und Nikotin, aber auch gegen weiche Drogen wie Haschisch vorgehen können?
Übung 8. Planen Sie ein Rollenspiel.
Die Situation ist: Auf einer Party betrinkt sich ein Klassenkamerad von Ihnen in kurzer Zeit mit Whisky. Als Sie und der Lehrer es bemerken, ist es schon zu spät. Sie bringen ihn nach Hause. Wie reagieren am nächsten Tag seine Eltern, seine Klassenkameraden, seine Klassenkameradinnen, der Lehrer, seine Freundin? Spielen Sie die Situation.
Aufgaben zum Text «Heiko und Britta über Jugend und Stress»
Übung 1. Stress … Durch welche Umstände Ihrer Meinung nach kann man in Stress geraten?
Übung 2. Hören Sie jetzt das Interview mit Heiko. Hat er Stress? Wodurch entsteht der Stress? Machen Sie bitte Stichpunkte.
Übung 3. Hören Sie das Interview noch einmal. Was sagt Heiko, was sagt er nicht?
|
Er sagt das |
Er sagt das nicht |
Später bin ich wahrscheinlich auch der Meinung, dass die Schulzeit die schönste Zeit war. |
|
|
Ich habe zweimal die Woche Nachmittagsunterricht, das ist normal. |
|
|
Der Musikleistungskurs ist für mehrere Schulen zusammen, weil es nicht so viele Fachlehrer gibt. |
|
|
Der Nachmittagsunterricht beginnt um 15.15 Uhr. |
|
|
An manchen Tagen habe ich bis halb sechs Unterricht, dann muss ich meine Hausaufgaben nicht machen. |
|
|
Was macht Heiko gegen den Stress? Wie finden Sie die es?
|
richtig |
falsch |
den Kopf bewegen |
|
|
in den Keller gehen |
|
|
sich aufregen |
|
|
Schlagzeug spielen |
|
|
eine Stunde schlafen |
|
|
Übung 4. Welche Metapher, welches Bild gebraucht Heiko für das Wort Stress?
Übung 5. Hat Britta Stress? Welche Aktivitäten betreibt sie? Machen Sie Stichpunkte.
Übung 6. Hören Sie jetzt das Interview noch einmal. Welche Erklärung hat Britta dafür, dass sie keinen Stress hat? Die Aktivitäten von Britta fassen sich in vier Gruppen einteilen.
Musik |
Sport |
Haushalt |
Job |
|
|
|
|
Übung 7. Überlegen Sie, wozu Britta das macht? Formulieren Sie Sätze nach dem Muster: Britta spielt Volleyball, um Kontakt mit anderen Menschen zu bekommen.
Übung 8. Haben Sie manchmal Stress? Was tun Sie dagegen? Oder seien Sie auch Lebenskünstler / Lebenskünstlerinnen wie Britta? Diskutieren Sie in der Gruppe.
Aufgaben zum Text «Berid über Scheidung ihrer Eltern»
Übung 1. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Wenn sich die Eltern scheiden lassen, wer leidet in erster Linie darunter?
Übung 2. Hören Sie zunächst das ganze Interview und machen Sie dabei Notizen zu folgenden Punkten:
1. Zum Verhältnis zwischen Berid und ihrem Vater. 2. Zum Verhältnis zwischen Berid und ihrer Mutter.
Übung 3. Hören Sie das Interview noch einmal und beantworten Sie die folgenden Fragen.
1. Wann haben sich die Eltern scheiden lassen? 2. Warum blieb Berid nach der Scheidung bei ihrer Mutter? 3. Wer gehört zu ihrer Familie? 4. Worunter leidet sie am meisten? 5. Warum sagt Berid ihrer Mutter nicht, dass sie deren Freunde nicht mag? 6. Warum hält Berid es für unmöglich, dass sich ihre Eltern versöhnen und wieder zusammenziehen? 7. Was wünscht sie sich für ihre Zukunft?
Übung 4. Berid gebraucht in diesem Interview fünfmal den Ausdruck «sozusagen». Können Sie herausfinden, warum sie ihn gebraucht? Was will sie wohl damit ausdrücken?
Sie haben sich sozusagen beide sehr verändert. Weil mein Vater früher meine Mutter ein bisschen unterdrückt hatte, macht jetzt meine Mutter sozusagen umso mehr Musik. Sie sind sozusagen durch die Scheidung zu verschieden geworden. Die Familie ist sozusagen total zerbrochen. Ich wünsche mir, dass meine Eltern sozusagen wieder miteinander reden.
Übung 5. Diskutieren Sie im Plenum folgende Fragen.
1. Sollten Ihrer Meinung nach Eltern, die sich trennen wollen, wenigstens solange zusammenbleiben, wie die Kinder noch klein sind? 2. Sollen Kinder ein Mitspracherecht haben, bei welchem Elternteil sie bleiben wollen? Wenn ja, ab welchem Alter? 3. Berid sagt, dass ihre Eltern für sie kein Vorbild mehr seien. Haben Sie ein Vorbild? Was erwarten Sie von einem Vorbild?
Übung 6. Wie meinen Sie? Mit wem sollen die Kinder nach der Scheidung der Eltern bleiben? Nennen Sie möglichst mehr Argumente.
Übung 7. Sind die Scheidungskinder Problemkinder? Welche Beispiele könnten Sie aus Ihrer Lebenserfahrung anführen?
Aufgaben zum Text «Manuela über das Verhältnis zu ihren Eltern»
Übung 1. Bevor Sie das Interview mit Manuela hören, überlegen Sie, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen sollen? Was finden Sie gut? Was ist nicht gut?
rausgehen bei Streit – Stärke zeigen – Kontrolle – Probleme diskutieren – Harmonie suchen – Grenzen setzen – Türen knallen – Freiheiten lassen – sich entschuldigen – gemeinsam essen – reden – dem Kind vertrauen – Hausarbeit teilen – alleine etwas unternehmen – Ohrfeigen verteilen – gemeinsam den Urlaub planen – gemeinsam Freizeit verbringen – Gespräche abbrechen …
Übung 2. Was bedeuten die Wendungen? Bitte verbinden Sie.
a) über die Stränge schlagen
|
1) überanstrengt sein und die Geduld verlieren |
b) Kinkerlitzchen |
2) einen Ausflug aufs Land machen |
c) «Vorzeigetochter» |
3) etwas Unwichtiges |
d) ins Grüne fahren |
4) über eine Grenze hinausgehen |
e) genervt sein
|
5) ein gut erzogenes Kind, auf das die Eltern stolz sind |
Übung 3. Hören Sie jetzt das Interview. Machen Sie sich Notizen. Was erfahren Sie über Manuela, den Vater, die Mutter, den Bruder.
Übung 4. Hören Sie den ersten Teil des Interviews noch einmal. Finden Sie bitte fünf Dinge, die Manuela an ihren Eltern gut findet.
Übung 5. Hören Sie den zweiten Teil des Interviews noch einmal. Sagt das Manuela im Interview?
|
Ja |
Nein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Übung 6. Hören Sie den letzten Teil des Interviews noch einmal. Was sagt Manuela über ihren Bruder? Streichen Sie die falschen Aussagen weg.
1. Er ist selten da. 2. Er hört mir zu. 3. Manchmal gibt es auch Ärger mit ihm. 4. Er packt mit an. 5. Er ist ein guter Junge. 6. Er ist ein faules Stück. 7. Er ist völlig unterschiedlich zu mir. 8. Er ist ein Junge und kann sich mehr erlauben. 9. Er glaubt, dass er reifer ist. 10. Er ist sechzehn. 11. Er hat eine Freundin.
