
B.Schlink Der Vorleser / Der Vorleser материалы для подготовки / Schlink-Der_Vorleser
.pdf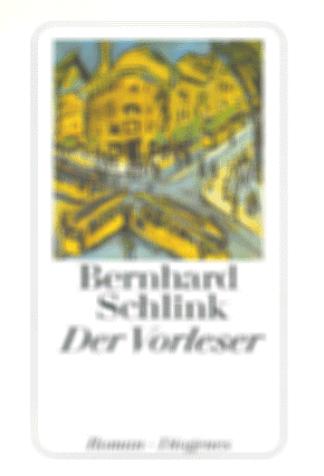
Hausaufgabe aus dem Deutschen
vom 21.05.2001 – 30.05.2001
Bernhard Schlink
Der Vorleser
Erstellt von Sebastian Bauer, 11c
URL: http://fme.de.vu
Gliederung
A.Dem Leser des Romans drängen sich viele Fragen auf.
B.Welche Änderungen vollziehen sich an Hanna während der Haft und welche Gründe gibt es für ihren Selbstmord?
I. Hanna wandelt sich im Lauf des Gefängnisaufenthalt. I.1. Hannas Äußeres verändert sich und wirkt alt und ungepflegt.
I.1.1. Mangelnde Hygiene
I.1.2. Deutliche Anzeichen des Alterungsprozesses
I.2. Hanna verändert ihr soziales Verhalten.
I.2.1. Verlässt ihr anfangs engagiertes Verhalten.
I.2.2. Verletzlichkeit macht Selbstsicherheit Platz.
I.2.3. Distanziert sich trotz Beliebtheit.
I.3. In Hanna gehen tiefe psychische Veränderungen vor. I.3.1. Hanna versucht Mündigkeit zu erlangen indem sie lesen und schreiben lernt.
I.3.2. Hanna fühlt sich nach Aufarbeitung ihrer
Vergangenheit schuldig.
Bitte wenden!
-2-
II. Hannas geistige Veränderungen führen zum Selbstmord.
II.1. Hanna sieht in ihrem weiteren Leben keine Perspektive. II.1.1. Hanna versucht immer noch ihren teilweisen Analphabetismus zu verbergen.
II.1.2. Hanna fehlt die Kraft sich eine neue Existenz aufzubauen.
II.1.3. Hanna braucht menschliche Zuwendung – selbst Michael ist nicht genug Stütze.
II.3. Hanna hält den Druck des schlechten Gewissens nicht mehr aus.
II.3.1. Dieser psychische Druck kann nicht abgebaut werden.
II.3.2. Hanna fühlt sich den Toten einer Rechenschaft schuldig.
C. Das Buch bietet noch viele weitere interessante Themen, über die es sich nachzudenken lohnt.
-3-
Ausformulierung:
Wenn man den Roman „Der Vorleser“ von dem 1944 geborenen Bernhard Schlink, der seit 1987 als Richter des Verfassungsgerichtshofes Münster (Nordrhein-Westfalen) tätig ist, gelesen hat, und die letzte Seite gerade zuschlägt, drängen sich dem Leser viele Fragen auf: Wie sieht Hanna, die ehemalige KZ-Wärterin, ihre Schuld im Bezug auf die Verbrennung der KZ-Häftlinge in der Kirche? Welche Wandlung vollzog Hanna während ihres Gefängnisaufenthalts? Was hat Hanna zu dem Selbstmord bewegt? Dabei ist letztere die Interessanteste, da sie sich mit allen drei Themen - zwar nicht umfassend - aber doch eingehend beschäftigt.
Während Hannas Gefängnisaufenthalt lassen sich schwerwiegende Veränderungen an Hanna beobachten. Am Auffallendesten ist dabei die äußere Wandlung die sich an Hanna vollzieht. Auf Michael wirkt besonders der Geruch nach „Großmüttern und alten Tanten“ (S.186), den Hanna nun an sich trägt, auffällig, da er ihren Duft aus der gemeinsamen Jugendzeit immer noch als frisch in Erinnerung hat. Diese Wandlung des Körpergeruchs lässt auf mangelnde Hygiene schließen, wie auch die Gefängnisleiterin im späteren Gespräch mit Michael bemerkt (S. 196); Hanna scheint keinen Wert mehr auf Körperpflege zu legen und veräußerlicht damit ihren inneren Zustand der Aufgabe.
Doch als noch ausgeprägter erweist sich der rein äußerliche Wechsel Hannas: „Graue Haare, ein Gesicht mit tiefen senkrechten Furchen in der Stirn, (..)“ (S. 184) – dieser Wechsel scheint sogar so ausgeprägt, dass sich der Erzähler beim Gefängnisbesuch ungläubig die Frage stellt ob „die Frau auf der Bank“ (S. 184) wirklich Hanna ist. Dieser Zweifel rührt wohl daher, dass Michael Hanna mit schulterlangem, aschblondem Haar, vollen, ohne Einbuchtung
-4-
gleichmäßig geschwungenen Lippen und einem kräftigen Kinn (S. 14) in Erinnerung hat.
Im Gegensatz dazu fallen der Frauengefängnisleiterin vor allem Hannas Umstellung ihrer Denkweise im Bezug auf ihr soziales Verhalten auf. Gegenüber Michael äußert sie, dass sich Hanna anfänglich im Gefängnis sehr engagiert habe, vor allem was den „Hilfsdienst für blinde Strafgefangene“ (S. 193) und die Bibliothek (S. 193) betrifft. Sie gab laut der Haftanstaltsleiterin immer einige von Michaels Kassetten an diese Einrichtung für Blinde ab. Auch dies lässt Hanna nach ihrer Aufgabe, nach ihrem Rückzug in ihr „Kloster“ bleiben. Ihr ganzes Umfeld scheint ihr gleichgültig zu sein. Zeitgleich mit dieser Veränderung verliert sie ihre vorher auffallende Selbstsicherheit, ja sogar Autorität. „Sie hatte immer auf sich gehalten“, weiß die Leiterin der Vollzugsanstalt zu berichten (S. 196). Auch Michael fällt dieser Wandel auf: Als er bei seinem ersten Besuch Hanna auf der Bank begegnet, ist von dieser ehemaligen Selbstsicherheit nichts mehr zu bemerken, sie wirkt auf ihn unsicher und verletzlich, als er sich ihr nähert (S. 185).
Ihren Mitgefangenen dürfte jedoch besonders die deutliche Distanzierung Hannas zu ihnen aufgefallen sein. Während Hanna anfangs unter ihnen als Autorität geschätzt und akzeptiert war und auch mal um Rat gefragt wurde, wie die Gefängnisdirektorin erkennt (S. 196), verliert sie diese herausragende Stellung durch ihr Verschwinden in der „einsamen Klause“ und distanziert sich somit von ihren Kolleginnen, wodurch sich ihr Ansehen bei ihnen mindert.
Diesen Wandlungen ihres sozialen Verhaltens gehen mehrere psychische Veränderungen voraus. Zum Einen versucht Hanna ihre Unmündigkeit und der daraus resultierenden Erfolglosigkeit im Leben Mündigkeit zu erlangen, indem sie anstrebt aus ihrem Analphabetismus auszubrechen und das Lesen und Schreiben zu
-5-
erlernen. Michael beschreibt Hanna hätte „den Schritt aus Unmündigkeit zur Mündigkeit getan, einen aufklärerrischen Schritt.“ (S. 178). Hanna empfindet für diesen Erfolg Stolz, der allerdings in Michael nicht die erwartete Freude und Bewunderung bringt, wie er selbst feststellt (S. 187).
Mit ihrer neu erworbenen Fähigkeit widmet Hanna sich ihrer dunklen Vergangenheit: „(..) und dann hat sie mich (..) gebeten, ihr Bücher über Frauen in KZs zu nennen, Gefangene und Wärterinnen.“, erklärt die Direktorin der Haftanstalt das Interesse Hannas (S.194). Allerdings hat Hanna sich nicht nur mittels Literatur mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, sondern auch ganz speziell mit dem Vorwurf beschäftigt, dass sie als KZ-Wärterin den KZ-Gefangenen, die in der angezündeten Kirche eingesperrt waren, jegliche Hilfe – obwohl es ihr laut Gericht möglich gewesen wäre – verweigert hätte. „Hier im Gefängnis waren sie [die Toten] oft bei mir.“ Versucht Hanna dies zu verdeutlichen (S. 187). Das Resultat dieser eingehenden Beschäftigung zeigt im ersten Gefängnisgespräch zwischen Hanna und dem Erzähler besondere Wirkung. Sie stellt fest, dass weder das Gericht noch sonst jemand das Recht hat für ihre Vergangenheit Rechenschaft zu fordern, aber die Toten diese fordern könnten (S.187).
Trotz dieser teilweise auch positiven Veränderungen, die in Hanna vorgehen nimmt Hanna sich das Leben. Grund dafür ist unter anderem auch die mangelnde Perspektive für ihre Zukunft. So ist sie innerlich immer noch so darauf bedacht, keinen wissen zu lassen, dass sie noch teilweise zu den Analphabeten zählt, da die Schrift noch nicht flüssig ist, und auch das Lesen noch nicht so einfach ist. Als Michael Hanna das erste mal in der Haftanstalt besucht sitzt sie mit dem Buch in den Händen auf der Bank, beobachtet aber über den
-6-
Rand der Lesebrille hinweg die Frau, die den Vögeln Brotkrummen zuwirft (S. 184).
Zu diesem Zeitpunkt fehlt ihr überhaupt die Kraft, die nötig ist um sich eine neue Existenz aufzubauen. Zwar hat sie „ihren Ort neu definiert“, wie die Leiterin feststellt (S. 197), hat dies aber in einer sehr kraftlosen und ergebenen Weise getan. Dabei beschränkt Hanna ihre Tätigkeit nur auf das aller Nötigste. Ihr neudefinierter Ort ist ein Ort wo „Aussehen, Kleidung und Geruch keine Bedeutung mehr haben.“ Wie Haftanstalt-Leiterin betont (S. 197). Sie benötigt all ihre Kraft um sich mit ihrer Vergangenheit auseinander zusetzen zu können.
Um ihren Ort tatsächlich, für sie in vorteilhafter Weise, neu definieren zu können, hätte Hanna eine starke Stütze gebraucht. Doch sie muss erkennen, dass selbst Michael ihr keine hilfreiche Stütze sein kann, was er auch selbst feststellen muss: „(..) wenn sie [Hannas Briefe] mich nicht einmal dazu hatten bringen können, ihr zu antworten, sie zu besuchen, mit ihr zu reden.“ (S. 187). Äußerlich hilft er ihr durchaus wie zum Beispiel durch die Beschaffung der Wohnung und der Leerstelle (S. 182/183). Doch Hanna braucht mehr als das, sie braucht das Gefühl akzeptiert und verstanden zu sein. Gegenüber Michael äußert sie ihren Unmut darüber: „Ich hatte immer das Gefühl, dass ohnehin keiner versteht, dass keiner weiß, wer ich bin und was mich hierzu und dazu gebracht hat.“ (S. 187).
Aber nicht nur das ist es, was Hanna zu schaffen macht, sondern auch ihr schlechtes Gewissen, das sich durch die Beschäftigung mit ihrer Vergangenheit wieder „zu Wort gemeldet hat“. Dieser psychische Druck ist schließlich so belastend, dass dieser mit ein schwerwiegender Grund für Hannas Suizid ist.
-7-
Die emotionale Last, die auf Hanna lagert, wäre lange nicht so schlimm gewesen, wenn es ihr möglich gewesen wäre ihre Gedanken und Gefühle anderen Personen mitzuteilen. Doch Michael antwortet nicht auf die Briefe, die Hanna ihm schreibt, und wirkt weder verständnisvoll noch glaubwürdig gegenüber Hanna. Während des ersten Gesprächs in der Haftanstalt stellt sie zweifelnde Fragen an Michael, die dieser nur sehr unglaubhaft beantworten kann: „ ‚Damit [mit dem Vorlesen] ist jetzt Schluss, nicht wahr?’ – ‚Warum soll damit Schluss sein?’ Aber ich sah mich weder Kassetten für sie sprechen noch ihr begegnen und ihr vorlesen.“ Hanna fühlt sich also während des gesamten Zuchthaus-Aufenthalts mit ihren Gefühlen alleine gelassen, womit ihre psychische Belastung drastisch zunimmt.
Zu dieser Last gehört unter anderem auch, dass Hanna sich den Toten einer Rechenschaft schuldig fühlt – sie hat sich Nacht für Nacht mit ihrer Schuld und der Forderung nach Rechenschaft auseinandergesetzt: „Sie [die Toten] kamen jede Nacht, ob ich sie haben wollte oder nicht.“ (S. 187). Später äußert Hanna das Ergebnis ihrer schlaflosen Nächten gegenüber Michael: „(..) Auch das Gericht konnte nicht Rechenschaft von mir fordern. Aber die Toten können es.“ (S. 187).
Der Selbstmord scheint in Hannas Situation die einzige Lösung. Aber man kann vermuten, dass der Suizid eine Art Hannas war Rechenschaft gegenüber den Toten abzulegen.
Das Buch bietet aber noch viele weitere interessante Themen, über die es sich lohnt nachzudenken. Man kann für sich selbst und auf mit einem Blick auf seine eigene Vergangenheit sicherlich einige neue Erekenntnisse erlangen.
-8-
Literaturverzeichnis:
Bernhard Schlink – „Der Vorleser“,
erschienen im Diogenes Verlag, 1997
-9-
