
Лекции по философии и немецкому / Уроки Немецкий
.pdf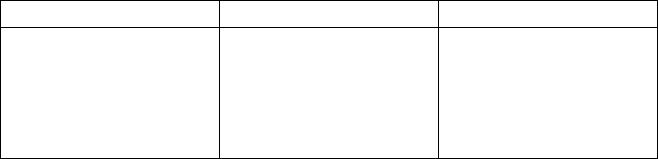
Am 23. Februar 1855 starb Carl Friedrich Gauß und bereits 1856 ließ Georg V, König von Hannover, Gauss-Münzen prägen zu Ehren des Ersten der Mathematiker
(mathematicorum principi). Von 1989 bis Ende 2001 zierte sein Konterfei die deutsche 10- D-Mark-Note.
Gauss hat nicht viele Werke veröffentlicht, dafür aber bedeutende. Sie waren bahnbrechend für die heutige Mathematik, aber auch für die Astronomie. Seine wichtigsten Werke sind:
1799: Doktorarbeit über den Fundamentalsatz der Algebra
1801: Disquisitiones Arithmeticae (Untersuchungen über höhere Arithmetik)
1809: Theoria Motus Corporum Coelestium in sectionibus conicis solem ambientium (Theorie der Bewegung der Himmelskörper)
1827: Disquisitiones generales circa superficies curvas (Allgemeine Untersuchung
über krumme Flächen)
1843/44: Untersuchungen über Gegenstände der Höheren Geodäsie, Teil 1
1846/47: Untersuchungen über Gegenstände der Höheren Geodäsie, Teil 2
Außerdem wurden nach Gauß auch die Gaußsche Glockenkurve und das Gaußsche Eliminationsverfahren benannt. Teilweise wurden auch seine Ideen für das Gauß-Krüger- Koordninatensystem übernommen.
Die biographischen Daten wurden folgender Internetseite entnommen: http://www.geniegauss.de/html/werke.html
Ü2.31 Wählen sie die Komposita aus dem Text. Lesen Sie diese Komposita mit der richtigen Betonung laut vor. Bestimmen Sie den Artikel dieser Wörter.
Ü2.32 Analysieren Sie die wissenschaftlichen Leistungen von J. Gauß. Was hat er entdeckt? Sind seine Entdeckungen heute aktuell?
Ü2.33 Übersetzen Sie folgende Wörter und Wortverbindungen und stellen Sie mit ihnen kurze Sätze über Gauß zusammen.
auf etw. neugierig bleiben (Dativ) sich widmen
im Bereich der Statistik das Bestätigungsfeld
Grundlagen schaffen korrigieren
bilden erhalten liefern einführen veröffentlichen
Ü 2.34 Hier finden Sie die kurzen Texte über die Brüder Grimm. Lesen Sie sie und sammeln Sie die Information zu folgenden Punkten:
Jacob |
Wilhelm |
1.Berufe
2.Wissenschaftsbereiche
3.Gemeinsame Tätigkeit
4.Eigene Leistungen
5.Hauptwerke
21

6.Pioniere im Bereich
7.Beitrag zur Wissenschaft (Kultur) Deutschlands
Jacob Grimm (4.01.1785 – 20.09.1863)
Der deutsche Sprach-, Literaturwissenschaftler und Jurist gilt als Begründer der deutschen Philologie und
Altertumswissenschaft. Jacob Grimm erlangte zusammen mit seinem Bruder Wilhelm Grimm Weltruhm als Märchensammler – „Die Märchen der Brüder Grimm“. Jacob Grimm legte zugleich mit dem „Deutschen Wörterbuch“ einen bedeutenden Grundstein zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache. Er gilt als Begründer der Germanistik. Die umfangreiche Sammlung von Märchen und Sagen und seine sprachwissenschaftlichen Arbeiten waren für ihn mit nationaler Einheit und Identifikation verbunden...
Die biographischen Daten wurden folgender Internetseite entnommen: http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=556&RID=1
Zusammen mit seinem Bruder Wilhelm gilt als Begründer der germanischen
Altertumswissenschaften der germanischen Sprachwissenschaft und der deutschen Philologie. Beiträge wie „Über den deutschen Meistergesang“ gelten neben der Forschung Karl Lachmanns als die soliden Bestandsaufnahmen älterer deutscher Literatur. Berühmt wurden beide durch ihre Sammlung „Kinderund Hausmärchen der Brüder Grimm“ (2 Bde. 1812-1815) und durch die Arbeit am „Deutschen Wörterbuch“ (ab 1838 1. Bd. 1854).
Jacob Grimm formulierte 1822 das erste Lautgesetz das die erste Lautverschiebung beschreibt. In angelsächsischen Ländern ist die Lautverschiebung seither als Grimm's Law bekannt.
Teile des Nachlasses (wie beispielsweise Bücher Bibliothek mit Randbemerkungen) liegen in der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SBB-PK).
Weitere Werke von J. Grimm:
Deutsche Grammatik 1819
Geschichte der deutschen Sprache 1848
Publikationen zur germanischen Rechtsgeschichte
Über den altdeutschen Meistergesang. Göttingen 1811
Die biographischen Daten wurden folgender Internetseite entnommen: http://www.uniprotokolle.de/Lexikon/Jacob_Grimm.html
Wilhelm Grimm (24.02.1786 – 16.12.1859)
Der deutsche Sprachund Literaturwissenschaftler sowie Märchenund Sagensammler Wilhelm Grimm formulierte sein
Hauptwerk in dem Buch über „Die Deutsche Heldensage“
(1829), das zum wissenschaftlichen Standardwerk wurde. Auch sein Name, wie derjenige seines Bruders Jacob Grimm, ist verbunden und berühmt geworden durch die große Sammlung von „Kinderund Hausmärchen“. …
Gerade Wilhelm Grimm ist es zu verdanken, dass die
Märchen und Sagen aufgrund seiner Bearbeitung einen einheitlichen Ton erhielten. …
22
Im Jahr 1815 unternahm Wilhelm Grimm eine Reise an den Rhein. Das Jahr darauf erschien der erste Teil der Gemeinschaftsarbeit "Deutsche Sagen", der zweite Teil folgte
1818. Diese Bücher erreichten aber nie die Popularität der Sammlung von "Kinderund Hausmärchen". Zusammen mit seinem Bruder erhielten sie die Ehrendoktorwürde der Universität Marburg. …
Die Brüder beteiligten sich 1837 an dem Protest gegen die eigenmächtige und unrechtmäßige Verfassungsaufhebung durch König Ernst August II. von Hannover. Beide erhielten kurz darauf ihre Entlassungen aus dem Universitätsdienst. Mit ihnen stemmten sich fünf weitere Professoren gegen das Handeln des Landesherren.
Die Protestaktion wurde in ganz Deutschland bekannt unter der Bezeichnung „Die Göttinger Sieben“. …
Im Jahr 1854 erschien dann der erste Teil des gemeinsamen „Deutschen Wörterbuches“, der zweite und dritte Teil war 1860 beziehungsweise 1862 fertig. Durch Wilhelm Grimms Mitarbeit am „Deutschen Wörterbuch“ trug er maßgeblich zu einer Vereinheitlichung der deutschen Sprache bei. …
Sowohl das literarische Schaffen als auch die Forschertätigkeit standen für Wilhelm Grimm wie auch für seinen Bruder Jacob in der Bedeutung, eine deutsche Einheit und gemeinsame Identifikation mit Deutschland zu schaffen in der Zeit französischer Besetzung und der Kleinstaaterei des Deutschen Bundes. …
In diesem Sinne betrachteten die Brüder Grimm ihre wissenschaftliche und Sammlertätigkeit als politische Arbeit. Wilhelm und Jacob Grimm betrieben ihre
Wissenschaft und Forschungen aber nicht unter dem Gesichtspunkt nationalistischer
Gesinnung, sondern stets vor dem Hintergrund eines guten gegenseitigen Verhältnisses gegenüber anderen Völkern.
Die biographischen Daten wurden folgender Internetseite entnommen: http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=558&RID=1
Ü2.35 Erklären Sie, weshalb die Brüder Grimm literarische Vertreter der
Romantik, Politiker und Humanisten waren. Suchen Sie nach den Fakten aus den Texten und nach Ihren eigenen Argumenten. Gebrauchen Sie weilund denn-Sätze.
Ü2.36 Informieren Sie sich nach dem Leben von L. Feuerbach und analysieren Sie folgende Information.
|
|
falsch |
richtig |
1. L. Feuerbach ist 1807 geboren. |
X |
|
|
2. |
Er war ein großer Psychologe. |
|
|
3. E r studierte Jura. |
|
|
|
4. |
Sein Vater war Rechtsgelehrte. |
|
X |
5.Die Familie wohnte in München.
6.Seine Mutter kannte J.W. Goethe.
7.Er studierte Theologie in Würzburg.
8.Alle seinen Werke waren verboten.
9.1832 begann er die Vorlesungen zu halten.
10.In Bruckberg fühlte er sich völlig frei.
Ludwig Andreas Feuerbach
Ludwig Andreas Feuerbach (* 28. Juli 1804 in Landshut; † 13. September 1872 in Rechenberg bei Nürnberg) war ein deutscher Philosoph, dessen Religionsund Idealismuskritik bedeutenden Einfluss auf die Bewegung des Vormärz hatte und einen
Erkenntnisstandpunkt formulierte, der für die modernen Humanwissenschaften, wie zum Beispiel die Psychologie, grundlegend geworden ist.
23
Ludwig Feuerbachs Vater war der aus Frankfurt stammende Rechtsgelehrte Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775–1833, 1808 geadelt), der als einer der bedeutendsten Juristen der neueren Zeit in Deutschland und insbesondere als Begründer des modernen deutschen Strafrechts gilt. …
Ludwigs Mutter, geb. Eva Wilhelmine Tröster (1774 in Dornburg/Saale, † 1852 in Nürnberg), stammte aus bescheidenen Verhältnissen, hatte allerdings hochadelige Vorfahren: ihr Großvater väterlicherseits war ein außerehelicher Sohn von Ernst August I., Herzog von Sachsen-Weimar, sie war also eine Cousine zweiten Grades von Großherzog Carl August, dem Freund und Förderer Goethes. …
Nachdem Ludwig Feuerbach sich schon in der Gymnasialzeit in Ansbach intensiv mit Theologischem beschäftigt und dafür sogar beim örtlichen Rabbiner HebräischUnterricht genommen hatte, begann er 1823 in Heidelberg ein Theologiestudium. Von der rationalistischen Theologie, die in Heidelberg von Heinrich Eberhard Gottlob Paulus gelehrt wurde, fühlte er sich heftig abgestoßen, doch der mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel befreundete Carl Daub machte ihn auf die Philosophie aufmerksam. …
Die akademische Karriere verbaute sich Feuerbach durch die anonyme Erstlingsschrift Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Sie erschien 1830 kurz nach dem Ausbruch der Unruhen, die im Gefolge der Pariser Julirevolution zwei Jahre lang auch ganz Deutschland erschütterten und im Hambacher Fest gipfelten. Wegen ihres religionskritischen Inhalts wurde die Schrift sofort verboten und der Verfasser polizeilich ermittelt. Im Frühjahr 1832 brach Feuerbach seine Vorlesungstätigkeit unvermittelt ab.
Auf der Suche nach Alternativen schrieb er die Aphorismensammlung Abälard und Héloïse oder Der Schriftsteller und der Mensch sowie die Geschichte der neuern Philosophie von Bacon von Verulam bis Benedict Spinoza. … Im ländlichen Bruckberg nahe Ansbach hatte er den ihm zuträglichen Ort gefunden. … Das einfache, aber insgesamt sorglose Leben auf dem Land entsprach Feuerbachs persönlichem Geschmack und die völlige Freiheit von allen akademischen Rücksichten wurde, wie er selbst bekannte, zum „archimedischen Punkt“ in seinem philosophischen Entwicklungsgang.
In Bruckberg trieb Feuerbach zunächst ausgiebig naturkundliche Studien und schrieb einen zweiten, ausschließlich Leibniz und dessen Monadentheorie gewidmeten Band seiner Geschichte der neuern Philosophie.
Die biographischen Daten wurden folgender Internetseite entnommen: http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
Ü2.37 Korrigieren Sie die falschen Sätze, widersprechen Sie.
Z.B.: Die Familie wohnte nicht in München, sondern in …
Ü2.38 Was wissen Sie über L. Feuerbach? War er Idealist, Materialist oder Utopist?
Ü2.39 Erklären Sie, was wird unter dem „archimedischen Punkt“ gemeint?
Ü2.40 Welche andere deutsche Philosophen sind Ihnen bekannt? Welche philosophischen Gedanken, Ideen, Konzepte, Theorien haben sie entwickelt?
Recherchieren Sie, wenn es nötig ist, im Internet. Kennzeichnen Sie die Zitate, die
Sie dem Internet entnommen haben, mit einem Quellennachweis.
Ü2.41 Haben Sie sich bei Ihrer Recherche auch an die Lehren von Max Weber, Immanuel Kant, Karl Marx, Friedrich Engels, Friedrich Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Artur Schopenhauer, Johann Gottfried Herder erinnert? Warum sind diese Philosophen weltberühmt?
24

Ü2.42 Formulieren sie Ihre Meinung über die Rolle der deutschen Philosophen in der internationalen Entwicklung des Wissenschaftsbereiches „Philosophie“. Schlagen Sie in einer Enzyklopädie unter dem Stichwort „Frankfurter Schule“ nach und vergleichen Sie mit den Informationen im Internet.
Ü2.43 Sehen Sie zwei Texte über Albert Schweitzer durch und vergleichen Sie sie.
Bestimmen Sie das Genre der Texte (Essay, Märchen, Vortrag, Vorlesung, Artikel, Erzählung, historischer Roman, Enzyklopädieangaben, Biographieangaben, archäologischer Überblick, Dokument, Rezension etc.).
Albert Schweitzer
Albert Schweitzer, deutscher evangelischer Theologe, Musiker, Mediziner und Philosoph, * 14. 1. 1875 Kaysersberg, Oberelsass, † 4. 9. 1965 Lambaréné (Gabun); hatte bereits grundlegende Werke zur Religionsphilosophie, Theologie („Von Reimarus zu Wrede“ 1906, seit 1913 unter dem Titel „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“) und Musikgeschichte („Johann Sebastian Bach“ französisch 1905, deutsch 1908) veröffentlicht, als er sich entschloss, Medizin zu studieren, um als Missionsarzt im damaligen Französisch-Äquatorialafrika tätig zu sein. 1913 gründete er das Urwaldhospital bei Lambaréné, in dem er selbst als Arzt tätig wurde. Schweitzers Philosophie ist aus einer
Kulturkritik hervorgegangen und gipfelt in einer weltbejahenden
Ethik tätiger Nächstenliebe und der „Ehrfurcht vor dem Leben“ („Kultur und Ethik“ 1923). Schweitzer war auch in der modernen Orgelbewegung führend (studierte Orgel bei Charles-Marie Widor in Paris). Autobiografien: „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“ 1924; „Aus meinem Leben und Denken“ 1931. Gesammelte Werke in 5 Bänden 1974;
Werke aus dem Nachlass 1995. Schweitzer erhielt 1951 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 1952 den Friedensnobelpreis.
Die biographischen Daten wurden folgender Internetseite entnommen: http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/bildung/index,page=1237524.html
Albert Schweitzer (14. 1. 1875 - 4. 9. 1965)
Der Arzt von Lambaréné
Sein Lebensweg war ein langer, weiter Weg, der zu vielen Leidenden, zu vielen armen und kranken Menschen führte.
Doch an seinem weiten Wege läutete ein Glöckchen. Schon im zarten Knabenalter hatte das einsame Glöckchen ihn zu der kleinen Dorfkirche im oberelsässischen Günsbach geleitet, in der sein Vater das würdige Amt eines Dorfpfarrers bekleidete. Die Kirche allein war es aber im Grunde anfänglich nicht, die ihn magisch fesselte. Nein, die schöne Orgel der Kirche war es gewesen, die ihn sofort begeistert hatte - und im späteren Leben Triumphe feiern ließ. …
Schon als 30jähriger Pfarrer hatte er bereits in Theologie und sogar in Philosophie promoviert, um anschließend eine Professur für Theologie in Straßburg zu erlangen. Doch die siebenjährige Studienzeit in Straßburg und Paris erschien ihm für seine kommende Lebensaufgabe nicht auszureichen. …
Seine von Theologie und Philosophie geprägte humanistische Weltanschauung, die die „Ehrfurcht vor dem Leben“ als oberstes Gebot ansieht, setzte sich nunmehr mit dem
Entschluss auch noch Arzt zu werden, schrankenlos durch. Erneut musste er als Student seinen Platz in den Hörsälen der Universitäten von Straßburg und Berlin einnehmen, bis er auch in dieser Fakultät zum Doktor der Medizin promovieren konnte. …
25

Das Übel des gesamten Gedankens war und blieb die medizinische Unterversorgung der Region des Landes Gabun und die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen, die anfänglich unlösbar erscheinen mussten. Aus kargen Erlösen von Buchveröffentlichungen, Vorträgen, Orgelkonzerten, sowie privaten und öffentlichen Zuwendungen, konnten erste Maßnahmen zur Errichtung eines Tropenspitals mit Leprastation in Angriff genommen werden. …
Seine erfolgreichste Lebensphase begann nach dem Zweiten Weltkrieg, in der er, ungestört von politischen Widrigkeiten und Querelen, der Menschheit den Dienst erweisen konnte, der ihm Dank seiner energievollen, begnadeten Fähigkeiten seit frühester Jugend stets vorgeschwebt hatte.
Trotz der enormen Leistungen, die sich in fortschreitenden Verbesserungen im Leben des Spitals offenbarten, nahm er sporadisch zugleich auch seine Wirksamkeit im europäischen Kulturleben durch Orgelkonzerte, Vorträge (war ein bedeutender
Bachforscher) und Reden wahr, die der Erstarkung echter humanistischer
Gemeinsamkeiten dienen sollten, die nicht nur im europäischen Raum, sondern auch in der übrigen Welt gehört und gewürdigt wurden. Diese Erfolge zeichneten sich in den großen Ehrungen, wie dem Goethe-Preis, den Ehrendoktorwürden zahlreicher Universitäten, dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1951) und dem
Friedensnobelpreis im Jahre 1952 aus.
Seine eigenständige, aus wahrer Theologie und wahrem humanistischen Denken geborene Ethik wurde von allen friedfertigen Menschen verstanden. Die große, ja wichtige Selbsterkenntnis des Menschen, die schon durch Descartes „Cogito ergo sum“ (ich denke, also bin ich) erkannt worden war, wurde durch die erweiterte Bewusstwerdung der
Daseinsfrage: „lch bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“, zur generalisierten These seiner prinzipiellen Ethik menschlichen Denkens und Handelns.
Im Hinblick auf seine global zu begreifende, verpflichtende Ethik, setzte er sich auch tatkräftig und mutig gegen die Gefahren eines Atomkrieges und die der Zerstörung der Umwelt sowie für die erst später aufkommenden Bestrebungen des Umweltschutzes unseres getretenen Planeten ein, um kommenden Generationen im humanistischen
Denken und Fühlen zum Sieg des Geistes zu verhelfen.
Die augenblickliche, heutige Situation des Spitals Lambaréné wird von großer
Zuversicht getragen. Im Jahre 1974 wurde es von einer internationalen Stiftung (Fondation Internationale), mit Sitz in Lambaréné, übernommen. Das zum Klinikum herangewachsene Spital, in dem hervorragende, moderne medizinische Leistungen hervorgebracht werden, wird wegen seines besonders spezifischen Charakters in der Welt international geleitet und vorbildlich betreut.
Die biographischen Daten wurden folgender Internetseite entnommen: http://www.uni- giessen.de/~gk1415/Albert-Schweitzer.htm
Ü 2.44 Bestimmen Sie den Unterschied der Texte und charakterisieren Sie sie. Gebrauchen Sie dabei folgende Antonyme:
kurz/lang, |
gefühlslos/emotional, |
sachlich/persönlich, |
trocken/gespannt, |
wissenschaftlich/schöngeistig, zielorientiert/locker, mit genauen Datenangaben/mit einzelnen Datenangaben, chronologisch gebaut/frei gebaut, mit/ohne Hinweisungen etc.
Ü2.45 Charakterisieren Sie Albert Schweitzer als den Wissenschaftler, den Pfarrer, den Musiker, den Arzt, zeigen Sie dabei seine aktive Lebensposition.
Ü2.46 Erklären Sie bitte, warum A. Schweitzer bei vielen Menschen beliebt war, warum er vielen Leuten auch heute noch sympathisch ist.
26
Ü 2.47 Besprechen Sie in einem Dialog die Ethik von A. Schweitzer. Eine(r) ist von seinem Konzept begeistert, der (die) andere versteht seine Ideen nicht. Die Diskussionsklischees finden Sie in der Beilage № „Deutsch lebendig“.
Ü2.48 Schreiben Sie kurz über die Aktualität der Erbe und Leistungen von
Schweitzer. Verbinden Sie seine Arbeit mit der modernen Zeit.
Ü2.49 In der Welt der Wissenschaft gibt es auch Beispiele der jahrelangen schöpferischen gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeit verschiedener Gelehrten, der Männer und Frauen. Lesen Sie den Text „Otto Hahn und Liese Meitner“. In welchen wissenschaftlichen Bereichen waren sie tätig?
Otto Hahn (8.03.1879 – 28.07.1968) und Lise Meitner (7.11.1878 – 27.10.1968)
Im Jahre 1907 bewarb sich Otto Hahn an der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin um eine Habilitation. Die damaligen Chemiker an der Universität intessierten sich nur wenig für das Radium. Aus diesem Grunde verkehrte der Chemiker
Hahn lieber in den Kreisen des Physikalischen Instituts. Dort kam er erstmals mit Lise Meitner in Kontakt. Sie kam 1907 als promovierte Physikerin nach Berlin und besuchte die Vorlesungen von Max Planck (1858-1947). Es entstand eine kollegiale Zusammenarbeit im Institut von Otto Hahn, die lange andauern sollte.
In den ersten Jahren entdeckten die beiden Wissenschaftler eine ganze Reihe an neuen Isotopen der Actinium-, Thoriumund Radiumzerfallsreihe. Bis dahin konnte man die neu entdeckten „Elemente“ nicht in das Periodensystem einordnen. Frederick Soddy lieferte 1913 mit seiner Theorie über die Isotope eine Lösung. Jedes Element hat eine eindeutig festgelegte Kernladungszahl (Ordnungszahl), von jedem Element gibt es aber unterschiedliche Atomarten, die sich durch unterschiedliche Atommassen auszeichnen. Nun war klar, dass Otto Hahn und Lise Meitner keine neuen Elemente entdeckt hatten.
1910 wurde Otto Hahn zum ordentlichen Professor ernannt. Bei einem seiner
Vorträge reiste er im Mai 1911 zu einer Tagung nach Stettin. Auf einer abschließenden Dampferfahrt auf der Ostsee kam er mit einer hübschen Dame mit großem Sommerhut ins Gespräch. Edith Junghans studierte an der königlichen Kunstschule in Berlin und war die Tochter des Stettiner Präsidenten des Stadtparlaments. Otto Hahn verliebte sich in die 25jährige Kunststudentin und heiratete sie zwei Jahr später. Mit Lise Meitner hatte er nach eigenen Angaben dagegen immer nur kollegialen Kontakt.
Der Bau des Kaiser Wilhelm Instituts in Berlin im Jahre 1911-1912 eröffnete ein neues Betätigungsfeld. 1912 übernahm Otto Hahn die Leitung für eine Abteilung, die sich mit der Erforschung der Radioaktivität befasste. Zu dieser Zeit arbeitete auch Fritz Haber in führender Position am Institut. Im gleichen Jahr fuhr Otto Hahn anlässlich der Sitzung der internationalen Radiumkommission nach Paris und lernte bei dieser Gelegenheit
Marie Curie persönlich kennen. Der ebenfalls anwesende Ernest Rutherford lud die Kommissionsmitglieder zu einem Essen ein und berichtete über seine Atomvorstellungen, dass sich im Innern des Atoms ein kleiner, konzentrierter Kernraum befindet, in dem eine starke Kraft wirkt, so dass die alpha-Strahlung abgelenkt wird. Ab 1913 erhielt auch Lise Meitner fest am Kaiser Wilhelm Institut eine bezahlte Anstellung. …
Im Jahre 1922 lud Niels Bohr die beiden deutschen Forscher nach Kopenhagen ein. Diese revanchierten sich mit einer Einladung nach Berlin. Im gleichen Jahr habilitierte
Lise Meitner, 1926 wurde sie außerordentliche Professorin an der Universität Berlin. 1932 fand die sogenannte „Bunsentagung“ in Münster statt, an der fast alle namhaften Atomphysiker der damaligen Zeit teilnahmen. Rutherford hielt den Einführungsvortrag und James Chadwick (1891-1974) berichtete von der Entdeckung des Neutrons. Um dieses
27

neu entdeckte Teilchen wurde an der Tagung dann ausführlich diskutiert. Einige
Teilnehmer glaubten, dass mit dem neu entdeckten Teilchen neue Entdeckungen gelingen könnten. …
Nach Ende des Krieges wurden die deutschen Atomforscher von den Alliierten verhaftet. In britischer Gefangenschaft erfuhren die 10 internierten Forscher - darunter auch Hahn, Gerlach, Heisenberg und von Weizsäcker - vom Atombombenabwurf auf Hiroshima. Vor allem Otto Hahn traf die Nachricht sehr, denn ihm war wohl bewusst, dass er mit seinen Experimenten zur Kernspaltung die Voraussetzungen zur Herstellung der furchtbaren Waffe geschaffen hatte.
Im November 1945 erhielt Otto Hahn rückwirkend den Nobelpreis für Chemie für die Entdeckung der Kernspaltung. Lise Meitner in Schweden ging leer aus. Auch in den darauf folgenden Jahren erhielt sie den Preis nicht, was heute aufgrund ihrer Mitwirkung an der entscheidenden Entdeckung kaum verständlich erscheint. Im Januar 1946 konnten die internierten Wissenschaftler nach Deutschland zurückkehren und erst danach fand die Überreichung des Nobelpreises an Otto Hahn in Schweden statt. Nach dem Krieg wurden Vorwürfe laut, die deutschen Forscher hätten entgegen ihrer Beteuerungen doch an der Entwicklung einer Atombombe für die Nazis gearbeitet. In einer öffentlichen
Gegendarstellung widersprach die Gruppe um Hahn und Heisenberg diesem Vorwurf. …
Von 1948 bis 1960 war Hahn Gründungspräsident der nach dem Krieg neu ins Leben gerufenen Max-Planck-Gesellschaft. Für seine politischen Tätigkeiten gegen Kernwaffen wurde er sogar einmal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Bis zu seinem Tod erhielt Otto Hahn zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen.
Lise Meitner erhielt nach dem Krieg zahlreiche Forschungsangebote aus den USA, die sie aber alle ausschlug. Sie wollte keinesfalls an einem Atombombenprojekt mitarbeiten. Ab 1947 leitete sie die Abteilung für Kernphysik an der Technischen
Hochschule in Stockholm. Verheiratet war sie nie, ihr Leben ging ganz in der Physik auf. 1960 zog sie nach Cambridge zu ihrem Neffen Otto Robert Frisch, wo sie 1968 - im gleichen Jahr wie Otto Hahn - starb. Auch sie wurde bis zu ihrem Tod mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. 1992 benannte man das Element 109 zu ihren Ehren
Meitnerium (Mt), sozusagen als späte Entschädigung für den nicht vergebenen Nobelpreis.
Die biographischen Daten wurden folgender Internetseite entnommen: http://www.seilnacht.com/chemiker/chehah.html
Ü2.50 Wo haben Otto Hahn und Lise Meitner gearbeitet? Was haben sie geleistet? Wodurch sind sie bekannt?
Ü2.51 Mit welchen WissenschaftlerInnen waren Otto Hahn und Lise Meitner bekannt? Welche wissenschaftliche Arbeit und Interessen verbanden diese WissenschaftlerInnen?
Ü2.52 Welche Ehrungen und Auszeichnungen erhielt Otto Hahn? Und Lise Meitner? Welche Gründe könnte es gegeben haben, dass beide nicht gemeinsam den Nobelpreis erhielten?
Ü2.53 Lesen Sie die wichtigsten Biographiedaten über den Architekten Walter Gropius.
Walter Gropius (18.05.1883 – 5.07.1969)
Architekt
1883
18. Mai: Walter Gropius wird in Berlin geboren.
1903
Architekturstudium an der Technischen Hochschule München.
28
1906/07
Wechsel an die Technische Hochschule in Charlottenburg.
1908
Eintritt in das Büro des Berliner Architekten Peter Behrens, über den er Ludwig
Mies van der Rohe kennenlernt.
Mitarbeit an den Bauten für die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG).
1910
Eröffnung eines eigenen Architekturbüros.
1911
Das von Gropius entworfene Faguswerk in Alfeld/Leine ist das erste Beispiel des „Neuen Bauens“ in Deutschland. Mit diesem Industriebau aus den neuen Materialien Eisen und Glas versucht Gropius, reine Konstruktion und Kunst zusammenzubringen.
Aktive Beteiligung am Deutschen Werkbund, dessen Mitglieder nach einer Synthese von Kunst und industriellen Fertigungsmethoden streben.
1914
Büround Fabrikgebäude im „monumentalen Stil“ für die Werkbundausstellung in Köln.
1915
Heirat mit Alma Mahler.
…
1919
Gropius gründet das Staatliche Bauhaus in Weimar und wird dessen Direktor. Sein Ziel ist die Errichtung des „Baus der Zukunft“ als Gesamtkunstwerk.
1923/24
Mitbegründer des „Rings“, einer Gruppe avantgardistischer Architekten unter der Führung Mies van der Rohes.
1925/26
Umzug des Bauhauses nach Dessau. In den dort errichteten Schulgebäuden und Meisterhäusern des Bauhauses, die zu seinen Hauptwerken zählen, gelingt Gropius die optische Trennung der einzelnen Funktionsbereiche mittels Material und Konstruktion.
ab 1926
Gropius setzt sich intensiv mit dem Massenwohnbau auseinander und tritt für die Rationalisierung der Bauindustrie ein. Zur Lösung der städtebaulichen und sozialen
Probleme des Siedlungsbaus propagiert er das Wohnhochhaus. In den kommenden Jahren entstehen zahlreiche Wohnungsbauprojekte wie die Siedlung Dessau-Törten (1926-1931), Wohnblöcke in der Siedlung Siemensstadt in Berlin (1929/30) und das Projekt Wannsee-Uferbebauung in Berlin (1930/31).
1927
Sein Entwurf des „Totaltheaters“ für den Theaterdirektor Erwin Piscator drückt die Suche nach einem „Gesamtkunstwerk“ von Architektur und Kunst, Akteur und
Zuschauer aus.
…
1937
Er emigriert nach Cambridge (Massachusetts/USA) und wird Professor für
Architektur an der Graduate School of Design der Harvard University.
1938
Er eröffnet ein eigenes Architekturbüro in Cambridge.
1946
Gropius ist Gründer und Leiter der Gruppe „The Architects Collaborative“ (TAC), einer Vereinigung junger Architekten, deren erstes Projekt das Harvard University Graduate Center (1948-1950) ist.
29
1955-1957
Er realisiert einen Wohnblock im Hansaviertel für die Bauaustellung in WestBerlin.
…
1969
5. Juli: Walter Gropius stirbt in Boston.
Die biographischen Daten wurden folgender Internetseite entnommen: http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/GropiusWalter/index.html
Wie viel, wie lange und welche Lebensabschnitte könnten Sie in seiner Biographie als Hauptstrecken seines Lebens bezeichnen? Beginnen Sie so:
Ich bin der Ansicht, dass es zwei bis zwölf Lebensabschnitte in seiner Biographie gibt.
Von … bis … studierte (wohnte, arbeitete) er an (in, bei) …
Ü2.54 Was Neues hat W. Gropius im Bereich „Architektur“ entdeckt (ausgearbeitet, entwickelt, geschafft, gegründet, projektiert, gebaut)?
Ü2.55 Lesen Sie den Text „Walter Gropius: Architekt der klassischen Moderne“ und erklären Sie, warum man ihn so nennt. Recherchieren Sie auch zur Biographie von Alma Mahler und ihrem Einfluß in Gesellschaft und Kunst. Vergleichen Sie das Ergebnis Ihrer Recherche mit folgendem Eintrag in einer Enzyklopädie:
„Mahler-Werfel, Alma, geb. Schindler, * 31. 8. 1879 Wien, † 11. 12. 1964 New York;
Kompositionsschülerin von A. Zemlinsky; veröffentlichte 1910 eine Sammlung von
Klavierliedern. Sie war in 1. Ehe mit G. Mahler verheiratet (1902-1911), sodann mit O. Kokoschka befreundet; 1915 heiratete sie W. Gropius (Trennung 1918) und 1929 F. Werfel, mit dem sie 1940 über Frankreich nach Amerika floh und dessen Nachlass sie sammelte und betreute. Autobiografie: „Mein Leben“ 1960.“
Quelle: dtv-Lexikon (Gütersloh/München 2006), elektronische Ausgabe.
„Walter Gropius: Architekt der Klassischen Moderne
Mit dem Bauhaus-Gebäude in Dessau schafft Walter Gropius ein Schlüsselwerk der Moderne in Europa. Seinen individuellen Stil entwickelt Gropius schon während seines Studiums beim Architekten Peter Behrens, Mitbegründer des Deutschen Werkbunds. Sein Konzept der „Architektur des industriellen Zeitalters“ kann Gropius das erste Mal in Alfeld an der Leine umsetzen: Das von ihm entworfene Faguswerk ist das erste Beispiel des
„Neuen Bauens“ in Deutschland. Mit diesem Industriebau aus den neuen Materialien
Eisen und Glas bringt Gropius reine Konstruktion und Kunst zusammen - richtungweisend für die moderne Architektur des 20. Jahrhunderts.
Seiner Zeit voraus war Walter Gropius aber nicht nur als Architekt: Zudem entwirft er Möbel, Tapeten, Autokarossen, eine Diesellokomotive und ganze Fabriken. 1919 gründet er das Staatliche Bauhaus Weimar, Deutschlands berühmteste Kunstund Designeinrichtung der Klassischen Moderne. Gropius leitet die Schule, die 1925 nach
Dessau umzieht, zehn Jahre lang. Während dieser Zeit widmet er sich nicht nur der pädagogischen und didaktischen Arbeit, sondern beschäftigt sich außerdem intensiv mit dem sozialen Massenwohnbau. In vielen Städten entstehen Siedlungen und Wohnblöcke nach seinen Ideen. Der Siemensstadt-Komplex in Berlin, der Wohnblock im Berliner
Hansaviertel und die „Gropiusstadt“ sind wichtige Projekte, die bis heute zu den Meilensteinen der modernen Architektur zählen.“
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=26195
30
