
Лекции по философии и немецкому / Уроки Немецкий
.pdffortlebt (Sternsinger). Strafrechtlich geahndet wird „Hausfriedensbruch im Amt“, wenn solcher von übereifrigen Staatsdienern begangenen wird. Es gilt immer noch, dass der Hausoder Wohnungsbesitzer den Ankömmling oder Gast „herein bittet“, also vor der Aufnahme jeglicher weiterer Kommunikation eine deutliche
Aufforderung zum Betreten seines Besitzes oder Eigentums ausspricht. Üblicherweise fragt auch der Besucher rechtzeitig „darf ich eintreten?“ oder „darf ich photographieren?“ Man reicht sich nicht über der Türschwelle die Hand zum Gruß und die Braut wird noch immer über die Türschwelle getragen, was wiederum auf alte rechtliche und magische Vorstellungen zurückgeht.
Der disparate Umgang mit Traditionen zeichnet sich jedoch im Alltagsleben seit den 70erJahren infolge der sozialen Revolution von 1968 ab. Damals wurde alles
„Alte“ der Kriegsgeneration infolge einer mangelnden Geschichtsaufarbeitung in den Familien infrage gestellt. Dies führte zu einem noch anhaltenden
Generationenkonflikt, als dessen Folge ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel zu beobachten ist.
In einer pluralistischen Gesellschaft mit individuellem Menschenbild, die sich infolge Kriegsfolgenbewältigung, demographischen Wandels und Migrationskultur nicht mehr ausschließlich an althergebrachten Definitionen orientiert, gestaltet sich die Sinnsuche des Lebens weder linear noch traditionskonform. Die Jugend scheint sich vom Ballast einer überholten Identitätstradition befreien zu wollen, zumal bereits jetzt jeder fünfte Einwohner Deutschlands (und in Industriestädten jeder dritte Einwohner) einen Migrationshintergrund in seiner Biographie hat, Tendenz steigend. Das Weltund Wertebild der deutschen Gesellschaft beginnt sich somit sozial und kulturell zu verschieben.
3.) Ausbildung und Berufsleben
Kaum ein Bereich des öffentlichen Lebens in Deutschland unterliegt derzeit solchen gravierenden Änderungen wie das Ausbildungsund Berufsleben.
Vorbei sind seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert die Zeiten der
Großfamilien spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Prägung. Dies hängt besonders mit der Veränderung der ursprünglich an den Jahreszeiten und der Natur orientierten Arbeitsleistung im Rhythmus der bäuerlichen Tagesund Jahreseinteilung zusammen. Die Taktzahl der Maschinenleistung hat den jahrhundertealten Biorhythmus der menschlichen Physis verändert (Berufskrankheiten). Erst infolge der ökologischen Bewegung des 80er Jahre beginnt man sich wieder auf die Beobachtung dieser körperlichen Bedürfnisse zu besinnen.
Diesen werden in der Zwischenzeit auch in vielen Berufen mit der Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten entsprochen, jedoch auch mit zum teil fraglichen Begleitbedingungen, die sich aus der Reduzierung von Arbeitsstellen und dem Aussterben vieler Berufsgruppen ergeben, welche durch maschinelle Leistung ersetzt werden. Die Umwandlung der privaten Lebensformen von der Großfamilie, in der mehrere Generationen unter einem Dach lebten und arbeiteten, zur Kleinfamilie war letztendlich der Preis für den durch die Industrialisierung erreichten Wohlstand.
Deswegen galt und gilt eine solide Ausbildung als ein Haupterziehungsziel in der Jugendförderung.
Der Weg von Erziehung und Ausbildung umfasst in Deutschland den (freiwilligen) Besuch des Kindergartens und den verpflichtenden Besuch der Grundschule sowie einer weiterführenden Schule. Es sollte (bisher) mindestens der Hauptoder Realschulabschluß erreicht werden, der zur Ausbildung im Rahmen einer Lehre befähigte. Jetzt benötigt man auch für die Lehre vielfach das Abitur.
Deswegen ist der Besuch des Gymnasiums und das Erreichen des Abiturs der bevorzugte Abschluß der Schulausbildung. Das Schulsystem in Deutschland
121
unterliegt momentan zahlreichen Veränderungen, mit denen aber nicht alle Teile der deutschen Gesellschaft einverstanden sind.
Großen Wert legt man in der deutschen Gesellschaft, dem Handel, der Industrie und Wissenschaft auf die Fortund Weiterbildung während des aktiven Berufslebens. Hierzu sind bestimmte Institute, Akademien der Unternehmen und
Behörden zuständig.
Für die Fortbildung von Privatpersonen stellen Städte die Volkshochschulen und große Gemeinden (z. B. Verbandsgemeinden) die Volksbildungswerke zur Verfügung, deren Kursund Vortragsangebote viele Themen des gesellschaftlichen, kulturellen, praktischen und künstlerischen Lebens umfassen. Der Besuch von Volkshochschulen ermöglicht Fremden das Erlernen der deutschen Sprache, die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft und das Knüpfen persönlicher Kontakte, aus denen auch Freundschaften entstehen können.
Grundsätzlich wird in den Bemühungen um die Weiterbildung die Eigeninitiative des Einzelnen erwartet und gefördert. Bequemlichkeit und Faulheit werden in der deutschen Gesellschaft nicht akzeptiert. Jedoch ist auch eine gute
Ausbildung in heutiger Zeit keine Garantie mehr für den Erhalt eines Arbeitsplatzes. Die Möglichkeiten der Beschäftigung hängen von der Entwicklung der Wirtschaft ab und können dadurch auch unerwarteten Veränderungen ausgesetzt sein. Die
Nutzung der zahlreichen Bildungsangeboten umfasst deswegen Seminare und Kurse für Erwachsene, Umschulungsmaßnahmen für Arbeitslose und die betriebliche
Fortbildung.
Betrachten wir nun vor dem Hintergrund eines differenzierten und zunehmend juristisch regulierten Arbeitslebens das Freizeitverhalten.
Freizeitregelungen, wie wir sie heute kennen, waren in historischer Zeit und vor allen in den mittelalterlichen Bauerngesellschaften unbekannt.
Im Unterschied zu den Bauern verfügten die Industriearbeiter und ihre Familien jedoch nicht über die eher mit häuslichen Arbeiten verbrachten ruhigeren Wintermonate, während derer die Bauern besonders das Brauchtum pflegten und künstlerisch tätig waren (Schnitzund Handarbeiten, Möbeldekoration, Vorlesen).
Brauchtumspflege in der Industrie gibt es heute nur noch im Bergbau, bzw. dem, was nach den Schließungen vieler Zechen seit den 70er Jahren des 20. Jhs. davon übrig blieb. Die Brauchtumspflege in ländlichen Gegenden ist dagegen weiterhin lebendig (z.B. Bayern, Norddeutschland). Über viele Jahrhunderte sorgten die kirchlichen Feste für Abwechslung in den täglichen Verrichtungen.
Wann also hatte der Mensch Urlaub, wie verbringt man seine Freizeit? – Das uns so geläufige wie selbstverständliche Wort konnte in der mittelalterlichen
Gesellschaft nur von Adligen in Anspruch genommen werden, welche an einem fürstlichen Hof dienten und sich von ihrer Herrschaft nach Darlegung von Gründen
(wichtige Reise im Dienste der Familie, Pilgerfahrt, Krankheit, Alter) von den
Pflichten bei Hofe entbinden ließen. Urlaub im heutigen Sinn ist also eine neue Komponente im Arbeitsleben und wurde über einen langen Zeitraum hinweg zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgehandelt. Vorausgegangenen war eine lange Auseinandersetzung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern seit dem Ende des 19. Jhs.
Ein Massenphänomen des deutschen Urlaubsverhaltens seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Fernreise. Die Teilhabe am Massentourismus wurde letztendlich aber zu einem der Wegbereiter der Globalisierung mit allen Folgen auf wirtschaftlichem, sozialem, ethnischem und medizinischem Gebiet (z.B. Einschleppung und Verbreitung von Tropenkrankheiten in Europa oder die Folgen von Aids).
122
Allgemein typisch für das deutsche Freizeitverhalten sind die Mitwirkung in
Vereinen (der Deutsche ist durchschnittlich Mitglied in bis zu sieben Vereinen), soziales Engagement, die Gartenarbeit (hierzu s. den Text von Gerhard Humberg) und vor allem das „Heimwerken“. Das Heer der privaten Heimwerker überflutet an Samstagen mit Euphorie und Freude die Baumärkte um einen Großteil seines
Nettoeinkommens in Handwerksmaschinen und Baumaterialien zu investieren, die in den seltensten Fällen betriebswirtschaftlich ausgenutzt werden. “Heimwerken“ und die Sorge um das Automobil gehören zu den Freizeitaktivitäten der Deutschen, auf die mindestens so viel Energie aufgewandt wird, wie für den Brotberuf selbst.
4.) Ökologie
Die Beschäftigung mit dem Thema „Natur“ war in Deutschland lange Zeit von unterschiedlichen Herangehensweisen besetzt und zeigt sich zunächst in der
Bedeutung des Waldes im deutschen Geistesleben und Selbstbewußtsein. In der Tradition dieses Denkens hat sich bis in unsere Zeit der familiäre Sonntagsausflug in den Wald erhalten, der besonders für Kinder zu den ersten außergewöhnlichen Erlebnissen außerhalb ihrer gewohnten häuslichen Umgebung gehört. Es fällt auf, dass in der Zeit der Globalisierung die Welt des Waldes ein vielfältiges mystischspirituelles Interesse erfährt, welches manche Anregung aus zeitgenössischen
Kinofilmen und der diesen zugrundeliegenden Fantasy-Literatur bezieht. In weiten Kreisen der alternativen Jugendkultur gilt die Hinwendung zu mittelalterlichen Szenespielen in der Umgebung des Waldes als Abgrenzung zur Stadtkultur und dem Konsumverhalten.
In Deutschland beschränkte sich die Naturverbundenheit lange Zeit auf die mystische Naturverklärung der Romantik, wie sie in der „blauen Blume“ und in Eichendorfs „Marmorbild“ in Erscheinung tritt: sich der menschlichen Ratio entziehend, den menschlichen Lebensweg dennoch umrankend und symbolisierend. Diese Vorstellung erhielt sich auch in dem deutschen Brauch, nach der Geburt eines Kindes einen Baum zu pflanzen.
Erst die moderne Medizin erkannte den Aufenthalt in der Natur als gesundheitsfördernd an. Der Leipziger Arzt Dr. Daniel G. M. Schreber (1800-1861) verordnete seinen Großstadtpatienten den Aufenthalt im Freien; auf diesen Arzt gehen auch die von E. I. Hauschild (1808-1866) 1864 eingerichteten
Kinderspielplätze und sog. Schrebergärten zurück, die zum Anbau gesunder Pflanzen am Stadtrand errichtet wurden. Solche Schrebergärten sind auch in unserer Zeit noch das private Rückzugsgebiet am Rande deutscher Großstädte und werden eher von den unteren Einkommensgruppen bevorzugt.
Kennzeichnend für die deutsche Hinwendung zur Natur ist seit dem Beginn des 20. Jh.s eine Protesthaltung gegenüber den jeweiligen Lebensumständen. Dies zeigt sich besonders an der Ökologiebewegung der 70er Jahre, welche aus der
Alternativen Lebensform und der 1968er Bewegung hervorging und zu einer maßgeblichen gesellschaftlichen Kraft wurde.
Besonders vor dem Hintergrund der fachlich und emotional geführten Lebensmitteldiskussion und Klimaforschung ist das Thema „Ökologie“ rechtlich, steuerpolitisch und administrativ in allen Lebensbereichen präsent.
5.) Migration und interkulturelles Leben
Zu den Themen, welche die öffentliche Diskussion seit geraumer bestimmen gehört das der Migration nach Deutschland. Das lange vernachlässigte Thema der „Ausländer“ und „Gastarbeiter“ wird aufgrund demographischer Faktoren zu einem Schlüsselthema künftigen gesellschaftlichen Lebens in Deutschland werden.
123
Obwohl es genügend historische Beispiele für Migration nach Deutschland gibt, wird das Thema in unterschiedlicher Weise wahrgenommen: der Förderung von
Migration von wirtschaftlicher und administrativer Seite steht eine zunehmend skeptische Position seitens weiter Kreise der Bevölkerung entgegen, wobei die Ablehnung bei niedrigem Bildungsstand besonders ausgeprägt ist. Deshalb legen neue Bildungskonzepte Wert auf die Vermittlung interkultureller Kompetenz.
Wie konnte es dazu kommen?
Die Migration in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. unterschied sich erheblich von den bisherigen historischen Migrationserfahrungen in Deutschland. Sie war nur bedingt Folge der Kriegszeit, hing selbst nicht mit militärischen Konflikten zusammen und wurde zunächst als eine Form von meist billigen Dienstleistungen wahrgenommen. Die Schnelligkeit des Wiederaufbaus im deutschen
Wirtschaftsleben, der kriegsbedingte Rückgang an männlicher Arbeitskraft im
Bereich der Schwerindustrie bedingten einen erheblichen Mangel an Arbeitskräften in der Automobilindustrie, der Stahlindustrie sowie in der Textilproduktion. Die
Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte seit der Zeit um 1960 erfolgte zuerst durch die großen Automobilkonzerne und dann durch die Textilindustrie. Besonders im
Ruhrgebiet hatte man bereits 150 Jahre gute Erfahrungen mit dem Zuzug polnischer
Arbeitskräfte gemacht, von denen viele blieben und ein Teil der deutschen
Gesellschaft wurden. Deshalb wurde lange Zeit nicht darauf geachtet, welchen persönlichen Lebensweg die nun angeworbenen Türken, Griechen, Italiener, Spanier und Portugiesen nehmen würden. Viele von ihnen kehrten nach der Veränderung der politischen Situation wieder in ihre Heimatländer zurück (bes. die Portugiesen). Die
Spanier und Polen wurden von einem gut funktionierenden Netzwerk der katholischen Kirche aufgefangen. Griechen und Italiener traten – da sie damals aus den von den Deutschen bevorzugten Urlaubsländern kamen – besonders durch ihre Restaurants in die deutsche Öffentlichkeit. Sie alle wurden in der deutschen Sprache zunächst als Gastarbeiter bezeichnet, da man davon ausging, dass die arbeitenden Gäste das Land auch wieder verließen. Infolge des auf staatlicher Ebene vereinbarten Familiennachzugs änderten sich aber Realität und Wahrnehmung. Eine bisher kaum beachtete Gruppe trat nun in die öffentliche Wahrnehmung. Lange hatte man über die z.T. menschenunwürdigen Lebensumstände der Gastarbeiter hinweggesehen (z.B. schlechte Unterbringung, keine sozialen Programme). Nachdem die Türken begannen, dieses Vakuum mit den ihnen vertrauten Organisationsformen aus ihrer meist konservativ geprägten ostanatolischen Heimat zu füllen und zu kompensieren, wurde das neue soziale Thema von der Bezeichnung „Gastarbeiter“ zur Bezeichnung „Ausländer“ hin verlagert. Diese Ausländer wurden plötzlich als anders und vor allen Dingen nicht-europäisch empfunden wegen ihrer Religion, Lebensgewohnheiten, Sozialstruktur, Ethik, Moral. Ihre Lebensführung war der Gegenentwurf dessen, was sich die deutsche Wohlstandsgesellschaft der Nachkriegszeit ursprünglich vorgestellt hatte. Der türkische Mittelstand der ersten und zweiten Generation ist jedoch in der deutschen Wirtschaftsgesellschaft angekommen, schafft Ausbildungsplätze und hat seine Vertreter in den Ausländerbeiräten der Städte und Gemeinden, in den Landtagen der Bundesländer und im Deutschen Bundestag in Berlin. Türkische Kunstund Kulturschaffende leisten ihren Beitrag zu einem zeitgenössischen
Kulturleben. In diesem Zusammenhang spielt auch der demographische Faktor eine zunehmende Rolle. Nach aktueller Statistik hat jeder fünfte Einwohner Deutschlands einen Migrationsintergrund (in den Ballungszentren häufig schon jeder dritte
Einwohner). Dies bedeutet, dass um 2040 die Einwohner Deutschlands mit Migrationshintergrund die Mehrheitsgesellschaft stellen werden. Die Folgen für die juristische Definition der Staatsangehörigkeit, die Identität durch Sprachzugehörigkeit, der religiöse Pluralismus (z.B. der Bau von Moscheen) und die
124

Identifikation mit einem gelebten und einem tradierten kulturellen Hintergrund werden eine andere Gesellschaft formen. Ob dies auf gesellschaftlicher Ebene in einer Zwischenphase paralleler Entwicklung erfolgen wird oder ob die junge Generation ungeachtet ihrer Herkunft sich von der Welt der „Alten“ lösen wird, kann nur schwer vorhergesagt werden, da erst die kurze Zeitspanne von vierzig Jahren sozialen Zusammenlebens verstrichen ist. Letztendlich werden es aber die jungen Familien gleich welcher Zusammensetzung sein, welche die künftige Gesellschaft Deutschlands gestalten werden.
Zusammenfassung
Nach der deutschen Wiedervereinigung 1989 setzten in Deutschland unter dem Einfluß der Globalisierung vielfältige Prozesse des inneren und äußeren
Wandels ein. Diese werden besonders in den Bereichen der Kultur, des
Generationendiskurses und des Arbeitsmarktes spürbar, da diese Bereiche zunehmend in internationale Entwicklungen eingebunden sind. Durch die
Auswirkung der Migration und auch den Folgen einer veränderten Außenpolitik kann man in zahlreichen Fragen des Alltagslebens und der Lebensbewältigung nicht mehr von einem allgemeinen gesellschaftlichen Konsens sprechen, wie er weitgehend noch in den 80er Jahren vorhanden gewesen ist. Dies betrifft vielfach auch die Fragen der
Integration von Neubürgern aus dem außereuropäischen Bereich und den künftigen Umgang mit der deutschen Sprache. Den auf führendem Weltniveau zu nennenden technischen Leistungen auf den Gebieten der Naturund Ingenieurwissenschaften, des Wasserbaus, der Ökotechnik, der Verkehrsund Transportsysteme, der Medizin und Gesundheitssorge steht auf allgemeiner Bevölkerungsebene ein zunehmender
Diskussionsbedarf hinsichtlich der geistig-kreativen Kulturfähigkeiten gegenüber, welche die Voraussetzung zur kulturellen Teilhabe auf allen Ebenen der Gesellschaft sind.
Ü 10.2 Charakterisieren Sie die Arbeit allgemein. Füllen Sie die Tabelle aus:
Hauptthema (global)
Wissenschaftsbereich
Wie viele Seiten?
Wie viele Teile?
Hauptziel
Transnational orientierte Inhaltsthemen
Hauptideen der Zusammenfassung
Welche Klassifikationen?
Ziel der Bilder
Welche Bilder?
Wie ist die Sprache?
Welche Themen sind international bzw. transnational orientiert?
125

Internationalismen (International gebrauchte Wörter)
Ü 10.3 Lesen Sie die Einleitung. Welche Definitionen (Begriffe) stellt die Autorin vor?
I. Zu den historischen Grundlagen, den Städten und Regionen
-Wie definieren Sie die Begriffe Lebensformen und Kultur?
Ü10.4 Kürzen Sie die Definitionen ab. Wählen Sie das, was Sie als den wichtigsten
Gedanken bezeichnen.
Ü10.5 Sind Sie mit den Definitionen von Dr. Ziethen völlig einverstanden? Haben
Sie andere Ideen und Meinungen?
-Welche historischen Zusammenhänge sind kennzeichnend für die Entwicklung des deutschen Städtewesens?
-Welche Elemente in der Siedlungsgeschichte sind römisch-mediterran und welche sind mitteleuropäisch beeinflusst?
-Vergleichen Sie deutsch und russische Rechtstradition in bezug auf Haus und Hof.
Ü10.6 Lesen Sie den Teil über die Städte und Regionen. Welche Information finden Sie in diesem Teil vom wichtigsten? Warum?
Ü10.7 Was war für Sie in diesem Teil neu?
Ü10.8 Auf welche Ereignisse in der Geschichte weist die Wissenschaftlerin hin? Wozu?
Ü10.9 Lesen Sie den 2. Teil. Welche Begriffe sind für die deutsche Sprache im Bereich „Alltag und Traditionen“ typisch?
Ü10.10 Übersetzen Sie die Wörter:
die Einfriedung, der Hausfrieden, die Öffentlichkeit, das Eigentum, der Besitzer, die
Gegebenheit, das Gesetzbuch, der Schutz, der Hausfriedensbruch, die Aufnahme, die Aufforderung, der Umgang, der Generationenkonflikt, die Folge, der Wandel, die
Gesellschaft, die Kriegsfolgenbewältigung, die Sinnsuche, der
Migrationshintergrund, das Wertebild
Ü 10.11 Charakterisieren Sie den deutschen Alltag und die deutschen Traditionen in 3-5 kurzen Sätzen.
1.) Wie könnte sich ein epochaler Wechsel im Wertesystem der deutschen Gesellschaft abbilden und welche Entwicklungen könnten diesen Wechsel begünstigen?
2.) Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden Sie im Generationendiskurs, wenn Sie die deutsche und russische Gesellschaft vergleichen?
Ü10.12 Was betont Dr. Ziethen in dem Teil „Ausbildung und Berufsleben“?
Ü10.13 Stellen Sie die Logikkette des 3. Teiles zusammen. Beginnen Sie so:
gravierende Änderungen |
die Veränderung der Arbeitsleistung |
die Industrialisierung |
... |
Ü 10.14 Warum spricht die Professorin im dritten Teil über die Freizeitaktivitäten und den Urlaub?
126
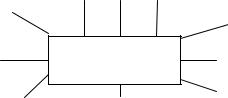
1.) Welche sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen stellt das Leben in der
Kleinfamilie bzw. in der Großfamilie?
2.) Welchen Stellenwert hat die Sorge um die Ausund Fortbildung? 3.) Vergleichen Sie das deutsche und russische Urlaubsverhalten.
Ü 10.15 Sammeln Sie die Hauptgedanken zum Thema „Ökologie“ im Teil 4. Stellen
Sie ein Assoziogramm zusammen.
Natur
Wald
Ökologie
Sonntagsausflug
Ü10.16 Welche Bedeutung hat der Wald in der deutschen Kultur?
Ü10.17 Nennen Sie deutsche Kulturtraditionen, die im Laufe der ökologischen
Geschichtsentwicklung entstanden sind. Systematisieren Sie sie:
Geschichtsentwicklung |
Tradition |
1. Die Bedeutung des Waldes |
Die Sonntagsausflüge in den Wald |
2. Die Erlebnisse im Wald |
Die Kinofilme und die Fantasie- |
|
Literatur |
3. ... |
... |
Ü 10.18 Charakterisieren Sie die wissenschaftliche Erfindung (Entdeckung) von dem Leipziger Arzt Dr. Daniel G.M. Schreber im Bereich „Medizin und Ökologie“. Ist seine Entdeckung noch heute aktuell?
Ü 10.19 Woraus resultieren die ökologische Bewegung und der Umweltschutz? Diese Wörter und Ausdrücke helfen Ihnen:
Kennzeichnend ist ...
Die Protesthaltung gegenüber ...
Das zeigt sich an ...
Das ist im ... präsent.
Die alternative Lebensform ...
Die Bewegung
Die gesellschaftliche Kraft Die Lebensmitteldiskussion Die Klimaforschung
Der Lebensbereich
Ü10.20 Kann ökologisches Bewusstsein die Gesellschaft verändern?
Ü10.21 Lesen Sie den Teil „Migration und interkulturelles Leben“. Wie verändert
sich die deutsche Gesellschaft infolge der Migration?
Ü 10.22 Welche Aufgaben stellen sich der deutschen Gesellschaft durch den Zuzug von Menschen aus außereuropäischen Kulturkreisen?
Ü10.23 Welche Tendenzen des Migrationsprozesses unterstreicht die Autorin?
Ü10.24 Suchen Sie im Internet Berichte zur Migration am Beispiel der Stadt Berlin.
Vergleichen Sie dies mit einer anderen Stadt (z.B. Frankfurt am Main,
Mannheim, Worms). – Hinweis: Die Website vieler Städte gibt unter dem Stichwort Verwaltung, Rathaus, Bürgerservice und ähnlichen Begriffen Informationen.
127
Ü10.25 Vergleichen Sie die Rolle der interkulturellen Kompetenz in Deutschland und Russland. Gebrauchen Sie dabei folgende Ideen:
a.Die interkulturelle Kompetenz bereichert die Menschen, erweitert den
Horizont, erzieht zur Toleranz, eröffnet neue Chancen, hilft beim Verständnis, beseitigt feindliche Gedanken …
b.In Deutschland spielt es eine Rolle, dass…
c.In Russland ist … besonders aktuell.
d.in Deutschland und Russland gibt es die folgenden Probleme: …
e.Man kann diese Probleme mit Hilfe … lösen.
Ü10.26 Welche Ideen will die Professorin zusammenfassen?
Ü10.27 Wie könnten Sie die von Ihnen gelesenen Teile zusammenfassen? Schreiben Sie 3-5 kurze Sätze.
Ü10.28 Welche Schlüsselbegriffe im Text können Sie mit vergleichbaren russischen Schlüsselbegriffen kommentieren?
Die Hilfsidee:
1.Sammeln Sie die deutschen und russischen Schlüsselbegriffe.
2.Vergleichen Sie die Begriffe.
3.Analysieren Sie, ob diese Begriffe verschieden oder identisch sind.
4.Systematisieren Sie die Begriffe in Ihrem Heft und in Ihren Gedanken.
5.Beantworten Sie jetzt die Frage.
Ü 10.29 Informieren Sie sich über die jüngere Geschichte Portugals, Spaniens, Griechenlands, Italiens und der Türkei und stellen Sie einen
Zusammenhang mit den Angaben im Text her. Systematisieren Sie folgende Geschichtsmaterialien.
|
Portugal |
Spanien |
Griechenland |
Italien |
die Türkei |
1. Die Kultur- |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
traditionen |
|
|
|
|
|
sind |
|
|
|
|
|
geschichtlich |
|
|
|
|
|
bestimmt |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3.Die |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
ökologischen |
|
|
|
|
|
Probleme |
|
|
|
|
|
herausgeprägt. |
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
Ü 10.30 Wie ist Deutschland in die internationale Entwicklung eingebunden? Beachten Sie dabei folgende Punkte:
1. Weltwirtschaft
2.Bologna-Prozess
3.Denglisch
4.Ökologische Probleme
5.Migration
Ü10.31 Lesen Sie den Essay „Ein Garten in Deutschland“ von G. Humberg. Wie ist
dieser Text mit dem Thema von G. Ziethen verbunden?
128
Essay
Ein Garten in Deutschland
von Gerhard Humberg, 2010 (Worms/Deutschland)
Der Garten ist im Laufe der Jahre „gewachsen“; es kamen Grundstücksteile hinzu, es fielen aber auch Teile wieder in andere Hände, – so, wie sich das Leben in einem Zeitraum von 48 Jahren, nämlich seit 1962, verändert hat.
Am Beispiel des Gartens und dessen Veränderung spiegelt sich nicht nur die Zeitgeschichte wider, auch die persönlichen Umstände durchlaufen in einem solchen
Zeitraum einen langen Weg. Viele Menschen haben in diesen Jahren den Garten genutzt, oder gepflegt, oder sich darin erholt, mitunter schöne Stunden erlebt …
Der Mai ist jetzt tatsächlich „gekommen“ und wie es im Lied weiter heißt: „Die Bäume schlagen aus!“ Es ist der Wonnemonat, der schönste Monat im Jahr. Die Vögel zwitschern und die jungen Menschen heiraten. In den Gärten entwickeln die Rentner ungeahnte Kräfte; sie mähen und sähen und schneiden und trinken Wein und denken nach.
In unserem Garten blühen zur Zeit noch der Flieder, zwei gelb blühende Sträucher und die Pfingstrosen. Die Tulpen sind verblüht, nur noch die Stengel schauen aus dem Gras. Die Rosen bilden kräftige Knospen und werden bald neue
Farben in den Garten bringen.
Die Kirschbäume stehen jetzt in voller Pracht und man müsste es eigentlich den Japanern gleichtun und ein Kirschblütenfest feiern. Wir sind aber zu nüchtern und freuen uns lieber darüber, die Heizung zurückdrehen zu können.
Die Arbeiten am Gartenhaus sind vorübergehend abgeschlossen. Die Dachentwässerung funktioniert wieder und das Regenwasser läuft wieder in den Froschteich. Zwei Frösche sind schon da; wenigstens diese kann ich sehen. Die Fische wurden ja alle verspeist und müssen demnächst durch neue ersetzt werden.
Die Menschen sind genauso mit dem Garten verbunden, wie die vielen Tiere, die dort ihr Zuhause gefunden haben. Morgens und abends zwitschern die Vögel und sind schon emsig dabei, einen guten Platz für ihr Nest zu finden. Jeder denkt an sich; es ist nicht anders in der Vogelwelt.
Der Igel ist des Nachts schon wieder unterwegs. Zwei große Feldhasen besuchen hin und wieder den Garten und fressen mit Begeisterung die frischen
Triebe der gepflanzten Kastanienbäume ab. Ein Specht klopft wie verrückt am Kirschbaum und hinterlässt große Löcher im Stamm.
Manche der Tiere kommen nur zeitweise, andere haben dort ihren ständigen
Wohnsitz eingenommen, wieder andere besuchen ihn nur zum Lieben und zum
„Jungekriegen“ und ziehen dann weiter. Sehr viele Tiere überfliegen nur den Garten und schauen ´mal vorbei, ob die Fische im Gartenteich groß genug sind, um sie genüsslich frühmorgens, wenn ich noch schlafe, zu verspeisen. – Die Welt ist in Ordnung. Die Welt im Garten ist in Ordnung.
Ü10.32 Drücken Sie Ihre Gedanken zum Text zu folgenden Punkten aus:
1.Auf welche Weise fühlt sich der Autor seinem Garten verbunden?
2.Wie stellen Sie sich diesen Garten vor? Könnte es ein Ziergarten, ein
Nutzgarten oder ein Waldgarten sein?
3.Beschreiben Sie den Kreislauf des Lebens am Beispiel des Gartens.
Ü10.33 Beschreiben Sie einen russischen Garten und vergleichen Sie ihn mit dem Garten im Text.
Ü10.34 Was war in den beiden Beiträgen interessant für Sie? Was hat Ihnen gefallen (nicht gefallen)?
129

Ü10.35 Systematisieren wir die neue Lexik! Welche Wörter und Ausdrücke waren für Sie neu und wichtig?
Ü10.36 Schreiben Sie 20 für Sie neue und aktuelle Wortverbindungen. Bilden Sie Ihr eigenes Satzbeispiel, Ihr neues Satzmodell.
Ü10.37 Reflektieren Sie Ihre Grammatik:
1. Nebensätze (5-7 Beispiele herausfinden |
analysieren |
|
verstehen |
|||
übersetzen) |
|
|
|
|
|
|
2. Erweiterte Attribute (5-7 Beispiele finden |
Hauptwort |
[x] |
und |
|||
erweitertes Attribut [ ] unterstreichen |
3 Variante |
der |
Übersetzung |
|||
machen) |
|
|
|
|
|
|
3. Passiv-Konstruktionen (5-7 Modelle finden |
den Subjekt [--] und das |
|||||
Prädikat [ ] unterstreichen |
die Zeitform des Verbs bestimmen |
|
||||
übersetzen |
in Aktiv-Form transformieren |
Aktiv-Passiv- |
|
|||
Logik kapieren) |
|
|
|
|
|
|
Ü 10.38 Hier finden Sie 3 nächste Texte, die mit der deutschen Kultur und Lebensformen in Deutschland verbunden sind. Wählen Sie einen für Sie interessanten Text und schreiben Sie die Inhaltsangabe. Gebrauchen Sie dabei folgende Wortverbindungen:
Es handelt sich um … Die Hauptidee ist …
Der Autor / die Autorin beschreibt (erzählt von …, unterstreicht, beweist, hebt … hervor) …
Besonders wichtig finde ich … Meiner Meinung nach …
Der Text informiert über … Neu für mich war …
In Deutschland ist … üblich.
Im Vergleich mit russischen Traditionen … Typisch russisch ist …
Einerseits …, andererseits … Besonders hat mir … gefallen
Kultur und Lebensform in Deutschland – das Beispiel Weinbau
Ähnlich wie die Produktion des Bieres aus der Gärung von Gerstenmalz, Hopfen und Wasser nach dem in unserer Zeit noch gültigen Reinheitsgebot des bayrischen Landtages aus dem Jahr 1516 gehört auch der Anbau der Weintraube und die Herstellung des Weines zu den seit der Antike ausgeübten und angesehenen
Berufen in der Lebensmittelherstellung. Noch die mittelalterliche
Domänenwirtschaft des Adels und der Könige benutzte die Handbücher der römischen Autoren zum Landund Weinbau. Archäologische Funde belegen, daß die
Weintraube und Importweine aus dem Mittelmeerraum seit des 2. Jh. v. Chr. über Italien in die Gebiete nördlich der Alpen gebracht wurden. Mit dem Beginn der römischen Präsenz im Mosel-, Rheinund Neckargebiet ab dem Ende des 1. Jhs. v. Chr. und besonders im Laufe des 1. Jhs. n. Chr. wurde der Weinbau, die Keltertechnik
(in Piesport an der Mosel wurden eine römische Kelter und sogar Traubenkerne archäologisch nachgewiesen), die dazugehörigen Speisen und Geschirrformen von der römischen Kultur bestimmt. Der Einfluß der lateinischen Sprache in den Weinanbaugebieten war noch bis in die Zeit um 1000 n. Chr. kulturell prägend und ist in der Fachsprache des deutschen Weinbaus bis heute lebendig; diese romanischen Gebiete unterschieden sich von den germanischsprachigen
130
