
- •Социальная работа и коррекционная педагогика в германии
- •400131. Волгоград, пр. Им. В.И.Ленина. 27. Kapitel I. Soziale arbeit und sozialpädagogik
- •1. Grundlagen sozialer Arbeit
- •1.1. Die Gegenwartsaufgabe sozialer Arbeit
- •1.2. Die Sozialpädagogik als Theorie und Praxis der Kinder-und Jugendhilfe
- •1.3. Lebensweltorientierte soziale Arbeit
- •2. Methoden sozialer Arbeit
- •2.1. Die soziale Einzelhilfe
- •2.2. Die soziale Gruppenarbeit
- •2.3. Die soziale Gemeinwesen2arbeit
- •2.4. Das Unterstützungsmanagement (Case Management)
- •3. Aufgaben und Anregungen
- •Kapitel II. Heil- und sonderpädagogik
- •1. Pädagogik als Wissenschaft
- •. Die Begriffe „Pädagogik" und „Erziehungswissenschaft"
- •1.2. Disziplinen der Pädagogik
- •2. Heil- und Sonderpädagogik
- •2.1 Der Begriff „Heil- bzw. Sonderpädagogik"
- •3. Behinderung als Gegenstand der Heil- bzw. Sonderpädagogik
- •4. Arten von Behinderungen
- •4.1. Was ist eine Körperbehinderung?
- •4.1.1 Paralympics: Die besten körperlich behinderten Sportlerinnen und Sportler der Welt treffen sich an den Olympischen Spiele
- •4.2 Was ist eine Hörbehinderung?
- •4.2.1 Mit den Händen reden
- •4.3 Die Sehbehinderung
- •4.3.1 Louis Braille
- •4.4 Was ist eine geistige Behinderung?
- •4.4.1 Menschen mit Down-Syndrom: Eingliederung in die Gesellschaft
- •Integration ist wichtig für die spätere Entwicklung
- •5. Aufgabenfelder der Behindertenarbeit
- •5.1 Die Anamneseerhebung
- •5.2 Heilpädagogische Diagnostik
- •5.3 Förderung
- •5.3.1 Früherkennung, Frühförderung und Förderschulen
- •5.4 Die Elternarbeit
- •6. Integration - mit behinderten Menschen leben
- •7. Erlebens- und Verhaltensstörungen als Gegenstand der Sonderpädagogik
- •7.1 Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen
- •7.2 Lernstörungen
- •7.3 Behandlung von Erlebens- und Verhaltensstörungen
- •7.3.1 Förder- und Therapiemaßnahmen mit den betroffenen Kindern bzw. Jugendlichen
- •Das psychoanalytische Therapieverfahren
- •3) Gesprächspsychotherapie
- •4) Systemische Therapie
- •5) Gruppentherapie
- •6) Logopädie
- •7) Physikalische Therapien
- •7.3.2 Elternberatung und Elterntraining
- •7.3.3 Schule für Erlebens- und Verhaltensgestörte sowie Heimunterbringung
- •8. Heil und Sonderpädagogik als Profession
- •8.1 Bin ich zum Heil- und Sonderpädagogen berufen?
- •8.2 Was sind Inhalte der Ausbildung zum Heilpädagogen?
- •8.3 Was sind die Inhalte des Studiums zum Heilpädagogen an Universitäten? 3
- •8.4. Wo kann ein Heil- und Sonderpädagoge arbeiten?
7. Erlebens- und Verhaltensstörungen als Gegenstand der Sonderpädagogik
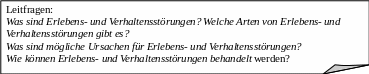
Von einer Erlebens- und Verhaltensstörung1 spricht man, wenn eine Beeinträchtigung vorhanden ist, die nicht auf organische Ursachen zurückzuführen2 ist und besondere pädagogische bzw. psychologische Maßnahmen erforderlich sind. Eine Erlebens- und Verhaltensstörung liegt vor, wenn
eine Beeinträchtigung im Erleben und Verhalten einer Person, in ihrem Lebensvollzug und/oder in ihrer Teilhabe1 am gesellschaftlichen Leben besteht,
diese Beeinträchtigung erheblich ist und
über einen längeren Zeitraum hinweg auftritt,
diese Beeinträchtigung nicht auf organische Ursachen zurückzuführen ist und
besondere pädagogische bzw. psychologische Maßnahmen erforderlich macht, um dem Betroffenen bzw. seiner Umgebung zu helfen.
Nicht jede Ängstlichkeit2 beispielsweise ist eine Erlebens- und Verhaltensstörung. Doch wenn eine Angst - etwa Prüfungsangst - über einen längeren Zeitraum anhält - zum Beispiel während der ganzen Schulzeit -, nicht organisch bedingt ist, die betroffene Person so stark einschränkt, dass sie deshalb an der Schule trotz guter Begabung und Intelligenz scheitert, und die Person sich auch nicht selbst helfen kann, sondern eine therapeutische Hilfe benötigt, so liegt eine Erlebens- und Verhaltensstörung vor.
Erlebens- und Verhaltensstörung bezeichnet eine erhebliche und längerfristige Beeinträchtigung im Erleben und Verhalten einer Person, in ihrem Lebensvollzug und/oder in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die nicht auf organische Ursachen zurückzuführen ist und besondere pädagogische bzw. psychologische Maßnahmen erforderlich macht. |
Auch bei den Erlebens- und Verhaltensstörungen spielt die Normvorstellung3 eine wichtige Rolle. Erlebens- und Verhaltensstörungen können in verschiedenen Bereichen und in unterschiedlicher Intensität auftreten. Diese Bereiche dürfen jedoch nicht unabhängig voneinander betrachtet werden.
7.1 Ursachen von Erlebens- und Verhaltensstörungen
Agende4 Ursachen können eine Erlebens- und Verhaltensstörung bewirken und an ihrer Entstehung beteiligt sein:
vorgeburtliche Faktoren wie Alkohol, Nikotin, Koffein oder Drogen sowie Belastungssituationen und Stress während der Schwangerschaft;
Sehr viele Gifte können den Embryo im Mutterleib schädigen. Alkohol, Kaffe der werdenden Mutter oder Drogenkonsum führen zu Schäden beim Kind. So führt Nikotin zu Schädigungen des Ungeborenen. Selbst eine geringe Menge Nikotin reicht aus, um Wachstum und Gehirnentwicklung nachhaltig und oft unwiederbringlich zu beeinträchtigen. Man hat festgestellt, dass Kinder von Raucherinnen später im Leben besonders häufig zu Lern- und Konzentrationsschwäche, verminderten Intelligenzquotienten und Hyperaktivität neigen.
soziokulturelle/situative Faktoren, d.h. das soziale und gesellschaftliche Umfeld (Familie, Freundeskreis);
ökonomische Faktoren wie schlechte Vermögensverhältnisse der Eltern bzw. des Elternteils, mangelnder Wohnraum, Wohnraumverdichtung, fehlende Kontaktmöglichkeiten im Wohnbezirk;
familiäre Faktoren wie disharmonische Familienatmosphäre, Beziehungsstörungen oder Gewalthandlungen zwischen den Eltern, ungünstige Geschwisterkonstellation wie etwa ständige Benachteiligung gegenüber den anderen Geschwistern;
Fehlformen1 in der Erziehung wie Ablehnung, Vernachlässigung, Überbehütung und Verwöhnung; mangelnde emotionale Zuwendung oder zu starke emotionale Bindung in der Beziehung Eltern(teil) - Kind, indifferente, inkonsequente oder widersprüchliche Erziehungseinstellungen und -maßnahmen, Überforderung2, Übertragung3 unbewusster Wünsche und Einstellungen der Eltern auf das Kind;
individuelle Erlebnisse wie Misshandlungen4 und sexueller Missbrauch5, Trennung der Eltern, Verlust eines Elternteils oder einer Bezugsperson6, schicksalhafte Erlebnisse wie zum Beispiel Unfälle, Erleben vermeintlicher Minderwertigkeit7 wie zum Beispiel Aussehen, Körpergestalt, Geschlecht, Behinderung.
Es ist kaum möglich, dass lediglich eine dieser genannten Ursachen eine Erlebens- und Verhaltensstörung hervorruft1, erst durch das Zusammenspiel mehrerer Ursachen kann es zu einer solchen kommen. Eine Erlebens- und Verhaltensstörung kann auch ein Folgesymptom einer Behinderung sein. Wenn etwa die organischen Ursachen bestimmter Verhaltensweisen nicht erkannt werden und die Umwelt nicht angemessen reagiert, dann kann eine Erlebens- und Verhaltensstörung als Sekundäreffekt eines organischen Defekts auftreten.
